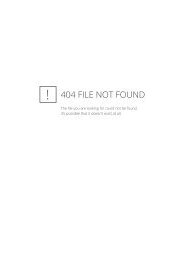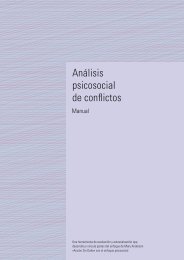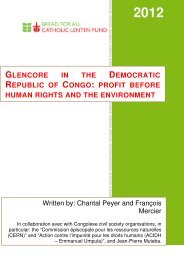Bodenschätze – Fluch oder Segen? - Brot für alle
Bodenschätze – Fluch oder Segen? - Brot für alle
Bodenschätze – Fluch oder Segen? - Brot für alle
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
EinBlick<br />
<strong>Bodenschätze</strong> <strong>–</strong> <strong>Fluch</strong> <strong>oder</strong> <strong>Segen</strong>?<br />
Das Rohstoffgeschäft bringt Reichtum <strong>für</strong> wenige<br />
und Elend <strong>für</strong> viele<br />
2/2010
Inhaltsverzeichnis<br />
Editorial 3<br />
Einführung ins Thema<br />
Rohstoffe <strong>–</strong> <strong>Bodenschätze</strong>, die Armut schaffen 4<strong>–</strong>7<br />
Rohstoffabbau und Menschenrechtsverletzungen gehen oft Hand in Hand 8<strong>–</strong>11<br />
Steuerflucht bringt Milliardenverluste <strong>für</strong> Rohstoffländer 12<strong>–</strong>14<br />
Fallbeispiele<br />
Einleitung<br />
Verschiedene Länder <strong>–</strong> gleiche Probleme 15<br />
Demokratische Republik Kongo<br />
Minenarbeiter/innen wie Tiere behandelt 16<strong>–</strong>18<br />
Peru<br />
Wirtschaftswachstum auf Kosten der indigenen Bevölkerung 19<strong>–</strong>21<br />
Südafrika<br />
Kampf <strong>für</strong> Menschenrechte und bessere Lebensbedingungen 22<strong>–</strong>24<br />
Elektronikindustrie<br />
Von der Mine zum Computer <strong>–</strong> ein undurchsichtiger Weg 25<br />
Fazit und Ausblick<br />
Wege hin zu einer nachhaltigen Ressourcengewinnung 26<strong>–</strong>29<br />
Links und Quellenhinweise 30<br />
Impressum 31<br />
Titelbild<br />
Harte und gefährliche Arbeit <strong>für</strong> wenig Geld: Kleinschürfer/innen in einer Mine im Süden der Demokratischen<br />
Republik Kongo. Dieses Bild stammt aus dem Dokumentarfilm «Katanga Business» (2009) des Belgiers Thierry Michel:<br />
www.katanga-lefilm.com
Editorial<br />
Ein Mobiltelefon benutzen, ein Fahrzeug auftanken<br />
<strong>oder</strong> einen Computer einschalten <strong>–</strong><br />
Tätigkeiten, die oft in Verbindung stehen mit<br />
Ungerechtigkeit, Ausbeutung und der Missachtung<br />
fundamentaler Menschenrechte.<br />
Im Grundsatz kann und soll die Rohstoff-<br />
Förderung dem Menschen dienen. Oft sind<br />
Nutzen und Profit jedoch sehr ungleich verteilt.<br />
Nebst den normalen Nutzniesser/innen<br />
gibt es skrupellose Profiteure und auf der anderen<br />
Seite sehr viele Verlierer/innen. Zu ihnen<br />
gehören vor <strong>alle</strong>m die armen Menschen<br />
in den Entwicklungs- und Schwellenländern.<br />
Mit diesem EinBlick führen wir die Thematik<br />
«Wirtschaft und Menschenrechte» (EinBlick<br />
2009) weiter. Er bietet Ihnen grundlegende<br />
Informationen zur gegenwärtigen Problematik<br />
des Rohstoffabbaus und seiner Wirkung<br />
auf die marginalisierten Bevölkerungsschichten<br />
in den Abbauregionen. Ein Thema, das<br />
bislang in der Öffentlichkeit wenig Beachtung<br />
gefunden hat. Darum haben sich <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong><br />
und Fastenopfer dazu entschlossen, diese Zusammenhänge,<br />
die Rolle der transnationalen<br />
Unternehmen und die Verantwortung der<br />
Konsument/innen zum Thema der ökumenischen<br />
Kampagne 2011 zu machen.<br />
Warum zwei kirchliche Werke sich diesem<br />
wirtschaftspolitischen Thema annehmen?<br />
Antonio Hautle<br />
Direktor, Fastenopfer<br />
Weil es um den Menschen als Geschöpf Gottes<br />
geht, dessen Würde nur zu oft mit Füssen<br />
getreten wird!<br />
Menschen werden durch ungerechte Wirtschaftsstrukturen<br />
und kriminelle Wirtschaftssyndikate<br />
ausgebeutet und ihrer fundamentalen<br />
Rechte beraubt. Regierungen,<br />
Bürokratien, Lokal<strong>für</strong>sten, internationale<br />
Kartelle und Unternehmen unterstützen sie<br />
dabei. Oft sind die Staaten unfähig <strong>oder</strong> unwillig,<br />
griffige und gerechte Gesetze durchzusetzen.<br />
Die internationalen Firmen profitieren<br />
davon <strong>–</strong> und nicht zuletzt auch wir: Wir nutzen<br />
billige Rohstoffe <strong>für</strong> unsere Wirtschaft,<br />
unsere Elektronikgeräte, unsere Industrie.<br />
Dass damit oft Leid, Ungerechtigkeit und Tod<br />
verbunden sind, bleibt uns verborgen.<br />
Für die und mit den Armen sollen und müssen<br />
die Kirchen hinschauen. Die Vaterunser-<br />
Bitten «Dein Reich komme, dein Wille<br />
geschehe» werden so zur konkreten Herausforderung:<br />
Hinschauen, aufklären, Druck auf<br />
Firmen, Handelsregeln, Regierungen erzeugen<br />
<strong>–</strong> und so dem Frieden, der Gerechtigkeit,<br />
den Menschenrechten und der Bewahrung<br />
der Schöpfung dienen.<br />
Wir hoffen, liebe Leserin, lieber Leser, dass<br />
dieser EinBlick auch Sie zum Nachdenken<br />
und zum Handeln anregt.<br />
Beat Dietschy<br />
Zentralsekretär, <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong><br />
3
Einführung ins Thema<br />
Rohstoffe <strong>–</strong> <strong>Bodenschätze</strong>, die Armut<br />
schaffen<br />
Daniel Hostettler, Fachverantwortlicher Menschenrechte, Fastenopfer<br />
Während die internationalen Rohstoffkonzerne Milliardengewinne machen … © Thierry Michel<br />
Trotz der weiterhin steigenden Nachfrage<br />
nach Rohstoffen gehören die ressourcenreichsten<br />
Länder zu den ärmsten und konfliktträchtigsten<br />
Staaten der Welt. Schwache<br />
Regierungen, verbreitete Korruption<br />
und die ungezügelte Macht multinationaler<br />
Unternehmen führen dazu, dass die<br />
Rechte und Ansprüche der Bevölkerung<br />
mit Füssen getreten werden.<br />
Der weltweite Wirtschaftsaufschwung der<br />
letzten zwei Jahrzehnte hat eine enorme<br />
Nachfrage nach <strong>Bodenschätze</strong>n mit sich gebracht.<br />
Aufstrebende Volkswirtschaften wie<br />
China, Indien <strong>oder</strong> Brasilien haben durch<br />
ihren Nachholbedarf an wirtschaftlicher<br />
Entwicklung den weltweiten Bedarf an Rohstoffen<br />
vervielfacht. So stiegen etwa die chinesischen<br />
Rohstoffimporte laut einer Studie<br />
der Deutschen Bank von 1986 bis ins Jahr<br />
4<br />
2006 um das Zwanzigfache an. 1 Die Umsätze<br />
des Rohstoffsektors verzeichneten entsprechende<br />
Zuwachsraten. Gleichzeitig führte<br />
die neoliberale Globalisierung mit ihren<br />
deregulierenden Tendenzen zum Abbau nationaler<br />
Gesetzesschranken. Sowohl Kapital<br />
wie auch Waren fliessen heute weitgehend<br />
ungehindert zwischen Ländern und Märkten<br />
hin und her.<br />
Die kontinuierlich grosse Nachfrage und der<br />
deregulierte Zugang haben in den letzten Jahren<br />
zu einer Preisentwicklung geführt, die den<br />
Rohstoffabbau auch noch in den unzugänglichsten<br />
Gebieten rentabel macht. Eine Folge<br />
davon sind Investitionen in immer fragilere<br />
Umgebungen und Länder mit schwachen<br />
staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen.<br />
Die aktuelle Abwärtsentwicklung der Rohstoffpreise<br />
als Resultat der Finanzkrise wird<br />
nur von kurzer Dauer sein. Sobald das Wachs-
tum in den industrialisierten Ländern und<br />
den Schwellenländern wieder anzieht, werden<br />
auch Rohstoffhunger und -preise wieder anziehen.<br />
Das Rennen nach Ausbeutung von<br />
noch nicht erschlossenen Gebieten wird weitergehen<br />
<strong>–</strong> mit <strong>alle</strong>n problematischen Effekten,<br />
die der beschleunigte Rohstoffabbau <strong>für</strong><br />
die betroffenen Bevölkerungen mit sich<br />
bringt.<br />
Armut trotz Ressourcenreichtum<br />
Einnahmen aus Steuern und Konzessionen<br />
<strong>für</strong> den Rohstoffabbau sind <strong>für</strong> viele Länder<br />
des Südens eine wichtige Einkommensquelle.<br />
In den lateinamerikanischen Ländern etwa<br />
machen die Einnahmen aus der Rohstoffindustrie<br />
durchschnittlich 28 Prozent des<br />
Bruttoinlandprodukts (BIP) aus. In Ländern<br />
wie Bolivien, Kolumbien, Panama und Venezuela<br />
gar bis zu 40 Prozent des BIP. 2 Der Ver-<br />
kauf ihres natürlichen Reichtums und die<br />
ausländischen Investitionen könnten <strong>für</strong> diese<br />
Länder also Ausgangspunkt einer raschen<br />
wirtschaftlichen Entwicklung sein und die<br />
Lebensbedingungen der Menschen markant<br />
verbessern.<br />
Paradoxerweise lebt aber weiterhin ein grosser<br />
Teil der Bevölkerung in vielen dieser Länder<br />
in Armut. So führen in Lateinamerika<br />
durchschnittlich 34,1 Prozent der Menschen<br />
ein Leben unter der Armutsgrenze. In stark<br />
von Rohstoffexporten abhängigen Ländern<br />
sind es zwischen 30 Prozent (Venezuela) und<br />
64 Prozent (Bolivien). 3 Diese Zahlen verdeutlichen,<br />
dass die Einnahmen aus den Rohstoffexporten<br />
offensichtlich nicht der breiten<br />
Bevölkerung zugute kommen. Vielmehr verstärkt<br />
der Rohstoffreichtum die Unterentwicklung<br />
eines Landes weiter. Laut der internationalen<br />
Nichtregierungsorganisation<br />
«Revenue Watch» leben zwei Drittel der<br />
… verdienen Kleinschürfer/innen, die auf eigenes Risiko nach Rohstoffen graben und an Zwischenhändler<br />
verkaufen, wenige Dollar am Tag. © Thierry Michel<br />
5
ärmsten Menschen in rohstoffreichen Ländern.<br />
4 Dies hat verschiedene Gründe:<br />
Einseitige Machtverteilung<br />
Viele Staaten des Südens verfügen nicht über<br />
den Willen und die Mittel, die Tätigkeiten<br />
transnationaler Konzerne effektiv zu regulieren<br />
und zu überwachen. Schwache Regierungsführung<br />
und mangelnde Rechtsstaatlichkeit,<br />
ungenügende Vollzugsorgane und<br />
Korruption sind Gründe da<strong>für</strong>, dass sich die<br />
Unternehmen oft in der stärkeren Verhandlungsposition<br />
befinden als die Regierungen<br />
der Rohstoffländer. Sowohl bei der Festlegung<br />
von Abbaurechten wie auch bei der<br />
effektiven Rohstoffgewinnung diktieren die<br />
Konzerne weitgehend die Konditionen.<br />
Hinzu kommt, dass viele Regierungen dringend<br />
auf externe Investitionen angewiesen<br />
sind. Die Preisentwicklung auf dem Rohstoffmarkt<br />
ermöglicht es ihnen, mit relativ geringem<br />
Aufwand an Kapital zu kommen und von<br />
Krediten unabhängiger zu werden. Auf die<br />
grosse Nachfrage reagieren sie deshalb mit<br />
einer Politik, die den Unternehmen sehr entgegenkommt.<br />
Mit dem Resultat, dass zwar Investitionen<br />
in die Länder fliessen, die Abgaben<br />
und Steuern der Unternehmen aber oft nur<br />
einen Bruchteil des Werts der ausgeführten<br />
Rohstoffe ausmachen (vgl. Seiten 12<strong>–</strong>14). Mit<br />
ihrer unternehmensfreundlichen Politik reduzieren<br />
die Staaten jedoch ihre Möglichkeiten,<br />
in entwicklungsrelevante Sektoren der Gesellschaft<br />
umfassend investieren zu können.<br />
Undurchsichtige Finanzflüsse<br />
Häufig sind es Zivilgesellschaft und Medien,<br />
die bei ungenügender Regierungsführung und<br />
fehlender Rechtsstaatlichkeit die Aufgabe<br />
6<br />
übernehmen, zusammen mit den betroffenen<br />
Gemeinden auf Mängel und Missbräuche im<br />
Bereich der Rohstoffindustrien hinzuweisen.<br />
Dies ist nicht einfach, da ihnen bezüglich<br />
Steuern und Konzessionsabgaben der Unternehmen<br />
oft die grundlegendsten Informationen<br />
fehlen. Entsprechende Daten werden von<br />
den Regierungen kaum freiwillig der Öffentlichkeit<br />
zugänglich gemacht. Für die Unternehmen<br />
besteht wiederum keinerlei Pflicht<br />
auszuweisen, was sie in welchem Land jeweils<br />
investiert, bezahlt und eingenommen haben.<br />
Informiert der Staat nicht transparent, hat die<br />
Bevölkerung also keine Möglichkeit in Erfahrung<br />
zu bringen, welche Gelder geflossen und<br />
ob diese vertragskonform sind (vgl. Seiten<br />
12<strong>–</strong>14).<br />
Menschenrechtsverletzungen alltäglich<br />
Es lässt sich nachweisen, dass Staaten mit<br />
schwachen Regierungen, einer hohen Armutsquote<br />
und einer Konflikt beladenen Geschichte<br />
überproportional von Missbräuchen<br />
durch Konzerne betroffen sind. Gerade in<br />
Ländern, wo gewalttätige Übergriffe zum<br />
Definition<br />
In diesem EinBlick wird der Begriff Rohstoffsektor/Rohstoffindustrien<br />
analog zum<br />
englischen Begriff «Extractive Industries»<br />
verwendet. Damit werden Unternehmen<br />
bezeichnet, die nicht erneuerbare Ressourcen<br />
(Erdöl und Erdgas, Mineralien und<br />
Met<strong>alle</strong>) erkunden und/<strong>oder</strong> deren Ausbeutung<br />
planen und durchführen. Nicht<br />
unter diese Bezeichnung f<strong>alle</strong>n Unternehmen,<br />
welche erneuerbare Ressourcen<br />
(Elektrizität, Sonnenkraft) fördern <strong>oder</strong><br />
die Rohstoffe weiterverarbeiten.
Düstere Aussichten: Minenarbeiter in der Kipushi Mine in Katanga, DR Kongo. © Patricio Frei, Fastenopfer<br />
Alltag gehören und der Staat selber Konfliktpartei<br />
ist, operieren transnationale Konzerne<br />
in rechtlichen Graubereichen und beeinflussen<br />
unausweichlich die Konfliktsituation mit<br />
ihren Interventionen. Die Missbräuche reichen<br />
von missachteten Landrechten bei Vertreibungen<br />
von Gemeinden <strong>oder</strong> ungenügender<br />
Abgeltung bis hin zu Trinkwasser- <strong>oder</strong><br />
Luftverschmutzungen als Nebeneffekt des<br />
Rohstoffabbaus (vgl. Seiten 8<strong>–</strong>11).<br />
Rohstoffabbau bringt arme Gemeinden in<br />
Entwicklungsländern in einen direkten Interessenskonflikt<br />
mit Konzernen, die zu den<br />
mächtigsten der Welt zählen. Ihnen gegenüber<br />
ihre Stimmen hörbar zu machen, ist angesichts<br />
der PR-Mittel, über welche die grossen<br />
Konzerne verfügen, sehr schwierig.<br />
Ausserdem schützen Staaten viel öfter die Interessen<br />
der Konzerne als diejenigen ihrer<br />
Bürger/innen <strong>–</strong> vor <strong>alle</strong>m wenn diese arm<br />
sind, in abgelegenen Gebieten wohnen und<br />
Minderheiten angehören.<br />
Menschen und Organisationen, die sich <strong>für</strong><br />
die Rechte der betroffenen Bevölkerung einsetzen,<br />
werden nicht selten selber zur Zielscheibe<br />
von Rufmordkampagnen, Bedrohungen<br />
und physischen Übergriffen. Viele werden<br />
aufgrund ihres Engagements gar durch staatliche<br />
<strong>oder</strong> parastaatliche Kräfte ermordet.<br />
Oft geht der Repression eine Diffamierung<br />
des Widerstands der betroffenen Bevölkerung<br />
voran, der soziale Protest wird kriminalisiert.<br />
Die Menschenrechte der Betroffenen bleiben<br />
auf der Strecke, während sich die Regierungen<br />
und die Unternehmen auf einen rechtlichen<br />
Rahmen berufen können, der auf die<br />
Bedürfnisse der unternehmerischen Profitmaximierung<br />
zugeschnitten worden ist. Die Unternehmen<br />
florieren, die Regierungen weisen<br />
Wachstumsraten vor, während die Kosten auf<br />
die Schwächsten abgewälzt werden.<br />
7
Rohstoffabbau und Menschenrechtsverletzungen<br />
gehen oft Hand in Hand<br />
Ester Wolf, Verantwortliche <strong>für</strong> das Dossier Recht auf Nahrung, <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong><br />
Ein Wandgemälde im Dorf einer indigenen Gemeinschaft ausserhalb von Guatemala City fordert den Rückzug<br />
internationaler Minenkonzerne. © Ulises Rodriguez / Keystone<br />
Die Übernahme immenser Landflächen,<br />
grossräumige Abholzungen und die Vergiftung<br />
von Böden und Grundwasser zerstören<br />
bei vielen Minenprojekten die Umwelt<br />
und die Lebensgrundlage der lokalen, oftmals<br />
indigenen Bevölkerung. Der Kampf gegen<br />
zahlreiche Menschenrechtsverletzungen<br />
und <strong>für</strong> grundlegende Rechte ist jedoch<br />
schwierig und teilweise lebensgefährlich.<br />
«Sie haben uns gesagt, dass nichts Schlechtes<br />
passieren wird. Das einzige, was komme, sei<br />
Entwicklungsfortschritt. Heute sind sich die<br />
Menschen hier bewusst, dass genau das Ge-<br />
8<br />
genteil wahr ist.» Delfino Tema, Bürgermeister<br />
der Gemeinde Sipacapa weiss, wovon er<br />
spricht. Seit «Montana Explorada», eine<br />
Tochterfirma der kanadischen «Goldcorp<br />
Inc.», im westlichen Hochland von Guatemala<br />
die Marlin Mine betreibt und dort jährlich<br />
2,5 Millionen Unzen Gold abbaut, hat sich<br />
das Leben der Gemeinden im Departement<br />
San Marcos drastisch verändert.<br />
Krankheiten und Wassermangel<br />
Lebte die indigene Bevölkerung hier einst am<br />
Fusse bewaldeter Berge mit einer vielfältigen
Flora und Fauna, bestimmen heute hässliche<br />
Kraterlandschaften, gerodete Waldstriche,<br />
ausgetrocknete und verseuchte Gewässer<br />
und der tägliche Lärm der Minenaktivitäten<br />
und Lastwagen die Umgebung und das Leben<br />
der Menschen. «Seit die Mine hier ist,<br />
leiden immer mehr Kinder an Husten, Herpes<br />
und Kopfweh», erzählt der Bauer Moises<br />
Bamaca.<br />
Grund da<strong>für</strong> ist die Verschmutzung der Gewässer<br />
mit Schwermet<strong>alle</strong>n, wie die Untersuchung<br />
der Kirchlichen Kommission <strong>für</strong> Frieden<br />
und Umwelt in einer Studie belegen<br />
konnte. 5 Diese hat auch bestätigt, dass viele<br />
Häuser der Anwohner/innen durch die Beben<br />
beschädigt wurden. Das Unternehmen selbst<br />
gibt an, dass die Mine 45 000 Liter Wasser<br />
pro Minute verbraucht. Dieser enorme Wasserverbrauch<br />
hat zur Austrocknung von Gewässern<br />
und akutem Wassermangel geführt.<br />
Grundlegende Rechte missachtet<br />
Die Situation der Marlin Mine ist kein Einzelfall.<br />
Zahlreiche Experten/innen bestätigen,<br />
dass kein Industriezweig eine solch zerstörerische<br />
Auswirkung auf die Umwelt und<br />
das soziale und kulturelle Gefüge hat wie Minen<br />
im Tagbau.<br />
So werden etwa beim Abbau von Gold grosse<br />
Flächen Land abgetragen und mit flüssigem<br />
Zyanid gefüllt, um das Gold aus dem Boden<br />
zu lösen. Der Boden bleibt auf viele Jahre vergiftet<br />
und <strong>für</strong> die Landwirtschaft unbrauchbar.<br />
Weitere Folgen des Tagbaus sind die Vergiftung<br />
von Wasserquellen, die Abholzung<br />
von Wäldern und damit verbundene negative<br />
Auswirkungen auf die Lebensgrundlage der<br />
Bevölkerung, Umwelt und Klima. Damit verletzen<br />
die Minenaktivitäten grundlegende<br />
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Men-<br />
schenrechte wie etwa das Recht auf Nahrung,<br />
Wasser, Unterkunft <strong>oder</strong> Gesundheit. 6<br />
Oft ist die lokale Bevölkerung auch direkt<br />
von Vertreibungen <strong>oder</strong> Zwangsumsiedlungen<br />
und der Zerstörung ihrer Felder und<br />
Häuser betroffen. Geltende Landrechte werden<br />
in vielen Fällen ignoriert. Angemessene<br />
Entschädigungen gibt es selten und wenn,<br />
dann bieten diese den Betroffenen kaum langfristige<br />
Perspektiven, um ihren Lebensunterhalt<br />
zu bestreiten. Gleichzeitig schaffen die<br />
Minen nur wenige Arbeitsplätze.<br />
Betroffene übergangen<br />
Auch die zivilen und politischen Rechte wie<br />
das Recht auf Leben, auf Freiheit und Sicherheit<br />
sowie die Versammlungs- und Meinungsfreiheit<br />
werden häufig verletzt. Friedliche<br />
Proteste gegen Aktivitäten in Minen werden<br />
immer wieder gewaltsam niedergeschlagen.<br />
Morde, willkürliche Festnahmen und Drohungen<br />
durch Militär, Polizei und privates<br />
Sicherheitspersonal der Minen gehen dabei<br />
Hand in Hand mit der Kriminalisierung der<br />
Opfer und derjenigen, die sich <strong>für</strong> ihre Rechte<br />
einsetzen. Besonders oft missachtet werden<br />
auch die in verschiedenen internationalen<br />
Konvention 169 der Internationalen<br />
Arbeitsorganisation (ILO)<br />
Die Konvention 169 der ILO ist ein völkerrechtlich<br />
verbindliches Instrument zur<br />
Durchsetzung der Rechte indigener Völker.<br />
Ein wichtiger Punkt ist die Anerkennung<br />
der Landrechte (Artikel 14) und die<br />
Verpflichtung der Staaten, die indigene<br />
Bevölkerung bei Projekten, die sie direkt<br />
betreffen, zu konsultieren (Artikel 6.1a).<br />
www.ilo169.de<br />
9
Verträgen festgelegten spezifischen Rechte<br />
der indigenen Bevölkerung (siehe Kasten).<br />
Viele dieser Rechte sind nicht nur in internationalen<br />
Pakten, Erklärungen und Konventionen<br />
festgeschrieben, sondern auch in den<br />
nationalen Verfassungen verankert. Meist<br />
mangelt es jedoch an deren Umsetzung und<br />
am Zugang der betroffenen Menschen zu<br />
rechtlichen Mitteln <strong>für</strong> ihre Verteidigung.<br />
Staaten tragen Verantwortung<br />
Hauptverantwortlich <strong>für</strong> die Menschenrechtsverletzungen<br />
sind die Regierungen, die<br />
die Konzessionen <strong>für</strong> die Minen vergeben.<br />
Doch auch die Unternehmen sind völkerrechtlich<br />
dazu verpflichtet, die Menschenrechte<br />
zu achten. 7 «Goldcorp Inc.» liess immerhin<br />
eine Studie zu den Auswirkungen der<br />
Aktivitäten in den Minen auf die Menschenrechte<br />
durchführen. Diese Studie vom Mai<br />
2010 zeigt zahlreiche Menschenrechtsverletzungen<br />
durch das Unternehmen auf und empfiehlt<br />
dem Konzern, von einem reaktiven zu<br />
einem proaktiven Ansatz überzugehen. 8<br />
Weltweiter Druck nötig<br />
Bereits im Jahr 2005 kritisierte der damalige<br />
Uno-Sonderberichterstatter Jean Ziegler bei<br />
Die umstrittene Marlin Mine. © COPAE<br />
10<br />
Protestaktion der indigenen Gemeinschaft. © COPAE<br />
seiner Untersuchungsreise in Guatemala, dass<br />
die Regierung die Lizenz <strong>für</strong> die Marlin Mine<br />
vergeben habe, ohne die betroffene indigene<br />
Bevölkerung ausreichend in die Verhandlungen<br />
einzubeziehen. Hierzu ist Guatemala<br />
jedoch gemäss der von der Regierung unterzeichneten<br />
Konvention 169 der Internationalen<br />
Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen<br />
(ILO) verpflichtet (siehe Kasten Seite 9).<br />
Auch das <strong>für</strong> die Umsetzung der Konvention<br />
zuständige ILO-Expert/innenkomitee sowie<br />
der Uno-Sonderberichterstatter <strong>für</strong> die Rechte<br />
der indigenen Bevölkerung kritisierten die<br />
mangelnde Konsultation und die fehlende<br />
Dialogbereitschaft gegenüber der Bevölkerung.<br />
Im Mai 2010 forderte die Interamerikanische<br />
Kommission <strong>für</strong> Menschenrechte (CIDH) den<br />
guatemaltekischen Staat schliesslich auf, die<br />
Aktivitäten der Marlin Mine in Guatemala zu<br />
suspendieren und konkrete Massnahmen<br />
zum Schutz der indigenen Bevölkerung zu ergreifen.<br />
Prominente Unterstützung bekam die<br />
Kommission von der Friedensnobelpreisträgerin<br />
Rigoberta Menchú, Bischof Ramazzini<br />
sowie zahlreichen lateinamerikanischen Regierungen<br />
und Menschenrechtsorganisationen<br />
aus <strong>alle</strong>r Welt.
Auch Unternehmen müssen Menschenrechte respektieren<br />
John Ruggie, Uno-Sonderbeauftragter <strong>für</strong> Wirtschaft und Menschenrechte, hat im Jahr<br />
2008 gegenüber dem Uno-Menschenrechtsrat festgehalten, dass auch Unternehmen <strong>für</strong> die<br />
Respektierung der Menschenrechte verantwortlich sind. Die Verpflichtung des Menschenrechtsschutzes<br />
obliege zwar den Staaten. Unternehmen werden aber angehalten, bei ihren<br />
Aktivitäten mit nötiger Sorgfalt (due diligence) vorzugehen, um keine Menschenrechtsverletzungen<br />
zu begehen <strong>oder</strong> mitzuverschulden. Ruggie empfiehlt den Unternehmen eine<br />
genaue Untersuchung des Kontextes und eine vorgängige Risikoanalyse bezüglich der Rechte<br />
der betroffenen Bevölkerung. Weiter sollen die Unternehmen die Wirkung ihrer Tätigkeiten<br />
auf die Menschenrechte fortlaufend überprüfen und darüber Bericht erstatten.<br />
Zwar verfügen heute <strong>alle</strong> grossen internationalen Konzerne über Richtlinien, die ein verantwortungsbewusstes<br />
Handeln festschreiben. Sie dienen aber eher der Öffentlichkeitsarbeit<br />
als der konkreten Umsetzung.<br />
Nichtregierungsorganisationen wie <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> und Fastenopfer kritisieren zudem, dass<br />
der Ansatz von Ruggie auf einem freiwilligen Engagement der Unternehmen beruht.<br />
Angesichts weltweiter Vergehen von Unternehmen und deren gravierenden sozialen und<br />
ökologischen Konsequenzen greift das Prinzip der Freiwilligkeit zu wenig. Um effektive<br />
Verhaltensänderungen zu erwirken, braucht es verbindliche internationale Rechtsnormen,<br />
mit denen die Unternehmensverantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können.*<br />
www.business-humanrights.org<br />
* EinBlick 1/2009, Wirtschaft und Menschenrechte. Der lange Prozess um die menschenrechtliche Verpflichtung<br />
von international tätigen Unternehmen.<br />
Die breite Unterstützung hatte Erfolg: Ende<br />
Juni 2010 kündigte die unter Druck geratene<br />
Regierung die Suspendierung der Mine an.<br />
Drohungen bleiben<br />
Für die betroffenen Gemeinden ist dieser Entscheid<br />
ein Meilenstein. Die Lage hat sich bis<br />
anhin jedoch <strong>alle</strong>s andere als normalisiert:<br />
«Es wurde uns damit gedroht, dass die Verteidigung<br />
unserer Rechte Folgen haben wird»,<br />
sagt Javier de León, Präsident der «Asociación<br />
de Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahaucan»<br />
(ADSIMI), der deshalb weiterhin auf<br />
die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft<br />
hofft. Unbegründet ist die Besorg-<br />
nis von Javier de León nicht: Am 7. Juni 2010<br />
wurde die Aktivistin Diodora Hernández<br />
durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt<br />
<strong>–</strong> nachdem sie zuvor mehrmals aufgrund<br />
ihres Engagements gegen die Marlin Mine<br />
bedroht worden war. Die Polizei lässt sich mit<br />
der Aufnahme der Ermittlungen Zeit.<br />
11
Steuerflucht bringt Rohstoffländern<br />
Milliardenverluste<br />
Markus Brun, Leiter Entwicklungspolitik, Fastenopfer<br />
Trotz steigender Weltmarktpreise <strong>für</strong> Rohstoffe<br />
verlieren die Rohstoffländer im Süden<br />
jährlich Steuereinnahmen in Milliardenhöhe.<br />
Grund da<strong>für</strong> sind Steuerflucht<br />
und schädliche Steuerpraktiken der internationalen<br />
Rohstoffunternehmen. Länder<br />
wie die Schweiz fördern diese Missstände,<br />
indem sie solche Praktiken tolerieren.<br />
Auf mindestens 50 Milliarden US-Dollar<br />
schätzt das renommierte britische Hilfswerk<br />
«Oxfam» die Verluste, die Entwicklungsländer<br />
jährlich durch Steuerflucht, internationalen<br />
Steuerwettbewerb und schädliche Steuerpraktiken<br />
erleiden. Das entspricht deutlich<br />
mehr als der Hälfte des Betrags, den <strong>alle</strong><br />
Industrieländer zusammen pro Jahr <strong>für</strong> öffentliche<br />
Entwicklungszusammenarbeit ausgeben.<br />
Besonders transnationale Unternehmen<br />
verfügen über eine ganze Palette von<br />
Strategien, die es ihnen erlauben, Steuern zu<br />
sparen. Den Entwicklungsländern entgehen<br />
dadurch substanzielle Finanzmittel, die sie<br />
<strong>für</strong> Investitionen in die lokale Entwicklung<br />
dringend benötigen würden.<br />
Steuererlasse <strong>für</strong> Minenunternehmen<br />
In den Jahren zwischen 2003 und 2008 stiegen<br />
die Preise <strong>für</strong> viele Rohstoffe weltweit<br />
stetig an. Trotzdem erhöhten sich die Staatseinnahmen<br />
in den Rohstoff exportierenden<br />
Ländern nicht. Eine Studie der afrikanischen<br />
Sektion des globalen Netzwerkes <strong>für</strong> Steuergerechtigkeit<br />
«Tax Justice Network», dem<br />
auch Fastenopfer und <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> angehö-<br />
12<br />
ren, analysierte die Ursachen <strong>für</strong> die sinkenden<br />
Steuereinnahmen. Dabei wurde deutlich,<br />
dass die Regierungen den Minenkompanien<br />
enorme Steuererleichterungen und Abgabenerlasse<br />
gewährt hatten <strong>–</strong> unter anderem in der<br />
von der Weltbank genährten Hoffnung, sich<br />
im Steuerwettbewerb eine bessere Ausgangslage<br />
<strong>für</strong> die eigenen Standorte zu sichern.<br />
Viele Verträge mit Minenunternehmen sind<br />
geheim und die Besitzverhältnisse oft schwer<br />
durchschaubar, denn meist gehören sie Unterfirmen<br />
von transnationalen Konzernen. Die<br />
Rechnungslegungsstandards sind so wenig<br />
harmonisiert, dass bei «kreativen» Buchhaltungspraktiken<br />
verschiedenste Möglichkeiten<br />
bestehen, um etwa Gewinne als Verluste auszuweisen<br />
und so Steuern zu sparen.<br />
Verluste im Kongo <strong>–</strong> Gewinne in der<br />
Schweiz<br />
Im Jahr 1980 machte der Minensektor in der<br />
Demokratischen Republik Kongo 25 Prozent<br />
der Steuereinnahmen und des Bruttoinlandprodukts<br />
(BIP) aus. Fünfundzwanzig Jahre<br />
später lieferte der Minensektor gerade noch<br />
27 Millionen US-Dollar an die Staatskasse,<br />
was 2,4 Prozent der Gesamtsteuereinnahmen<br />
entspricht. Der Anteil am BIP ist gar um den<br />
Faktor 100 geschrumpft. 9 Gründe <strong>für</strong> den<br />
drastischen Einnahmenrückgang gibt es viele:<br />
die Kleptokratie des Diktators Mobutu Sese<br />
Seko, die instabile politische Situation nach<br />
seinem Wegputsch im Jahr 1997, die Kriegsökonomie<br />
im Osten des Landes, die weit verbreitete<br />
Korruption, die marode Infrastruk-
tur, die Volatilität der Rohstoffpreise auf dem<br />
Weltmarkt und andere.<br />
Nicht zu unterschätzen sind aber auch die Intransparenz<br />
im Rohstoff- und Minensektor<br />
im Allgemeinen und die Steuervermeidungspraktiken<br />
transnationaler Konzerne im Besonderen.<br />
Traurige Berühmtheit erlangte der<br />
Steuerbetrugsskandal des in der Schweiz ansässigen<br />
Holzgrosshandelsunternehmens<br />
«Danzer». «Greenpeace» 10 zeigte im Jahr<br />
2008 in einer detaillierten Studie auf, wie<br />
«Danzer» und dessen Tochterunternehmen<br />
«Siforco» und «IFO» im Kongo grosse Verluste,<br />
in der Schweiz jedoch hohe Gewinne<br />
auswiesen. Gemäss «Greenpeace» verloren<br />
die beiden kongolesischen Staaten <strong>alle</strong>in<br />
durch «Danzers» Steuervermeidungspraktiken<br />
beinahe acht Millionen Euro. Diese Sum-<br />
me entspricht den Kosten von Impfungen <strong>für</strong><br />
700 000 kongolesische Kinder <strong>oder</strong> fünfzig<br />
Mal dem Gesamtbudget des Umweltministeriums<br />
der Demokratischen Republik Kongo.<br />
Interne Verrechnungspraktiken<br />
Nach Schätzungen der Organisation <strong>für</strong> wirtschaftliche<br />
Zusammenarbeit und Entwicklung<br />
(OECD) werden inzwischen 60 Prozent<br />
des Welthandels konzernintern abgewickelt.<br />
Bei diesen internen Handelsaktivitäten von<br />
Waren, Rohstoffen und Lebensmitteln, aber<br />
auch von Dienstleistungen, können Mutterkonzerne<br />
und Tochterunternehmen Verrechnungspreise<br />
untereinander manipulieren. Gemäss<br />
Gesetzesvorschriften müssten solche<br />
Geschäfte unter marktüblichen Preisen abge-<br />
Trotz riesiger Gewinne wies das Schweizer Holzhandelsunternehmen «Danzer» im Abbauland Kongo grosse<br />
Verluste aus. © Markus Mauthe / Greenpeace / Keystone<br />
13
wickelt werden <strong>–</strong> dies entspricht jedoch nicht<br />
der gängigen Praxis.<br />
Schweiz leistet Beihilfe<br />
Diese verbreitete Tatsache führt dazu, dass<br />
reiche Industriestaaten wie die Schweiz auf<br />
der einen Seite Hilfe leisten in Form von Zahlungen<br />
<strong>für</strong> die Entwicklungszusammenarbeit.<br />
Auf der anderen Seite tolerieren sie jedoch,<br />
dass bei ihnen ansässige Konzerne den Ländern<br />
des Südens dringend notwendige entwicklungsrelevante<br />
Steuergelder entziehen.<br />
Die Schweiz toleriert schädliche Steuerpraktiken.<br />
© Rebecca Blackwell / Keystone<br />
Solchen Machenschaften gilt es vehement entgegenzutreten,<br />
zum Beispiel indem transnationale<br />
Konzerne zu mehr Transparenz<br />
gezwungen werden. Dazu müssten sie ihre<br />
Rechnungslegung nach Ländern (das so genannte<br />
«Country by Country Reporting» 11 )<br />
lückenlos offen legen. Sie müssten dabei angeben,<br />
in welchen Ländern sie und ihre Tochterfirmen<br />
tätig sind, unter welchen Namen sie<br />
dort auftreten und welche Finanzergebnisse<br />
sie in den jeweiligen Ländern erzielt haben.<br />
Auch die an die Behörden bezahlten Steuern<br />
am jeweiligen Standort, die Gehaltskosten<br />
und die Anzahl der Mitarbeitenden müssten<br />
aufgeführt werden. Solche Vorschriften kön-<br />
14<br />
nen national (auch in der Schweiz) und international<br />
eingeführt werden. Dazu braucht es<br />
aber den politischen Willen der Industrieund<br />
Schwellenländer.<br />
Tansania <strong>–</strong> <strong>Bodenschätze</strong> machen nur<br />
ausländische Firmen reich<br />
Tansania ist mit einem geschätzten Goldvermögen<br />
von 39 Milliarden US-Dollar<br />
Afrikas drittgrösster Goldproduzent. Von<br />
diesem <strong>Segen</strong> profitiert die einfache Bevölkerung<br />
jedoch wenig. Grosszügige Steuererlasse<br />
und geschickte Steuervermeidungspraktiken<br />
haben dem Staat (konservativ<br />
geschätzt) zwischen den Jahren 1997 und<br />
2005 Steuereinbussen von über 265 Millionen<br />
US-Dollar beschert.<br />
Dem Parlament wurde im Jahr 2007 ein<br />
Bericht vorgelegt, der bestätigt, dass der<br />
Minensektor in derselben Periode einen<br />
Gesamtverlust von über einer Milliarde<br />
US- Dollar ausgewiesen habe <strong>–</strong> und das bei<br />
steigenden Rohstoffpreisen.<br />
Vertreter/innen des Minensektors rechtfertigen<br />
sich immer wieder damit, neue Arbeitsplätze<br />
geschaffen und die Lebensumstände<br />
der Menschen im Umfeld der<br />
Minen verbessert zu haben. In Wahrheit<br />
verloren über 400 000 im Kleinstabbau<br />
schürfende Personen ihre Existenzgrundlage,<br />
während die grossen Minenunternehmen<br />
von 1990 bis 2000 nur gerade 10000<br />
neue Arbeitsplätze schufen. 10 Prozent der<br />
Stellen sind von nicht afrikanischen Ausländern<br />
besetzt, denen Tansania grosszügige<br />
Steuererlasse gewährt. 12
Fallbeispiele<br />
Verschiedene Länder <strong>–</strong> gleiche Probleme<br />
Daniel Hostettler, Fachverantwortlicher Menschenrechte, Fastenopfer<br />
Fehlende Mitsprache der betroffenen Bevölkerung,<br />
Menschenrechtsverletzungen<br />
und eine Politik im Interesse des Kapitals<br />
sind feste Konstanten beim Rohstoffabbau,<br />
wie folgende Fallbeispiele illustrieren.<br />
<strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> und Fastenopfer unterstützen<br />
Gemeinden dabei, sich zu organisieren und<br />
sich gegen ihre Ausbeutung zu wehren.<br />
Rohstoffprojekte variieren in ihrer Planung<br />
und Durchführung teilweise erheblich <strong>–</strong> abhängig<br />
vom Rohstoff, dem Investitionsvolumen,<br />
den geologischen Gegebenheiten <strong>oder</strong><br />
den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.<br />
Es gibt aber auch Phänomene, die bei <strong>alle</strong>n<br />
Projekten zu beobachten sind. So werden<br />
etwa die Rechte der betroffenen lokalen Gemeinschaften<br />
systematisch dem Profitstreben<br />
der Unternehmen untergeordnet. Die folgenden<br />
Fallbeispiele aus der Demokratischen<br />
Republik Kongo, aus Südafrika und Peru zeigen<br />
auf, dass die Bevölkerungen kaum jemals<br />
in die Planungs- und Entscheidungsprozesse<br />
der Rohstoffunternehmen einbezogen werden,<br />
obwohl ihre Mitsprache im internationalen<br />
Recht festgeschrieben ist. Auch die<br />
Staaten verletzen ihre völkerrechtlich verbindlichen<br />
Schutzpflichten, indem sie nicht<br />
Willens <strong>oder</strong> fähig sind, sich <strong>für</strong> die Interessen<br />
der Bevölkerung einzusetzen.<br />
Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht,<br />
dass stets die vom Rohstoffabbau betroffene<br />
Bevölkerung die sozialen Kosten zu tragen<br />
hat. Meist befindet sie sich in einer schwachen<br />
Trostloses Leben im Umfeld einer Mine in Indien.<br />
© Amnesty International<br />
und verletzlichen Position und ist auf sich selber<br />
angewiesen. Fastenopfer und <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong><br />
arbeiten in verschiedenen Ländern mit Betroffenen<br />
zusammen und unterstützen sie<br />
dabei, sich zu organisieren, an Informationen<br />
zu gelangen, sich zu wehren und Lösungen<br />
<strong>für</strong> die grossen Herausforderungen zu finden.<br />
Ziel ist es, den verletzlichen Gruppen gegenüber<br />
den ungleich mächtigeren Akteuren zu<br />
einer besseren Verhandlungsposition zu verhelfen.<br />
Damit werden der Rohstoffabbau und<br />
viele der damit verbundenen Konsequenzen<br />
zwar nicht verunmöglicht, doch die Chance<br />
wächst, dass die Bedürfnisse der Betroffenen<br />
stärker berücksichtigt werden.<br />
15
Demokratische Republik Kongo<br />
Minenarbeiter/innen wie Tiere behandelt<br />
Patricio Frei, Verantwortlicher Öffentlichkeitsarbeit, Fastenopfer<br />
Früher gab es <strong>für</strong> die Minenarbeiter in Kolwezi Maismehl und Schulen, heute sind sie auf sich <strong>alle</strong>ine gestellt.<br />
© Patricio Frei / Fastenopfer<br />
Ausländische Firmen plündern die <strong>Bodenschätze</strong><br />
der Demokratischen Republik<br />
Kongo und beuten die Bevölkerung aus.<br />
Nun setzt sich die katholische Kirche mit<br />
Unterstützung von Fastenopfer <strong>für</strong> Gerechtigkeit<br />
ein.<br />
Die Strapazen dieser Nacht sind ihm ins Gesicht<br />
geschrieben. Die Schicht dauerte von<br />
gestern 17 Uhr bis heute Morgen um 7 Uhr.<br />
14 Stunden ohne Pause. Jetzt ist Constantin<br />
Kabeya Kalombo müde und möchte schlafen<br />
gehen. Ihm brennen die Arme. Rund acht<br />
Tonnen Kupfererz haben er und sein Schichtkumpel<br />
diese Nacht in den Schmelzofen ge-<br />
16<br />
schaufelt, macht rund 4 Tonnen pro Arbeiter<br />
und Schaufel.<br />
Kabeya trägt eine Baumwolljacke, Jeans und<br />
eine Sonnenbrille. Sie bieten nicht ausreichend<br />
Schutz <strong>für</strong> die Arbeiten am 1200 Grad<br />
heissen Schmelzofen. «Die Hitze ist so gross,<br />
dass du die Kleidung nicht mehr spürst. Du<br />
spürst nur noch die Hitze in dir.» Kabeya<br />
zeigt auf eine verhornte Stelle auf seinem<br />
Handrücken: Eine der zahlreichen kleinen<br />
Verbrennungen, die er in seiner Zeit als Minenarbeiter<br />
erlitten hat. Einer seiner Kumpel<br />
hat sogar ein Auge verloren.<br />
Einmal im Jahr schickt sie das Kupferverarbeitungsunternehmen<br />
«Katanga Metals» in
Kolwezi zur medizinischen Kontrolle <strong>–</strong> zum<br />
Tierarzt. Dieser misst jedoch einzig Gewicht<br />
und Körpergrösse der Arbeiter. «Dann vergleicht<br />
er die Zahlen mit unseren Vorjahreswerten»,<br />
erklärt Kabeya.<br />
Keine Alternative zur Ausbeutung<br />
Constantin Kabeya spricht ruhig, wenn er auf<br />
Suaheli die Verhältnisse in der Fabrik beschreibt.<br />
Seine Wortwahl ist gemässigt. Obschon<br />
er weiss, dass er ausgebeutet wird. Kein<br />
Zorn, keine Verbitterung. Er erzählt ohne<br />
grosse Emotionen. Denn er weiss: Das Unternehmen<br />
findet bei einer nationalen Arbeitslosenquote<br />
von 40 Prozent problemlos Ersatz<br />
<strong>für</strong> ihn.<br />
Constantin Kabeya wirkt trotz der harten<br />
Arbeit und seinen 60 Jahren erstaunlich jung.<br />
Der Vater von 13 Kindern lebt in UZK. Das<br />
Dorf hat seinen Namen von der Zinkfabrik,<br />
die einst in der Nähe stand: Usine de Zinc de<br />
Kolwezi.<br />
Früher sei es besser gewesen, sagt Kabeya.<br />
Früher, da arbeiteten er und seine Kumpel <strong>für</strong><br />
das staatliche Bergbauunternehmen «Gécamines».<br />
Das Unternehmen finanzierte eine<br />
Schule <strong>für</strong> die Arbeiterkinder und Maismehl<br />
<strong>für</strong> jede Familie, bei sechs Kindern zwei Säcke<br />
à 50 Kilogramm. Bis die Fabrik vor fünf Jahren<br />
in private Hände überging.<br />
62StundenWoche<br />
Jetzt ist <strong>alle</strong>s anders. Seitdem das Unternehmen<br />
einem Inder gehört, gibt es nur noch die<br />
staatliche Schule. Die Mehlsäcke, die an die<br />
Arbeiter abgegeben werden, sind nur noch<br />
halb so gross, und auch der Lohn wurde halbiert:<br />
Im Monat gerade mal 170 US-Dollar<br />
anstatt wie früher 300 US-Dollar.<br />
Constantin Kabeya © Patricio Frei / Fastenopfer<br />
62 Stunden Arbeit pro Woche sind keine Seltenheit,<br />
obwohl das kongolesische Arbeitsrecht<br />
dies verbietet. Das weiss auch Pfarrer<br />
Abbé Marcel Ngwesi Lwandanda. Er interessiert<br />
sich <strong>für</strong> Kabeyas Ausführungen. Im Dezember<br />
2009 hat ihn der Bischof von Kolwezi<br />
zum Beobachter <strong>für</strong> <strong>Bodenschätze</strong> ernannt.<br />
Nun ist er der Vertreter der «Commission<br />
Épiscopale pour les Ressources Naturelles»<br />
(Cern), die ihm das nötige Fachwissen über<br />
den Abbau von <strong>Bodenschätze</strong>n vermittelt hat.<br />
Kirche fordert Gerechtigkeit<br />
Cern wurde 2008 von der kongolesischen<br />
Bischofskonferenz ins Leben gerufen, um mit<br />
Unterstützung von Fastenopfer gegen Missbräuche<br />
beim Abbau von <strong>Bodenschätze</strong>n vorzugehen.<br />
Die Gewinne aus Kupfer, Koltan<br />
und anderen Erzen sollen zur Entwicklung<br />
17
Seit «Katanga Metals» in private Hände überging, erhalten die Arbeiter/innen gerade noch die Hälfte ihres<br />
früheren Lohnes. © Patricio Frei / Fastenopfer<br />
des Kongos beitragen. Eigentlich ist gesetzlich<br />
festgelegt, welcher Anteil des Gewinns dem<br />
Staat, der Provinz und letztlich auch der Bevölkerung<br />
zugute kommen sollte. Doch die<br />
Unternehmen machen oft falsche Angaben zu<br />
den Abbaumengen, <strong>oder</strong> das Geld versickert<br />
in den Taschen korrupter Beamter.<br />
Nun will die Kirche <strong>für</strong> Recht und Ordnung<br />
sorgen. In <strong>alle</strong>n 47 Diözesen des Kongos soll<br />
sich dereinst je ein Priester mit den <strong>Bodenschätze</strong>n<br />
befassen. «Gott hat uns die Erde<br />
gegeben, damit wir da<strong>für</strong> sorgen, dass der<br />
Reichtum <strong>für</strong> die Entwicklung der Bevölkerung<br />
genutzt wird. Stattdessen verursacht er<br />
Konflikte und Krieg», sagt Abbé Marcel.<br />
Der Pfarrer wird es nicht einfach haben, <strong>für</strong><br />
seine Mandanten Recht zu bekommen. Kolwezi<br />
gilt als der Ort mit den grössten und<br />
ertragreichsten Minen in der ganzen Demokratischen<br />
Republik Kongo. Den wirtschaft-<br />
18<br />
lichen Interessen der hier tätigen transnationalen<br />
Konzerne können und wollen sich die<br />
lokalen Behörden nicht entziehen. So ist die<br />
Bürgermeisterin schon einmal vor Ort, wenn<br />
eine Bergbaufirma mit Bulldozern hektarweise<br />
Felder <strong>für</strong> neue Lagerh<strong>alle</strong>n niederwalzt <strong>–</strong><br />
ohne vorgängig die Kleinbauernfamilien zu<br />
informieren, die dort seit 25 Jahren ihr Gemüse<br />
angepflanzt haben.<br />
Die Rechte der Kleinbäuerinnen und der Arbeiter<br />
interessieren in Kolwezi kaum jemanden,<br />
wenn es ums grosse Geschäft geht. Abbé<br />
Marcel und die Cern versuchen, dies nun zu<br />
ändern.
Peru<br />
Wirtschaftswachstum auf Kosten der<br />
indigenen Bevölkerung<br />
Daniel Hostettler, Fachverantwortlicher Menschenrechte, Fastenopfer<br />
Das Amazonasbecken in Peru ist reich an<br />
zahlreichen <strong>Bodenschätze</strong>n. Jahrelang hat<br />
die Regierung versucht, die Rechte der indigenen<br />
Gemeinschaften an der Land und<br />
Ressourcennutzung zu Gunsten von privaten<br />
Investoren einzuschränken. Doch der<br />
Druck auf die Regierung, sich <strong>für</strong> bessere<br />
Lebensbedingungen und mehr Mitsprache<br />
der Indigenen einzusetzen, wächst.<br />
Am 5. Juni 2009 kam es in der Provinz<br />
Bagua im peruanischen Amazonasgebiet zu<br />
gewalttätigen Konfrontationen zwischen<br />
Indigenen und Polizeikräften. 23 Polizisten<br />
und 10 Zivilpersonen kamen dabei ums<br />
Leben. Den tragischen Ereignissen vorangegangen<br />
war eine zweijährige Auseinandersetzung<br />
zwischen der Regierung von<br />
Präsident Alan García und der indigenen<br />
Bevölkerung um den Zugang zu Land und<br />
Ressourcen in der Region. Per Dekret wollte<br />
die Regierung im Zuge ihrer radikalen Freihandelspolitik<br />
den Zugang <strong>für</strong> transnationale<br />
Konzerne zu den Rohstoffen im Amazonasgebiet<br />
vereinfachen. Dazu sollten auch<br />
die national und international verbrieften<br />
Rechte der indigenen Bevölkerung auf Mitsprache<br />
bei Verhandlungen eingeschränkt<br />
werden.<br />
Investoren vor Grundrechten<br />
Das peruanische Amazonasgebiet birgt grosse<br />
natürliche Reichtümer an Erzen, Erdöl,<br />
Holz und Wasser. Transnationale Konzerne<br />
Denkmal <strong>für</strong> die Opfer der Ausschreitungen.<br />
© Ronar Espinoza / Vicariato de Jaen<br />
sichern sich mittels Konzessionen die Ausbeutung<br />
dieser Ressourcen. Dank der hohen<br />
Weltmarktpreise stieg Peru auf diese Weise in<br />
wenigen Jahren an die Spitze der Länder<br />
Lateinamerikas mit dem höchsten Wirtschaftswachstum.<br />
Die Rechte von Kleinbauern<br />
und -bäuerinnen, indigenen Gemeinschaften<br />
und anderen Bevölkerungsgruppen<br />
haben in dieser Politik keinen Platz mehr.<br />
19
Entsprechend haben die beachtlichen Summen,<br />
die von den Konzernen <strong>für</strong> Konzessionen<br />
und Steuern bezahlt werden, in all den<br />
Jahren des Rohstoffbooms nicht zu einer Verbesserung<br />
der ökonomischen und sozialen<br />
Perspektiven der lokalen Bevölkerung beigetragen.<br />
Im Gegenteil: Seit den 1960er Jahren<br />
hat sich die Situation der indigenen Gemeinschaften<br />
angesichts verseuchten Trinkwassers<br />
und zerstörter Anbauflächen sowie der Verbreitung<br />
neuer Krankheiten und der Zerstörung<br />
der ökologischen Vielfalt drastisch verschlechtert.<br />
Marginalisierung der Indigenen<br />
Die Kommission, die eingesetzt wurde, um<br />
die gewalttätigen Auseinandersetzungen in<br />
Bagua zu untersuchen, kam denn auch zum<br />
Schluss, dass die ökonomische, soziale und<br />
kulturelle Marginalisierung der indigenen<br />
Bevölkerung den Hintergrund <strong>für</strong> die sich<br />
zunehmend radikalisierte Bewegung gegen<br />
die Regierung gebildet hatte. Die eingeschränkte<br />
Mitsprache, welche die Regierung<br />
per Dekret durchsetzen wollte, verletzt die in<br />
der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation<br />
(ILO) garantierte Konsultation<br />
der indigenen Bevölkerung (vgl. Kasten<br />
Seite 9). Zwar hatte sich der peruanische<br />
Staat bis anhin ohnehin nicht um die Einhaltung<br />
dieser Garantie geschert. Aufgrund der<br />
Dekrete be<strong>für</strong>chteten die Indigenen aber,<br />
auch noch die letzte Möglichkeit zu verlieren,<br />
bei der Entwicklung ihrer Regionen mitentscheiden<br />
zu können.<br />
Eskalierter Konflikt<br />
Mitte 2008 begannen die Indigenen-Organisationen,<br />
Aktionen gegen die Regierungsbe-<br />
20<br />
Sicherheitskräfte gehen gewaltsam gegen Protestierende<br />
vor. © Thomas Quirynen / Amnesty International<br />
schlüsse durchzuführen. Anfangs 2009 forderte<br />
die ILO den peruanischen Staat auf, die<br />
Konvention 169 einzuhalten. Und auch die<br />
Bischöfe der Amazonasregion riefen die Regierung<br />
dazu auf, die Dekrete zurückzunehmen<br />
und das indigene Recht auf Konsultation<br />
zu respektieren. Da die Regierung keinerlei<br />
Willen zeigte, sich der Frage grundsätzlich zu<br />
stellen, begannen die Indigenen-Organisationen<br />
des Amazonasgebiets Anfang April 2009<br />
einen Generalstreik. Dieser wurde begleitet<br />
von Strassen- und Flussblockaden, der Besetzung<br />
von Landeplätzen und der Lahmlegung<br />
unternehmerischer Infrastruktur. Anfang<br />
Mai 2009 rief die Regierung den Notstand <strong>für</strong><br />
die Region aus und entsandte zusätzliche Sicherheitskräfte.<br />
Die Spannung stieg weiter an.
Wie es genau zu den gewalttätigen Zusammenstössen<br />
vom 5. Juni kam, ist bis heute<br />
nicht abschliessend geklärt. Berichte von verschiedenen<br />
Seiten kommen zu widersprüchlichen<br />
Ergebnissen. Auch die Nacharbeit in<br />
vier gemischten Kommissionen brachten<br />
kaum konkrete Resultate. Laut dem «Centro<br />
Amazónico de Antropología y Aplicación<br />
Práctica» (CAAA), einer Partnerorganisation<br />
von Fastenopfer, welche die marginalisierte<br />
Bevölkerung bei Organisations- und Rechtsfragen<br />
begleitet, bleibt der Druck auf das<br />
Amazonas-Gebiet und dessen Rohstoffreichtum<br />
weiterhin bestehen, da die Vergabe von<br />
Konzessionen an transnationale Konzerne<br />
nicht gestoppt wurde.<br />
Druck auf Regierung bleibt nötig<br />
Der einzige Lichtblick nach den gewalttätigen<br />
Konfrontationen ist die Verabschiedung eines<br />
Gesetzes, das den Indigenen gemäss ILO-<br />
Konvention 169 das Recht auf Konsultation<br />
bei Projekten, die ihre Lebensweise tangieren,<br />
zuerkennt. Zwar hat Präsident García seine<br />
Unterschrift verweigert und das Gesetz an<br />
den Kongress zurückgewiesen. In einer zweiten,<br />
noch ausstehenden Abstimmung kann<br />
der Kongress dem Gesetz jedoch definitiv zustimmen.<br />
Aber auch in diesem Fall wird sich noch weisen<br />
müssen, wie das Gesetz in der Praxis<br />
umgesetzt wird und ob es sich bewährt. Entsprechender<br />
Druck von unten und auf internationaler<br />
Ebene wird wohl weiterhin nötig<br />
sein, um die Regierung und die Konzerne<br />
dazu zu bringen, ihre Verpflichtungen einzuhalten.<br />
Ursache der Ausschreitungen: Die Marginalisierung der indigenen Bevölkerung zu Gunsten internationaler<br />
Rohstoffkonzerne. © Thomas Quirynen / Amnesty International<br />
21
Südafrika<br />
Kampf <strong>für</strong> Menschenrechte und bessere<br />
Lebensbedingungen<br />
Miges Baumann, Leiter Entwicklungspolitik, <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong><br />
In der Hüttensiedlung Ikemeleng vermögen es nur wenige, ihre Kinder zur Schule zu schicken.<br />
© Miges Baumann / <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong><br />
Die «Bench Marks Foundation», eine Partnerorganisation<br />
von <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong>, kämpft im<br />
südlichen Afrika da<strong>für</strong>, dass Minengesellschaften<br />
ihren Menschenrechtsverpflichtungen<br />
nachkommen. Sie befähigt betroffene<br />
Gemeinschaften, von den<br />
Unternehmen den nötigen Beitrag zur Verbesserung<br />
ihrer Lebensbedingungen und<br />
zur Beendigung der Umweltzerstörung<br />
einzufordern.<br />
Phindile Boitumelo (30) steht vor einem im<br />
Boden vergrabenen Ölfass und zeigt auf den<br />
22<br />
Inhalt: «Das ist eine unserer Wasserstellen<br />
hier in Ikemeleng, Rustenberg. Das Wasser<br />
ist aber sehr schmutzig, und oft hat es überhaupt<br />
kein Wasser.» In der informellen Hütten-<br />
und Wellblech-Siedlung Ikemeleng wohnen<br />
ein paar tausend Menschen. Einige<br />
arbeiten in den umliegenden Minengesellschaften,<br />
viele sind arbeitslos. Die hygienischen<br />
Verhältnisse sind äusserst prekär. Wasserstellen<br />
<strong>oder</strong> Toiletten gibt es nur wenige.<br />
Das Wasser im nahegelegenen Bach ist verschmutzt<br />
und vergiftet, meistens ist er ausgetrocknet.
Die himmelschreienden hygienischen Zustände<br />
in Ikemeleng sind nur eines der Probleme<br />
der Hüttensiedlung. Umweltverschmutzung<br />
durch die sie umgebenden Platin-Minen,<br />
Luftverschmutzung durch Schmelzanlagen,<br />
Vergiftungen, Gesundheitsprobleme, fehlende<br />
Arbeitsrechte, tiefe Löhne, Landraub,<br />
soziale Ausgrenzung und die völlige Vernachlässigung<br />
durch die Behörden der Stadt Rustenberg<br />
gehören ebenfalls zum Alltag in Ikemeleng.<br />
Die Wellblechsiedlung ist geradezu<br />
typisch <strong>für</strong> die Situation rund um die Bergbauunternehmen<br />
in Südafrika.<br />
«95 Prozent der Jugendlichen hier sind arbeitslos»,<br />
sagt Phindile, die selber einmal als<br />
Spreng-Assistentin in einer Mine gearbeitet<br />
hat. «Das bringt grosse Probleme <strong>für</strong> uns Junge.<br />
Mädchen müssen ihren Körper verkaufen<br />
und Jungen beginnen zu stehlen.» Der Grossteil<br />
der Minenarbeiter/innen komme aus dem<br />
Ausland. Sie können sich noch weniger <strong>für</strong><br />
ihre Rechte wehren als die Einheimischen.<br />
International hörbare Stimme<br />
Phindile ist eine von zehn jungen Erwachsenen,<br />
die 2009 erstmals an einem Training im<br />
Rahmen des «Monitoring Action»-Projekts<br />
der südafrikanischen Nichtregierungsorganisation<br />
«Bench Marks Foundation» (siehe<br />
Kasten) teilnehmen konnten. Die Idee des<br />
Programms ist so simpel wie bestechend: Je<br />
zwei junge arbeitslose Menschen, die von<br />
einer Siedlungsgemeinschaft ausgewählt werden,<br />
erhalten eine Ausbildung. Diese befähigt<br />
sie, über die Situation in ihrer Siedlung und<br />
in den Minen zu schreiben und die Berichte<br />
als Blogs im Internet zu veröffentlichen. So<br />
erhalten die Gemeinschaften erstmals eine<br />
Stimme: Berichte über Vorfälle in der Siedlung<br />
<strong>oder</strong> in den Minengesellschaften sind<br />
Phindile Boitumelo zeigt eine Wasserstelle.<br />
© Miges Baumann / <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong><br />
sofort <strong>für</strong> die ganze Weltöffentlichkeit zugänglich.<br />
Die neue Aufgabe stärkt auch das Selbstvertrauen<br />
und die Fähigkeiten der jungen Menschen.<br />
Sie lernen, ihre Situation zu analysieren,<br />
die Hintergründe und Ursachen <strong>für</strong> die<br />
Armut und Probleme in ihrer Gemeinschaft<br />
zu verstehen und Lösungen zu formulieren. In<br />
einer zweiten Trainingsphase müssen die<br />
Monitoring-Aktivist/innen in ihrer Gemeinschaft<br />
eine Gruppe gründen, gemeinsam einen<br />
Aktionsplan formulieren und eine Aktion<br />
durchführen. Die Aktionen und allfälligen<br />
Treffen der Gruppe mit Behörden <strong>oder</strong> Vertreter/innen<br />
der Minengesellschaften werden<br />
protokolliert und via Internet veröffentlicht.<br />
Werden gemachte Vereinbarungen <strong>oder</strong> Ver-<br />
23
Wellblech-Siedlung Ikemeleng.<br />
© Miges Baumann / <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong><br />
sprechungen nicht eingehalten, ist theoretisch<br />
die ganze Welt darüber informiert.<br />
Viel beachtetes Modell<br />
In Ikemeleng hat das Projekt bereits erste<br />
bescheidene Resultate erzielt: einige Wassertanks<br />
und Toiletten wurden aufgestellt. Sie<br />
helfen, die hygienischen Verhältnisse etwas<br />
zu verbessern. Der Weg ist jedoch noch lang<br />
und beschwerlich. Eine friedliche Demonstration<br />
im August 2009 wurde von der Poli-<br />
24<br />
zei gewaltsam aufgelöst. Schüsse fielen, es gab<br />
Verletzte.<br />
Obschon die Monitoring-Aktivist/innen nach<br />
der Ausbildung keine finanzielle Unterstützung<br />
erhalten, sind die Vertreter/innen der<br />
«Bench Marks Foundation» davon überzeugt,<br />
dass ihr viel beachtetes Modell in den<br />
Gemeinschaften zu Veränderungen führen<br />
kann und sie dazu befähigt, eine bessere Verhandlungsposition<br />
gegenüber Behörden und<br />
Minengesellschaften einzunehmen. Die im<br />
Internet veröffentlichten Erfahrungsberichte<br />
ermöglichen es, auch international Druck gegenüber<br />
der jeweiligen Unternehmen aufzubauen.<br />
Das Ziel: die Minengesellschaften sollen ihre<br />
soziale Verantwortung und ihre menschenrechtlichen<br />
Verpflichtungen gegenüber den<br />
Arbeitenden und ihren Angehörigen in den<br />
Gemeinden wahrnehmen, damit sich das Los<br />
der Minenarbeiter/innen und die Lebensqualität<br />
in den Hüttensiedlungen verbessert.<br />
«Bench Marks Foundation» <strong>–</strong> eine Stiftung, die Unternehmen auf die Finger schaut<br />
Die von verschiedenen Kirchen in Südafrika gegründete Stiftung hat zum Ziel, dass die<br />
Unternehmen, speziell die Minengesellschaften im südlichen Afrika, mehr zur Entwicklung<br />
der Gesellschaft und zur Einhaltung der Menschenrechte beitragen. Arbeitsschwerpunkte<br />
der unabhängigen Nichtregierungsorganisation sind die Befähigung von Gemeinschaften<br />
rund um Minengesellschaften zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und die Verpflichtung<br />
von Unternehmen zur Einhaltung der Menschenrechte und Umweltnormen.<br />
Mit ihren «Policy Gap»-Studien zur Situation in bestimmten Rohstoffunternehmen <strong>oder</strong><br />
Bergbaugegenden dokumentiert die Stiftung die Lücken zwischen den beschönigenden PR-<br />
Aussagen von Firmen und den davon massiv abweichenden realen Zuständen vor Ort. Die<br />
«Bench Marks Foundation» ist eine von <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> direkt unterstütze Partnerorganisation.<br />
Sie ist als wichtige Stimme im Bereich der menschenrechtlichen Verantwortung und<br />
Verpflichtungen von Unternehmen weltweit anerkannt. «Monitoring Action» ist ein Projekt<br />
der Stiftung.<br />
www.bench-marks.org.za<br />
http://sites.google.com/site/monitoringaction
Elektronikindustrie<br />
Von der Mine zum Computer <strong>–</strong><br />
ein undurchsichtiger Weg<br />
Chantal Peyer, Verantwortliche <strong>für</strong> Unternehmen und Menschenrechte, <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong><br />
Valérie Trachsel, Verantwortliche «High Tech <strong>–</strong> No Rights», Fastenopfer<br />
22 Kilo Rohstoffe sind nötig <strong>für</strong> die Herstellung eines<br />
PCs. © Patrik Kummer / <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong><br />
Was verbindet Phindile Boitumelo, Bewohnerin<br />
der Wellblechsiedlung Ikemeleng in Südafrika,<br />
mit dem iPad in der Auslage eines<br />
Schweizer Warenhauses? Das Platin, ein korrosionsresistentes<br />
Edelmetall, das <strong>für</strong> elektronische<br />
Schaltungen gebraucht wird. Platin ist<br />
einer von vielen Rohstoffen aus dem afrikanischen<br />
Boden, die <strong>für</strong> die Herstellung von<br />
Handys, Computern, iPods und anderen<br />
Elektrogeräten benötigt werden. Dazu gehören<br />
auch Kupfer, Aluminium, Blei, Gold,<br />
Zink, Nickel, Zinn, Silber, Eisen, Palladium,<br />
Quecksilber und Kobalt. Rund 22 Kilo Rohstoffe<br />
braucht es <strong>für</strong> die Herstellung eines<br />
einzigen Computers und dessen Zubehör.<br />
Der Rohstoffabbau und -handel ist in der<br />
Hand von Firmen, deren Namen den Konsument/innen<br />
und oftmals auch den westlichen<br />
Markenfirmen nicht bekannt sind. Die Rohstoffindustrie<br />
ist eine undurchsichtige Branche<br />
und die Produktionskette eines Computers<br />
äusserst komplex. Die Folge davon:<br />
Firmen wie «Apple» <strong>oder</strong> «Dell» können<br />
nicht sagen, aus welchen Minen die Met<strong>alle</strong><br />
stammen, die sie <strong>für</strong> ihre Produktion verwenden.<br />
Damit wächst auch die Gefahr von Menschenrechtsverletzungen,<br />
wie verschiedene<br />
Studien des holländischen Forschungsinstituts<br />
SOMO, einem Partner von <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong>,<br />
belegen. 13<br />
So wurde etwa die Mine in Bisie im Osten der<br />
«Demokratischen» Republik Kongo bis vor<br />
wenigen Jahren von einem einflussreichen<br />
Lokalherrscher geführt. Heute ist sie in den<br />
Händen von Splittergruppen der Kongolesischen<br />
Armee, die zahlreicher Verbrechen gegen<br />
die Menschlichkeit angeklagt ist. Aufgrund<br />
von fehlenden Sicherheitsvorkehrungen<br />
sind schlimme Unfälle in der Mine an der<br />
Tagesordnung. Auch die Dörfer in der Region<br />
leiden unter den Minen: Schwermet<strong>alle</strong>, die<br />
sich im Grundwasser und in Flüssen sammeln,<br />
führen zu Krebserkrankungen, Atembeschwerden<br />
und anderen schweren Krankheiten.<br />
Wegen der vergifteten Böden verlieren<br />
die lokalen Bauern und Bäuerinnen ihre Lebensgrundlage.<br />
Für Nichtregierungsorganisationen wie <strong>Brot</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>alle</strong> und Fastenopfer müssen solche Missstände<br />
von der Elektronikindustrie anerkannt<br />
und jedes Glied der Produktionskette dazu<br />
angehalten werden, ihren Teil der Verantwortung<br />
<strong>für</strong> die Verbesserung der Situation zu<br />
übernehmen. Dieser Forderung werden wir<br />
mit der ökumenischen Kampagne 2011 Nachdruck<br />
verleihen (siehe Seiten 26<strong>–</strong>29).<br />
25
Fazit und Ausblick<br />
Wege hin zu einer nachhaltigen Ressourcengewinnung<br />
Chantal Peyer, Verantwortliche <strong>für</strong> Unternehmen und Menschenrechte, <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong><br />
Das Haus dieser Frau in Papua Neuguinea wurde abgebrannt, weil die Porgera Goldmine das Land <strong>für</strong> sich<br />
beansprucht. © Amnesty International<br />
Die Rohstoffindustrie ist geprägt von Interessenskonflikten<br />
zwischen lokalen Ge<br />
meinschaften, Regierungen und Unternehmen.<br />
Menschenrechte und Umwelt<br />
schutz sind dabei zweitrangig. Reformen,<br />
die zu mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit<br />
und einer verbesserten Transparenz bei<br />
den Finanzflüssen führen, sind daher<br />
dringend notwendig. <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> und<br />
Fastenopfer setzen sich mit der ökumeni<br />
26<br />
schen Kampagne 2011 u.a. <strong>für</strong> folgende<br />
Massnahmen ein.<br />
1. Einführung fairer Konsultationsmechanismen<br />
Minenunternehmen agieren oftmals in Drittländern.<br />
Dort sind sie Gäste, die auf fremder<br />
Erde Investitionen tätigen und daraus wert-
volle Rohstoffe gewinnen. Deshalb sind sie<br />
dazu verpflichtet, <strong>für</strong> die lokalen Gemeinschaften<br />
faire und nachhaltige Lösungen zu<br />
ermöglichen. In der Realität ist dies bis anhin<br />
kaum der Fall.<br />
In Südafrika gehörten zur Zeit der Apartheid<br />
78 Prozent des fruchtbarsten Landes der weissen<br />
Bevölkerung. Für die indigenen Gemeinschaften<br />
blieben lediglich 13 Prozent kargen<br />
Landes übrig. Heute werden diese Gemeinschaften,<br />
zu denen auch Ikemeleng (Seite 22<strong>–</strong><br />
24) gehört, von ihren Grundstücken vertrieben,<br />
weil sie sich als äusserst ressourcenreich<br />
erwiesen haben. Die Kompensationszahlungen,<br />
die sie da<strong>für</strong> von den Unternehmen erhalten,<br />
sind lächerlich. De facto haben die Dorfbewohner/innen<br />
keine andere Wahl als ihr Land zu<br />
verlassen, ihre Friedhöfe umzuplatzieren und<br />
Zeugen der unaufhaltsamen Verschlechterung<br />
ihrer Lebensbedingungen zu werden.<br />
Die so genannten Konsultationen der lokalen<br />
Gemeinschaften durch die Minenunternehmen<br />
sind absolut ungenügend. Sie finden<br />
in der Regel am Abend statt, weit entfernt<br />
und schwer erreichbar <strong>für</strong> die Dorfbewohner/innen.<br />
Abgehalten werden Sie in einer<br />
sehr technischen Sprache ohne ausgewogene<br />
Vertretung <strong>alle</strong>r betroffenen Gemeinden<br />
und die Meinungen unterschiedlicher Personen.<br />
<strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> und Fastenopfer fordern, dass<br />
keine Konzessionen an Rohstoffunternehmen<br />
vergeben werden dürfen, ohne ein vorangehendes,<br />
freies und auf umfassenden Informationen<br />
beruhendes Einverständnis («free prior<br />
and informed consent») der lokalen Gemeinschaften.<br />
Es liegt in der Verantwortung der<br />
Unternehmen, neue Konsultationsmechanismen<br />
einzuführen <strong>–</strong> vor, während und nach<br />
den Investitionstätigkeiten.<br />
Die ökumenische Kampagne 2011 von <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> und Fastenopfer<br />
Die Rolle der Rohstoffindustrie und ihre Auswirkungen auf die Umwelt und die marginalisierten<br />
Bevölkerungen in den Ländern des Südens und insbesondere in Afrika wird im<br />
Zentrum der ökumenische Kampagne 2011 von Fastenopfer und <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> stehen. Nebst<br />
der Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit und von Schweizer Unternehmen <strong>für</strong> die<br />
Problematik richten sich die Werke mit ihren Forderungen in erster Linie an die Schweizer<br />
Regierung.<br />
Mit einer Unterschriftensammlung per Internet soll diese dazu aufgefordert werden, ihre<br />
Aussenwirtschaftspolitik mit ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen besser in Einklang<br />
zu bringen. Ausserdem soll sie sich im Rahmen der Gesetzgebung <strong>für</strong> die Einführung<br />
eines «Country by Country»-Reporting durch Unternehmen einsetzen sowie <strong>für</strong> die Haftbarkeit<br />
von Mutterunternehmen <strong>für</strong> Menschenrechtsverletzungen ihrer Tochtergesellschaften<br />
(vgl.Text).<br />
Durch eine breite Beteiligung an der Unterschriftensammlung kann den Forderungen<br />
gegenüber der Schweizer Regierung genügend Gewicht verliehen werden, um im Bereich<br />
Wirtschaft und Menschenrechte endlich auch in der Schweiz zu substanziellen Resultaten<br />
zu gelangen.<br />
www.rechtaufnahrung.ch (ab Januar 2011)<br />
27
Die Pflicht der Regierungen ist es, da<strong>für</strong> zu<br />
sorgen, dass die ILO-Konvention 169 eingehalten<br />
wird.<br />
<strong>–</strong> Die Regierungen müssen die betreffenden<br />
Völker durch geeignete Verfahren und<br />
insbesondere durch ihre repräsentativen<br />
Einrichtungen konsultieren, wann immer<br />
gesetzgeberische <strong>oder</strong> administrative Massnahmen,<br />
die sie unmittelbar berühren können,<br />
erwogen werden (Artikel 6a).<br />
<strong>–</strong> Die Eigentums- und Besitzrechte der betroffenen<br />
Völker an dem von ihnen von<br />
alters her besiedelten Land sind anzuerkennen<br />
(Artikel 14).<br />
2. Mehr Transparenz bei Finanzflüssen<br />
Die Erträge aus den <strong>Bodenschätze</strong>n kommen<br />
in den wenigsten Fällen der Bevölkerung zu<br />
Gute (Seiten 12<strong>–</strong>14). Die Gewinne machen die<br />
internationalen Rohstoffkonzerne, während<br />
die lokalen Gemeinschaften leer ausgehen.<br />
Schwache Regierungen, instabile politische<br />
Situationen, Krieg, Korruption und volatile<br />
Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt sind<br />
Gründe da<strong>für</strong>. Am meisten fällt jedoch die<br />
Steuerflucht der internationalen Rohstoffunternehmen<br />
ins Gewicht, die auf 50 Milliarden<br />
US-Dollar jährlich geschätzt werden (siehe<br />
Seiten 12<strong>–</strong>14). Riesige Summen, die in Gesundheits-<br />
<strong>oder</strong> Schulprogramme <strong>oder</strong> in die<br />
Entwicklung der lokalen Landwirtschaft investiert<br />
werden könnten.<br />
Um diesen Praktiken der Steuervermeidung<br />
einen Riegel zu schieben, braucht es mehr<br />
Transparenz im Rohstoffsektor. Die USA haben<br />
einen ersten Schritt in diese Richtung<br />
gemacht: Am 16.Juli 2010 hat der Senat die<br />
«Dodd-Frank Wall Street»-Reform angenommen<br />
und den Consumer Protection Act genehmigt.<br />
Damit müssen künftig <strong>alle</strong> Erdöl-,<br />
28<br />
Gas- <strong>oder</strong> Rohstoffunternehmen öffentlich<br />
und nach Land unterteilt die Abgaben deklarieren,<br />
die sie an die Regierungen in den<br />
jeweiligen Abbauländern getätigt haben. Ein<br />
entscheidender rechtlicher Schritt, der es den<br />
Behörden der Entwicklungsländer, Nichtregierungsorganisationen,<br />
der Bevölkerung und<br />
Forschungsinstituten ermöglicht, Steuerflucht<br />
aufzudecken.<br />
<strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> und Fastenopfer fordern, dass<br />
die Schweiz dem amerikanischen Beispiel<br />
folgt und sich <strong>für</strong> entsprechende Reformen<br />
einsetzt, z.B. im Rahmen der Revision der<br />
OECD-Richtlinien <strong>für</strong> multinationale Unternehmen.<br />
Das Parlament seinerseits soll bei der<br />
aktuellen Revision des Rechnungslegungsgesetzes<br />
darauf hinarbeiten, dass die Rechnungslegung<br />
nach Land («country by country<br />
reporting») integriert wird.<br />
3. Juristische Verantwortung von<br />
Mutterunternehmen <strong>für</strong> ihre Tochtergesellschaften<br />
Gemäss Schweizerischem Handelsrecht können<br />
Mutterunternehmen <strong>für</strong> die Aktivitäten<br />
ihrer Tochtergesellschaften nicht zur Rechenschaft<br />
gezogen werden. Dazu ein Beispiel:<br />
Das Schweizer Unternehmen «Glencore» mit<br />
Sitz in Baar (Kanton Zug) ist im Rohstoffabbau<br />
und -handel tätig. Im Jahr 2009 belief<br />
sich der Umsatz des grössten Schweizer Unternehmens<br />
dank den Aktivitäten seiner<br />
Tochtergesellschaften weltweit auf 106 Milliarden<br />
US-Dollar. Eine der Gesellschaften<br />
hat ihren Sitz in Sambia und besitzt rund 73<br />
Prozent der Kupfer und Kobalt-Mine in Mopani.<br />
In einem der ärmsten Länder des südlichen<br />
Afrikas gelegen, beschäftigt die Mine<br />
7800 Arbeiter/innen. Hätte das Unternehmen<br />
illegale Vertreibungen, die Vergiftung von
Wo brennende Ölpipelines zum Alltag gehören: Kinder im Niger-Delta. © George Osodi / Keystone<br />
Flüssen, Kinderarbeit <strong>oder</strong> ungenügende Sicherheitsvorkehrungen<br />
bei den Arbeiter/innen<br />
zu verantworten, gäbe es juristisch gesehen in<br />
der Schweiz keine Möglichkeit, das Mutterunternehmen,<br />
das seinerseits die Gewinne<br />
einsteckt, da<strong>für</strong> verantwortlich zu machen.<br />
In der aktuellen Schweizer Gesetzgebung<br />
werden Mutterunternehmen und ihre Tochtergesellschaften<br />
als juristisch unabhängige<br />
Einheiten behandelt. Auch fehlt im Schweizerischen<br />
Handelsrecht eine Klausel, die Konzernchefs<br />
zu Massnahmen verpflichten würde,<br />
Menschenrechtsverletzungen und Verstössen<br />
gegen Umweltgesetzgebungen der Tochtergesellschaften<br />
vorzubeugen. Damit unterstützt<br />
die Schweiz multinationale Unternehmen darin,<br />
sich ihrer Verantwortung zu entziehen.<br />
<strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> und Fastenopfer fordern, dass<br />
das bestehende Schweizer Handelsrecht um<br />
folgende Pflichten ergänzt wird:<br />
<strong>–</strong> Eine Haftpflicht <strong>für</strong> Mutterunternehmen<br />
bezüglich der Tätigkeiten ihrer Tochtergesellschaften.<br />
<strong>–</strong> Eine Sorgfaltspflicht, welche die Unternehmensführer/innen<br />
von transnationalen<br />
Unternehmen dazu verpflichtet, Massnahmen<br />
zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen<br />
durch ihre Tochtergesellschaften<br />
und ihre wichtigsten Zulieferer zu<br />
ergreifen.<br />
In der Europäischen Union arbeitet eine<br />
Koalition von Nichtregierungsorganisationen<br />
bereits in diese Richtung.<br />
www.corporatejustice.org<br />
29
Links und Quellenhinweise<br />
Quellenhinweise<br />
1 Deutsche Bank Research: Chinas Rohstoffhunger,<br />
Auswirkungen auf Afrika und Lateinamerika. www.<br />
dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/<br />
PROD0000000000200146.pdf<br />
2 Christian Aid: Undermining the poor: Mineral Taxation<br />
Reforms in Latin America, 2009. Die Studie<br />
stützt sich auf den Latin America Economic Outlook<br />
2009 der OECD.<br />
3 ECLAC: Social Panorama of Latin America, 2008,<br />
S.9. www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/34733/<br />
PSI2008-SintesisLanzamiento.pdf<br />
4 The Revenue Watch Institute: Transforming Resource<br />
Wealth into Well-Being, 2010.<br />
5 www.resistance-mining.org<br />
6 Uno-Pakt <strong>für</strong> wirtschaftliche, soziale und kulturelle<br />
Menschenrechte (wsk-Pakt) sowie Rechtskommentare<br />
Nr. 12 und Nr. 15 zum Pakt.<br />
7 Uno-Rechtskommentar Nr.12 zum wsk-Pakt (Artikel<br />
20)<br />
8 Human Rights Assessment of Goldcorp’s Marlin<br />
Mine, Mai 2010: www.hria-guatemala.com<br />
9 http://eiti.org/DRCongo<br />
10 Greenpeace 2008, Conning the Congo: www.green<br />
peace.org/international/en/publications/reports/<br />
conning-the-congo<br />
11 www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Bilanzierungs<br />
regeln_Country-by-Country_deutsch_08.pdf<br />
12 Curtis M.,Lissu T., A golden opportunity: How Tanzania<br />
is failing to benefit from gold mining, Oktober<br />
2008: www.pambazuka.org/images/articles/407/<br />
goldenopp.pdf<br />
13 http://somo.nl/dossiers-en/sectors/extractives/extractives<br />
30<br />
Links<br />
Unternehmensverantwortung<br />
www.amnesty.ch<br />
www.business-humanrights.ch<br />
www.evb.ch<br />
www.humanrights.ch<br />
www.multiwatch.ch<br />
www.bench-marks.org.za<br />
www.corporatejustice.org<br />
www.icj.org<br />
www.oecdwatch.org<br />
www.transparency.org<br />
Rohstoff und Elektronikindustrie<br />
www.fair-computer.ch<br />
www.eiti.org<br />
www.makeitfair.org<br />
www.somo.nl<br />
Weitere Partner<br />
www.cisde.org<br />
Ökumenische Kampagne 2011<br />
www.rechtaufnahrung.ch
Impressum<br />
Herausgeber: <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> / Fastenopfer, Bern / Luzern, September 2010<br />
Redaktion: Pascale Schnyder<br />
Autor/innen: Miges Baumann, Markus Brun, Patricio Frei, Daniel Hostettler,<br />
Chantal Peyer, Valérie Trachsel, Ester Wolf<br />
Korrektorat: Sylvia Garatti<br />
Grafik: Cavelti AG, Druck und Media, Gossau<br />
Auflage: 8600 (deutsch), 3800 (französisch)<br />
Bestellungen: <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong>, Monbijoustrasse 29, Postfach 5621, 3001 Bern<br />
Telefon 031 380 65 65, Fax 031 380 65 63, materialstelle@bfa-ppp.ch<br />
Preis: CHF 5.<strong>–</strong><br />
Fastenopfer, Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 Luzern<br />
Telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10, mail@fastenopfer.ch
Viele Länder in Asien, Lateinamerika und Afrika verfügen über immense <strong>Bodenschätze</strong>. In<br />
den seltensten Fällen trägt dieser Reichtum zur Entwicklung der Länder bei <strong>–</strong> im Gegenteil:<br />
Die ressourcenreichsten Länder gehören oftmals zu den ärmsten und konfliktträchtigsten<br />
Staaten der Welt.<br />
Dieser EinBlick zeigt die Auswirkungen des exzessiven Rohstoffabbaus auf Menschen und<br />
Umwelt auf, beleuchtet die Problematik der Steuerflucht und der fehlenden Regulierung internationaler<br />
Rohstoffkonzerne und präsentiert Lösungsansätze, wie der Rohstoffreichtum der<br />
nationalen Entwicklung und der lokalen Bevölkerung zu Gute kommen könnte.<br />
<strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> ist der Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirchen der Schweiz. Er unterstützt<br />
rund 350 Projekte in Asien, Lateinamerika und Afrika, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Entwicklungspolitisch<br />
engagiert sich <strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong> <strong>für</strong> ein faires internationales Weltwirtschaftssystem,<br />
<strong>für</strong> das Recht auf Nahrung, <strong>für</strong> Gerechtigkeit im Klimawandel, <strong>für</strong> soziale und ökologische<br />
Unternehmensverantwortung und <strong>für</strong> faire und transparente Finanzbeziehungen.<br />
<strong>Brot</strong> <strong>für</strong> <strong>alle</strong>, Monbijoustrasse 29, Postfach 5621, 3001 Bern<br />
Telefon 031 380 65 65, Fax 031 380 65 64<br />
www.brotfuer<strong>alle</strong>.ch, bfa@bfa-ppp.ch<br />
Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz. Die 350<br />
Projekte in 16 Ländern weltweit bauen auf die Stärkung lokaler Gemeinschaften, in denen<br />
sich Menschen zusammenschliessen und Lösungen <strong>für</strong> bessere Lebensbedingungen suchen.<br />
Fastenopfer engagiert sich auf nationaler und internationaler Ebene <strong>für</strong> bessere entwicklungspolitische<br />
Rahmenbedingungen und mehr Gerechtigkeit.<br />
Fastenopfer, Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 Luzern<br />
Telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10<br />
www.fastenopfer.ch, mail@fastenopfer.ch