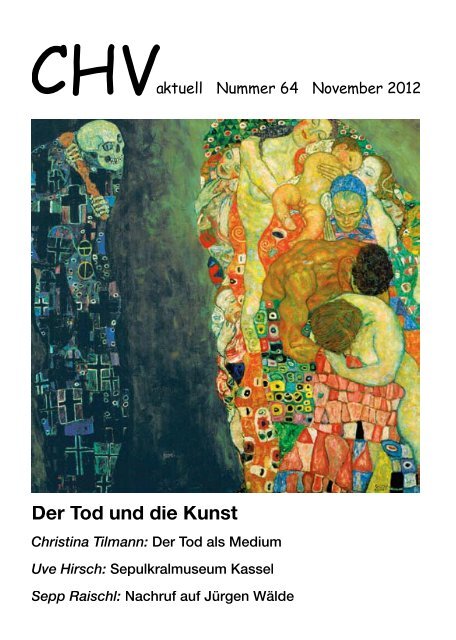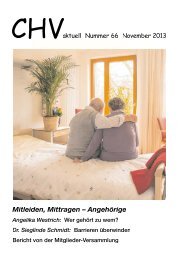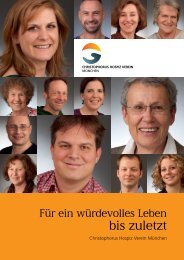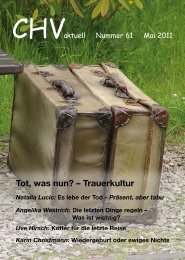PDF Datei laden - Christophorus Hospiz Verein e.V.
PDF Datei laden - Christophorus Hospiz Verein e.V.
PDF Datei laden - Christophorus Hospiz Verein e.V.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
CHV CHVaktuell Nummer 64 November<br />
Der Tod und die Kunst<br />
Christina Tilmann: Der Tod als Medium<br />
Uve Hirsch: Sepulkralmuseum Kassel<br />
Sepp Raischl: Nachruf auf Jürgen Wälde<br />
2012
Knobloch Hartmut<br />
- Rechtsanwalt -<br />
Daiserstraße 51<br />
81371 München<br />
Telefon + 49-(0) 89/725 0142<br />
Fax +49-(0)89/725 63 01<br />
hartmut.knobloch@t-online.de<br />
- Erbrecht -<br />
- Testamentsgestaltung -<br />
- Patientenverfügung -<br />
- Vorsorgevollmachten -<br />
- Nachlassabwicklung -<br />
- Testamentsvollstreckung -<br />
- Immobilien- und Mietrecht -
Editorial<br />
Liebe Mitglieder und Freunde des CHV<br />
Würdiges Sterben. Seit mehr als 25 Jahren stellt sich<br />
der <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> dieser Aufgabe.<br />
Doch die <strong>Hospiz</strong>arbeit kostet Geld. Im Mai zur neuen<br />
Vorstandsvorsitzenden gewählt kämpfe ich für eine<br />
angemessene Finanzierung.<br />
Denk<br />
Kurz vor meinem dreißigsten Geburtstag erlebte ich<br />
in einer Art Vision mein eigenes Sterben – ohne Angst<br />
sehe ich seither dem Tod entgegen. Mehr als einmal<br />
bin ich – behütet durch Schutzengel – dem Unfalltod<br />
entgangen.<br />
Wir begleiten Sie<br />
Zu meiner Person:<br />
Ich bin 66 Jahre alt, zum zweiten Mal verheiratet und stolze Omi. Mein Berufsleben bei<br />
der AWO München und Oberbayern, bei der Landeshauptstadt München und als<br />
Projektleiterin eines sozialwissenschaftlichen Das Forschungsinstitutes neue Bestattungsunternehmen<br />
in Augsburg war<br />
geprägt von der Arbeit für alte, pflegebedürftige und sterbende Menschen. Jetzt freue ich<br />
für München und Umgebung<br />
mich darauf, als ehrenamtliche Vorsitzende mitzuhelfen, unseren <strong>Verein</strong> in schwierigen<br />
Zeiten zu konsolidieren.<br />
Das Ehrenamt war von Anbeginn an eine der tragenden Säulen des CHV. Aber nach und<br />
nach hat sich die zweite Säule – die „Profis“ – zunehmend vergrößert und in ihren Aufgaben<br />
differenziert. Leider hielt die Finanzierung der <strong>Hospiz</strong>arbeit mit dieser Erweiterung<br />
nicht Schritt. <strong>Hospiz</strong> ist sinnvoll – darin sind sich Öffentlichkeit und politische<br />
Entscheidungsträger einig. Aber wer soll was bezahlen? In der ambulanten <strong>Hospiz</strong>arbeit<br />
wurde bisher nur die Koordination und Anleitung ehrenamtlicher <strong>Hospiz</strong>helfer bezahlt,<br />
Pflege und Sozialarbeit gingen leer aus. Jetzt ist die SAPV dazugekommen – hier zahlt die<br />
Krankenkasse für besonders bedürftige, genau definierte sterbende Menschen den Einsatz<br />
eines multiprofessionellen Teams unter ärztlicher Leitung. Aber was ist mit dem<br />
„normalen“ Sterbenden daheim, im Krankenhaus und im Pflegeheim? Das stationäre<br />
<strong>Hospiz</strong> als letzte Station ist nicht für alle bedürftigen und anspruchsberechtigten<br />
Menschen erreichbar. In München gibt es zu wenige <strong>Hospiz</strong>betten: der CHV bietet den<br />
Münchner Bürgern ein <strong>Hospiz</strong> mit 16 Zimmern. Die Barmherzigen Brüder führen das<br />
0 89- 64 24 86 80<br />
zweite <strong>Hospiz</strong> mit 12 Betten. Der Träger eines stationären <strong>Hospiz</strong>es ist vom Gesetz her<br />
gehalten, 10 % der Kosten aus Eigenmitteln selber aufzubringen. Das können nur wenige<br />
Träger finanzieren. Diese Restriktion halte ich für einen sozialpolitischen Skandal.<br />
1
Wie kommt das zustande? Der Jugendwahn beginnt zwar zu schwinden, aber kranke und<br />
sterbende Menschen sieht man nicht gerne. Die Illusion des „for ever young“ verkauft<br />
sich einfach besser. Und die Kassen scheuen Kostensteigerungen.<br />
Ich freue mich, beim CHV Menschen gefunden zu haben, die so denken wie ich, die gemeinsam<br />
mit mir den Kampf aufgenommen haben und nicht aufgeben werden.<br />
Und ich hoffe, unter politischen Entscheidungsträgern und bei Kassenvertretern mutige<br />
und sensible Menschen für unser Anliegen gewinnen zu können.<br />
Denn ich bin überzeugt: Unsere Gesellschaft braucht <strong>Hospiz</strong>e mehr denn je. Dass Sie<br />
unser <strong>Christophorus</strong>-Haus und mich in meiner Arbeit unterstützen<br />
wünscht sich<br />
Ihre<br />
R. Salzmann-Zöbeley<br />
2
Inhalt<br />
Der Tod als Kulturphänomen<br />
Seit jeher befassen sich die Künste mit Tod und Sterben. Der Mensch<br />
soll sich seiner Vergänglichkeit bewusst und gemahnt werden, sich Zeit<br />
seines Lebens damit auseinanderzusetzen.<br />
4 Tod und Leben<br />
Gustav Klimt und sein wichtigstes Werk<br />
Uve Hirsch<br />
5 Der Tod und die Kunst<br />
Gedanken von Ingrid Pfuner<br />
7 Sepulkralmuseum Kassel<br />
Bestattungs-, Friedhofs- und Trauerkultur<br />
Uve Hirsch<br />
11 Ruhe sanft<br />
Der Umgang mit Tod, Trauer und<br />
Gedenken Uve Hirsch<br />
13 Der Tod als Medium<br />
Kulturgeschichte des angekündigten<br />
Sterbens Christina Tilmann<br />
16 Die Pforte<br />
Eingang <strong>Christophorus</strong>-Haus<br />
Heinz Biersack<br />
18 Der Tod gehört zum Leben<br />
Das Unabänderliche akzeptieren<br />
Uve Hirsch<br />
20 Marc Aurel<br />
Selbstbetrachtungen<br />
21 Hieronymus Bosch<br />
Der Flug zum Himmel<br />
22 Totenbilder<br />
Thema aller Hochkulturen<br />
Andreas Tönnesmann<br />
Titelbild: Gustav Klimt – „Tod und Leben“<br />
24 <strong>Hospiz</strong>helfer-Tagebuch<br />
Elisabeth Hofmann<br />
26 Ein Praktikum im CHV<br />
28 Sterben in Deutschland<br />
30 Jahre <strong>Hospiz</strong>bewegung –<br />
Umfrage des DHPV<br />
Anja Beckendorf<br />
30 Hinweis auf ARD-Themenwoche<br />
32 Nachruf auf Jürgen Wälde<br />
34 Neue Palliativkraft<br />
Sepp Raischl<br />
Astrid Schneider-Eicke<br />
36 Der Tod und die Kunst –<br />
ein Abriss durch die Kunstepochen<br />
40 In eigener Sache<br />
Aufnahme ins stationäre <strong>Hospiz</strong><br />
Rubriken<br />
35 Gedichte – (weitere auf Seite 39 und 42)<br />
43 Aus dem <strong>Verein</strong><br />
45 Stifterkreis <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong><br />
46 Termine<br />
48 Impressum<br />
3
4<br />
GUSTAV KLIMT – Tod und Leben<br />
In Gustav Klimts im Jahr 1910 entstandenen großen Gemälde „Tod und Leben“ gibt es<br />
keinen persönlichen Tod, sondern nur einen allegorischen Sensenmann, der hämisch<br />
grinsend auf das „Leben“ blickt. Dieses Leben besteht aus allen Generationen: vom Baby<br />
bis zur Großmutter sind alle Altersstufen vertreten und verbildlichen den Zirkel des Lebens,<br />
der unendlich ist. Der Tod kann zwar einzelne Individuen aus dem Leben schlagen,<br />
dem Leben selbst, der Menschheit als Ganzes, jedoch nichts anhaben. Der Zirkel des Lebens<br />
wiederholt sich auch in den vielfältigen, wunderschönen, pastellfarbenen Kreisornamenten,<br />
die das Leben verspielt umranken. Gustav Klimt bezeichnete dieses Gemälde,<br />
das 1911 in Rom mit dem ersten Preis der Internationalen Kunstausstellung gewürdigt<br />
wurde, als sein wichtigstes figuratives Werk. Trotzdem schien er im Jahr 1915 plötzlich<br />
nicht mehr zufrieden mit dieser Version gewesen zu sein und begann das bereits gerahmte<br />
Gemälde zu überarbeiten. Der einst angeblich goldfarbene Hintergrund wurde nun<br />
grau und sowohl der Tod als auch das Leben mit weiteren Ornamenten ergänzt. Vor dem<br />
Original stehend, kann man auf der linken Innenseite des von Joseph Hoffmann entworfenen<br />
Rahmens noch Spuren dieser Übermalung von Gustav Klimt erkennen.<br />
Aus dem Ausstellungskatalog des Museums LEOPOLD in Wien, das anlässlich des 150. Geburtstages<br />
des wohl berühmtesten Malers Österreichs sein Leben und Werk gewürdigt hat.
Wenn seit mehr als 90 Jahren jeden Sommer<br />
wieder auf dem Salzburger Domplatz<br />
Hugo von Hofmannsthals Mysterienspiel<br />
„Jedermann“ aufgeführt wird und wenn<br />
der Tod im Sterben des reichen Mannes<br />
hier nicht mehr als abstraktes Wesen, sondern<br />
als Personifikation auftritt und sein<br />
Ruf über die Köpfe der Menschen hinweg<br />
donnert, kann sich kaum einer dem Sog<br />
entziehen.<br />
Vier Jahre lang spielte der Schauspieler<br />
Ben Becker den Tod. Die Salzburger Nachrichten<br />
kommentierten dies nach der Ankündigung<br />
Beckers, diese Rolle künftig<br />
nicht mehr zu übernehmen, mit „Ben<br />
Becker pfeift auf den Tod“. Tod“ Aber so leicht<br />
scheint das – selbst im Spiel – nicht zu<br />
sein. Wenn man die Entscheidung des<br />
Schauspielers, sein klares Nein und die<br />
Feststellung „die Rolle als Tod hat mir zugesetzt“,<br />
bei der er im Interview Bewegung<br />
und Emotion durch das Vibrieren der<br />
Stimme nicht zu unterdrücken vermochte,<br />
dagegen setzt und die Worte, die er als Tod<br />
hilflos und doch zornig spricht „Es hilft<br />
kein Bitten und kein Beten“, dann ist zu<br />
erkennen, wie direkt die Kunst auf unser<br />
Innerstes, die Angst vor dem Unausweichlichen,<br />
zugreifen kann.<br />
Schon lange vorher befasste sich der junge<br />
Hugo von Hofmannsthal in dem Bruchstück<br />
„Der Tod des Tizian“ mit diesem<br />
Thema. Sohn, Schüler und Musen warten<br />
1576 angstvoll auf den Tod des neunundneunzigjährigen<br />
großen Malers und Desi-<br />
Der Tod und die Kunst<br />
Gedanken von Ingrid Pfuner<br />
derio, einer seiner Schüler, fasst das, was<br />
Kunst zu sein vermag, in die Worte<br />
„…Und hätte jeder nicht ein heimlich Bangen<br />
Von irgend etwas und ein still Verlangen<br />
Noch irgend etwas und Erregung viel<br />
Mit innrer Lichter buntem Farbenspiel<br />
Und irgend etwas, das zu kommen säumt,<br />
Wovon die Seele ihm phantastisch träumt,<br />
Und irgend etwas, das zu Ende geht,<br />
Wovon ein Schmerz verklärend ihn durchweht –<br />
So lebten wir in Dämmerung dahin,<br />
Und unser Leben hätte keinen Sinn…<br />
Die aber wie der Meister sind, die gehen,<br />
Und Schönheit wird und Sinn, wohin sie sehen.“<br />
Der damals erst achtzehnjährige Hoffmannsthal<br />
lässt Tizianello, den Sohn des<br />
Renaissancemalers, über seinen Vater sagen<br />
„… er lehrte uns, die Dinge sehen…“<br />
Weitsichtig erkannte er die Vergänglichkeit<br />
des Schaffenden und die Dauerhaftigkeit<br />
der Träume und der Hoffnung in dem<br />
Geschaffenen.<br />
Auch in der ‚jungen‘ Literatur wird ein<br />
Schriftsteller, der in Büchern, die ein Leben<br />
zwischen Krankheit und Tod erzählen<br />
und die Zerbrechlichkeit auch eines jungen<br />
Daseins zum Thema machen, zum<br />
Bestsellerautor. Aber – dem Zeitgeist entsprechend<br />
– gab der zum Kultautor erkorene<br />
Amerikaner John Green kürzlich kurz<br />
und bündig in einem Interview auf die<br />
Frage: „Wie stehen Sie zum Tod?“ die Antwort<br />
„Ich bin dagegen!“<br />
5
Ein schönes Bild setzt sich zusammen,<br />
wenn man einmal im oberbayerischen<br />
Murnau im Münter-Haus aus dem Fenster<br />
sieht, in dem die Künstlerin Gabriele<br />
Münter mit Wassily Kandinsky von 1909<br />
an fünf Jahre lang lebte und dann bis zum<br />
Lebensende arbeitete. In den letzten Jahren<br />
ihres Lebens, als sie das Haus nicht<br />
mehr so leicht verlassen konnte, ließ sie<br />
sich Blumen bringen, die an der Schwelle<br />
zum Verblühen waren, um die Schönheit<br />
der Vergänglichkeit zu malen. Man blickt<br />
über die Häuser des Ortes hinweg auf<br />
grüne Terrassen. Und wenn man das Haus<br />
verlässt, in dem Kunst und Leben eine so<br />
fruchtbare Symbiose eingingen (während<br />
des 3. Reiches war es ein offenes Haus<br />
auch für die Künstler, die eine Bleibe<br />
brauchten und im Keller überlebten zahlreiche<br />
Gemälde von Kandinsky den Krieg)<br />
und durch den Ort spaziert auf die andere<br />
Seite hinüber zu den grünen Terrassen,<br />
steht man auf dem Dorffriedhof. Gräberreihen<br />
ziehen sich durch grüne Hecken<br />
den Hügel hinauf. Man schaut, vor dem<br />
Grab stehend, in dem Gabriele Münter<br />
mit ihrem späteren Lebensgefährten liegt,<br />
eine schöne spätbarocke Kirche zur Rechten,<br />
wieder hinauf direkt zum Haus, nun<br />
von der anderen Seite. Damals wie heute<br />
Ben Becker als Tod in „Jedermann“ bei<br />
den Salzburger Festspielen<br />
6<br />
beherbergte das Haus die Kunst und die<br />
Künstler, die hier lebten und arbeiteten,<br />
und hält die Erinnerung wach an die<br />
Kreativität, die hier einen Platz fand. In<br />
Sichtweite liegt die letzte Heimstatt der<br />
Künstlerin – ein gerader, freier Blick bildet<br />
die Brücke zwischen Diesseits und Jenseits.<br />
Und hier können wir einen Bogen schlagen<br />
zum Beginn dieser Gedanken, denn<br />
dass der Tod, diese so schwer fassbare Endlichkeit<br />
allen Daseins, durch die Kunst<br />
auch zu einer lebendigen Unterstützung<br />
führen kann, das zeigt sehr schön die diesjährige<br />
„Jedermann“-Generalprobe. Am<br />
Ende des „Jedermann“ steht ja nicht mehr<br />
das Erkennen von Schuld und Versäumnis<br />
im Vordergrund, sondern die Versöhnung<br />
und die Zuversicht. Durch den Auftritt<br />
der Künstler ohne Gage bei dieser Generalprobe<br />
wurden über sechzigtausend Euro<br />
gesammelt für den Bau eines neuen Tageshospizes<br />
in Salzburg.<br />
Was bleibt?<br />
Die Frage, die wir uns im Laufe eines Lebens<br />
immer wieder stellen – wer kann sie<br />
schöner beantworten als die Schönheit<br />
und das Wissen in den Worten, den Tönen<br />
und dem Bild in der Kunst.
Sepulkralmuseum Kassel – Bestattungs-,<br />
Friedhofs- und Trauerkultur<br />
Von Uve Hirsch<br />
Es gibt zwei entscheidende Impulse für die Fortentwicklung der Kultur: Die Liebe - und<br />
den Tod. Dem Tod in all seinen Facetten widmet sich das Museum für Sepulkralkultur,<br />
das 1992 in Kassel eröffnet wurde.<br />
Heinrich der Löwe und seine Gattin Mathilde, Dom zu Braunschweig, 1240 – Sepulkralmuseum<br />
Sein Name leitet sich vom lateinischen sepulcrum ab und bedeutet Grab, Grabstätte. Das<br />
in Deutschland einzigartige Museum zeigt, wie sich Menschen früherer Zeiten mit dem<br />
Tod auseinandergesetzt und auf das Sterben vorbereitet haben. Wie Bestattungen vollzogen<br />
wurden und wie Trauer, aber auch Gedenken und Erinnerung Ausdruck fanden.<br />
Zum Beispiel Memento-mori-Objekte, Alltagsgegenstände, die an die irdische Endlichkeit<br />
erinnern und eine gottgefällige Lebensführung anmahnen. Außerdem sind Objekte<br />
ausgestellt, die eine wichtige Rolle in der Sterbestunde spielten, z. B. Sterbekreuze, Reliquien<br />
und Versehgarnituren.<br />
7
Totenschädel, Süddeutschland, 19.Jhdt. – Sepulkralmuseum<br />
Um Gräber neu belegen zu können, wurden die Gebeine ins Beinhaus (Karner) gebracht<br />
und die Schädel mit den Namen der Verstorbenen versehen.<br />
Aber auch Särge, Urnen und Leichenwagen, Trauerkleidung und Trauerschmuck, Totenkronen,<br />
Kranzkästen, Haarbilder und Sterbemedaillen gehören zu den Exponaten.<br />
8<br />
Modernes Graffiti im Sepulkralmuseum
Sarg in Gestalt eines Hahnes, Ghana 2000 –<br />
Sepulkralmuseum<br />
Außereuropäische Sepulkralkultur – Sepulkralmuseum<br />
9
Die Endlichkeit des Lebens mag auf den ersten Blick bedrückend sein, aber sie verleiht<br />
ihm auch seine unwiederbringliche Einmaligkeit. Wer das Museum besucht hat, wird an<br />
der Ausgangstür mit den Worten verabschiedet: Leben Sie wohl!<br />
Museum für Sepulkralkultur, Weinbergstr. 25-27, 34117 KASSEL<br />
www.sepulkralmuseum.de<br />
.sepulkralmuseum.de<br />
Fotos und Zusammenfassung: Uve Hirsch<br />
10<br />
Tod als Sensenmann, Airbrush<br />
Tod als Sensenmann, 1505
Ruhe sanft.<br />
Der Umgang mit Tod, Trauer und Gedenken<br />
Industriell gefertigte Grabskulptur<br />
Die Einstellung zum Tod hat sich<br />
gewandelt<br />
Was man heute noch in vielen südlichen<br />
Ländern sehen kann, nämlich Frauen in<br />
schwarzer Kleidung, war auch bei uns bis<br />
vor ca. 50 Jahren ganz normaler „grauer“<br />
Alltag. Man zeigte einfach, dass jemand<br />
Nahestehender verstorben war. Der Tod<br />
war präsenter – allgegenwärtiger. Kirchliche<br />
Lehre, Volksglaube und vor allem<br />
Beobachtungen, die auf Erfahrungen des<br />
Alltags basierten, prägten das Verhältnis<br />
des Menschen zum Tod. Die Konfrontation<br />
mit Sterben und Tod ist eine Grenzsituation,<br />
für die Menschen zu allen Zeiten<br />
verbindliche Handlungen geschaffen haben,<br />
um mit den damit verbundenen Gefühlen<br />
von Trauer, Angst, Unsicherheit<br />
Von Uve Hirsch<br />
Totenbretter im Sepulkralmuseum<br />
und Ratlosigkeit besser umgehen zu können.<br />
Sätze wie: „Die Beisetzung fand in aller<br />
Stille statt.“ oder: „Von Beileidsbezeugungen<br />
am Grabe bitten wir Abstand zu<br />
nehmen.“ findet man erst auf Traueranzeigen<br />
in heutiger Zeit. Damit verzichtet man<br />
aber bewusst auf Schutz und Stütze durch<br />
die Gemeinschaft.<br />
Richtiges Verhalten wurde früher<br />
„eingeübt“<br />
Nicht in die Hölle zu kommen, auch<br />
nicht übermäßig lange im Fegefeuer verharren<br />
zu müssen, war lebenslange Motivation<br />
für eine entsprechende Lebenshaltung,<br />
für Beichte und Buße. Hieraus<br />
entstanden unzählige Bilder, Sprüche und<br />
Gebete um einen „glückseligen“ Tod, mit<br />
11
der Möglichkeit, Ablass für sich oder die<br />
Armen Seelen zu erlangen, mit Verweis<br />
auf Joseph als Sterbepatron und auf Maria<br />
als ganz besondere Fürsprecherin, gewissermaßen<br />
eine gedruckte Lebenshilfe, die<br />
man täglich vor Augen hatte. Die große<br />
Bedeutung eines guten (richtigen) Sterbens<br />
und die Vorstellung von einem regelrechten<br />
Kampf zwischen Gottes Engeln<br />
und dem Teufel um die Seele des<br />
Sterbenden im Augenblick seines Todes<br />
führte zu etlichen Handlungen, die dem<br />
Sterbenden Hilfe und Erleichterung bringen<br />
sollte. Kirchliche Unterstützung sollte<br />
das Versehen der Sterbenden mit den<br />
Sterbesakramenten durch einen herbeigerufenen<br />
Priester bewirken. Das Versehgerät<br />
und evtl. auch das Versehtuch<br />
gehörten spätestens seit Mitte des 19.<br />
Jahrhunderts zu jedem katholischen<br />
Haushalt und waren meist Teil der Aussteuer<br />
oder bereits zur Kommunion geschenkt.<br />
Ein weiteres Indiz für die Präsenz<br />
des Todes während des Lebens. Nach<br />
Eintreten des Todes wird der Leichnam<br />
versorgt. Er wird gewaschen und aufgebahrt,<br />
bekommt Sterbekreuz und Rosenkranz<br />
in die gefalteten Hände, aber ab<br />
jetzt gehört er einer anderen Welt an, und<br />
die Gemeinschaft rückt zusammen in gemeinsamer<br />
Totenwache und etlichen<br />
Brauchhandlungen, nicht nur um den<br />
Toten zu seiner letzten Ruhe zu geleiten,<br />
sondern auch um die Lebenden vor den<br />
Toten zu schützen, die sich – so sie nicht<br />
sanft ruhen können – eventuell gegen sie<br />
wenden könnten (Leichenabwehr).<br />
12<br />
Ruhe sanft!<br />
Der mittelalterliche Friedhof kannte weder<br />
eine Grabmalkunst noch eine Heraushebung<br />
des Einzelgrabes. Vielerorts setzten<br />
diese erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts<br />
ein, sodass das 19. Jahrhundert schließlich<br />
ein Übermaß an Grabmalkunst hervorbrachte.<br />
Hierzu gehören Grabsteine, Kreuze,<br />
Grabgitter, Engel und eine symbolhafte<br />
Bepflanzung wie zum Beispiel die Trauerweide,<br />
die schnell auch in der Erinnerungskultur<br />
zum Sinnbild für Tod und<br />
Trauer wurde. Als sich das Familienleben<br />
im städtischen Bürgertum immer mehr<br />
der Öffentlichkeit entzog, und die Betonung<br />
des eigenen Heimes immer mehr<br />
Gewicht erlangte, verloren auch Tod und<br />
Sterben ihren öffentlichen Charakter,<br />
wurden gewissermaßen privatisiert und<br />
auf eine stärker familiäre Gefühlsebene<br />
verlagert. Dies leistete wiederum dem privaten<br />
Gedenken in den eigenen vier Wänden<br />
entsprechenden Vorschub. Und so ist<br />
es nicht verwunderlich, dass viele Totengedenken,<br />
ob als individuelle Haar-Arbeit<br />
oder als standardisierte Prägedrucke,<br />
Friedhofsmotive wie Grabstein, Urne oder<br />
Trauerweide aufweisen. Das öffentliche<br />
Denkmalzeichen wurde in klein in die<br />
gute Stube geholt. Sogenannte Kranzkästen,<br />
zunächst in Kirchen ausgestellt, wanderten<br />
ebenfalls in den Privatbereich ab.<br />
Nur die erst aus dem 19. Jahrhundert<br />
stammende Fotografie beschritt den Weg<br />
umgekehrt vom privaten Album auf das<br />
Grabmalmedaillon.
Schlingensief hat es getan. Die Stolpes haben<br />
es getan. Und auch Papst Johannes<br />
Paul II. hat es getan. Sie alle haben ihre<br />
Krankheit öffentlich gemacht. Wenn auch<br />
mit sehr unterschiedlichen Motiven.<br />
Die Publicity in Schach halten, darum<br />
ging es wahrscheinlich Manfred Stolpe<br />
und seiner Frau, als sie sich freiwillig zu<br />
Sandra Maischberger begaben, um öffentlich<br />
über ihre Krankheit zu sprechen.<br />
Sie wollten die Kontrolle behalten darüber,<br />
was Boulevard-Medien mit ihrem Leben<br />
veranstalten. Wenn schon Berichterstattung,<br />
dann besser gelenkte.<br />
Bei Papst Johannes Paul II., der im April<br />
2005 nach schwerer Parkinson-Erkran-<br />
Der Tod als Medium<br />
Von Christina Tilmann<br />
Vom öffentlichen Umgang mit Krankheit –<br />
eine kleine Kulturgeschichte des angekündigten Sterbens<br />
„Am Totenbett” –<br />
Der Schweizer Maler Ferdinand<br />
Hodler begleitete seine sterbende<br />
geliebte Valentine Gode-Darel.<br />
Foto: AKG<br />
kung unter weltweiter Anteilnahme starb,<br />
war das Motiv ein religiöses. Stellvertretendes<br />
Leiden als Nachfolger Christi, ein Opfertod,<br />
der an das notwendige Ende jedes<br />
Lebens erinnert – und an die Auferstehungsgewissheit<br />
des Christenmenschen.<br />
Mit dieser Botschaft hat der Papst der<br />
katholischen Kirche einen ungeahnten Popularitätsschub<br />
beschert.<br />
Christoph Schlingensief schließlich war<br />
getrieben von dem Wunsch, die Regie über<br />
das eigene Leben zu behalten. Und von<br />
dem Bewusstsein, dass in den Händen eines<br />
Künstlers auch das eigene Sterben zum<br />
Kunstwerk werden kann. Immer wieder<br />
neu hat er seine Krebserkrankung thematisiert:<br />
in dem Oratorium „Die Kirche der<br />
Angst vor dem Fremden in mir”, in der In-<br />
13
szenierung der „Heiligen Johanna” an der<br />
Deutschen Oper Berlin, in der Ready-<br />
Made-Oper „Mea Culpa” am Burgtheater<br />
und in seinem Krankheitstagebuch. Sterben<br />
als Chance für die Kunst – wenn sonst<br />
keine Chance mehr bleibt.<br />
Der Tod und die Kunst. Es ist eine mächtige<br />
Beziehung, von Anfang an. Seit den an<br />
die Vergänglichkeit gemahnenden Stillleben<br />
des Barock, seit den mittelalterlichen<br />
Totentänzen, von den unzähligen Kreuzigungsbildern<br />
gar nicht zu reden. Memento<br />
mori, gedenke, dass du sterblich bist, rufen<br />
diese Bilder in guter christlicher Tradition<br />
– und schwelgen oft in höchst realistischen<br />
Darstellungen. Die ausgemergelte Gestalt<br />
von Dürers Mutter kurz vor ihrem Tod,<br />
der „tote Christus” von Hans Holbein, der<br />
Isenheimer Altar von Mathias Grünewald,<br />
sie alle bedienen – auch – ein voyeuristisches<br />
Interesse, das erst in der höheren Idee<br />
der Vorläufigkeit alles körperlichen Seins<br />
aufgehoben wird. Dieser Aspekt fehlt zum<br />
Beispiel bei dem umstrittenen Präparator<br />
Gunter von Hagens, weshalb dessen Ausstellung<br />
der „Körperwelten” zu Recht immer<br />
wieder angegriffen wird.<br />
Zumal in der Medienwelt übt das letzte<br />
Tabu, der Tod, offenbar einen unwiderstehlichen<br />
Reiz aus. Wenn der Künstler<br />
Gregor Schneider vorschlägt, einen Todkranken<br />
mit dessen Zustimmung im Museum<br />
öffentlich sterben zu lassen, der Tod<br />
sozusagen als Kunstaktion, ist das, im Rahmen<br />
der Diskussion über öffentliche Sterbebegleitung,<br />
eine unerträgliche Provokation.<br />
Wenn Christoph Schlingensief eine<br />
baumgroße Lunge auf einer Opernbühne<br />
ausstellt – ist das Kunst?<br />
14<br />
Doch ist der Versuch, dem Tod mit künstlerischen<br />
Mitteln beizukommen, nicht von<br />
jeher ein Wesensmerkmal von Kunst gewesen?<br />
Denn ihr größtes Versprechen lautet,<br />
ähnlich wie das der Religion, dass da etwas<br />
ist, das größer ist, das länger hält als das<br />
Leben. Marcel Proust hat der lebenslangen<br />
Krankheit sein Roman-Meisterwerk „Auf<br />
der Suche nach der verlorenen Zeit“ abgetrotzt.<br />
Sterben und Schaffen. Die Beispiele aus<br />
der Kunst sind Legion. Maler wie Edvard<br />
Munch, Egon Schiele, Ferdinand Hodler<br />
oder Dante Gabriel Rossetti, die ihre Frauen,<br />
Geliebten oder Familienangehörigen<br />
auf dem Sterbebett malten, haben sie damit<br />
unsterblich gemacht und der eigenen<br />
Trauer ein Ventil gegeben. Friedrich Rückert<br />
hat seinen innerhalb weniger Wochen<br />
an Scharlach gestorbenen Kindern<br />
Ernst und Luise mit seinen „Kindertotenliedern”<br />
eine ergreifende Totenklage hinterhergeschickt.<br />
Brigitte Maria Meyer widmete<br />
Heiner Müller posthum ein<br />
wunderbares Fotobuch; der große Dramatiker,<br />
schmal und blass, mit seiner kleinen<br />
Tochter auf dem Arm. Und auch die Bilder,<br />
die die Fotografin Annie Leibovitz von<br />
ihrer Freundin Susan Sontag gemacht hat,<br />
nach deren Krebsoperation im Krankenhaus<br />
und zuletzt auf dem Totenbett, sind<br />
intime Begegnungen.<br />
Das künstlerische Begleiten des Sterbens<br />
eines geliebten Menschen ist Trauerarbeit,<br />
aus der großartige Kunst entstehen kann.<br />
Wer mit dem eigenen Sterben an die Öffentlichkeit<br />
geht, verfolgt oft andere Motive.<br />
Auch wenn es Künstler sind, die diesen<br />
Weg wählen. Jörg Immendorff, der an der
tödlichen Nervenkrankheit ALS litt, nutzte<br />
jede Gelegenheit, in Interviews über<br />
diese Krankheit zu sprechen – um eine<br />
bessere medizinische Erforschung der<br />
noch relativ unbekannten Krankheit zu erreichen.<br />
Der Schweizer Lehrer Fritz Angst,<br />
der 1976 im Alter von 32 Jahren an Krebs<br />
starb, schrieb unter dem Pseudonym Fritz<br />
Zorn sein Buch „Mars“, das zum Kultbuch<br />
wurde: eine wütende Abrechnung, nicht<br />
nur mit der eigenen Krebserkrankung,<br />
sondern mit der saturierten Zürcher Gesellschaft,<br />
die er für seine Erkrankung mitverantwortlich<br />
macht. Doch so ehrbar das<br />
Motiv auch sei, die medialen Begleiterscheinungen<br />
und Mechanismen sind die<br />
immer gleichen. Es ist ein Eindringen in<br />
einen Bereich, der Schutz und Intimität<br />
Albrecht Dürers Mutter – 1514<br />
verdient. Will ich, als Fernsehzuschauer,<br />
wirklich wissen, dass Schlingensief unter<br />
dem Eindruck seiner Erkrankung seiner<br />
Freundin versprochen hat, sie zu heiraten?<br />
Das öffentliche Interesse verdankt sich allein<br />
ihrer Prominenz. Was nichts daran ändert,<br />
dass der Tod in unserer Gesellschaft<br />
tabuisiert wird, dass Sterbende und Angehörige<br />
oft schmerzhaft erfahren, wie allein<br />
gelassen sie mit der fundamentalen Erfahrung<br />
sind, auf die niemand sie vorbereitet<br />
hat und von der niemand wirklich hören<br />
will. In der Erfahrung solcher Einsamkeit<br />
hilft dann die Kunst. Manchmal.<br />
Artikel im Berliner Tagesspiegel vom 23.4.2009,<br />
wir danken der Autorin<br />
15
Die Pforte ist per defintionem ein bewachter<br />
Eingang eines Klosters, eines Krankenhauses<br />
oder auch eines <strong>Hospiz</strong>es. Den<br />
Dienst an der Pforte des <strong>Christophorus</strong>-<br />
Hauses, die manchmal mehr, manchmal<br />
weniger stark frequentiert ist, versehe ich<br />
jetzt seit einem guten Jahr. Meine<br />
Freundinnen und Freunde reagierten mit<br />
Verwunderung und Erstaunen auf meine<br />
Entscheidung, diese Stelle als Krankheitsvertretung<br />
zu übernehmen. Bei der Frage<br />
nach dem Beruf antwortet man auch eher<br />
verhalten als beherzt – „Pförtner“. In Zeiten,<br />
in denen ein Hausmeister zum Facility<br />
Manager mutiert, klingt Pförtner doch<br />
gelinde gesagt banal. Alternative Bezeichnungen<br />
wie Rezeptionist, Portier oder<br />
Concierge werten den Berufsstand nicht<br />
signifikant auf, wobei der französische<br />
Begriff Concierge dem vulgärlateinischen<br />
Wort conservus (= Mitsklave) entlehnt ist.<br />
Doch schrauben wir den Empfang nicht<br />
16<br />
Die Pforte<br />
Von Heinz Biersack<br />
auf ein Sklavenniveau herunter, denn das<br />
entspricht nicht dem Charakter dieser<br />
Tätigkeit.<br />
Der Empfang ist die erste Schnittstelle mit<br />
dem CHV. Jeder weiß aus eigener Erfahrung,<br />
der erste Eindruck zählt. Läuft bei<br />
dieser relevanten Schnittstelle etwas schief,<br />
ist der Schaden nur noch schwer zu beheben.<br />
Es ist wichtig, den Besuchern des<br />
Hauses das Gefühl zu vermitteln, erwartet<br />
und willkommen zu sein. Abgesehen von<br />
dieser Funktion, repräsentiert der Empfang<br />
die Corporate Identity des <strong>Verein</strong>s,<br />
d.h. konkret, er muss den Charakter der<br />
Einrichtung widerspiegeln. Neben der<br />
Schnittstelle zwischen Besucher bzw. Anrufer<br />
und CHV, ist der Empfang auch<br />
Schnittstelle zwischen allen anderen Abteilungen<br />
im Haus. Die Aufgaben des Empfangs<br />
werden sehr gut mit den verschiedenen<br />
Bedeutungen des lateinischen Verbs<br />
recipere, recipere vom dem sich das Wort Rezeption<br />
ableitet, definiert: aufnehmen, zurücknehmen,<br />
retten, versprechen, zurückziehen,<br />
annehmen, erobern, gestatten, vorbehalten,<br />
zurückerhalten.<br />
Leider ist die Pforte des <strong>Christophorus</strong><br />
Hauses – nicht zuletzt wegen der Milchglasscheiben<br />
– etwas unauffällig – „Entschuldigung,<br />
ich habe sie übersehen“.<br />
Immer wieder stürmen ortsunkundige Besucher<br />
am Empfang vorbei und stehen anschließend<br />
desorientiert im stationären Bereich<br />
oder in der Verwaltung. Besonders<br />
schwierig ist die Situation an jedem letzten<br />
Mittwoch des Monats, an dem zahlreiche
Besucher zur Informationsveranstaltung<br />
zum Thema Patientenverfügung ins Haus<br />
kommen. Trotz der Hinweisschilder verirren<br />
sich immer wieder einige Interessierte<br />
in den Gängen und wenden sich anschließend<br />
hilfesuchend an Mitarbeiter/innen<br />
des Hauses. Einem Zirkusdirektor gleich<br />
versuche ich die Scharen in den richtigen<br />
Raum zu lotsen und feiere es als Erfolg,<br />
wenn dies ohne Komplikationen gelingt.<br />
Viele Besucher, die zum ersten Mal in<br />
das <strong>Christophorus</strong>-Haus kommen, nähern<br />
sich eher vorsichtig und bleiben einen<br />
Augenblick vor der Türe stehen ehe sie eintreten:<br />
Noch einmal Luft holen, noch eine<br />
Zigarette rauchen, Ängste, Hemmschwellen<br />
überwinden. Bisweilen spüre ich ihre<br />
Nervosität, wenn sie mir an der Pforte ihr<br />
Anliegen vortragen – wer kann dies nicht<br />
verstehen in Anbetracht der Not, die sie<br />
oft zu uns führt. Ausdruck der Nervosität<br />
ist auch das häufig zu beobachtende Phänomen<br />
der Überpünktlichkeit bei Terminen<br />
für das Aufnahmeteam im stationären<br />
Bereich, die oft identisch begründet wird:<br />
„Ich wusste nicht, ob ich einen Parkplatz<br />
finden werde“. Doch schnell legt sich die<br />
Spannung, denn jeder spürt, dies ist ein<br />
ganz „normaler“, heller und freundlicher<br />
Ort, kein fremdes, unwirtliches Terrain:<br />
„Mein Gott ist das toll hier, auch schon<br />
von außen“.<br />
Die eingehenden Anrufe sind in erster<br />
Linie Anfragen für den ambulanten oder<br />
stationären Bereich. Periodenweise häufen<br />
sich aber auch Fragen zum Thema Patientenverfügung<br />
und Vorsorgevollmacht, wobei<br />
spezifisch rechtliche Fragen an Herrn<br />
Heßdörfer weitergeleitet werden, der sich<br />
seit vielen Jahren in dieser Sache ehren-<br />
amtlich für den CHV engagiert. Da das<br />
<strong>Hospiz</strong> keine Institution ist, mit der sich<br />
immer klare Vorstellungen verbinden, tasten<br />
sich einige Anrufer erst langsam vor<br />
und artikulieren ihr Anliegen entsprechend<br />
diffus: „Sie müssen wissen, ich kenne<br />
mich da nicht so aus“. Aus diesem<br />
Grund bedarf es bisweilen großer Phantasie<br />
und Geduld, um das eigentliche Anliegen<br />
zu verstehen.<br />
Andere Anrufer sehen im <strong>Hospiz</strong> eine Instanz,<br />
die für alle schwierigen Fragen im<br />
Kontext Leben und Tod zuständig ist:<br />
„Ich habe da eine Frage, die ist in gewisser<br />
Weise nicht alltäglich ...“. Eine immer<br />
wiederkehrende Frage ist dabei die<br />
Checkliste für die letzten Tage und Stunden‚<br />
die muss es doch geben! Eine Anruferin<br />
will für den eventuellen Fall eines<br />
komatösen Zustandes Vorsorge treffen<br />
und überlegt, welche Musik sie dann hören<br />
und welche Düfte sie riechen möchte.<br />
Eine rüstige Seniorin trägt sich mit dem<br />
Gedanken bei uns einzuziehen, da sie gerne<br />
etwas mehr Kontakt hätte: „Meine<br />
Freundinnen sind jetzt auch alle weggezogen“.<br />
Knifflige Fragen und Anliegen üben<br />
immer einen besonders großen Reiz aus,<br />
sind sie doch das Salz in der Suppe der alltäglichen<br />
Routine.<br />
Nein, der „Pförtnerdienst“ im <strong>Christophorus</strong>-Haus<br />
ist – von manch ruhigen<br />
Nachmittagen abgesehen – eine äußerst<br />
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem<br />
sehr kollegialen Arbeitsumfeld. Darüber<br />
hinaus gibt es für diesen Dienst große<br />
Vorbilder: Konrad von Parzham hat es als<br />
Pförtner seines Klosters in Altötting bis<br />
zur Heiligkeit gebracht – wenn das kein<br />
Ansporn ist.<br />
17
„Bist Du da, wenn es soweit ist?“<br />
Eine Frage, die Verantwortung aufbürdet.<br />
Wird das Sterben leichter, wenn die<br />
Angst davor mitgeteilt werden kann? Wie<br />
die Tage, die Zeit, die noch bleibt, füllen,<br />
gestalten, wertvoll machen?<br />
Jede neue Begleitung ist eine neue Herausforderung.<br />
Die Erwartungen an den<br />
<strong>Hospiz</strong>helfer sind groß, besonders, wenn<br />
die Angehörigen den nahen Tod, den<br />
bevorstehenden Verlust verdrängen wollen.<br />
Alleingelassen mit seinen Depressionen,<br />
Alpträumen und Erinnerungen, der<br />
Furcht vor dem Ungewissen, den Schmerzen<br />
und dem Bewusstsein, es geht zu Ende,<br />
bringen dem Todkranken die Stunden mit<br />
dem Begleiter aus dem <strong>Hospiz</strong> oft die einzigen<br />
Momente der Erleichterung.<br />
„Der Tod gehört zum Leben“, –<br />
ein unglaublicher Satz, wenn ihn ein<br />
Mensch, der stirbt ausspricht. Das Unabänderliche<br />
akzeptieren, „das Beste daraus<br />
machen“ – das wollte Traudl S. in ihren<br />
18<br />
Der Tod gehört zum Leben<br />
Von Uve Hirsch<br />
letzten Lebensmonaten. Sie spürte „es<br />
geht nicht mehr lang“, soviel war noch zu<br />
klären und zu ordnen. Mit der Vergangenheit<br />
abschließen, der Flucht aus Breslau<br />
nach München, dem längst verstorbenen,<br />
ständig untreuen Ehemann, den<br />
wenigen noch verbliebenen Bekannten<br />
und Freunden. Für mich, der sie über<br />
zwei Jahre lang als <strong>Hospiz</strong>helfer begleitet<br />
hatte, ein beklemmendes Gefühl, mit<br />
Traudl beim Steinmetz ihren Grabstein<br />
auszusuchen, im Friedhofsamt die Grabstelle<br />
auszuwählen und beim Bestattungsdienst<br />
den Sarg, Blumenschmuck, Musik,<br />
Trauerkarten, die Beerdigungszeremonie<br />
zu bestellen und gleich zu bezahlen. Mit<br />
derselben Geschäftigkeit, mit der sie<br />
früher im Supermarkt einkaufte, wollte<br />
sie<br />
„dass alles geregelt ist“.<br />
„Ich will Niemandem zur Last fallen“<br />
wiederholte sie ständig.<br />
Wir hatten viel unternommen miteinander<br />
bei meinen Besuchen. Musik war<br />
Traudls Leidenschaft. Von einem uralten,<br />
krächzenden Grammophon hörten wir Elvis<br />
Presley und die Beatles, aber auch Carmina<br />
Burana oder die Zauberflöte.<br />
Es gelang mir mit dem Hinweis, einer<br />
85jährigen, todkranken alten Dame einen<br />
letzten Wunsch erfüllen zu wollen, Karten<br />
für die ständig ausverkaufte Johann-<br />
Strauß-Operette Fledermaus zu ergattern.<br />
Selbst eine Fahrt mit dem Rollator im<br />
Riesenrad auf dem Oktoberfest war noch
möglich. Erstaunlich, zu welchen Anstrengungen<br />
Traudl fähig war, die sonst oft<br />
tagelang, vollgepumpt mit Schmerz- und<br />
Beruhigungsmitteln, im Bett lag.<br />
„Warum machst du das?“<br />
hat sie mich oft gefragt. Sie konnte nur<br />
schwer begreifen, dass ihre Freude, ihr<br />
Mut, ihre Lebenslust mir immer wieder<br />
Bild Seite 18 und 19: Alter Friedhof in Arolsen (Hessen)<br />
Erfolgserlebnisse brachten, für die ich ihr<br />
bis heute dankbar bin.<br />
Mit dem Bewusstsein, der Tod gehört zum<br />
Leben, konnte Traudl S., als es soweit war,<br />
ohne Klagen Abschied nehmen. Und sie<br />
bleibt mir als Vorbild in Erinnerung, wie<br />
auch die letzten Tage unseres Daseins sinnvoll<br />
und würdig gestaltet werden können.<br />
19
Und wenn du auch dreitausend Jahre<br />
lebtest, so bedenke doch, dass du nur das<br />
Leben verlierst, das du gerade im jetzigen<br />
Moment lebst; das längste Leben ist mit<br />
dem kürzesten im Angesicht des Todes<br />
vollkommen gleich.<br />
Der gegenwärtige Zeitpunkt ist für alle<br />
von gleicher Dauer, wie ungleich auch immer<br />
die Vergangenheit gewesen sein mag.<br />
Mit dem Tod verlierst du nur den jetzigen<br />
Augenblick.<br />
Niemand kann die Vergangenheit oder die<br />
Zukunft verlieren, denn wie sollte man<br />
ihm das rauben können, was er nicht besitzt?<br />
20<br />
Marc Aurel –<br />
Büste in Rom<br />
Marc Aurel – Selbstbetrachtungen<br />
Man muss sich also diese beiden Wahrheiten<br />
merken:<br />
Die eine, dass sich alles im ewigen Kreislauf<br />
befindet, und dass es keine Bedeutung<br />
für unser Leben hat, dieselben Dinge immer<br />
und immer wieder zu erleben.<br />
Die andere, dass der im höchsten Lebensalter<br />
und der sehr jung Sterbende das<br />
Gleiche verlieren: Sie verlieren nur den<br />
gegenwärtigen Zeitpunkt, weil sie nur diesen<br />
allein besitzen, und weil man das, was<br />
man nicht besitzt, nicht verlieren kann.<br />
Zweites Buch, 14. Kapitel
Hieronymus Bosch – Der Flug zum Himmel<br />
Das Bild beschreibt die Himmelfahrt der<br />
Verstorbenen als eine Vision himmlischer<br />
Freude. Die Seelen der Toten entledigen<br />
sich ihrer sterblichen Hüllen, und die von<br />
göttlicher Gnade gesegneten Seelen schweben<br />
durch die Nacht dem Licht entgegen.<br />
Begleitet und geführt werden sie von zwei<br />
Engeln und voller Sehnsucht blicken sie<br />
aufwärts.<br />
Der Tod wird hier als Tunnel aus Licht<br />
symbolisiert, an dessen Ende vertraute Wesen<br />
aus Licht warten.<br />
Hieronymus Bosch:<br />
Der Flug zum Himmel, 1500-1504.<br />
Bildquelle: http://de.wikipedia.org/w/index.<br />
21
Seit ihren Anfängen haben alle Hochkulturen<br />
den Tod zu ihrem Thema gemacht,<br />
seiner Erklärung und Gestaltung größte<br />
produktive Kräfte gewidmet. Schon<br />
früh, im alten Ägypten etwa, verwandte<br />
man Phantasie und Mühe darauf, die<br />
Rohheit des Sterbens durch Riten zu<br />
mildern, die Endgültigkeit des Todes<br />
durch die Hoffnung auf ein Danach in<br />
Frage zu stellen. Das Bild war an diesem<br />
Prozess kultureller Sublimierung von Anfang<br />
an beteiligt. Totenbilder und Bilder<br />
für den Tod gehören zu den ältesten<br />
künstlerischen Zeugnissen, die wir besitzen.<br />
Die Frage nach den Anfängen realistischer<br />
Totendarstellung führt uns in die<br />
Epoche der Renaissance. Um das Jahr<br />
1500 entdeckten Künstler wie Leonardo<br />
da Vinci und Albrecht Dürer in der Anatomie<br />
eine der Grundlagen der bildenden<br />
Kunst. Das genaue Studium des<br />
menschlichen Körpers, wie es nur die damals<br />
noch heftig umstrittene Sektion<br />
von Leichnamen ermöglichte, setzte<br />
neue Maßstäbe für den Schönheitskanon<br />
der Künste; es beeinflusste etwa die Proportionslehre<br />
und die Aktdarstellung der<br />
beginnenden Neuzeit.<br />
Zum wichtigsten Träger von Totenporträts<br />
wurde in der westlichen Kunsttradition<br />
das plastische Grabmal. Schon die<br />
Etrusker setzten lebensgroße Porträtstatuen<br />
auf Sarkophage, um spätere Generationen<br />
an ihre verstorbenen Vorfahren zu<br />
22<br />
Totenbilder, Thema aller Hochkulturen<br />
Von Andreas Tönnesmann<br />
erinnern. In der christlichen Kultur fanden<br />
anspruchsvolle Grabmäler bis ins 19.<br />
Jahrhundert meist in Kirchen, seltener<br />
auf Friedhöfen Platz. Auf diese Weise<br />
standen sie den Gläubigen ständig vor<br />
Augen und regten zu liturgischem Gebet<br />
für die Seelen an. In Mittelalter und früher<br />
Neuzeit hatte das Grabmal darüber<br />
hinaus repräsentative Aufgaben zu erfüllen<br />
– es garantiert nicht nur die geistliche,<br />
sondern auch die weltliche ,memoria‘<br />
der Toten. Aus entsprechenden<br />
Rücksichtnahmen erklärt sich, weshalb<br />
die Liegefiguren, die fast immer zum<br />
Aldo Rossi, Friedhof San Cataldo in Modena,<br />
erbaut 1972-1984<br />
Grabmal gehören, in aller Regel eher<br />
Schlafende als Tote zu zeigen scheinen.<br />
Gleichwohl ist der Tod auch für viele<br />
moderne Künstler eines der großen, herausfordernden<br />
Themen geblieben. 1971<br />
schrieb die Stadt Modena in Norditalien<br />
einen landesweiten Wettbewerb für die<br />
Erweiterung ihres alten Friedhofes aus.<br />
Den Auftrag erhielt der Mailänder Archi-
tekt Aldo Rossi (1931-1997), einer der<br />
einflussreichsten Baugestalter und Architekturtheoretiker<br />
seiner Generation. Er<br />
fand für die neue Friedhofsanlage eine<br />
ebenso karge wie sinnlich beeindruckende<br />
Form. Der geometrisch streng kalkulierte<br />
Grundriss gleicht in der rippenförmigen<br />
Ordnung der Bauzeilen einem<br />
menschlichen Skelett. Funktionales<br />
Grundelement sind in vielfacher Wieder-<br />
holung langgezogene, mehrstöckige Totenhäuser,<br />
in deren Wände nach italienischer<br />
– letztlich antiker – Tradition unzählige<br />
Grabkammern eingelassen sind.<br />
Der Verfasser, Dr. phil. Andreas Tönnesmann ist<br />
ordentlicher Professor für Kunst- und Architekturgeschichte<br />
an der Eidgenössischen Technischen<br />
Hochschule Zürich.<br />
San Cataldo – Innenansicht<br />
23
28. April 2012<br />
Zweimal in der Woche besuche ich Frau B.<br />
in einem Altenheim in München, sie ist<br />
krebskrank im fortgeschrittenen Stadium.<br />
Kurz bevor ich aufbrechen möchte, kommt<br />
eine Schwester, um sie mit dem Rollstuhl<br />
in den Speisesaal zu bringen. Da ich noch<br />
Zeit habe, begleite ich Frau B. dorthin. Der<br />
Rollstuhl wird an einen Tisch geschoben,<br />
an dem schon Frau G. sitzt. Ich kenne Frau<br />
G. und habe einmal miterlebt, wie sie im<br />
ganzen Haus gesucht wurde. Ich hole mir<br />
einen Stuhl vom Nachbartisch und setze<br />
mich zu den beiden Frauen.<br />
Auf dem Tisch stehen zwei Gläser und ein<br />
Krug mit Saft.<br />
Die Schwester bringt für die beiden Frauen<br />
eine Schüssel mit Brei. Sie fragt mich,<br />
ob ich auch Brei haben wolle. Ich verneine.<br />
Frau G. will aufstehen. Die Schwester ruft<br />
ihr zu: „Frau G., bleiben Sie doch sitzen,<br />
bis Sie aufgegessen haben!“ Frau G. setzt<br />
sich widerspruchslos wieder hin.<br />
Die Schwester bringt mir ein Glas und<br />
einen Teller mit Schwarzbrot und Butter.<br />
Frau G. schaut sehnsüchtig auf meinen<br />
Teller. Ich lege zwei Butterbrotstücke auf<br />
ihren Teller, dann proste ich meinen beiden<br />
Tischnachbarinnen zu. Frau B. hebt<br />
ihr Glas und sagt „zum Wohl“ – Frau G.<br />
nimmt eines der beiden Brotstücke und<br />
stößt damit an.<br />
24<br />
<strong>Hospiz</strong>helfer-Tagebuch<br />
Von Elisabeth Hofmann<br />
Frau G. will wieder aufstehen. Ich sage:<br />
„Bleiben Sie doch bei uns, allein schmeckt<br />
es uns nicht“. Frau G. setzt sich wieder<br />
hin.<br />
Frau B. hat etwas von dem Brei an die<br />
Backe geschmiert. Ich gebe ihr eine der<br />
zwei Papierservietten, die auf dem Tisch<br />
liegen. Sie zerteilt die Serviette in kleine<br />
Stücke, die sie fein säuberlich neben der<br />
Breischüssel aufreiht. Ich sage zu Frau B.<br />
„Sie müssen nicht sparen, sie können ruhig<br />
die ganze Serviette nehmen“.<br />
Nach einer Zeit sehe ich, dass bei Frau B.<br />
etwas Weißes aus dem Mundwinkel hängt.<br />
Plötzlich realisiere ich, dass die ganze<br />
Papierserviette stückchenweise im Mund<br />
verschwunden ist. Schnell nehme ich die<br />
zweite Serviette, die noch auf dem Tisch<br />
liegt, an mich.<br />
Ich verabschiede mich von Frau B. und<br />
Frau G. und bedanke mich bei der<br />
Schwester.<br />
Ich hoffe, dass Frau B. die Papierserviette<br />
problemlos verdaut hat und dass Frau G.<br />
noch einige Zeit am Tisch sitzengeblieben<br />
ist.<br />
Meine Hochachtung vor dem Pflegepersonal<br />
ist nochmals gestiegen.
1. Mai 2012<br />
Ich werde von der Familie angerufen, dass<br />
Frau B. gestorben sei.<br />
Mit einem Strauß Flieder fahre ich in das<br />
Heim, um von Frau B. Abschied zu nehmen.<br />
Das Zimmer von Frau B. wird für<br />
mich aufgeschlossen. Ich stelle meinen<br />
Flieder in dem Marme<strong>laden</strong>glas, das ich<br />
von zuhause mitgebracht hatte, auf das<br />
Nachtkästchen. Frau B. ist mit einer<br />
schwarz-weißen Bluse bekleidet. Die Hände<br />
liegen unter der Bettdecke – alles ist<br />
sauber und ordentlich.<br />
Während ich am Bett von Frau B. sitze,<br />
klopft es. Es ist Herr Z., der junge Stationsleiter:<br />
„Die Herren vom Bestattungsdienst<br />
sind da“. Herr Z. will Platz für den<br />
Sarg schaffen und wirft dabei das Telefon<br />
vom Nachtkästchen. Die Batterien kullern<br />
unter das Bett. Herr Z. entschuldigt sich:<br />
„Ich vertrag das nicht“. Er verlässt rasch<br />
das Zimmer.<br />
Die beiden Bestatter sind sehr freundlich,<br />
sie halten mich für eine Angehörige. Ich<br />
sage, dass ich eine <strong>Hospiz</strong>helferin sei. Sie<br />
ziehen Frau B. ein weißes Spitzenhemd an<br />
und fahren ihr mit einem Kamm durch die<br />
Haare. Geschickt nehmen sie der Verstorbenen<br />
die Ohrringe und den Ehering ab.<br />
Ich gebe Frau B. einen Fliederzweig in die<br />
Hand und mache ein Foto von den Händen.<br />
Die Bestatter geben mir den Schmuck<br />
der Verstorbenen und verabschieden sich<br />
freundlich.<br />
Ich hebe die Teile des Telefons und die Batterien<br />
vom Boden auf und setze das Telefon<br />
wieder zusammen. Es funktioniert<br />
noch.<br />
Auf dem Gang treffe ich Herrn Z. und händige<br />
ihm den Schmuck von Frau B. aus.<br />
Herr Z. sagt: „Ich weiß, dass das Sterben zu<br />
unserem Beruf gehört – aber ich kann das<br />
nicht sehen, das gelbe Gesicht …“. Ich versuche<br />
ihn zu trösten und erzähle ihm von<br />
meiner ersten Begegnung mit einer Sterbenden.<br />
Ich frage nach seinem Alter – er ist<br />
26. Ich bin 76 – da habe ich einen Vorsprung<br />
von 50 Jahren.<br />
Später schicke ich den Angehörigen das<br />
Foto der Verstorbenen mit dem Fliederzweig<br />
in den Händen.<br />
25
Bereichert …<br />
Um eine ganz besondere Erfahrung wurde<br />
ich in den 22 Wochen beim <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> bereichert.<br />
Nachdem ich im Herbst vor zwei Jahren<br />
begonnen hatte, „Soziale Arbeit“ an der<br />
Katholischen Stiftungsfachhochschule zu<br />
studieren, war es an der Zeit, mein Praxissemester<br />
zu absolvieren. Gar nicht so<br />
leicht, sich für einen Bereich zu entscheiden,<br />
da es im gesamten Studium nur eine<br />
einzige Möglichkeit gibt, Praxiserfahrung<br />
zu sammeln. Meine ursprüngliche Planung,<br />
diese Zeit im Ausland zu verbringen,<br />
hatte nicht geklappt und im Nachhinein<br />
denke ich, dass das wohl so sein<br />
sollte und auch gut so war ...<br />
Seit Januar 2009 arbeite ich in Großhadern<br />
auf der Palliativstation und es gefällt<br />
mir dort ausnehmend gut. Jeden Tag<br />
lernt man unglaubliche Menschen kennen<br />
und jeden Tag darf ich für mein weiteres<br />
Leben dazulernen. So habe ich mich gefragt,<br />
ob ich in diesem Bereich, in dem ich<br />
gerne auch nach meinem Studium tätig<br />
sein würde, meinen Horizont erweitern<br />
möchte oder ob ich doch lieber das Praktikum<br />
nutzen sollte, ganz neue Erfahrungen<br />
zu sammeln. Aus diversen Gründen<br />
habe ich mich für die erste Option entschieden.<br />
Für mich war es spannend, die Menschen<br />
zu treffen, mit denen ich zuvor das ein<br />
26<br />
Ein Praktikum im CHV<br />
Von Anja Beckendorf<br />
oder andere Mal telefoniert hatte, wenn es<br />
z.B. um die Verlegung eines Patienten in<br />
das <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> ging. Aufregend,<br />
eine ganz neue Seite des Palliativbereiches<br />
kennenzulernen. Je näher der erste<br />
Tag rückte, desto mehr bibberte ich jedoch<br />
auch, ob ich mich mit den Leuten verstehen<br />
würde und ob ich ihre Erwartungen<br />
erfüllen könne. Natürlich wollte ich nicht<br />
als „Kollegin“ versagen.<br />
Doch bereits am ersten Tag waren diese<br />
Sorgen passé. Alle begrüßten mich so herzlich<br />
und offen, niemand gab mir das Gefühl<br />
„nur“ Praktikantin zu sein. Dies hat<br />
sich durch die kompletten Monate durchgezogen<br />
und nahm viel Druck von mir.<br />
Nach lediglich einem halben Jahr als Praktikantin<br />
hatte ich das Gefühl, „mein“<br />
Team verlassen zu müssen.<br />
Obwohl ich drei Jahre im selben Bereich<br />
tätig gewesen war, stellte der ambulante<br />
Bereich überraschend viel Neuland für<br />
mich dar. Ich sah mich ganz neuen Herausforderungen<br />
gegenüber, über die ich<br />
mir zuvor gar keine Gedanken gemacht<br />
hatte. Im Krankenhaus konnte ich stets<br />
alle Hilfsmittel oder helfenden Hände vor<br />
Ort nutzen sobald ich sie brauchte. Dies<br />
war nun völlig anders. Ich bewundere die<br />
Kreativität und die Flexibilität, die in diesem<br />
Bereich eingebracht werden müssen.<br />
Dies gilt sowohl für die haupt-, als auch<br />
für die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen.<br />
Jeden Tag habe ich es aufs Neue genossen,<br />
Menschen und ihre Lebenssituationen
kennenzulernen. Schließlich ist es nicht<br />
selbstverständlich, jemanden in seinem<br />
ganz persönlichen Zufluchtsort – seiner<br />
Wohnung – begegnen zu dürfen. Und<br />
doch denke ich, dass gerade dies die Arbeit<br />
so besonders und wertvoll macht: Erfahrungen<br />
teilen zu dürfen und Menschen<br />
auf ihrem Weg unterstützen zu können.<br />
Dies gilt aber nicht nur für die kranken<br />
Menschen und ihre Zugehörigen, sondern<br />
ebenso für die <strong>Hospiz</strong>helfer/innen, die<br />
sich aus unterschiedlichsten Beweggründen<br />
für dieses Ehrenamt beim CHV entschieden<br />
haben. Auch diesbezüglich werde<br />
ich einige Geschichten in Erinnerung<br />
behalten.<br />
Die Zeit meines Praktikums war eine sehr<br />
bewegte für den <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong>.<br />
Personelle Veränderungen, Krankheit<br />
und Versterben von geschätzten Menschen,<br />
aber auch freudige Ereignisse, prägten die<br />
Wochen. Auch in diesem Zusammenhang<br />
erlebte ich es als bewegend, wie wertschätzend<br />
alle miteinander umgingen, auch wenn<br />
die Grenzen das ein oder andere Mal mit<br />
Sicherheit erreicht waren.<br />
Für dies alles ein ganz, ganz liebes Dankeschön.<br />
Ich hatte eine wunderbare Zeit<br />
beim CHV und werde sehr viel für mein<br />
weiteres Leben mitnehmen.<br />
Krankenzimmer im <strong>Hospiz</strong><br />
27
28<br />
Sterben in Deutschland –<br />
Wissen und Einstellungen zum Sterben<br />
Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung des DHPV<br />
Wo steht unsere Gesellschaft rund 30 Jahre<br />
nach dem Beginn der <strong>Hospiz</strong>bewegung<br />
und der Entwicklung der Palliativmedizin<br />
in Deutschland? In wieweit setzen sich die<br />
Menschen mit Sterben und Tod auseinander?<br />
Was wissen sie über <strong>Hospiz</strong>? Und was<br />
bedeutet das für ihr eigenes Sterben?<br />
Immerhin geben 39% der Befragten an,<br />
dass Sterben und Tod in ihrem persönlichen<br />
Umfeld eine große bis sehr große<br />
Rolle spielt. Das ist nahezu jeder zweite der<br />
Befragten. 83% haben bereits Erfahrung<br />
mit dem Sterben eines nahestehenden<br />
Menschen gemacht. 54%, also ebenfalls<br />
mehr als die Hälfte der Befragten, geben<br />
an, sich über das eigene Sterben häufig<br />
bzw. ab und zu Gedanken gemacht zu haben.<br />
Dies variiert innerhalb der Altersgruppen,<br />
aber bereits junge Menschen zwischen<br />
18 und 29 Jahren bestätigen dies zu<br />
48%. D.h., Menschen werden in ihrem<br />
Alltag, ihren Familien und in ihrem Beruf<br />
mit Sterben und Tod konfrontiert. Dem-<br />
gegenüber steht die Auseinandersetzung in<br />
der Gesellschaft, die von vielen Menschen<br />
bei weitem nicht als ausreichend empfunden<br />
wird. Mehr als die Hälfte, das sind<br />
58% der Befragten, gibt an, dass sich die<br />
Gesellschaft mit dem Thema zu wenig befasst.<br />
Das heißt, den konkreten, individuellen<br />
Erfahrungen der einzelnen Menschen<br />
steht die weitgehende Sprachlosigkeit innerhalb<br />
der Gesellschaft gegenüber.<br />
Gefragt danach, wo sie sterben wollen, geben<br />
66% der Befragten, die sich bereits<br />
über ihr eigenes Sterben Gedanken gemacht<br />
haben, an, zuhause sterben zu wollen,<br />
18% sagen, dass sie in einer Einrichtung<br />
zur Betreuung schwerstkranker und<br />
sterbender Menschen sterben wollen. Die<br />
Zahlen belegen, was im <strong>Hospiz</strong>- und Palliativbereich<br />
bereits als Erfahrungswissen<br />
weitergegeben wird: Der überwiegende<br />
Teil der Bevölkerung möchte zuhause<br />
sterben.
89% der Befragten geben an, vom Begriff<br />
<strong>Hospiz</strong> gehört zu haben und 66% können<br />
den Begriff richtig einordnen. Diese Ergebnisse<br />
bestätigen den hohen Bekanntheitsgrad<br />
der <strong>Hospiz</strong>bewegung. Ca.<br />
80.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich<br />
in diesem Bereich, die damit auch<br />
ihr persönliches Umfeld mit dem Thema<br />
in Berührung bringen.<br />
Das Abfassen einer Patientenverfügung ist<br />
ein wichtiges Thema in unserer Bevölkerung:<br />
26% der Befragten haben eine Patientenverfügung<br />
verfasst, 43% haben schon einmal<br />
ernsthaft darüber nachgedacht.<br />
Sowohl beim Abfassen der Patientenverfügung<br />
als auch bei der ernsthaften Auseinandersetzung<br />
mit einer solchen spielt das<br />
Lebensalter eine wesentliche Rolle: So haben<br />
42% der Menschen über 60 Jahre eine<br />
Patientenverfügung und 52% der 50 bis<br />
59-Jährigen bzw. 43% der über 60-jährigen<br />
Menschen haben ernsthaft darüber<br />
nachgedacht. Diese Ergebnisse sind auch<br />
deshalb von Bedeutung, weil die Auseinandersetzung<br />
mit diesen Fragen zugleich<br />
den Dialog in unserer Gesellschaft über<br />
Leben und Tod fördert.<br />
Die Befragten würden sich bei der Suche<br />
nach einem Platz in einer Palliativeinrichtung<br />
bzw. <strong>Hospiz</strong>einrichtung am häufigsten<br />
an ihre Hausärztin / ihren Hausarzt<br />
wenden.<br />
Den Hausärzten kommt nach wie vor eine<br />
entscheidende Rolle bei der Betreuung ihrer<br />
Patientinnen und Patienten in dieser<br />
29
letzten Lebensphase zu. In den komplexen<br />
Versorgungsstrukturen ist es häufig nicht<br />
einfach für Menschen, das für sie richtige<br />
Versorgungsangebot zu finden. Der Hausarzt,<br />
bzw. die Hausärztin hat hier eine<br />
zentrale Rolle. Aufgrund dieser Türöffnerfunktion<br />
ist es wichtig, dass Hausärztinnen<br />
und Hausärzte über die <strong>Hospiz</strong>- und<br />
Palliativangebote selbst gut informiert<br />
sind, damit sie ihre Patientinnen und Patienten<br />
über <strong>Hospiz</strong>- und Palliativarbeit<br />
und die Möglichkeit hospizlich-palliativer<br />
Betreuung kompetent beraten können.<br />
30<br />
Der Deutsche <strong>Hospiz</strong>- und Palliativ-Verband,<br />
Dachverband von über 1.000 <strong>Hospiz</strong>vereinen<br />
und Palliativeinrichtungen mit<br />
inzwischen rund 80.000 Ehrenamtlichen<br />
und zahlreichen hauptamtlich Engagierten,<br />
wurde im Jahre 1992 gegründet. Er vertritt<br />
deren Interessen und die Belange der<br />
schwerstkranken und sterbenden Menschen<br />
gegenüber Politik und Gesundheitswesen.<br />
ARD-Themenwoche<br />
17. bis 23. November 2012<br />
Im Fernsehen, im Radio, im Internet<br />
Unter dem Motto „Leben mit dem Tod“ soll die ARD-Themenwoche 2012 helfen, Sprachlosigkeit<br />
im Angesicht von Tod und Trauer zu überwinden und dem Verdrängen entgegenzuwirken.<br />
Mit sorgfältig ausgewählten Spielfilmen, Reportagen, Dokumentationen, Features,<br />
Diskussionen und Interaktionen im Ersten und in den Dritten Programmen will die ARD<br />
starke emotionale Akzente setzen und die Zuschauer und Hörer umfassend informieren<br />
und beraten.<br />
Drei inhaltliche Schwerpunkte<br />
Drei inhaltliche Schwerpunkte, die sich im Ersten, in den Dritten Programmen, im Radio<br />
und im Internet wiederfinden: „Wie wir umgehen mit dem Tod“, „Wie wir sterben wollen“<br />
und „Was am Ende bleibt“.<br />
Im ersten Schwerpunkt „Wie wir umgehen mit dem Tod“ steht das Verhältnis der Menschen<br />
zum Tod im Mittelpunkt: Welche Rolle spielt der Tod in unseren Köpfen, wann und<br />
wie kommt er dort vor, wie reden wir darüber? Obwohl wir von unserem Ende wissen, verdrängen<br />
wir es, sprechen nicht darüber. Der Schwerpunkt soll Tabus bewusst machen,<br />
gezielt hinterfragen und zur Überwindung der allgemeinen Sprachlosigkeit beitragen.<br />
Im zweiten Schwerpunkt „Wie wir sterben wollen“ steht der Sterbeprozess im Mittelpunkt:<br />
Die Entscheidung darüber, wie, wo und wann gestorben wird, fällt auf Grundlage moralischer,<br />
juristischer und religiöser Urteile sowie gesellschaftlicher Normen und politischer<br />
Rahmenbedingungen. Die Frage der Selbstbestimmung ist dabei ein zentrales Thema.
Aber: Mehr als die Hälfte aller Deutschen haben keine Erfahrung mit Sterben<br />
und Tod, sie wissen nicht, wie man tröstet und trauert, obwohl die Gesellschaft<br />
zunehmend altert. Der Schwerpunkt soll Menschen aufklären. Er regt zudem<br />
die Diskussion über würdevolles Sterben als gesellschaftliche Aufgabe an.<br />
Im dritten Schwerpunkt „Was am Ende bleibt“ wird diskutiert, was bleibt, wenn<br />
jemand gestorben ist – physisch und mental. Denn die Auseinandersetzung mit<br />
dem Ende ist immer verbunden mit dem<br />
Nachdenken über unser Leben, unsere Beziehungen<br />
und Bilanzen. Der Schwerpunkt<br />
soll entsprechend Jung und Alt zu einer eigenen<br />
Zwischenbilanz ihres Lebens anregen.<br />
Er soll Denkanstöße liefern, sich mit der<br />
Vorstellung vom eigenen Ende zu beschäftigen<br />
und darüber mit anderen ins Gespräch<br />
zu kommen. Was bleibt von mir? Was soll<br />
bleiben, in Erinnerungen, in Lebenszeugnissen,<br />
im Internet?<br />
Im Rahmen dieser Themenwoche sendet die ARD im<br />
ersten Programm am<br />
21. November um 20.15 Uhr<br />
den Film „Blaubeerblau“, den wir Ihnen sehr empfehlen.<br />
Es handelt sich um einen Spielfilm, dessen Handlung wesentlich in einem <strong>Hospiz</strong><br />
stattfindet. Rainer Kaufmann, der Regisseur, hat sich vor Drehbeginn nicht<br />
nur in einem langen Gespräch mit uns im <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> ausführlich<br />
über alles, was in einem <strong>Hospiz</strong> wichtig ist, informiert, sondern uns auch das<br />
Drehbuch vorab zum Lesen gegeben. Der Film ist sehr gelungen und wurde bei<br />
den 48. Hugo TV Awards des Chicago International Filmfestival als bestes TV-<br />
Drama ausgezeichnet. Beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen bekam<br />
er den Publikumspreis.<br />
Auch der Deutsche <strong>Hospiz</strong>- und Palliativ-Verband (DHPV) überreicht seinen<br />
jährlichen Medienpreis am 18. Oktober in Berlin an die ARD für die Themenwoche<br />
Leben mit dem Tod. Tod Wir sind sehr dankbar, dass die Themen <strong>Hospiz</strong>- und<br />
Palliativversorgung, Sterben und Trauer sowohl im Erwachsenenbereich als<br />
auch im Kinderbereich immer wieder einen Platz in den Medien erhalten und<br />
mit dieser Schwerpunktwoche vielfältig darüber informiert wird. Leider wissen<br />
immer noch zu wenige Menschen, dass sie alle unter bestimmten Voraussetzungen<br />
einen Anspruch auf eine ambulante oder stationäre <strong>Hospiz</strong>- und Palliativversorgung<br />
haben. Angelika Westrich<br />
31
32<br />
Eine Quelle ist versiegt – Abschied von Jürgen Wälde<br />
Es war zu Beginn der Sommerferien im<br />
letzten Jahr, als Jürgen Wälde, 50 Jahre<br />
alt, von einer Krebs-Diagnose getroffen<br />
wurde. Nach einem Jahr, das ihm und<br />
seiner Familie viel Kraft abforderte, war<br />
seine Lebensenergie erschöpft. Seine<br />
Familie, aber auch wir, die <strong>Hospiz</strong>helfer/innen<br />
und Kollegen und Kolleginnen,<br />
bleiben erschüttert, fassungslos,<br />
aber auch dankbar zurück.<br />
Jürgen Wälde war nach seiner theologisch-pastoralen<br />
Ausbildung und seelsorgerlichen<br />
Tätigkeit zum Studium der<br />
Sozialen Arbeit gekommen und eröffnete<br />
als erster sog. „Jahrespraktikant“<br />
der Sozialen Arbeit eine Tradition.<br />
Schnell wurde nach seinem Einstieg in<br />
die Hauptamtlichkeit im Jahr 1997<br />
spürbar, welche Bereicherung Jürgen<br />
† 12. September 2012<br />
für das gesamte <strong>Hospiz</strong>-Team darstellte.<br />
Seine Liebenswürdigkeit, seine aufmerksam<br />
ruhige, kritische und bisweilen<br />
skeptische Sichtweise und Haltung<br />
tat allen, die ihm begegneten und mit<br />
ihm arbeiteten, gut. Seine Entschlossenheit,<br />
Ernsthaftigkeit, sein Suchen<br />
und Fragen bewegten Viele und Vieles.<br />
Sehr klar und unmissverständlich war<br />
sein kritischer Geist, der uns auf unsere<br />
offenen „Baustellen“ hinwies und zur<br />
Gründlichkeit mahnte. Eine seiner<br />
wichtigsten Lebensadern blieb ihm bis<br />
zuletzt erhalten, der Humor. Nicht oft,<br />
aber jeweils mit nachhaltiger Wirkung<br />
und Stoßkraft gelang es ihm, in kabarettistischer<br />
Hochform ernste Dinge<br />
humorvoll aufs Korn zu nehmen. Sein<br />
„Herr Pfleiderer“ geht in die CHV-Geschichte<br />
ein.
Beruflich galt von Anfang an seine<br />
Achtsamkeit den ehrenamtlichen <strong>Hospiz</strong>helfer/innen,<br />
deren Schulung, Fortbildung<br />
und Begleitung. Über viele<br />
Jahre schrieb er dreimal jährlich die<br />
<strong>Hospiz</strong>helfer-Briefe und bereitete viele<br />
Veranstaltungen vor. Viele werden ihm<br />
dafür immer dankbar sein. „Jürgen hat<br />
mir beigebracht, dass ich nicht das ganze<br />
Leid der Welt tragen kann!“ Wir haben<br />
viel von ihm gelernt.<br />
Er zeichnete von Anfang an verantwortlich<br />
für die Qualifizierungskurse<br />
für die Koordinatoren-Tätigkeit in den<br />
ambulanten <strong>Hospiz</strong>diensten. Seit 1999<br />
bildete er eine Säule der <strong>Hospiz</strong>philosophie<br />
und -praxis in der <strong>Christophorus</strong><br />
Akademie. Sogar im letzten Jahr seiner<br />
Krankheit setzte er die Kursleitung fort,<br />
soweit ihm das seine körperliche Verfassung<br />
noch erlaubte. Die Vorsitzende<br />
des Bayerischen <strong>Hospiz</strong>- und Palliativverbandes<br />
dankt ihm für 4 Jahre Vorstandstätigkeit<br />
bis 2011 und hebt „seine<br />
Ruhe, Kompetenz, seine wunderbar<br />
hintergründige Art und seine herzliche<br />
Zugewandtheit“ hervor: „Er war ein<br />
besonders sympathischer Mensch, der<br />
sich durch seine Liebenswürdigkeit und<br />
seine große Begabung, achtsam zuzuhören,<br />
Wertschätzung zu geben und<br />
vermittelnd zu wirken, auszeichnete.<br />
… Er war auch immer bereit, sein Wissen<br />
und seine Erfahrung mit anderen<br />
zu teilen … Viele Koordinatoren und<br />
<strong>Hospiz</strong>begleiter kennen ihn von Seminaren<br />
und Fachtagen in ganz Bayern,<br />
denen er durch seine herzerfrischende<br />
und praktische Art stets eine besondere<br />
Note gab. Wir sind dankbar, dass er<br />
jahrelang die Entwicklung des BHPV<br />
mitbestimmt hat und wir dabei viel von<br />
ihm lernen konnten.“<br />
Seine letzte berufliche Begeisterung<br />
galt der systemischen Trauerbegleitung.<br />
Mit großer Umsicht und Ruhe<br />
war er ein verlässlicher Ansprechpartner<br />
für die Trauernden. In vielen Einzelgesprächen,<br />
persönlich oder am Telefon,<br />
baute er mit seinen Kolleginnen<br />
dieses Angebot im CHV neu auf und<br />
wurde Menschen in Not zu einer<br />
großen Stütze und zum wertvollen<br />
Ratgeber.<br />
Seine Kunst, die rechten Worte zu finden<br />
und Sprache zu einem Genuss werden<br />
zu lassen, fand zuletzt auch Ausdruck<br />
in Buchbeiträgen. Sein Ringen<br />
um das rechte Maß, um das rechte Tun<br />
und Lassen, um das rechte Wort, um<br />
die richtige Richtung von <strong>Hospiz</strong>- und<br />
Palliativarbeit in Lehre und Praxis hat<br />
viele beeinflusst, hat Vielen vieles gegeben<br />
und wird auf Jahre hin wirksam<br />
bleiben.<br />
Wir sind sehr dankbar.<br />
Der <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> e.V.<br />
33
Einige von Ihnen haben mich vielleicht im<br />
<strong>Christophorus</strong>-Haus schon kurz kennengelernt<br />
– auf diesem Wege möchte ich jetzt<br />
die Gelegenheit nutzen, um mich zumindest<br />
schon einmal schriftlich vorzustellen!<br />
Mein Name ist Astrid Schneider-Eicke,<br />
ich bin Diplom-Sozialpädagogin (FH) mit<br />
Weiterbildungsstudium „Master of Social<br />
Work“ und arbeite mich seit 01.07.2012<br />
beim ambulanten <strong>Hospiz</strong>dienst des CHV<br />
ein.<br />
Mit dem Thema Krankheit und Tod wurde<br />
ich durch die Krebserkrankung meiner<br />
Mutter und den plötzlichen Tod meines<br />
Vaters schon in meiner Jugend konfrontiert.<br />
Durch mein Engagement in der<br />
kirchlichen Jugendarbeit konnte ich in<br />
diesen schweren Zeiten aber zum Glück<br />
immer auf Gesprächspartner und Unterstützung<br />
zurückgreifen.<br />
Deshalb entschied ich mich nach dem<br />
Abitur für das Studium der Sozialen Arbeit,<br />
um selbst auch in der Jugendarbeit<br />
tätig zu werden. Aber es kam anders!<br />
34<br />
Neue Mitarbeiterin im Team Soziale Arbeit<br />
Das Alten- und Pflegeheim, in dem ich<br />
während meines Studiums lange als Pflegehilfe<br />
mitgearbeitet hatte, fragte mich an,<br />
ob ich nicht die verwaiste Stelle des sozialpädagogischen<br />
Fachdienstes dort übernehmen<br />
könnte. Ich war total überrascht, aber<br />
natürlich auch sehr erfreut und sagte zu. –<br />
Irgendwann saß ich dann dort in meinem<br />
Büro und hatte eine richtige Krise: „Ich<br />
bin 24 Jahre alt, und die Leute um mich<br />
herum sterben wie die Fliegen – irgendwas<br />
läuft hier falsch.“ In einer Einzelsupervision<br />
durfte ich mir dann Unterstützung<br />
holen und in einer Aufstellung meinen<br />
Platz zwischen den Senioren, dem Tod und<br />
dem Leben suchen.<br />
Ich habe ihn gefunden, und das gibt mir<br />
immer neue Kraft und Motivation, mit<br />
Menschen auch im Angesicht von Leid<br />
und Tod noch Leben zu entdecken und zu<br />
fördern. Bisher konnte ich dabei in verschiedenen<br />
Einrichtungen der Altenhilfe –<br />
Altenheim, Betreutes Wohnen, Alten- und<br />
Service-Zentrum und in einer Fachstelle<br />
für pflegende Angehörige bei der Alzheimer<br />
Gesellschaft München – Erfahrungen<br />
sammeln.<br />
Da dabei die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen<br />
Helferinnen und Helfern immer<br />
eine große Rolle gespielt hat, freue ich mich<br />
sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen!<br />
PS: Der „Jugendarbeit“ bin ich ein Stück<br />
weit durch meine nebenberufliche Lehrtätigkeit<br />
für die angehenden Sozialarbeiterinnen<br />
und Sozialarbeiter an der Katholischen<br />
Stiftungsfachhochschule München<br />
dann doch noch treu geblieben …
Am En End nde de d<br />
Plötzlich ist verzuckt das Flackerlicht,<br />
Das mich lockte durch so viele Lüste,<br />
In den starren Fingern schreit die Gicht,<br />
Plötzlich steh ich wieder in der Wüste,<br />
Steppenwolf, und speie auf die Scherben<br />
Der verglühten Feste ohne Glück,<br />
Packe meinen Koffer, fahr zurück<br />
In die Steppe, denn es gilt zu sterben.<br />
Lebe wohl, vergnügte Bilderwelt,<br />
Maskenbälle, allzu süße Frauen;<br />
Hinterm Vorhang, der nun klirrend fällt,<br />
Weiß ich warten das gewohnte Grauen.<br />
Langsam geh dem Feinde ich entgegen,<br />
Eng und enger schnürt mich ein die Not.<br />
Das erschrockne Herz mit harten Schlägen<br />
Wartet, wartet, wartet auf den Tod.<br />
Hermann Hesse<br />
35
Albrecht Dürer: Ritter, Tod und Teufel<br />
36<br />
Der Tod und die Kunst –<br />
ein Abriss durch die Epochen
Albrecht Dürer: Apokalypse<br />
Hans Baldung Grien (1517):<br />
Der Tod und das Mädchen<br />
37
Jacques-Louis David: Der sterbende Marat (1773)<br />
Käthe Kollwitz: Abschied und Tod<br />
38<br />
Edvard Munch: Der Tod und das Mädchen, 1894
Wem ein Geliebtes stirbt,<br />
dem ist es wie ein Traum,<br />
die ersten Tage kommt er<br />
zu sich selber kaum.<br />
Wie er’s ertragen soll,<br />
kann er sich selbst nicht fragen;<br />
und wenn er sich besinnt,<br />
so hat er’s schon ertragen.<br />
Friedrich Rückert<br />
Hans Makart:<br />
Der Tod der Cleopatra (1875)<br />
39
Unser <strong>Verein</strong> unterhält seit mehr als zehn<br />
Jahren ein stationäres <strong>Hospiz</strong>. Insgesamt<br />
gibt es im Großraum München lediglich<br />
28 <strong>Hospiz</strong>plätze, davon sind 16 im<br />
<strong>Christophorus</strong> Haus in der Effnerstraße.<br />
In unseren 16 Einzelzimmern können<br />
wir jedes Jahr mehreren hundert Menschen<br />
bei ihrem letzten Lebensabschnitt<br />
Herberge geben. Wir stellen dafür, neben<br />
den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern,<br />
ein multiprofessionelles Team zur Verfügung,<br />
um den Menschen in den komplexen,<br />
schwierigen Situationen Beistand<br />
leisten zu können. Menschen, die an einer<br />
unheilbaren Erkrankung leiden und<br />
mit ihrem baldigen Versterben rechnen<br />
müssen, bekommen in unserem Haus<br />
mit ihren individuellen Bedürfnissen<br />
und Wünschen einen Platz. Außerdem<br />
besteht eine enge Vernetzung mit anderen<br />
ambulanten <strong>Hospiz</strong>diensten und<br />
Palliativstationen (Barmherzige Brüder,<br />
Harlaching, Großhadern, Schwabing<br />
und Neuperlach) im Großraum München.<br />
Die bisweilen unzureichende Versorgung<br />
in den verschiedenen stationären Einrichtungen<br />
unseres Gesundheitssystems ließen<br />
die Errichtung eines stationären<br />
<strong>Hospiz</strong>es notwendig erscheinen. Das stationäre<br />
<strong>Hospiz</strong> ist jedoch nur ein Teil<br />
unseres Angebots für Menschen in ihrer<br />
letzten Lebensphase. Das Bestreben des<br />
CHV war es von jeher, das Sterben nicht<br />
aus der Gesellschaft an spezielle Orte auszugliedern,<br />
sondern in der vertrauten<br />
40<br />
In eigener Sache<br />
Was Sie über die Aufnahme in das stationäre <strong>Hospiz</strong> wissen sollten<br />
häuslichen Umgebung möglich zu machen.<br />
Deshalb wird der Großteil der Hilfesuchenden<br />
durch unsere ambulanten<br />
Angebote versorgt; dazu gehören unser<br />
Ambulanter <strong>Hospiz</strong> und Palliativberatungsdienst<br />
(AHPB), der Palliativ-Geriatrische<br />
Dienst (PGD) und seit 2009 auch<br />
die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung<br />
(SAPV). Abgesehen von der<br />
Zuzahlung durch die Kranken- und Pflegekassen,<br />
ist die Finanzierung dieses breiten<br />
Spektrums nur dank unserer Mitglieder<br />
und den damit verbundenen<br />
Mitgliedsbeiträgen, bzw. dank zahlreicher<br />
Spenden und Stiftungen möglich.<br />
Die Kosten des stationären <strong>Hospiz</strong>es werden<br />
zum größeren Teil durch die Kranken-<br />
und Pflegekassen gedeckt. Im Auftrag<br />
des Gesetzgebers haben dazu die<br />
maßgeblichen Verbände der <strong>Hospiz</strong>träger<br />
mit den Krankenkassen Rahmenvereinbarungen<br />
abgeschlossen, die Art und<br />
Umfang der Leistungen stationärer <strong>Hospiz</strong>e<br />
festlegen. Das bedeutet konkret, der<br />
CHV ist – wie alle stationären <strong>Hospiz</strong>e –<br />
an diese Rahmenvereinbarungen gebunden.<br />
Unter anderem ist darin auch festgelegt,<br />
welcher Personenkreis in einem <strong>Hospiz</strong><br />
versorgt werden kann und soll. Die<br />
wichtigsten Aussagen der Rahmenvereinbarung<br />
zu diesen Aufnahmevoraussetzungen<br />
sind:<br />
1. Grundvoraussetzung für die Aufnahme<br />
in ein stationäres <strong>Hospiz</strong> ist, dass<br />
die/der Patient/in an einer Erkrankung
leidet, die progredient verläuft, die bereits<br />
ein weit fortgeschrittenes Stadium<br />
erreicht hat und bei der eine Heilung<br />
ausgeschlossen ist.<br />
2. Es muss eine palliativmedizinische<br />
und -pflegerische Versorgung notwendig<br />
oder vom Patient gewünscht werden.<br />
3. Die Lebenserwartung muss begrenzt<br />
sein und lediglich Tage, Wochen oder<br />
wenige Monate betragen.<br />
4. Eine Krankenhausbehandlung im<br />
Sinne des § 39 SGB V darf nicht erforderlich<br />
sein; ebenso darf keine ambulante<br />
Versorgung im Haushalt oder in der<br />
Familie ausreichen. Die bisher Betreuenden<br />
müssen regelmäßig überfordert<br />
sein.<br />
5. Bewohner von Pflegeeinrichtungen<br />
können nur dann aufgenommen werden,<br />
wenn die oben genannten Kriterien<br />
erfüllt sind, d.h. insbesondere<br />
wenn die Einrichtung mit der Versorgung<br />
des Bewohners regelmäßig überfordert<br />
ist.<br />
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind,<br />
kommen laut Rahmenvereinbarung insbesondere<br />
folgende Krankheitsbilder für<br />
eine Versorgung in einem stationären<br />
<strong>Hospiz</strong> in Betracht: Krebserkrankungen,<br />
Vollbild der Infektionskrankheit AIDS,<br />
Erkrankungen des Nervensystems und<br />
chronische Nieren-, Herz-, Verdauungstrakt-<br />
oder Lungenerkrankungen. Die<br />
Aufnahme und der weitere Verbleib müssen<br />
vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen<br />
genehmigt werden. Bestehen<br />
im voraus Zweifel, ob alle Bedingungen<br />
erfüllt sind, muss dies mit dem Medizinischen<br />
Dienst abgestimmt werden.<br />
Jede Anfrage für den stationären Bereich<br />
wird im CHV von einem Team nach bestem<br />
Wissen und Gewissen geprüft. Alles<br />
wird versucht, um den Menschen in dieser<br />
schwierigen Lebensphase gerecht zu<br />
werden. Viele Betroffene und / oder ihre<br />
Angehörigen tun sich sehr schwer mit<br />
diesem „letzten Umzug” auf diese „letzte<br />
Station”. Auf der anderen Seite haben<br />
auch viele den Wunsch, in einer geborgenen<br />
Atmosphäre wie im <strong>Christophorus</strong>-<br />
Haus sterben zu können. Beides ist für<br />
uns nur allzu gut verständlich. Wir erleben<br />
es oft als schmerzlich, Menschen, die<br />
für einen Platz im stationären <strong>Hospiz</strong> anfragen,<br />
enttäuschen zu müssen. Aufgrund<br />
dieser Vorgaben ist es uns auch nicht<br />
möglich, <strong>Verein</strong>smitglieder bei der Vergabe<br />
von <strong>Hospiz</strong>plätzen zu bevorzugen.<br />
Für den Fall, dass wir gezwungen sind die<br />
Aufnahme abzulehnen, suchen wir mit<br />
den Betroffenen natürlich nach Lösungen,<br />
wie es weitergehen kann. Es wird geklärt,<br />
ob vor Ort Beratung und Unterstützung<br />
angeboten werden kann.<br />
Gegebenenfalls findet eine hausinterne<br />
Übergabe an den Ambulanten <strong>Hospiz</strong>dienst<br />
statt. Das spezialisierte ambulante<br />
Palliativ Care-Team kann dabei helfen,<br />
soziale, medizinische, psychische oder<br />
pflegerische Probleme adäquat anzugehen,<br />
um so die Lebensqualität und die<br />
Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen<br />
bis zum Lebensende zu erhalten, zu<br />
fördern und zu verbessern. Mehr als 80%<br />
der von dem Team Betreuten kann bis zuletzt<br />
in der vertrauten, meist häuslichen,<br />
41
Umgebung verbleiben. Oft erschließen<br />
sich erst bei genauem Hinsehen Ressourcen<br />
und Möglichkeiten, den Weg zu<br />
Hause weiter zu gehen – wenn man die<br />
nötige moralische und praktische Unterstützung<br />
erfährt.<br />
42<br />
Das Aufnahmeteam des stationären Bereichs<br />
des <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong>s,<br />
Frau Brigitte Hirsch und Frau Elisabeth<br />
Wolf, steht bei Fragen oder Unklarheiten zu<br />
diesem Thema jederzeit zur Verfügung.<br />
Wo ist der Mensch, den ich gerade brauche?<br />
Mir ist illegitim traurig zu Mut.<br />
Als läge meine Traurigkeit im Bauche.<br />
Ach, welche Menschen sind denn eigentlich gut?<br />
Ich kann es mir im Grunde nicht verhehlen,<br />
Dass ich jetzt böse grüble über die,<br />
Die augenblicklich mir gerade fehlen.<br />
Und kämen sie: Wie schroff empfing ich sie!<br />
Misstrauisch würde selbst mein Loben klagen,<br />
Und wenn ich sänge, wie ein Vogel singt.<br />
Auch käme ich garnicht darauf, zu fragen,<br />
Ob sie nicht just auch einen von den Tagen<br />
Durchgrübeln, da uns alles schmal misslingt.<br />
Joachim Ringelnatz
Aus dem <strong>Verein</strong><br />
Der Tod unseres Kollegen Jürgen Wälde<br />
nach schwerer Krankheit am 12. September<br />
hat uns alle sehr erschüttert. Er war<br />
eine Säule unseres Teams. Mit ihm hat<br />
der <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> einen<br />
Menschen verloren, der ihn sowohl<br />
menschlich als auch inhaltlich entscheidend<br />
mit geprägt hat. Einen Nachruf finden<br />
Sie an anderer Stelle dieses Heftes.<br />
Bereits im letzten Heft berichteten wir<br />
von den schwierigen Verhandlungen mit<br />
den Kranken- und Pflegekassen zur Finanzierung<br />
unseres stationären <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong>es. Bald nach Erscheinen<br />
des letzten Heftes konnte dann im Rahmen<br />
der Schiedsverhandlungen eine fast<br />
15-%ige Erhöhung des Vergütungssatzes<br />
erreicht werden. Dieses Ergebnis deckt<br />
zwar immer noch nicht 90% der entstehenden<br />
Kosten, wie es das Gesetz vorsieht.<br />
10% der Kosten müssen die Träger<br />
der <strong>Hospiz</strong>e ohnehin aus Spenden und<br />
Stiftungsmitteln selbst aufbringen. Es<br />
gibt uns jedoch Luft zum Durchatmen<br />
und motiviert uns, unsere Arbeit für die<br />
schwerstkranken Bewohner in unserem<br />
<strong>Hospiz</strong> engagiert weiter zu führen.<br />
Am 7. Mai fand die diesjährige Mitgliederversammlung<br />
des <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong><br />
<strong>Verein</strong>s statt. Besonders freuen wir<br />
uns, dass Frau Renate Salzmann-Zöbeley<br />
in dieser Sitzung zur ersten Vorsitzenden<br />
des <strong>Verein</strong>s gewählt wurde. Sie stellt sich<br />
Ihnen im Editorial dieses Heftes persönlich<br />
vor. Gemeinsam mit mir – der ich ja<br />
auch erst seit Januar im Amt bin – hat<br />
Frau Salzmann-Zöbeley bereits eine Reihe<br />
von Antrittsbesuchen bei wichtigen<br />
Kooperationspartnern des CHV begonnen,<br />
unter anderem im Gesundheits- und<br />
im Sozialreferat der Stadt München und<br />
bei der Münchner Stadtdekanin Frau<br />
Kittelberger. Außerdem machten sich in<br />
den letzten Wochen eine Reihe von<br />
Münchner Stadträten aus dem Gesundheits-<br />
und dem Sozialausschuss und aus<br />
Bogenhausen bei verschiedenen Besuchen<br />
im <strong>Christophorus</strong>-Haus ein Bild<br />
über unsere Arbeit, die Angebote und<br />
Dienste des CHV.<br />
Durch das hohe Engagement unserer<br />
Mitarbeiter war es möglich, die Belegung<br />
im stationären <strong>Hospiz</strong> und die Zahl der<br />
ambulant versorgten Patienten in den<br />
ersten drei Quartalen des Jahres noch einmal<br />
zu erhöhen. Immer wieder sind wir<br />
dabei auch mit Situationen konfrontiert,<br />
die auch für uns Herausforderungen darstellen.<br />
Nur ein Beispiel: Im <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong> nahmen wir eine junge Wachkomapatientin<br />
auf. Die Versorgung von<br />
Wachkomapatienten bedeutet eine besondere<br />
Anforderung für unser stationäres<br />
Team. Insbesondere die Klärung der<br />
ethischen Fragen vor der Aufnahme sind<br />
besonders sensibel und können nur in<br />
vielen und intensiven Gesprächen und<br />
Beratungen mit den Angehörigen, Pflegenden,<br />
Ärzten und allen anderen beteiligten<br />
Berufsgruppen des CHV geklärt<br />
werden.<br />
In einer Gesellschaft, in der Sterben, Tod<br />
und Trauer nach wie vor Tabuthemen<br />
sind, gehört die Verbreitung der <strong>Hospiz</strong>idee<br />
zu den Aufgaben des CHV. In der<br />
letzten Ausgabe des Mitgliedermagazins<br />
„LIES“ der Lebenshilfe ist ein Artikel zur<br />
Sterbebegleitung von Menschen mit Behinderung<br />
von Herrn Steil, Herrn<br />
Raischl und Herrn Dr. Augustin (Haus-<br />
43
arzt im stationären <strong>Hospiz</strong>) erschienen. In<br />
der Zeitschrift „Bild der Frau“ ist eine Reportage<br />
zum Thema <strong>Hospiz</strong>- und Palliativversorgung<br />
geplant. Für diese Reportage<br />
hat die Journalistin unter anderem den<br />
CHV besucht und sich mit Bewohnern<br />
des stationären <strong>Hospiz</strong>es, Patienten des<br />
ambulanten <strong>Hospiz</strong>es und einem Teil unserer<br />
Mitarbeiter unterhalten.<br />
Als kleines Dankeschön für ihren unermüdlichen<br />
Einsatz das ganze Jahr über<br />
<strong>laden</strong> wir Mitarbeiter, <strong>Hospiz</strong>helfer,<br />
Vorstände, andere Ehrenamtliche, Honorarkräfte<br />
und externe Berufsgruppen<br />
jedes Jahr zu einem Sommerfest ein. Das<br />
Fest bietet Gelegenheit, gemeinsam ein<br />
paar schöne Stunden verbringen zu können.<br />
Und zwar ganz bewusst – ohne dass<br />
wie sonst – Arbeit und Aufgaben im Vordergrund<br />
stehen. Für unser Sommerfest<br />
am 8. Juli haben wir viele positive Rückmeldungen<br />
bekommen. Ich gebe den<br />
Dank weiter an die vielen Helfer, die tatkräftig<br />
zum Gelingen des Festes beigetragen<br />
haben.<br />
Wir freuen uns sehr, dass seit Sommer<br />
Frau Astrid Schneider-Eicke und seit Oktober<br />
Herr Robert Milbradt als neue Kollegin<br />
und Kollege unser Team der Sozialarbeiter<br />
im ambulanten Bereich verstärken.<br />
Sehr dankbar sind wir außerdem, dass die<br />
Evangelische Landeskirche uns seit Oktober<br />
für die nächsten zwei Jahre eine Seelsorgestelle<br />
mit 11 Stunden pro Woche für<br />
unser ambulantes SAPV-Team zur Verfügung<br />
stellt. Wir heißen also auch Herrn<br />
Diakon Braun, der diese Stelle ausfüllt,<br />
herzlich willkommen.<br />
In den letzten Wochen hat der CHV in<br />
Kooperation mit dem Augustinum ein<br />
Projekt zur Implementierung der <strong>Hospiz</strong>kultur<br />
und Palliativversorgung in den drei<br />
44<br />
Münchner Senioreneinrichtungen des<br />
Augustinums durchgeführt. Das Projekt<br />
verlief sehr erfolgreich, so dass das Augstinum<br />
auch in Zukunft mit uns zusammenarbeiten<br />
möchte.<br />
Beim Bezirksausschuss Bogenhausen haben<br />
wir einen Antrag gestellt, sich beim<br />
MVG dafür einzusetzen, dass auf Höhe<br />
unseres <strong>Christophorus</strong> Hauses in der Effnerstraße<br />
und gegenüber auf der Höhe<br />
des neuen Seniorenheimes „Haus an der<br />
Effnerstraße“ durch Haltestellen einer<br />
Buslinie eine unmittelbare Anbindung an<br />
den öffentlichen Personennahverkehr<br />
entsteht. Wir hoffen, dass unser Antrag<br />
die entsprechende Wirkung zeigt und von<br />
der Kommunalpolitik unterstützt wird.<br />
Für viele der Angehörigen, Mitglieder<br />
und Besucher, die zu uns ins <strong>Christophorus</strong><br />
Haus kommen, ist die bisherige öffentliche<br />
Anbindung beschwerlich. Viele<br />
sind ältere Menschen, die nicht mehr so<br />
gut zu Fuß sind. Sie können den Weg zu<br />
den relativ weit entfernten Haltestellen<br />
nur mit Mühe zurücklegen.<br />
Wenn Sie dies lesen, hat unser <strong>Hospiz</strong>helfertag<br />
am 27.10.12, diesmal im Schloss<br />
Fürstenried, bereits stattgefunden. Er<br />
stand unter dem Motto „Anerkennung“.<br />
Unter anderem erhielt eine Reihe langjähriger<br />
ehrenamtlicher <strong>Hospiz</strong>helfer die<br />
Auszeichnung „München dankt“ für ihr<br />
wertvolles Engagement.<br />
In diesem Zusammenhang möchte ich<br />
zum Schluss die Gelegenheit ergreifen,<br />
auch auf diejenigen ehrenamtlichen Mitarbeiter<br />
des <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong>s<br />
hinzuweisen, die nicht <strong>Hospiz</strong>helfer<br />
sind. Über 40 Ehrenamtliche arbeiten<br />
außerhalb der <strong>Hospiz</strong>helfer-Tätigkeit für<br />
den CHV. Sie engagieren sich bei Bildungsveranstaltungen<br />
des CHV, arbeiten
an verschiedensten Stellen in der Verwaltung<br />
oder in der Öffentlichkeitarbeit mit,<br />
unterstützen uns bei der Gewinnung von<br />
Spendern, bringen ihre Kompetenzen in<br />
der Seelsorge oder in der Fachpolitik ein,<br />
kümmern sich mit uns um Haus und<br />
Garten, gestalten Feiern und Veranstaltungen<br />
mit, verhandeln für uns Preis-<br />
Stifterkreis<br />
Zusammen mit der Stiftung Stifter für<br />
Stifter setzen wir uns seit dem Frühjahr<br />
2006 dafür ein, im <strong>Hospiz</strong>bereich eine<br />
Kultur des Stiftens zu fördern. Fünf Stiftungen<br />
und ihre Stifter, die sie ins Leben<br />
gerufen haben, gehören mittlerweile unserem<br />
Stifterkreis an.<br />
Unsere Stifterinnen und Stifter eint die<br />
Vorstellung, gesellschaftliche Aufgaben<br />
im Bereich der Versorgung schwerstkranker<br />
und sterbender Menschen zu stärken<br />
und unterstützen zu wollen und man<br />
muss finanziell beileibe kein Bill Gates<br />
sein, um sich für diese gesellschaftlichen<br />
Belange zu engagieren. Alle unsere Stifter<br />
betonen, dass sie in erster Linie große persönliche<br />
Befriedigung aus ihrem Engagement<br />
ziehen und sich einsetzen wollen für<br />
die ambulante und stationäre hospizliche<br />
und palliative Versorgung im Rahmen<br />
unseres <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong>s.<br />
Stiftungen können und sollen aber niemals<br />
die alleinige Lösung von grundsätzlich<br />
gesellschaftlichen Herausforderungen<br />
sein. Sie sind, auch bei uns, vielmehr<br />
ein wichtiger Baustein im Kontext der<br />
Versorgung schwerstkranker und sterbender<br />
Menschen.<br />
nachlässe und noch Vieles mehr. Jede Art<br />
von ehrenamtlicher und bürgerschaftlicher<br />
Unterstützung ist von unschätzbarem<br />
Wert für den <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong><br />
<strong>Verein</strong>. Ich danke Ihnen im Namen des<br />
gesamten CHV ganz herzlich.<br />
Ihr Leonhard Wagner<br />
Im ablaufenden Jahr haben wir aus unseren<br />
Stiftungen erhebliche Mittel für verschiedene<br />
Projekte erhalten. So unterstützte<br />
die Herbert Huber Stiftung unsere<br />
allgemeine ambulante <strong>Hospiz</strong>- und Palliativversorgung<br />
mit 25.000,- Euro. Wir<br />
konnten damit eine Pflegefachkraft mitfinanzieren,<br />
mit deren Hilfe es möglich<br />
ist, dass viele Menschen daheim sterben<br />
können und nicht mehr in ein Krankenhaus<br />
oder ein Pflegeheim verlegt werden<br />
müssen.<br />
Eine andere Stiftung unseres Stifterkreises<br />
ermöglichte die Beschaffung von zusätzlichen<br />
kleinen Esstischen in unseren<br />
Bewohnerzimmern, so dass diese in normaler<br />
Tischhöhe ihre Mahlzeiten im<br />
Zimmer einnehmen können.<br />
Und wieder eine unserer Stiftungen, die<br />
Barbara und Christof Lehner Stiftung,<br />
fördert mit 1.000,- Euro unser Angebot<br />
von Kunsttherapie-Begleitung im stationären<br />
Bereich. Sie ist kein Luxusangebot,<br />
sondern eine wirksame und hilfreiche<br />
Unterstützung unserer Bewohner in der<br />
Auseinandersetzung und Akzeptanz ihres<br />
Sterbenmüssens.<br />
45
Auch unsere <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> Stiftung,<br />
die dank kleinerer und größerer Zustiftungs-<br />
oder Spenden-Beträge unserer<br />
Mitglieder immer weiter anwächst, konnte<br />
dieses Jahr 16.000,- Euro für den stationären<br />
Bereich ausschütten. Der Betrag<br />
hilft, die jährlich zu leistenden 10% Trägeranteil<br />
im stationären Bereich zu finanzieren.<br />
Damit ermöglichen unsere Stiftungen<br />
wichtige Bausteine für die Aufrechterhaltung<br />
und weitere Durchführung verschiedener<br />
Projekte. Allen unseren Stifterinnen<br />
und Stiftern sagen wir ein herzliches<br />
Dankeschön für ihr Engagement und ihre<br />
Unterstützung.<br />
Keiner Stiftung, sondern einem sehr<br />
schnellen und persönlichen Impuls eines<br />
Spenders, der unserer Einladung zum<br />
Stiftertreffen folgte, verdanken wir einen<br />
Termine<br />
Information und Beratung zur Patientenverfügung<br />
Viele Menschen möchten Vorsorge treffen für den Fall, dass sie durch Unfall, Krankheit<br />
oder Alter nicht mehr in der Lage sind, ihren Willen zu äußern und selbstständig zu ent-<br />
scheiden. Ein offenes Angebot für alle Interessierten zu Fragen der Patientenverfügung<br />
und Vorsorge-Vollmacht. Jeweils am letzten Mittwoch im Monat von 10:00 bis<br />
12:00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.<br />
28. November 2012<br />
30. Januar 2013<br />
Erfahrene Mitarbeiter/innen unseres Teams informieren Sie an diesen Vormittagen, was<br />
Sie beachten sollten und gehen auf Ihre individuellen Fragen ein.<br />
Teilnahmegebühr: 5 Euro (für Mitglieder 3 Euro)<br />
46<br />
27. Februar 2013<br />
27. März 2013<br />
Gartenpavillon. Das Holz-Modell überzeugte<br />
ihn so, dass er sich ganz spontan<br />
entschloss, die Kosten dafür in Höhe von<br />
3.500,- Euro zu übernehmen. Die Fundamente<br />
für diese zusätzliche Sitzinsel in<br />
unserem Garten werden noch im Herbst<br />
gebaut. Der hölzerne Aufbau mit einem<br />
begrünten Dach und seitlichen Blumenbeeten<br />
wird im Frühjahr 2013 fertig gestellt,<br />
so dass unsere Bewohner, ihre Angehörigen,<br />
aber auch sonstige Besucher<br />
und unsere <strong>Hospiz</strong>helfer einen noch<br />
schöneren Garten genießen können.<br />
Es ist ein wunderbares Gefühl, auch im<br />
Stiftungsbereich so viele Unterstützerinnen<br />
und Unterstützer für unsere Arbeit zu<br />
haben. Es trägt uns alle und hilft, in dieser<br />
Arbeit beständig zu bleiben. Dafür<br />
danken wir Ihnen sehr.<br />
Ihre Angelika Westrich<br />
24. April 2013<br />
29. Mai 2013
Vorträge<br />
Patientenverfügung und<br />
Vorsorgevollmacht<br />
22. April 2013<br />
jeweils von 18:30 – 20:00 Uhr<br />
Offene Führungen im <strong>Christophorus</strong>-Haus 2013<br />
Das <strong>Christophorus</strong>-Haus vereint alle ambulanten und stationären Angebote des <strong>Christophorus</strong><br />
<strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong>s e.V. unter einem Dach. Mit den offenen Führungen vermitteln<br />
wir Interessierten einen Einblick in unser Haus und unsere Arbeit.<br />
07. November 2012 10:00 – 12:00 Uhr<br />
09. Januar 2013 10:00 – 12:00 Uhr<br />
06. Februar 2013 18:00 – 20:00 Uhr<br />
20. März 2013 14:00 – 16:00 Uhr<br />
15. Mai 2013 10:00 – 12:00 Uhr<br />
Interesse an ehrenamtlicher Mitarbeit?<br />
An diesen Tagen stellen wir Ihnen Möglichkeiten vor, sich im <strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong><br />
<strong>Verein</strong> zu engagieren:<br />
19. Februar 2013 von 17:00 bis 18:30 Uhr<br />
Offener Trauertreff<br />
Testament, Erbe, Besteuerung<br />
des Nachlasses<br />
08. Juli 2013<br />
Patientenverfügung und<br />
Vorsorgevollmacht<br />
14. Oktober 2013<br />
Der CHV bietet trauernden Menschen Unterstützung an. Der offene Gesprächskreis<br />
findet zweimal monatlich, jeweils dienstags um 15:00 Uhr statt.<br />
Termine und Anmeldung unter Telefonnummer 089 / 13 07 87- 0<br />
Weitere Termine<br />
47
Grundseminare 2012/2013<br />
Nachmittagsseminar<br />
08. April bis 13. Mai 2013, jeweils sechsmal montags von 14:30 bis 17:00 Uhr<br />
Wochenendseminare<br />
Jeweils Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr<br />
WS 4<br />
WS 1<br />
Abendseminar<br />
28. Januar bis 12. März 2013, sechs Montagabende von 19:00 bis 21:30 Uhr (außer<br />
Rosenmontag)<br />
Kursgebühr für alle Seminare beträgt 60 Euro (50 Euro für Mitglieder)<br />
Alle Kurse finden im <strong>Christophorus</strong>-Haus, Effnerstraße 93, statt.<br />
Bitte melden Sie sich zu den Seminaren frühzeitig schriftlich an über die Internetseite<br />
www.chv www.chv www .chv.org .org oder per Mail: bildung@chv<br />
bildung@chv.org<br />
bildung@chv<br />
bildung@chv.org<br />
bildung@chv<br />
bildung@chv.org<br />
bildung@chv oder per Telefon: 089 / 13 07 87- 0<br />
48<br />
Impressum<br />
10./11. November 2012<br />
02./03. März 2013<br />
Alle oben genannten Veranstaltungen finden in den Räumen des CHV statt.<br />
MVV: U 4 Arabellapark, Tram 16 bis Arabellastraße und Tram 18 bis Effnerplatz,<br />
Bus 188 bis Odinstraße.<br />
CHV aktuell erscheint zweimal jährlich und wird herausgegeben vom<br />
<strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> e.V., München.<br />
Redaktion: Heinz Biersack, Irene Braun, Julia Hagmeyer, Uve Hirsch, Helmut Nadler, Ingrid Pfuner,<br />
Inge Scheller (v.i.S.d.P.), Leonhard Wagner und Angelika Westrich<br />
Layout und Herstellung: Helmut Nadler<br />
Anzeigenleitung: Helga Ostermeier Tel. (08441) 80 57 37, 0160-580 67 98<br />
Die nächste Ausgabe von CHV aktuell ist für Mai 2013 vorgesehen.<br />
Geplanter Schwerpunkt: <strong>Hospiz</strong> für alle?<br />
Redaktionsschluss: 15. April 2013<br />
<strong>Christophorus</strong> <strong>Hospiz</strong> <strong>Verein</strong> e.V., Effnerstraße 93, 81925 München,<br />
Tel.( 089) 13 07 87-0, Fax 13 07 87-13; www.chv.org; info@chv.org<br />
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:30 Uhr<br />
Sozialbank München, Konto Nr. 98 555 00, BLZ 700 205 00<br />
Commerzbank München, Konto Nr. 42 42 111, BLZ 700 400 41<br />
HOSPIZ
Karl Albert Denk<br />
(Bestattermeister)<br />
✆<br />
Unsere Beratungsräume<br />
München<br />
Individuelle<br />
Gestaltung<br />
Kompetente und<br />
familiäre Betreuung<br />
Persönliche und fa f miliäre Betreuung.<br />
Karl Albert Denk knüpft ft f an eine beispielhaft ft f e Familientradition<br />
an. Seit über vier Generationen pfl fl f egt die Familie<br />
Denk eine einzigartige Bestattungs- und Trauerkultur, die<br />
nun wieder neu belebt wird. Die Würde das Menschen zu<br />
wahren und zu bewahren, ist uns ein wichtiges Anliegen.<br />
Kommen Sie und sprechen Sie mit uns. Auf Wunsch kommen<br />
wir zu Ihnen nach Hause, selbstv tv t erständlich kostenlos<br />
und unverbindlich.<br />
089-64 24 86 80<br />
Tag und Nacht fü f r Sie da, auch an Sonn- und Feiertagen.<br />
Münch ch c en, Ismaninger Str.17<br />
Grünwald, Tölzer Straße 37<br />
Erding, Kirchgasse 2a<br />
Freising, Prinz-Ludwig-Str. 5<br />
www.karlalbertdenk.de<br />
Persönliche<br />
Abschiednahme