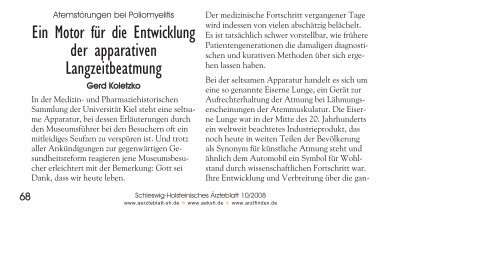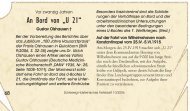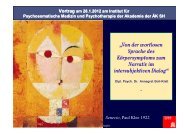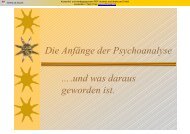Ein Motor für die Entwicklung der apparativen Langzeitbeatmung
Ein Motor für die Entwicklung der apparativen Langzeitbeatmung
Ein Motor für die Entwicklung der apparativen Langzeitbeatmung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
68<br />
Atemstörungen bei Poliomyelitis<br />
<strong>Ein</strong> <strong>Motor</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>apparativen</strong><br />
<strong>Langzeitbeatmung</strong><br />
Gerd Koletzko<br />
In <strong>der</strong> Medizin- und Pharmaziehistorischen<br />
Sammlung <strong>der</strong> Universität Kiel steht eine seltsame<br />
Apparatur, bei dessen Erläuterungen durch<br />
den Museumsführer bei den Besuchern oft ein<br />
mitleidiges Seufzen zu verspüren ist. Und trotz<br />
aller Ankündigungen zur gegenwärtigen Gesundheitsreform<br />
reagieren jene Museumsbesucher<br />
erleichtert mit <strong>der</strong> Bemerkung: Gott sei<br />
Dank, dass wir heute leben.<br />
Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 10/2008<br />
www.aerzteblatt-sh.de www.aeksh.de www.arztfindex.de<br />
Der medizinische Fortschritt vergangener Tage<br />
wird indessen von vielen abschätzig belächelt.<br />
Es ist tatsächlich schwer vorstellbar, wie frühere<br />
Patientengenerationen <strong>die</strong> damaligen diagnostischen<br />
und kurativen Methoden über sich ergehen<br />
lassen haben.<br />
Bei <strong>der</strong> seltsamen Apparatur handelt es sich um<br />
eine so genannte Eiserne Lunge, ein Gerät zur<br />
Aufrechterhaltung <strong>der</strong> Atmung bei Lähmungserscheinungen<br />
<strong>der</strong> Atemmuskulatur. Die Eiserne<br />
Lunge war in <strong>der</strong> Mitte des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
ein weltweit beachtetes Industrieprodukt, das<br />
noch heute in weiten Teilen <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
als Synonym <strong>für</strong> künstliche Atmung steht und<br />
ähnlich dem Automobil ein Symbol <strong>für</strong> Wohlstand<br />
durch wissenschaftlichen Fortschritt war.<br />
Ihre <strong>Entwicklung</strong> und Verbreitung über <strong>die</strong> gan-
ze Welt steht im engen Zusammenhang mit <strong>der</strong><br />
Ausbreitung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>lähmung, einer Infektionskrankheit,<br />
<strong>die</strong> durch das Poliomyelitisvirus<br />
hervorgerufen wird. In Mittel- und Westeuropa<br />
gilt sie seit spätestens Anfang <strong>der</strong> 1990er Jahre<br />
als eradiziert.<br />
Obwohl nur bei circa einem Prozent <strong>der</strong> Infizierten<br />
<strong>die</strong> <strong>für</strong> <strong>die</strong> Krankheit charakteristischen<br />
Symptome, wie schlaffe Lähmungen im Bereich<br />
<strong>der</strong> Extremitäten, bisweilen unter Beteiligung<br />
<strong>der</strong> Interkostalmuskulatur und Ausbildung einer<br />
Zwerchfelllähmung auftreten, hat es wäh-<br />
Werbeprospekt <strong>der</strong> Firma Dräger <strong>für</strong> <strong>die</strong> Eiserne Lunge<br />
(Abbildungen/Quelle: Gerd Koletzko)<br />
rend <strong>der</strong> Epidemien eine erschreckend hohe<br />
Morbidität gegeben. Dieses genuin medizinisch,<br />
epidemische Phänomen forcierte <strong>die</strong> Konstruktion<br />
eines technischen Gerätes, das in <strong>der</strong> Lage<br />
ist, <strong>die</strong> Vitalfunktion Atmung über längere Zeit<br />
hinaus zu gewährleisten. Ohne den epidemischen<br />
Charakter <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>lähmung wäre <strong>die</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>der</strong> Eisernen Lunge und einer Rei-<br />
Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 10/2008<br />
www.aerzteblatt-sh.de www.aeksh.de www.arztfindex.de<br />
medizin und wissenschaft<br />
he an<strong>der</strong>er Beatmungsgeräte wohl nicht in dem<br />
uns bekannten Maße vorangetrieben worden.<br />
Der Prototyp <strong>für</strong> <strong>die</strong> Eiserne Lunge, wie sie uns<br />
noch heute bekannt ist, stammt aus dem Jahre<br />
1929 und wurde von dem Ingenieur Philip Drinker<br />
und dem Physiologen Louis Shaw in Boston<br />
(USA) entwickelt. 1931 gab es eine Poliomyelitisepidemie<br />
in New York mit 4 138 gezählten<br />
Erkrankungsfällen, von denen 88 eine Atemlähmung<br />
erlitten. 1 Dabei wurden erste klinische Erfahrungen<br />
mit <strong>der</strong> Eisernen Lunge gesammelt,<br />
<strong>die</strong> zu einigen Verbesserungen <strong>der</strong> Apparatur<br />
führten. Jedoch trugen beson<strong>der</strong>s<br />
<strong>der</strong> große und schwere Stahltank<br />
und <strong>die</strong> enormen Kosten <strong>für</strong> ein<br />
solches Gerät wenig zu einer größeren<br />
Verbreitung außerhalb <strong>der</strong><br />
USA bei. Im Zuge einer weltweit<br />
grassierenden Epidemie im Jahr<br />
1937 konstruierte <strong>der</strong> australische<br />
Medizinphysiker Edward<br />
Thomas Both in Adelaide nach<br />
dem Vorbild <strong>der</strong> amerikanischen<br />
Eisernen Lunge ein Gerät aus<br />
Sperrholz, dessen Gewicht und<br />
Herstellungskosten weit unter<br />
dem des stählernen Prototyp lagen.<br />
Diese „hölzerne Lunge“ fand rasche<br />
Verbreitung in Großbritannien<br />
und wurde zu Beginn des<br />
Zweiten Weltkriegs in großer<br />
Stückzahl in den Werken des<br />
britischen Automobilherstellers<br />
William Morris (alias Lord Nuffield)<br />
produziert. 2 Obwohl sich<br />
auch in Deutschland <strong>die</strong> Kin<strong>der</strong>lähmung<br />
zunehmend ausbreitete,<br />
war im Zusammenhang mit <strong>der</strong><br />
Aufrüstung und dem inzwischen<br />
ausgebrochenen Zweiten Weltkrieg<br />
an eine Konstruktion <strong>die</strong>ses Beatmungsgerätes<br />
hierzulande nicht zu denken. Laut <strong>der</strong><br />
Habilitationsschrift des Hamburger Arztes Axel<br />
Dönhardt soll es 1941 vorbereitende Besprechungen<br />
<strong>für</strong> den Bau einer deutschen Eisernen<br />
Lunge im Reichsluftfahrtministerium gegeben<br />
haben, jedoch sei eine Fabrikation nie aufgenommen<br />
worden.<br />
69
medizin und wissenschaft<br />
70<br />
Jahre später, 1947/48, kam es in Deutschland zu<br />
einer folgenschweren Epidemie, bei <strong>der</strong> allein<br />
<strong>für</strong> den Großraum Hamburg 228 Poliomyelitiskranke<br />
im Altonaer Krankenhaus behandelt<br />
wurden, von denen nachweislich 31 schwere<br />
Atemstörungen erlitten. 3 In ganz Deutschland<br />
wurden innerhalb <strong>die</strong>ser Epidemie 9 122 Erkrankungsfälle<br />
registriert. 4 <strong>Ein</strong>e Eiserne Lunge<br />
stand den behandelnden Ärzten als Therapiegerät<br />
nicht zur Verfügung.<br />
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges befanden<br />
sich <strong>die</strong> Ärzte <strong>der</strong> amerikanischen sowie<br />
britischen Besatzungsmächte in Deutschland.<br />
Sie waren seit gut einem Jahrzehnt mit <strong>der</strong> Unterdruckbeatmungstechnik<br />
vertraut. Ihre großen<br />
Lazarette hatten sie mit entsprechenden<br />
Geräten ausgestattet. Das ermutigte deutsche<br />
Ärzte, sich um <strong>die</strong> Beschaffung eines Respirators<br />
zu bemühen. Der damalige Leiter des Allgemeinen<br />
Krankenhauses Hamburg Altona, Reinhard<br />
Aschenbrenner, schrieb 1948 in <strong>der</strong><br />
DMW: „Lei<strong>der</strong> sind unsere Bemühungen, <strong>für</strong><br />
<strong>die</strong> Hamburger Pm-Epidemie 1947 eine amerikanische<br />
o<strong>der</strong> englische Eiserne Lunge zu bekommen,<br />
erfolglos geblieben. Nachdem uns<br />
aber schließlich durch <strong>die</strong> Besatzungsbehörde<br />
<strong>die</strong> Besichtigung einer im General-Hospital<br />
Hamburg-Barmbek aufgestellten hölzernen ,Eisernen<br />
Lunge’ dankenswerterweise ermöglicht<br />
worden war, nahmen wir sofort Verhandlungen<br />
mit <strong>der</strong> Deutschen Werft, Hamburg Finkenwer<strong>der</strong>,<br />
auf, <strong>die</strong> uns bereitwilligst sofort ihre Hilfe<br />
zusagte. (...) Die erste unserer Eisernen Lungen<br />
konnte am 12.10.47 in Betrieb genommen werden,<br />
nachdem <strong>die</strong> Belegschaft <strong>der</strong> Deutschen<br />
Werft drei Tage und Nächte lang unermüdlich<br />
an ihrer Fertigstellung gearbeitet hatte.“ 3<br />
Da<strong>für</strong> mussten hohe Hürden überwunden werden,<br />
was aus heutiger Sicht beson<strong>der</strong>s tollkühn<br />
erscheint. Die Hartherzigkeit <strong>der</strong> Besatzungsmächte<br />
erlaubte den deutschen Ärzten erst<br />
nach äußerst zähem und nachdrücklichem Verhandeln<br />
den Zutritt zum Lazarett. Zugelassen<br />
wurde eine einzige Besichtigung des Gerätes.<br />
<strong>Ein</strong> an<strong>der</strong>es Problem bestand in <strong>der</strong> Behebung<br />
<strong>der</strong> Materialnot. Nach Kriegsende war also Erfindungsgeist<br />
gefragt. Mit ihm wurde Erstaunliches<br />
sowie Kontradiktorisches zugleich zustande<br />
gebracht.<br />
Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 10/2008<br />
www.aerzteblatt-sh.de www.aeksh.de www.arztfindex.de<br />
Der Hamburger Prototyp entstand aus Kriegsschrott.<br />
Ausgerechnet ein Torpedobehälter<br />
stellte den luftdichten Tank dar, in dem <strong>die</strong><br />
mögliche Heilung <strong>der</strong> atemgelähmten Poliomyelitispatienten<br />
vollzogen werden sollte. Weitere<br />
Teile des Gerätes waren <strong>der</strong> Blasebalg einer<br />
Feldschmiede, ein Wendegetriebe eines havarierten<br />
Fischkutters und ein Elektromotor. 5<br />
Neben verschiedenen kleineren deutschen Unternehmen<br />
hatten sich zuletzt <strong>die</strong> Lübecker<br />
Dräger-Werke <strong>die</strong> einzelnen Patente gesichert.<br />
Die Dräger-Werke produzierten bis zum Beginn<br />
<strong>der</strong> 1960er Jahre serienmäßig Eiserne Lungen.<br />
Dieses fast monströs und beängstigend wirkende<br />
Beatmungsgerät stellte <strong>für</strong> viele hilflose Patienten<br />
eine Überlebenschance dar. Es soll an <strong>die</strong>ser<br />
Stelle jedoch nicht vergessen sein, dass poliomyelitische<br />
Atemstörungen weitaus komplizierter<br />
Genese sind, als dass <strong>die</strong> Eiserne Lunge den Königsweg<br />
bei <strong>der</strong>en Behandlung darstellte. Nach<br />
Prodromalerscheinungen wie einer aseptischen<br />
Meningitis, Nackensteifigkeit, Muskelschmerzen<br />
und Fieberanstieg können <strong>die</strong> ge<strong>für</strong>chteten<br />
Lähmungen einsetzen. Je nach Ausbreitung <strong>der</strong><br />
viralen Infektion in den Vor<strong>der</strong>hornzellen des<br />
Rückenmarks und Manifestation in höheren<br />
Ebenen bis zu den Kernen des IX. und X. Hirnnervs,<br />
schließlich Befall des Atem- und Kreislaufzentrums<br />
in <strong>der</strong> Medulla oblongata, kann<br />
das Fortschreiten <strong>der</strong> Krankheit unerwartet zum<br />
Stillstand kommen. <strong>Ein</strong>e Rekonvaleszenz mit<br />
Residualschäden innerhalb einiger Monate ist<br />
möglich.<br />
Damit <strong>die</strong>se Phase <strong>der</strong> Erkrankung überhaupt<br />
erreicht werden kann, ist es gegebenenfalls nötig,<br />
<strong>die</strong> zwischenzeitliche Atemlähmung mithilfe<br />
künstlicher Beatmung zu überbrücken. Die häufigste<br />
Todesursache ist <strong>die</strong> <strong>der</strong> Bulbärparalyse.<br />
Durch <strong>die</strong> dabei auftretenden Störungen <strong>der</strong><br />
Schluckbewegung ist eine Zwangsbeatmung mit<br />
<strong>der</strong> Eisernen Lunge kontraindiziert, da <strong>die</strong> Gefahr<br />
besteht, dass Schleim und Speichel geradezu<br />
in <strong>die</strong> Lungen eingesogen werden. Das führt<br />
zu Atelektase und Pneumonie und <strong>die</strong> Remission<br />
<strong>der</strong> gestörten Atmung wird stark beeinträchtigt.<br />
Diese klinischen Erfahrungen erfor<strong>der</strong>ten<br />
eine Sekretabsaugvorrichtung an <strong>der</strong> Eisernen<br />
Lunge. <strong>Ein</strong> durch Tracheotomie eingeführter
In existenzieller Abhängigkeit eines Menschen. Künstliche Beatmung während einer<br />
folgenschweren Poliomyelitisepidemie 1952 in Kopenhagen<br />
Schlauch, verbunden mit <strong>der</strong> Absauganlage, in<br />
<strong>die</strong> oberen Luftwege kann <strong>die</strong> Atemwegsverlegung<br />
verhin<strong>der</strong>n.<br />
<strong>Ein</strong> ganz an<strong>der</strong>er Weg <strong>der</strong> <strong>apparativen</strong> Beatmung<br />
wurde 1952 bei einer verheerenden Poliomyelitisepidemie<br />
in Dänemark eingeschlagen.<br />
Am zuständigen Blegdam-Krankenhaus in Kopenhagen<br />
wurden im Jahr 1952 (zwischen Juli<br />
und Dezember) 2 722 Poliomyelitiskranke aufgenommen,<br />
von denen 866 eine Atemlähmung<br />
aufwiesen. 6 Im Blegdam-Krankenhaus gab es eine<br />
Eiserne Lunge und sechs Cuirass-Respiratoren.<br />
Der Cuirass-Respirator war eine Art Saugglocke,<br />
<strong>die</strong> auf <strong>die</strong> Brust geschnallt wurde.<br />
Durch intermittierenden Über- und Unterdruck<br />
verhalf sie <strong>der</strong> Lunge zum Atmen. Angesichts<br />
<strong>der</strong> großen Patientenzahl und <strong>der</strong> hohen Mortalität<br />
waren möglichst unkonventionelle Lösungen<br />
gefragt, wollte man alle gegen den Erstickungstod<br />
ringenden Patienten gleichzeitig behandeln.<br />
Der damalige Leiter des Krankenhauses H. C.<br />
A. Lassen zog seinen Anästhesisten Bjørn Ibsen<br />
zu Rate, <strong>der</strong> empfahl <strong>die</strong> Patienten zu tracheotomieren<br />
und mithilfe eines von Hand betriebenen<br />
Pendelatemsystems zu behandeln. Diese<br />
Methode war in <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Chirurgie seit länge-<br />
Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 10/2008<br />
www.aerzteblatt-sh.de www.aeksh.de www.arztfindex.de<br />
medizin und wissenschaft<br />
rem bekannt. Sie <strong>die</strong>nte zur<br />
kurzzeitigen Beatmung bei<br />
<strong>der</strong> Anwendung von Relaxantien.<br />
In <strong>der</strong> damaligen<br />
Fachpresse ist von mehreren<br />
Hun<strong>der</strong>t Medizinstudenten<br />
<strong>die</strong> Rede, <strong>die</strong> in verschiedenen<br />
Tagesschichten <strong>die</strong><br />
atemgelähmten Patienten<br />
über Wochen und Monate<br />
ununterbrochen beatmeten<br />
und dadurch <strong>die</strong> Mortalität<br />
stark zurückdrängten.<br />
Die Geschichte <strong>der</strong> Poliomyelitis<br />
skizziert eindrucksvoll<br />
<strong>die</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>der</strong> <strong>apparativen</strong><br />
<strong>Langzeitbeatmung</strong>.<br />
Letztlich mündete sie in <strong>der</strong><br />
Etablierung des verhältnismäßig<br />
jungen Faches <strong>der</strong> Intensivmedizin.<br />
In retrospektiver Betrachtung scheinen verschiedene<br />
Ideen und <strong>Entwicklung</strong>en bescheiden<br />
gewesen zu sein. Trotzdem waren sie innovativ.<br />
In ihrer Wirkung haben sie sich mehr als beeindruckend<br />
bewiesen.<br />
Das außerordentlich emotionale Engagement<br />
<strong>der</strong> Kieler Museumsbesucher gegenüber jenen,<br />
<strong>die</strong> mit <strong>der</strong> Eisernen Lunge beatmet worden<br />
sind, zeigt das vielfach fehlende Bewusstsein gegenüber<br />
dem harten Überlebenskampf früherer<br />
Patientengenerationen, sowie dem teils hilflosen<br />
und dennoch kämpferisch innovativen Handeln<br />
<strong>der</strong> damaligen Ärzte. Die Frage, wer gegenwärtig<br />
vollumfänglich den Fortschritt <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen<br />
Intensivmedizin beanspruchen darf, entscheidet<br />
inzwischen weniger eine materielle Not, denn<br />
mehr <strong>die</strong> finanzielle Ausstattung unseres Gesundheitssystems.<br />
<strong>Ein</strong> nicht unlösbares Problem,<br />
entgegen <strong>der</strong> entscheidenden Frage, wie lange<br />
überhaupt eine technische Assistenz zur Aufrechterhaltung<br />
<strong>der</strong> Vitalfunktionen gewährleistet<br />
sein soll.<br />
Literatur beim Verfasser o<strong>der</strong> im Internet unter<br />
www.aerzteblatt-sh.de<br />
Gerd Koletzko, Münsterberger Weg 60, 12621 Berlin<br />
71