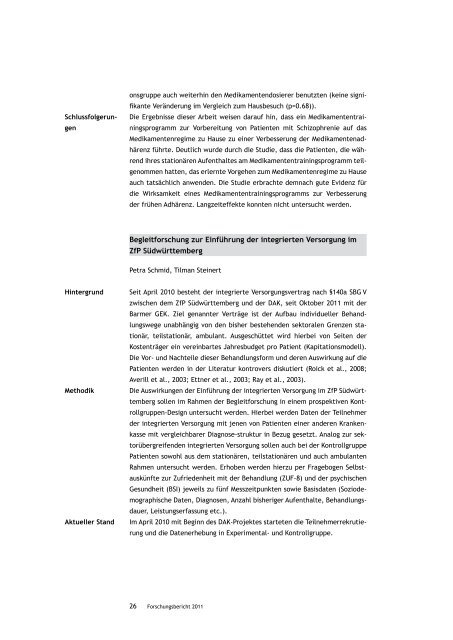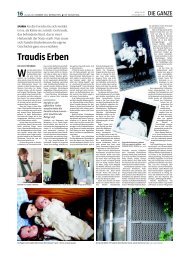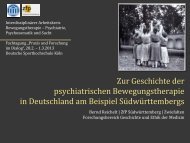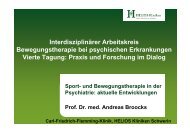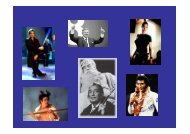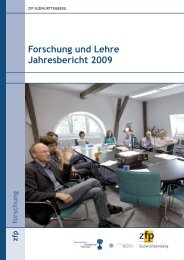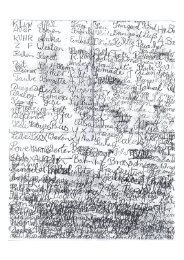Forschungsbericht 2011 - ZfP Südwürttemberg
Forschungsbericht 2011 - ZfP Südwürttemberg
Forschungsbericht 2011 - ZfP Südwürttemberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schlussfolgerun-<br />
gen<br />
Hintergrund<br />
Methodik<br />
Aktueller Stand<br />
onsgruppe auch weiterhin den Medikamentendosierer benutzten (keine signifikante<br />
Veränderung im Vergleich zum Hausbesuch (p=0.68)).<br />
Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen darauf hin, dass ein Medikamententrainingsprogramm<br />
zur Vorbereitung von Patienten mit Schizophrenie auf das<br />
Medikamentenregime zu Hause zu einer Verbesserung der Medikamentenadhärenz<br />
führte. Deutlich wurde durch die Studie, dass die Patienten, die während<br />
ihres stationären Aufenthaltes am Medikamententrainingsprogramm teilgenommen<br />
hatten, das erlernte Vorgehen zum Medikamentenregime zu Hause<br />
auch tatsächlich anwenden. Die Studie erbrachte demnach gute Evidenz für<br />
die Wirksamkeit eines Medikamententrainingsprogramms zur Verbesserung<br />
der frühen Adhärenz. Langzeiteffekte konnten nicht untersucht werden.<br />
Begleitforschung zur Einführung der integrierten Versorgung im<br />
<strong>ZfP</strong> <strong>Südwürttemberg</strong><br />
Petra Schmid, Tilman Steinert<br />
Seit April 2010 besteht der integrierte Versorgungsvertrag nach §140a SBG V<br />
zwischen dem <strong>ZfP</strong> <strong>Südwürttemberg</strong> und der DAK, seit Oktober <strong>2011</strong> mit der<br />
Barmer GEK. Ziel genannter Verträge ist der Aufbau individueller Behandlungswege<br />
unabhängig von den bisher bestehenden sektoralen Grenzen stationär,<br />
teilstationär, ambulant. Ausgeschüttet wird hierbei von Seiten der<br />
Kostenträger ein vereinbartes Jahresbudget pro Patient (Kapitationsmodell).<br />
Die Vor- und Nachteile dieser Behandlungsform und deren Auswirkung auf die<br />
Patienten werden in der Literatur kontrovers diskutiert (Roick et al., 2008;<br />
Averill et al., 2003; Ettner et al., 2003; Ray et al., 2003).<br />
Die Auswirkungen der Einführung der integrierten Versorgung im <strong>ZfP</strong> <strong>Südwürttemberg</strong><br />
sollen im Rahmen der Begleitforschung in einem prospektiven Kontrollgruppen-Design<br />
untersucht werden. Hierbei werden Daten der Teilnehmer<br />
der integrierten Versorgung mit jenen von Patienten einer anderen Krankenkasse<br />
mit vergleichbarer Diagnose-struktur in Bezug gesetzt. Analog zur sektorübergreifenden<br />
integrierten Versorgung sollen auch bei der Kontrollgruppe<br />
Patienten sowohl aus dem stationären, teilstationären und auch ambulanten<br />
Rahmen untersucht werden. Erhoben werden hierzu per Fragebogen Selbstauskünfte<br />
zur Zufriedenheit mit der Behandlung (ZUF-8) und der psychischen<br />
Gesundheit (BSI) jeweils zu fünf Messzeitpunkten sowie Basisdaten (Soziodemographische<br />
Daten, Diagnosen, Anzahl bisheriger Aufenthalte, Behandlungsdauer,<br />
Leistungserfassung etc.).<br />
Im April 2010 mit Beginn des DAK-Projektes starteten die Teilnehmerrekrutierung<br />
und die Datenerhebung in Experimental- und Kontrollgruppe.<br />
Hintergrund und<br />
Fragestellung<br />
26 <strong>Forschungsbericht</strong> <strong>2011</strong> 27 <strong>Forschungsbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
Methode<br />
Methode<br />
Die Einflüsse der antipsychotischen Langzeitbehandlung mit<br />
atypischen Neuroleptika auf die funktionale Beeinträchtigung und<br />
die subjektive Lebensqualität von Patienten mit schizophrenen<br />
Erkrankungen (ELAN-Studie)<br />
Tilman Steinert, Susanne Jaeger, Carmen Pfiffner (Forschungsbeteiligte des<br />
Studienzentrums <strong>ZfP</strong> <strong>Südwürttemberg</strong> – Weissenau)<br />
Beschreibung des Projekts siehe Forschungsprojekte der Arbeitsgruppe For-<br />
schung und Lehre Universität Tübingen<br />
Stationäre Behandlungswege in der Psychiatrie und Psychosoma-<br />
tik für Angst und Depression (PfAD)<br />
Tilmann Steinert, Cornelia Albani, Gerd Weithmann, Dana Bichescu-Burian,<br />
Christina Cerisier, Agata Czekaj, Julia Grempler<br />
Depressionen und Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen.<br />
Die Versorgung dieser Erkrankungen erfolgt in verschieden Bereichen<br />
und Settings: stationär (psychiatrische Kliniken und psychosomatische Krankenhäuser,<br />
Rehabilitationskliniken), teilstationär und ambulant (Fachärzte,<br />
ärztliche und psychologische Psychotherapeuten, PIA). Bisher kaum beforscht<br />
ist die differentielle Indikationsstellung in dem Versorgungssystem und welche<br />
Wege die Patienten aus welchen Gründen nehmen, wenn sie im System<br />
sind. Ziel des geplanten Projekts ist die Untersuchung von vergleichbar großen<br />
Gruppen von Patienten, die wegen Depressionen oder Angststörungen volloder<br />
teilstationär behandelt werden. Die Hauptfragestellung bezieht sich auf<br />
die Faktoren, die den Weg innerhalb des Versorgungssystems beeinflussen und<br />
die bestehenden Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren. Weiter werden<br />
durch das geplante Untersuchungsdesign Fragen bezüglich des Behandlungserfolgs<br />
und der Behandlungskostenentwicklung untersucht.<br />
Dazu sollen Patienten in vier verschiedenen Versorgungsbereichen untersucht<br />
werden: psychiatrische Depressionsstation, psychiatrische Krisenstation, psychiatrische<br />
Tagesklinik und psychosomatische Akutklinik.<br />
Geplant ist eine multizentrische Längsschnittuntersuchung einer Stichprobe<br />
von insgesamt 320 teilnahmefähigen Patienten mit ICD-10 Hauptdiagnosen<br />
nach F3 und F4. Neben einer ausführlichen Symptomerhebung und Diagnosestellung<br />
per semistrukturierter Interviews, Selbst- und Fremdauskünftsbögen<br />
und Checklisten, werden Krankheitsanamnese, Sozialanamnese, Zuweisungsmodus,<br />
Behandlungsmotivation und weiterführende Behandlungswege mittels<br />
Fragebogen erhoben. Darüber hinaus wird an den Messzeitpunkten nach Entlassung<br />
ein Interview durchgeführt (Telephoninterview). Die Daten werden