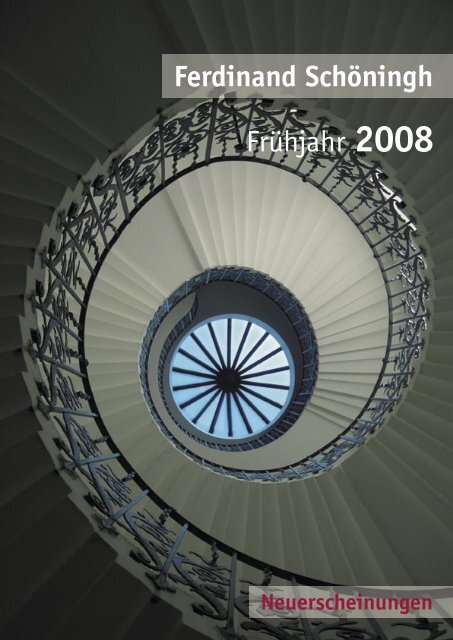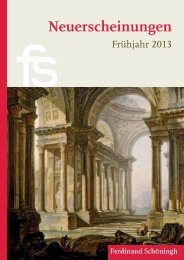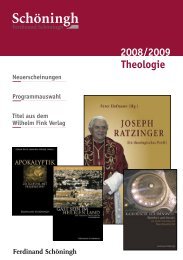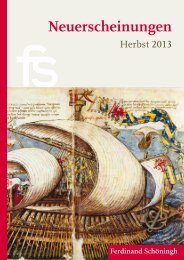geschichte - Verlag Ferdinand Schöningh
geschichte - Verlag Ferdinand Schöningh
geschichte - Verlag Ferdinand Schöningh
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Ferdinand</strong> <strong>Schöningh</strong><br />
Frühjahr 2008<br />
Neuerscheinungen
Inhalt<br />
Geschichte | Politik ................................. S. 3 – 5, 7, 20 – 21<br />
Geschichte .......................................................... S. 6, 8 – 19,<br />
21 – 22, 40, 41<br />
Militär<strong>geschichte</strong> ........................................ S. 9, 15 – 18, 21<br />
UTB | Uni-Taschenbücher .................. S. 22<br />
Pädagogik ............................................................ S. 23 – 27<br />
Literaturwissenschaft ........................... S. 26, 31 – 33<br />
Philosophie ........................................................ S. 28, 30 – 31<br />
Theologie .............................................................. S. 29, 34 – 37<br />
Religionsphilosophie .............................. S. 30<br />
Sozialethik ......................................................... S. 35, 38<br />
Rechtswissenschaft ................................. S. 38 – 39<br />
Kirchen<strong>geschichte</strong> ..................................... S. 40<br />
Kirchenmusik .................................................. S. 40<br />
Nordrhein-Westfälische<br />
Akademie der Wissenschaften .... S. 41<br />
Backlist .................................................................. S. 42, 43<br />
Liebe Leserinnen,<br />
liebe Leser,<br />
im Mittelpunkt unseres Frühjahrsprogramms stehen –<br />
wie gewohnt – Geschichte und Zeitgeschehen, Theologie<br />
und – neuerdings verstärkt – Pädagogik.<br />
Lassen Sie uns Ihren Blick zunächst auf Historisches<br />
lenken, auf die deutschen Jahre von 1933 bis 1945,<br />
auf Afrika, auf die islamische Welt, die USA und, ja,<br />
die europäische Kunst<strong>geschichte</strong>. Konrad H. Jarausch<br />
ediert die Feldpostbriefe seines Vaters von 1939 bis<br />
1942: »Das stille Sterben...« – ein einzigartiges persönliches<br />
Zeugnis über die Verbrechen der Wehrmacht<br />
im Osten, aber auch ein bewegendes Dokument über<br />
die Verantwortung des Einzelnen in der Maschinerie<br />
des Krieges. Um Verantwortung geht es auch in Das<br />
Deutsche Rote Kreuz unter der NS-Diktatur von Birgitt<br />
Morgenbrod und Stephanie Merkenich, einer Arbeit, mit<br />
der das DRK sich seiner eigenen Vergangenheit stellt.<br />
Dasselbe tut für die berühmte Berliner Medizinische<br />
Fakultät Die Charité im Dritten Reich, hrsg. von Sabine<br />
Schleiermacher und Udo Schagen.<br />
Nach Afrika führt uns Eckard Michels, mit der umfassenden<br />
Biographie des »Helden von Deutsch-Ostafrika«,<br />
Lettow-Vorbeck, der nach 1918 zu einer Ikone des Kolonialrevisionismus<br />
wurde. Eine aktuelle Krisenregion, die<br />
zunehmend brisanter wird, behandelt mit gewohnter<br />
Kompetenz der neue Wegweiser zur Geschichte: Sudan.<br />
In Die Länder des Islam verdeutlicht Arnold Hottinger vor der Folie ihrer Geschichte und Traditionen, was die<br />
Invasion der Moderne für islamische Gesellschaften und Identität(en) heute bedeutet.<br />
Die Präsidentschaftswahl in den USA wirft ihre Schatten voraus. Die Primaries sind in vollem Gange. Die Geschichte<br />
der wichtigsten und dramatischsten Wahlen erzählt Ronald D. Gerste in Duell ums Weiße Haus. In Neokonservatismus<br />
und amerikanische Außenpolitik lotet Patrick Keller deren ideologischen Hintergrund und den Einfluss<br />
der Neo-Cons von Reagan bis Bush jr. aus. Und einen Ritt durch Geschichte und Kunst<strong>geschichte</strong> von Dante bis<br />
Napoleon unternimmt Volker Hunecke mit Europäische Reitermonumente.<br />
Unser Pädagogik-Programm wartet mit drei Schwerpunkt-Titeln auf. Das Handbuch der Erziehungswissenschaft<br />
wird mit dem zweiten Band »Schule und Erwachsenenbildung/Weiterbildung« fortgeführt. Der bekannte Bildungsforscher<br />
Dietrich Benner legt seinen Band über Bildungstheorie und Bildungsforschung vor. Den dritten Schwerpunkt<br />
bildet das international erprobte Projekt Erziehung der renommierten Pädagogen Winfried Böhm, Ernesto<br />
Schiefelbein und Sabine Seichter.<br />
Gott ist uns als Referenzort für »Welt« abhanden gekommen. Die Sendung des Paulus von Uwe Jochum stellt<br />
dem trügerischen Sicherheitsversprechen der Diesseitigkeit des Menschen das Jenseitige entgegen, auf das die<br />
Sendung des Apostels zielt: Paulus weist auf Umkehr in eine Welt, die auf Freiheit und Vertrauen gebaut ist.<br />
Das war die Vorschau auf die Vorschau.<br />
Blättern Sie einfach weiter – Sie werden noch viele interessante Bücher entdecken!<br />
Mit den besten Grüßen<br />
Ihr<br />
Dr. Hans J. Jacobs<br />
Lektorat Theologie | Pädagogik<br />
Ihr<br />
Michael Werner<br />
Lektorat Geschichte | Politik<br />
Umschlagabbildung: Wikimedia Commons, URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Borromini_SantIvo.jpg, lizenziert unter GNU-Lizenz für freie Dokumentation (Lizenztext siehe http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GNU_Free_Documentation_License)
GESCHICHTE | POLITIK 3<br />
RONALD D. GERSTE<br />
Duell ums Weiße Haus<br />
Amerikanische Präsidentschaftswahlen<br />
von George Washington bis 2008<br />
Alle vier Jahre wählt Amerika seinen Präsidenten. Kein anderer demokratischer<br />
Prozess ist von so entscheidender Bedeutung auch für den Rest<br />
der Welt. Gebannt blickt sie auf die USA, bestaunt Wahlversammlungen<br />
und Parteitage, deren Inszenierungen der Regie Hollywoods entsprungen<br />
scheinen, verfolgt Fernsehdebatten der Kandidaten und wundert sich über<br />
das eigenartige Wahlsystem, das nach dem Prinzip »Alles dem Sieger«<br />
die Wahlmännerstimmen der einzelnen Staaten ausschließlich einem<br />
Kandidaten zufallen lässt - und das es möglich macht, dass der Kandidat mit<br />
den meisten Wählerstimmen am Ende doch die Wahl verliert.<br />
Die Geschichte der amerikanischen Präsidentschaftswahlen ist voller<br />
Dramatik und kennt »gestohlene« Wahlen ebenso wie Erdrutschsiege, hat<br />
Kandidaten gesehen, die an ihren Skandalen und andere, die an der Rolle<br />
der Medien gescheitert sind. Ronald D. Gerste führt durch eine Geschichte<br />
von Wahlen und Wählern, wie sie einzigartig ist unter den Demokratien der<br />
Welt, und erklärt dabei nicht zuletzt die Besonderheiten des amerikanischen<br />
politischen Systems und seiner Wahlen.<br />
In dem spannenden, streckenweise fast an einen historischen Roman<br />
erinnernden, wissenschaftlich stets korrekten Buch lässt er »Schlachten«,<br />
Debatten und Triumphe wiederaufleben, die Amerikas Schicksal und mit<br />
ihm das der Welt bestimmten: Das Zählfiasko von 2000, ein fast symbolhafter<br />
Auftakt der Präsidentschaft des George W. Bush. Die hauchdünne<br />
Entscheidung zwischen John F. Kennedy und Richard Nixon 1960, als<br />
das Fernsehen endgültig zu einem bestimmenden Wahlfaktor wurde. Die<br />
Neubesinnung Amerikas auf seine Stärken nach dem Wahlsieg Ronald<br />
Reagans. Den Skandal der Wahl von 1876. Wählerentscheide in Zeiten des<br />
Krieges : 1812, 1916, 1940, 2004. Und die Stunden, in denen Amerikas<br />
Heroen ihren Weg zum Ruhm antraten: George Washington, Thomas<br />
Jefferson, Abraham Lincoln und Franklin D. Roosevelt.<br />
2008. ca. 240 Seiten, Abb., Franz. Broschur<br />
ca. € 19,90<br />
ISBN 978-3-506-76539-0<br />
Auslieferung für die Schweiz:<br />
<strong>Verlag</strong> Neue Zürcher Zeitung<br />
Der Autor:<br />
Ronald D. Gerste, Dr. med. und Dr. phil.,<br />
geb. 1957, Studium der Humanmedizin<br />
und Geschichte an der Universität Düsseldorf;<br />
Promotion in beiden Fächern.<br />
Zunächst Tätigkeit als Augenarzt und<br />
freier Journalist. Schreibt für zahlreiche<br />
wissenschaftliche Zeitschriften und<br />
u. a. für die Neue Zürcher Zeitung und<br />
Die Zeit. Lebt seit 2001 als hauptberuflicher<br />
Wissenschaftskorrespondent und<br />
Sachbuchautor in Washington, DC.<br />
Ein gut strukturierter, bestens lesbarer Überblick über die wichtigsten,<br />
dramatischsten und seltsamsten Wahlen der amerikanischen Geschichte!
4 GESCHICHTE | POLITIK<br />
PATRICK KELLER<br />
Neokonservatismus<br />
und amerikanische Außenpolitik<br />
Ideen, Krieg und Strategie<br />
von Ronald Reagan bis George W. Bush<br />
Im Streit um die amerikanische Außen- und Anti-Terror-Politik seit dem<br />
11. September 2001 gibt es einen beherrschenden Kampfbegriff: Neokonservatismus.<br />
Eine Clique neokonservativer Ideologen, so der Vorwurf, habe<br />
den intellektuellen Hintergrund für den neuen amerikanischen Imperialismus<br />
und besonders für den Krieg gegen den Irak geschaffen. Wer aber sind diese<br />
Neocons, was macht den Kern ihres Denkens aus und wie haben sie auf die<br />
Politik der Weltmacht Einfluss genommen?<br />
2008. 374 Seiten, Festeinband<br />
€ 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76528-4<br />
Der Autor:<br />
Patrick Keller, Dr. phil., geb. 1978, Studium<br />
der Politikwissenschaft, Neueren<br />
deutschen Literatur, Amerikanischen<br />
Sprache und Literatur in Bonn und an<br />
der Georgetown University, Washington<br />
DC; seit 2003 wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl<br />
für Politik und Zeit<strong>geschichte</strong> sowie<br />
am Nordamerikastudienprogramm<br />
der Universität Bonn. Schwerpunkte:<br />
Innen- und Außenpolitik der USA, amerikanische<br />
Geistes<strong>geschichte</strong>, internationale<br />
Politik.<br />
Patrick Keller, gründlicher Kenner der amerikanische Geistes<strong>geschichte</strong><br />
und der internationalen Politik, legt die erste in die Tiefe gehende Studie<br />
der Neocons vor. Er schildert, wie eine militante Denkschule und ihre führenden<br />
Vertreter unter den Präsidenten Ronald Reagan und George W. Bush<br />
die amerikanische Strategie prägten – und die USA schließlich mit ihrer<br />
einseitigen Politik der Stärke in das Desaster des Irak-Krieges führten, mit<br />
dessen Folgen nun nicht nur sie zu ringen haben.<br />
In brillanten Portraits der »Väter« der Neocons wie Irving Kristol und<br />
Norman Podhoretz, Henry Jackson und Nathan Glazer zeichnet Keller<br />
zunächst die Entstehungs<strong>geschichte</strong> des Neokonservatismus seit dem in<br />
den 1960er Jahren erfolgten Bruch mit dem Linksliberalismus nach und<br />
entfaltet sodann den ideologischen Hintergrund der Außenpolitiken der<br />
Reagan- und Bush-Administrationen.<br />
Diese erste umfassende und ausgewogene Studie des Neokonservatismus<br />
ist eine fesselnde Pflichtlektüre für alle, die sich in der Beschäftigung mit<br />
den USA und ihrer Politik nicht mit Klischees begnügen wollen.
GESCHICHTE | POLITIK 5<br />
ARNOLD HOTTINGER<br />
Die Länder des Islam<br />
Geschichte, Traditionen und der Einbruch der Moderne<br />
Arnold Hottinger, langjähriger Nahostkorrespondent der Neuen Zürcher<br />
Zeitung, berichtet seit Jahrzehnten über die islamische Welt. Er ist international<br />
hoch geachtet, als einer der ganz wenigen Journalisten, dessen<br />
tiefgründige Analysen auch von der Wissenschaft ernst genommen werden.<br />
Nach seinem großen Buch »Islamische Welt« legt er nun ein neues wichtiges<br />
Werk vor. Darin beleuchtet und analysiert er die heutigen Probleme<br />
der Länder islamischer Religion und Kultur – vor dem Hintergrund ihrer<br />
vielfältigen unterschiedlichen Geschichte(n) und Besonderheiten und<br />
vor der Herausforderung durch die Moderne, mit der sie alle konfrontiert<br />
sind. Der engagierte Vermittler zwischen Orient und Okzident zeichnet ein<br />
vielschichtiges und differenziertes Bild der islamischen Welt, die, wie er<br />
überzeugend darstellt, mit dem Islam, schon gar nicht mit dem Islamismus,<br />
längst nicht hinreichend erklärt und zu verstehen ist, und er verdeutlicht<br />
die Strukturprobleme, die die Invasion der Moderne für diese Welt nach sich<br />
zieht.<br />
Kann eine Religionsgemeinschaft von einer Milliarde Menschen mit unterschiedlichem<br />
historischem und nationalem Hintergrund so homogen sein,<br />
wie sie allgemein vom Westen wahrgenommen wird? Unter dieser Leitfrage<br />
betrachtet Hottinger die islamischen Länder von Ägypten bis zur Türkei,<br />
von Nordafrika bis zum Iran, vom Irak bis Afghanistan und Pakistan. Bei<br />
aller Vielfalt der Mentalitäten und Probleme, die er deutlich vor Augen<br />
führt, ist diesen Ländern doch eines gemeinsam: der Einbruch fremder<br />
Kulturelemente in die überkommene reich differenzierte Welt des Islam,<br />
ein Einbruch, der sie zur Auseinandersetzung mit westlichen Lebensformen<br />
in einer globalisierten Welt zwingt. Eine neue Umwelt tut sich auf, die sich<br />
offenbar anschickt, die Muslime zu überwältigen. Wie gehen sie mit dieser<br />
von ihnen mehr als Bedrohung denn als Chance begriffenen Entwicklung<br />
um? Was nehmen sie an, was lehnen sie ab? Wie schaffen sie es, in einer<br />
zusammenwachsenden Welt ihre Identität zu bewahren? All diesen Fragen<br />
spürt Arnold Hottinger mit großem Wissen und Einfühlungsvermögen nach<br />
– und er warnt eindringlich vor den Gefahren, die eine auf Unkenntnis<br />
basierende Gleichsetzung von Islam, Islamismus und Terrorismus nach sich<br />
zieht.<br />
2008. ca. 336 Seiten, 2 Karten, Festeinband<br />
ca. € 34,90<br />
ISBN 978-3-506-76541-3<br />
Auslieferung für die Schweiz:<br />
<strong>Verlag</strong> Neue Zürcher Zeitung<br />
Der Autor:<br />
Arnold Hottinger, geb. 1926, Arabist<br />
und Orientalist. Drei Jahrzehnte lang<br />
Korrespondent der Neuen Zürcher<br />
Zeitung für den Nahen Osten. Zahlreiche<br />
ausgedehnte Reisen in die islamischen<br />
Länder von Afghanistan bis<br />
Marokko. Zahlreiche Publikationen,<br />
zuletzt »Islamische Welt« (2004).<br />
Vortragstätigkeit und Publizist für<br />
Zeitungen und Rundfunk.<br />
Von Arnold Hottinger:<br />
Islamische Welt<br />
Der Nahe Osten: Erfahrungen,<br />
Begegnungen, Analysen<br />
2004. 752 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag<br />
€ 24,90<br />
ISBN 978-3-506-71800-6<br />
Gottesstaaten<br />
und Machtpyramiden<br />
Demokratie in der islamischen Welt<br />
2000. 480 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag<br />
€ 19,90<br />
ISBN 978-3-50673947-6
6 GESCHICHTE<br />
ANNETTE KATZER<br />
Araber in deutschen Augen<br />
Das Araberbild der Deutschen<br />
vom 16. bis zum 19. Jahrhundert<br />
2008. ca. 416 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 44,90/sFr 76,-<br />
ISBN 978-3-506-76400-3<br />
Nicht erst, seit Öl und Islamismus ihr Bild und ihre<br />
Wahrnehmung bestimmen, beschäftigen sich Deutsche<br />
mit den Arabern. Schon im 16. Jahrhundert begann<br />
ein Araberbild zu entstehen, das mangels engerer<br />
Beziehungen allerdings noch diffus war. Die Araber<br />
blieben zunächst »bekannte Unbekannte«. Mit wachsendem<br />
geographischem und kulturellem Wissen<br />
jedoch erfuhren sie eine genauere, im Wandel der<br />
Zeiten wechselnde Beurteilung, schwankend zwischen<br />
den Polen von Diffamierung, Kriminalisierung und<br />
Glorifizierung.<br />
Annette Katzer beschreibt in ihrer detailreichen Studie<br />
Entstehen und Entwicklung des deutschen Araberbildes<br />
bis zum 19. Jahrhundert. Sie bezieht Faktoren wie<br />
Religion, geistesgeschichtliche Strömungen und politische<br />
Interessen ebenso ein wie die Bedingungen von<br />
Kulturkontakten und individuellen Wahrnehmungen.<br />
Die farbige Darstellung macht Mechanismen der<br />
Stereotypenbildung deutlich, die uns gerade heute<br />
bedenkenswert erscheinen sollten.<br />
Die Autorin:<br />
Annette Katzer, Dr. phil., geb. 1966, Studium der Geschichte und<br />
Anglistik in Köln, Bochum und Essen; Studienrätin für Englisch<br />
und Geschichte an einem Duisburger Gymnasium.<br />
ERWIN OBERLÄNDER | VOLKER KELLER (HRSG.)<br />
Kurland<br />
Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum<br />
zur russischen Provinz. Ausgewählte Dokumente<br />
zur Verfassungs<strong>geschichte</strong> 1561 – 1795<br />
2008. ca. 304 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 58,-/sFr 98,-<br />
ISBN 978-3-506-76536-9<br />
Das Herzogtum Kurland, 1561 aus Resten des livländischen<br />
Ordensstaates entstanden und 1795 untergegangen,<br />
nimmt in seiner Entwicklung – deutscher Herzog<br />
und deutscher Adel, lettische Bauernschaft, polnischlitauischer<br />
Lehnsherr und russische Zaren als Garanten<br />
der Adelsprivilegien – unter den Territorialherrschaften<br />
der Frühen Neuzeit eine Sonderstellung ein.<br />
Der Kampf um die Vorherrschaft zwischen Herzog<br />
und Ritterschaft, der von den rivalisierenden Nachbarmächten<br />
Schweden, Polen-Litauen und Russland stark<br />
beeinflusst wurde, prägte die gesamte Geschichte des<br />
Herzogtums. Er sucht in der deutschen Verfassungs<strong>geschichte</strong><br />
seinesgleichen, doch hat er in der jüngeren<br />
Diskussion zum Absolutismus kaum Beachtung<br />
gefunden. Die vorliegende Edition schwer zugänglicher<br />
Quellen eröffnet einen neuen Zugang zur Geschichte<br />
dieses ebenso eigenartigen wie interessanten Herzogtums.<br />
Die Herausgeber:<br />
Erwin Oberländer, Prof. Dr. Dr. h.c. (em.), geb. 1937, war bis<br />
2002 Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität<br />
Mainz.<br />
Volker Keller, Dr. phil., geb. 1961, ist als Gymnasiallehrer tätig.
GESCHICHTE | POLITIK 7<br />
WEGWEISER ZUR GESCHICHTE<br />
Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Potsdam<br />
Sudan<br />
Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes<br />
herausgegeben von Dieter H. Kollmer und Andreas Mückusch<br />
Der neueste Band der erfolgreichen »Wegweiser zur Geschichte« befasst<br />
sich mit einer Konfliktzone der Weltpolitik, die immer größeres Gewicht<br />
erlangt: Bürgerkrieg zwischen islamischen und nicht-islamischen Gruppen,<br />
Massenmorde, Vertreibungen, Darfur und die immer schärfere internationale<br />
Konkurrenz um Öl sind die Stichworte. Zuverlässig und verständlich<br />
wie gewohnt führt der Band in Geschichte und Gegenwart, Religionen und<br />
Kulturen einer faszinierenden Region ein.<br />
Zwar schlossen im Jahre 2005 nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs der Norden und der Süden der<br />
Islamischen Republik Sudan einen Friedensvertrag, doch ist die politische Führung in der Hauptstadt<br />
Khartum bis heute den Nachweis darüber schuldig geblieben, dass sie die nicht-islamische und<br />
nicht-arabische Bevölkerung des Südens tatsächlich an der Macht beteiligen möchte. Die Kämpfe<br />
im Süden und in Darfur hinterließen eine in Gruppen zerfallene Gesellschaft, die das Vertrauen in<br />
eine zentrale Regierung und den Glauben an gewaltfreie politische Teilhabe erst noch lernen muss.<br />
Vielfältige Konflikte behindern bis heute die Ausbildung von Stabilität und Wohlstand in dem von<br />
zahlreichen Ethnien bewohnten Land. Seit dem Sommer 2004 engagiert sich nach der Afrikanischen<br />
Union nun auch die UNO aktiv im Friedensprozess, die Bundesrepublik entsendet unter anderem<br />
Militärbeobachter.<br />
2008. 236 Seiten, zahlreiche, durchgehend<br />
farbige Abb. und Karten, kart.<br />
ca. € 13,90/sFr 23,-<br />
ISBN 978-3-506-76396-9<br />
Der neue »Wegweiser zur Geschichte« bietet in drei Abschnitten umfassende Informationen über<br />
Geschichte und Kultur des Sudan. Renommierte Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Politik<br />
und Bundeswehr zeichnen zunächst die wichtigsten historischen Entwicklungslinien sowie die<br />
Entstehung der aktuellen Konflikte nach. In einem zweiten Teil: »Strukturen und Lebenswelten«,<br />
stehen die staatspolitischen Probleme, das gesellschaftliche Gefüge sowie Religion, Wirtschaft und<br />
Kultur des Landes im Vordergrund. Der Anhang enthält eine Zeittafel, Literaturtipps und Internetlinks.<br />
Zahlreiche vierfarbige Karten erschließen die historische Geographie des Großraums.<br />
Weitere Wegweiser zur Geschichte:<br />
Naher Osten<br />
2007. 264 Seiten, kart.<br />
€ 14,90/sFr 26,80<br />
ISBN 978-3-506-76371-6<br />
Kosovo<br />
2006. 240 Seiten, kart.<br />
€ 13,90/sFr 25,10<br />
ISBN 978-3-506-75665-7<br />
Demokratische Republik<br />
Kongo<br />
2., durchges. Auflage 2006. 216 Seiten, kart.<br />
€ 12,90/sFr 23,50<br />
ISBN 978-3-506-75745-6<br />
Horn von Afrika<br />
2007. 288 Seiten, kart.<br />
€ 14,90/sFr 26,30<br />
ISBN 978-3-506-76397-6<br />
Afghanistan<br />
2., durchges. u. erw. Auflage 2007. 264 Seiten, kart.<br />
€ 14,90/sFr 26,30<br />
ISBN 978-3-506-75664-0<br />
Bosnien-<br />
Herzegowina<br />
2., durchges. u. erw. Auflage 2007. 216 Seiten, kart.<br />
€ 12,90/sFr 23,50<br />
ISBN 978-3-506-76428-7
8 GESCHICHTE<br />
VOLKER HUNECKE<br />
Europäische Reitermonumente<br />
Ein Ritt durch die Geschichte Europas<br />
von Dante bis Napoleon<br />
Reiterdenkmäler als Ausdruck herrscherlicher Pracht und herrscherlichen<br />
Willens durchziehen die europäische Geschichte. Mit dem Römischen Reich<br />
ging das Reitermonument in seiner vornehmsten Gestalt, dem überlebensgroßen<br />
ehernen Abbild, für lange Jahrhunderte unter. Im Italien der<br />
Renaissance wurde es wiedergeboren, die eisernen Herrscher bestiegen<br />
wieder ihre ehernen Rosse, zur Mehrung ihres Ruhmes. Reitermonumente<br />
breiteten sich von nun an als Symbole und wesentliche Bestandteile der<br />
Inszenierung von Fürstenmacht über ganz Europa aus.<br />
2008. ca. 296 Seiten, 130 Abb., Festeinband,<br />
Großformat<br />
ca. € 49,90/sFr 84,-<br />
ISBN 978-3-506-76552-9<br />
Der Titel erscheint in Gemeinschaftsproduktion<br />
mit dem Wilhelm Fink <strong>Verlag</strong><br />
Der Autor:<br />
Volker Hunecke, geb. 1940, Dr. phil.,<br />
1978 – 2007 Professor für Neuere Geschichte<br />
an der Technischen Universität<br />
Berlin; zahlreiche Veröffentlichungen<br />
insbesondere zur Geschichte Italiens<br />
und Frankreichs.<br />
Volker Hunecke legt einen eindrucksvollen, reich bebilderten Überblick<br />
über alle künstlerisch, politisch und symbolgeschichtlich bemerkenswerten<br />
Reitermonumente vor, die in dem halben Jahrtausend zwischen Dante und<br />
Napoleon entstanden. Die glänzend geschriebene Darstellung ist gleichsam<br />
ein Ritt durch die europäische Geschichte, der sich von der Blüte der italienischen<br />
Stadtrepubliken bis zu den Massakern der Französischen Revolution<br />
an den ehernen Reitern der Monarchie erstreckt und der den Leser von<br />
Sizilien bis nach Skandinavien, von Lissabon bis nach St. Petersburg führt.<br />
Die eingehenden Analysen der verschiedenen Monumente lassen Hauptstationen<br />
der europäischen Geschichte im Spiegel der Kunst lebendig<br />
werden: das Freiheitsstreben der italienischen Kommunen, die Entstehung<br />
von Signorie und modernem Fürstenstaat; das Ringen um Hegemonie<br />
und Gleichgewicht unter den großen Mächten; Erstarken und Ausbreitung<br />
des Absolutismus; die Souveränitätsansprüche der großen Reichsstände;<br />
die Entfaltung des modernen Russland. Im 18. Jahrhundert kündigt<br />
sich dann in Westeuropa bereits, wie Hunecke vor Augen führt, eine Art<br />
»Verbürgerlichung« des fürstlichen Denkmals an, die auf das 19. und 20.<br />
Jahrhundert mit seinen vielen, aber künstlerisch weniger bemerkenswerten<br />
Reiterstatuen vorausweist.
GESCHICHTE | MILITÄRGESCHICHTE 9<br />
ECKARD MICHELS<br />
»Der Held von Deutsch-Ostafrika«:<br />
Paul von Lettow-Vorbeck<br />
Ein preußischer Kolonialoffizier<br />
Die glänzend geschriebene Biographie eines der populärsten deutschen<br />
Generäle des Ersten Weltkriegs. Der Kommandeur der deutschen Schutztruppe<br />
in Ostafrika kapitulierte nach erbitterten vierjährigen Kämpfen erst zwei<br />
Wochen nach Kriegsende in Europa. Angeblich »im Felde unbesiegt«, wurde<br />
er nach 1918 zu einer Ikone der Republikgegner und Kolonialrevisionisten.<br />
Eckard Michels, Autor des vielbeachteten Standardwerks »Deutsche in der<br />
Fremdenlegion«, zeichnet in seiner spannenden Biographie mit klaren Strichen<br />
das Leben eines Kolonialoffiziers, dessen Werdegang und Lebenswelt<br />
bis 1914 ihn als typischen Repräsentanten adeliger preußischer Militärdynastien<br />
ausweisen. Obwohl Lettow-Vorbeck wesentliche Teile seiner Karriere<br />
in Übersee verbrachte, in China, Deutsch-Südwest- und Deutsch-Ostafrika,<br />
blieb er in seinem Denken und Handeln ganz mitteleuropäisch geprägt.<br />
Die Darstellung ist für den deutschen Sprachraum zugleich die erste aus den<br />
Quellen geschriebene, wissenschaftlich fundierte Geschichte des Krieges in<br />
Ostafrika, der Lettow-Vorbeck berühmt machte. Das Buch verdeutlicht, dass<br />
dieser Krieg kein »ritterlicher Kampf« zwischen der von ihm befehligten<br />
deutschen Schutztruppe und ihren weit überlegenen britischen, südafrikanischen,<br />
belgischen und portugiesischen Gegnern war, sondern ein rücksichtsloser<br />
Kleinkrieg, der vor allem eine humanitäre Katastrophe für die<br />
afrikanische Zivilbevölkerung bedeutete.<br />
Abschließend widmet sich der Autor der Rolle des »Löwen von Afrika« bei<br />
der Instrumentalisierung »seines« Krieges für den Kolonialrevisionismus<br />
der Weimarer Republik und des Dritten Reiches, mit dem Lettow-Vorbeck<br />
bereitwillig kollaborierte. Die von ihm selbst sorgsam gepflegten Legenden<br />
vom ritterlichen Krieg in Ostafrika, von »Heia Safari« und treuen Askaris<br />
verschafften dem Pour-le-Mérite-Träger über seinen Tod 1964 hinaus fortdauernde<br />
Popularität in der Bundesrepublik und im angelsächsischen Raum.<br />
Michels leuchtet den gesellschaftlichen Hintergrund aus, vor dem diese<br />
Legenden entstehen und überdauern konnten.<br />
2008. 360 Seiten, zahlr. Abb.,<br />
Festeinband mit Schutzumschlag<br />
ca. € 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76370-9<br />
Der Autor:<br />
Eckard Michels, Dr. phil. habil., geb.<br />
1962, studierte Geschichte, Öffentliches<br />
Recht und Politische Wissenschaften<br />
in Hamburg, nach Tätigkeit für die<br />
Universität der Bundeswehr in Hamburg,<br />
das Haus der Geschichte der<br />
Bundesrepublik Deutschland in Bonn<br />
und für die OSZE in Bosnien seit 1997<br />
Dozent für Geschichte am Birkbeck<br />
College der University of London.<br />
Vom selben Autor:<br />
Deutsche in der Fremdenlegion 1870 – 1965<br />
Mythen und Realitäten<br />
5., durchgesehene Auflage 2006.<br />
362 Seiten, 16 Seiten Bildteil, kart.<br />
€ 24,90/sFr 44,-<br />
ISBN 978-3-506-75718-0<br />
»Ein ebenso faszinierendes wie facettenreiches Bild der Fremdenlegion.«<br />
Handelsblatt
10 GESCHICHTE<br />
WOLFGANG FRISCHBIER<br />
Heinrich Abeken 1809 – 1872<br />
Eine Biographie<br />
2008. ca. 620 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag<br />
ca. € 78,-/sFr 132,-<br />
ISBN 978-3-506-76538-3<br />
= Otto-von-Bismarck-Stiftung. Wissenschaftliche Reihe, Band 9<br />
Die erste wissenschaftliche Biographie des engsten<br />
Mitarbeiters Bismarcks in der Reichsgründungszeit, der<br />
viel mehr war als »Bismarcks Feder«, wie manche ihn<br />
abschätzig genannt haben.<br />
Als Erster Rat der Politischen Abteilung nahm Abeken<br />
einen besonderen Rang ein. In der labyrinthischen<br />
Schleswig-Holstein-Frage bereitete er Bismarcks ersten<br />
durchschlagenden Erfolg vor. Als bevorzugter<br />
Reisebegleiter Wilhelms I. wurde Abeken unersetzbarer<br />
Koordinator zwischen dem König und seinem<br />
Ministerpräsidenten. In Bad Ems 1870 und in Versailles<br />
erlebte Abeken den Höhepunkt seiner politischen<br />
Wirksamkeit.<br />
Theologe, preußischer Gesandtschaftsprediger in Rom, Mitbegründer<br />
des anglikanisch-preußischen Gemeinschaftsbistums Jerusalem, rechte<br />
Hand des Ägyptologen Richard Lepsius während der großen preußischen<br />
Expedition an den Nil, Bildungsbürger, Stammgast in den führenden<br />
Berliner Salons – das sind Stationen eines facettenreichen Lebens, das<br />
auf einer breiten Grundlage neu erschlossenen Quellenmaterials erstmals<br />
aus dem Schatten Bismarcks herausgeholt wird.<br />
Der Autor:<br />
Wolfgang Frischbier, geb. 1957, Studium der Politikwissenschaft,<br />
Germanistik und Geschichtswissenschaft in Frankfurt/Main.<br />
Oberstudienrat an einem Darmstädter Gymnasium.<br />
HORST GROEPPER<br />
Bismarcks Sturz<br />
und die Preisgabe des<br />
Rückversicherungsvertrages<br />
Herausgegeben von Maria Tamina Groepper<br />
2008. ca. 604 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 88,-/sFr 149,-<br />
ISBN 978-3-506-76540-6<br />
»Die Entente zwischen Frankreich und Russland ist<br />
heute eine vollendete Tatsache. Dieses Bündnis – ist es<br />
nicht der General v. Caprivi, der es geschaffen hat? Und<br />
dafür hatte Wilhelm II. ihn, Bismarck, weggejagt!« So<br />
sah der französische Botschafter in Berlin die Wende in<br />
Europa nach Bismarcks Entlassung im März 1890.<br />
Anhand deutscher, französischer und russischer Quellen rekonstruiert<br />
Horst Groepper, der ehemalige Botschafter der Bundesrepublik<br />
Deutschland in Moskau (1962 – 1966), das Drama um Bismarcks Sturz mit<br />
seinen außenpolitischen Ursachen und Folgen. Es gelingt ihm, auf der<br />
Basis seines reichen Quellenmaterials und durch eine kritische detaillierte<br />
Analyse des berühmten Rückversicherungsvertrages, neues Licht<br />
auf Bismarcks friedenserhaltende Bündnispolitik zu werfen und die auf<br />
Holstein zurückgehende These von der »Unvereinbarkeit« der Verträge<br />
zu korrigieren.<br />
Maria Tamina Groepper, die Tochter des 2002 verstorbenen Autors, hat<br />
sein Manuskript für den Druck vorbereitet und seine Arbeit in einem<br />
ausführlichen Essay in den Zusammenhang der Forschung gestellt.<br />
Der Autor:<br />
Horst Groepper (1909 – 2002), Botschafter a.D., Volljurist, war<br />
dreimal auf diplomatischem Posten in Moskau: 1939 – 1941 als<br />
Legationssekretär unter Botschafter Graf von der Schulenburg,<br />
der ihn 1943 als Unterhändler für die von Hitler abgelehnten<br />
Gespräche über einen Sonderfrieden mit der UdSSR vorschlug;<br />
1956 – 1960 als Botschaftsrat; 1962 – 1966 als Botschafter.
GESCHICHTE 11<br />
KONRAD JARAUSCH<br />
»Das stille Sterben...«<br />
Feldpostbriefe aus Polen und Russland 1939 – 1942<br />
Hrsg. von Konrad H. Jarausch und Klaus Jochen Arnold<br />
Mit einem Geleitwort von Hans-Jochen Vogel<br />
Die Briefe Dr. Konrad Jarauschs dokumentieren wie kaum ein anderes<br />
Zeugnis eines deutschen Soldaten den Alltag des Vernichtungskrieges im<br />
Osten. Ihre Genauigkeit und ihre Offenheit sind einzigartig. Mit scharfem<br />
Blick beschreibt der Verfasser, Feldwebel d. R., promovierter Theologe und<br />
Germanist, das Leben der Truppe, ihren Umgang mit dem Gegner und das,<br />
was seine Erlebnisse und Beobachtungen in ihm auslösen.<br />
Ein erregendes Buch, das neues Licht auf den Themenkomplex »Verbrechen<br />
der Wehrmacht« wirft, aber auch die Frage nach der Verantwortung des<br />
Einzelnen in der Maschinerie des Krieges neu stellt.<br />
Bis heute mangelt es an genauen Augenzeugenberichten über das<br />
Massensterben sowjetischer Kriegsgefangener im Winter 1941/42, das<br />
lange Zeit zu den vernachlässigten Aspekten des nationalsozialistischen<br />
Eroberungskrieges im Osten gehörte. Die Briefe Jarauschs sind die ersten,<br />
die ausführlich ein erschütterndes Zeugnis ablegen. Der Küchenleiter in<br />
einem Gefangenenlager schildert schonungslos und zugleich mitfühlend<br />
das schier unvorstellbare Elend der in deutsche Hand gefallenen Rotarmisten.<br />
Ihre Offenheit und ihr Reflexionsniveau lassen die Briefe Jarauschs weit<br />
über die Masse der bekannten Feldpostbriefe hinausragen. Sie dokumentieren<br />
in seltener Eindringlichkeit, wie ein deutschnationaler protestantischer<br />
Bildungsbürger, der anfangs den Krieg bejaht, unter dem Eindruck<br />
dessen, was er dann in ihm erlebt und sieht, innerlich zum Gegner des<br />
Regimes wird, das diesen Krieg angezettelt hat.<br />
Die Briefe Konrad Jarauschs wurden von seinem Sohn Konrad H. Jarausch<br />
gesammelt, der den an Fleckfieber verstorbenen Vater niemals kennenlernte.<br />
Der bekannte Historiker begibt sich in einer längeren Einführung<br />
auf eine schwierige »Vatersuche« und setzt sich kritisch mit dem »Vorbild<br />
eines virtuellen Übervaters« auseinander. Gleichzeitig ordnet Klaus J.<br />
Arnold die Briefe in den Rahmen des Krieges und in die Diskussion um die<br />
Wehrmachtverbrechen ein.<br />
2008. ca. 372 Seiten, zahlr. bisher unveröffentlichte<br />
Abb., Festeinband mit Schutzumschlag<br />
ca. € 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76546-8<br />
Die Herausgeber:<br />
Konrad H. Jarausch, geb. 1941, ist<br />
Senior Fellow am Zentrum für Zeithistorische<br />
Forschung, Potsdam und Lurcy<br />
Professor of European Civilization an<br />
der University of North Carolina in<br />
Chapel Hill. Zahlreiche Veröffentlichungen<br />
zur deutschen und europäischen<br />
Geschichte.<br />
Klaus Jochen Arnold, Dr. phil., geb.<br />
1968, veröffentlichte eine mit dem<br />
Werner-Hahlweg-Preis für Militär<strong>geschichte</strong><br />
ausgezeichnete Studie zur<br />
Besatzungspolitik der Wehrmacht in<br />
der Sowjetunion. Bearbeiter des DFG-<br />
Projekts des Brandenburgischen Landeshauptarchivs<br />
und Zentrums für<br />
Zeithistorische Forschung Potsdam zu<br />
»Demontagen in der SBZ und Berlin<br />
1945 – 1948 – Sachthematisches Inventar«.<br />
2006/2007 Lehrbeauftragter an<br />
der Universität Leipzig.
12 GESCHICHTE<br />
SABINE SCHLEIERMACHER | UDO SCHAGEN (HRSG.)<br />
Die Charité im Dritten Reich<br />
Zur Dienstbarkeit medizinischer Wissenschaft<br />
im Nationalsozialismus<br />
In der nationalsozialistischen Medizin war das ärztliche Ethos vom Heilen<br />
in sein Gegenteil, in das der Vernichtung verkehrt worden. Die Mitglieder<br />
der medizinischen Fakultäten waren so weit in das NS-System eingebunden,<br />
dass zahlreiche Professoren und Dozenten 1946/47 zu den Angeklagten des<br />
Nürnberger Ärzteprozesses gehörten.<br />
Die politischen Machthaber stießen auf die bereitwillige Unterstützung der<br />
medizinischen Wissenschaft. Sie lieferte Kriterien für die Differenzierung<br />
zwischen als »höherwertig« und »lebensunwert« kategorisierten Menschen,<br />
für Rassenbiologie und Rassenhygiene, für Zwangssterilisierung und<br />
Menschenversuche.<br />
2008. ca. 264 Seiten, kart.<br />
ca. € 19,90/sFr 35,90<br />
ISBN 978-3-506-76476-8<br />
Die Herausgeber:<br />
Sabine Schleiermacher, Mag. theol., Dr.<br />
rer. medic., geb. 1957, seit 1999 wiss.<br />
Angestellte Forschungsstelle Zeit<strong>geschichte</strong>,<br />
Institut für Geschichte der<br />
Medizin, Charité/Berliner Hochschulmedizin.<br />
Udo Schagen, Dr. med., geb. 1939,<br />
Studium der Medizin in München, Münster,<br />
Innsbruck, Hamburg; 1986 – 2004<br />
Leiter der Forschungsstelle Zeit<strong>geschichte</strong><br />
im Institut für Geschichte der<br />
Medizin der Charité/Berliner Hochschulmedizin;<br />
2003 – 2006 wiss. Leiter<br />
(gem. mit S. Schleiermacher) DFG-Projekt<br />
»Wissenschaftlicher Anspruch und<br />
staatliches Interesse. Die Hochschulmedizin<br />
an der Charité im Wechsel<br />
staatlicher Systeme 1933 und 1945«.<br />
Das vorliegende Buch befasst sich mit diesem Thema am Beispiel der<br />
angesehensten deutschen Klinik ihrer Zeit, der Charité. Zu ihren herausragenden<br />
Gestalten gehörte der Chirurg <strong>Ferdinand</strong> Sauerbruch. Er hatte<br />
viele prominente Patienten; unter ihnen befand sich 1943 auch der Kopf<br />
des militärischen Widerstandes gegen Hitler, Generaloberst Beck.<br />
Gegenstand des Buches, das exemplarischen Charakter beanspruchen kann,<br />
sind die Mitglieder der Berliner Medizinischen Fakultät, an die schon vor<br />
1933 die berühmtesten Ärzte und Wissenschaftler des Deutschen Reiches<br />
berufen worden waren. Sie stützten die Ziele nationalsozialistischer<br />
Gesundheits- und Hochschulpolitik und beteiligten sich freiwillig und aktiv<br />
an menschenverachtenden und menschenvernichtenden Forschungen im<br />
Zeichen des »wissenschaftlichen Fortschritts«.<br />
Kritisch dargestellt werden u.a. das wissenschaftspolitische Engagement<br />
<strong>Ferdinand</strong> Sauerbruchs, das eugenische Denken des Gynäkologen Walter<br />
Stoeckel, die Untersuchungen an Hingerichteten durch Hermann Stieve,<br />
die Vorstellungen zu Sterilisation und »Euthanasie« der Psychiater Karl<br />
Bonhoeffer und Maximinian de Crinis, die menschenverachtenden Versuche<br />
Georg Bessaus an Kindern, aber auch die liberale Weltanschauung des<br />
Pharmakologen Wolfgang Heubner.
GESCHICHTE 13<br />
BIRGITT MORGENBROD | STEPHANIE MERKENICH<br />
Das Deutsche Rote Kreuz<br />
unter der NS-Diktatur<br />
1933 – 1945<br />
Mit einem Geleitwort von Rudolf Seiters<br />
und einem Vorwort von Hans Mommsen<br />
Das Schicksal und die Rolle des Deutschen Roten Kreuzes in den Jahren von<br />
1933 bis 1945 sind in Forschung und Öffentlichkeit lange verdrängt worden.<br />
Die von den Historikerinnen Birgitt Morgenbrod und Stephanie Merkenich<br />
vorgelegte, vom Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes in Auftrag gegebene<br />
Monographie behandelt das Thema nun erstmals in umfassender Form.<br />
Bereits im Frühjahr 1933 geriet das DRK ins Visier der neuen Machthaber<br />
und wurde schon bald in den radikalen Umbau von Staat und Gesellschaft<br />
eingefügt. Als einzige deutsche Massenorganisation außerhalb der NSDAP<br />
und ihrer Gliederungen avancierte das Rote Kreuz zu einer interessanten<br />
Größe im Machtkampf der NS-Führungseliten untereinander. Der SS gelang<br />
es schließlich, sich den entscheidenden Einfluss auf Form und Arbeit der<br />
deutschen Rotkreuz-Gesellschaft und darüber hinaus die Verfügungsgewalt<br />
über deren personelle und materielle Ressourcen zu sichern.<br />
Die Verfasserinnen zeichnen diffenziert und mit kritischem Blick den Weg<br />
des DRK in den NS-Staat und damit die Transformation eines vielschichtigen<br />
Wohlfahrtsverbandes in eine rein auf den militärischen Sanitätsdienst orientierte<br />
Organisation nach. Sie analysieren die Konflikte, die sich aus der<br />
Spannung zwischen dem Totalitätsanspruch des Regimes und dem Status<br />
des DRK als freiwillige Hilfsgesellschaft im Sinne der Genfer Konvention<br />
ergaben, und sie machen deutlich, dass der Grat, der das DRK von den<br />
menschenverachtenden Praktiken der nationalsozialistischen Herrschaft<br />
trennte, in einigen Bereichen sehr schmal war.<br />
2008. ca. 520 Seiten, zahlreiche Abb.,<br />
Festeinband mit Schutzumschlag<br />
ca. € 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76529-1<br />
Die Autorinnen:<br />
Birgitt Morgenbrod, Dr. phil., geb. 1955,<br />
Studium der Geschichte und Germanistik<br />
in Düsseldorf, wiss. Mitarbeiterin<br />
an den historischen und sozialwissenschaftlichen<br />
Seminaren der Universitäten<br />
Düsseldorf und Heidelberg<br />
sowie der Bayerischen Akademie der<br />
Wissenschaften in München. Seit 1998<br />
freiberufliche Historikerin.<br />
Stephanie Merkenich, Dr. phil., geb.<br />
1967, Studium der Geschichte und Germanistik<br />
in Bonn, Tübingen und Düsseldorf,<br />
zunächst wiss. Mitarbeiterin<br />
am historischen Seminar der Universität<br />
Düsseldorf, danach Referentin im<br />
Deutschen Bundestag. Seit 1998 freiberufliche<br />
Historikerin.
14 GESCHICHTE<br />
Die nationalsozialistische<br />
»Aktion T4« und ihre Opfer<br />
Historische Bedingungen und ethische Konsequenzen<br />
für die Gegenwart<br />
Herausgegeben von Maike Rotzoll, Gerrit Hohendorf, Petra Fuchs,<br />
Paul Richter, Christoph Mundt, Wolfgang U. Eckart<br />
2008. 400 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 48,-/sFr 81,-<br />
ISBN 978-3-506-76543-7<br />
= Sammlung <strong>Schöningh</strong> zur Geschichte und Gegenwart<br />
SABINE KIENITZ<br />
Beschädigte Helden<br />
Kriegsinvalidität und Körperbilder 1914 – 1923<br />
2008. ca. 408 Seiten, zahlr. Abb. Festeinband<br />
ca. € 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76537-6<br />
= Krieg in der Geschichte, Band 41<br />
Die öffentlich sichtbare Figur des Kriegsinvaliden<br />
gehört zu den schockierenden Folgen des Ersten<br />
Weltkriegs. Allein in Deutschland waren es rund 2,7<br />
Millionen Männer aller Altersstufen und Gesellschaftsschichten,<br />
die als hilflose menschliche Wracks den<br />
Krieg überlebten. Als ein lebendiges Relikt des Krieges<br />
war der Kriegsinvalide ein offenes Symbol, das je<br />
nach Perspektive und Interessenlage unterschiedlich<br />
gedeutet werden konnte: Er verkörperte die militärische<br />
Niederlage und diente Pazifisten als Mahnung<br />
wie gleichermaßen Revanchisten und Kriegstreibern<br />
als Option. Mit seinen industriell gefertigten Prothesen<br />
war er zugleich ein nationales Symbol für den Sieg<br />
deutscher Ingenieurskunst und die medizinisch-technische<br />
Überwindung der Kriegsfolgen.<br />
Die Kulturwissenschaftlerin Sabine Kienitz beschäftigt sich aus einer<br />
symboltheoretischen Perspektive und mit Methoden der visuellen<br />
Anthropologie mit den je unterschiedlichen Lesarten des kriegsbeschädigten<br />
männlichen Körpers, der im Schnittpunkt von diskursiven<br />
Zuschreibungen und chirurgischen und prothetischen Praktiken neu<br />
entstand und der im symbolischen Kampf um die »richtige« Erinnerung<br />
und den Sinn des Krieges eine wichtige Rolle spielte.<br />
Die Autorin:<br />
Sabine Kienitz, Dr. rer. soc., PD, geb. 1958, Studium, Promotion<br />
und Habilitation im Fach Empirische Kulturwissenschaft an<br />
der Univ. Tübingen; Mitarbeiterin im SFB »Kriegserfahrungen<br />
– Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit« an der Univ. Tübingen;<br />
derzeit Vertretungsprofessur am Inst. für Kulturanthropologie/<br />
Europäische Ethnologie an der Univ. Göttingen.<br />
Der vorliegende Band geht auf ein ein internationales<br />
Kolloquium in Heidelberg zurück, das 2006<br />
Ergebnisse eines Projektes vorstellte, das die verschollen<br />
geglaubten psychiatrischen Krankenakten der<br />
Opfer der »Aktion T4«, der zentral organisierten Phase<br />
der Krankenmorde, erstmals systematisch untersucht.<br />
Zudem wurde der gegenwärtige Forschungsstand zu<br />
dieser ersten großen Massenvernichtungsaktion des<br />
NS-Regimes zusammengetragen.<br />
Die in einem Archiv des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit<br />
der DDR aufgefundenen 30.000 Krankenakten haben der historischen<br />
Forschung zur NS- »Euthanasie« einen einmaligen Bestand an die Hand<br />
gegeben, der es ermöglicht, die Perspektive der Opfer der »Aktion T4«<br />
in den Vordergrund zu rücken. Zugleich kann der Prozess der Selektion<br />
näher untersucht werden. Dabei soll herausgearbeitet werden, welche der<br />
bisher in der Forschung vermuteten Selektionskriterien tatsächlich die<br />
Entscheidung über Tod und Leben beeinflusst haben. Darüber hinaus versucht<br />
der Band, die »Aktion T4« in ihren zeitlichen, räumlichen und bürokratischen<br />
Abläufen umfassend zu rekonstruieren, auch für Regionen,<br />
über deren Bedeutung in der »Aktion T4« bisher wenig bekannt war, wie<br />
die besetzten tschechischen Gebiete des Reichsgaus Sudetenland oder<br />
Slowenien.<br />
Die Herausgeber:<br />
Maike Rotzoll, Dr. med., geb. 1964, Fachärztin für Psychiatrie und<br />
Medizinhistorikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut<br />
für Geschichte der Medizin Heidelberg.<br />
Gerrit Hohendorf, Dr. med., geb. 1963, Facharzt für Psychiatrie<br />
und Psychotherapie, Medizinhistoriker, wiss. Angestellter am<br />
Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der TU München.<br />
Petra Fuchs, Dr. phil., geb. 1958, Erziehungswissenschaftlerin und<br />
Historikerin, Gastwissenschaftlerin am Institut für Geschichte der<br />
Medizin der Charité Berlin.<br />
Paul Richter, Dr. phil., Dipl. Psych., geb. 1955, Leitender Psychologe<br />
der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg.<br />
Christoph Mundt, Prof. Dr. med., geb. 1944, Ärztlicher Direktor der<br />
Klinik für Allgemeine Psychiatrie der Universität Heidelberg.<br />
Wolfgang U. Eckart, Prof. Dr. med., geb. 1952, Direktor des Instituts<br />
für Geschichte der Medizin der Universität Heidelberg.
GESCHICHTE | MILITÄRGESCHICHTE 15<br />
BERNHARD R. KROENER<br />
Kriegerische Gewalt und<br />
militärische Präsenz in der Neuzeit<br />
Ausgewählte Schriften<br />
Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes<br />
herausgegeben von Ralf Pröve und Bruno Thoß<br />
Bernhard R. Kroener ist einer der namhaftesten Vertreter der Militär<strong>geschichte</strong><br />
in Deutschland. Sein Arbeitsfeld weist eine enorme zeitliche Tiefe<br />
und thematische Breite auf. In Forschung und Lehre setzt er bereits im<br />
späten Mittelalter ein, um dann die gesamte Epoche der Neuzeit in das Blickfeld<br />
seiner Aufmerksamkeit zu rücken. Dabei verfolgt er sowohl wirtschaftswie<br />
sozialhistorische als auch kultur- und politikgeschichtliche Ansätze.<br />
Seine besondere Konzentration gilt der Erforschung des Dreißigjährigen<br />
Krieges und der Geschichte des deutschen Miltärs im Dritten Reich und im<br />
Zweiten Weltkrieg. Nicht zuletzt mit seiner monumentalen Biographie des<br />
Generalobersten Friedrich Fromm (2005) hat er hier Maßstäbe gesetzt.<br />
Die in vorliegendem Band versammelten Aufsätze geben Einblick in<br />
zentrale wissenschaftliche Tätigkeitsfelder des Inhabers der Potsdamer<br />
Professur für Militär<strong>geschichte</strong>. In einem breiten zeitlichen Bogen bilden<br />
sie vier thematische Schwerpunkte: historiographische Probleme und aktuelle<br />
Forschungsdebatten; die Lebensbedingungen im Sozialsystem Militär;<br />
Rüstung und Aufrüstung als ideologisches, ökonomisches und politisches<br />
Problem; die Entstehung und Verbreitung von Kriegsmythen.<br />
Dieser Band spiegelt nicht nur die wissenschaftliche Spannbreite des Autors<br />
wider, sondern ist auch ein glänzendes Zeugnis der modernen deutschen<br />
Militär<strong>geschichte</strong> nach dem Zweiten Weltkrieg.<br />
Vom selben Autor:<br />
»Der starke Mann im Heimatkriegsgebiet«<br />
Generaloberst Friedrich Fromm<br />
2008. ca. 360 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 44,90/sFr 76,-<br />
ISBN 978-3-506-76548-2<br />
Der Autor:<br />
Bernhard R. Kroener, Prof. Dr. phil., geb.<br />
1948, ist Professor für Militär<strong>geschichte</strong><br />
an der Universität Potsdam und Mitherausgeber<br />
der Reihe »Krieg in der<br />
Geschichte«.<br />
Die Herausgeber:<br />
Bruno Thoß, Dr. phil., geb. 1945, ist<br />
Wissenschaftlicher Direktor am Militärgeschichtlichen<br />
Forschungsamt, Potsdam.<br />
Ralf Pröve, Prof. Dr. phil., geb. 1960, ist<br />
apl. Professor an der Universität Potsdam.<br />
Eine Biographie<br />
2005. 1.060 Seiten + 24 Seiten Bildteil, zahlr. Abb., Festeinband<br />
€ 59,90/sFr 101,-<br />
ISBN 978-3-506-71734-4<br />
»Die Tragödie Fromms spiegelt die Tragödie des deutschen Offizierskorps wider. Das macht die<br />
Größe und Bedeutung dieser glänzend geschriebenen Biografie aus.«<br />
Rheinischer Merkur<br />
»This biography raises the benchmark by which future publications of the genre will be judged.<br />
No serious student of the Wehrmacht can afford to neglect this important resource.«<br />
Marcus Faulkner,<br />
Dept. of War Studies, King’s College London
16 GESCHICHTE | MILITÄRGESCHICHTE<br />
MAGNUS KOCH<br />
Fahnenfluchten<br />
Deserteure der Wehrmacht<br />
im Zweiten Weltkrieg –<br />
Lebenswege und Entscheidungen<br />
2008. ca. 356 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76457-7<br />
= Krieg in der Geschichte, Band 42<br />
Deutsche Soldaten, die ihre Truppe während des<br />
Zweiten Weltkrieges verließen, galten als Verräter an<br />
der NS-Volksgemeinschaft – über 15.000 von ihnen<br />
ließ die Wehrmachtjustiz von 1939 bis 1945 hinrichten.<br />
Einigen hundert Deserteuren gelang die Flucht<br />
in die Schweiz. In sechs Fallstudien zeichnet der<br />
Autor erstmals Lebenswege und Entscheidungen dieser<br />
Deserteure nach. Einzigartige Quellenfunde ermöglichen<br />
neue Fragen an die Geschichte der Verweigerung<br />
im Vernichtungskrieg – so über den Zusammenhang<br />
von Männlichkeit und Kampfbereitschaft.<br />
Im Spiegel von Vernehmungsprotokollen, Selbstzeugnissen<br />
und Romanmanuskripten erweisen sich<br />
Vorstellungen von Deserteuren als (regimekritischen)<br />
Kriegsgegnern als Klischee. Durch das Gegeneinanderlesen<br />
zeitgenössischer und aktueller Texte kann<br />
die Studie auch erstmals Veränderungen biographischer<br />
Selbstsichten zeigen; diese verweisen auf<br />
die gewandelten Erinnerungsbedingungen im Nachkriegsdeutschland.<br />
Durch den Blick auf die Außenseiter<br />
zeigt das Buch, was die Wehrmacht zusammen hielt<br />
– und wie Deserteure vor und nach 1945 das Stigma<br />
Fahnenflucht verarbeiteten.<br />
Der Autor:<br />
Magnus Koch, Dr. phil. geb. 1967, 2001 – 2003 Mitglied des<br />
Wissenschaftler-Teams der Ausstellung »Verbrechen der Wehrmacht<br />
– Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941 – 1944«; seit<br />
2005 freier Mitarbeiter bei der Stiftung Denkmal für die ermordeten<br />
Juden Europas, Berlin.<br />
MATTHIAS SPRENGER<br />
Landsknechte auf dem Weg<br />
ins Dritte Reich?<br />
Zu Genese und Wandel des Freikorps-Mythos<br />
2008. ca. 248 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76518-5<br />
Um die Freikorps hat sich seit den 20er Jahren ein<br />
Mythos gebildet. Er oszilliert zwischen »Truppen im<br />
preußischen Geiste«, »Söldnern ohne Sold« und »ewigen<br />
Landsknechten« .<br />
Wie entstand dieser Mythos? Wie und von wem wurde<br />
er vermittelt? Und mit welchen Zielen? Diese Fragen<br />
stehen im Mittelpunkt der Arbeit, die erstmals die<br />
Freikorpserinnerungsliteratur der Weimarer Republik<br />
und des Dritten Reiches im Zusammenhang mit den<br />
erhaltenen Freikorpsakten einer kritischen Prüfung<br />
unterzieht.<br />
Hierbei verfolgt der Autor einen kulturgeschichtlichen Ansatz. Sein Ziel<br />
ist es, den Wandel in der Selbststilisierung der Freikorpskämpfer aufzuzeigen<br />
- von anfänglich reaktionären sowie revolutionär-antibürgerlichen<br />
Tönen über die Annäherung an die NS-Ideologie bis zu ihrer Glorifizierung<br />
im Nationalsozialismus. Durch die Herausarbeitung des NS-Einflusses auf<br />
die Freikorpsmythen macht er den Übergang zum wirkungsmächtigen<br />
politischen Mythos deutlich. Nicht zuletzt verfolgt er auch die Spuren, die<br />
die Freikorpsmythen in der Geschichtsschreibung hinterlassen haben.<br />
Der Autor:<br />
Matthias Sprenger, Dr. phil., geb. 1975, nach dem Studium in Saarbrücken,<br />
Padua, Bonn und Mainz seit 2007 in der Unternehmenskommunikation<br />
eines großen Münchener Unternehmens tätig.
GESCHICHTE | MILITÄRGESCHICHTE 17<br />
BJÖRN MICHAEL FELDER<br />
Unter wechselnden Herren<br />
Lettland im Zweiten Weltkrieg<br />
Zwischen sowjetischen und deutschen Besatzern<br />
1940 – 1946<br />
2008. ca. 400 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76544-4<br />
= Krieg in der Geschichte, Band 43<br />
1940 erzwang die Rote Armee im Gefolge des Hitler-<br />
Stalin-Pakts den Anschluss Lettlands an die UdSSR.<br />
Im Juni 1941 marschierte die Wehrmacht ein und<br />
integrierte das Land in das »Reichskommissariat<br />
Ostland«. Ein Großteil der jüdischen Bevölkerung<br />
wurde ermordet. 1944 kehrte die Rote Armee zurück.<br />
Zehntausende von Letten wurden nach Sibirien verschleppt.<br />
Von 1940 – 1946 verlor Lettland ein Drittel<br />
seiner Bevölkerung – durch Deportation, physische<br />
Vernichtung oder Flucht.<br />
Björn M. Felder zeigt anhand bisher unbekannter Quellen die verheerenden<br />
Auswirkungen der sowjetischen und der nationalsozialistischen<br />
Gewaltherrschaft auf die lettische Bevölkerung. Er zeigt, wie sowjetische<br />
und nationalsozialistische Besatzungspraktiken wirkten, und wie die<br />
Letten und ihre politischen Eliten versuchten, ihre Interessen gegen die<br />
zunehmend als solche wahrgenommene deutsche »Kolonialherrschaft«<br />
bzw. gegen die russische »Fremdherrschaft« zu behaupten. In großer<br />
Klarheit werden so am lettischen Beispiel die dramatische Lage der<br />
mittelosteuropäischen Nationen zwischen Hitler und Stalin und ihr<br />
Bemühen um Unabhängigkeit deutlich.<br />
Das Buch wurde 2007 mit dem renommierten Fraenkel-Preis des Institute<br />
of Contemporary History and Wiener Library, London, ausgezeichnet.<br />
Der Autor:<br />
Björn Michael Felder, geb. 1974, Studium der Neueren und Osteuropäischen<br />
Geschichte, Philosophie und Germanistik in Stuttgart,<br />
Riga und Tübingen. Forschungsstipendiat des DAAD, der<br />
ZEIT-Stiftung sowie des DHI Washington, D.C. Seit 2003 Forschungstätigkeit<br />
für die Lettische Historikerkommission.<br />
BERND WEGNER<br />
Hitlers Politische Soldaten:<br />
Die Waffen-SS<br />
1933 – 1945<br />
8. Auflage 2008. 400 Seiten, kart.<br />
€ 24,90/sFr 44,-<br />
ISBN 978-3-506-76313-6<br />
Nach kurzer Zeit jetzt bereits<br />
in 8. Auflage lieferbar!<br />
Eines der umstrittensten Themen der Zeit<strong>geschichte</strong><br />
bis auf den heutigen Tag ist die Waffen-SS, nicht erst<br />
seit Grass. Bernd Wegners auch international hoch<br />
gelobtes Buch informiert wie kein anderes über die<br />
Entwicklung und die innere Struktur von »Hitlers<br />
Elitetruppe«.<br />
»Bernd Wegner hat das Standardwerk über die Waffen-SS geschrieben.«<br />
DIE ZEIT<br />
»Übertrifft alle Arbeiten über das Thema bei weitem. Bei Wegner<br />
bleiben keine Fragen, die mit der Waffen-SS zusammenhängen,<br />
unbeantwortet.«<br />
Deutsche Welle<br />
»Ein Buch von ungewöhnlicher Qualität. Pflichtlektüre für alle, die<br />
sich über den SS-Staat informieren wollen.«<br />
American Historical Review<br />
Der Autor:<br />
Bernd Wegner, Dr. phil., geb. 1949, ist Professor für Neuere<br />
Geschichte an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr<br />
Hamburg und Mitherausgeber der Reihe »Krieg in der Geschichte«.
18 GESCHICHTE | MILITÄRGESCHICHTE<br />
UTE PLANERT (HRSG.)<br />
Krieg und Umbruch:<br />
Mitteleuropa um 1800<br />
Erfahrungs<strong>geschichte</strong>(n)<br />
auf dem Weg in eine neue Zeit<br />
2008. ca. 420 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 49,90/sFr 84,-<br />
ISBN 978-3-506-75661-9<br />
= Krieg in der Geschichte, Band 44<br />
PHILIPP VON HILGERS<br />
Kriegsspiele<br />
Eine Geschichte der Ausnahmezustände<br />
und Unberechenbarkeiten<br />
2008. ca. 200 Seiten, 16 s/w Abb., kart.<br />
ca. € 24,90/sFr 44,-<br />
ISBN 978-3-506-76553-6<br />
Das Werk erscheint in Gemeinschaftsproduktion mit dem Wilhelm Fink <strong>Verlag</strong><br />
Über Jahrhunderte versuchten Militärstrategen und<br />
Mathematiker mit einer komplexen konfliktbeladenen<br />
Welt fertig zu werden. Wie sie dabei ausgerechnet<br />
in Spielen immer wieder eine operative Basis für ihr<br />
Denken und Handeln fanden, schildert dieses Buch in<br />
historischer Tiefe und medientheoretischer Aktualität.<br />
Zum Vorschein kommt eine über ein Jahrtausend währende Folge von<br />
unterschiedlichen Kriegsspielen: so das mittelalterliche Zahlenkampfspiel,<br />
barocke Ideen über Krieg und Spiel, das Kriegsspiel im 19. Jahrhundert in<br />
Preußen und die politischen Planspiele von Reichswehr und Wehrmacht.<br />
Hilgers entdeckt bekannte Figuren der Ideen<strong>geschichte</strong>, die in<br />
Kriegsspielen die Gestalt der Kriege ihrer Zeit zu entwerfen suchten:<br />
Leibniz, Heinrich von Kleist, Wittgenstein, Carl Schmitt, John von<br />
Neumann und andere. Sehr genau zeichnet er nach, wie Kriege ihr<br />
Denken und ihre Karrieren entscheidend geprägt haben, und er stellt die<br />
Frage, wie es sein konnte, dass Spiele eine Sphäre eroberten, in der sich<br />
menschliches Handeln von seiner unberechenbarsten Seite zeigt.<br />
Um die Wechselwirkungen zwischen Schlachtfeldern und Kriegsspielen<br />
zu erfassen, geht der Autor auf die großen Umbrüche ein, die die<br />
Kulturtechniken der Zeichenanwendungen erfasst haben. Als ein Schlüssel<br />
wird der mathematische Diskurs ausgemacht, der allein auf Symbolen<br />
beruhende Zeichenapparate hervorbringt und seine Anwendung explizit<br />
als Spiel mit Zeichen zu begreifen beginnt.<br />
Der Autor:<br />
Philipp von Hilgers ist Postdoctoral Research Fellow am Max-<br />
Planck-Institut für Wissenschafts<strong>geschichte</strong>, Berlin.<br />
Um 1800 stellten Kriege und Krisen die Menschen<br />
in Mitteleuropa vor beispiellose Veränderungen. Das<br />
Alte Reich brach zusammen, Napoleon wurde Herr<br />
des Kontinents. Das Buch legt neueste Ergebnisse<br />
der Forschung zu den Erfahrungen der Menschen in<br />
dieser Zeit tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels<br />
vor. An Beispielen aus den Niederlanden, der Schweiz,<br />
dem Elsaß, dem italienischen Tirol und ausgewählten<br />
Rheinbundstaaten untersuchen namhafte Autoren<br />
die Auswirkungen der Reformpolitik und erzählen<br />
von Protesten gegen den Einbruch der Moderne<br />
in die Lebenswelt. Sie verfolgen, auf welche Weise<br />
soziale Eliten ihre Position zu wahren suchten und<br />
machen deutlich, wie stark Konfession und vormoderne<br />
Mentalität noch immer die Wahrnehmung des<br />
Krieges und seiner Folgen bestimmten. Und sie zeigen,<br />
wie die Geschichte(n) der napoleonischen Zeit<br />
im 19. Jahrhundert immer wieder entlang aktueller<br />
Bedürfnisse umgeschrieben wurden.<br />
Die Herausgeberin:<br />
Prof. Ute Planert, Dr. phil., geb. 1964, lehrt als Hochschuldozentin<br />
und apl. Prof. Europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts<br />
an der Universität Tübingen.<br />
Von der selben Autorin:<br />
Der Mythos vom Befreiungskrieg<br />
Frankreichs Kriege und der deutsche Süden.<br />
Alltag – Wahrnehmung – Deutung<br />
1792 – 1841<br />
2007. 739 Seiten, 1 Faltkarte, Festeinband<br />
€ 68,-/sFr 115,-<br />
ISBN 978-3-506-75662-6<br />
= Krieg in der Geschichte, Band 33
GESCHICHTE 19<br />
ERIK GIESEKING<br />
JUSTITIA ET PAX<br />
1967 – 2007<br />
40 Jahre Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden<br />
Eine Dokumentation<br />
Herausgegeben von der Deutschen Kommission Justitia et Pax<br />
2008. 576 Seiten, 20 Seiten Bildteil, Festeinband<br />
€ 49,90/sFr 84,-<br />
ISBN 978-3-506-76478-2<br />
Seit vierzig Jahren ist die Deutsche Kommission<br />
Justitia et Pax die Stimme der katholischen Kirche für<br />
Anliegen der Entwicklungspolitik, der Menschenrechte,<br />
der Friedens- und Versöhnungsarbeit in Politik und<br />
Gesellschaft. Mit der Enzyklika »Populorum Progressio«<br />
gab Papst Paul VI. 1967 den entscheidenden Anstoß<br />
für die Gründung der Justitia et Pax-Kommissionen.<br />
Die Arbeit von Justitia et Pax wurde seitdem<br />
zum Kernstück kirchlichen Zeugnisses für Gerechtigkeit<br />
und Frieden in der Welt. Ihr Bestreben ist auf<br />
Bewusstseinsbildung unter den Christen und den Dialog<br />
mit Politik und Gesellschaft gerichtet.<br />
Die zum 40-jährigen Bestehen vorgelegte Darstellung und Dokumentation<br />
entstand in Kooperation mit der Kommission für Zeit<strong>geschichte</strong>,<br />
Bonn. Sie stellt das vielfältige Wirken von Justitia et Pax in den zurückliegenden<br />
Jahren einem interessierten Publikum vor. Zugleich ist sie<br />
ein wichtiger Baustein für die wissenschaftliche Aufarbeitung kirchlicher<br />
Entwicklungs-, Friedens- und Menschenrechtspolitik.<br />
Der Autor:<br />
Erik Gieseking, Dr. phil., geb. 1965, Studium der Mittleren und<br />
Neueren Geschichte, Bibliothekswissenschaften und Historischen<br />
Hilfswissenschaften an der Universität zu Köln; seit 2006<br />
Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Kommission für Zeit<strong>geschichte</strong><br />
in Bonn.<br />
ANDREAS HENKELMANN<br />
Caritas<strong>geschichte</strong> zwischen<br />
katholischem Milieu und<br />
Wohlfahrtsstaat<br />
Das Seraphische Liebeswerk (1889 – 1971)<br />
2008. ca. 504 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag<br />
ca. € 59,-/sFr 100,-<br />
ISBN 978-3-506-76527-7<br />
= Veröffentlichungen der Kommission für Zeit<strong>geschichte</strong>. Reihe B, Band 113<br />
»Kinderseelen retten ist das göttlichste aller Werke!«<br />
Mit diesem und ähnlichen Aufrufen begann in den<br />
1890er Jahren der Siegeszug einer heute weitgehend<br />
unbekannten katholischen Vereinigung. 1889<br />
gründeten Mitglieder des franziskanischen Drittordens<br />
unter Leitung eines Kapuzinerpaters in Koblenz das<br />
Seraphische Liebeswerk und leiteten damit die beispiellose<br />
Erfolgs<strong>geschichte</strong> eines katholischen Sammel- und<br />
Fürsorgevereins ein. Etwa 400.000 Katholiken unterstützten<br />
1914 den Verein, offenbar auch angezogen<br />
von seinem reichen »geistlichen Gnadenschatz«.<br />
Der Verein, der sich um »religiös und sittlich gefährdete« Kinder kümmerte,<br />
stand immer wieder vor der Herausforderung, sich zur staatlichen<br />
Kinder- und Jugendfürsorge zu positionieren. Das führte zu zahlreichen<br />
Konflikten um die Vereinbarkeit von katholischer Identität und<br />
Erwartungen des Wohlfahrtsstaates. Die Studie liefert sowohl einen<br />
wesentlichen Beitrag zur Caritas- und Ordens<strong>geschichte</strong> als auch zur<br />
Sozial- und Mentalitäts<strong>geschichte</strong> des katholischen Milieus. So steuert<br />
sie wichtige Erkenntnisse über wohlfahrts- und sozialstaatliche<br />
Entwicklungen in Deutschland bis zum Beginn der 1970er Jahre bei.<br />
Der Autor:<br />
Andreas Henkelmann, Dr. theol., geb. 1973, Wiss. Mitarbeiter am<br />
Lehrstuhl für Kirchen<strong>geschichte</strong> des Mittelalters und der Neuzeit<br />
an der Ruhr-Universität Bochum.
20 GESCHICHTE | POLITIK<br />
RAINER LIEDTKE | KLAUS WEBER (HRSG.)<br />
Philanthropie und Religion<br />
in den europäischen<br />
Zivilgesellschaften<br />
Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert<br />
2008. 288 Seiten, kart.<br />
ca. € 36,90/sFr 63,-<br />
ISBN 978-3-506-76384-6<br />
Mut – Hoffnung – Zuversicht<br />
Festschrift für Bernhard Vogel zum 75. Geburtstag<br />
Herausgegeben von Dieter Althaus, Günter Buchstab,<br />
Norbert Lammert und Peter Molt<br />
2008. 304 Seiten, Festeinband<br />
€ 38,-/sFr 64,-<br />
ISBN 978-3-506-76481-2<br />
Bernhard Vogel hat wie nur wenige Politiker in seinem<br />
öffentlichen Wirken seit fast 50 Jahren auf Gestalt und<br />
Wesen unserer res publica Einfluss genommen – als<br />
Abgeordneter und prominenter Vertreter der CDU, als<br />
Kultusminister, als Ministerpräsident von Rheinland-<br />
Pfalz und Thüringen, als Repräsentant kirchlicher<br />
Organisationen und als Vorsitzender der Konrad-<br />
Adenauer-Stiftung.<br />
Die Autoren der Festschrift, Freunde, Kollegen und Wegbegleiter aus<br />
Wissenschaft, Kultur und Politik, zeichnen nicht nur Lebensweg und<br />
Wirken Bernhard Vogels nach (Peter Molt, Helmut Herles). Sie diskutieren<br />
auch die Entwicklung der Politikfelder und Problemkreise, die<br />
Schwerpunkte in dessen politischem Handeln bildeten: Politik aus christlicher<br />
Verantwortung (Otto Depenheuer, Alois Glück, Michael Krapp),<br />
Föderalismus (Hans Maier, Heinrich Oberreuter, Erwin Teufel), Kultur<br />
und Bildung (Karl Martin Graß, Hermann Ströbel, Jürgen Wilke, Hans-<br />
Joachim Veen), internationale Verständigung (Andreas Khol, Friedrich<br />
Kronenberg, Josef Thesing, Gerhard Wahlers).<br />
Die Herausgeber:<br />
Dieter Althaus ist seit 2003 Ministerpräsident des Freistaats<br />
Thüringen.<br />
In den letzten zwei Jahrzehnten hat der Begriff<br />
»Zivilgesellschaft« in verschiedenen sozial- und kulturwissenschaftlichen<br />
Forschungsfeldern zwar Konjunktur,<br />
ist aber keineswegs eindeutig definiert. Philanthropie<br />
und organisierte Wohlfahrt sind dabei als gestaltende<br />
Elemente zivilgesellschaftlicher Formationen identifiziert,<br />
aber bislang unterbewertet worden, und irrigerweise<br />
wird Religion von vielen Wissenschaftlern noch<br />
immer als Antagonist der Zivilgesellschaft verstanden.<br />
Der vorliegende Band macht einerseits die vielfältigen<br />
Beziehungen zwischen organisierter Religion, privater<br />
Religiosität und philanthropischem Engagement<br />
deutlich. Andererseits verdeutlicht er, dass Religion<br />
und Philanthropie bzw. Wohltätigkeit wichtige Antriebskräfte<br />
bei der Entwicklung zivilgesellschaftlicher<br />
Strukturen und Aktivitäten waren. Die Beiträge erörtern<br />
dies in verschiedenen nationalen europäischen<br />
Kontexten, in transnationaler Perspektive und kulturübergreifend<br />
auch für die japanische Gesellschaft.<br />
Die Herausgeber:<br />
Prof. Rainer Liedtke, Dr. phil., geb. 1967, Studium der Geschichte<br />
und Germanistik in Bochum, der Geschichte in Warwick und<br />
Oxford. Derzeit wiss. Mitarbeiter und PD am Hist. Institut der<br />
Universität Gießen.<br />
Klaus Weber, geb. 1960, Studium der Geschichte und Philosophie<br />
an der Universität Hamburg; 2002/03 Research Fellow am Centre<br />
for the Study of Human Settlement and Historical Change; seit<br />
2004 Research Fellow am Royal Holloway College (London) und<br />
am Rothschild Archive (London).<br />
Dr. Günter Buchstab ist Leiter der Wissenschaftlichen Dienste/<br />
Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-<br />
Stiftung.<br />
Dr. Norbert Lammert ist seit 2005 Präsident des Deutschen Bundestags.<br />
Prof. Dr. Peter Molt ist seit 1992 Honorarprofessor für Entwicklungspolitik<br />
an der Universität Trier.
POLITIK 21<br />
ELMAR WIESENDAHL (HRSG.)<br />
Eliten<br />
in der Transformation von<br />
Gesellschaft und Bundeswehr<br />
ELMAR WIESENDAHL (HRSG.)<br />
Innere Führung<br />
für das 21. Jahrhundert<br />
Die Bundeswehr und das Erbe Baudissins<br />
Herausgegeben mit Unterstützung<br />
des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, Potsdam<br />
2007. 207 Seiten, kart.<br />
€ 18,-/sFr 32,90<br />
ISBN 978-3-506-76479-9<br />
Die Bundesrepublik befindet sich in einer Übergangsphase,<br />
in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Gerade<br />
wenn sich Gesellschaften grundlegend wandeln oder<br />
gar transformieren, fällt Eliten und ihrer Führungsrolle<br />
eine besondere Verantwortung zu.<br />
Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Bundeswehr<br />
gehen der Frage nach, welche Bedeutung Eliten im<br />
Transformationsprozess von Gesellschaft, Politik,<br />
Wirtschaft und Militär in Deutschland zukommt. Sie tun<br />
dies vor dem historischen Hintergrund der Entwicklung<br />
vom Kaiserreich bis zur Gegenwart. International vergleichend<br />
werden auch die postkommunistischen Eliten<br />
in Russland und unterschiedliche Eliteauslesemuster<br />
untersucht. Ein zentraler Fragepunkt ist überdies, ob<br />
die Funktionseliten von heute sich zu Verantwortungseliten<br />
fortentwickeln müssen.<br />
Der Herausgeber:<br />
Professor Dr. Elmar Wiesendahl lehrte Politikwissenschaft und ist<br />
Leiter des Fachbereichs Sozialwissenschaften an der Führungsakademie<br />
der Bundeswehr. Er befasst sich mit Parteien, Demokratie,<br />
Eliten und dem Verhältnis von Militär und Gesellschaft.<br />
Herausgegeben im Auftrag der Führungsakademie<br />
der Bundeswehr, Hamburg von Elmar Wiesendahl<br />
2007. 167 Seiten, kart.<br />
€ 16,90/sFr 31,-<br />
ISBN 978-3-506-76480-5<br />
Wie kein anderer hat der große Militärreformer Wolf<br />
Graf von Baudissin mit der von ihm entwickelten<br />
Inneren Führung den Geist und das Binnengefüge<br />
der Bundeswehr vor ihrer Transformation von der<br />
Verteidigungsarmee zur international operierenden<br />
Einsatzarmee geprägt. Innere Führung hieß<br />
für Baudissin, die Führungsphilosophie und das<br />
Berufsleitbild der Armee an die politischen und gesellschaftlichen<br />
Bedingungen anzupassen, die er zu<br />
Zeiten der Neuaufstellung demokratisch zuverlässiger<br />
Streitkräfte in der Bundesrepublik vorfand.<br />
Dies ist ein halbes Jahrhundert her. Heute, im 21.<br />
Jahrhundert, steht die Bundeswehr vor radikal gewandelten<br />
Herausforderungen: durch neue internationale<br />
Konfliktszenarien, ein erweitertes Einsatzspektrum<br />
und tiefgreifende Veränderungen der deutschen<br />
Gesellschaft. Darauf muss sie Antworten finden.<br />
Um diese geht es dem vorliegenden Band.<br />
Ausgewiesene Autoren aus Wissenschaft und Bundeswehr untersuchen<br />
die Konsequenzen, welche die neuen Bedingungen der Außen- und<br />
Sicherheitspolitik, das gewandelte Kriegsbild und die Entwicklung zur<br />
Zivilgesellschaft für das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform und für die<br />
Führungsphilosophie der Bundeswehr haben.
22 GESCHICHTE | UTB<br />
BEATE ALTHAMMER<br />
Das Bismarckreich 1871 – 1890<br />
KARL DITT | KLAUS TENFELDE (HRSG.)<br />
Das Ruhrgebiet<br />
in Rheinland und Westfalen<br />
Koexistenz und Konkurrenz des Raumbewusstseins<br />
im 19. und 20. Jahrhundert<br />
2007. ca. 540 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 52,-/sFr 82,-<br />
ISBN 978-3-506-75748-7<br />
= Forschungen zur Regional<strong>geschichte</strong>, Band 57<br />
Rheinland, Westfalen, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen<br />
– welche Vorstellungen von diesen unterschiedlichen<br />
Räumen haben sich im Lauf der Zeit entwickelt, wie<br />
ist hier räumliches Bewusstsein entstanden, und wie<br />
hat es das Handeln der Akteure beeinflusst? In den<br />
1920er Jahren unternahm die Forschung den Versuch,<br />
Räume und ihre Wahrnehmung anhand der Verbreitung<br />
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Befunde zu<br />
bestimmen. In den 1950er Jahren wurden die raumstrukturierenden<br />
Funktionen zentraler Orte für ihr<br />
näheres und weiteres Umland betont. Seit den 1980er<br />
Jahren gehen Geographen und Historiker verstärkt<br />
dazu über, die in den Köpfen der Menschen vorhandenen<br />
»mental maps« – die zwischen den sozialen<br />
Gruppen und Individuen variierenden räumlichen<br />
Begriffe und Sichtweisen – zu untersuchen. Diesen<br />
Ansatz wendet der vorliegende Band konsequent auf<br />
die im 19. Jahrhundert entstandene Region Ruhrgebiet<br />
an.<br />
Die Herausgeber:<br />
Karl Ditt, Dr. phil., geb. 1950, ist Wissenschaftlicher Referent im<br />
LWL-Institut für westfälische Regional<strong>geschichte</strong> in Münster.<br />
Klaus Tenfelde, Prof. Dr. phil., geb. 1944, Lehrstuhlinhaber an<br />
der Ruhr-Universität Bochum, Leiter des Instituts für soziale<br />
Bewegungen.<br />
2008. ca. 256 Seiten, ca. 40 Abb., kart.<br />
ca. € 16,90/sFr 31,-<br />
ISBN 978-3-8252-2995-5<br />
= Uni-Taschenbücher, UTB 2995 M<br />
(Reihe: Seminarbuch Geschichte)<br />
Gegliedert nach grundlegenden Problemfeldern werden den Lesern<br />
die wichtigsten Aspekte der deutschen Geschichte zwischen der<br />
Reichsgründung und dem Rücktritt Bismarcks als Reichskanzler vermittelt:<br />
politisches System und innere Nationsbildung, konfessionelle<br />
und nationale Minderheiten, wirtschaftliche Entwicklungen und<br />
Arbeiterbewegung, Sozialpolitik, Geschlechterbeziehungen, Wissenschaft<br />
und Technik, Außenpolitik, Kolonialbewegung, Bismarckmythos.<br />
DIETMAR RÖSLER | EMER O’SULLIVAN<br />
Kinder- und Jugendliteratur<br />
im Fremdsprachenunterricht<br />
2008. ca. 256 Seiten, ca. 25 Abb., kart.<br />
ca. € 17,90/sFr 32,-<br />
ISBN 978-3-8252-2993-1<br />
= Uni-Taschenbücher, UTB 2993 M<br />
(Reihe: StandardWissen Lehramt)<br />
Kinder- und Jugendliteratur kann die ideale, altersgerechte Lektüre beim<br />
schulischen Spracherwerb sein. Doch welche Texte soll man lesen? Ab<br />
wann ist die Lektüre einer Ganzschrift sinnvoll? Wie kann das Verhältnis<br />
des literarischen Textes und seiner Verfilmung untersucht werden?<br />
An Beispielen aus dem Deutschen, Englischen und Französischen wird<br />
gezeigt, wie Kinder- und Jugendliteratur den Spracherwerb und die<br />
Herausbildung interkultureller Sensibilität fördern kann.<br />
ENGELBERT THALER<br />
Teaching English Literature<br />
2008. ca. 256 Seiten, ca. 20 Abb., kart.<br />
ca. € 17,90/sFr 32,-<br />
ISBN 978-3-8252-2997-9<br />
= Uni-Taschenbücher, UTB 2997 M<br />
(Reihe: StandardWissen Lehramt)<br />
Die Lektüre literarischer Texte ist zentraler Bestandteil des Englischunterrichts<br />
für fortgeschrittene Lernende. Dieses UTB bietet eine<br />
umfassende Einführung für zukünftige Englischlehrerinnen und -lehrer.<br />
Das Sprachniveau des Buches liegt auf lesefreundlichem Niveau. Die<br />
englische fachsprachliche Begriffswelt wird einbezogen und konsequent<br />
vermittelt. Motivierende Leitfragen, Grafiken und Übersichten didaktisieren<br />
den Band.
PÄDAGOGIK 23<br />
Handbuch der Erziehungswissenschaft<br />
Im Auftrag der Görres-Gesellschaft<br />
Herausgegeben von Gerhard Mertens, Ursula Frost, Winfried Böhm, Volker Ladenthin<br />
Nach einer Phase großer Ausdifferenzierung – vielleicht sogar einer gewissen<br />
Unübersichtlichkeit – will das Handbuch in drei Bänden den Grundstein<br />
für eine fundierte Diskussion der Erziehungswissenschaft in allen Fachbereichen<br />
legen.<br />
Band II<br />
Teilband 1: Schule<br />
Herausgeben von Stephanie Hellekamps, Wilfried Plöger, Wilhelm Wittenbruch<br />
Der Band bietet einen Überblick für Studierende, Lehrerinnen/Lehrer und Schulpädagog/innen über<br />
das Forschungs- und Handlungsfeld Schule in drei Schwerpunkten. In dem Schwerpunkt »Schule<br />
im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem und pädagogischem Auftrag« werden pädagogische<br />
Begründungen, kulturelle Vermittlungsleistungen und gesellschaftliche Ansprüche erörtert.<br />
»Didaktik als Ziel-, Prozess- und Handlungstheorie« konstruiert den Begriff des Unterrichts als<br />
dreiseitiges Verhältnis von Lehren, Lernen und Sache. Dass Schule über den Unterricht hinaus auch<br />
durch ihre spezifische Organisationsstruktur wirkt und dass sich die Einzelschule durch eine individuelle<br />
Schulkultur auszeichnet, ist Gegenstand des dritten Schwerpunkts »Schule als Lebensraum«.<br />
Den Abschluss bilden Beiträge zu »Schulpädagogik als erziehungswissenschaftliche Disziplin«. Die<br />
Integration allgemeinpädagogischer, soziologischer und psychologischer Aspekte entspricht der<br />
Intention des Bandes, einen reduktionistischen Zugriff auf die Institution Schule und schulisches<br />
Lernen zu vermeiden. Durch kritische Sichtung von Theorien, Daten und Sachverhalten werden<br />
»Innovationspotentiale« für das Handlungsfeld Schule bereitgestellt.<br />
Teilband 2: Erwachsenenbildung/Weiterbildung<br />
Herausgegeben von Thomas Fuhr, Philipp Gonon, Christiane Hof<br />
Die Erwachsenenbildung/Weiterbildung hat sich im letzten Jahrhundert zu einem zentralen, breit<br />
ausgebauten Feld des lebenslangen Lernens und der Bildung entwickelt. Das Handbuch stellt aktuelle<br />
Theorien und empirische Befunde in nationaler und internationaler Perspektive vor. Nach Beiträgen zu<br />
theoretischen Grundlagen und zur Geschichte der Erwachsenenbildung werden Lernvoraussetzungen,<br />
Politik, Recht und Institutionen der Erwachsenenbildung und Weiterbildung behandelt. Es folgen<br />
Teile zu Zielen und Inhaltsbereichen der Bildung Erwachsener, zu Management und Didaktik der<br />
Erwachsenenbildung, zu Personal, Studium der Erwachsenenbildung und Fragen der Professionalität<br />
sowie zu ethischen und forschungsmethodologischen Fragen. Die Beiträge wurden von führenden<br />
Forschern verfasst. Sie wenden sich an Erwachsenenbildner und Weiterbildner, Studierende und die<br />
Wissenschaft.<br />
Band I:<br />
Grundlagen Allgemeine Erziehungswissenschaft<br />
2007. ca. 1.150 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 78,-/sFr 132,-<br />
Subskriptionspreis: ca. € 68,-/sFr 115,-<br />
ISBN 978-3-506-76350-1<br />
Band III:<br />
Familie, Kindheit, Jugend, Sozial, Medienpädagogik/Interkulturelle<br />
und Vergleichende Erziehungswissenschaft/Umweltpädagogik<br />
2008. ca. 900 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 68,-/sFr 115,-<br />
Subskriptionspreis: ca. € 58,-/sFr 98,-<br />
ISBN 978-3-506-76496-6<br />
Das Werk steht zur Subskription.<br />
Die Subskription endet mit Erscheinen<br />
des letzten Bandes.<br />
Die Herausgeber:<br />
Dr. Stephanie Hellekamps ist Prof. für<br />
Erziehungswissenschaft an der Universität<br />
Münster.<br />
Prof. Dr. Wilfried Plöger ist Prof. für<br />
Erziehungswissenschaften an der Universität<br />
Köln.<br />
Prof. Dr. Wilhelm Wittenbruch ist Prof.<br />
em. für Erziehungswissenschaften an<br />
der Universität Münster.<br />
Prof. Dr. Thomas Fuhr ist Prof. für<br />
Erwachsenenbildung/Weiterbildung<br />
an der Pädagogischen Hochschule Freiburg.<br />
Prof. Dr. Philipp Gonon ist Professor<br />
und Inhaber des Lehrstuhls für Berufspädagogik<br />
an der Universität Zürich.<br />
PD Dr. Christiane Hof ist Vertreterin<br />
einer Professur für Weiterbildung und<br />
Medien an der Technischen Universität<br />
Braunschweig.<br />
ISBN 978-3-506-76550-5<br />
(erscheint im Herbst 2008)
24 PÄDAGOGIK<br />
ELISABETH MEILHAMMER<br />
Neutralität als bildungstheoretisches<br />
Problem<br />
Von der Meinungsabstinenz zur Meinungsgerechtigkeit<br />
2008. ca. 200 Seiten, kart.<br />
ca. € 28,-/sFr 49,-<br />
ISBN 978-3-506-76512-3<br />
Wie kann in der pluralistischen Gesellschaft eine pädagogische<br />
Förderung der freien Meinungsbildung aussehen,<br />
die nicht zugleich in unzulässiger Weise lenkend<br />
oder manipulierend ist? Die in diesem Buch entwickelte<br />
Konzeption der Neutralität als Meinungsgerechtigkeit<br />
will eine Antwort auf diese Frage geben.<br />
Die freiheitlich-demokratische multikulturelle Gesellschaft ist durch<br />
eine Vielfalt an Weltanschauungen und Stellungnahmen zu werthaltigen<br />
Fragen gekennzeichnet, auf die es keine allgemein verbindlichen<br />
Antworten gibt. Trotzdem sind es gerade jene kontroversen Fragen, zu<br />
denen der einzelne Mensch eine eigene Position beziehen muss, um<br />
Orientierung und Teilhabe zu finden; gerade an ihnen erweist sich seine<br />
Bildung.<br />
Hieraus erwächst das Problem, dass der Prozess der individuellen<br />
Meinungsbildung zwar pädagogisch gefördert, jedoch nicht in eine<br />
bestimmte Richtung gedrängt werden soll. Die in diesem Buch entwickelte<br />
Neutralitätskonzeption bietet eine Lösung hierfür an; sie besteht<br />
darin, auf dem Weg zur besten und autonomen Urteilsfindung die<br />
Meinungsgerechtigkeit zur Geltung zu bringen. Es zeigt sich, dass diese<br />
Konzeption, deren tiefste Rechtfertigung die ethische Rationalität ist,<br />
der pluralistischen Gesellschaft gemäß ist und sich als Grundlage für<br />
politische und interkulturelle Bildungsansätze eignet.<br />
Die Autorin:<br />
Elisabeth Meilhammer, Dr. phil. habil. PD, Dipl.-Päd., geb. 1964;<br />
seit 1993 wiss. Tätigkeit am Lehrstuhl für Erwachsenenbildung<br />
der Univ. Jena, 2001/02 Guest Assistant Professor an der Univ.<br />
of Notre Dame (Indiana, USA), 2007 Vertretung der Professor für<br />
Erwachsenenbildung/Weiterbildung an der TU Chemnitz; 2007/08<br />
Vertretung der Professur für Erwachsenenbildung an der Univ.<br />
Jena.<br />
GERHARD MERTENS<br />
Balancen – Pädagogik<br />
und das Streben nach Glück<br />
2. Auflage 2008. 160 Seiten, kart.<br />
€ 19,90/sFr 35,90<br />
ISBN 978-3-506-75623-7<br />
Das Streben nach Glück ist mit dem Menschen als<br />
einem denkenden, fühlenden, suchenden Wesen unlösbar<br />
verbunden, meist aber nur latent gegenwärtig. In<br />
Zeiten gesellschaftlichen und persönlichen Umbruchs<br />
allerdings tritt es in den Vordergrund und verdichtet<br />
sich zu der Frage nach dem erfüllten, dem guten<br />
Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Ein Zeichen<br />
von Bildung ist es dann, sich auf diese Frage einzulassen<br />
und am sinnhaften Gelingen des Daseins mitzuwirken.<br />
In einer vielgestaltigen, komplexen Welt wie der<br />
unseren ist dies freilich meist nur in Akten ständigen<br />
Ausbalancierens machbar.<br />
Im Bereich der Bildung kommt die Glücksthematik heute, wenn überhaupt,<br />
so vornehmlich auf den konkreten Feldern praktischer Pädagogik<br />
zur Sprache. Entsprechend erörtert das vorliegende Buch die Freizeitund<br />
Konsumpädagogik unter den Kategorien »humanes Erleben und<br />
Verbrauchen«; die Gesundheitsbildung unter dem Leitbegriff des »leibseelisch-sozialen<br />
Wohlergehens«; die Identitätsbildung unter den<br />
Kategorien der »Selbstaktualisierung« und »inneren Kohärenz« und<br />
schließlich die sittliche Bildung unter dem Leitbegriff der »Verantwortung«<br />
als einer situativ-balancierenden Steuerungsinstanz der Humanität.<br />
Immer steht dabei die Frage nach den Balancen erfüllten Menschseins<br />
im Mittelpunkt.<br />
Der Autor:<br />
Gerhard Mertens, Prof. Dr. theol., Dr. phil., war von 1992 – 1998<br />
als Ordinarius für Pädagogik an der Universität Regensburg tätig.<br />
Seit 1998 lehrt er Pädagogische Anthropologie und Ethik an der<br />
Universität zu Köln.
PÄDAGOGIK 25<br />
DIETRICH BENNER<br />
Bildungstheorie<br />
und Bildungsforschung<br />
Grundlagenreflexionen und Anwendungsfelder<br />
Statt eindimensionalem schulischem Lernen von Sachverhalten plädiert der<br />
Autor für eine Erziehung, die die Schüler befähigt, selbständig zu urteilen<br />
und für ihr Urteil einzustehen. Der erste Teil des Bandes bietet dafür die<br />
theoretischen Grundlagen, der zweite erprobt sie an Kontexten wie: Bildung<br />
und Demokratie, Bildung und Kultur, Bildung und Religion, Moralisierung<br />
und experimenteller Ethik sowie an dem Widerstreit von Bildung und<br />
Globalisierung.<br />
Die Studien zu einer »reflexiven und innovatorischen Bildungsforschung«<br />
binden die »Struktur der Allgemeinbildung im Kerncurriculum moderner<br />
Bildungssystem« an die Entwicklung einer Urteils- und Deutungs- sowie<br />
einer Partizipations- und Handlungskompetenz zurück. Sie führen über<br />
die in den PISA-Projekten bisher untersuchten Kompetenzbereiche hinaus<br />
und machen die Qualität von Kompetenzmodellen und Testaufgaben davon<br />
abhängig, dass in ihnen bildungstheoretisch, didaktisch und fachdidaktisch<br />
ausgewiesene Fragestellungen erfasst werden.<br />
Deutungskompetenz wird als Befähigung zu einem Denken definiert, das<br />
zwischen lebensweltlichen, wissenschaftlichen, hermeneutischen sowie<br />
ideologie- und voraussetzungskritischen Formen des Urteilens unterscheidet<br />
und die Abstimmungsprobleme zwischen diesen Urteilsformen nicht<br />
leugnet, sondern reflektiert. Partizipationskompetenz wird als die Fähigkeit<br />
gefasst, in den ausdifferenzierten Praxisbereichen von Ökonomie, Moral,<br />
Politik, Bildung, Kunst und Religion nicht nur Leistungen im Bereich des<br />
Wissens und Urteilens erbringen, sondern auch eigene Stellungnahmen<br />
entwickeln und diskursiv vertreten zu können.<br />
Die grundlagentheoretischen Überlegungen fragen nach Struktur und<br />
Aufgaben einer zeitgemäßen Erziehung, unterscheiden zwischen affirmativer<br />
und reflexiver Emanzipation, binden gelingende Bildungsprozesse an<br />
den Erwerb von Urteils- und Partizipationskompetenzen in den Bereichen<br />
»Wissen« und »Umgang« zurück und weisen auf die Abhängigkeit der<br />
Entwicklung solcher Kompetenzen von einer reflexiven Auseinandersetzung<br />
mit eigenen und fremden kulturellen Kontexten sowie einer innovatorischen<br />
Praxis der Überlieferung hin, welche die nachwachsende Generation in die<br />
zentralen Praxisfelder des gesellschaftlichen Zusammenlebens einführt.<br />
2008. ca. 220 Seiten, kart.<br />
ca. € 19,90/sFr 35,90<br />
ISBN 978-3-506-76515-4<br />
Der Autor:<br />
Dietrich Benner, Prof. Dr. phil., geb.<br />
1941, 1965 Promotion im Hauptfach<br />
Philosophie an der Universität Wien,<br />
1970 Habilitation im Fach Erziehungswissenschaft<br />
an der Universität Bonn,<br />
1971 – 1972 Universität Freiburg i. Br.,<br />
1973 – 1991 Professor für Erziehungswissenschaft<br />
an der Westfälischen<br />
Wilhelms-Universität Münster, seit 1991<br />
Prof. für Allgemeine Erziehungswissenschaft<br />
an der Humboldt-Universität<br />
zu Berlin; Rufe an die Universitäten<br />
Klagenfurt (1976) und Zürich (1977);<br />
seit 2004 Honorarprofessor an der East<br />
China Normal University Shanghai.<br />
Im zweiten Teil werden die grundlagentheoretischen Überlegungen anhand<br />
konkreter Anwendungsfelder (Demokratie, Kultur, Religion, Ethik, Moralisierung,<br />
Globalisierung) untersucht.
26 LITERATUR | PÄDAGOGIK<br />
KATHARINA MÜLLER-ROSELIUS<br />
Max Frisch<br />
Gebildete Literatur –<br />
literarische Bildung<br />
2008. ca. 240 Seiten, kart.<br />
ca. € 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76506-2<br />
Das Werk von Max Frisch ist literaturwissenschaftlich,<br />
philosophisch, psychologisch und vor allen Dingen<br />
pädagogisch durchleuchtet worden. Generationen von<br />
Schülern kennen den »Homo faber«, Generationen von<br />
Studenten kennen den »Stiller« als Anti-Bildungsroman.<br />
Wer kennt nicht Frischs säkularisiertes Bibelzitat »Du<br />
sollst dir kein Bildnis machen«?<br />
Aus dem Werk von Max Frisch lernen – das war auch das Anliegen der<br />
Autorin. Dabei fahndet sie nicht nach didaktischen Allgemeinplätzen, die<br />
dieses Werk bereithält. Katharina Müller-Roselius fragt nach »Bildung« in<br />
den Schriften Max Frischs, sie untersucht die Bildungsprozesse des Ich,<br />
das als schreibendes, als erzählendes sich selbst entwirft und mit diesen<br />
fiktiven Entwürfen selbstkritisch die Möglichkeiten einer gelungenen<br />
Biographie durchspielt.<br />
Mit dem Blick auf unterschiedliche Dimensionen des aktuellen bildungstheoretischen<br />
Diskurses greift sie Frischs Theorie der Erlebnismuster auf<br />
und verweist auf die Brüchigkeit moderner Bildungsgänge. Max Frisch<br />
wird dabei nicht uminterpretiert, sondern vom bewussten Standpunkt<br />
der Bildungstheoretikerin aus neu gelesen. Das Ergebnis kann schließlich<br />
als eine kritische Revision aktueller Schulpolitik und universitärer<br />
Didaktik gelesen werden: So verheißungsvolle wie fragwürdige Begriffe<br />
wie »Kompetenzen« und »Standards« stehen damit auf dem Prüfstand<br />
– ebenso wie eine Vorstellung von Bildung als zielsicherem Prozess.<br />
Die Autorin:<br />
Katharina Müller-Roselius, Dr. phil., geb. 1975, studierte deutsche<br />
und französische Literaturwissenschaft sowie Erziehungswissenschaft<br />
in Bonn, Reims und Hamburg; wiss. Mitarbeiterin<br />
an der Univ. Hamburg; z. Zt. unterrichtet sie an einem Hamburger<br />
Gymnasium die Fächer Deutsch, Französisch, Kreatives Schreiben<br />
und Philosophie.<br />
JOHANNES BILSTEIN | LEOPOLD KLEPACKI |<br />
ECKART LIEBAU | JÖRG ZIRFAS<br />
Geschichte der<br />
ästhetischen Bildung<br />
Band 1: Antike und Mittelalter<br />
2008. ca. 200 Stein, kart.<br />
ca. € 29,90/sFr 49,90<br />
Subskriptionspreis: ca. € 24,90/sFr 44,-<br />
ISBN 978-3-506-76492-8<br />
Die Geschichte der ästhetischen Bildung erscheint in 4 Bänden<br />
und steht bis zum Erscheinen des 4. Bandes zur Subskription!<br />
Mit diesem vierbändigen Werk zur Geschichte der ästhetischen Bildung<br />
wird eine schmerzliche Lücke in der Geschichte der Bildung und der<br />
Pädagogik geschlossen.<br />
Die Beschäftigung mit Kunst, Schönheit, Spiel und Form hat in allen Epochen<br />
der europäischen Geschichte zentrale Bedeutung für die Bildung des<br />
Menschen. Ästhetische Bildung war und ist dabei immer eng mit künstlerischer<br />
Produktion und ästhetischer Rezeption sowie mit Nachahmung<br />
und Kreativität verbunden. Die Darstellung ist in vier Zeitabschnitte<br />
gegliedert: Antike und Mittelalter, Frühe Neuzeit, Neuzeit und Moderne.<br />
Die zentralen Autoren werden jeweils unter biographischen und inhaltlichen<br />
Aspekten behandelt; die jeweilige Theorie ästhetischer Bildung<br />
wird im Grundriss dargestellt. Kulturwissenschaftliche Einführungen<br />
eröffnen jeweils Autoren übergreifend einen historischen Rahmen für<br />
Lebensformen, Weltanschauungen, Bildungskonzepte und ästhetische<br />
Modelle der einzelnen Epochen.<br />
Die Autoren:<br />
Johannes Bilstein, ist Prof. für Erziehungswissenschaft an der<br />
Folkwang Hochschule, Essen.<br />
Dr. Leopold Klepacki ist Lehrbeauftragter für Darstellendes Spiel<br />
an der Erziehungswissenschaftlichen Fak. der Univ. Erlangen.<br />
Prof. Dr. Eckart Liebau ist Professor (Lehrstuhl für Pädagogik II) an<br />
der Universität Erlangen.<br />
Prof. Dr. Jörg Zirfas ist Akademischer Rat in Pädagogik an der<br />
Universität Erlangen.<br />
Die weiteren Bände:<br />
Band 2: Frühe Neuzeit | Band 3: Neuzeit | Band 4: Moderne
PÄDAGOGIK 27<br />
WINFRIED BÖHM | ERNESTO SCHIEFELBEIN | SABINE SEICHTER<br />
Projekt<br />
Erziehung<br />
Ein Lehr- und Lernbuch<br />
Die Erziehung als das Projekt der Moderne scheint am Ende zu sein. War<br />
es der Grundgedanke der abendländischen Erziehung, den Menschen zum<br />
Menschen zu erziehen, hat die Pädagogik heute den Blick auf den ganzen<br />
Menschen weitgehend verloren und richtet ihr Interesse auf einzelne<br />
Aspekte: Qualifikationen, Kompetenzen, Strategien, Methoden. Angesichts<br />
einer offenen und ungewissen Zukunft und im Hinblick auf den nicht mehr<br />
vorgegebenen, sondern vom einzelnen selbst zu bestimmenden Lebenssinn<br />
wird eine Erziehung immer fragwürdiger, die den Menschen in erster Linie<br />
für Zwecke abrichten und auf Funktionen vorbereiten will.<br />
In dieser Situation erscheint es dringend notwendig, das Projekt Erziehung<br />
von einer zukunftsfähigen Idee her neu zu entwerfen. Dabei darf die europäische<br />
Tradition von Antike, Christentum und Aufklärung nicht leichtfertig<br />
über Bord geworfen werden, sondern sie muss im Hinblick auf die<br />
Herausforderungen einer unbestimmten Zukunft vom Prinzip der Person<br />
her neu überdacht und fruchtbar gemacht werden. Mit Person ist damit der<br />
mit Vernunft, Freiheit und Sprache ausgestatte mündige Mensch gemeint,<br />
dessen Bestimmung es ist, sich selbst zu bestimmen und den die Erziehung<br />
deshalb nicht zum Mittel für andere Zwecke gebrauchen darf, seien diese<br />
ideologisch, politisch oder ökonomisch.<br />
Das vorliegende Buch versteht sich als Anleitung zu diesem kritischen<br />
Nachdenken über Erziehung und als innovativer Wegweiser zu einem verantwortungsbewussten<br />
eigenen Standpunkt. Dieses von dem deutschen<br />
Pädagogen Winfried Böhm und dem chilenischen Bildungsplaner ursprünglich<br />
für (latein-)amerikanische Leser verfasste und inzwischen weltweit erprobte<br />
Lehr- und Lernbuch wurde von der jungen Erziehungswissenschaftlerin<br />
Sabine Seichter für ein breites deutsches Publikum vollständig überarbeitet.<br />
Es wendet sich grundsätzlich an alle an Erziehung Interessierten (besonders<br />
Eltern, Erzieher, Lehrer, Studierende, Bildungspolitiker, Pädagogen) und<br />
eignet sich gleichermaßen als Lehrbuch in der Ausbildung von Erziehern<br />
und Lehrern und als Lernbuch für das individuelle Selbststudium.<br />
2008. ca. 240 Seiten, kart.<br />
ca. € 22,90/sFr 41,-<br />
ISBN 978-3-506-76516-1<br />
Die Herausgeber:<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Winfried Böhm, Studium<br />
von Philosophie, Pädagogik, Theologie,<br />
Geschichte und Musikwissenschaft.<br />
1974 – 2005 Ordinarius und Vorstand<br />
des Instituts für Pädagogik an der<br />
Universität Würzburg. Gastprofessor<br />
an bedeutenden Universitäten in Europa,<br />
Südamerika und den USA. Nebenberuflich<br />
tätig als Opernregisseur und<br />
-librettist.<br />
Prof. Dr. Ernesto Schiefelbein, Studium<br />
von Wirtschaftswissenschaften, Statistik<br />
und Erziehungswissenschaft. Direktor<br />
der UNESCO für Lateinamerika und die<br />
Karibik, 1994 Erziehungsminister Chiles,<br />
1997 – 2004 Rektor der Universität St.<br />
Thomas in Santiago, Gastprofessor an<br />
den Universitäten Hiroshima, Harvard,<br />
Cordoba. International renommierter<br />
Bildungsplaner und -berater von<br />
UNESCO und Weltbank.<br />
Dr. phil., Dipl. Päd. Sabine Seichter,<br />
Studium von Pädagogik, Soziologie,<br />
Psychologie und Betriebswirtschaftslehre<br />
in Würzburg und Rom, Promotion<br />
2007, Lehrbeauftragte für Allgemeine<br />
Pädagogik an der Universität Würzburg.
28 PHILOSOPHIE<br />
HERIBERT MÜHLEN<br />
Im-Wir-sein<br />
Grundlegung der Wir-Wissenschaft<br />
Beitrag zu einer wirgemäßen Lebensund<br />
Weltordnung<br />
Aus dem Nachlass herausgegeben von Wilhelm Maas<br />
2008. ca. 320 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag<br />
ca. € 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76505-5<br />
Erstmalig in der abendländischen Denk<strong>geschichte</strong><br />
wird hier, nach der traditionellen, griechisch-mittelalterlichen<br />
Seinsphilosophie (Es-Philosophie) und der<br />
neuzeitlichen Ich-Philosophie, eine Wir-Philosophie<br />
vorgelegt, die vom Sprachgeschehen »wir« und einer<br />
Analyse seiner Implikationen ausgeht und aufweist,<br />
dass das Im-Wir-sein allem menschlichen Denken<br />
und Handeln immer schon vorgegeben ist und es<br />
das menschliche Dasein insgesamt und als solches<br />
apriori und alternativlos bestimmt. Diese Wir-<br />
Bestimmtheit wird im Einzelnen thematisiert. Es werden<br />
wirgemäße Denkweisen eingeübt und wirgemäße<br />
Handlungsorientierungen aufgezeigt.<br />
Methodisch gesehen wird hier nicht über das »Wir« gesprochen, sondern<br />
der Leser wird einbezogen in den Mitvollzug des »Wir«-Geschehens und<br />
in den dieses Sprachgeschehen reflektierenden Nachvollzug.<br />
Das rasante Anwachsen der Weltbevölkerung und eine Globalisierung aller<br />
Lebensbezüge haben die Philosophie zunehmend mit einem geschichtlich<br />
neuen Weltbezug konfrontiert: »Wie können wir alle überleben?« lautet<br />
die entscheidende Frage nach einer neuen Weltordnung und einer<br />
entsprechenden Wir-Ethik. Die »Charta der Vereinten Nationen« von<br />
1945 und die »Pariser Charta für ein neues Europa« von 1990, die einen<br />
wesentlichen Anstoß zu diesem Buch geliefert haben, werden einer<br />
detaillierten Analyse unterzogen.<br />
OTTO NEUMAIER<br />
Moralische Verantwortung<br />
Beiträge zur Analyse eines ethischen Begriffs<br />
2008. ca. 240 Seiten, kart.<br />
ca. € 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76504-8<br />
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen,<br />
folgende Frage zu beantworten: Welche<br />
Bedingungen sind notwendig dafür, dass es objektiv<br />
gerechtfertigt ist, jemandem moralische Verantwortung<br />
im Sinne einer Pflicht zuzurechnen?<br />
Durch die Beantwortung dieser Frage soll ein kleiner, aber wesentlicher<br />
Bereich der Verantwortungsproblematik geklärt werden. Dies zu tun,<br />
erscheint allein schon deshalb notwendig, weil die Häufigkeit, mit welcher<br />
die Ausdrücke »verantwortlich« und »Verantwortung« verwendet<br />
werden, mit einer gewissen Unbestimmtheit in Bezug darauf einher geht,<br />
was damit jeweils gemeint sein könnte. Diese Unbestimmtheit betrifft<br />
nicht zuletzt die Fragen, ob sich die Rede von jemandes Verantwortung<br />
auf eine Pflicht der betreffenden Person bezieht oder nicht und ob eine<br />
solche Pflicht als moralische Angelegenheit zu sehen ist oder als eine<br />
des Rechts oder anderer Normsysteme. Um moralische Verantwortung<br />
im Sinne einer Pflicht zu bestimmen, ist insbesondere notwendig, die<br />
Bedingungen anzugeben, die erfüllt sein müssen, damit es objektiv<br />
gerechtfertigt ist, jemandem Verantwortung im Allgemeinen zuzurechnen,<br />
andererseits aber ist zu klären, in welchem Sinne sich Menschen<br />
dabei auf Moral berufen. Eine solche Analyse ist notwendig, um zu erkennen,<br />
auf welche Weise die Rede von moralischer Verantwortung in unser<br />
Leben eingreifen kann und soll.<br />
Der Autor:<br />
Otto Neumaier, Dr. phil., geb. 1951, Studium der Philosophie und<br />
Germanistik an der Universität Innsbruck; seit 1980 am Institut<br />
für Philosophie der Universität Salzburg, seit 2005 AoUniv.-<br />
Professor; 1993/94 Gastprofessor an der University of California,<br />
Irvine, 2005 Gastprofessor an der Lettischen Kulturakademie,<br />
Riga.<br />
Der Autor:<br />
Heribert Mühlen, Dr. phil., Dr. theol., von 1964 bis 1997 Professor<br />
für Dogmatik an der Theologischen Fakultät Paderborn.
THEOLOGIE 29<br />
UWE JOCHUM<br />
Die Sendung des Paulus<br />
Politik der Umkehr<br />
Gott ist uns als Referenzort für »Welt« abhanden gekommen.<br />
Nahezu jeder wird es für einleuchtend halten, nicht übernatürliche<br />
Instanzen zu bemühen, sondern mit wissenschaftlichen Mitteln zu ergründen,<br />
was uns widerfahren ist. Zu diesen wissenschaftlichen Mitteln gehört<br />
zweifellos ein immer umfänglicher werdendes und perfekter erscheinendes<br />
technisches Instrumentarium, mit dessen Hilfe wir einerseits der Natur bis<br />
in ihr Grundmuster auf die Schliche kommen und uns andererseits vor ihr<br />
schützen wollen. Dem entspricht eine wissenschaftliche Sprache, die auf<br />
den Zweck von Analyse, Bearbeitung und Herstellung von Natur reduziert<br />
ist – also letztlich die Beherrschbarkeit von Natur suggeriert. Dieses System<br />
selbstgeschaffener Zeichensymbolik verschafft das Gefühl einer ungeahnten<br />
Sicherheit.<br />
Der Preis, der für diese trügerische Sicherheit zu zahlen ist, besteht im<br />
Verlust dessen, was jenseits der Grenze dieses selbstgeschaffenen Kontrollund<br />
Manipulationssystems liegt: Das Jenseitige bleibt eine Schein-Welt, die<br />
höchstenfalls als das Mystische wahrgenommen wird.<br />
Dieses Versprechen auf grenzenlose allumfassende Sicherheit ist nicht<br />
einlösbar, der Einbruch des verdrängten Jenseitigen unausweichlich.<br />
Der Autor zeigt, dass Paulus dieses Problem dadurch löst, dass er auf den<br />
unbegründbaren und aus keinen Zeichen abzuleitenden Anfang unseres<br />
Sprechens zurückgeht und darin einen Einsatz wagt, der unseren medientheoretischen<br />
Gewohnheiten widerspricht. Aber genau in diesem Widerspruch<br />
entdeckt Paulus eine Welt der Freiheit, in der wir uns auf eine<br />
Zukunft entwerfen, in der die Dinge und die Welt einmal vollkommen anders<br />
sein sollen. Das aber ist nur möglich im Vertrauen darauf, dass wir diese<br />
Freiheit auch wirklich gewinnen können. Für Paulus hat dieses Vertrauen<br />
einen Namen: Jesus Christus.<br />
2008. ca. 184 Seiten, kart.<br />
ca. € 19,90/sFr 35,90<br />
ISBN 978-3-506-76549-9<br />
Der Autor:<br />
Uwe Jochum, geb. 1959, Dr. phil.,<br />
Studium der Germanistik und Politikwissenschaft<br />
in Heidelberg; seit 1989<br />
wiss. Bibliothekar an der Universitätsbibliothek<br />
Konstanz.
30 PHILOSOPHIE | RELIGIONSPHILOSOPHIE<br />
MARTIN KNECHTGES | JÖRG SCHENUIT (HRSG.)<br />
Profane Zumutungen<br />
2008. ca. 120 Seiten, franz Broschur<br />
Einzelheftpreis: ca. € 12,90/sFr 24,-<br />
Abopreis: ca. € 9,90/sFr 18,90<br />
ISBN 978-3-506-76497-3<br />
= Fuge | Journal für Religion und Moderne, Band 2<br />
Da mag von der Rückkehr der Religion noch so sehr die<br />
Rede sein: Dem Glaubenden, der nach dem Heiligen<br />
Ausschau hält, weht im liberalen Gemeinwesen ein<br />
profaner Wind entgegen, der ihn stören muss. Dabei<br />
sind es nicht die inneren Überzeugungen geistig<br />
beweglicher Atheisten, die seine religiöse Lebensführung<br />
behindern. Mit intellektuellen Atheisten,<br />
die an sich selbst zweifeln, kann er ins Gespräch<br />
kommen. Es ist die zum Dogma erstarrte a-religiöse<br />
Gesamttendenz unserer Kultur, die ihm zum Problem<br />
geworden ist. Denn in ihrem Sog werden alle Phänomene<br />
des Lebens unbedacht profan gedeutet.<br />
Dadurch sind die Glaubenden genötigt, ihre religiösen<br />
Überzeugungen in der Öffentlichkeit zurückzuhalten<br />
und sie zu einer bloßen Privatsache zu degradieren.<br />
Mit dieser Zumutung leben sie unter den kulturellen<br />
Bedingungen einer zementierten laïcité.<br />
Band 2 der FUGE erörtert diese Tendenz aus unterschiedlichen<br />
Perspektiven. Es kommen Stimmen zu Wort, die vor der religiösen<br />
Verwahrlosung unserer Kultur warnen, aber auch solche, die von den<br />
Vorzügen der Freiheit sprechen. »Profane Zumutungen« enthält Beiträge<br />
von Léon Bloy, Franz-Xaver Kaufmann, Friedrich Wilhelm Graf, Terry<br />
Eagleton, Rainer Bucher, Anthony Carty, Robert Lembke und Jürgen<br />
Manemann.<br />
Die »FUGE. Journal für Religion & Moderne« erscheint halbjährlich mit<br />
wechselnden Themenschwerpunkten.<br />
Die Herausgeber:<br />
Martin Knechtges, Dr. phil., ist wissenschaftlicher Referent für<br />
Philosophie und Ethik an der Kath. Akademie in Berlin.<br />
Jörg Schenuit, arbeitet als freier Publizist und Übersetzer.<br />
MICHAEL F. KÖCK<br />
Personale Struktur<br />
religiöser Erfahrung<br />
Komplementarität und Transzendenz bei Max Müller<br />
2008. ca. 276 Seiten, kart.<br />
ca. € 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76485-0<br />
Ausschauhalten nach einem unendlichen »Du«<br />
Begegnet der Mensch in religiöser Erfahrung einem<br />
(unendlich) höheren »Du« oder einem unpersönlichen,<br />
unansprechbaren »Es«?<br />
Die vorliegende religionsphilosophische Analyse untersucht – mit<br />
Hilfe des Begriffspaares »Komplementarität und Transzendenz« sowie<br />
in kritischer Auseinandersetzung mit Max Müller (1906 – 1994) – die<br />
Struktur personaler religiöser Erfahrung.<br />
Dabei geht es zwar vordergründig um mitunter ziemlich komplexe<br />
und diffizile religionsphilosophische Zusammenhänge, im Hintergrund<br />
ist dabei aber immer auch die ideengeschichtliche Vernetzung religiöser<br />
Paradigmen mit politisch-gesellschaftlicher Praxis mitzudenken – und<br />
dies nicht zuletzt in Hinblick auf die geistige Selbstfindung des modernen<br />
Europa!<br />
Auf das Werk Max Müllers konzentriert sich das Interesse vor allem<br />
wegen seiner exemplarischen Bedeutung: Kondensiert doch in seinen<br />
Texten ein Denkmuster, welches beispielhaft ist für einen ganz<br />
bestimmten Stil des Philosophierens seiner Zeit.<br />
Darum mag die eingehende Analyse seiner Schriften dazu beitragen,<br />
besser zu verstehen, was es heißt, personal strukturierte religiöse<br />
Erfahrung mit den geistigen wie sprachlichen Mitteln einer speziellen<br />
philosophischen Tradition theoretisch zu erfassen.<br />
Der Autor:<br />
Michael F. Köck, geb. 1968, Studium der Theologie und Philosophie<br />
in Salzburg und Innsbruck, seit 1998 Lehrbeauftragter für<br />
Philosophie an der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Salzburg<br />
mit den Schwerpunkten Logik, Sprachphilosophie, Fragen der<br />
Gegenwartsphilosophie und Religionsphilosophie.
PHILOSOPHIE | LITERATURWISSENSCHAFT 31<br />
BÄRBEL FRISCHMANN |<br />
ELIZABETH MILLÁN-ZAIBERT (HRSG.)<br />
Das neue Licht der Frühromantik<br />
Innovation und Aktualität frühromantischer Philosophie<br />
2008. ca. 320 Seiten, kart.<br />
ca. € 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76503-1<br />
Die Frühromantiker, die sich in Auseinandersetzung<br />
mit der klassischen deutschen Philosophie und<br />
Literatur profilierten, befanden sich nicht nur philosophisch,<br />
literarisch und naturwissenschaftlich auf<br />
der Höhe der Zeit, sondern gingen auch in vielen<br />
Bereichen neue Wege. Sie rangen auf originelle und<br />
oft auch radikale Weise um Alternativen zu den bisherigen<br />
Denkmodellen, Rationalitätsformen, Konzepten<br />
von Philosophie, Poesie, Religion, Naturwissenschaft,<br />
Politik und selbst Lebensformen und stellten gerade<br />
darin eine Herausforderung für ihre Zeit und die nachfolgende<br />
Entwicklung dar.<br />
Der vorliegende Band zielt darauf, die innovativen philosophischen<br />
Leistungen der Frühromantik und deren Tragweite auch für die heutigen<br />
philosophischen Diskussionen herauszustellen. Dabei wird nicht nur der<br />
gegenwärtige Forschungsstand dokumentiert, sondern auch verschiedene<br />
Zugänge zur Philosophie der Frühromantik erörtert.<br />
Die Herausgeber:<br />
Bärbel Frischmann, Dr. phil., PD, Studium der Philosophie in Berlin<br />
und Jena; Habilitation im Fach Philosophie an der Univ. Bremen<br />
Lehrtätigkeit an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der<br />
Universität Bremen; z. Zt. wiss. Mitarbeiterin an der Universität<br />
Bremen. Gastprofessuren an der Korea University in Seoul und an<br />
der Universität Tübingen.<br />
Prof. Elizabeth Millán-Zaibert, Dr. phil., Studium an der State<br />
University of New York, Buffalo und Tübingen; Lehrtätigkeit an der<br />
Universidad Simón Bolívar, Caracas (Venezuela) und an der DePaul<br />
University, Chicago; z. Zt. Associate Professor der Philosophie an<br />
der DePaul University, Chicago.<br />
MICHAEL WEITZ<br />
Allegorien des Lebens<br />
Literarisierte Anthropologie bei Fr. Schlegel,<br />
Novalis, Tieck und E.T.A. Hoffmann<br />
2008. ca. 220 Seiten, kart.<br />
ca. € 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76508-6<br />
Das Buch liefert eine völlig neue Sicht auf kanonische<br />
Texte der deutschen Romantik. Indem der Autor eine<br />
diskursgeschichtliche Neubestimmung der Romantik<br />
jenseits der üblich gewordenen Epochenphrasierung<br />
eines grundlegenden Bruchs um 1775 vornimmt, leistet<br />
er einen erheblichen Beitrag zur Romantikforschung.<br />
Es geht um eine grundlegende Affinität romantischer<br />
Prosa zur barocken Klugheits- und Lebenskunst. Denn<br />
über die heute geläufige kulturhistorische Situierung<br />
der Romantik als »Vorbote der Moderne« bis hin<br />
zur Post-Moderne macht der Autor den empirischen<br />
Befund einer Semantik aus, die in die entgegen gesetzte<br />
Richtung steuert und die romantische Literatur<br />
erstmals in einer Traditionslinie von Moralistik und<br />
Anthropologie her lesbar macht. Es wird in der romantischen<br />
Diskurslogik die überraschende Kontinuität<br />
eines Lebenskunstdiskurses freigelegt, der nicht, wie<br />
verbreitet, als Restbestand antiker Traditionen in der<br />
Neuzeit betrachtet aufgefasst wird, sondern als grundierendes<br />
Denkmuster romantischer Literatur.<br />
Der Autor:<br />
Dr. Michael Weitz, geb. 1963, Studium der Germanistik, Anglistik<br />
und Pädagogik in Köln und St. Louis (Washington University);<br />
Dozententätigkeit in der Wirtschaft; 2002 – 2007 Lektor für Deutsche<br />
Sprache an der Sporthochschule Köln; seit 2007 Assistenz-<br />
Professor an der Hankuk University of Foreign Studies in Seoul,<br />
South Korea.
32 LITERATURWISSENSCHAFT<br />
STEFAN SCHWEIZER<br />
Anthropologie der Romantik<br />
Körper, Seele und Geist.<br />
Anthropologische Gottes-, Welt und Menschenbilder<br />
der wissenschaftlichen Romatik<br />
2008. ca. 700 Seiten, kart.<br />
ca. € 99,-/sFr 167,-<br />
ISBN 978-3-506-76509-3<br />
Körper, Seele und Geist. Aus welchen Teilen besteht<br />
der Mensch? Mit dieser Fragestellung hat sich die<br />
Anthropologie schon seit Jahrhunderten beschäftigt.<br />
Vorliegendes Buch arbeitet diese Frage anhand der<br />
Epoche der Romantik und des damaligen wissenschaftlichen<br />
Diskurses der Anthropologie auf. Zwischen den<br />
Anthropologen gab es große Meinungsunterschiede.<br />
Die Schule der Dualisten behauptete, dass der Mensch<br />
aus einer Seele und einem Körper bestehe. Die genuin<br />
christlich inspirierten Trinitarier gingen hingegen von<br />
einem Gott analogen Menschenbild mit den Merkmalen<br />
Geist, Seele und Körper aus.<br />
Das Buch verspricht zudem neue Einsichten über die<br />
Romantik. War sie eine eher progressive oder doch<br />
restaurativ-reaktionäre Epoche?<br />
Aus der Fragestellung heraus wird außerdem das schwierige und differenzierte<br />
Themengebiet der Anthropologie zur Zeit der Romantik deutlich,<br />
denn die Anthropologie stellt eine Schnittmengendisziplin aus Medizin,<br />
Philosophie, Physiologie, Psychologie und Theologie dar, wobei diese nur<br />
die wichtigsten sind.<br />
Der Autor:<br />
Stefan Schweizer, Dr. phil., geb. 1973, Studium der Rechtswissenschaft,<br />
Philosophie, Politologie und Germanistik; seit<br />
2004 Studienassessor und Lehrbeauftragter des Instituts für<br />
Literaturwissenschaft der Univ. Stuttgart; 2007 Berufung als<br />
Lehrbeauftragter Geschichte/Gemeinschaftskunde an das<br />
Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Stuttgart.<br />
KLAUS VIEWEG (HRSG.)<br />
Friedrich Schlegel<br />
und Friedrich Nietzsche<br />
Transzendentalpoesie oder Dichtkunst mit Begriffen<br />
2008. ca. 224 Seiten, kart.<br />
ca. € 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76493-5<br />
= Schlegel-Studien, Band 1<br />
Das ungeklärte Verhältnis zwischen Literatur und<br />
Philosophie, zwischen dem Heer der Metaphern und der<br />
Phalanx des Begriffs, zwischen Imagination und begreifendem<br />
Denken läßt einen komparativen Rückgriff auf<br />
Friedrich Schlegels Konzept der Transzendentalpoesie<br />
und Nietzsches Gedanken einer Dichtkunst mit Begriffen<br />
als besonders produktiv erscheinen.<br />
Richard Rorty zufolge wird die moderne Literatur und Philosophie seit<br />
1800 von der Tradition des Ironistischen geprägt, es vollziehe sich eine<br />
Art Literarisierung der Kultur. Diese Ironik setze auf ständig sich verändernde<br />
literarische Neubeschreibungen, auf das Schaffen von innovativen<br />
Vokabularen, womit an die Stelle von Argumentation und logischem<br />
Diskurs literarisches Geschick und Literaturkritik trete. Nietzsche brachte<br />
diese neue Konstellation von Literatur und Philosophie treffend auf den<br />
Punkt: »Der Philosoph erkennt, indem er dichtet, und dichtet, indem er<br />
denkt.«<br />
Es geht um die Grenzziehung zwischen Literatur und Philosophie, zwischen<br />
nicht-diskursiven und begrifflichem Denken, zwischen der Sprache<br />
der Vorstellung und der Sprache des Begriffs (Hegel), um die schwierige<br />
»Arbeit an diesem Übergang« (Derrida).<br />
Der Herausgeber:<br />
Klaus Vieweg, Prof. Dr., geb. 1953, lehrt Philosophie an der<br />
Friedrich-Schiller-Universität Jena. Forschungsschwerpunkte:<br />
Deutscher Idealismus, besonders Hegel; Skeptizismus.
Athenäum<br />
Jahrbuch für Romantik<br />
Herausgegeben von Ernst Behler (†),<br />
Jochen Hörisch, Manfred Frank<br />
und Günter Oesterle<br />
17. Jahrgang 2007.<br />
ca. 256 Seiten, Festeinband<br />
Abopreis: ca. € 34,90/sFr 59,-<br />
Einzelpreis: ca. € 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76435-5<br />
Aus dem Inhalt:<br />
Abhandlungen<br />
Manfred Franz:<br />
»Der schwere Schritt in die Wirklichkeit«.<br />
Über das Werden eines frühromantischen<br />
Realismus<br />
Michael Lommel:<br />
Peter Schlemihl und die Medien des Schattens<br />
Hans Feger:<br />
Das Groteske in Bonaventuras Nachtwachen<br />
Hermann Patsch:<br />
Zwischen den »Fakzionen«. Friedrich Schlegels<br />
Brief an Gottfried Körner vom 2. August 1976<br />
Robert S. Leventhal:<br />
Transcendental or Material Oscillation: An<br />
Alternative Reading of Friedrich Schlegel’s<br />
Alternating Principle (Wechselerweis)<br />
1796 – 1797<br />
Günter Oesterle:<br />
Dialog und versteckte Kritik oder »Ideentausch«<br />
und »Palinodie«: Wilhelm von<br />
Humboldt und Friedrich Schiller<br />
Uwe Steiner:<br />
Kreuz-Zeichen. Warum Stifters Bergkristall<br />
Kleists Das Erdbeben in Chili in eine Ökonomie<br />
des Narrativen umschreibt<br />
Steffen Dietzsch:<br />
Klingemanns Faust (1811)<br />
Jochen Hörisch:<br />
Der Rest ist beredtes Schweigen. Goethes<br />
Gedicht Im ernsten Beinhaus<br />
Geistergespräch<br />
Friedrich Kittler:<br />
Ein Gespräch unter Freunden, Freundinnen<br />
und Erbfeinden<br />
PAUL GOETSCH<br />
Machtphantasien in<br />
englischsprachigen<br />
Faust-Dichtungen:<br />
Funktionsgeschichtliche<br />
Studien<br />
2008. ca. 300 Seiten, kart.<br />
ca. € 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76499-7<br />
= Beiträge zur englischen und amerikanischen<br />
Literatur, Band 26<br />
Als ein »Schlüsselmythos der Neuzeit«<br />
(Watt) erfreut sich die Faust-<br />
Geschichte im englischen Sprachraum<br />
großer Beliebtheit. Neben<br />
dem Volksbuch und Marlowes Doctor<br />
Faustus haben verschiedene<br />
Prätexte die englische und amerikanische<br />
Entwicklung beeinflusst,<br />
vor allem Goethes Faust, Mary<br />
Shelleys Frankenstein, Spenglers<br />
Der Untergang des Abendlandes<br />
und Thomas Manns Doktor Faustus.<br />
Die vorliegende Untersuchung<br />
interessiert sich weniger für das<br />
einzelne Werk in seiner Abhängigkeit<br />
von Prätexten als für seine<br />
Stellung und seine historischen<br />
Funktionen in der Entwicklung der<br />
Faust-Mythe.<br />
Die »Arbeit am Mythos« – seine Weiterführung,<br />
Umformulierung, seine Ent- und Remythisierung<br />
sowie seine Destruktion – gilt<br />
hauptsächlich seinen Grundannahmen und<br />
den Formelementen, die sie zum Ausdruck<br />
bringen. Die Faust-Mythe gehört zu den Erzählungen,<br />
die über menschliches Maß hinausgehen<br />
und Vorstellungen des Grandiosen<br />
entwerfen. Faust-Gestalten träumen als Vertreter<br />
des modernen Individualismus von der<br />
Herrschaft über Zeit und Natur, von politischgesellschaftlicher<br />
Macht, dichterischem Ruhm<br />
sowie sexueller Potenz. Die Faust-Texte interpretieren,<br />
bestätigen und befördern diesen<br />
Prozess, kritisieren ihn aber auch und heben<br />
die Ambivalenz der Entwicklung in der westlichen<br />
Welt hervor.<br />
Der Autor:<br />
Paul Goetsch, Prof. em., Dr. phil., geb. 1934,<br />
war von 1971 bis zu seiner Emeritierung<br />
Professor für englische und amerikanische<br />
Literatur an der Universität Freiburg.<br />
LITERATURWISSENSCHAFT 33<br />
DENNIS HANNEMANN<br />
Klassische Antike<br />
und amerikanische<br />
Identitätskonstruktion<br />
Untersuchungen zu Festreden<br />
der Revolutionszeit und der<br />
frühen Republik 1770 – 1815<br />
2008. ca. 240 Seiten, kart.<br />
ca. € 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76491-1<br />
= Beiträge zur englischen und amerikanischen<br />
Literatur, Band 27<br />
Für die Konstitution des amerikanischen<br />
Selbstverständnisses im<br />
späten 18. und frühen 19. Jahrhundert<br />
spielten Griechenland<br />
und Rom eine bedeutsame Rolle.<br />
Inwieweit sich die junge Nation<br />
vor dem Horizont antiker Modelle<br />
politisch wie historisch zu verorten<br />
versuchte, offenbart gerade<br />
das Genre der Festreden (u. a.<br />
Fourth of July- und Washington-<br />
Gedenkreden), denen aufgrund<br />
ihrer Einbettung in eine kollektive<br />
Festkultur eine zentrale Funktion<br />
für die Identitätsstiftung zufällt.<br />
Dieses Genre wird hier erstmals<br />
systematisch aus rhetorischer und<br />
rezeptionsgeschichtlicher Perspektive<br />
untersucht.<br />
Dabei treten zwei Verfahren der Vereinnahmung<br />
antiker Wissensbestände zutage. Während<br />
der exemplarische Antikerekurs genutzt<br />
wird, ein republikanisches Wertesystem zu<br />
vermitteln, dient der typologische Antikerekurs<br />
dazu, Amerika zur Erbin einer von der<br />
Antike kommenden Ziviltradition zu stilisieren.<br />
Die Festreden reflektieren zugleich zeitgenössische<br />
Geschichtsauffassungen, insofern<br />
sie das historia magistra vitae-Konzept und<br />
die progressive Geschichtsdeutung miteinander<br />
verknüpfen.<br />
Der Autor:<br />
Dennis Hannemann, geb. 1975, Studium<br />
der Englischen und Lateinischen Philologie<br />
an den Univ. Tübingen, Reading und<br />
Yale; z. Zt. Studienreferendar an einem<br />
Tübinger Gymnasium.
34 THEOLOGIE<br />
GERDA RIEDL | MANFRED NEGELE<br />
Apokalyptik<br />
Zeitgefühl mit Perspektive?<br />
2008. ca. 300 Seiten, kart.<br />
ca. € 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76490-4<br />
Flammendes Inferno, einstürzende Hochhäuser, verzweifelte<br />
Menschen – Panik, wohin das Auge reicht.<br />
So gestalten sich in unserem Kulturkreis die vorherrschenden<br />
Assoziationen zum Begriff der »Apokalyptik«.<br />
Mit dem biblisch-christlichen Verständnis dieses<br />
Phänomens hat eine derartige Weltuntergangsstimmung<br />
wenig bis gar nichts zu tun: Kein Angstgebilde,<br />
sondern ein Hoffnungsgemälde, ein Zeitgefühl mit Perspektive<br />
eben eröffnet sich in christlichem Horizont.<br />
Vorliegender Band fokussiert das Phänomen ›Apokalyptik‹ zunächst<br />
aus politologischer, soziologischer und mentalitätsgeschichtlicher<br />
Perspektive. Dabei stellt sich heraus, in welch ungeheurem Ausmaß<br />
moderne Apokalyptik als bloßes Säkularisat jede Hoffnung auf einen<br />
Neuanfang längst verabschiedet hat.<br />
Unbeschadet des bekannten Hegelschen Diktums fungiert in apokalyptischen<br />
Denkbahnen Welt<strong>geschichte</strong> aber gerade nicht als Weltgericht:<br />
»Die Apokalyptik anerkennt die Geschichte nicht als Weltgericht, begehrt<br />
dagegen auf, dass das Blut der Opfer im Sinn des Werdens trocknet«<br />
(Alain Finkielkraut). Ganz anders deshalb biblisch-christliche Apokalyptik:<br />
Hier wird bedrängende Vergangenheit und quälende Gegenwart um<br />
die ankommende Zukunft des dreieinen Gottes bereichert.<br />
Die Herausgeber:<br />
Gerda Riedl, Prof. Dr. theol., apl. Professorin für Dogmatik an der<br />
Kath.-Theol. Fak. der Univ. Augsburg und seit 2004 Gastprofessorin<br />
für Dogmatik an Kath.-Theol. Fakultät der Univ. Innsbruck.<br />
Manfred Negele, Prof. Dr., Vertreter der Professur für Philosophie<br />
an der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Augsburg.<br />
Christian Mazenik, Dipl. theol., wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für<br />
Kirchen<strong>geschichte</strong> an der Kath.-Theol. Fak. der Univ. Augsburg.<br />
WILHELM METZ | KARLHEINZ RUHSTORFER (HRSG.)<br />
Christlichkeit der Neuzeit –<br />
Neuzeitlichkeit des<br />
Christentums<br />
Zum Verhältnis von freiheitlichem Denken<br />
und christlichem Glauben<br />
2008. ca. 240 Seiten, kart.<br />
ca. € 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76494-2<br />
Das Verhältnis von Aufklärung und Religion, säkularer<br />
Gesellschaft und Kirchen gewinnt nicht zuletzt durch<br />
die jüngsten weltpolitischen Ereignisse eine neue<br />
Brisanz. Die westlichen Ideale Vernunft, Freiheit und<br />
Humanität wurzeln in besonderer Weise in der klassischen<br />
Neuzeit. Obwohl die Frage nach dem Verhältnis<br />
von neuzeitlichem Denken und christlichem Glauben<br />
seit mehr als zwei Jahrhunderten Gegenstand theologischer<br />
und philosophischer Forschung ist, steht eine<br />
prinzipielle Beantwortung noch aus. Sowohl durch<br />
eingehende Analyse von einzelnen Denkern als auch<br />
durch innovative Betrachtungsweisen der Epoche im<br />
Ganzen gehen namhafte Wissenschaftler diese so aktuell<br />
gewordene Frage neu an. Dabei eröffnen sich weitreichende<br />
Perspektiven für Theologie und Philosophie.<br />
Die Herausgeber:<br />
Karlheinz Ruhstorfer, Prof. Dr. theol., geb. 1963, Studium der<br />
Germanistik, Philosophie und Theologie; Wiss. Oberassistent am<br />
Lehrstuhl für Dogmatik und ökumenische Theologie Freiburg.<br />
Wilhelm Metz, Prof. Dr. phil., geb. 1959 Studium der Philosophie,<br />
Germanistik, Linguistik, Kunst<strong>geschichte</strong> und Latein, Griechisch.<br />
Wiss. Assistent an der Universität/GHS Siegen. 1997 Habilitation.<br />
Ab 2004 Lehrtätigkeit am Gymnasium.
THEOLOGIE | SOZIALETHIK 35<br />
HUBERT WOLF | JUDITH SCHEPERS (HRSG.)<br />
»In wilder zügelloser Jagd<br />
nach Neuem«<br />
100 Jahre Modernismus und Antimodernismus<br />
in der katholischen Kirche<br />
2008. ca. 320 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76511-6<br />
= Römische Inquisition und Indexkongregation, Band 12<br />
Die katholische Kirche und die »Moderne« – ein<br />
Thema, über das sich heute genauso trefflich streiten<br />
lässt wie schon vor 100 Jahren. Damals hatte Pius X.<br />
in einem Rundumschlag alles Moderne verurteilt. Insbesondere<br />
die Glaubenswächter der Inquisition und<br />
Indexkongregation hatten diese »antimodernistische«<br />
Haltung zu vertreten und verurteilten Bücher über<br />
Bücher. Doch warum hielt man damals an der Römischen<br />
Kurie alles für schlimm, was mit »modern« zu tun<br />
hatte? Warum ließ man sogar bis 1967 die katholischen<br />
Priester in einem »Antimodernisteneid« den<br />
Irrtümern der Zeit abschwören und dem kirchlichen<br />
Lehramt unerschütterliche Unterordnung geloben?<br />
Nach einer Analyse, warum es vor gut 100 Jahren überhaupt zu einem<br />
solch erklärten Antimodernismus kommen konnte und auf welche<br />
Archive sich die Forschung heute stützen kann, werden ausgewählte<br />
Fälle vorgestellt. Für den weiteren Fortgang der Forschungen dürfte das<br />
im Anhang enthaltene Inventar sämtlicher deutscher Buchzensurfälle<br />
von 1893 bis 1922 von ausschlaggebender Bedeutung sein.<br />
Die Herausgeber:<br />
Hubert Wolf, Prof. Dr. theol., geb. 1959, ist Dir. des Sem. für Mittl.<br />
und Neuere Kirchen<strong>geschichte</strong> an der Univ. Münster; er ist Träger<br />
des Leibniz-Preises 2003 und des Communicator-Preises 2004.<br />
Judith Schepers, geb. 1978, Studium der Kath. Theol. in Münster<br />
und Rom; seit 2004 wiss. Mitarbeiterin am DFG-Projekt »Römische<br />
Inquisition und Indexkongregation« an der Univ. Münster.<br />
MANFRED SPIEKER<br />
Kirche und Abtreibung<br />
in Deutschland<br />
Ursachen und Verlauf eines Konflikts<br />
2., erweiterte Auflage 2008. ca. 290 Seiten, kart.<br />
ca. € 36,90/sFr 63,-<br />
ISBN 978-3-506-78622-7<br />
Der Konflikt um die Mitwirkung der katholischen Kirche<br />
in Deutschland an der nachweispflichtigen Schwangerschaftskonfliktberatung<br />
brachte die Kirche in den<br />
90er Jahren an den Rand einer Spaltung. Von 1993<br />
bis 1999 wurde die Problematik eines katholischen<br />
Beratungsscheines unter den deutschen Bischöfen,<br />
zwischen der Mehrheit der Bischöfe und Rom und<br />
unter den deutschen Katholiken kontrovers diskutiert.<br />
Niemals im 20. Jahrhundert hat ein kirchliches Thema<br />
derart die Öffentlichkeit beschäftigt. Auf Anweisung<br />
von Papst Johannes Paul II. hat die katholische Kirche<br />
in Deutschland die Ausstellung des Beratungsscheins,<br />
der die straflose Tötung des ungeborenen Kindes<br />
lizensiert, Anfang 2001 eingestellt. Seitdem fährt der<br />
Verein »Donum Vitae« als katholischer Beratungsverein<br />
fort, diesen Schein auszustellen.<br />
Die Arbeit zeigt die Ursachen und den Verlauf dieses Konflikts seit seinen<br />
Anfängen im Juni 1993. Sie geht den Gründen nach, weshalb die<br />
Verteidigung des deutschen Beratungskonzepts gegenüber Rom immer<br />
mehr die Verteidigung der katholischen Lehre über die Abtreibung<br />
gegenüber dem Gesetzgeber überlagerte. Sie erörtert die Bedeutung des<br />
Beratungsscheins in rechtlicher, moraltheologischer, sozialethischer,<br />
pastoraltheologischer und philosophischer Perspektive, schildert die<br />
politischen, rechtlichen und kirchlichen Kontroversen seit dem Jahr<br />
2000 und skizziert die Trendwenden in der Gesetzgebung und in der<br />
Gesellschaft westlicher Demokratien.<br />
Der Autor:<br />
Manfred Spieker, Prof. Dr. phil., geb. 1943, ist o. Professor für<br />
Christliche Sozialwissenschaften an der Universität Osnabrück.
36 THEOLOGIE<br />
THOMAS SCHREIJÄCK (HRSG.)<br />
Theologie interkulturell<br />
Glaubenskommunikation in einer gewandelten Welt<br />
2008. ca. 320 Seiten, Festeinband<br />
ca. € 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76510-9<br />
»Theologie interkulturell« beschäftigt sich seit über<br />
20 Jahren mit der Frage, wie sich der christliche Glaube<br />
in den regionalen Kulturen entwickelt und was<br />
diese kontextuelle kirchliche und theologische Vielfalt<br />
für die eine katholische Weltkirche bedeutet. Über<br />
diesen Zeitraum hinweg hat in jedem Studienjahr eine<br />
Theologin oder ein Theologe aus einem nichteuropäischen<br />
Land Afrikas, Asiens, Lateinamerikas oder dem<br />
pazifischen Raum die Einladung an die Universität<br />
Frankfurt angenommen, um über Forschungsergebnisse<br />
und Erfahrungen authentisch zu berichten und in den<br />
persönlichen und wissenschaftlichen Austausch mit<br />
Kolleginnen und Kollegen hier einzutreten.<br />
Die Beiträge in diesem Band dokumentieren die Ergebnisse des ersten<br />
gemeinsamen Zusammentreffens dieser Wissenschaftler in Frankfurt aus<br />
Anlass des 20jährigen Jubiläums von »Theologie interkulturell«, das<br />
unter dem Titel »Aufbruch in eine Welt für alle« nach Perspektiven suchte,<br />
Glauben in einer gewandelten Welt zu kommunizieren.<br />
Der Herausgeber:<br />
Thomas Schreijäck, Prof. Dr. theol., Dipl. Pädagoge, geb. 1953,<br />
seit 1995 Prof. für Praktische Theologie, Religionspädagogik und<br />
Kerygmatik am Fachbereich Kath. Theologie der Johann Wolfgang<br />
Goethe-Universität Frankfurt a. M.; 1.Vorsitzender von »Theologie<br />
interkulturell«. Forschungsgebiete: Religionspädagogische<br />
Bildungstheorie; Kontextuelle Theologien in Lateinamerika; Theologie<br />
interkulturell in praktisch-theologischer Perspektive.<br />
LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH<br />
Der Rechtsstatus<br />
kirchlicher Vereine<br />
Übersetzt von Gabriele Stein<br />
Mit einer Einleitung von Heribert Hallermann<br />
2008. ca. 220 Seiten, kart.<br />
ca. € 26,90/sFr 47,-<br />
ISBN 978-3-506-76513-0<br />
= Kirchen- und Staatskirchenrecht, Band 8<br />
Die Bedeutung von Vereinen in der Kirche nimmt beständig<br />
zu; sie bewegen sich in einem Raum der Autonomie<br />
und sind zugleich ein Zeichen der Gemeinschaft und<br />
der Einheit der Kirche. Dementsprechend ist eine terminologisch<br />
präzise Darlegung des für sie geltenden<br />
kanonischen Rechts erforderlich. Ausgehend von den<br />
theologischen Vorgaben des Zweiten Vatikanischen<br />
Konzils stellt Lluís Kardinal Martínez Sistach, einer der<br />
international renommiertesten Kirchenrechtler, das<br />
Vereinsrecht der Kirche und die Kriterien für den kirchlichen<br />
Charakter der Vereine vor und lädt so zu einer<br />
rechtskonformen Praxis im Umgang mit kirchlichen<br />
Vereinen und Verbänden ein.<br />
Zwei Anhänge – Statuten und die Canones des Codex<br />
über die kirchenrechtlichen Vereine – komplettieren<br />
das Werk, das in Spanien bereits seine fünfte Auflage<br />
erlebt.<br />
Der Autor:<br />
Lluís Martínez Sistach, Prof. Dr. theol., geb. 1937 in Barcelona,<br />
1961 Priesterweihe, Promotion über Vereinsrecht in der Kirche,<br />
Erzbischof von Barcelona, Erhebung in den Kardinalsstand am<br />
24.11.2007.
THEOLOGIE 37<br />
PETER HOFMANN | ANDREAS MATENA (HRSG.)<br />
ChristusBild<br />
Icon + Ikone.<br />
Wege zu Theorie und Theologie des Bildes<br />
2008. ca. 240 Seiten, kart.<br />
ca. € 32,90/sFr 56,-<br />
ISBN 978-3-506-76495-9<br />
= ikon. Bild + Theologie<br />
Bild und Begriff des Bildes sind für die Theologie keine<br />
ephemeren Themen. Die Inkarnation des Logos als Bild<br />
des unsichtbaren Gottes (Joh 1,14; Kol 1,15) stellt<br />
dieses Thema sogar ins Zentrum jeder christlichen<br />
Theologie. Das Christentum ist nicht Schrift-, sondern<br />
Offenbarungs- und damit Bildreligion: »Am Anfang war<br />
das Bild«, nämlich Christus als das eikon des Vaters,<br />
auf den sich die Schau des Menschen »von Angesicht<br />
zu Angesicht« richtet (1 Kor 13,12). Seit ihren Anfängen<br />
hat die christliche Theologie nicht nur dieses als<br />
Bildwerdung zu beschreibende Offenbarungsdatum in<br />
ihr Zentrum gestellt, sondern auch die Frage nach dem<br />
Verhältnis des einen Bildes Christus zu den materiellen<br />
Bildern aufgeworfen. Allerdings hat der lateinische<br />
Westen keine allgemeingültige Bildtheologie entwickelt<br />
und lässt den Bildstatus weitgehend ungeklärt.<br />
Die Texte dieses Bandes dokumentieren einen interdisziplinären Spannungsbogen,<br />
der vom »Bild als solchem«, dem »Bild als Bild eines<br />
anderen« bis zum »Bild als Ding« reicht. Die beteiligten Kunsthistoriker,<br />
Philosophen und Theologen (Eckhard Nordhofen, Dirk van de Loo,<br />
Christian Spies, Jörg Splett, Hansjürgen Verweyen, Bernhard Taureck,<br />
Thomas Lentes, Reinhard Hoeps, Mateusz Kapustka) verhandeln in ihren<br />
Beiträgen Themen wie Gottesmedien, Ikonizität und Personalität.<br />
Die Herausgeber:<br />
Prof. Dr. Peter Hofmann und Dipl.-Theol. Andreas Matena lehren am<br />
Institut für Katholische Theologie der Universität Koblenz.<br />
Franziskaner in Thüringen<br />
Für Gott und die Welt<br />
Text- und Katalogband zur Ausstellung in den Mühlhäuser<br />
Museen vom 29. März bis zum 31. Oktober 2008<br />
Im Auftrag der Mühlhäuser Museen<br />
und der Fachstelle Franziskanische Forschung<br />
herausgegeben von Thomas T. Müller, Bernd Schmies<br />
und Christian Loefke<br />
2008. ca. 320 Seiten, Festeinband mit Schutzumschlag<br />
ca. € 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76514-7<br />
Noch zu Lebzeiten des hl. Franz von Assisi kamen<br />
seine Ordensbrüder 1224 nach Thüringen. Bis zur<br />
Reformation gehörte die Kustodie Thüringen mit 12<br />
Klöstern (plus zwei weiteren Klöstern im heutigen<br />
Bundesland Thüringen) zu den am dichtesten von<br />
Franziskanern besiedelten Gebieten mit nachhaltigem<br />
Einfluss auf Bildung und Frömmigkeit. Der reich bebilderte<br />
Katalog zur Ausstellung vom 29.03. – 31.10.2008<br />
in der Kornmarktkirche, der ehemaligen Franziskanerkirche,<br />
in Mühlhausen/Th. bietet erstmals eine Gesamtdarstellung<br />
der verschiedenen Aspekte franziskanischen<br />
Lebens in Thüringen von den Anfängen bis<br />
heute.<br />
Die Herausgeber:<br />
Thomas T. Müller ist amtierender Direktor der Mühlhäuser Museen<br />
(Mühlhausen/Thüringen).<br />
Bernd Schmies ist Leiter der Fachstelle Franziskanische Forschungen<br />
(Münster).<br />
Christian Loefke ist stellvertretender Leiter der Fachstelle Franziskanische<br />
Forschungen ( Münster).
38 SOZIALETHIK | RECHTSWISSENSCHAFT<br />
ARND KÜPPERS<br />
Gerechtigkeit in der<br />
modernen Arbeitswelt<br />
und Tarifautonomie<br />
2008. ca. 600 Seiten, kart.<br />
ca. € 78,-/sFr 132,-<br />
ISBN 978-3-506-76507-9<br />
= Abhandldungen zur Sozialethik, Band 50<br />
Das deutsche Konsensmodell Soziale<br />
Marktwirtschaft ist in die Kritik<br />
geraten und mit ihm auch zwei<br />
seiner Hauptakteure: die Sozialpartner,<br />
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände.<br />
Ihnen wird der<br />
Vorwurf gemacht, in ihren Tarifabschlüssen<br />
Verträge zu Lasten<br />
Dritter zu schließen – zu Lasten<br />
vor allem der Arbeitslosen und damit<br />
auf Kosten des Gemeinwohls.<br />
Diesem Vorwurf geht die Untersuchung<br />
nach. Sie nimmt dazu nicht<br />
nur die Geschichte und die aktuelle<br />
Gestalt der Tarifautonomie in<br />
den Blick, sondern fragt auch nach<br />
den Strukturen der modernen<br />
Arbeitsgesellschaft, vor allem den<br />
Gründen und Folgen des drängenden<br />
Problems der Massenarbeitslosigkeit.<br />
Unter der genuin sozialethischen<br />
Perspektive der Beteiligungsgerechtigkeit<br />
wird die Tarifautonomie<br />
gegen Fundamentalkritik<br />
verteidigt und die Diskussion<br />
über eine Reform des Tarifrechts<br />
bzw. eine Flexibilisierung der<br />
Tarifpolitik differenziert beurteilt.<br />
Die vorliegende Arbeit wurde ausgezeichnet<br />
mit dem Bernhard-Welte-Preis 2007<br />
der Theologischen Fakultät der Universität<br />
Freiburg, gestiftet vom Erzbischöflichen<br />
Ordinariat Freiburg.<br />
Der Autor:<br />
Arnd Küppers, geb. 1973, Studium der<br />
Kath. Theologie, der Philosophie und der<br />
Rechtswissenschaft in Bielefeld und Bonn;<br />
seit 2003 wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl<br />
für Christliche Gesellschaftslehre an der<br />
Universität Freiburg.<br />
PAUL MIKAT<br />
Konflikt und Loyalität<br />
2007. 107 Seiten, kart.<br />
€ 9,90/sFr 18,90<br />
ISBN 978-3-506-76430-0<br />
Die vorliegende Schrift zeigt einige<br />
wichtige Bedingungen und Voraussetzungen<br />
für die Begegnung<br />
von Kirche und römischem Imperium<br />
im Lichte der Konfliktpotentialität<br />
religiöser Interessen auf.<br />
Nicht um Konfliktverlauf geht es,<br />
sondern um Konfliktpotentialitäten,<br />
die mit existentiellen religiösen<br />
Glaubensentscheidungen gegeben<br />
sein können. Damit wird<br />
die Frage verbunden, welche Loyalitätsbedingungen<br />
für Christen<br />
und Kirche im sich anbahnenden<br />
und schließlich ausweitenden<br />
Spannungsfeld von Kirche und<br />
Imperium möglich waren.<br />
Der Autor:<br />
Paul Mikat, Prof. Dr. Dr. h.c. mult., Jurist,<br />
Theologe, Kultusminister des Landes<br />
NRW 1962 – 1966, Mitglied des Deutschen<br />
Bundestages 1969 – 1987, Mitglied der<br />
NRW-Akademie der Wissenschaften und<br />
deren Präsident von 1998 – 2001. Seit<br />
1967 ist er Präsident der Görres-Gesellschaft<br />
zur Pflege der Wissenschaft.<br />
DOROTHEA STEFFEN<br />
Bürgerliche Rechtseinheit<br />
und Politischer<br />
Katholizismus<br />
2008. ca. 580 Seiten, kart.<br />
ca. € 78,-/sFr 132,-<br />
ISBN 978-3-506-76482-9<br />
= Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen<br />
der Görres-Gesellschaft, Band 116<br />
Dass der politische Katholizismus<br />
im Kaiserreich von einer oppositionellen<br />
zu einer »reichs- und<br />
systemloyalen« Position (Nipperdey)<br />
fand, ist bekannt. Wie sich<br />
dieser Prozess vollzog, zeigt die<br />
vorliegende Untersuchung der<br />
Auseinandersetzung um die Vereinheitlichung<br />
des materiellen<br />
bürgerlichen Rechts. In einer umfassenden<br />
Analyse politischer und<br />
publizistischer Quellen zeigt die<br />
Autorin, wie der politische Katholizismus<br />
in den fast dreißig Jahre<br />
währenden Debatten um das entstehende<br />
Bürgerliche Gesetzbuch<br />
seine Haltung zur Grundfragen der<br />
politischen, staatlichen, gesellschaftlichen<br />
und wirtschaftlichen<br />
Ordnung des Kaiserreichs entwickelte<br />
und klärte. In einer Mischung<br />
aus systematischem und chronologischem<br />
Zugriff macht sie insbesondere<br />
deutlich, wie die bürgerlichen<br />
Zentrumspolitiker seit den<br />
späten 1880er Jahren die innerkatholischen<br />
Diskussionen dominieren<br />
und schließlich nicht nur<br />
die Zustimmung der Fraktion zur<br />
Kodifikation, sondern sich selbst<br />
als die prägende Kräfte durchsetzen<br />
konnten.<br />
Die Autorin:<br />
Dr. Dorothea Steffen, geb. 1971, Studium<br />
der Geschichte, Rechtswissenschaft und<br />
Kunst<strong>geschichte</strong> an der FU Berlin; z. Zt.<br />
wiss. Mitarbeiterin für den SPD-Parteivorstand.
Schönburger Gespräche zur Recht und Staat<br />
Herausgegeben von Otto Depenheuer und Christoph Grabenwarter<br />
RECHTSWISSENSCHAFT 39<br />
Band 8<br />
OTTO DEPENHEUER<br />
Selbstbehauptung<br />
des Rechtsstaates<br />
2. Auflage 2008. 128 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag<br />
€ 19,90/sFr 35,90<br />
ISBN 978-3-506-75743-2<br />
Gewalt ist im freiheitlichen Verfassungsstaat beim<br />
Staat monopolisiert, rechtlich domestiziert und demokratisch<br />
legitimiert. Als fundamentalistischer Terror<br />
kehrt sie indes mit ursprünglicher Willkür und atavistischer<br />
Brutalität auf die politische Bühne zurück.<br />
Wie kann der freiheitliche Rechtsstaat seine Existenzform gegenüber<br />
seiner islamisch-fundamentalistischen Negation verteidigen? Kann sich<br />
die rechtlich gehegte Staatsgewalt gegen die barbarische Gewalt eines<br />
global agierenden terroristischen Netzwerkes behaupten, ohne ihr<br />
Ethos zu verraten? Kennt die Not des Staates kein Gebot des Rechts?<br />
Oder ist er umgekehrt an seine Rechtsordnung und deren Prinzipien<br />
ausnahmslos gebunden mit der Folge: Fiat iustitia pereat mundus? Muss<br />
der Rechtsstaat auch den Feind als Rechtssubjekt achten? Darf er um<br />
seiner Existenz willen in letzter Konsequenz sogar unschuldige Menschen<br />
opfern? Diesen existentiellen Fragen der Rechtsstaates geht die Studie<br />
vor dem Hintergrund der aktuellen terroristischen Bedrohung durch den<br />
islamischen Fundamentalismus nach.<br />
Der Autor:<br />
Otto Depenheuer, Prof. Dr. iur., geb. 1953, Studium der Rechtswissenschaften<br />
in Bonn; Habilitation 1992; seit 1999 Lehrstuhl<br />
für »Allgemeine Staatslehre, Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie«<br />
sowie Direktor des »Seminars für Staatsphilosophie und<br />
Rechtspolitik« an der Universität zu Köln.<br />
Band 10<br />
CHRISTIAN HILLGRUBER<br />
Staat und Religion<br />
Überlegungen zur Säkularität, zur Neutralität<br />
und zum religiös-weltanschaulichen Fundament<br />
des modernen Staates<br />
2007. 122 Seiten, Festeinband mit Schutzumschlag<br />
€ 19,90/sFr 35,90<br />
ISBN 978-3-506-76474-4<br />
Die Problematik des Verhältnisses von Staat und<br />
Religion ist so alt wie die Menschheits<strong>geschichte</strong>.<br />
Stets hat sich die Frage gestellt, wie sich organisierte<br />
politische Herrschaft mit der von Herrschern und<br />
Beherrschten geglaubten religiösen Wahrheit verträgt,<br />
sich mit ihr verbinden oder doch wenigstens vereinbaren<br />
lässt. Beim Nachdenken über die rechte Beziehung<br />
von Staat und Religion stößt man auf wirkmächtige<br />
Mythen: Den Mythos von der Entstehung des modernen<br />
Staates als Vorgang der Säkularisation, den Dämon des<br />
»christlichen Staates« und die Mär vom weltanschaulich-religiös<br />
neutralen Staat des Grundgesetzes.<br />
Die vorliegende Schrift betreibt Entmystifizierung und entwickelt<br />
Gegenthesen: Der Staat des Grundgesetzes ist – wie der moderne<br />
Staat überhaupt – gegenüber den verschiedenen Religionen und<br />
Weltanschauungen nicht neutral. Diese Erkenntnis sollte zugleich den<br />
Weg freimachen für eine staatliche Religionspolitik, die nicht alle<br />
Religionsgemeinschaften gleich behandelt, sondern nach ihrer säkularen<br />
Gemeinwohlförderlichkeit unterscheidet und dementsprechend staatlichen<br />
Schutz und staatliche Förderung bewusst ungleich verteilt.<br />
Der Autor:<br />
Christian Hillgruber, geb. 1963, Habil. 1997 an der Univ. zu Köln.<br />
Seit dem WS 2002/2003 Inhaber eines Lehrstuhls für Öffentl.<br />
Recht an der Universität Bonn.
40 KIRCHENGESCHICHTE | GESCHICHTE | KIRCHENMUSIK<br />
Nuntiaturberichte<br />
aus Deutschland<br />
Die Kölner Nuntiatur<br />
Herausgegeben im Auftrag<br />
der Görres-Gesellschaft<br />
Band IX/1<br />
Nuntius Fabio Chigi<br />
Herausgegeben von Erwin Gatz<br />
und Konrad Repgen<br />
Bearbeitet von Maria Teresa Börner<br />
2008. ca. 750 Seiten, kart.<br />
ca. € 148,-/sFr 249,-<br />
Subskriptionspreis: ca. € 130,-/sFr 218,-<br />
ISBN 978-3-506-76489-8<br />
Der vorliegende Band enthält<br />
die wöchentliche Korrespondenz<br />
zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat<br />
in Rom und dem<br />
Nuntius in Köln, Fabio Chigi, dem<br />
späteren Papst Alexander VII.<br />
Die Edition beginnt mit der Reise<br />
Chigis nach Köln im Juni 1639<br />
und endet mit seiner Berufung im<br />
März 1644 nach Münster zu den<br />
Verhandlungen der europäischen<br />
Großmächte, die 1648 im sogenannten<br />
Westfälischen Frieden<br />
beschlossen wurden.<br />
Das Briefkorpus, in der italienischen<br />
Originalsprache belassen,<br />
liegt für Fabio Chigi fast geschlossen<br />
vor. Jedes Schreiben wird<br />
durch ein deutschsprachiges Regest<br />
eingeleitet und kritisch kommentiert.<br />
Ein Register erschließt<br />
den Band.<br />
Die Bearbeiterin:<br />
Maria Terese Börner, geb. 1977, Studium<br />
der Geschichte und Soziologie an der<br />
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt,<br />
2002 – 2006 Stipendiatin am Römischen<br />
Institut der Görres-Gesellschaft.<br />
GERD KAMPERS<br />
Geschichte<br />
der Westgoten<br />
2008. ca. 400 Seiten, kart.<br />
ca. € 59,-/sFr 100,-<br />
ISBN 978-3-506-76517-8<br />
Die im Deutschen als Westgoten<br />
bezeichneten Wisigoten entstanden<br />
auf dem Boden des Römischen<br />
Reiches und hatten wesentlichen<br />
Anteil an der Transformation der<br />
römischen Welt. An der Wende<br />
zwischen Antike und Mittelalter<br />
begründeten sie die Reiche von<br />
Toulouse und Toledo, wo sie zu<br />
Mitgliedern einer poströmischen<br />
Gesellschaft wurden, in der sie<br />
auch nach dem Untergang ihres<br />
spanischen Reiches deutliche<br />
Spuren hinterließen.<br />
Die durch Quellennähe und Anschaulichkeit<br />
geprägte Synthese schildert die Geschichte<br />
der Wisigoten, ohne sie unzulässig zu verkürzen<br />
oder unnötig zu komplizieren. Nach<br />
Darstellung der Herkunft und Entstehung der<br />
Goten bis zum Ende des 3. Jh. und der Welt<br />
der Goten im 4. Jh. werden die Gründe<br />
und Bedingungen für die Ethnogenese der<br />
Wisigoten untersucht. Auf die Behandlung<br />
der Geschichte des Reiches von Toulouse<br />
und seines durch Kontinuität und Wandel<br />
gekennzeichneten inneren Aufbaus folgt als<br />
Schwerpunkt der Darstellung die Schilderung<br />
des durch Imperialisierung und Katholisierung,<br />
durch innenpolitische Turbulenzen<br />
und Aufstände geprägten Aufstiegs und Falls<br />
des Reiches von Toledo bis zum Finale am<br />
Guadalete. Abschließend wird der Weg der<br />
spätantiken Zivilisation Spaniens in das werdende<br />
Mittelalter nachgezeichnet. Ein umfangreiches<br />
Quellen- und Literaturverzeichnis<br />
ermöglicht den Einstieg in die wissenschaftliche<br />
Diskussion.<br />
Der Autor:<br />
Gerd Kampers, Dr. phil., geb. 1944, Studium<br />
der Geschichte und Anglistik an<br />
der Universität Bonn. 1973 – 79 wiss.<br />
Mitarbeiter am Hist. Seminar der Univ.<br />
Bonn; 1979 – 1992 Gymnasiallehrer.<br />
ELENA SAWTSCHENKO<br />
Die Kantaten von<br />
Johann Friedrich Fasch<br />
im Licht der<br />
pietistischen<br />
Frömmigkeit<br />
Pietismus und Musik<br />
2008. ca. 400 Seiten, kart. / incl. CD<br />
ca. € 49,90/sFr 84,-<br />
ISBN 978-3-506-76498-0<br />
= Beiträge zur Geschichte der Kirchenmusik,<br />
Band 14<br />
Im Leben des Zerbster Hofkapellmeisters<br />
Johann Friedrich Fasch<br />
(1688 – 1758) kreuzen sich Kontakte<br />
zu den unterschiedlichsten<br />
Strömungen des Pietismus: vom<br />
radikalen Pietismus J. W. Petersens<br />
bis zur Hallenser Prägung A. H.<br />
Franckes; zur Herrnhuter Richtung<br />
N. L. Reichsgraf von Zinzendorfs<br />
und zu den reisenden Missionaren<br />
des ersten protestantischen Instituts<br />
zur Judenmission.<br />
Am Beispiel von Faschs Kantatenjahrgang Das<br />
in Bitte, Gebeth, Fürbitte und Dancksagung<br />
bestehende Opffer von 1735/36 wird eine<br />
spezielle Frage an die Kantate, der wichtigsten<br />
kirchenmusikalischen Gattung in den<br />
lutherischen Gebieten Deutschlands, gestellt:<br />
ob und wie sich in ihr Momente pietistischer<br />
Frömmigkeit erkennen lassen, ob es musikalische<br />
Merkmale gibt, die auf eine pietistische<br />
Haltung zurückzuführen sind.<br />
Der Erhellung des gattungsgeschichtlichen<br />
Hintergrunds werden neue Erkenntnisse zur<br />
Biographie Faschs vorangestellt (u. a. seine<br />
Interpretation eines Zerbster Theologenstreits).<br />
Kapitel zu Faschs Auseinandersetzung<br />
mit dem Kirchenliedgut im genannten Kantatenjahrgang<br />
und zum liturgischen Kontext<br />
runden das Buch ab.<br />
Die Autorin:<br />
Elena Sawtschenko, geb. 1965, Studium<br />
der Musikwissenschaft an der Gnesin-<br />
Musikakademie in Moskau; Forschungsaufenthalt<br />
und Promotinsstudium an<br />
der Universität Leipzig, Mitarbeit im<br />
interdisziplinären Graduiertenkolleg<br />
der Universität Tübingen an dem Thema<br />
»Die Bibel – ihre Entstehung und ihre<br />
Wirkung«.
NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN | GESCHICHTE 41<br />
Abhandlungen der Nordrhein-<br />
Westfälischen Akademie<br />
der Wissenschaften<br />
Band 115<br />
Union Académique<br />
Internationale<br />
Averrois Opera<br />
Series B – Averroes Latinus<br />
Commentarium Magnum<br />
In Aristotelis Physicorum<br />
Librum Septimum<br />
(Vindobonensis, lat. 2334)<br />
Edidit Horst Schmieja<br />
2007. XXXVI + 292 Seiten, engl. Broschur<br />
€ 43,90/sFr 74,-<br />
ISBN 978-3-506-76316-7<br />
Sonderreihe<br />
Papyrologica Coloniensia<br />
Vol. XXXII<br />
Die Giessener Zenonpapyri<br />
(P. Iand. Zend.)<br />
Bearbeitet von Philip Schmitz<br />
2007. XVI + 277 Seiten, engl. Broschur<br />
€ 53,90/sFr 91,-<br />
ISBN 978-3-506-76431-7<br />
Vorträge Geisteswissenschaften<br />
G 413<br />
KLAUS BERGDOLT<br />
Das Auge und die Theologie<br />
Naturwissenschaften und »Perspectiva«<br />
an der päpstlichen Kurie in Viterbo<br />
(ca. 1260 – 1285)<br />
2007. 56 Seiten, Abb., kart.<br />
€ 14,90/sFr 27,90<br />
ISBN 978-3-506-76475-1<br />
G 414<br />
BERNHARD KÖNIG<br />
Petracas<br />
Rerum vulgarium fragmenta<br />
als Liederbuch<br />
(Canzoniere):<br />
Kompositionsprinzipien,<br />
Form und Sinn<br />
(Zum 700. Geburtstag des Dichters<br />
am 20. Juli 2004)<br />
2007. 33 Seiten, kart.<br />
€ 8,90/sFr 17,-<br />
ISBN 978-3-506-76477-5<br />
Bereits angekündigt!<br />
Der Abschluss der großen Edition<br />
JOSEF BECKER (HRSG.)<br />
Bismarcks spanische »Diversion« und der<br />
preußisch-deutsche Reichsgründungskrieg<br />
Quellen zur Vor- und Nach<strong>geschichte</strong> der Hohenzollern-Kandidatur<br />
für den Thron in Madrid 1866 – 1932<br />
Band III:<br />
Spanische Diversion , »Emser Depesche«<br />
und Reichsgründungslegende bis zum<br />
Ende der Weimarer Republik<br />
12. Juli 1870 – 1. September 1932<br />
2008. XXXVI + 638 Seiten, 11 s/w Abb., Leinen mit Schutzumschlag<br />
€ 138,-/sFr 232,-<br />
Subskriptionspreis bei Abnahme aller drei Bände:<br />
€ 118,-/sFr 198,-<br />
ISBN 978-3-506-70720-8<br />
Band I:<br />
Der Weg zum spanischen Thronangebot<br />
Spätjahr 1866 – 4. April 1870<br />
2003. LXXXVI + 538 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag<br />
€ 137,-/sFr 230,-<br />
Subskriptionspreis: € 117,60/198,-<br />
ISBN 978-3-506-70718-5<br />
Band II:<br />
Aus der Krise der kleindeutschen Nationalpolitik<br />
in die preußisch-französische Julikrise 1870<br />
5. April 1870 – 12. Juli 1870<br />
2003. VIII + 633 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag<br />
€ 137,-/sFr 230,-<br />
Subskriptionspreis: € 117,60/sFr 198,-<br />
ISBN 978-3-506-70719-2<br />
Zu dieser Edition:<br />
»La publication du recueil de J. Becker sera un évènement scientifique.«<br />
Jean Stengers (†)<br />
(Académie Royale de Belgique)<br />
»This long-awaited compilation […] is a model of its kind – […] the most exciting collection<br />
of Bismarckiana in a generation.«<br />
David Wetzel (Berkeley, CEH 2004)<br />
»Cette publication est un véritable monument scientifique […], une contribution de premier<br />
ordre aux débats suscités depuis longtemps en Allemagne et en France […]«<br />
Pierre Guillen<br />
(Grenoble, Relations Internationales 2004)<br />
»Wenn es in den letzten Jahren überhaupt eine Urkundenzusammenstellung gegeben hat, die<br />
für die Analyse der deutschen Geschichte nicht nur des 19. Jahrhunderts von grundlegender<br />
Bedeutung ist, dann ist es die Quellensammlung von Becker.«<br />
Hans-Ulrich Wehler (Bielefeld)
42 BACKLIST<br />
Enzyklopädie Migration<br />
in Europa<br />
Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart<br />
Herausgegeben von Klaus J. Bade,<br />
Pieter C. Emmer, Leo Lucassen und Jochen Oltmer<br />
2007. 1.156 Seiten im Großformat, zahlr. Abb. und Karten,<br />
Festeinband<br />
€ 78,- (Auslieferung für die Schweiz: <strong>Verlag</strong> NZZ)<br />
ISBN 978-3-506-75632-9<br />
KLAUS-JÜRGEN MÜLLER<br />
Generaloberst Ludwig Beck<br />
Eine Biographie<br />
Herausgegeben mit Unterstützung<br />
des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes<br />
2008. 836 Seiten + 20 Seiten Bildteil,<br />
Festeinband mit Schutzumschlag<br />
€ 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-72874-6<br />
LARS BERGER<br />
Die USA und der<br />
islamistische Terrorismus<br />
Herausforderungen im Nahen und Mittleren Osten<br />
2007. 481 Seiten, Festeinband<br />
€ 36,90/sFr 63,-<br />
ISBN 978-3-506-76369-3<br />
JÖRG ECHTERNKAMP | STEFAN MARTENS (HRSG.)<br />
Der Zweite Weltkrieg in Europa<br />
Erfahrung und Erinnerung<br />
Herausgegeben im Auftrag des Deutschen<br />
Historischen Instituts Paris und des<br />
Militärgeschichtlichen Forschungsamtes<br />
2007. 311 Seiten, Festeinband<br />
€ 34,90/sFr 59,-<br />
ISBN 978-3-506-76470-6<br />
KLAUS SCHWABE<br />
Weltmacht und Weltordung<br />
Amerikanische Außenpolitik<br />
von 1898 bis zur Gegenwart<br />
Eine Jahrhundert<strong>geschichte</strong><br />
2., durchges. Auflage 2007. XIV + 560 Seiten,<br />
Leinen mit Schutzumschlag<br />
€ 44,90<br />
(Auslieferung für die Schweiz: <strong>Verlag</strong> NZZ)<br />
ISBN 978-3-506-74783-9<br />
CHARLES W. SYDNOR, JR.<br />
Soldaten des Todes<br />
Die 3. SS-Division »Totenkopf« 1933 – 1945<br />
Aus dem Englischen von Karl Nicolai<br />
5. Auflage 2007. XIV + 320 Seiten + 16 Seiten Bildteil,<br />
Karten, Festeinband<br />
€ 25,90/sFr 46,-<br />
ISBN 978-3-506-79084-2<br />
Urs Schoettli<br />
China – die neue Weltmacht<br />
2007. 240 Seiten, zahlr. Abb., franz. Broschur<br />
€ 22,-<br />
(Auslieferung für die Schweiz: <strong>Verlag</strong> NZZ)<br />
ISBN 978-3-506-76405-8<br />
DIETRICH BEYRAU | MICHAEL HOCHGESCHWENDER |<br />
DIETER LANGEWIESCHE (HRSG.)<br />
Formen des Krieges<br />
Von der Antike bis zur Gegenwart<br />
2007. 522 Seiten, 25 s/w-Abb., Festeinband<br />
€ 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76368-6<br />
= Krieg in der Geschichte, Band 37<br />
WOLFGANG GIELER (HRSG.)<br />
Die Außenpolitik<br />
der Staaten Afrikas<br />
Ein Handbuch:<br />
Ägypten bis Zentralafrikanische Republik<br />
2007. 500 Seiten, Festeinband<br />
€ 58,-/sFr 98,-<br />
ISBN 978-3-506-76473-7<br />
ERHARD WIERSING<br />
Geschichte des<br />
historischen Denkens<br />
Zugleich eine Einführung in die Theorie<br />
der Geschichte<br />
2007. 1.091 Seiten, Festeinband<br />
€ 78,-/sFr 132,-<br />
ISBN 978-3-506-75654-1
BACKLIST 43<br />
WOLFGANG KÖNIG<br />
Wilhelm II. und die Moderne<br />
Der Kaiser und die technisch-industrielle Welt<br />
2007. 330 Seiten., 38 s/w-Abb., Festeinband<br />
€ 34,90/sFr 59,-<br />
ISBN 978-3-506-75738-8<br />
Lexikon Familie<br />
Mehrdeutige und umstrittene Begriffe zu Familie,<br />
Leben und ethischen Fragen<br />
Herausgegeben vom<br />
Päpstlichen Rat für die Familie<br />
Redaktionelle Bearbeitung<br />
der deutschen Ausgabe: Hans Reis<br />
2007. 860 Seiten, Festeinband mit Schutzumschlag<br />
€ 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76322-8<br />
DOMINIK FUGGER<br />
Das Königreich<br />
am Dreikönigstag<br />
Eine historisch-empirische Ritualstudie<br />
2007. 248 Seiten, 28 Bildtafeln, 25 farb. u. 15 s/w-Abb.,<br />
Leinen mit Schutzumschlag<br />
€ 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-76404-1<br />
HANS-JOACHIM HÖHN<br />
Postsäkular<br />
Gesellschaft im Umbruch – Religion im Wandel<br />
2007. 212 Seiten, kart.<br />
€ 22,90/sFr 41,-<br />
ISBN 978-3-506-76328-0<br />
GEORG GRESSER<br />
Clemens II.<br />
Der erste deutsche Reformpapst<br />
2007. 248 Seiten, kart.<br />
€ 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76329-7<br />
KONRAD HILPERT (HRSG.)<br />
Theologische Ethik –<br />
autobiographisch<br />
2007. 276 Seiten, kart.<br />
€ 29,90/sFr 49,90<br />
ISBN 978-3-506-76390-7<br />
REINHARD HOEPS (HRSG.)<br />
Handbuch der Bildtheologie<br />
In vier Bänden<br />
Band 1: Bild-Konflikte<br />
2007. 419 Seiten + 8 Seiten farb. Abb., Festeinband<br />
€ 44,90/sFr 76,-<br />
Subskriptionspreis: € 38,-/sFr 64,-<br />
ISBN 978-3-506-75736-4<br />
THOMAS BOHRMANN | WERNER VEITH |<br />
STEPHAN ZÖLLER (HRSG.)<br />
Handbuch Theologie<br />
und Populärer Film<br />
Band 1<br />
2007. 376 Seiten, kart.<br />
€ 39,90/sFr 67,-<br />
ISBN 978-3-506-72963-7<br />
ALEX STOCK<br />
Poetische Dogmatik –<br />
Gotteslehre<br />
Band 3: Bilder<br />
2007. 449 Seiten, 119 s/w-Abb., Festeinband<br />
€ 78,-/sFr 132,-<br />
ISBN 978-3-506-76449-2<br />
MICHAEL SCHRAMM<br />
Der unterhaltsame Gott<br />
Theologie populärer Filme<br />
2008. 168 Seiten, kart.<br />
€ 22,90/sFr 41,-<br />
ISBN 978-3-506-76444-7
<strong>Verlag</strong> <strong>Ferdinand</strong> <strong>Schöningh</strong><br />
Jühenplatz 1–3 · 33098 Paderborn<br />
Postfach 2540 · 33055 Paderborn<br />
Fon 0 52 51/1 27-5<br />
Fax 0 52 51/1 27-8 60<br />
e-Mail info@schoeningh.de<br />
Internet www.schoeningh.de<br />
Ihre Ansprechpartner im <strong>Verlag</strong>:<br />
Für alle Fragen, Hinweise, Anregungen ... stehen wir Ihnen<br />
gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie:<br />
Presse:<br />
Vertrieb|Werbung:<br />
Sandra Erdmann<br />
Ulrike Stutzinger<br />
Fon 0 52 51/1 27-7 90 Fon 0 52 51/1 27-6 41<br />
Fax 0 52 51/1 27-8 60 Fax 0 52 51/1 27-8 60<br />
e-Mail erdmann@schoeningh.de stutzinger@schoeningh.de<br />
Buchhandelsvertretung für Deutschland<br />
Außendienst Deutschland Nord<br />
Silvia Lörke | UTB:forum Fon 02 21/9 13 90 75<br />
Ursulaplatz 1 Fax 02 21/9 13 90 11<br />
50668 Köln e-Mail loerke@utbforum.de<br />
Außendienst Deutschland Süd<br />
Silke Trost | UTB:forum Fon 07 11/9 97 47 71<br />
Breitwiesenstraße 9 Fax 07 11/7 80 13 76<br />
70565 Stuttgart e-Mail trost@utbforum.de<br />
Außendienst Deutschland Ost<br />
Katrin Rhein | UTB:forum Fon 01 77/7 59 63 13<br />
Hans-Fallada-Str. 21 Fax 01 77/50 97 78<br />
17489 Greifswald e-Mail rhein@utbforum.de<br />
Auslieferung Deutschland<br />
Brockhaus|Commission<br />
UTB für Wissenschaft<br />
Kreidlerstraße 9 Breitwiesenstr. 9<br />
70806 Kornwestheim 70365 Stuttgart<br />
Fon 0 71 54/13 27-22 Fon 07 11/7 82 95 55-0<br />
Fax 0 71 54/13 27-13 Fax 07 11/7 80 13 76<br />
e-Mail schoeningh@brocom.de e-Mail utb@utb-stuttgart.de<br />
Auslieferung Österreich<br />
Dr. Franz Hain<br />
Buchhandelsvertreterin:<br />
<strong>Verlag</strong>sauslieferungen GmbH<br />
Leitner <strong>Verlag</strong>svertretungen<br />
Dr. Otto-Neurath-Gasse 5 · A-1220 Wien Jutta Leitner<br />
Fon 01/2 82 65 65 Beatrixgasse 4 B · A-1030 Wien<br />
Fax 01/2 82 52 82 Fon + Fax 01/7 10 31 41<br />
e-Mail bestell@hain.at e-Mail leitner-vv@utanet.at<br />
Auslieferung Schweiz | Liechtenstein<br />
Scheidegger & Co. AG<br />
Buchhandelsvertreterin:<br />
c/o AVA <strong>Verlag</strong>sauslieferung AG<br />
Ruth Schildknecht<br />
Centralweg 16<br />
Scheidegger & Co. AG<br />
CH-8910 Affoltern am Albis<br />
Obere Bahnhofstrasse 10A<br />
Fon 0 44/7 62 42 50 CH-8910 Affoltern am Albis<br />
Fax 0 44/7 62 42 10 Fon 0 44/7 62 42 46<br />
e-Mail e.bachofner@ava.ch Fax 0 44/7 62 42 49<br />
r.schildknecht@scheidegger-buecher.ch<br />
Preisänderungen vorbehalten · Stand 01.01.2008 · Erfüllungsort Paderborn<br />
In Österreich kann der Euro-Preis aufgrund des unterschiedlichen MwSt.-Satzes von<br />
dem angegebenen Euro-Preis abweichen. Die sFr-Preise sind unverbindliche Ladenpreise.<br />
Autoren<br />
Althammer, B. ....................................................... 22<br />
Althaus, D. ................................................................. 20<br />
Arnold, K. J. ............................................................. 11<br />
Becker, J. .................................................................... 41<br />
Behler, E. ..................................................................... 33<br />
Benner, D. .................................................................. 25<br />
Bergdolt, K. .............................................................. 41<br />
Bilstein, J. .................................................................. 26<br />
Böhm, W. ........................................................ 23, 27<br />
Börner, M. T. ........................................................... 40<br />
Buchstab, G. ............................................................ 20<br />
Depenheuer, O. .................................................... 39<br />
Ditt, K. ............................................................................ 22<br />
Eckart, W. .................................................................... 14<br />
Felder, B. M. ............................................................ 17<br />
Frank, M. ...................................................................... 33<br />
Frischbier, W. .......................................................... 10<br />
Frischmann, B. ...................................................... 31<br />
Frost, U. ........................................................................ 23<br />
Fuchs, P. ....................................................................... 14<br />
Fuhr, T. ........................................................................... 23<br />
Gatz, E. ........................................................................... 40<br />
Gerste, R. D. ................................................................ 3<br />
Gieseking, E. ............................................................ 19<br />
Goetsch, P. ................................................................. 33<br />
Gonon, P. ..................................................................... 23<br />
Groepper, H. ............................................................ 10<br />
Hannemann, D. .................................................... 33<br />
Hellekamps, S. ...................................................... 23<br />
Henkelmann, A. ................................................... 19<br />
Hilgers, P. v. ............................................................ 18<br />
Hillgruber, C. .......................................................... 39<br />
Hof, C. ............................................................................. 23<br />
Hofmann, P. ............................................................. 37<br />
Hohendorf, G. ........................................................ 14<br />
Hörich, J. ..................................................................... 33<br />
Hottinger, A. .............................................................. 5<br />
Hunecke, V. .................................................................. 8<br />
Jarausch, K. H. ..................................................... 11<br />
Jochum, U. .............................................................. 29<br />
Kampers, G. .............................................................. 40<br />
Katzer, A. ........................................................................ 6<br />
Keller, P. .......................................................................... 4<br />
Keller, V. .......................................................................... 6<br />
Kienitz, S. ................................................................... 14<br />
Klepacki, L. ................................................................ 26<br />
Knechtges, M. ........................................................ 30<br />
Koch, M. ........................................................................ 16<br />
Köck, M. F. ................................................................. 30<br />
Kollmer, D. H. ........................................................... 7<br />
König, B. ...................................................................... 41<br />
Kroener, B. R. ........................................................ 15<br />
Küppers, A. ................................................................ 38<br />
Ladenthin, V. .......................................................... 23<br />
Lammert, N. ............................................................. 20<br />
Liebau, E. .................................................................... 26<br />
Liedtke, R. .................................................................. 20<br />
Loefke, C. ..................................................................... 37<br />
Maas, W. ....................................................................... 28<br />
Martínez Sistach, L. ........................................ 36<br />
Matena, A. .................................................................. 37<br />
Mazenik, C. ................................................................ 34<br />
Meilhammer, E. .................................................... 24<br />
Merkenich, S. .......................................................... 13<br />
Mertens, G. ..................................................... 23, 24<br />
Metz, W. ........................................................................ 34<br />
Michels, E. ..................................................................... 9<br />
Mikat, P. ........................................................................ 38<br />
Millán-Zaibert, E. ............................................... 31<br />
Molt, P. .......................................................................... 20<br />
Morgenbrod, B. .................................................... 13<br />
Mückusch, A. .............................................................. 7<br />
Mühlen, H. ................................................................. 28<br />
Müller, T. T. ............................................................... 37<br />
Müller-Roselius, K. ........................................... 26<br />
Mundt, C. ..................................................................... 14<br />
Negele, M. .................................................................. 34<br />
Neumaier, O. ........................................................... 28<br />
O’Sullivan, E. ........................................................... 22<br />
Oberländer, E. ........................................................... 6<br />
Oesterle, G. ............................................................... 33<br />
Planert, U. .................................................................. 18<br />
Plöger, W. ................................................................... 23<br />
Pröve, R. ....................................................................... 15<br />
Repgen, K. .................................................................. 40<br />
Richter, P. ................................................................... 14<br />
Riedl, G. ........................................................................ 34<br />
Rösler, D. ..................................................................... 22<br />
Rotzoll, M. .................................................................. 14<br />
Ruhstorfer, K. ......................................................... 34<br />
Sawtschenko, E. .................................................. 40<br />
Schagen, U. .............................................................. 12<br />
Schenuit, J. .............................................................. 30<br />
Schepers, J. .............................................................. 35<br />
Schiefelbein, E. .................................................... 27<br />
Schleiermacher, S. ........................................... 12<br />
Schmieja, H. ............................................................. 41<br />
Schmies, B. ............................................................... 37<br />
Schmitz, P. ................................................................. 41<br />
Schreijäck, T. ........................................................... 36<br />
Schweizer, S. ........................................................... 32<br />
Seichter, S. ................................................................ 27<br />
Spieker, M. ................................................................. 35<br />
Sprenger, M. ............................................................ 16<br />
Steffen, D. .................................................................. 38<br />
Tenfelde, K. ............................................................... 22<br />
Thaler, E. ...................................................................... 22<br />
Thoß, B. ........................................................................ 15<br />
Vieweg, K. ................................................................... 32<br />
Weber, K. ..................................................................... 20<br />
Wegner, B. ................................................................. 17<br />
Weitz, M. ...................................................................... 31<br />
Wiesendahl, E. ....................................................... 21<br />
Wittenbruch, W. ................................................... 23<br />
Wolf, H. .......................................................................... 35<br />
Zirfas, J. ........................................................................ 26