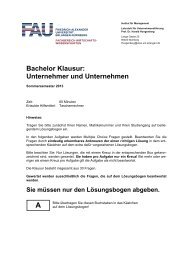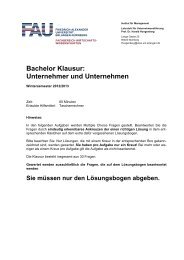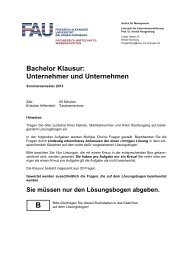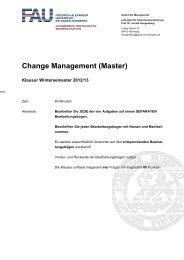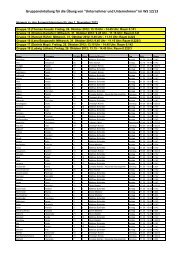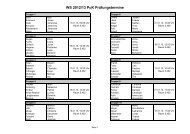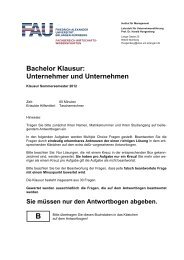Führungswechsel und Strategiewandel - Lehrstuhl für ...
Führungswechsel und Strategiewandel - Lehrstuhl für ...
Führungswechsel und Strategiewandel - Lehrstuhl für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />
Eine empirische Untersuchung bei deutschen Großunternehmen<br />
04-01<br />
Prof. Dr. Harald Hungenberg<br />
Dr. Torsten Wulf<br />
Kathrin Stengl<br />
Herausgeber:<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Dr.-Ing. E.h. Dietger Hahn<br />
Prof. Dr. Harald Hungenberg
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />
Eine empirische Untersuchung bei deutschen Großunternehmen<br />
04-01<br />
Prof. Dr. Harald Hungenberg<br />
Dr. Torsten Wulf<br />
Kathrin Stengl<br />
Autoren<br />
Prof. Dr. Harald Hungenberg<br />
Inhaber des <strong>Lehrstuhl</strong>s <strong>für</strong> Unternehmensführung an der Friedrich-Alexander Universität<br />
Erlangen-Nürnberg <strong>und</strong> Gastprofessor an der ENPC in Paris. Wissenschaftlicher Leiter<br />
des Instituts <strong>für</strong> Unternehmungsplanung<br />
Dr. Torsten Wulf<br />
Wissenschaftlicher Assistent am <strong>Lehrstuhl</strong> <strong>für</strong> Unternehmensführung an der<br />
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg<br />
Kathrin Stengl<br />
Diplomandin am <strong>Lehrstuhl</strong> <strong>für</strong> Unternehmensführung an der Friedrich-Alexander Universität<br />
Erlangen-Nürnberg
Inhaltsverzeichnis<br />
Zusammenfassung............................................................................................2<br />
1. Die Beziehung von <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> als<br />
von der Forschung vernachlässigtes Phänomen...................................................3<br />
2. <strong>Führungswechsel</strong> als Gr<strong>und</strong>lagen des <strong>Strategiewandel</strong>s.......................................4<br />
3. Hypothesen zum Zusammenhang von <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Strategiewandel</strong>................................................................................................6<br />
3.1. <strong>Führungswechsel</strong> als Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden.............6<br />
3.2. Arten von <strong>Führungswechsel</strong>n............................................................................7<br />
3.3. Kontingenzfaktoren der Wechsel-Wandel-Beziehung.........................................8<br />
4. Methodik der empirischen Untersuchung...........................................................13<br />
4.1 Ermittlung der Stichprobe................................................................................13<br />
4.2 Operationalisierung der Variablen...................................................................14<br />
5. Ergebnisse der empirischen Untersuchung.........................................................16<br />
5.1 Deskriptive Analyse der Stichprobe..................................................................16<br />
5.2 Ergebnisse zum Wechsel-Wandel-Zusammenhang............................................19<br />
5.3 Ergebnisse zu Moderatoren des Wechsel-Wandel-Zusammenhangs...................21<br />
6. Diskussion <strong>und</strong> Interpretation..........................................................................22<br />
7. Ausblick..........................................................................................................25<br />
Anhang...........................................................................................................27<br />
Literaturverzeichnis..........................................................................................29<br />
Zusammenfassung<br />
Der vorliegende Beitrag untersucht den Zusammenhang zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze<br />
<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> in deutschen Großunternehmen. Die Analyse einer<br />
Stichprobe von 58 <strong>Führungswechsel</strong>n in 44 der 200 größten deutschen Unternehmen verdeutlicht,<br />
dass Wechsel in der Unternehmensspitze tatsächlich Strategieänderungen zur Folge<br />
haben <strong>und</strong> dass die Stärke dieser Veränderung von der Art des <strong>Führungswechsel</strong>s abhängt.<br />
Summary<br />
This paper analyzes the strategic consequences of executive succession in large German companies.<br />
An empirical investigation of a sample of 58 succession events in 44 of the 200 largest<br />
German companies shows that executive succession is connected to strategic change and that<br />
the extent of this change is dependent on the succession type.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 3<br />
1. Die Beziehung von <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> als von<br />
der Forschung vernachlässigtes Phänomen<br />
Spitzenführungskräften, auch als Top Manager bezeichnet, wird im Allgemeinen<br />
eine große Bedeutung <strong>für</strong> die Entwicklung <strong>und</strong> den Erfolg von Unternehmen<br />
zugesprochen. 1 Ihr Handeln bezieht sich auf viele unterschiedliche<br />
Entscheidungen, wobei sich der Einfluss der Spitzenführungskräfte insbesondere<br />
in Entscheidungen über die Unternehmensstrategie manifestiert. 2 Ein<br />
Wechsel an der Unternehmensspitze stellt daher <strong>für</strong> ein Unternehmen ein Ereignis<br />
dar, das auch zu gravierenden Veränderungen in seiner strategischen<br />
Ausrichtung führen kann. In der Tat zeigen praktische Beispiele – beispielsweise<br />
der Wechsel von Thomas Middelhoff zu Gunther Thielen bei der Bertelsmann<br />
AG im Jahre 2002 – immer wieder, dass Veränderungen in der Person<br />
des Vorstandsvorsitzenden bzw. des Vorsitzenden der Geschäftsführung bedeutende<br />
Strategieänderungen nach sich ziehen.<br />
Angesichts der praktischen Relevanz von <strong>Führungswechsel</strong>n an der Unternehmensspitze<br />
hat sich die betriebswirtschaftliche Forschung vor allem in<br />
den USA seit den sechziger Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt <strong>und</strong><br />
es aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. 3 Dabei dominieren allerdings<br />
Beiträge, die sich mit den Ursachen von <strong>Führungswechsel</strong>n, persönlichen<br />
Merkmalen des Nachfolgers oder der Wechselhäufigkeit beschäftigen. Die Folgen<br />
eines <strong>Führungswechsel</strong>s werden dagegen wesentlich seltener thematisiert.<br />
Sofern Konsequenzen von <strong>Führungswechsel</strong>n untersucht werden, beschränken<br />
sich die entsprechenden Studien meist auf Erfolgswirkungen. Strategieänderungen<br />
als Folge von <strong>Führungswechsel</strong>n sind dagegen bisher nur von wenigen<br />
Autoren betrachtet worden. 4 Deren Ergebnisse zeigen jedoch, dass es durchaus<br />
Anlass <strong>für</strong> die Vermutung gibt, dass ein Wechsel an der Unternehmensspitze<br />
mit Strategieänderungen verb<strong>und</strong>en ist. 5<br />
In Deutschland ist das Thema <strong>Führungswechsel</strong> in der betriebswirtschaftlichen<br />
Forschung bisher sehr viel seltener adressiert worden als in den USA.<br />
Erst in jüngerer Zeit finden sich einige Untersuchungen, die sich mit den Ursachen,<br />
der Häufigkeit, aber auch mit den Erfolgswirkungen von Wechseln an der<br />
Spitze deutscher Unternehmen beschäftigen. Strategische Konsequenzen von<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Vgl. Gutenberg (1962), S. 60; Poensgen (1982a), S. 3; Salomo (2001), S. 33.<br />
Vgl. Schrader (1995), S. 290 ff.<br />
Vgl. Kesner/Sebora (1994), S. 336 ff.; Oesterle (1999), S. 28 ff.; Salomo (2001),<br />
S. 100 ff.<br />
Vgl. Schrader (1995), S. 198; Pitcher/Chreim/Kisfalvi (2000), S. 629.<br />
Vgl. u.a. Lant/Milliken/Batra (1992), S. 591 ff.; Miller (1993), S. 645 ff.; Wiersema<br />
(1992), S. 83 ff.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 4<br />
<strong>Führungswechsel</strong>n bei deutschen Unternehmen sind dagegen bislang noch gar<br />
nicht untersucht worden. 6<br />
Daher besteht das Ziel dieses Beitrags darin, die Ergebnisse einer empirischen<br />
Untersuchung darzustellen, in der der Zusammenhang zwischen einem<br />
Wechsel an der Unternehmensspitze – differenziert nach unterschiedlichen<br />
Wechselarten – <strong>und</strong> dem <strong>Strategiewandel</strong> bei deutschen Großunternehmen<br />
untersucht worden ist. Konkret wurden im Zeitraum 1990 bis 2000 58<br />
<strong>Führungswechsel</strong> in 44 der 200 größten deutschen Unternehmen betrachtet.<br />
Der Beitrag beginnt mit einer kurzen Betrachtung der Bedeutung von<br />
<strong>Führungswechsel</strong>n <strong>für</strong> <strong>Strategiewandel</strong> aus theoretischer Perspektive. Daraus<br />
werden im Anschluss Hypothesen zum Zusammenhang zwischen<br />
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> sowie zu den Einflussfaktoren dieser<br />
Beziehung abgeleitet. Schließlich folgen eine Beschreibung der<br />
Untersuchungsmethodik, die Vorstellung der wichtigsten Ergebnisse sowie<br />
deren Diskussion <strong>und</strong> Interpretation. Der Beitrag schließt mit einem Ausblick<br />
auf den weiteren Forschungsbedarf.<br />
2. <strong>Führungswechsel</strong> als Gr<strong>und</strong>lage des <strong>Strategiewandel</strong>s<br />
Die Frage, was eine Strategie ist, wie sie entsteht <strong>und</strong> vor allem wie sie sich<br />
verändert, wird in der Betriebswirtschaftslehre nicht ganz einheitlich beantwortet.<br />
7 Die meisten Vertreter der Betriebswirtschaftslehre folgen jedoch dem so<br />
genannten entscheidungstheoretischen Ansatz, der davon ausgeht, dass Strategien<br />
die Zukunft eines Unternehmens gr<strong>und</strong>legend vorzeichnen <strong>und</strong> von den<br />
obersten Führungskräften des Unternehmens gestaltet <strong>und</strong> umgesetzt werden.<br />
Wie Strategien sich verändern, bleibt im entscheidungstheoretischen Ansatz<br />
allerdings offen. Implizit wird aber meist unterstellt, dass Strategien permanent<br />
an veränderte Umweltbedingungen angepasst werden. 8<br />
In der Praxis lässt sich jedoch beobachten, dass Unternehmen ihre Strategie<br />
nicht permanent verändern. Dazu tragen unter anderem eine mangelnde<br />
Wahrnehmung von Umweltveränderungen, organisatorische Trägheit oder<br />
interne Widerstände bei. 9 Realistischer als die Unterstellung eines kontinuierlichen<br />
Wandels scheint daher die Vorstellung zu sein, dass Unternehmen regelmäßig<br />
längere Phasen der Konstanz durchlaufen, die durch kurze Phasen strategischen<br />
Wandels unterbrochen werden. 10<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Vgl. Oesterle (1999), S. 23 f.; Salomo (2001), S. 173 ff.<br />
Vgl. Mintzberg (1998).<br />
Vgl. Child (1972), S. 10 ff.; Chandler (1962), S. 384 ff.; Andrews (1971), S. 227 ff.<br />
Vgl. Tushman/Virany/Romanelli (1985), S 298.<br />
Vgl. Mintzberg (1978), S. 943.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 5<br />
Diese Sichtweise des <strong>Strategiewandel</strong>s entspricht dem so genannten<br />
„punctuated equilibrium“-Ansatz der Unternehmensentwicklung. 11 Die Phasen<br />
der strategischen Kontinuität (equilibrium genannt) lassen sich charakterisieren<br />
als „time spans of incremental change which elaborate a particular strategic<br />
orientation”. 12 Während dieser Zeit steht das Bestreben im Vordergr<strong>und</strong>, mit<br />
Hilfe kleinerer Anpassungen, vor allem der unterstützenden Strukturen, Systeme<br />
<strong>und</strong> Prozesse, die strategische Ausrichtung zu verfeinern <strong>und</strong> zu festigen.<br />
Die gr<strong>und</strong>legende Unternehmensstrategie bleibt dabei jedoch unberührt. 13 Eine<br />
solche Phase der Kontinuität wird in regelmäßigen Abständen (punctuated) von<br />
einer Phase des Wandels abgelöst, die gekennzeichnet ist durch kurzzeitige<br />
„simultaneous and discontinuous shifts in strategy“. 14<br />
Zahlreiche Faktoren werden in der Literatur als Gr<strong>und</strong> da<strong>für</strong> genannt, dass<br />
ein Unternehmen von einer Phase der Kontinuität in eine Phase des Wandels<br />
übergeht. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Misserfolg in der Vergangenheit,<br />
gravierende Umweltveränderungen, aber auch <strong>Führungswechsel</strong>. 15<br />
Empirische Untersuchungen geben sogar Anlass zu der Vermutung, dass<br />
Wechsel an der Unternehmensspitze als Auslöser von <strong>Strategiewandel</strong> eine<br />
ganz wichtige Rolle spielen: „Succession seems to break organizational momentum.”<br />
16 Neue Spitzenführungskräfte – so die dahinter stehende Argumentation<br />
– sind wesentlich besser als ihre Vorgänger in der Lage, die Notwendigkeit<br />
strategischer Anpassungen zu erkennen, verkrustete Denk- <strong>und</strong> Handlungsmuster<br />
zu durchbrechen, Strukturen aufzubrechen <strong>und</strong> schließlich Veränderungen<br />
zu implementieren. Darüber hinaus werden sie weniger stark mit vergangenen<br />
(Fehl-)Entscheidungen in Verbindung gebracht <strong>und</strong> sind weniger an vergangene<br />
Entscheidungen geb<strong>und</strong>en. 17 Angesichts dieser zumindest theoretisch<br />
vorhandenen Bedeutung des <strong>Führungswechsel</strong>s <strong>für</strong> strategischen Wandel erscheint<br />
eine tiefer greifende empirische Untersuchung dieses Zusammenhangs<br />
sinnvoll.<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
Vgl. Miller/Friesen (1980), S. 592 ff.; Tushman/Romanelli (1985), S. 173.<br />
Tushman/Romanelli (1985), S. 173.<br />
Vgl. Tushman/Newman/Romanelli (1991), S. 779 f.<br />
Tushman/Romanelli (1985), S. 214.<br />
Vgl. u.a. Romanelli/Tushman (1994), S. 1141ff.<br />
Miller (1993), S. 656; siehe auch Virany/Tushman/Romanelli (1985), S. 20 ff.<br />
Vgl. Occasio (1993), S. 152 ff.; Virany/Tushman/Romanelli (1992), S. 73 ff.;<br />
Hambrick/Geletkanycz/Fredrickson (1993), S. 404 ff.: Einschränkend muss an<br />
dieser Stelle jedoch angemerkt werden, dass die Kausalbeziehung zwischen <strong>Führungswechsel</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> keineswegs eindeutig ist. So besteht auch die<br />
Möglichkeit, dass neue Führungskräfte berufen worden sind, um eine bereits im<br />
Vorfeld formulierte strategische Anpassung „lediglich“ zu implementieren. Dieser<br />
Fall kann z.B. dann eintreten, wenn es dem Vorgänger an notwendigen Fähigkeiten<br />
mangelte oder eine zu starke Verknüpfung seiner Person mit der ehemaligen<br />
Strategie bestand. Allerdings scheint die Vermutung plausibler, dass die neue Spitzenführungskraft<br />
eigene strategische Vorstellungen entwickelt <strong>und</strong> diese umsetzt.<br />
Diese Vermutung leitet daher die weitere Untersuchung.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 6<br />
3. Hypothesen zum Zusammenhang von <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />
3.1 <strong>Führungswechsel</strong> als Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden<br />
Bevor Hypothesen zum Zusammenhang von <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />
aufgestellt werden können, muss die Frage geklärt werden, auf<br />
welchen Personenkreis sich der Begriff <strong>Führungswechsel</strong> beziehen soll. Insbesondere<br />
in den USA, die in der <strong>Führungswechsel</strong>forschung eine dominante<br />
Rolle einnehmen, wird die Frage, wer zum Kreis der Spitzenführungskräfte<br />
eines Unternehmens zählt, kontrovers diskutiert. Dabei lassen sich drei unterschiedliche<br />
Strömungen identifizieren. Manche Forscher beschränken sich bei<br />
der Analyse von Spitzenführungskräften auf die Person des CEO. 18 Andere<br />
betrachten das gesamte Board of Directors einschließlich des CEO. 19 Eine<br />
dritte Gruppe schließlich bezieht den <strong>Führungswechsel</strong> auf einen noch weiteren<br />
Kreis, der auch Senior Vice Presidents <strong>und</strong> Executive Vice Presidents umfasst.<br />
20<br />
In Deutschland ist die Bestimmung der Personen, die zum Kreis der Spitzenführungskräfte<br />
zählen, aufgr<strong>und</strong> der von amerikanischem Recht abweichenden<br />
Unternehmensverfassung etwas einfacher. Studien, die sich mit Spitzenführungskräften<br />
in deutschen Aktiengesellschaften beschäftigen, konzentrieren<br />
sich entweder auf den Vorstandsvorsitzenden oder den gesamten Vorstand.<br />
Die Frage, wer die strategische Ausrichtung eines Unternehmens eher beeinflusst<br />
– der Vorstandsvorsitzende oder das gesamte Vorstandsteam –, ist allerdings<br />
umstritten. Laut AktG ist der Vorstand ein Kollektivorgan, das strategische<br />
Entscheidungen gemeinschaftlich trifft <strong>und</strong> verantwortet. In der Praxis<br />
besitzt der Vorstandsvorsitzende jedoch häufig eine hervorgehobene Rolle.<br />
Dementsprechend weisen zahlreiche Autoren darauf hin, dass faktisch vor<br />
allem der Vorstandsvorsitzende die strategischen Entscheidungen des Unternehmens<br />
prägt. 21 Aus diesem Gr<strong>und</strong> wird in der vorliegenden Untersuchung<br />
<strong>Führungswechsel</strong> als ein Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden<br />
verstanden. Daraus leitet sich folgende gr<strong>und</strong>sätzliche Forschungshypothese ab:<br />
Hypothese 1: Es besteht ein Zusammenhang zwischen einem Wechsel in der Person des<br />
Vorstandsvorsitzenden <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
Vgl. Kesner/Sebora (1994), S. 328 ff.<br />
Vgl. Goodstein/Gautam/Boeker (1994), S. 246 ff.; Goodstein/Boeker (1991), S.<br />
324 ff.; Golden/Zajac (2001), S. 1103 ff., Westphal/Fredrickson (2001), S. 1132.<br />
Vgl. Gupta (1988), S. 159 ff.; Tihanyi et al. (2000), S. 1162 ff.<br />
Vgl. Gutenberg (1962), S. 45 f.; Salomo (2000), S. 29 f.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 7<br />
3.2 Arten von <strong>Führungswechsel</strong>n<br />
Verschiedene empirische Untersuchungen verdeutlichen, dass die Folgen<br />
eines <strong>Führungswechsel</strong>s nicht unabhängig von seinen Ursachen gesehen werden<br />
dürfen. 22 So gibt es auch Anlass zu der Vermutung, dass die Stärke des<br />
<strong>Strategiewandel</strong>s von der Art des <strong>Führungswechsel</strong>s beeinflusst wird. Insbesondere<br />
die Frage, ob ein <strong>Führungswechsel</strong> unfreiwillig, freiwillig oder unabwendbar<br />
ist, kann <strong>für</strong> den <strong>Strategiewandel</strong> eine Rolle spielen. Dementsprechend<br />
werden diese drei Wechselarten in der Untersuchung berücksichtigt. 23<br />
Unfreiwilliger Wechsel<br />
Ein unfreiwilliger Wechsel liegt vor, wenn der Vorstandsvorsitzende gegen<br />
seinen eigenen Willen aus dem Amt scheiden muss. Diesem Wechsel geht in<br />
der Regel ein Konflikt zwischen dem Vorstandsvorsitzenden <strong>und</strong> dem Aufsichtsrat<br />
voraus. Als Konfliktursachen kommen Unstimmigkeiten über die<br />
strategische Ausrichtung des Unternehmens oder ein unbefriedigender Unternehmenserfolg<br />
in Frage - <strong>und</strong> damit zusammenhängend ein schwindendes Vertrauen<br />
in die Leistungsfähigkeit des Vorstandsvorsitzenden. Die Aufgabe des<br />
neuen Vorstandsvorsitzenden besteht nun darin, die unbefriedigende Situation<br />
zu verbessern. Daher ist bei einem unfreiwilligen Wechsel mit einem <strong>Strategiewandel</strong><br />
zu rechnen, durch den der neue Vorstandsvorsitzende entweder den<br />
strategischen Vorstellungen des Aufsichtsrats besser entsprechen oder das Unternehmen<br />
wieder auf einen nachhaltigen Erfolgspfad zurückführen will. 24<br />
Freiwilliger Wechsel<br />
Ein freiwilliger Wechsel liegt vor, wenn ein Vorstandsvorsitzender aus eigenem<br />
Antrieb das Unternehmen verlässt. Da<strong>für</strong> können zwei Gründe ausschlaggebend<br />
sein. Zum einen kann Unzufriedenheit mit der aktuellen Arbeitssituation<br />
eine Rolle spielen (negative Motivation). Ähnlich wie beim unfreiwilligen<br />
Wechsel liegt in diesem Fall eine – allerdings weniger stark ausgeprägte –<br />
Konfliktsituation vor. Ein negativ motivierter freiwilliger Wechsel kann z.B. als<br />
Vorwegnahme einer eventuell drohenden Entlassung aufgefasst werden. Als<br />
Folge dieser Art des freiwilligen Wechsels wird daher ein größeres Ausmaß<br />
strategischer Veränderungen erwartet. Neben einem negativ motivierten ist<br />
auch ein positiv motivierter freiwilliger Wechsel möglich. In diesem Fall ist eine<br />
berufliche Neuorientierung des Vorstandsvorsitzenden, meist infolge eines<br />
attraktiven Angebots eines anderen Unternehmens, Auslöser des Wechsels. Bei<br />
22<br />
23<br />
24<br />
Vgl. Pitcher/Chreim/Kisfalvi (2000), S. 645; Salomo (2001), S. 118.<br />
Vgl. Schrader/Lüthje (1995), S. 468 ff.<br />
Vgl. Leker/Salomo (1998), S. 159; Schrader/Lüthje (1995), S. 469; Salomo (2001),<br />
S. 53 ff.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 8<br />
einem positiv motivierten freiwilligen Wechsel ist mit einem geringeren Ausmaß<br />
strategischer Veränderungen zu rechnen, da der berufliche Aufstieg des<br />
scheidenden Vorstandsvorsitzenden auch als Ausdruck vergangenen Erfolgs<br />
gesehen wird <strong>und</strong> Wandel in erfolgreichen Unternehmen in der Regel schwieriger<br />
zu realisieren ist. 25<br />
Unabwendbarer Wechsel<br />
Ein unabwendbarer Wechsel liegt vor, wenn der Vorstandsvorsitzende<br />
sein Amt aufgr<strong>und</strong> unvermeidbarer Umstände aufgibt. Zu diesen unvermeidbaren<br />
Umständen zählen zum einen die planmäßige Pensionierung als „Normalfall“<br />
des <strong>Führungswechsel</strong>s, aber auch das Ausscheiden aufgr<strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitlicher<br />
Probleme oder Tod. Zumindest im Fall der planmäßigen Pensionierung ist<br />
weitgehend absehbar, wann der amtierende Vorsitzende aus dem Amt ausscheidet.<br />
Daher kann das Unternehmen den <strong>Führungswechsel</strong> langfristig planen.<br />
Teilweise ist der scheidende Vorstandsvorsitzenden sogar in den Auswahlprozess<br />
des Nachfolgers involviert. Hambrick et al. stellen <strong>für</strong> diesen Fall<br />
eine Tendenz zum „self-cloning“ fest. 26 Allerdings zeigen Untersuchungen, dass<br />
jeder neue Vorstandsvorsitzende bestrebt ist, dem Unternehmen seine eigene<br />
Prägung zu geben. Insofern wird vermutet, dass auch bei unabwendbarem<br />
Wechsel strategischer Wandel beobachtet werden kann, allerdings in geringerem<br />
Ausmaß als bei freiwilligem <strong>und</strong> unfreiwilligem Wechsel. 27<br />
Hypothese 2: Die Stärke des strategischen Wandels unterscheidet sich abhängig von der<br />
Art des Wechsels des Vorstandsvorsitzenden.<br />
3.3 Kontingenzfaktoren der Wechsel-Wandel-Beziehung<br />
Die Beziehung zwischen <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> ist, wie<br />
praktische Beispiele zeigen, nicht in allen Unternehmen gleich ausgeprägt. Daher<br />
liegt die Vermutung nahe, dass situative Einflussfaktoren, so genannte<br />
Kontingenzfaktoren, eine wichtige Rolle spielen. In der empirischen Forschung<br />
werden im Zusammenhang mit <strong>Führungswechsel</strong>n vor allem drei Gruppen von<br />
Einflussfaktoren berücksichtigt. Dabei handelt es sich um Unternehmensfaktoren,<br />
um Eigenschaften des neuen Vorstandsvorsitzenden <strong>und</strong> um Eigenschaften<br />
des scheidenden Vorstandsvorsitzenden. 28 Ausgewählte Faktoren aus diesen<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
Vgl. Salomo (2001), S. 55 ff.; Leker/Salomo (1998), S. 159 ff.; Schrader/Lüthje<br />
(1995), S. 469 ff.; Bluedorn (1982), S. 81 ff.<br />
Vgl. Hambrick/Geletkanycz/Fredrickson (1993), S. 414 f.<br />
Vgl. Schrader/Lüthje (1995), S. 469; Friedmann/Singh (1989), S. 723; Gabarro<br />
(1988), S. 240 ff.<br />
Vgl. Lant/Milliken/Batra (1992), S. 591 ff.; Miller (1993), S. 645 ff.; Wiersema<br />
(1992), S. 83 ff.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 9<br />
drei Gruppen werden auch in die vorliegende Untersuchung als Moderatoren<br />
berücksichtigt.<br />
3.3.1 Unternehmensfaktoren<br />
Dass der Unternehmenskontext die Beziehung zwischen <strong>Führungswechsel</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> beeinflusst, erscheint unmittelbar einsichtig. Insbesondere<br />
das Unternehmensalter, die Unternehmensgröße <strong>und</strong> der Unternehmenserfolg<br />
vor dem Wechsel beeinflussen empirischen Studien zufolge die Beziehung zwischen<br />
Wechsel <strong>und</strong> Wandel. 29<br />
Unternehmensalter<br />
Ältere Unternehmen sind in der Regel durch stärker etablierte Strukturen<br />
<strong>und</strong> Prozesse gekennzeichnet als junge Unternehmen. Daraus resultiert im<br />
Allgemeinen eine größere Trägheit <strong>und</strong> Zurückhaltung gegenüber Veränderungen.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist zu vermuten, dass in älteren Unternehmen weniger<br />
<strong>Strategiewandel</strong> infolge von <strong>Führungswechsel</strong>n auftreten wird als in jungen<br />
Unternehmen. 30<br />
Hypothese 3: Das Unternehmensalter moderiert den Zusammenhang zwischen einem<br />
Wechsel des Vorstandsvorsitzenden <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />
Unternehmensgröße<br />
Die Größe eines Unternehmens zeigt sich vor allem in einer stärkeren<br />
Spezialisierung <strong>und</strong> einer Zunahme innerbetrieblicher Komplexität. Dadurch<br />
gehen tendenziell Flexibilität <strong>und</strong> Beeinflussbarkeit des Unternehmens zurück.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist zu vermuten, dass in größeren Unternehmen weniger<br />
<strong>Strategiewandel</strong> infolge von <strong>Führungswechsel</strong>n auftreten wird als in kleineren<br />
Unternehmen. 31<br />
Hypothese 4: Die Unternehmensgröße moderiert den Zusammenhang zwischen einem<br />
Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />
29<br />
30<br />
31<br />
Vgl. Hambrick/Finkelstein (1987), S. 383.<br />
Vgl. Hannan/Freeman (1984), S. 157 ff.; Miller/Dröge (1986), S. 542 ff. Andererseits<br />
zeigen Untersuchungen aber auch, dass jüngere Unternehmen eine geringe<br />
Neigung zu strategischem Wandel besitzen, da sie es scheuen, jüngste Verbindungen<br />
zu K<strong>und</strong>en/Lieferanten zu gefährden. Dieser Einwand ist an dieser Stelle allerdings<br />
nicht sehr gravierend, da sich keine ganz jungen Unternehmen in der<br />
Stichprobe befinden.<br />
Vgl. Tushman/Romanelli (1985), S. 191 f.; Mintzberg (1979), S. 233 f.; Hambrick/Finkelstein<br />
(1987), S. 384 ff.; Friedman/Singh (1989), S. 728 ff. Teilweise<br />
wird allerdings argumentiert, dass größeren Unternehmen mehr Ressourcen zur<br />
Verfügung stehen, die <strong>für</strong> die Umsetzung von Wandel erforderlich sind. Vgl. Haveman<br />
(1993), S. 25 ff.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 10<br />
Unternehmenserfolg vor dem Wechsel<br />
Mangelnder Unternehmenserfolg gilt in der betriebswirtschaftlichen Forschung<br />
ganz generell als Auslöser strategischer Veränderungen. Anpassungsmaßnahmen<br />
sollen dann dazu dienen, das Unternehmen wieder besser auf seine<br />
Umwelt auszurichten. Gerade im Fall des <strong>Führungswechsel</strong>s kann der Nachfolger<br />
einen negativen Erfolg als Ansatzpunkt <strong>für</strong> die Überwindung von Trägheit<br />
<strong>und</strong> als Rechtfertigung <strong>für</strong> die Umsetzung notwendiger Veränderungen nutzen.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist zu vermuten, dass in Unternehmen, die vor dem Wechsel<br />
durch einen unbefriedigenden Unternehmenserfolg gekennzeichnet waren,<br />
mehr <strong>Strategiewandel</strong> infolge von <strong>Führungswechsel</strong>n auftreten wird als in erfolgreichen<br />
Unternehmen.<br />
Hypothese 5: Der Unternehmenserfolg vor dem Wechsel moderiert den Zusammenhang<br />
zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />
3.3.2 Eigenschaften des neuen Vorstandsvorsitzenden<br />
Neben unternehmensspezifischen Faktoren wird in der Literatur zum<br />
<strong>Führungswechsel</strong> auch den Eigenschaften des neuen Vorstandsvorsitzenden<br />
ein wichtiger Einfluss bescheinigt. Im Zusammenhang mit <strong>Strategiewandel</strong><br />
erscheinen vor allem das Alter dieser Person, die Dauer ihrer Unternehmenszugehörigkeit<br />
<strong>und</strong> ihr Ausbildungshintergr<strong>und</strong> relevant. 32<br />
Alter<br />
Verschiedene empirische Untersuchungen zeigen, dass das strategische<br />
Entscheidungsverhalten von Führungskräften durch ihr Lebensalter beeinflusst<br />
wird. 33 So lässt sich empirisch belegen, dass Unternehmen, die von jüngeren<br />
Führungskräften geleitet werden, mehr <strong>Strategiewandel</strong> realisieren, da jüngere<br />
Führungskräfte tendenziell auf neue Situationen offener <strong>und</strong> risikofreudiger<br />
reagieren als ältere. Darüber hinaus wird jüngeren Führungskräften bescheinigt,<br />
dass sie besser in der Lage sind, die physischen <strong>und</strong> mentalen Anstrengungen<br />
auf sich zu nehmen, die mit Wandel verb<strong>und</strong>en sind. 34 Ältere Führungskräfte<br />
zeichnen sich dagegen durch eine stärkere Bindung an den Status quo aus. Darüber<br />
hinaus erlangen Sicherheitsaspekte einen höheren Stellenwert, <strong>und</strong> risikoreiche<br />
Entscheidungen werden tendenziell vermieden. 35 Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist<br />
zu vermuten, dass ältere Nachfolger im Falle des <strong>Führungswechsel</strong>s weniger<br />
<strong>Strategiewandel</strong> durchführen als jüngere.<br />
32<br />
33<br />
34<br />
35<br />
Vgl. Hambrick/Mason (1984), S. 193 ff.<br />
Vgl. Hambrick/Mason (1984), S. 198; Thomas/Litschert/Ramaswamy (1991), S.<br />
513; Wiersema/Bantel (1992), S. 97.<br />
Vgl. Grimm/Smith (1991), S. 560 ff.; Child (1974), S. 181 ff.<br />
Vgl. Carlsson/Karlsson (1970), S. 711 ff.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 11<br />
Hypothese 6: Das Alter des neuen Vorstandsvorsitzenden moderiert den Zusammenhang<br />
zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit<br />
Verschiedene Studien zeigen, dass eine lange Unternehmenszugehörigkeit<br />
von Führungskräften tendenziell zu geringerer Veränderungsbereitschaft führt.<br />
Gerade bei der Person des Vorstandsvorsitzenden kann im Falle langer Unternehmenszugehörigkeit<br />
davon ausgegangen werden, dass sie die Ausrichtung des<br />
Unternehmens auch vor ihrem Amtsantritt schon wesentlich mitgeprägt hat.<br />
Daraus resultiert – wie verschiedene Studien zeigen – eine stärkere Bindung an<br />
den Status quo, was wiederum die Barrieren <strong>für</strong> <strong>Strategiewandel</strong> erhöht. Darüber<br />
hinaus führt eine lange Unternehmenszugehörigkeit häufig zu einer eher<br />
selektiven Informationsverarbeitung <strong>und</strong> damit zu einer gewissen „Blindheit“<br />
<strong>für</strong> neue Lösungen. Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist zu vermuten, dass Nachfolger mit<br />
langer Unternehmenszugehörigkeit im Falle von <strong>Führungswechsel</strong>n weniger<br />
<strong>Strategiewandel</strong> durchführen. 36<br />
Hypothese 7: Die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit des neuen Vorstandsvorsitzenden<br />
moderiert den Zusammenhang zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze<br />
<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />
Ausbildungsrichtung<br />
Verschiedene empirische Untersuchungen zeigen, dass die Bereitschaft<br />
zum <strong>Strategiewandel</strong> auch durch die Ausbildung einer Führungskraft beeinflusst<br />
wird. Dabei wird argumentiert, dass die Ausbildung, die eine Führungskraft<br />
erfahren hat, ihr Denken <strong>und</strong> Handeln nachhaltig prägt. In diesem Zusammenhang<br />
wird im Allgemeinen unterstellt, dass Absolventen natur- oder<br />
ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen eine größere Affinität zu Fortschritt<br />
<strong>und</strong> Innovation besitzen als beispielsweise Wirtschaftswissenschaftler oder<br />
Juristen. Dementsprechend kann vermutet werden, dass Nachfolger, die eine<br />
natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung besitzen, im Falle von <strong>Führungswechsel</strong>n<br />
mehr <strong>Strategiewandel</strong> durchführen als Wirtschaftswissenschaftler<br />
oder Juristen. 37<br />
Hypothese 8: Die Ausbildungsrichtung des neuen Vorstandsvorsitzenden moderiert<br />
den Zusammen hang zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong><br />
<strong>Strategiewandel</strong>.<br />
36<br />
37<br />
Vgl. Finkelstein/Hambrick (1996), S. 81 ff.; Hambrick/Geletkanycz/Fredrickson<br />
(1993), S. 404 ff.<br />
Vgl. Finkelstein/Hambrick (1996), S. 99 ff.; Holland (1985), S. 15 ff.; Hitt/Tyler<br />
(1991), S. 333; Fondas/Wiersema (1997), S. 571 f.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 12<br />
3.3.3 Eigenschaften des ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden<br />
Neben unternehmensspezifischen Faktoren <strong>und</strong> Eigenschaften des neuen<br />
Vorstandsvorsitzenden werden in der Literatur zum <strong>Führungswechsel</strong> die Eigenschaften<br />
des ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden als dritter wichtiger<br />
Einflussbereich hervorgehoben. Vor allem die Dauer seiner Amtszeit gilt in<br />
diesem Zusammenhang als wichtig. In Deutschland scheint darüber hinaus<br />
noch von Bedeutung, ob der scheidende Vorstandsvorsitzende in den Aufsichtsrat<br />
wechselt oder nicht. 38<br />
Länge der Amtszeit<br />
Hambrick <strong>und</strong> Fukutomi zeigen in einer Untersuchung, dass Vorstandsvorsitzende<br />
oft bereits zu Beginn ihrer Amtszeit ein strategisches Paradigma<br />
entwickeln, an das sie sich im Laufe der Zeit immer stärker geb<strong>und</strong>en fühlen.<br />
Dadurch wird es <strong>für</strong> einen Vorstandsvorsitzenden zunehmend schwerer, einmal<br />
getroffene Richtungsentscheidungen ohne „Gesichtsverlust“ zurückzunehmen.<br />
Die jüngste Diskussion um die Strategie der DaimlerChrysler AG könnten als<br />
Beispiel hier<strong>für</strong> gewertet werden. Dementsprechend wächst mit zunehmender<br />
Amtszeit des scheidenden Vorstandsvorsitzenden die Gefahr, dass aufgr<strong>und</strong><br />
vergangener Bindungen notwendige strategische Anpassungen unterblieben<br />
sind <strong>und</strong> das Unternehmen nur noch unzureichend auf veränderte Anforderungen<br />
der Umwelt ausgerichtet ist. 39 Daraus ergibt sich nach dem <strong>Führungswechsel</strong><br />
ein erhöhter Bedarf an strategischem Wandel, den der neue Vorstandsvorsitzende<br />
aufgr<strong>und</strong> seiner geringeren Bindung an vergangene Entscheidungen<br />
besser umsetzen kann als der alte. Dementsprechend kann vermutet werden,<br />
dass eine lange Amtszeit des Vorgängers im Falle von <strong>Führungswechsel</strong>n eher<br />
zu <strong>Strategiewandel</strong> führt als eine kurze.<br />
Hypothese 9: Die Länge der Amtszeit des ehemaligen. Vorstandsvorsitzenden moderiert<br />
den Zusammenhang zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong><br />
<strong>Strategiewandel</strong>.<br />
Wechsel in den Aufsichtsrat<br />
Insbesondere in deutschen Großunternehmen verlassen ausscheidende<br />
Vorstandsvorsitzende ihr Unternehmen oft nicht völlig, sondern treten – häufig<br />
sogar als Vorsitzende – in den Aufsichtsrat ein. Da der Aufsichtsrat eine Kontrollfunktion<br />
gegenüber dem Vorstand ausübt, besteht <strong>für</strong> den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden<br />
so die Möglichkeit, Einfluss auf Entscheidungen seines<br />
Nachfolgers auszuüben. Dieser Einfluss kann strategischen Wandel erschwe-<br />
38<br />
39<br />
Vgl. Hambrick/Fukutomi (1991), S. 724 ff.; Poensgen (1982b), S. 194 ff.<br />
Vgl. Miller (1991), S. 47.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 13<br />
ren. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Wandel ein negatives Licht auf den<br />
ehemaligen Vorstandsvorsitzenden werfen würde. 40 Insofern kann vermutet<br />
werden, dass ein Wechsel des scheidenden Vorstandsvorsitzenden in den Aufsichtsrat<br />
zu weniger <strong>Strategiewandel</strong> führt als im Falle seines Ausscheidens aus<br />
dem Unternehmen.<br />
Hypothese 10: Der Wechsel des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden in den Aufsichtsrat<br />
moderiert den Zusammenhang zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze<br />
<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />
Abbildung 1 liefert einen zusammenfassenden Überblick über die Struktur<br />
des unterstellten Zusammenhangs zwischen <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />
sowie die berücksichtigten Moderatoren.<br />
Unternehmensfaktoren:<br />
Wechsel an der<br />
Unternehmensspitze<br />
- unfreiwillig<br />
- freiwillig<br />
- unabwendbar<br />
Eigenschaften des neuen<br />
Vorstandsvorsitzenden:<br />
- Alter<br />
- Unternehmenszugehörigkeit<br />
- Ausbildungsrichtung<br />
- Unternehmensalter<br />
- Unternehmensgröße<br />
- Unternehmenserfolg<br />
vor dem Wechsel<br />
Eigenschaften des ausscheidenden<br />
Vorstandsvorsitzenden:<br />
- Amtszeit<br />
- Wechsel in den Aufsichtsrat<br />
<strong>Strategiewandel</strong><br />
Abbildung 1:<br />
Struktur des Zusammenhangs von <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />
4. Methodik der empirischen Untersuchung<br />
4.1 Ermittlung der Stichprobe<br />
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht darin, den Zusammenhang<br />
zwischen <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> bei deutschen Großunternehmen<br />
zu analysieren. Daher wurden nur Unternehmen betrachtet, die<br />
ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> die Auswahl der zu untersuchenden<br />
<strong>Führungswechsel</strong> bildete eine Übersicht der 200 größten deutschen<br />
Unternehmen aus dem Jahr 2001. 41 Aus dem Kreis dieser 200 Unter-<br />
40<br />
41<br />
Vgl. Friedmann/Singh (1989), S. 727 ff.; Poensgen (1982b), S. 194.<br />
Vgl. o.V. (2002).
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 14<br />
nehmen wurden alle Aktiengesellschaften ausgewählt, 42 die nicht Teil eines<br />
größeres Konzerns sind <strong>und</strong> bei denen innerhalb des Untersuchungszeitraumes<br />
von 1990 bis 2000 ein Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden stattgef<strong>und</strong>en<br />
hat. 43 Insgesamt flossen 58 <strong>Führungswechsel</strong> in 44 verschiedenen<br />
Unternehmen in die Untersuchung ein. Ein Überblick über die Unternehmen<br />
der Stichprobe findet sich im Anhang.<br />
4.2 Operationalisierung der Variablen<br />
Arten des <strong>Führungswechsel</strong>s<br />
Die Zuordnung der identifizierten <strong>Führungswechsel</strong> zu den drei Kategorien<br />
unfreiwilliger, freiwilliger <strong>und</strong> unabwendbarer Wechsel erfolgte auf Basis<br />
einer Inhaltsanalyse von Beiträgen der Wirtschaftspresse. Gerade die Frage<br />
nach der Ursache eines Wechsels an der Spitze eines Großunternehmens ist<br />
immer wieder Gegenstand der Berichterstattung in der Wirtschaftspresse, so<br />
dass eine Auswertung dieser Datenbasis geeignet erschien, um die Wechselart<br />
zu bestimmen. 44 Sofern aus der Wirtschaftspresse keine eindeutigen Hinweise<br />
auf die Wechselart ablesbar waren oder Angaben vollkommen fehlten, wurde<br />
Munzingers Biographisches Archiv als zusätzliche Informationsquelle genutzt. 45<br />
Zur Zuordnung der <strong>Führungswechsel</strong> zu einer der drei Kategorien wurde die<br />
von Schrader/Lüthje konzipierte Indikatorenliste verwendet (Abbildung 2). 46<br />
Strategischer Wandel<br />
Da es sich bei den meisten der betrachteten Unternehmen um Konzerne<br />
handelt, wurde <strong>Strategiewandel</strong> als Veränderung des Diversifikationsgrads der<br />
betrachteten Unternehmen definiert. Zur Messung des Diversifikationsgrads<br />
wurde das Entropie-Maß nach Jacquemin/Berry verwendet. 47 Für dessen Berechnung<br />
wurden aus forschungspragmatischen Gründen die von den entsprechenden<br />
Unternehmen in ihrer Segmentberichterstattung ausgewiesenen Umsätze<br />
je Geschäftsfeld herangezogen. Diese Vorgehensweise schien geeignet, da<br />
42<br />
43<br />
44<br />
45<br />
46<br />
47<br />
Zwei GmbHs der Top 10 wurden als Ausnahmen berücksichtig, da die untersuchungsrelevanten<br />
Daten im Vorfeld der Analyse verfügbar waren <strong>und</strong> so der<br />
Stichprobenumfang erhöht werden konnte.<br />
Identifiziert wurden die Wechselfälle über Online-Recherche sowie in Einzelfällen<br />
über einen Vergleich in Hoppenstedts Handbuch deutscher Aktiengesellschaften.<br />
Zur Bestimmung der Wechselzeitpunkte wurden Angaben in Munzinger’s Biographischem<br />
Archiv hinzugezogen. Vgl. o.V. (2003).<br />
Vgl. Salomo (2001), S. 189.<br />
Vgl. o.V. (2003).<br />
Vgl. Schrader/Lüthje (1995), S. 476 ff.; der Indikatorenliste von Schrader/Lüthje<br />
wurde von Studien in der Vergangenheit eine hohe Reliabilität <strong>und</strong> Validität attestiert.<br />
Dennoch ist das Lebensalter der ausscheidenden Spitzenführungskraft als<br />
Hilfsindikator unabwendbarer Abgänge herangezogen worden, da vor allem geplante<br />
Wechsel häufig nicht explizit in der Presse erwähnt werden.<br />
Vgl. Jacquemin/Berry (1979), S. 359 ff.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 15<br />
in dieser Analyse nicht der absolute Diversifikationsgrad sondern dessen Veränderung<br />
im Zeitverlauf von Interesse ist <strong>und</strong> da die von Unternehmen selbst<br />
vorgenommene Geschäftsfeldsegmentierung ihre strategische Ausrichtung<br />
besser zum Ausdruck bringt als beispielsweise der SIC-Code. Die Messung des<br />
Diversifikationsgrades wurde zu zwei Zeitpunkten vor <strong>und</strong> nach dem Wechsel<br />
des Vorstandsvorsitzenden durchgeführt. Konkret wurde ein individueller Analysezeitraum<br />
von fünf Jahren je Wechselfall bestimmt. Dieser umfasste das<br />
Wechseljahr (t 0) sowie eine zeitliche Spanne von zwei Jahren vor (t -2) <strong>und</strong> nach<br />
(t +2) dem Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden. Die betragsmäßige<br />
Differenz zwischen t +2 <strong>und</strong> t -2 ging als Maßgröße <strong>für</strong> <strong>Strategiewandel</strong> in die Analyse<br />
ein. Die Umsatzzahlen je Geschäftsfeld, die zur Berechnung des Entropie-<br />
Maßes notwendig sind, stammten vorrangig aus Geschäftsberichten der betroffenen<br />
Unternehmen. Sofern Geschäftsberichte nicht zur Verfügung standen,<br />
erfolgte ein Rückgriff auf Hoppenstedts Handbuch deutscher Aktiengesellschaften.<br />
Unabwendbarer<br />
Wechsel<br />
Freiwilliger<br />
Wechsel<br />
Unfreiwilliger<br />
Wechsel<br />
Planmäßige<br />
Pensionierung<br />
Ges<strong>und</strong>heitliche<br />
Probleme<br />
Tod<br />
Vorsitzender ist<br />
Entscheidungsträger<br />
Aufsichtsrat wird<br />
passiv dargestellt<br />
Keine öffentliche<br />
Rücktrittsforderung<br />
Vorsitzender wäre<br />
weiterbeschäftigt<br />
worden<br />
Aufsichtsrat löst<br />
Vertrag (öff.) auf<br />
Starke Konflikte<br />
mit Aufsichtsrat<br />
Vorsitzender verantwortlich<br />
<strong>für</strong> Fehlentwicklung<br />
Strategie wird als<br />
falsch bezeichnet<br />
Abbildung 2:<br />
Ausgewählte Indikatoren der Wechselarten<br />
Kontingenzfaktoren<br />
Unternehmensalter: Das Unternehmensalter wurde als Differenz zwischen<br />
dem Gründungsjahr <strong>und</strong> dem jeweiligen Analysejahr t 0 bestimmt <strong>und</strong> anschließend<br />
logarithmiert.<br />
Unternehmensgröße: Zur Bestimmung der Unternehmensgröße wurde der<br />
Gesamtumsatz in t 0 herangezogen <strong>und</strong> im Bedarfsfall in Euro umgerechnet.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 16<br />
Unternehmenserfolg vor dem Wechsel: Die Operationalisierung des Unternehmenserfolgs<br />
erfolgte anhand der Gesamtkapitalrentabilität. 48 Wie der <strong>Strategiewandel</strong><br />
wurde auch der Erfolg vor dem Wechsel an zwei Punkten gemessen: t-2<br />
<strong>und</strong> t -1. Die Differenz der Gesamtkapitalrentabilität in diesen beiden Jahren<br />
ging als Unternehmenserfolg vor dem Wechsel in die Analyse ein. 49<br />
Alter des neuen Vorstandsvorsitzenden: Das Alter wurde als Differenz zwischen<br />
Geburtsdatum <strong>und</strong> dem Tag des Amtsantritts in t 0 bestimmt <strong>und</strong> möglichst<br />
jahr- <strong>und</strong> monatsgenau angegeben.<br />
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit: Die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit<br />
wurde als Differenz zwischen dem erstmaligen Eintritt in das Unternehmen<br />
<strong>und</strong> dem Tag der offiziellen Amtsübernahme gemessen. Die Angaben<br />
erfolgten jahr- <strong>und</strong> monatsgenau.<br />
Ausbildungsrichtung: Die Ausbildungsrichtung wurde durch die höchstrangige,<br />
abgeschlossene Ausbildung einer Person definiert. In jedem Fall erfolgte<br />
eine Zuordnung zu einer der sieben Kategorien BWL, VWL, Jura, Mathematik,<br />
Physik, Chemie, Ingenieurwesen <strong>und</strong> Sonstige. Die Ausbildungsrichtungen<br />
BWL, VWL <strong>und</strong> Jura wurden in einem zweiten Schritt zur Kategorie „Wirtschafts-<br />
<strong>und</strong> Rechtswissenschaften“ zusammengefasst, die Ausbildungsrichtungen<br />
Physik, Mathematik, Chemie sowie Ingenieurwesen zur Kategorie „Naturwissenschaft“.<br />
Länge der Amtszeit des ehemaligen Vorsitzenden: Die Amtszeit des scheidenden<br />
Vorsitzenden wurde als Differenz zwischen dem Tag des Amtsantritts <strong>und</strong> dem<br />
Tag des Ausscheidens aus dem Amt jahr- <strong>und</strong> monatsgenau ermittelt.<br />
Wechsel in den Aufsichtsrat: Der Wechsel des ehemaligen Vorsitzenden in das<br />
Kontrollorgan ging als nominal skalierte 0/1-Variable in die Untersuchung ein.<br />
5. Ergebnisse der empirischen Untersuchung<br />
5.1 Deskriptive Analyse der Stichprobe<br />
Bevor die Ergebnisse der Analyse zum Zusammenhang zwischen <strong>Führungswechsel</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> sowie zum Einfluss der moderierenden Variablen<br />
präsentiert werden, erfolgt eine kurze deskriptive Auswertung der Stichprobe.<br />
Von Interesse sind dabei insbesondere die Verteilung der unabhängigen<br />
Variable „Wechsel des Vorstandsvorsitzenden“ auf die drei Wechselkategorien<br />
48<br />
49<br />
Vgl. Coenenberg (1994), S. 614.<br />
Vgl. Virany/Tushman/Romanelli (1992), S. 81.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 17<br />
unfreiwilliger, freiwilliger <strong>und</strong> unabwendbarer Wechsel, die Stärke des beobachteten<br />
<strong>Strategiewandel</strong>s sowie die Korrelationen der berücksichtigten Einflussfaktoren.<br />
Hinsichtlich der Verteilung der unabhängigen Variable „Wechsel des Vorstandsvorsitzenden“<br />
auf die drei Kategorien des <strong>Führungswechsel</strong>s zeigt sich,<br />
dass der unabwendbare Wechsel mit 56,9 Prozent die absolute Mehrheit aller<br />
untersuchten Wechselfälle repräsentiert. Hier bestätigt sich die Vermutung, dass<br />
der unabwendbare Wechsel, also primär das Ausscheiden im Rahmen einer<br />
planmäßigen Pensionierung, den Normalfall des <strong>Führungswechsel</strong>s darstellt.<br />
Freiwillige <strong>und</strong> unfreiwillige Wechsel sind mit 20,7 Prozent bzw. 22,4 Prozent<br />
etwa gleich stark in der Stichprobe vertreten (Abbildung 3). Diese Verteilungswerte<br />
stimmen im Wesentlichen mit den von Schrader <strong>und</strong> Lüthje erstmalig in<br />
dieser Form dokumentierten Ergebnissen überein. In ihrer Analyse resultierte<br />
<strong>für</strong> unabwendbare Wechsel ein Wert von 49 Prozent, gefolgt von freiwilligen<br />
Wechseln mit 26 Prozent <strong>und</strong> unfreiwilligen mit 25 Prozent. 50<br />
Häufigkeit<br />
in %<br />
50<br />
33<br />
25<br />
10<br />
12 13<br />
0<br />
freiwillig unfreiwillig unabwendbar<br />
Wechselart<br />
Abbildung 3: Verteilung der Wechselarten in der Gr<strong>und</strong>gesamtheit (n = 58)<br />
Darüber hinaus zeigt die deskriptive Auswertung der Stichprobe, dass<br />
<strong>Strategiewandel</strong> im Zusammenhang mit <strong>Führungswechsel</strong> tatsächlich zu beobachten<br />
ist. Der Mittelwert der Veränderung des Entropie-Maßes zwischen t+2<br />
<strong>und</strong> t -2 liegt bei einem Wert von 0,174. Diese Veränderung entspricht in ihrer<br />
Größenordnung den Ergebnissen amerikanischen Studien. 51<br />
50<br />
51<br />
Vgl. Schrader/Lüthje (1995), S. 479 ff.<br />
Vgl. Wiersema/Bantel (1992), S. 108.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 18<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Wandel<br />
Korrelation<br />
Signifikanz<br />
1<br />
.<br />
Korrelation<br />
Signifikanz<br />
-,301(*)<br />
,022<br />
1<br />
.<br />
Korrelation<br />
Signifikanz<br />
,051<br />
,703<br />
-,205<br />
,122<br />
1<br />
.<br />
Unternehmensalter<br />
Unternehmensgröße<br />
Unternehmenserfolg<br />
vor dem<br />
Wechsel<br />
Korrelation<br />
Signifikanz<br />
,009<br />
,947<br />
-,102<br />
,450<br />
-,099<br />
,465<br />
1<br />
.<br />
Korrelation<br />
Signifikanz<br />
,063<br />
,638<br />
,069<br />
,608<br />
-,027<br />
,840<br />
-,207<br />
,122<br />
1<br />
.<br />
Alter des neuen<br />
Vorstandsvorsitzenden<br />
Unternehmenszugehörigkeit<br />
neuer Vorstandsvorsitzender<br />
Korrelation<br />
Signifikanz<br />
-,383(**)<br />
,003<br />
,292(*)<br />
,027<br />
,206<br />
,125<br />
,022<br />
,870<br />
,360(**)<br />
,006<br />
1<br />
.<br />
Korrelation<br />
Signifikanz<br />
-,215<br />
,105<br />
-,232<br />
,079<br />
-,106<br />
,430<br />
-,113<br />
,402<br />
,006<br />
,966<br />
,523(**)<br />
,000<br />
1<br />
.<br />
Amtszeit ehemaliger<br />
Vorstandsvorsitzender<br />
Ausbildungsrichtung<br />
neuer Vorstandsvorsitzender<br />
Korrelation<br />
Signifikanz<br />
,021<br />
,874<br />
-,016<br />
,904<br />
-,097<br />
,469<br />
,020<br />
,884<br />
,129<br />
,335<br />
,036<br />
,791<br />
-,150<br />
,261<br />
1<br />
.<br />
1<br />
.<br />
Wechsel in<br />
den Aufsichtsrat<br />
Korrelation<br />
Signifikanz<br />
-,297(*)<br />
,024<br />
,310(*)<br />
,018<br />
,088<br />
,513<br />
,077<br />
,571<br />
,157<br />
,238<br />
,546(**)<br />
,000<br />
,437(**)<br />
,001<br />
,030<br />
,824<br />
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant<br />
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant<br />
Abbildung 4:<br />
Korrelationen
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 19<br />
Schließlich lassen sich auch aus einem Überblick über die direkten Korrelationen<br />
zwischen den einbezogenen Moderatorvariablen <strong>und</strong> dem <strong>Strategiewandel</strong><br />
einige interessante Ergebnisse ableiten (Abbildung 4). So weisen drei<br />
der untersuchten Moderatoren – unabhängig von ihrer Interaktion mit <strong>Führungswechsel</strong><br />
– einen signifikanten negativen Zusammenhang mit dem <strong>Strategiewandel</strong><br />
auf. Konkret handelt es sich dabei um die Faktoren Unternehmensalter,<br />
Unternehmenszugehörigkeit des neuen Vorstandsvorsitzenden sowie<br />
Wechsel in den Aufsichtsrat. Daraus kann geschlossen werden, dass das Ausmaß<br />
des <strong>Strategiewandel</strong>s umso geringer ist, je älter ein Unternehmen ist <strong>und</strong> je<br />
länger der neue Vorstandsvorsitzende dem Unternehmen angehört. Außerdem<br />
lässt sich folgern, dass weniger Wandel zu beobachten ist, wenn der ehemalige<br />
Vorstandsvorsitzende in den Aufsichtsrat wechselt. Diese signifikanten Zusammenhänge<br />
bedeuten jedoch nicht, dass – wie in den Hypothesen 3, 7 <strong>und</strong><br />
10 vermutet – die drei Faktoren eine Moderatorwirkung auf den Wechsel-<br />
Wandel-Zusammenhang besitzen. Vielmehr zeigen die Korrelationen nur, dass<br />
das Unternehmensalter, die Unternehmenszugehörigkeit <strong>und</strong> der Wechsel in<br />
den Aufsichtsrat unabhängig vom <strong>Führungswechsel</strong> einen direkten Einfluss auf<br />
das Ausmaß des <strong>Strategiewandel</strong>s ausüben.<br />
Außerdem verdeutlicht die Korrelationsmatrix, dass die drei Variablen Unternehmensalter,<br />
Unternehmenszugehörigkeit des neuen Vorstandsvorsitzenden<br />
<strong>und</strong> Wechsel des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden in den Aufsichtsrat<br />
signifikant positiv miteinander korreliert sind. Darüber hinaus lässt sich aus der<br />
Matrix ablesen, dass die Länge der Amtszeit des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden<br />
signifikant positiv mit einem Wechsel in den Aufsichtsrat <strong>und</strong> mit der<br />
Unternehmenszugehörigkeit des neuen Vorstandsvorsitzenden korreliert ist.<br />
5.2 Ergebnisse zum Wechsel-Wandel-Zusammenhang<br />
Die Hypothesen 1 <strong>und</strong> 2 haben sich mit dem Zusammenhang zwischen<br />
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> im Allgemeinen beschäftigt. Dabei wurde<br />
zum einen vermutet, dass <strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> in Beziehung<br />
zu einander stehen <strong>und</strong> dass die Variable <strong>Führungswechsel</strong> dementsprechend<br />
einen signifikanten Anteil der Varianz der Variable <strong>Strategiewandel</strong> erklärt.<br />
Zum anderen wurde die Hypothese aufgestellt, dass unfreiwilliger Wechsel<br />
mehr Wandel nach sich zieht als freiwilliger Wechsel <strong>und</strong> dieser wiederum<br />
mehr als unabdingbarer Wechsel.<br />
Als Prüfverfahren <strong>für</strong> diese Hypothesen wurde das Allgemeine Lineare<br />
Modell (ALM) gewählt. Dieses Verfahren gewährt einen detaillierteren Einblick
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 20<br />
in die Ergebnisstatistiken als die originäre Varianzanalyse. 52 Abbildung 5 gibt<br />
einen Überblick über die Ergebnisse der Analyse.<br />
Quelle<br />
Quadratsumme<br />
Typ 3<br />
df F-Wert Signifikanz Partielles Eta 2<br />
Wechsel 0,181 2 4,035 0,023 0,128<br />
Fehler 1,231 55<br />
Korr. Gesamtvariation<br />
(R 2 = 0,128)<br />
1,411 57<br />
Abbildung 5: Ergebnisse des Allgemeinen Linearen Modells (ALM) zum Wechsel-Wandel-Zusammenhang<br />
(n = 58)<br />
Aus den Ergebnisparametern lässt sich ein Effekt der unabhängigen Variable<br />
„Wechsel“ auf die abhängige Variable „<strong>Strategiewandel</strong>“ ablesen. Dies<br />
verdeutlicht das partielle Eta-Quadrat. Danach erklärt das Wechselereignis an<br />
der Unternehmensspitze knapp 13 Prozent der Varianz der abhängigen Variable<br />
<strong>Strategiewandel</strong>. 53 Angesichts des Signifikanzniveaus von p ≤ 0,05 kann der<br />
erklärbare Varianzanteil als signifikant bezeichnet werden. 54 Damit unterstützen<br />
die Untersuchungsergebnisse die Hypothese 1, d.h. es besteht ein Zusammenhang<br />
zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong>.<br />
Dieses Ergebnis entspricht gleichzeitig bisherigen Erkenntnissen der Wechsel-<br />
Wandel-Beziehung in der amerikanischen Forschung. 55<br />
Darüber hinaus muss die Vermutung überprüft werden, dass zwischen einzelnen<br />
Wechselarten signifikante Unterschiede hinsichtlich des realisierten Ausmaßes<br />
an strategischen Veränderungen bestehen. Das ALM sieht hier<strong>für</strong> Posthoc-Tests<br />
vor, mit denen ermittelt werden kann, zwischen welchen Abgangsarten<br />
Differenzen auftreten. Abbildung 6 gibt einen Überblick über die<br />
Mittelwerte des <strong>Strategiewandel</strong>s je Wechselart. Bereits diese Werte lassen erste<br />
Trends erkennen. Abbildung 6 zeigt, dass <strong>für</strong> unfreiwillige Wechsel das größte<br />
Ausmaß strategischer Veränderungen festzustellen ist, gefolgt von freiwilligen<br />
Wechseln <strong>und</strong> schließlich unabwendbaren Wechseln. Mittels eines Post-hoc-<br />
Test nach Tuckey-HSD 56 kann zwischen unfreiwilligem <strong>und</strong> unabwendbarem<br />
Wechsel eine signifikante Mittelwertdifferenz festgestellt werden (p = 0,023).<br />
52<br />
53<br />
54<br />
55<br />
56<br />
Vgl. Eckey/Kosfeld/Rengers (2002), S.149 ff.<br />
Das partielle Eta-Quadrat entspricht dabei dem bekannteren R 2 der Regressionsanalyse.<br />
Vgl. Diehl/Staufenbiehl (2002), S. 277 ff.<br />
Da in vorliegendem Fall nicht von einer normalverteilten Gr<strong>und</strong>gesamtheit ausgegangen<br />
werden kann, wurde ergänzend ein 3-Gruppen-Kruskal-Wallis-Test berechnet,<br />
der auf dem Niveau p ≤ 0,01 die Ergebnisse des ALM erneut bestätigt.<br />
Vgl. Bortz (1989), S. 347.<br />
Vgl. Wiersema (1992), S. 83 ff.; Lant/Milliken/Batra (1992), S 602 f.<br />
Vgl. Diehl/Staufenbiehl (2002), S. 259 ff.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 21<br />
Damit ist die Aussage zulässig, dass in Verbindung mit unfreiwilligem Wechsel<br />
mehr strategischer Wandel auftritt als in Verbindung mit unabwendbarem<br />
Wechsel.<br />
Wechselart<br />
unfreiwillig freiwillig unabwendbar<br />
Mittelwert 0,261 0,206 0,128<br />
Standardabweichung 0,157 0,181 0,134<br />
Abbildung 6: Durchschnittlicher <strong>Strategiewandel</strong> je Wechselart (n = 58)<br />
Die Differenz zwischen freiwilligen <strong>und</strong> unabwendbaren Wechseln verfehlt<br />
dagegen mit einem p = 0,283 die Signifikanzgrenze. Es ist zu vermuten,<br />
dass ein größerer Stichprobenumfang an dieser Stelle zu einer Ergebnisverbesserung<br />
beitragen könnte. Gleiches gilt <strong>für</strong> die Differenz zwischen unfreiwilligen<br />
<strong>und</strong> freiwilligen Wechseln. Insgesamt kann also die Hypothese 2 nur partiell<br />
bestätigt werden.<br />
5.3 Ergebnisse zu den Moderatoren des Wechsel-Wandel-Zusammenhangs<br />
Zur Überprüfung der Hypothesen 3 bis 10, die eine moderierende Wirkung<br />
unterschiedlicher Variablen auf den <strong>für</strong> signifikant bef<strong>und</strong>enen Wechsel-<br />
Wandel-Zusammenhang unterstellen, wird die nach Wechselarten differenzierende<br />
Ergebnisdarstellung verlassen. Im Vordergr<strong>und</strong> steht im Folgenden die<br />
Frage, inwieweit sich Moderatoreffekte <strong>für</strong> die Wechsel-Wandel-Beziehung<br />
insgesamt belegen lassen. Als Prüfverfahren wurde wiederum das ALM verwendet,<br />
in das die Variable „Wechsel“ <strong>und</strong> der jeweilige Moderator einfließen.<br />
Aus der Ergebnisstatistik ist ersichtlich, ob eine signifikante Wirkung der jeweiligen<br />
Moderatorvariable auf den zentralen Wechsel-Wandel-Zusammenhang<br />
besteht. Diese Vorgehensweise zur Überprüfung der Existenz von Moderatoreffekten<br />
ist vergleichbar mit der bekannteren Alternative moderiert hierarchischer<br />
Regressionen. Abbildung 7 weist die Ergebnisse der ALM-Analysen aus,<br />
wobei sich die Darstellung auf die Moderatoreffekte beschränkt.<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass drei der acht linearen Modellanalysen einen<br />
signifikanten Moderatoreffekt ausweisen. Konkret handelt es sich dabei um die<br />
unterlegten Faktoren Unternehmensalter, Unternehmensgröße sowie die Amtszeit<br />
des ehemaligen Vorsitzenden. Aufgr<strong>und</strong> dieser Ergebnisse können die<br />
Hypothesen 3, 4 <strong>und</strong> 9 unterstützt werden. Als positiv ist in diesem Zusammenhang<br />
zu bewerten, dass die Berücksichtigung der Moderatoreffekte den<br />
erklärbaren Varianzanteil von ursprünglich knapp 13 Prozent auf bis zu 28<br />
Prozent im Falle des Unternehmensalters steigert.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 22<br />
Modereffekt<br />
Partielles Eta 2 des<br />
Modells<br />
F-Wert<br />
Wechsel x Unternehmensalter 0,283 3,174 *<br />
Wechsel x Unternehmensgröße 0,214 2,620 †<br />
Wechsel x Unternehmenserfolg vor dem<br />
Wechsel<br />
Wechsel x Alter des neuen Vorstandsvorsitzenden<br />
Wechsel x Unternehmenszugehörigkeit des<br />
neuen Vorstandsvorsitzenden<br />
Wechsel x Ausbildungsrichtung des neuen<br />
Vorstandsvorsitzenden<br />
Wechsel x Amtszeit des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden<br />
Wechsel x Wechsel des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden<br />
in den Aufsichtsrat<br />
0,143 0,132<br />
0,151 0,341<br />
0,198 0,710<br />
0,210 2,316<br />
0,267 4,639 *<br />
0,181 1,147<br />
(* p ≤ 0,05; † p ≤ 0,1)<br />
Abbildung 7: Ergebnisse der ALM-Analysen zu den Moderatoreffekten<br />
Neben den drei signifikanten Moderatoreffekten muss der Effekt der Variable<br />
„Ausbildungsrichtung“ hervorgehoben werden. Dieser Moderator verfehlt<br />
mit einem Signifikanzniveau von p = 0,109 äußerst knapp die Interpretationsgrenze.<br />
Bei einer größeren Stichprobe könnte sich daher auch <strong>für</strong> diese<br />
Variable ein signifikanter Effekt ergeben. Die übrigen vier Variablen weisen<br />
dagegen keinen signifikanten Moderatoreffekt auf. Folglich müssen die Hypothesen<br />
5, 6, 7, 8 <strong>und</strong> 10 abgelehnt werden.<br />
6. Diskussion <strong>und</strong> Interpretation<br />
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, dass ein signifikanter<br />
Zusammenhang zwischen einem Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden<br />
<strong>und</strong> einer Veränderung des Diversifikationsgrads deutscher Großunternehmen<br />
besteht <strong>und</strong> dass die Stärke dieser Veränderung von der Art des<br />
Wechsels abhängt. Damit bestätigt diese Untersuchung weitgehend die Ergebnisse<br />
amerikanischer Studien. Dort haben unter anderem Miller, Tushman/Rosenkopf,<br />
Romanelli/Tushman sowie Lant/Milliken/Batra gezeigt, dass
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 23<br />
ein Wechsel des CEOs strategischen Wandel begünstigt. 57 Wiersema/Bantel<br />
sowie Wiersema haben den Einfluss von Wechseln im gesamten Top Management<br />
Team auf den Diversifikationsgrad amerikanischer Unternehmen gemessen<br />
<strong>und</strong> dabei Veränderungen festgestellt, die in ihrer Größenordnung den in<br />
dieser Untersuchung ermittelten Strategieänderungen entsprechen. 58 Schließlich<br />
hat Wiersema in einer Studie gezeigt, dass Unternehmen, in denen unerwartete<br />
<strong>Führungswechsel</strong> aufgetreten sind, ein besonders hohes Ausmaß strategischen<br />
<strong>und</strong> strukturellen Wandels aufweisen. 59<br />
Aufgr<strong>und</strong> ihrer Signifikanz <strong>und</strong> ihrer Übereinstimmung mit den Resultaten<br />
von Studien aus dem amerikanischen Raum erscheint es lohnenswert, die Ergebnisse<br />
der vorliegenden Untersuchung als Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> eine vertiefte Analyse<br />
des Wechsel-Wandel-Zusammenhangs bei deutschen Unternehmen zu nutzen.<br />
Im Rahmen einer solchen vertieften Analyse sollten vor allem Moderatoreneffekte,<br />
aber auch der Einfluss unterschiedlicher Wechselarten intensiver<br />
beleuchtet werden. Hinsichtlich der Wechselarten wurde in der vorliegenden<br />
Analyse bereits ein signifikanter Unterschied zwischen strategischem Wandel<br />
nach unabwendbaren <strong>und</strong> unfreiwilligen <strong>Führungswechsel</strong>n ermittelt. Für den<br />
freiwilligen Wechsel ergaben sich jedoch keine signifikanten Ergebnisse. Allerdings<br />
ist zu vermuten, dass bereits eine größere Stichprobe an dieser Stelle zu<br />
besseren Ergebnissen führt.<br />
In Bezug auf die Moderatoreneffekte konnten in der vorliegenden Untersuchung<br />
nur drei von acht Hypothesen bestätigt werden. So zeigte sich, dass<br />
das Unternehmensalter, die Unternehmensgröße sowie die Amtszeit des ausscheidenden<br />
Vorstandsvorsitzenden in Verbindung mit dem <strong>Führungswechsel</strong><br />
den erklärbaren Varianzanteil des <strong>Strategiewandel</strong>s deutlich steigerten. Die übrigen<br />
fünf vermuteten Moderatoreffekte haben sich jedoch nicht bestätigt. Daher<br />
sollten zukünftige Studien auch an diesen Punkten ansetzen. Besonders<br />
überraschend ist in diesem Zusammenhang, dass kein Moderatoreffekt des<br />
Unternehmenserfolgs vor dem Wechsel ermittelt werden konnte, obwohl andere<br />
Studien dieser Variablen einen wichtigen Einfluss einräumen. 60 Hier könnten<br />
unter Umständen durch eine andere Operationalisierung dieses Faktors <strong>und</strong><br />
durch eine Bereinigung um Branchen- <strong>und</strong> Jahreseffekte bessere Ergebnisse<br />
erzielt werden. 61<br />
Auch die untersuchten Eigenschaften des neuen Vorstandsvorsitzenden –<br />
sein Alter, seine Unternehmenszugehörigkeit <strong>und</strong> seine Ausbildungsrichtung –<br />
57<br />
58<br />
59<br />
60<br />
61<br />
Vgl. Miller (1993), S. 644 ff.; Tushman/Rosenkopf (1996), S. 939 ff.; Romanelli/Tushman<br />
(1994), S. 1141 ff.; Lant/Milliken/Batra (1992), S. 585 ff.<br />
Vgl. Wiersema/Bantel (1993), S. 485 ff.; Wiersema (1992), S. 73 ff.<br />
Vgl. Wiersema (1995), S. 185 ff.<br />
Vgl. Schrader (1995), S. 185 ff.<br />
Vgl. Salomo (2001), S. 222 ff.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 24<br />
haben keinen signifikanten Moderatoreneffekt ergeben. Diese Ergebnisse müssen<br />
allerdings differenziert betrachtet werden. So resultiert der mangelnde Effekt<br />
des Alters vor allem daraus, dass das durchschnittliche Alter von Vorstandsvorsitzenden<br />
zum Zeitpunkt ihrer Berufung – in der Stichprobe <strong>und</strong><br />
wohl auch darüber hinaus – relativ homogen ist. Das Alter scheint daher eher<br />
als Moderatorvariable bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen<br />
Veränderungen im gesamten Vorstand <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> relevant, nicht jedoch<br />
bezogen auf den Vorstandsvorsitzenden. 62<br />
Der mangelnde Moderatoreffekt der zweiten untersuchten Eigenschaft des<br />
neuen Vorstandsvorsitzenden – seiner Unternehmenszugehörigkeit – ist dagegen<br />
nicht darauf zurückzuführen, dass kein Zusammenhang zwischen dieser<br />
Variablen <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> besteht. Vielmehr zeigt eine Korrelationsanalyse<br />
eine signifikante negative Beziehung zwischen den Variablen Unternehmenszugehörigkeit<br />
<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> (r = - 0,383; p ≤ 0,01), d.h. eine lange Unternehmenszugehörigkeit<br />
steht <strong>Strategiewandel</strong> entgegen. 63 Die Tatsache, dass sich<br />
der Moderatoreffekt nicht durchsetzen kann, resultiert daher eher aus der mangelnden<br />
Effektstärke der Unternehmenszugehörigkeit im Vergleich zum Konstrukt<br />
<strong>Führungswechsel</strong>. Hambrick et al. schlagen daher vor, anstelle der Unternehmenszugehörigkeit<br />
eher die Branchenzugehörigkeit als Moderator in die<br />
Analyse strategischer Auswirkungen von <strong>Führungswechsel</strong>n einzubeziehen. 64<br />
Im Falle der „Ausbildungsrichtung“ des neuen Vorstandsvorsitzenden schließlich<br />
ließen die Analysen keine eindeutige Aussage über die Existenz eines Moderatoreffekts<br />
zu, da das Signifikanzniveau knapp die Interpretationsgrenze<br />
verfehlte. Bei diesem Moderator könnte bereits eine größere Stichprobe zu<br />
besseren Ergebnissen führen.<br />
In Bezug auf den ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden konnte der vermutete<br />
Moderatoreffekt des Wechsels in den Aufsichtsrat nicht bestätigt werden.<br />
Ähnlich wie bei der Variable Unternehmenszugehörigkeit des neuen Vorstandsvorsitzenden<br />
ist dieser mangelnde Effekt nicht darauf zurückzuführen,<br />
dass keine Beziehung zwischen Wechsel in den Aufsichtsrat <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />
besteht. Vielmehr ist auch hier ein signifikanter negativer Zusammenhang<br />
beobachtbar (r = - 0,297; p ≤ 0,05), d.h. Strategieveränderungen treten weniger<br />
stark auf, wenn der ehemalige Vorstandsvorsitzende in den Aufsichtsrat wechselt.<br />
Wiederum ist jedoch die Effektstärke des Wechsels in den Aufsichtsrat im<br />
Vergleich zum Konstrukt <strong>Führungswechsel</strong> zu gering.<br />
62<br />
63<br />
64<br />
Vgl. Grimm/Smith (1991), S. 559 ff.; Hitt/Tyler (1991), S. 336 ff.<br />
Vgl. Finkelstein/Hambrick (1996), S. 85; Stevens/Beyer/Trice (1978), S. 388;<br />
Schmidt/Posner (1983), S. 14 f.<br />
Vgl. Hambrick/Geletkanycz/Fredrickson (1993), S. 404 ff.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 25<br />
7. Ausblick<br />
Insgesamt hat die vorliegende Untersuchung einige wichtige Ergebnisse<br />
zum Zusammenhang zwischen einem Wechsel an der Unternehmensspitze <strong>und</strong><br />
dem <strong>Strategiewandel</strong> in deutschen Großunternehmen hervor gebracht. Tiefer<br />
gehende Analysen zu Wechselarten <strong>und</strong> insbesondere zu Kontingenzfaktoren<br />
des <strong>Führungswechsel</strong>s sind jedoch notwendig, um ein noch besseres Verständnis<br />
dieses wichtigen empirischen Phänomens zu entwickeln.<br />
Neben einer Vertiefung der Forschung zum Wechsel-Wandel-Zusammenhang<br />
lassen sich aus der vorliegenden Untersuchung auch Anstöße <strong>für</strong><br />
weitergehende Forschungsanstrengungen ableiten. So scheinen die Ergebnisse<br />
dieser Studie zum einen die Annahme des „punctuated equilibrium“-Ansatzes<br />
zu bestätigen, dass strategischer Wandel in Unternehmen nicht kontinuierlich<br />
sondern eher punktuell stattfindet <strong>und</strong> dass das Anstoßen von Wandel herausragende<br />
Ereignisse erfordert, durch die Unternehmensträgheit <strong>und</strong> interne Widerstände<br />
überw<strong>und</strong>en werden. Ein Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden<br />
stellt – den Ergebnissen dieser Untersuchung zufolge – ein solches<br />
herausragendes Ereignis dar. In der Tat kann eine Neubesetzung der zentralen<br />
Führungsposition eines Unternehmens als Symbol interpretiert werden, das von<br />
Mitarbeitern <strong>und</strong> Führungskräften des Unternehmens mit Veränderung oder<br />
dem Beginn einer neuen Ära in Verbindung gebracht wird <strong>und</strong> so die prinzipiell<br />
vorhandene Trägheit von Unternehmen vermindert. Diese Symbolfunktion<br />
eines <strong>Führungswechsel</strong>s wird tendenziell stärker sein, wenn der Vorstandsvorsitzende<br />
unfreiwillig aus dem Amt scheidet. Um diese Vermutungen zu bestätigen,<br />
ist es jedoch nicht ausreichend, nur Strategieänderungen im Umfeld eines<br />
<strong>Führungswechsel</strong>s zu untersuchen, wie in der vorliegenden Studie geschehen.<br />
Vielmehr muss in diesem Fall ebenfalls analysiert werden, ob <strong>und</strong> in welchem<br />
Umfang strategischer Wandel auch im Laufe der Amtszeit von Vorstandsvorsitzenden<br />
auftritt <strong>und</strong> ob der im Rahmen von <strong>Führungswechsel</strong>n festgestellte<br />
strategische Wandel von einer generell im gleichen Zeitraum bei anderen Unternehmen<br />
zu beobachtenden Strategieänderung abweicht.<br />
Ein zweiter Anstoß <strong>für</strong> weitergehende Forschungsanstrengungen, der sich<br />
aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung ableiten lässt, betrifft die<br />
Rolle des Vorstandsvorsitzenden. So deutet der signifikante Zusammenhang,<br />
der zwischen einem Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden <strong>und</strong><br />
dem <strong>Strategiewandel</strong> ermittelt worden ist, darauf hin, dass Vorstandsvorsitzende<br />
tatsächlich eine herausragende Position innerhalb des Vorstands einnehmen<br />
<strong>und</strong> strategische Entscheidungen wesentlich beeinflussen. Darüber hinaus stützen<br />
die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung die Vermutung, dass neue<br />
Vorstandsvorsitzende mit zwar in der Regel nicht revolutionären, aber doch<br />
sichtbaren Strategieänderungen dem Unternehmen „ihren Stempel aufdrücken“.<br />
Zur Bestätigung dieser Vermutungen wäre es jedoch notwendig, neben
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 26<br />
dem Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden auch Auswirkungen<br />
von Veränderungen in anderen Vorstandspositionen zu analysieren. Darüber<br />
hinaus müsste eine kausale Beziehung zwischen dem Wechsel des Vorstandsvorsitzenden<br />
<strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> nachgewiesen werden. 65 Da<strong>für</strong> scheinen vor<br />
allem qualitative Forschungsmethoden wie z.B. Tiefeninterviews geeignet.<br />
Insgesamt verdeutlicht diese Darstellung möglicher weiterer Forschungsfelder,<br />
dass die Themen <strong>Führungswechsel</strong>, Spitzenführungskräfte <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />
noch erhebliches Potenzial <strong>für</strong> künftige Forschung bieten, die auch<br />
<strong>für</strong> die Praxis wichtige <strong>und</strong> interessante Erkenntnisse bringen kann.<br />
65<br />
So kann aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie nicht abgeleitet werden,<br />
dass der beobachtete strategische Wandel durch den neuen Vorstandsvorsitzenden<br />
initiiert worden ist. Vielmehr ist genauso denkbar, dass der neue Vorstandsvorsitzende<br />
lediglich berufen worden ist, weil ihm mehr als seinem Vorgänger zugetraut<br />
wird, eine bereits vorher beschlossene Strategieänderung auch umzusetzen.<br />
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen lediglich einen Zusammenhang<br />
zwischen einem Wechsel in der Person des Vorstandsvorsitzenden <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong><br />
auf, erlauben jedoch - wie alle derartigen Untersuchungen - keine<br />
Aussagen zu Kausalzusammenhängen zwischen den Variablen.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 27<br />
Anhang<br />
Unternehmen <strong>und</strong> Wechselzeitpunkte<br />
Unternehmen<br />
Wechselzeitpunkt<br />
Analysezeitraum ∆ Entropiemaß<br />
adidas AG 1993 1991-1995 0,130<br />
Axel Springer Verlag AG 1991 1989-1993 0,090<br />
Axel Springer Verlag AG 1994 1992-1996 0,065<br />
Axel Springer Verlag AG 1998 1996-2000 0,245<br />
BASF AG 1990 1988-1992 0,061<br />
Bayer AG 1992 1990-1994 0,029<br />
Beierdorf AG 1994 1992-1996 0,029<br />
Bertelsmann AG 1998 1996-2000 0,481<br />
Bilfinger + Berger AG 1999 1997-2001 0,105<br />
BMW AG 1993 1991-1995 0,063<br />
BMW AG 1999 1997-2001 0,182<br />
Continental AG 1991 1989-1993 0,118<br />
Continental AG 1999 1997-2001 0,166<br />
Daimler-Chrysler AG 1995 1993-1997 0,137<br />
Deutsche Bahn AG 1997 1995-1999 0,286<br />
Deutsche Bahn AG 1999 1997-2001 0,172<br />
Deutsche Babcock AG 1990 1988-1992 0,179<br />
Deutsche Babcock AG 1997 1995-1999 0,281<br />
Deutsche Telekom AG 1995 1993-1997 0,201<br />
Franz Haniel & Cie.<br />
GmbH<br />
1993 1991-1995 0,328<br />
Fresenius AG 1992 1990-1994 0,179<br />
Heidelberger Zement AG 1995 1993-1997 0,189<br />
Henkel KgaA 1992 1990-1994 0,042<br />
Henkel KgaA 2000 1998-2002 0,195<br />
Hoechst AG 1994 1992-1996 0,083<br />
Karstadt-Quelle AG 2000 1998-2002 0,422<br />
Linde AG 1997 1995-1999 0,044<br />
Lufthansa AG 1991 1989-1993 0,068<br />
MAN AG 1996 1994-1998 0,011
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 28<br />
Unternehmen<br />
Wechselzeitpunkt<br />
Analysezeitraum ∆ Entropiemaß<br />
Mannesmann AG 1994 1992-1996 0,097<br />
Merck KgaA 2000 1998-2002 0,071<br />
Metro AG 1999 1997-2001 0,645<br />
mg technologies ag 1993 1991-1995 0,595<br />
Philipp Holzmann AG 1992 1990-1994 0,287<br />
Philipp Holzmann AG 1997 1995-1999 0,188<br />
Philipp Holzmann AG 1999 1997-2000 0,325<br />
Porsche AG 1990 1988-1992 0,076<br />
Porsche AG 1992 1990-1994 0,126<br />
Preussag AG 1994 1992-1996 0,032<br />
RAG AG 1995 1993-1997 0,533<br />
RAG AG 2000 1998-2002 0,047<br />
Robert Bosch GmbH 1993 1991-1995 0,087<br />
Ruhrgas AG 1996 1994-1998 0,040<br />
RWE AG 1995 1993-1997 0,085<br />
Salzgitter AG 2000 1998-2002 0,488<br />
SAP AG 1998 1996-2000 0,041<br />
Siemens AG 1992 1990-1994 0,020<br />
Strabag AG 1991 1989-1993 0,203<br />
Strabag AG 1997 1995-1999 0,417<br />
Südzucker AG 1995 1993-1997 0,064<br />
Thyssen AG 1991 1989-1993 0,329<br />
Thyssen AG 1996 1996-1998 0,004<br />
Veba AG 66 1993 1991-1995 0,014<br />
Viag AG 1995 1993-1997 0,043<br />
Viag AG 1998 1996-1999 0,350<br />
Voith AG 2000 1998-2002 0,127<br />
Volkswagen AG 1993 1991-1995 0,141<br />
Wella AG 2000 1998-2002 0,034<br />
66<br />
Die Unternehmen Viag AG <strong>und</strong> Veba AG, die erst im Jahr 2000 zur E.O.N AG<br />
verschmolzen waren, wurden aufgr<strong>und</strong> ihrer Größe in den Jahren zuvor berücksichtigt.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 29<br />
Literaturverzeichnis<br />
Andrews, K. (1971): The Concept of Corporate Strategy, Homewood 1971.<br />
Bluedorn, A. (1982): The Theories of Turnover: Causes, Effects, and Meaning,<br />
in: Research in the Sociology of Organizations, 1. Jg. 1982, S. 75-128.<br />
Bortz, J. (1989): Statistik <strong>für</strong> Sozialwissenschaftler, 3. Aufl., Berlin 1989.<br />
Carlsson, G., Karlsson, K. (1970): Age, Cohorts and the Generation of Generations,<br />
in: American Sociological Review, 35. Jg. 1970, S. 710-718.<br />
Chandler, A. (1962): Strategy and Structure: Chapters in the History of the<br />
American Industrial Enterprise, Cambridge 1962.<br />
Child, J. (1972): Organizational Structure, Environment and Performance: The<br />
Role of Strategic Choice, in: Sociology, 6. Jg. 1972, S. 1-22.<br />
Child, J. (1974): Managerial and Organizational Factors associated with Company<br />
Performance, in: The Journal of Management Studies, 11. Jg. 1974,<br />
S. 175-189.<br />
Coenenberg, A. (1994): Jahresabschluss <strong>und</strong> Jahresabschlussanalyse: betriebswirtschaftliche,<br />
handels- <strong>und</strong> steuerrechtliche Gr<strong>und</strong>lagen, 15. Aufl.,<br />
Landsberg/Lech 1994.<br />
Diehl, J., Staufenbiehl, T. (2002): Statistik mit SPSS, Eschborn 2002.<br />
Donaldson, G., Lorsch, J. (1983): Decision Making at the Top, New York<br />
1983.<br />
Eckey, H.-F., Kosfeld, R., Rengers, M. (2002): Multivariate Statistik, Wiesbaden<br />
2002.<br />
Finkelstein, S., Hambrick, D. (1996): Strategic Leadership: Top Executives and<br />
their Effect on Organizations, St. Paul 1996.<br />
Fondas, N., Wiersema, M. (1997): Changing of the Guard: The Influence of<br />
CEO Socialization on Strategic Change, in: Journal of Management<br />
Studies, 34. Jg. 1997, S. 561-584.<br />
Friedman, S., Singh, H. (1989): CEO Succession and Stockholder Reaction:<br />
The Influence of Organizational Context and Event Content, in: Academy<br />
of Management Journal, 32. Jg. 1989, S. 718-744.<br />
Gabarro, J. (1988): Executive Leadership and Succession: The Process of Taking<br />
Charge, in: The Executive Effect: Concepts and Methods for Studying<br />
Top Managers, Hrsg. D. Hambrick, London 1988, S. 237-268.<br />
Golden, B., Zajac, E. (2001): When will Boards influence Strategy? Inclination x<br />
Power = Strategic Change, in: Strategic Management Journal, 22. Jg.<br />
2001, S. 1087-1111.<br />
Goodstein, J., Boeker, W. (1991): Turbulence at the Top: A new Perspective on<br />
Governance Structure Changes and Strategic Change, in: Academy of<br />
Management Journal, 34. Jg. 1991, S. 306-330.<br />
Goodstein, J., Gautam, K., Boeker, W. (1994): Research Notes and Communications:<br />
The Effect of Board Size and Diversity on Strategic Change, in:<br />
Strategic Management Journal, 15. Jg. 1994, S. 241-250.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 30<br />
Grimm, C., Smith, K. (1991): Research Notes and Communications: Management<br />
and Organizational Change: A Note on the Railroad Industry, in:<br />
Strategic Management Journal, 12. Jg. 1991, S. 557-562.<br />
Gupta, A. (1988): Contingency Perspectives on Strategic Leadership: Current<br />
Knowledge and Future Research Directions, in: The Executive Effect:<br />
Concepts and Methods for Studying Top Managers, Hrsg. D. Hambrick,<br />
London 1988, S. 147-178.<br />
Gutenberg, E. (1962): Unternehmensführung – Organisation <strong>und</strong> Entscheidung,<br />
Wiesbaden 1962.<br />
Hambrick, D., Finkelstein, S. (1987): Managerial Discretion: A Bridge between<br />
Polar Views of Organizational Outcomes, in: Research in Organizational<br />
Behaviour, 9. Jg. 1987, S. 369-406.<br />
Hambrick, D., Fukutomi, G. (1991): The Seasons of a CEO`s Tenure, in:<br />
Academy of Management Review, 16. Jg. 1991, S. 719-742.<br />
Hambrick, D., Geletkanycz, M., Fredrickson, J. (1993): Top Executive Commitment<br />
to the Status Quo: Some Tests of its Determinants, in: Strategic<br />
Management Journal, 14. Jg. 1993, S. 401-418.<br />
Hambrick, M., Mason, P. (1984): Upper Echelons: The Organization as a Reflection<br />
of its Top Managers, in: Academy of Management Review, 9. Jg.<br />
1984, S. 193-206.<br />
Hannan, M., Freeman, J. (1984): Structural Inertia and Organizational Change,<br />
in: American Sociological Review, 49. Jg. 1984, S. 149-164.<br />
Haveman, H. (1993): Organizational Size and Change: Diversification in the<br />
Savings and Loan Industry after Deregulation, in: Administrative Science<br />
Quarterly, 17. Jg. 1993, S. 20-50.<br />
Hitt, M., Tyler, B. (1991): Strategic Decision Models: Integrating different Perspectives,<br />
in: Strategic Management Journal, 12. Jg. 1991, S. 327-351.<br />
Holland, J. (1985): Making vocational Choices, 2. Aufl., Englewood Cliffs 1985.<br />
Jaquemin, A., Berry, C. (1979): Entropy Measure of Diversification and Corporate<br />
Growth, in: The Journal of Industrial Economics, 27. Jg. 1979, S.<br />
359-369.<br />
Kesner, I., Sebora, T. (1994): Executive Succession: Past, Present & Future, in:<br />
Journal of Management, 20. Jg. 1994, S. 327-372.<br />
Lant, T., Milliken, F., Batra, B. (1992): The Role of Managerial Learning and<br />
Interpretation in Strategic Persistence and Reorientation: An Empirical<br />
Exploration, in: Strategic Management Journal, 13. Jg. 1992, S. 585-608.<br />
Leker, J., Salomo, S. (1998): Die Veränderung der wirtschaftlichen Lage im<br />
Verlauf eines Wechsels an der Unternehmensspitze, in: Zeitschrift <strong>für</strong><br />
betriebswirtschaftliche Forschung, 50. Jg. 1998, S. 156-177.<br />
Miller, D. (1991): Stale in the Saddle: CEO Tenure and the Match between<br />
Organization and Environment, in: Management Science, 37. Jg. 1991, S.<br />
34-52.<br />
Miller, D. (1993): Some Organizational Consequences of CEO Succession, in:<br />
Academy of Management Journal, 36. Jg. 1993, S. 644-659.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 31<br />
Miller, D., Dröge, C. (1986): Psychological and Traditional Determinants of<br />
Structure, in: Administrative Science Quarterly, 31. Jg. 1986, S. 539-560.<br />
Miller, D., Friesen, P. (1980): Momentum and Revolution in Organizational<br />
Adaptation, in: Academy of Management Journal, 23. Jg. 1980, S. 591-<br />
614.<br />
Mintzberg, H. (1978): Patterns in Strategy Formation, in: Management Science,<br />
24. Jg. 1978, S. 934-948.<br />
Mintzberg, H. (1979): The Structuring of Organizations, 2. Aufl., Englewood<br />
Cliffs 1979.<br />
Mintzberg, H., Ahlstrand, B, Lampel, J. (1998): Strategy Safari, London 1998.<br />
Occasio, W. (1993): The Structuring of Organizational Attention and the Enactment<br />
of Economic Adversity: A Reconciliation of Theories of Failure-induced<br />
Change and Threat-Rigidity, Working Paper, Sloan School<br />
of Management, Cambridge 1993.<br />
o.V. (2002): Rangliste der TOP 500 deutscher Unternehmen, in: DIE WELT,<br />
http://www.welt.de/extra/ra.../500_2001.php?anfang=1&von=1&bis=<br />
200&limit=50&zur=1, 08.08.2003.<br />
o.V. (2003): Munzinger Online, Infobase Personen,<br />
http://www.munzinger.de/lpBin/lpExt.dll?f=templates&fn=magazin.ht<br />
ml, 04.2003.<br />
Oesterle, M.-J. (1999): <strong>Führungswechsel</strong> im Top-Management, Wiesbaden<br />
1999.<br />
Pitcher, P., Chreim, S., Kisfalvi, V. (2000): CEO Succession Research: Methodological<br />
Bridges over Troubled Waters, in: Strategic Management<br />
Journal, 21. Jg. 2000, S. 625-648.<br />
Poensgen, O. (1982a): Der Weg in den Vorstand: Die Charakteristiken der<br />
Vorstandsmitglieder der Aktiengesellschaften des verarbeitenden Gewerbes,<br />
in: Die Betriebswirtschaft, 42. Jg. 1982, S. 3-25.<br />
Poensgen, O. (1982b): Fluktuation, Amtszeit <strong>und</strong> weitere Karriere von Vorstandsmitgliedern,<br />
in: Die Betriebswirtschaft, 42. Jg. 1982, S. 177-195.<br />
Romanelli, E., Tushman, M. (1994): Organizational Transformatin as Punctuated<br />
Equilibrium: An Empirical Test, in: Academy of Management Journal,<br />
37. Jg. 1994, S. 1141-1166.<br />
Salomo, S. (2001): Wechsel der Spitzenführungskraft <strong>und</strong> Unternehmenserfolg,<br />
Berlin 2001.<br />
Schmidt, W., Posner, B. (1983): Managerial Values in Perspektive, New York<br />
1983.<br />
Schrader, S. (1995): Spitzenführungskräfte, Unternehmensstrategie <strong>und</strong> Unternehmenserfolg,<br />
Tübingen 1995.<br />
Schrader, S., Lüthje, C. (1995): Das Ausscheiden der Spitzenführungskraft aus<br />
dem Unternehmen: Eine empirische Analyse, in: Zeitschrift <strong>für</strong> Betriebswirtschaft,<br />
65. Jg. 1995, S. 467-492.
<strong>Führungswechsel</strong> <strong>und</strong> <strong>Strategiewandel</strong> 32<br />
Stevens, J., Beyer, J., Trice, H. (1978): Assessing Personal, Role, and Organizational<br />
Predictors of Managerial Commitment, in: Academy of Management<br />
Journal, 21. Jg. 1978, S. 380-396.<br />
Tihanyi, L., Ellstrand, A., Daily, C., Dalton, D. (2000): Composition of the Top<br />
Management Team and Firm International Diversification, in: Journal of<br />
Management, 26. Jg. 2000, S. 1157-1177.<br />
Thomas, A., Litschert, R., Ramaswamy, K. (1991): The Performance Impact of<br />
Strategy – Manager Coalignment: An Empirical Examination, in: Strategic<br />
Management Journal, 12. Jg. 1991, S. 509-522.<br />
Tushman, M., Romanelli, E. (1985): Organizational Evolution: A Metamorphosis<br />
Model of Convergence and Reorientation, in: Research in Organizational<br />
Behavior, 7. Jg. 1985, S. 171-222.<br />
Tushman, M., Rosenkopf, L. (1996): Executive Succession, Strategic Reorientation<br />
and Performance Growth: A longitudinal study in the U.S. Cement<br />
Industry, in: Management Science, 42 Jg. 1992, S. 939-953.<br />
Tushman, M., Newman, W., Romanelli, E. (1991): Convergence and Upheaval:<br />
Managing the Unsteady Pace of Organizational Evolution, in: The Strategy<br />
Process, Hrsg. H. Mintzberg, B. Quinn, 2. Aufl., Englewood Cliffs<br />
1991, S. 778-785.<br />
Tushman, M., Virany, B., Romanelli, E. (1985): Executive Succession, Strategic<br />
Reorientations, and Organizational Evolution: The Minicomputer Industry<br />
as a Case in Point, in: Technology in Society, 7. Jg. 1985, S. 297-313.<br />
Virany, B., Tushman, M., Romanelli, E. (1985): A longitudinal Study on Determinants<br />
of Executive Succession, Working Paper, Columbia University<br />
1985.<br />
Virany, B., Tushman, M., Romanelli, E. (1992): Executive Succession and organization<br />
Outcomes in Turbulent Environments: An Organizational<br />
Learning Approach, in: Organization Science, 3. Jg. 1992, S. 72-91.<br />
Westphal, J., Fredrickson, J. (2001): Who directs Strategic Change? Director<br />
Experience, the Selection of new CEOs, and Change in Corporate Strategy,<br />
in: Strategic Management Journal, 22. Jg. 2001, S. 1113-1137.<br />
Wiersema, M. (1992): Strategic Consequences of Executive Succession within<br />
diversified Firms, in: Journal of Management Studies, 29. Jg. 1992, S. 73-<br />
94.<br />
Wiersema, M. (1995): Executive Succession as an Antecedent to Corporate<br />
Restructuring, in: Human Resource Management, 34. Jg. 1995, S. 185-<br />
202.<br />
Wiersema, M., Bantel, K. (1992): Top Management Team Demography and<br />
Corporate Strategic Change, in: Academy of Management Journal, 35. Jg.<br />
1992, S. 91-121.<br />
Wiersema, M., Bantel, K. (1993): Top Management Team Turnover as an Adaptation<br />
Mechanism: The Role of the Environment, in: Strategic Management<br />
Journal, 14. Jg. 1993, S. 485-504.
Institut <strong>für</strong> Unternehmungsplanung<br />
Gießen<br />
Licher Straße 62<br />
D-35394 Gießen<br />
Deutschland<br />
Tel.: + 49 - (0)641/ 47 64 0<br />
Fax: + 49 - (0)641/ 49 35 07<br />
E-mail: giessen@iup-online.de<br />
Institut <strong>für</strong> Unternehmungsplanung<br />
Berlin<br />
Sekretariat HAD 30<br />
Hardenbergstraße 4 - 5<br />
D-10623 Berlin<br />
Tel.: + 49 - (0)30/ 314 22846<br />
Fax: + 49 - (0)30/ 314 79449<br />
E-mail: berlin@iup-online.de<br />
Ansprechpartner <strong>für</strong> die<br />
Weiterbildungsangebote des IUP:<br />
Institut <strong>für</strong> Unternehmungsplanung Gießen/ Berlin<br />
Prof. Dr. Harald Hungenberg<br />
<strong>Lehrstuhl</strong> <strong>für</strong> Unternehmungsführung<br />
Universität Erlangen-Nürnberg<br />
Lange Gasse 20<br />
D-90403 Nürnberg<br />
Tel.: + 49 - (0)911/ 5302 314<br />
Fax: + 49 - (0)911/ 5302 474<br />
E-mail: bildung@iup-online.de<br />
http://www.iup-online.de