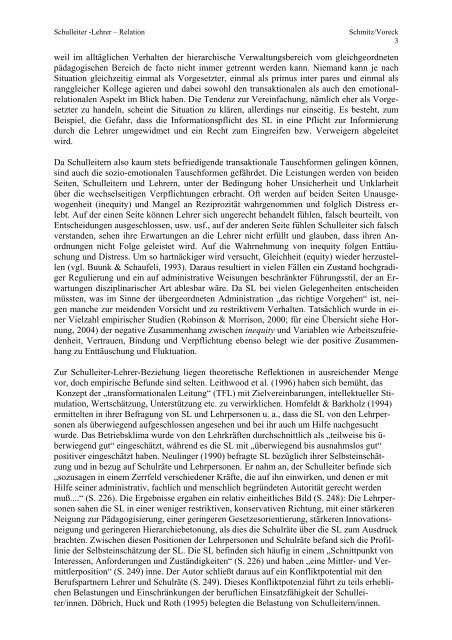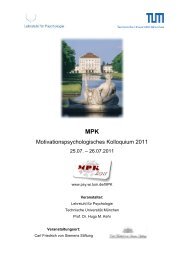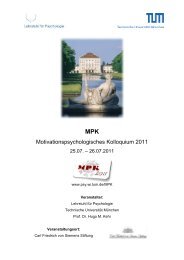Schulleiter - Technische Universität München
Schulleiter - Technische Universität München
Schulleiter - Technische Universität München
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Schulleiter</strong> -Lehrer – Relation<br />
Schmitz/Voreck<br />
3<br />
weil im alltäglichen Verhalten der hierarchische Verwaltungsbereich vom gleichgeordneten<br />
pädagogischen Bereich de facto nicht immer getrennt werden kann. Niemand kann je nach<br />
Situation gleichzeitig einmal als Vorgesetzter, einmal als primus inter pares und einmal als<br />
ranggleicher Kollege agieren und dabei sowohl den transaktionalen als auch den emotionalrelationalen<br />
Aspekt im Blick haben. Die Tendenz zur Vereinfachung, nämlich eher als Vorgesetzter<br />
zu handeln, scheint die Situation zu klären, allerdings nur einseitig. Es besteht, zum<br />
Beispiel, die Gefahr, dass die Informationspflicht des SL in eine Pflicht zur Informierung<br />
durch die Lehrer umgewidmet und ein Recht zum Eingreifen bzw. Verweigern abgeleitet<br />
wird.<br />
Da <strong>Schulleiter</strong>n also kaum stets befriedigende transaktionale Tauschformen gelingen können,<br />
sind auch die sozio-emotionalen Tauschformen gefährdet. Die Leistungen werden von beiden<br />
Seiten, <strong>Schulleiter</strong>n und Lehrern, unter der Bedingung hoher Unsicherheit und Unklarheit<br />
über die wechselseitigen Verpflichtungen erbracht. Oft werden auf beiden Seiten Unausgewogenheit<br />
(inequity) und Mangel an Reziprozität wahrgenommen und folglich Distress erlebt.<br />
Auf der einen Seite können Lehrer sich ungerecht behandelt fühlen, falsch beurteilt, von<br />
Entscheidungen ausgeschlossen, usw. usf., auf der anderen Seite fühlen <strong>Schulleiter</strong> sich falsch<br />
verstanden, sehen ihre Erwartungen an die Lehrer nicht erfüllt und glauben, dass ihren Anordnungen<br />
nicht Folge geleistet wird. Auf die Wahrnehmung von inequity folgen Enttäuschung<br />
und Distress. Um so hartnäckiger wird versucht, Gleichheit (equity) wieder herzustellen<br />
(vgl. Buunk & Schaufeli, 1993). Daraus resultiert in vielen Fällen ein Zustand hochgradiger<br />
Regulierung und ein auf administrative Weisungen beschränkter Führungsstil, der an Erwartungen<br />
disziplinarischer Art ablesbar wäre. Da SL bei vielen Gelegenheiten entscheiden<br />
müssten, was im Sinne der übergeordneten Administration „das richtige Vorgehen“ ist, neigen<br />
manche zur meidenden Vorsicht und zu restriktivem Verhalten. Tatsächlich wurde in einer<br />
Vielzahl empirischer Studien (Robinson & Morrison, 2000; für eine Übersicht siehe Hornung,<br />
2004) der negative Zusammenhang zwischen inequity und Variablen wie Arbeitszufriedenheit,<br />
Vertrauen, Bindung und Verpflichtung ebenso belegt wie der positive Zusammenhang<br />
zu Enttäuschung und Fluktuation.<br />
Zur <strong>Schulleiter</strong>-Lehrer-Beziehung liegen theoretische Reflektionen in ausreichender Menge<br />
vor, doch empirische Befunde sind selten. Leithwood et al. (1996) haben sich bemüht, das<br />
Konzept der „transformationalen Leitung“ (TFL) mit Zielvereinbarungen, intellektueller Stimulation,<br />
Wertschätzung, Unterstützung etc. zu verwirklichen. Homfeldt & Barkholz (1994)<br />
ermittelten in ihrer Befragung von SL und Lehrpersonen u. a., dass die SL von den Lehrpersonen<br />
als überwiegend aufgeschlossen angesehen und bei ihr auch um Hilfe nachgesucht<br />
wurde. Das Betriebsklima wurde von den Lehrkräften durchschnittlich als „teilweise bis ü-<br />
berwiegend gut“ eingeschätzt, während es die SL mit „überwiegend bis ausnahmslos gut“<br />
positiver eingeschätzt haben. Neulinger (1990) befragte SL bezüglich ihrer Selbsteinschätzung<br />
und in bezug auf Schulräte und Lehrpersonen. Er nahm an, der <strong>Schulleiter</strong> befinde sich<br />
„sozusagen in einem Zerrfeld verschiedener Kräfte, die auf ihn einwirken, und denen er mit<br />
Hilfe seiner administrativ, fachlich und menschlich begründeten Autorität gerecht werden<br />
muß....“ (S. 226). Die Ergebnisse ergaben ein relativ einheitliches Bild (S. 248): Die Lehrpersonen<br />
sahen die SL in einer weniger restriktiven, konservativen Richtung, mit einer stärkeren<br />
Neigung zur Pädagogisierung, einer geringeren Gesetzesorientierung, stärkeren Innovationsneigung<br />
und geringeren Hierarchiebetonung, als dies die Schulräte über die SL zum Ausdruck<br />
brachten. Zwischen diesen Positionen der Lehrpersonen und Schulräte befand sich die Profillinie<br />
der Selbsteinschätzung der SL. Die SL befinden sich häufig in einem „Schnittpunkt von<br />
Interessen, Anforderungen und Zuständigkeiten“ (S. 226) und haben „eine Mittler- und Vermittlerposition“<br />
(S. 249) inne. Der Autor schließt daraus auf ein Konfliktpotential mit den<br />
Berufspartnern Lehrer und Schulräte (S. 249). Dieses Konfliktpotenzial führt zu teils erheblichen<br />
Belastungen und Einschränkungen der beruflichen Einsatzfähigkeit der <strong>Schulleiter</strong>/innen.<br />
Döbrich, Huck und Roth (1995) belegten die Belastung von <strong>Schulleiter</strong>n/innen.