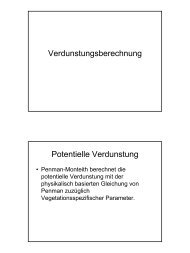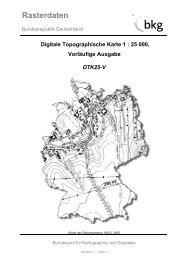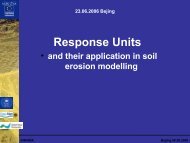Kurzbericht zum Projekt 07/2007 Entwicklung meteorologisch ...
Kurzbericht zum Projekt 07/2007 Entwicklung meteorologisch ...
Kurzbericht zum Projekt 07/2007 Entwicklung meteorologisch ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
(5), ‚Grünland’ (6), ‚Busch/ Strauch’ (7), ‚Wald/Forst’ (8) und ‚Gewässer’ (9). Durch<br />
die Reduzierung der Anzahl der FNK wird das eingangs erwähnte Konzept der Klimatope<br />
<strong>zum</strong> Konzept der Arealtypen erweitert. Während ein Klimatop die Ausprägung<br />
der atmosphärischen Grenzschicht über genau einer Flächennutzung<br />
beschreibt, können in einem Arealtyp neben einer vorherrschenden Flächennutzung<br />
untergeordnete Nutzungen auftreten. Dieser Ansatz ist auf der Maßstabsebene der<br />
Regionalplanung (1:50.000...100.000) wirklichkeitsnäher und vereinfacht zusätzlich<br />
die Verfahrenshandhabung. Die einzelnen FNK werden bzgl. ihrer Klimawirksamkeiten<br />
ausführlich dargestellt und zusätzlich tabellarisch charakterisiert bzgl. ihrer<br />
spezifischen klimatischen, lufthygienischen und bioklimatischen Wirksamkeiten (z. B.<br />
Kaltluftproduktion, Staubbindung, lufthygienische Einschätzung, Gesamteinschätzung).<br />
So wird dem Anwender ein schneller Überblick ermöglicht.<br />
Die Verdunstung wird in sechs Klassen (VK) von je 25 mm Spannweite der Verdunstungshöhe<br />
eingeteilt und jeder VK eine Ziffer (1...6) zugeordnet. Dabei muss<br />
beachtet werden, dass nicht alle FNK durch dieselbe VK in gleicher Weise auf- oder<br />
abgewertet werden. Zum Beispiel werden urbane FNK durch hohe VK wegen geringerer<br />
Überwärmungsgefahr bioklimatisch aufgewertet. Dagegen setzt eine hohe<br />
Verdunstung die Kaltluftproduktivität naturnäherer FKN herab.<br />
Die letzte Stelle im Wertetripel wird durch das Relief bestimmt. Dieses wurde in die<br />
zwei Geländeformklassen (GFK) ‚Senke’ (1) und ‚Hang/Scheitel’ (2) unterteilt und<br />
dient der Einschätzung der Kaltluftdynamik. An dieser Stelle ist das Bewertungsverfahren<br />
nicht automatisiert. Vielmehr ist der Planer gefordert, anhand seines Kartenmaterials<br />
und zweier Tabellen <strong>zum</strong> Einen die Kaltluftdynamik zu bewerten und <strong>zum</strong><br />
Anderen die Wirkung der Kaltluft in potenziellen Akkumulationsgebieten einzuschätzen.<br />
Dazu stehen ihm Angaben über die Größe möglicher Kaltlufteinzugsgebiete und<br />
die Beschaffenheit der Kaltluftleitbahn (Hangneigung, -querprofil, -länge) sowie über<br />
Klimate unterschiedlicher, im mitteleuropäischen Raum auftretender konkaver<br />
Reliefformen zur Verfügung.<br />
Das Bewertungsverfahren wurde in mehreren Auflösungen (1 km, 500 m, 200 m,<br />
100 m und 50 m) auf zwei Untersuchungsgebiete angewendet, die exemplarisch für<br />
die Landschaftsvielfalt Thüringens stehen. Dabei wurde u. a. deutlich, dass verschiedene<br />
Naturraumausstattungen und Flächennutzungsstrukturen unterschiedliche<br />
Auflösungsoptima bedingen.<br />
Das Untersuchungsgebiet 1 (UG1) liegt im Thüringer Becken im Raum Sömmerda<br />
und stellt einen stark ländlich geprägten, kaum reliefierten Raum dar. Kaltluftdynamiken<br />
spielen daher kaum eine Rolle. Auswertungen verschiedener Rasterauflösungen<br />
ergaben, dass eine Kantenlänge von ca. 100 m eine ausreichend detaillierte Ergebniskarte<br />
erbringt, um die Klimawirksamkeit des Raumes zu untersuchen (s. Abb. 1).<br />
Mit dem Untersuchungsgebiet 2 (UG 2) wurden Reliefeinflüsse auf die Klimawirksamkeit<br />
von Flächen gezeigt. Das UG 2 liegt an der SO-Abdachung des Thüringer<br />
Waldes bei Friedrichroda. Es weist damit eine größere Reliefenergie und eine stärkere<br />
Flächendifferenzierung auf als das UG 1. An diesem Beispiel können sowohl<br />
Fernwirkungen klimawirksamer Flächen als auch der Einfluss der stärker differenzierten<br />
Eingangsebenen auf die Auflösung aufgezeigt werden. Die optimale Rastergröße<br />
liegt hier bei ca. 50 m Kantenlänge (s. Abb. 2).