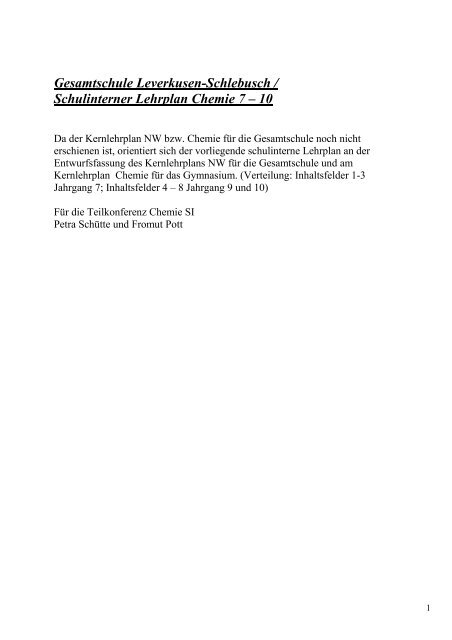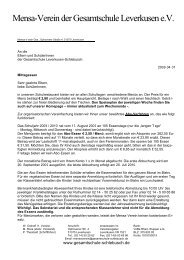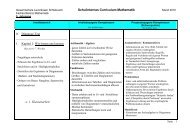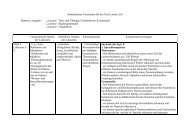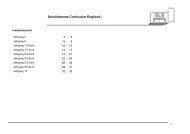Chemie - der Gesamtschule Leverkusen Schlebusch
Chemie - der Gesamtschule Leverkusen Schlebusch
Chemie - der Gesamtschule Leverkusen Schlebusch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Gesamtschule</strong> <strong>Leverkusen</strong>-<strong>Schlebusch</strong> /<br />
Schulinterner Lehrplan <strong>Chemie</strong> 7 – 10<br />
Da <strong>der</strong> Kernlehrplan NW bzw. <strong>Chemie</strong> für die <strong>Gesamtschule</strong> noch nicht<br />
erschienen ist, orientiert sich <strong>der</strong> vorliegende schulinterne Lehrplan an <strong>der</strong><br />
Entwurfsfassung des Kernlehrplans NW für die <strong>Gesamtschule</strong> und am<br />
Kernlehrplan <strong>Chemie</strong> für das Gymnasium. (Verteilung: Inhaltsfel<strong>der</strong> 1-3<br />
Jahrgang 7; Inhaltsfel<strong>der</strong> 4 – 8 Jahrgang 9 und 10)<br />
Für die Teilkonferenz <strong>Chemie</strong> SI<br />
Petra Schütte und Fromut Pott<br />
1
Inhaltsfel<strong>der</strong><br />
mit fachlichen Schwerpunkten<br />
1. Stoffe und<br />
Stoffverän<strong>der</strong>ungen<br />
• Gemische und Reinstoffe<br />
• Stoffeigenschaften<br />
• Stofftrennverfahren<br />
• Einfache Teilchenvorstellung<br />
• Kennzeichen chem. Reaktionen<br />
2. Stoff- und Energieumsätze<br />
bei chem.<br />
Reaktionen<br />
• Oxidationen<br />
• Elemente und Verbindungen<br />
• Exotherme und endotherme<br />
Reaktionen,<br />
• Aktivierungsenergie<br />
• Gesetz von <strong>der</strong> Erhaltung <strong>der</strong><br />
Masse Reaktionsschemata (in<br />
Worten)<br />
• (Wasser als Oxid – Analyse u.<br />
Synthese IHF 2,3 bzw.4)<br />
Fachliche Kontexte<br />
Speisen und Getränke – alles<br />
<strong>Chemie</strong>?<br />
• Was ist drin? Wir untersuchen<br />
Lebensmittel/ Getränke und<br />
ihre Bestandteile<br />
• Wir mischen und trennen Stoffe im<br />
Zusammenhang mit<br />
Lebensmitteln<br />
• Wir verän<strong>der</strong>n Lebensmittel<br />
Feuer und Flamme<br />
• Brände und Brandbekämpfung<br />
• Verbrannt ist nicht vernichtet<br />
3. Luft und Wasser Nachhaltiger Umgang mit<br />
Ressourcen<br />
• Luftzusammensetzung<br />
• Nachweisreaktionen<br />
• Luftverschmutzung, saurer<br />
Regen<br />
• (Wasser als Oxid – Analyse u.<br />
Synthese IHF 2,3 bzw.4)<br />
• Abwasser und<br />
Wie<strong>der</strong>aufbereitung<br />
(ggf. auch in IHF 1)<br />
4. Metalle und<br />
Metallgewinnung<br />
• Gebrauchsmetalle<br />
• Legierungen<br />
• Reduktionen/ Redoxreaktion<br />
• Gesetz von den konstanten<br />
Massenverhältnisse<br />
• Recycling<br />
• Luft zum Atmen<br />
• Bedeutung des Wassers als<br />
Trink- und Nutzwasser;<br />
Aus Rohstoffen werden<br />
Gebrauchsgegenstände<br />
• … vom Beil des Ötzi u.a.<br />
an<strong>der</strong>en Beilen<br />
(Kupfer- und Eisengewinnung,<br />
Bronze als Legierung,<br />
Recycling von Altmetallen)<br />
2
5. Elementfamilien, Atombau<br />
und Periodensystem<br />
• Alkali- o<strong>der</strong> Erdalkalimetalle<br />
• Halogene<br />
• Nachweisreaktionen<br />
• Kern-Hülle-Modell<br />
• Elementarteilchen<br />
• Schalen- bzw. Kugelwolkenmodell<br />
und Besetzungsschema<br />
• Periodensystem<br />
• Atomsymbole • Atomare Masse<br />
6. Energie aus chem.<br />
Reaktionen - Unpolare und<br />
polare Elektronenpaarbindung<br />
• Alkane als Erdölprodukte<br />
• unpolare und polare<br />
Elektronenpaarbindung<br />
• Wasser als Dipol<br />
• Wasserstoffbrückenbindung<br />
• Isomerie bei Alkanen und<br />
Oktanzahl<br />
• Alternative Treibstoffe und<br />
Antriebsformen (ggf. in<br />
Referatform)<br />
7. Ionenbindung und<br />
Ionenkristalle<br />
• Ionenbildung und Ionenbindung<br />
• Eigenschaften von Salzen<br />
• Chemische Formelschreibweise<br />
• (Gitter- und<br />
Hydratationsenergie/<br />
E-Kurs)<br />
8. Saure und alkalische<br />
Lösungen<br />
• Ionen in sauren und alkalischen<br />
Lösungen<br />
• Neutralisation<br />
• (Protonenaufnahme und<br />
Protonenabgabe an einfachen<br />
Beispielen/E-Kurs)<br />
Böden und Gesteine - Vielfalt<br />
und Ordnung<br />
• Aus tiefen Quellen –<br />
Mineralwasser<br />
bzw.<br />
• Streusalz und Dünger - wie viel<br />
verträgt <strong>der</strong> Boden<br />
Zukunftssichere<br />
Energieversorgung -<br />
<strong>Chemie</strong> macht mobil<br />
• Mobilität die Gegenwart und die<br />
Zukunft des Autos<br />
Die Welt <strong>der</strong> Mineralien<br />
• <strong>Chemie</strong> ist cool – Einführung<br />
<strong>der</strong> Ionenbindung am Beispiel<br />
<strong>der</strong> Einmal-kühlkompresse<br />
bzw.<br />
• Salzbergwerke<br />
Reinigungsmittel,<br />
Säuren und Laugen im Alltag<br />
• Anwendungen von Säuren im Alltag<br />
und Beruf<br />
bzw.<br />
• Haut und Haar, alles im neutralen<br />
Bereich<br />
3
<strong>Gesamtschule</strong>-<strong>Schlebusch</strong> <strong>Leverkusen</strong>/<br />
Schulinterner Lehrplan <strong>Chemie</strong> SII<br />
Die <strong>Chemie</strong> ist die Lehre <strong>der</strong> Stoffe und <strong>der</strong> Stoffumwandlungen. Der Unterricht in<br />
<strong>der</strong> Oberstufe baut auf den in <strong>der</strong> Mittelstufe erworbenen Kenntnissen, Fertigkeiten<br />
und Fähigkeiten auf. Es gilt vor allem zu erarbeiten, dass chemische Reaktionen<br />
dynamische Prozesse sind, die häufig als Reaktionsketten ablaufen und durch<br />
gezielte Eingriffe beeinflusst werden können.<br />
Je<strong>der</strong> Jahrgangsstufe ist ein Leitthema zugeordnet. Innerhalb dieses Leitthemas sind<br />
die Themenfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Jahrgangsstufen 11 und 12 verbindlich, in <strong>der</strong> Jahrgangsstufe<br />
13 kann aus mehreren Möglichkeiten gewählt werden.<br />
Jahrgangsstufe 11: Ablauf und Steuerung chemischer Reaktionen<br />
Themenfeld A Themenfeld B Themenfeld C<br />
Reaktionsfolge <strong>der</strong><br />
organischen <strong>Chemie</strong><br />
Unterrichtsreihe:<br />
Vom Alkohol zum<br />
Aromastoff<br />
Ein technischer Prozess<br />
Unterrichtsreihe:<br />
Die Estersynthese<br />
Stoffkreislauf in Natur und<br />
Umwelt<br />
Unterrichtsreihe:<br />
Der Kohlenstoffkreislauf<br />
Unterrichtsgegenstände:<br />
Ausgewählte organische Stoffklassen, Oxidationszahlen, homologe Reihe,<br />
systematische Nomenklatur, Reaktionsgeschwindigkeit, Katalyse, chemisches<br />
Gleichgewicht, Massenwirkungsgesetz, Abhängigkeit von Druck, Temperatur und<br />
Konzentration;<br />
Jahrgangsstufe 12: <strong>Chemie</strong> in Anwendung und Gesellschaft<br />
Themenfeld A Themenfeld B Themenfeld C<br />
Gewinnung, Speicherung<br />
und Nutzung elektrischer<br />
Energie in <strong>der</strong> <strong>Chemie</strong><br />
Unterrichtsreihe:<br />
Von <strong>der</strong> Batterie zum<br />
Akkumulator und zur<br />
Brennstoffzelle<br />
Reaktionswege zur<br />
Herstellung von Stoffen in<br />
<strong>der</strong> organischen <strong>Chemie</strong><br />
Unterrichtsreihe:<br />
Von fossilen Rohstoffen<br />
über das Cyclohexanol<br />
zum Nylon<br />
o<strong>der</strong><br />
Vom Erdöl zum Plexiglas<br />
Analytische Verfahren zur<br />
Konzentrationsbestimmung<br />
Unterrichtsreihe:<br />
Spurensuche –<br />
Konzentrationsbestimmung<br />
z.B.: Quantitative Bestimmung<br />
von Säuren in Lebensmitteln<br />
durch Titration<br />
Unterrichtsgegenstände:<br />
Galvanische Zelle, Elektrolyse, Spannungsreihe, Nernst-Gleichung, Reaktionsstern,<br />
Reaktionstypen: Substitution, Addition und Eliminierung, funktionelle Gruppen,
Protolysen, pH- und pOH-Werte, pk S und pk B - Werte, Titrationen mit<br />
Endpunktbestimmung, Titrationskurven;<br />
Jahrgangsstufe 13: Chemische Forschung – Erkenntnisse, Entwicklungen<br />
und Produkte<br />
Mindestens ein Theoriekonzept muss mit einem geeigneten Themenfeld gekoppelt<br />
werden. Die Fachkonferenz hat sich für folgende Kopplung ausgesprochen:<br />
Theoriekonzept<br />
Themenfel<strong>der</strong><br />
Makromoleküle – Bausteine vieler Natur-<br />
Natürliche und synthetische Werkstoffe<br />
und Kunststoffe<br />
Obligatorische Unterrichtsgegenstände:<br />
• Aufbau von Makromolekülen<br />
- Monomere als Bausteine <strong>der</strong> Polymere<br />
- Größe, Gestalt und Anordnung <strong>der</strong> Makromoleküle, fadenförmige,<br />
verzweigte, vernetzte Moleküle, Helixstruktur, räumliche Faltung<br />
- molare Masse<br />
• Reaktionstypen zur Verknüpfung von Monomeren zu Polymeren<br />
- Polymerisation und/o<strong>der</strong><br />
- Polykondensation und /o<strong>der</strong><br />
- Polyaddition<br />
• Struktureigenschaftsbeziehungen<br />
- Temperaturverhalten, z.B. Schmelzen, Zersetzen, Denaturieren und/o<strong>der</strong><br />
- Lösungsverhalten und/o<strong>der</strong><br />
-Viskosität und/o<strong>der</strong><br />
- Verhalten gegenüber Säuren und Laugen<br />
Ist <strong>Chemie</strong> Abiturfach, müssen zusätzlich zu den Vorgaben in den Richtlinien die<br />
Informationen für das Fach <strong>Chemie</strong> im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Einführung des<br />
Zentralabiturs ab dem Jahr 2007 in NRW beachtet werden. Diese sind zu finden<br />
unter:<br />
http://www.standardsicherung.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=7<br />
Grundsätze zur Leistungsbewertung:<br />
Im Zusammenhang mit <strong>der</strong> neuen APO-GOSt zum Schuljahr 2010/2011 bzw.<br />
2011/2012 und <strong>der</strong> an <strong>der</strong> GLS praktizierten Profilbildung in <strong>der</strong> Jahrgangsstufe 12<br />
(Bio-LK gekoppelt mit einem Ch-GK) besteht z.Zt. für die Schülerinnen und Schüler<br />
keine Möglichkeit <strong>Chemie</strong> als Abiturfach zu wählen, da unter den vier Abiturfächern<br />
seitdem keine zwei Naturwissenschaften angewählt werden können. Demnach<br />
werden seitdem im <strong>Chemie</strong>-Grundkurs keine Klausuren mehr geschrieben. Die<br />
Bewertungsgrundlage stellt somit die „Sonstige Mitarbeit“ dar.<br />
Die Basis <strong>der</strong> Leistungsbewertung bilden das Schulgesetz und die APO-GOSt.<br />
Berücksichtigung finden ebenfalls die Grundsätze zur Lernerfolgsüberprüfung aus<br />
den Richtlinien <strong>Chemie</strong> (S. 89 ff).
Bei <strong>der</strong> Bewertung <strong>der</strong> sonstigen Mitarbeit ist <strong>der</strong> Fachlehrer gehalten, die vielfältigen<br />
Möglichkeiten auszuschöpfen, die Schülerinnen und Schüler haben, um den<br />
Unterricht mitzugestalten und ihre Leistungsfähigkeit zu zeigen.<br />
Neben Redebeiträgen in Unterrichtsgesprächen können diese sein: mündliche – ggf.<br />
durch Visualisierungshilfen unterstützte – Kurzvorträge zum Beispiel zur Planung,<br />
Durchführung und Auswertung von Versuchen o<strong>der</strong> zur Darstellung fachspezifischer<br />
Zusammenhänge, die Dokumentation von Versuchen in Form eines Protokolls,<br />
Anfertigung und Vortrag von Referaten, Schriftliche Übungen und die Mitarbeit in<br />
Projekten.<br />
Bei <strong>der</strong> Notenfindung wird die Qualität und <strong>der</strong> Umfang <strong>der</strong> erbrachten Leistungen<br />
berücksichtigt sowie <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungsbereich <strong>der</strong> zu bewältigenden Aufgaben. Dabei<br />
ist zu beachten, dass von <strong>der</strong> Jahrgangsstufe 11 zur 13 eine Progression stattfindet,<br />
also die Schülerinnen und Schüler zunehmend auf die Bewältigung <strong>der</strong><br />
Anfor<strong>der</strong>ungsbereiches III herangeführt werden müssen.<br />
Für die Teilkonferenz <strong>Chemie</strong> SII<br />
Petra Schütte