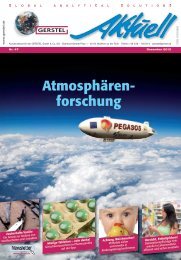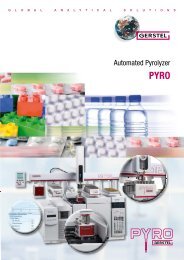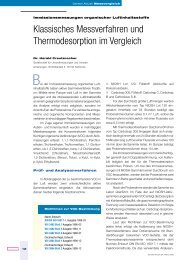GERSTEL Aktuell Nr. 44 (pdf; 5,32 MB) - Gerstel GmbH & Co.KG
GERSTEL Aktuell Nr. 44 (pdf; 5,32 MB) - Gerstel GmbH & Co.KG
GERSTEL Aktuell Nr. 44 (pdf; 5,32 MB) - Gerstel GmbH & Co.KG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
www.gerstel.de<br />
Kundenzeitschrift der <strong>GERSTEL</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong> · Eberhard-<strong>Gerstel</strong>-Platz 1 · 45473 Mülheim an der Ruhr · Telefon +49 2 08 - 7 65 03-0 · gerstel@gerstel.de<br />
ISSN 1618 - 5900<br />
<strong>Nr</strong>. <strong>44</strong> Dezember 2011<br />
Dicke Luft?<br />
Wenn Heim und Büro<br />
krank machen<br />
BIODIESEL · KLINISCHE CHEMIE · PESTIZIDE · WASSER · WHISKEY
www.gerstel.de<br />
I SN 1618 - 59 0<br />
Kundenzeitschrift der <strong>GERSTEL</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong> · Eberhard-<strong>Gerstel</strong>-Platz 1 · 45473 Mülheim an der Ruhr · Telefon + 49 2 08 - 7 65 03-0 · gerstel@gerstel.de<br />
<strong>Nr</strong>. <strong>44</strong> November 20 1<br />
Dicke Luft?<br />
Wenn Heim und Büro<br />
krank machen<br />
BIODIESEL · KLINISCHE CHEMIE · PESTIZIDE · WASSER · WHISKEY<br />
Inhalt<br />
Wenn Heim und<br />
Büro krank machen<br />
Dicke Luft?___________ 4<br />
Liebe Leserinnen<br />
und Leser,<br />
Labor im Porträt: LAVES Oldenburg<br />
Auf der Schwinge<br />
des <strong>Co</strong>ndors ______________ 8<br />
Forensische Toxikologie<br />
Unterwegs in postmortaler<br />
und Drogenanalytik ______ 11<br />
Aromaprofiling von Whiskey<br />
Auf den Geschmack<br />
gekommen ______________ 12<br />
Klinische Chemie<br />
Überleben sichern________ 15<br />
Wasseranalytik<br />
(Nimm zwei) 2 ______________ 18<br />
Biokraftstoff<br />
Nachhaltig abgefüllt ______ 21<br />
Dopinganalytik<br />
Von lahmen Gäulen<br />
und schnellen Pferden____ 23<br />
News ______________________ 3<br />
Impressum<br />
Herausgeber<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong><br />
Eberhard-<strong>Gerstel</strong>-Platz 1<br />
45473 Mülheim an der Ruhr<br />
Konzeption, Text, Redaktion<br />
Redaktionsbüro<br />
Guido Deußing<br />
Presse Text Kommunikation<br />
Uhlandstraße 16<br />
41464 Neuss<br />
guido.deussing@pressetextkom.de<br />
Wissenschaftlicher Beirat<br />
Dr. Eike Kleine-Benne<br />
eike_kleine-benne@gerstel.de<br />
Dr. Oliver Lerch<br />
oliver_lerch@gerstel.de<br />
Dr. Malte Reimold<br />
malte_reimold@gerstel.de<br />
Leserservice<br />
Andrea Hamm<br />
aktuell@gerstel.com<br />
Grafische Umsetzung<br />
Paura Design, Hagen, Germany<br />
www.paura.de<br />
ISSN 1618-5900 · 12 / 2011<br />
der vielen Jahre<br />
ungeachtet, die<br />
wir in der Branche<br />
der Analysentechnik<br />
tätig<br />
sind, gerate ich<br />
immer wieder<br />
ins Staunen<br />
Eberhard G. <strong>Gerstel</strong>, geschäftsführender<br />
Gesellschafter.<br />
angesichts der Vielgestaltigkeit der Bereiche, in<br />
denen die analytischen Trenntechniken, allen<br />
voran die Gas- und Flüssigkeitschromatographie,<br />
für Durchblick, Klarheit und Erkenntnisgewinn<br />
sorgen. Interessant zu sehen ist vor allem, wie<br />
sehr doch des Menschen Wohl und Weh an der<br />
Verfügbarkeit und dem Einsatz präziser, sensitiver<br />
Analysengeräte und -systeme hängen.<br />
Zum Beispiel in der Medizin: Betrachten<br />
Sie nur einmal das sogenannte Sick-Building-<br />
Syndrom. Noch bis vor einigen Jahren wurden<br />
Patienten, die wiederholt mit Kopfschmerzen,<br />
Schleimhautreizung, Müdigkeit, verminderter<br />
Leistungsfähigkeit oder, profaner noch, mit<br />
einem nicht näher zu umschreibenden, undefinierbaren<br />
Unwohlsein in die Arztpraxis kamen,<br />
in Ermangelung konkreter Ursachen gerne als<br />
eingebildete Kranke eingestuft.<br />
Heute weiß man, dass flüchtige organische<br />
Verbindungen (VOC/SVOC), von Baumaterialien<br />
und Bauprodukten abgesondert, unser Wohlbefinden<br />
und unsere Gesundheit in geschilderter<br />
Art und Weise nachhaltig beeinträchtigen<br />
können. Eine nicht unwichtige Erkenntnis vor<br />
allem für uns zivilisierte Menschen der nördlichen<br />
Hemisphäre, die wir nahezu 90 Prozent<br />
unserer Zeit in Innenräumen verbringen! Gefahr<br />
erkannt, Gefahr gebannt? Was getan wird, um<br />
eine Gesundheitsbelastung durch Materialemissionen<br />
zu verhindern, erfahren Sie in unserer<br />
Titelgeschichte „Dicke Luft“ auf Seite 4.<br />
Der Mensch aber lebt nicht von Luft allein –<br />
von Zeit zu Zeit müssen wir unserem Organismus<br />
auch Nahrung in fester und flüssiger Form zuführen,<br />
wollen wir bei Kräften bleiben. Die Lebensmittel,<br />
die hierzulande angeboten werden, sind<br />
in der Regel sicher, und der Verbraucher hat allen<br />
Grund, sich darauf zu verlassen, in den Auslagen<br />
der Supermärkte qualitativ hochwertige Produkte<br />
vorzufinden; die Lebensmittelskandale der letzten<br />
Jahre ändern an dieser Tatsache wenig.<br />
Dem Verbraucherschutz sei Dank, der in<br />
Europa gesetzlich verankert ist und sehr ernst<br />
genommen wird. Allerdings genügt es nicht,<br />
Gesetze zu erlassen; vielmehr braucht es geeigneter<br />
Institutionen, die eine Einhaltung der<br />
für Schadstoffbelastungen vorgeschriebenen<br />
Grenzwerte messtechnisch überwachen. Beim<br />
Nachweis von Pestiziden in Lebensmitteln hat<br />
auf europäischer Ebene das LAVES in Niedersachen<br />
die Nase vorn. Dank seiner erfahrenen<br />
Experten und einer erstklassigen Analysentechnik.<br />
Der Beitrag „Auf den Schwingen des <strong>Co</strong>ndors“<br />
auf Seite 6 bietet einen kleinen lebhaften<br />
Einblick hinter die Kulissen des LAVES.<br />
Was lesen Sie sonst noch in dieser neuen<br />
Ausgabe der „<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong>“? Zum Beispiel<br />
dass es berechtigte Gründe gibt, von Anwendung<br />
zu Anwendung verschiedene Extraktionstechniken<br />
zu kombinieren, festgemacht am<br />
Beispiel des Aromaprofilings von Whiskey. Auf<br />
Seite 12 lesen Sie hierzu den Beitrag „Auf den<br />
Geschmack gekommen“, maßgeblich verfasst<br />
von dem international anerkannten Experten<br />
Dr. Kevin Mac Namara.<br />
Gedanken gemacht über eine effiziente,<br />
überaus aussagekräftige Analyse von Wasser mit<br />
der Stir Bar Sorptive Extraction haben sich Applikationsexperten<br />
der <strong>GERSTEL</strong> K.K. in Tokio, Japan.<br />
Mehr noch: Die von Nobuo Ochiai und Kollegen<br />
entwickelte Methode der „Sequenziellen SBSE“,<br />
beschrieben im Beitrag „(Nimm zwei) 2 “ auf Seite<br />
18, macht deutlich, wie leistungsstark der Einsatz<br />
zweier <strong>GERSTEL</strong>-Twister ist.<br />
Last but not least wirft die vorliegende<br />
„<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong>“ ein Schlaglicht auf die Analyse<br />
von Glycerin-Rückständen in Biodiesel. Laut<br />
geltender US- und EU-Norm darf der Anteil an<br />
freiem Glycerin einen bestimmten Grenzwert<br />
nicht überschreiten. Dank einer intelligenten<br />
Automatisierung der Probenvorbereitung verläuft<br />
die Analyse überaus effizient und sicher.<br />
Die vorliegende „<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong>“ lädt Sie<br />
wieder einmal aufs Neue ein, mit uns durch<br />
Laborwelten zu reisen, in denen <strong>GERSTEL</strong>-<br />
Geräte und -Systeme eine wichtige Rolle spielen.<br />
Ich wünsche mir, dass das gebotene Themenspektrum<br />
auch bei Ihnen auf Interesse stößt<br />
und es uns erneut gelungen ist, Wissenswertes<br />
aus der Branche fundiert und mit Kurzweil zu<br />
vermitteln.<br />
Viel Vergnügen bei der Lektüre<br />
wünscht Ihr<br />
2 <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011
<strong>GERSTEL</strong> feiert das zehnjährige<br />
Bestehen seiner Schweizer Tochtergesellschaft:<br />
2001 gründete das Unternehmen<br />
die <strong>GERSTEL</strong> AG mit Sitz in Sursee.<br />
Ansprechpartner ist seit dem ersten Tag<br />
der Chemiker Dr. Winfried Röder, der als<br />
Vertriebsbeauftragter des Unternehmens<br />
vor Ort verantwortlich zeichnet. Ihm zur<br />
Seite steht der Serviceingenieur Thomas<br />
Schnyder.<br />
Bereits seit Jahrzehnten bestehen enge<br />
Kontakte insbesondere zu GC/MS- und<br />
LC/MS-Anwendern in der Schweizer<br />
Lebensmittel-, Aroma-, Textil- und<br />
Pharmaindustrie, die seitdem vertieft,<br />
intensiviert und erweitert wurden. Heute<br />
sind zahlreiche Analysenlaboratorien in<br />
der Schweiz mit <strong>GERSTEL</strong>-Technologie<br />
ausgestattet.<br />
Zentrale der <strong>GERSTEL</strong> AG<br />
in Sursee, Schweiz.<br />
Dr. Winfried Röder,<br />
Ihr Schweizer<br />
Ansprechpartner.<br />
Jubiläum: Zehn Jahre <strong>GERSTEL</strong> AG in der Schweiz<br />
Bewährte Präsenz:<br />
Für GC/MS- und LC/MS-Anwender vor Ort.<br />
Durch die Beteiligung an Messen wie<br />
der ILMAC oder der Labotec Suisse sowie<br />
an wissenschaftlichen Konferenzen zeigt<br />
<strong>GERSTEL</strong> eine deutliche Präsenz. Eine<br />
besondere Möglichkeit zum intensiven<br />
Erfahrungsaustausch bilden Anwenderseminare,<br />
die das Unternehmen turnusmäßig<br />
alle zwei Jahre auch in der Schweiz durchführt;<br />
ein Forum, auf dem Anwender und<br />
Applikationsspezialisten über ihre Arbeit<br />
mit <strong>GERSTEL</strong>-Technologie berichten<br />
und sich austauschen.<br />
Dank der engagierten Kolleginnen<br />
und Kollegen der <strong>GERSTEL</strong> AG ist es<br />
möglich, individuell, schnell und flexibel<br />
auf die Erfordernisse der Schweizer Labore<br />
zu reagieren und <strong>GERSTEL</strong>-Kunden in<br />
der Schweiz optimal zu unterstützen.<br />
Erfahrungsaustausch fördern<br />
Rund 450 Teilnehmer zählte <strong>GERSTEL</strong> dieses Jahr auf seiner Anwenderseminartour durch<br />
Deutschland und die Schweiz. Wie in der Vergangenheit stand die Applikation im Mittelpunkt<br />
der Veranstaltungsreihe, die am 22. März 2011 in Hamburg begann und am 14. April 2011<br />
in Frankfurt am Main endete. Das Themenspektrum, über das Anwender und <strong>GERSTEL</strong>-Applikationsexperten<br />
berichteten, war weit gefächert und reichte von der „Impfstoffanalytik mittels<br />
GC/MS und LC/MS“ über die „Automatisierte Pyrolyse mit dem <strong>GERSTEL</strong>-TDU“ bis zu „Anwendungsmöglichkeiten<br />
der DHS in der Food- und Flavor-Analytik“. Das Fazit der Teilnehmer am Ende<br />
der Seminarreihe motivierte die <strong>GERSTEL</strong>aner, am bestehenden Konzept festzuhalten: 2013 geht<br />
<strong>GERSTEL</strong> wieder auf Tournee ...<br />
Auszeichnung<br />
Eberhard-<br />
EGP<br />
<strong>Gerstel</strong>-Preis<br />
2012<br />
Die von<br />
<strong>GERSTEL</strong><br />
gesponserte<br />
Auszeichnung<br />
wird<br />
auf der Analytica<br />
2012<br />
zum zweiten<br />
Mal von<br />
der Gesellschaft<br />
Deutscher<br />
Chemiker (GDCh) an<br />
eine(n) herausragende(n) Wissenschaftler/in<br />
auf dem Gebiet<br />
der analytischen Trenntechniken<br />
verliehen.<br />
Vom Arbeitskreis „Separation Science“<br />
wird 2012 zum zweiten Mal der Eberhard-<strong>Gerstel</strong>-Preis<br />
für eine herausragende<br />
Publikation auf dem Gebiet der<br />
analytischen Trenntechniken vergeben.<br />
Gestiftet wird der alle zwei Jahre<br />
ausgelobte Preis in Höhe von 2500<br />
Euro von <strong>GERSTEL</strong>. Das Unternehmen<br />
wurde 1967 von Eberhard <strong>Gerstel</strong><br />
senior gegründet und hat sich seitdem<br />
zu einem weltweit führenden Anbieter<br />
von Systemen und Lösungen für<br />
die automatisierte Probenvorbereitung<br />
und Probenaufgabe in der GC/MS und<br />
LC/MS entwickelt.<br />
Verliehen wird der Eberhard-<br />
<strong>Gerstel</strong>-Preis 2012 am 18. April<br />
2012 im Rahmen der Analytica-<strong>Co</strong>nference<br />
auf der Analytica 2012 in München.<br />
Bewerber sollten Erstautor (corresponding<br />
author) einer 2010/2011<br />
von einer international anerkannten<br />
Fachzeitschrift gedruckten bzw.<br />
zum Druck akzeptierten Publikation sein.<br />
Autoren können sich bewerben<br />
beziehungsweise für diese Auszeichnung<br />
vorgeschlagen werden. Eine international<br />
besetzte Jury wählt den Preisträger.<br />
Bewerbungen bzw. Kandidatenvorschläge<br />
sollten elektronisch, idealerweise<br />
als PDF-Datei, bis spätestens 17.<br />
Februar 2012 (Stichtag) eingereicht werden.<br />
Kopie der Publikation, Lebenslauf<br />
des Autors, Stellungnahme bzw. Empfehlung<br />
sind einzureichen an:<br />
Prof. Dr. Werner Engewald, Universität<br />
Leipzig, Institut für analytische Chemie,<br />
Linnéstr. 3, 04103 Leipzig, Deutschland,<br />
E-Mail: engewald@uni-leipzig.de<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011 3
Dicke Luft?<br />
Wenn Heim und Büro krank machen<br />
Produkte für den Haus- und Wohnungsbau können verantwortlich sein für die Belastung von Innenräumen<br />
durch flüchtige organische Verbindungen (VOC/SVOC). Um die Gesundheit der Bewohner und Beschäftigten<br />
beziehungsweise Gebäudenutzer zu schützen, ist gemäß geltender Vorschriften das Emissionsverhalten im<br />
Innenraum eingesetzter Werkstoffe zu untersuchen. Für die Vorgehensweise grundlegend sind hierzulande die<br />
Vorgaben des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB). Einen wesentlichen<br />
Bestandteil bildet die Prüfkammeruntersuchung, verbunden mit einer Anreicherung der Analyten auf einem<br />
geeigneten Adsorbens und anschließender Thermodesorption-GC/MS-Analyse. Abseits der zeitintensiven<br />
Prüfkammeruntersuchung liefert die thermische Extraktion in kompakten Thermoextraktoren aussagekräftige<br />
Informationen über das Emissionsverhalten von Bauprodukten u. a. für die Qualitäts- oder Produktionskontrolle.<br />
Zur Analyse von Materialemissionen<br />
eingesetztes<br />
TDS/TDS A-GC/MS-<br />
System.<br />
PVC, Linoleum, Teppich, Laminat, Parkett,<br />
Kork – die Wahl der richtigen<br />
Auslegeware, des passenden Bodens für den<br />
Wohn- oder Arbeitsbereich, kann ob der<br />
großen Bandbreite der am Markt verfügbaren<br />
Produkte durchaus Kopfzerbrechen<br />
bereiten. Ähnlich verhält es sich im ungünstigen<br />
Fall, ist die Entscheidung längst<br />
getroffen und der Bodenbelag schon fest<br />
mit dem Untergrund verklebt.<br />
Dann nämlich, wenn sich<br />
aus dem Bodenbelag<br />
beziehungsweise<br />
Bodensystem<br />
flüchtige organische<br />
Verbindungen (VOC/<br />
SVOC) verdünnisieren<br />
und die Innenraumluft verschmutzen.<br />
Hartgesottene mögen an dem Ausstoß keinen<br />
Anstoß nehmen, anderen Bewohnern<br />
oder Raumnutzern hingegen kann diese<br />
Art der Luftbelastung das Leben zur Hölle<br />
machen: Treten nach Bezug eines neuen,<br />
renovierten oder sanierten Gebäudes mit<br />
einem Mal Symptome wie Kopfschmerzen,<br />
Schleimhautreizungen, Müdigkeit, allergische<br />
Reaktionen, Abwehrschwäche, häufige<br />
Infektionskrankheiten, Verschlechterung<br />
von Asthma bronchiale, akute Atembeschwerden,<br />
depressive Zustände, allgemeines<br />
Unwohlsein oder verminderte<br />
Leistungsfähigkeit auf, zieht der versierte<br />
Mediziner bei seiner Diagnose auch das<br />
sogenannte Sick-Building-Syndrom als<br />
Ursache mit in Betracht, hervorgerufen<br />
unter anderem von<br />
VOC- und SVOC-Emissionen<br />
aus Bauprodukten.<br />
Wenn Zimmerluft<br />
krank macht<br />
Da der Mensch die meiste<br />
Zeit seines Lebens in<br />
Innenräumen verbringt,<br />
abhängig von der Jahreszeit<br />
rund 80 bis 90<br />
Prozent des Tages, übt<br />
das Klima in der Woh-<br />
4 <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011
denen Gebäude errichtet oder die in solche<br />
eingebaut werden, haben diese Anforderung<br />
in besonderer Weise zu erfüllen,<br />
nämlich dadurch, dass durch chemische,<br />
physikalische oder biologische Einflüsse<br />
keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen<br />
entstehen (§16 <strong>MB</strong>O).“ Die<br />
Europäische Union trägt der herausragenden<br />
Bedeutung der Bauprodukte für<br />
das Wohl und Weh des Menschen durch<br />
die europäische Bauprodukten-Richtlinie<br />
Rechnung, die 1989 in Kraft trat und u.<br />
a. die Gesundheit der Gebäudenutzer im<br />
Fokus hat. In Deutschland wurde sie 1992<br />
durch das Bauprodukte-Gesetz (BauPG)<br />
und die Novelle der Landesbauordnung in<br />
nationales Recht umgewandelt.<br />
Abb. 1: SCHEMA ZUR GESUNDHEITLICHEN BEWERTUNG VON<br />
VOC*- UND SVOC*-EMISSIONEN AUS BAUPRODUKTEN<br />
1. Messung<br />
nach 3 Tagen<br />
2. Messung<br />
nach 28 Tagen<br />
Prüfung auf:<br />
TVOC3 < 10 mg/m³?<br />
ja<br />
Kanzerogene3 EU-Kat. 1 und 2 < 0,01 mg/m³?<br />
ja<br />
TVOC28 < 1,0 mg/m³?<br />
ja<br />
SVOC28 < 0,1 mg/m³?<br />
ja<br />
Kanzerogene28 EU-Kat. 1 und 2 < 0,001 mg/m³?<br />
ja<br />
Bewertbare Stoffe:<br />
Gilt bei Betrachtung aller VOC mit NIK**<br />
R = C i/NIK i** < 1?<br />
ja<br />
Nicht bewertbare Stoffe:<br />
Ist die Summe aller VOC ohne NIK**<br />
VOC28 < 0,1 mg/m³?<br />
ja<br />
Das Produkt ist für die Verwendung<br />
in Innenräumen geeignet<br />
nung und am Arbeitsplatz einen entscheidenden<br />
Einfluss auf sein Wohlbefinden<br />
und seine Gesundheit aus. Wesentliche<br />
Faktoren sind vor allem die herrschende<br />
Temperatur und die relative Luftfeuchte<br />
AgBB - Bewertungsschema für VOC aus Bauprodukten; Stand 2010<br />
im<br />
Teil<br />
Raum.<br />
2: Vorgehensweise<br />
Allerdings spielt die Qualität<br />
der Luft beziehungsweise ihre Belastung<br />
mit VOC (C 6 -C 16 ) und SVOC (>C 16 -C 22 )<br />
eine nicht unerhebliche Rolle. Viele Bauprodukte<br />
kommen als potenzielle Emissionsquellen<br />
in Betracht, neben Bodenbelägen<br />
auch Verlegewerkstoffe, Farben, Lacke,<br />
Holzschutzmittel, Holzwerkstoffe, Wandund<br />
Deckenverkleidungen, Abdichtungen,<br />
Putz, Mauersteine, Zement und Beton.<br />
Indes sind bauliche Anlagen gemäß der<br />
Landesbauordnungen so zu errichten und<br />
instandzuhalten, dass „Leben, Gesundheit<br />
Ausschuss zur und die natürliche<br />
gesundheitlichen<br />
Bewertung von<br />
Bauprodukten Lebensgrundlage<br />
nicht gefährdet<br />
werden“ (§ 3<br />
nein<br />
Ablehnung<br />
Musterbauordnung<br />
[<strong>MB</strong>O],<br />
nein<br />
Ablehnung<br />
2002). In einer<br />
Stellungnahme<br />
des Umweltbundesamtes<br />
heißt<br />
nein<br />
Ablehnung<br />
es weiter: „Bauprodukte,<br />
mit<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
Ablehnung<br />
Ablehnung<br />
Ablehnung<br />
Ablehnung<br />
Für die zu diesen Zeitpunkten ebenfalls vorgesehenen sensorischen Prüfungen stehen<br />
derzeit noch keine abgestimmten und allgemein anerkannten Verfahren zur Verfügung.<br />
Konzept zur Bewertung<br />
von Emissionen<br />
aus Bauprodukten<br />
nach dem AgBB-<br />
Schema. Gerd Bittner:<br />
„Ein Produkt, das die<br />
AgBB-Bewertungskriterien<br />
erfüllt, ist<br />
für die Verwendung<br />
in Innenräumen<br />
geeignet.“<br />
* VOC: Retentionsbereich<br />
C 6 -C 16 ,<br />
SVOC: Retentionsbereich<br />
> C 16 -C 22 ,<br />
** NIK: Niedrigste<br />
interessierende Konzentration.<br />
Einheitliches Bewertungsschema<br />
So weit, so gut. Doch der Gesetzgeber wäre<br />
schlecht beraten, würde er sich darauf verlassen,<br />
dass nicht sein kann, was nicht sein<br />
darf. Getreu dem Motto „Verbraucherschutz<br />
hat Vorrang“ gilt: Vertrauen ist gut,<br />
Kontrolle ist besser! Wie aber lässt sich die<br />
Qualität von Bauprodukten in einheitlicher<br />
und reproduzierbarer Weise überprüfen?<br />
Der Ausschuss zur gesundheitlichen<br />
Bewertung von Bauprodukten (AgBB) hat<br />
ein Schema zur Bewertung flüchtiger organischer<br />
Substanzen (VOC/SVOC) entwickelt.<br />
„Die Prüfkriterien des AgBB für<br />
Bodenbeläge sehen eine erstmalige Zulassungsprüfung<br />
vor, deren Ergebnisse in einer<br />
jährlichen Überwachungsprüfung des Bauprodukts<br />
kontrolliert werden“, sagt Gerd<br />
Bittner vom Textiles & Flooring Institute<br />
(TFI) in Aachen, das Emissionsprüfungen<br />
u. a. von Bodensystemen vornimmt. VOC-<br />
Prüfungen werden am TFI mittels Prüfkammern<br />
u. a. auf Grundlage der Normen<br />
DIN EN ISO 16000-11, DIN EN ISO<br />
16000-9 und DIN ISO 16000-6 durchgeführt.<br />
Diese Normen legen die Testbedingungen<br />
für unterschiedlichste Bodenbeläge<br />
in Prüfkammern sowie die analytische<br />
Bestimmung der flüchtigen organischen<br />
Verbindungen nach drei sowie 28 Tagen<br />
durch aktive Probenahme auf geeigneten<br />
Adsorbentien, in der Regel Tenax, fest; die<br />
Bestimmung der Analyten erfolgt gemäß<br />
AgBB nach Thermodesorption mittels<br />
ThermalDesorptionSystem (<strong>GERSTEL</strong>-<br />
TDS), anschließender Gaschromatographie<br />
und massenselektiver Detektion (GC/<br />
MS). „Für die Zuordnung der Einzelstoffe<br />
zu den Retentionsbereichen C 6 -C 16 beziehungsweise<br />
>C 16 -C 22 ist die Analytik auf<br />
einer unpolaren Säule zugrunde zu legen“,<br />
heißt es im „AgBB – Bewertungsschema<br />
für VOC aus Bauprodukten; Stand 2010“.<br />
* VOC, TVOC: Retentionsbereich C6 – C16, SVOC: Retentionsbereich > C16 – C22<br />
** NIK: Niedrigste interessierende Konzentration, engl. LCI<br />
UBA II 1.3 –<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011 5<br />
Emissionskammerprüfung nach DIN EN ISO 16000-9 bis 11<br />
AgBB 2010
NIK-Werte<br />
NIK-Werte sind die niedrigsten toxikologisch<br />
interessierenden Konzentrationen (engl.: LCI =<br />
Lowest <strong>Co</strong>ncentration of Interest) für Innenräume<br />
im privaten und öffentlichen Bereich; sie beziehen<br />
sich nicht auf Arbeitsplatzbelastungen.<br />
MAK-Werte<br />
MAK-Werte (Maximale Arbeitsplatzkonzentration)<br />
beschreiben die höchstzulässige Konzentration<br />
eines Arbeitsstoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff<br />
in der Luft am Arbeitsplatz, die auch nach<br />
täglicher achtstündiger Exposition, jedoch bei Einhaltung<br />
einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit<br />
von 40 Stunden, im Allgemeinen die Gesundheit<br />
der Beschäftigten nicht beeinträchtigt und diese<br />
nicht unangemessen belästigt.<br />
AgBB<br />
Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung<br />
von Bauprodukten (AgBB) wurde 1997 von der<br />
Länderarbeitsgruppe „Umweltbezogener Gesundheitsschutz“<br />
(LAUG) der Arbeitsgemeinschaft der<br />
Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG) ins<br />
Leben gerufen. Vertreten sind im AgBB neben den<br />
Landesgesundheitsbehörden auch das Umweltbundesamt<br />
(UBA), das Deutsche Institut für<br />
Bautechnik (DIBt), die Bauministerkonferenz, die<br />
Konferenz der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen<br />
zuständigen Minister und Senatoren der<br />
Länder (ARGEBAU), die Bundesanstalt für Materialforschung<br />
und -prüfung (BAM), das Bundesinstitut<br />
für Risikobewertung (BfR) und der Koordinierungsausschuss<br />
03 für Hygiene, Gesundheit und<br />
Umweltschutz des Normausschusses Bauwesen<br />
im DIN (DIN-KOA 03). Die Geschäftsstelle des<br />
AgBB ist im Umweltbundesamt im Fachgebiet II<br />
1.3 (Gesundheitsbezogene Exposition, Innenraumhygiene)<br />
angesiedelt.<br />
Relevant für die Emissionsprüfung<br />
von Bodensystemen<br />
• DIN EN ISO 16000-9<br />
Emissionsprüfkammerverfahren<br />
• DIN EN ISO 16000-11<br />
Probenahme, Lagerung der Proben und<br />
Vorbereitung der Prüfstücke<br />
• DIN ISO 16000-6<br />
Bestimmung von VOC in der Innenraumluft<br />
und in Prüfkammern, Probenahme TENAX TA ® ,<br />
Thermodesorption-(TDS)-GC/MS<br />
• DIN ISO 16000-3<br />
Messen von Formaldehyd und anderen<br />
Carbonylverbindungen; Probenahme<br />
• Schema zur gesundheitlichen Bewertung<br />
von VOC- und SVOC-Emissionen aus Bauprodukten<br />
(AgBB)<br />
• DIBt-Zulassungsgrundsätze<br />
Als Einzelstoffe gelten alle identifizierten<br />
und nicht identifizierten Verbindungen.<br />
Ferner sieht das AgBB-Schema für alle<br />
Substanzen „grundsätzlich eine einheitliche<br />
Nachweisgrenze von 1 µg/m 3 vor, um<br />
das Emissionsspektrum zunächst qualitativ<br />
möglichst vollständig zu erfassen. Je nach<br />
Anforderung sind alle Einzelstoffe weiterhin<br />
zu quantifizieren und ab einer Konzentration<br />
von 5 µg/m 3 sowohl als Einzelstoff<br />
als auch in der Summe zu berücksichtigen.<br />
Ausnahmen gelten für kanzerogene<br />
Stoffe der EU-Kategorie 1 und 2. Die<br />
Quantifizierung der identifizierten Substanzen<br />
mit NIK-Werten und der Kanzerogene<br />
hat substanzspezifisch zu erfolgen.<br />
Die Quantifizierung der identifizierten<br />
Substanzen ohne NIK-Werte und die der<br />
nicht-identifizierten (‚unbekannten‘) Substanzen<br />
erfolgt jeweils gegen Toluol-Äquivalente.“<br />
Thermoextraktion bestens<br />
geeignet als Schnellverfahren<br />
Der vom AgBB geforderte Prüfzeitraum<br />
von rund einem Monat eigne sich hervorragend,<br />
um ein umfangreiches Emissionsprofil<br />
zu erhalten, befindet Gerd Bittner.<br />
Die Auswertung erfolgt dabei anhand<br />
typischer Peakmuster, die sich aufzeichnen<br />
und vergleichen lassen; es ließen sich Substanzen<br />
qualitativ vergleichen, Leitkomponenten<br />
identifizieren und eine Quantifizierung<br />
durch Zugabe eines internen Standards<br />
realisieren. Die Prüfkammermessung<br />
sei überdies nicht nur zeit-, sondern<br />
auch arbeits- und kostenintensiv. Für die<br />
Industrie stelle die Prüfkammermessung<br />
daher, insbesondere bei Neuentwicklungen,<br />
die eine frühzeitige beziehungsweise<br />
produktionsnahe Bewertung oder Optimierung<br />
des Produkts erforderten, ein<br />
Problem dar (time to market). Aus diesem<br />
Grund führe das TFI seit Jahren im Zuge<br />
der Produktentwicklung, zur Produktionsund<br />
Chargenkontrolle sowie zum Zwecke<br />
der Reklamationsuntersuchung und Identitätsprüfung<br />
im Auftrag Schnelltests mittels<br />
Thermoextraktion durch.<br />
Zum Einsatz komme dabei u. a. der<br />
<strong>GERSTEL</strong>-ThermalExtractor (TE),<br />
der aufgrund seines groß dimensionierten<br />
Extraktorrohres (ID: 14 mm, L: 177<br />
mm, davon 75 mm Probenraum) die Aufnahme<br />
unterschiedlicher Probearten und<br />
-mengen erlaubt: „Wir untersuchen damit<br />
textile wie elastische Bodenbeläge, Mehrschichtensysteme<br />
wie auch unterschiedlich<br />
konsistente beziehungsweise adäquat präparierte<br />
Verlegewerkstoffe, also Kleber“,<br />
berichtet Gerd Bittner. Die Proben werden<br />
ausgeheizt und die extrahierten Analyten<br />
auf Tenax angereichert. Die TDS-GC/<br />
MS-Analyse erfolgt schließlich gemäß den<br />
Richtlinien der AgBB.<br />
„Durch Anpassung der unterschiedlichen<br />
Testbedingungen der Thermoextraktion<br />
an die Emissionsprüfkammer zeigt das<br />
ausgetestete Thermoextraktionsverfahren<br />
unter den Aspekten einer Vergleichbarkeit<br />
der Emissionen bzw. der typischen Peakmuster<br />
qualitativ eine zufriedenstellende<br />
Übereinstimmung“, bemerkt Gerd Bittner<br />
und ergänzt: „Nach unseren bisherigen<br />
Erfahrungen lassen sich mit dem TE-<br />
System für ein Kurzzeitverfahren die VOC<br />
aus den unterschiedlichsten Bodenbelägen,<br />
Verlegewerkstoffen und Fußbodenaufbauten<br />
unter den Aspekten der Vergleichbarkeit<br />
und des Emissionspotenzials effizient<br />
und sicher bestimmen. Damit erweist sich<br />
die Thermoextraktion als wertvolle Ergänzung<br />
zur Prüfkammeruntersuchung.“<br />
Weitere Informationen<br />
Gerd Bittner, Textiles & Flooring Institute (TFI),<br />
Charlottenburger Allee 41, 52068 Aachen,<br />
Telefon 0241-9679-00,<br />
Telefax 0241-9679-200,<br />
www.tfi-online.de<br />
<strong>GERSTEL</strong>-TE: Dank des<br />
groß dimensionierten<br />
Extraktorrohres geeignet<br />
für die Thermoextraktionsuntersuchung<br />
unterschiedlicher<br />
Probenarten<br />
und -mengen.<br />
6 <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011
Thermoextraktion mittels <strong>GERSTEL</strong>-TE als probate Alternative zur<br />
Prüfkammeruntersuchung – Beispiele aus der Praxis des TFI<br />
Optimierung von Teppichfliesen I:<br />
Eine Teppichfliese wurde dem Produktionszyklus<br />
entnommen und auf<br />
ihr VOC/SVOC-Emissionsverhalten<br />
untersucht. Das Resultat: auffällig<br />
starke Signale im Chromatogramm<br />
im Bereich von 10-14 Minuten. Zur<br />
Erforschung der Ursachen wurden<br />
die bei der Herstellung der Teppichfliese<br />
eingesetzt Hilfsmitel thermisch<br />
extrahiert. Dabei stieß das TFI in<br />
kürzester Zeit auf den Verursacher<br />
und konnte so eine klare Strategie<br />
für die weitere Produktentwicklung<br />
und -fertigung vorschlagen.<br />
Optimierung von Teppichfliesen<br />
II: Die TDS-GC/MS<br />
nach Thermoextraktion (TE) der<br />
Analyten aus einer Teppichfliese<br />
zeigte im Chromatogramm<br />
auffällig starke Emissionen im<br />
Bereich von 8-14 Minuten. Die<br />
Emissionsquelle wurde ausfindig<br />
gemacht und substituiert – mit<br />
sichtbarem Erfolg, wie die Analyse<br />
des Endprodukts belegt.<br />
Sinnvolle Ergänzung:<br />
Die Kongruenz beider mittels<br />
TDS-GC/MS aufgezeichneten<br />
Chromatogramme macht eine<br />
signifikante Übereinstimmung<br />
der Resultate der Langzeituntersuchung<br />
in der Prüfkammer<br />
und der Kurzzeitmessung im<br />
<strong>GERSTEL</strong>-ThermoExtraktor<br />
(TE) deutlich. Mit diesem Bild<br />
lassen sich Strategien bei der<br />
weiteren Vorgehensweise<br />
etwa im Rahmen der Produktentwicklung,<br />
Produktionskontrolle<br />
oder bei Reklamationen<br />
festlegen.<br />
Weitere Informationen<br />
[1] www.umweltbundesamt.de/<br />
bauprodukte/agbb.htm<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011 7
Die MPS-PrepStation, ihrer Spannweite wegen<br />
von den Mitarbeiterinnen des LAVES-Pestizidlabors<br />
„<strong>Co</strong>ndor“ genannt, garantiert konstante Resultate<br />
bei der Herstellung von Standardlösungen auch<br />
bei wechselnden Anwendern.<br />
Labor im Porträt: LAVES Oldenburg<br />
Auf den Schwingen des <strong>Co</strong>ndors<br />
Das Lebensmittelinstitut des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-<br />
VES) in Oldenburg erzielte für Getreideuntersuchungen im Jahr 2009 bei einem Vergleich der europäischen<br />
Pestizidlabore das beste Gesamtergebnis. Die zugrunde liegende Leistung erfordere sehr<br />
gut ausgebildete, im höchsten Maße erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betonte LAVES-Präsident<br />
Eberhard Haunhorst seinerzeit. Das allein aber genügt bei näherer Betrachtung nicht. Überragende<br />
Laborleistungen verlangen neben Erfahrung und Know-how auch eine adäquate Laborausstattung.<br />
„<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong>“ hat das LAVES besucht und den Mitarbeitern des Pestizidlabors über die Schulter geschaut.<br />
Der Raum mutet an wie die Vorratskammer<br />
einer Großküche. Ein Hauch von<br />
Seeluft mischt sich unter den herben, erdigen<br />
Geruch. Gestern gab es Fisch, heute<br />
stehen Pilze auf dem Plan. Geliefert aus<br />
der Zucht direkt auf den Tisch: Champignon,<br />
Seitling, Judasohr, Shiitake liegen da<br />
in schwarzen und blauen Körbchen dicht<br />
an dicht. Was hier lagert, steht jedoch nicht<br />
zum Verzehr, sondern bereit, auf eine mögliche<br />
Belastung mit Pflanzenschutzmittelrückständen<br />
untersucht zu werden.<br />
Erste Adresse im Land Niedersachen für die<br />
verbraucherschutzrechtliche Überwachung von<br />
Lebensmitteln auf mögliche Pestizidbelastungen.<br />
lysentechnik die Einhaltung lebensmittelrechtlicher<br />
Bestimmungen und stellt damit<br />
einen wichtigen Eckpfeiler im Gesamtkonzept<br />
des niedersächsischen Verbraucherschutzes<br />
dar.<br />
Das Adressschild nahe der Straße weist<br />
dem Besucher den Weg entlang des Parkplatzes<br />
zum Eingang des Lebensmittelinstituts:<br />
ein mehrstöckiges, großzügig<br />
verglastes Gebäude, das von außen nicht<br />
vermuten lässt, was es in seinem Inneren<br />
beheimatet, nämlich eines der besten europäischen<br />
Pestizidlabore für Getreide.<br />
Für seine Geschicke verantwortlich<br />
zeichnet Dr. Iris Suckrau. Die agile Lebens-<br />
Eine der ersten Adressen<br />
für Pestizidanalytik in der EU<br />
Über alle Zweifel erhaben sein, lautet die<br />
Devise des Landesamtes für Verbraucherschutz<br />
und Lebensmittelsicherheit, kurz<br />
LAVES. Gesundheitsschädliche Lebensmittel<br />
dürfen nun einmal nicht auf den Tellern<br />
der Verbraucher landen. Diese Haltung<br />
entspringt der Vernunft – daraus aber eine<br />
Selbstverständlichkeit ableiten? Die Wirklichkeit<br />
sieht anders aus – trotz gesetzlicher<br />
Regelungen, die den Schutz des Verbrauchers<br />
über wirtschaftliche Interessen stellen.<br />
In Niedersachsen prüft und überwacht<br />
daher das LAVES mithilfe moderner Anamittelchemikerin<br />
hat ihren Beruf von der<br />
Pike auf erlernt: Ausbildung zur Chemielaborantin;<br />
Abitur auf dem zweiten Bildungsweg;<br />
Studium der Lebensmittelchemie;<br />
Promotion. Fleißig. Ehrgeizig. Talentiert.<br />
Der strahlende Blick hinter den Brillengläsern<br />
unter der Kurzhaarfrisur betont<br />
ihre frische, heitere Natur. Dem LAVES-<br />
Wissenschaftsstab gehört sie seit 1995 an.<br />
Vor ihrem Wechsel ins Pestizidlabor fahndete<br />
Dr. Suckrau im Auftrag des LAVES<br />
nach Dioxin in Lebens- und Futtermitteln.<br />
Vier wissenschaftliche und 15 technische<br />
Mitarbeiter, bei denen es sich vorwiegend<br />
um Mitarbeiterinnen handelt, zählt<br />
das Pestizidlabor. „Als ich hier anfing“,<br />
erinnert sich Dr. Iris Suckrau, „waren wir<br />
nur zu viert.“ Die Wissenschaftlerin sitzt<br />
an ihrem Schreibtisch, entspannt zurückgelehnt,<br />
lächelt. Die Tischplatte vor ihr ist<br />
aufgeräumt, das Büro einfach und praktisch.<br />
Im Büro verbringe sie wenigstens<br />
ebenso viel Zeit wie im Labor, um Analysenprotokolle<br />
auszuwerten, Messergebnisse<br />
zu interpretieren und Gutachten zu<br />
erstellen. „Was wir produzieren“, sagt die<br />
Wissenschaftlerin, „muss juristisch einwandfrei<br />
und vor Gericht unanfechtbar<br />
sein.“<br />
8 <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011
Zur Kundschaft des LAVES zählen<br />
die Lebensmittelüberwachungsbehörden,<br />
die Landkreise sowie die kreisfreien<br />
Städte. „Wir arbeiten nicht für Privatpersonen<br />
oder für Unternehmen, sondern<br />
ausschließlich in hoheitlichem Auftrag“,<br />
erklärt die Wissenschaftlerin. Die<br />
rund 3000 Lebens- und Futtermittelproben,<br />
die das Landesamt alljährlich auf Pestizide<br />
untersucht, werden in der Regel auf<br />
behördliches Geheiß eingesandt.<br />
Lebensmittelanalytik vor<br />
allem saisonaler Erzeugnisse<br />
Früher, erinnert sich Iris Suckrau, seien die<br />
Lebensmittelkontrolleure beauftragt gewesen,<br />
jeder für sich eine bestimmte Anzahl<br />
von Proben zur Untersuchung abzuliefern.<br />
Mancher Pfiffikus sei daraufhin schnurstracks<br />
in den nächsten Supermarkt gelaufen,<br />
um sich an der Obsttheke mit Erfolg<br />
versprechenden Südfrüchten einzudecken,<br />
Teammitglieder: Tof, Casper, Ernie, Bert – kein GC/<br />
MS-System im Pestizidlabor des LAVES, das keinen<br />
„Kosenamen“ bekommen hätte.<br />
Was wäre die moderne Pestizidanalytik ohne die<br />
QuEChERS-Methode? Die <strong>GERSTEL</strong>-Option Automated<br />
Liner EXchange erlaubt lange Sequenzen<br />
mit validen Daten. Der Anwender sagt Danke.<br />
die übrigens in puncto Schadstoffbelastung<br />
heute viel besser seien als ihr Ruf. Dr. Iris<br />
Suckrau: „Die waren natürlich im Handumdrehen<br />
mit ihrer Arbeit fertig.“ Wirklich<br />
sinnig und hilfreich sei das allerdings<br />
nicht gewesen.<br />
Die Zeiten haben sich geändert. Beliebigkeit<br />
ist out. Heute werde zunehmend<br />
risikoorientiert und breitflächig vor der<br />
eigenen Tür gekehrt: „Der Fokus liegt vor<br />
allem darauf, saisonale Erzeugnisse der<br />
Region wie Spargel oder Erdbeeren unter<br />
die Lupe zu nehmen, um, wenn Sie so wollen,<br />
den eigenen Stall sauber zu halten“,<br />
erläutert Dr. Suckrau.<br />
Wenn Greenpeace wieder einmal Zahlen<br />
vorlegt, die auf eine erhöhte Belastung<br />
von Paprika, Salat & <strong>Co</strong>. mit chemischen<br />
Rückständen hindeuten, steigt das<br />
Arbeitsaufkommen im Pestizidlabor des<br />
LAVES. Durch die Nachrichten sensibilisiert,<br />
schauen die Lebensmittelkontrolleure<br />
bei ihren unangemeldeten Stippvisiten<br />
in Bäckereien, Metzgereien, Imbissbuden,<br />
Gaststätten, Großküchen, Handelsunternehmen,<br />
landwirtschaftlichen Betrieben<br />
und der Lebensmittelindustrie noch<br />
etwas genauer hin, ob die vorgeschriebenen<br />
Hygienerichtlinien und Qualitätsstandards<br />
eingehalten werden beziehungsweise<br />
nur einwandfreie Ware verarbeitet, hergestellt<br />
und angeboten wird.<br />
Lassen Güte und Qualität zu wünschen<br />
übrig, keimt auch nur der leiseste<br />
Verdacht eines Verstoßes gegen das Verbraucherschutz-<br />
und Lebensmittelrecht,<br />
ist der Kontrolleur gehalten, verdächtiges<br />
Material doppelt zu beproben, erklärt Dr.<br />
Suckrau: „Die Erstprobe landet zur Untersuchung<br />
bei uns.“ Die identische Zweitprobe<br />
wird dem beprobten Unternehmen<br />
überlassen, auf dass es im Streitfall, beispielsweise<br />
bei einer vom LAVES festgestellten<br />
überhöhten Pestizidbelastung, ein<br />
Gegengutachten bei einem privaten Labor<br />
in Auftrag geben kann. Da dieser Schritt<br />
mit erheblichen Kosten verbunden ist,<br />
wird in der Regel zunächst der Rechtsweg<br />
beschritten und ein Anwalt eingeschaltet.<br />
„Das Erste, was der Anwalt eines<br />
Unternehmens nach Vorliegen meines<br />
Gutachtens macht“, erklärt die Wissenschaftlerin,<br />
„ist eine Detailprüfung, ob die<br />
Probennahme ordnungsgemäß und richtig<br />
verlaufen ist.“ Weil es sich bei der Probennahme<br />
um einen diffizilen, stark reglementierten<br />
Vorgang handelt, schult das LAVES<br />
einmal im Jahr alle Lebensmittelkontrolleure,<br />
bei denen es sich häufig um Bäcker,<br />
Köche oder Angehörige anderer Berufe der<br />
Lebensmittelbranche handelt, die sich zum<br />
Lebensmittelkontrolleur haben weiterbilden<br />
lassen. Nur wenn die Prüfer ihren Job<br />
richtig machen, können Dr. Iris Suckrau<br />
und ihr Team im Pestizidlabor des LAVES<br />
erfolgreich arbeiten.<br />
Blick hinter die Kulissen des<br />
LAVES-Pestizidlabors<br />
Zischen, Glucksen und Klackern erfüllt<br />
den Raum, das Sonnenlicht wird von den<br />
heruntergelassenen Rollos gelenkt. Das<br />
Interieur des GC/MS-Labors schafft eine<br />
gewisse Vertrautheit für jene, die sich in der<br />
Gaschromatographie beheimatet fühlen:<br />
GC-Laboratorien gleichen sich immer auf<br />
die eine oder andere Weise. Auf den Labortischen<br />
– ein GC/MS-System ordentlich<br />
neben dem nächsten; dahinter Gasleitungen<br />
und Kabel, die gen Decke verlaufen,<br />
Absaugstutzen und Steckerleisten<br />
– herrscht das für dieses technische Equipment<br />
immer gleiche Tohuwabohu.<br />
Das aber ist nicht störend. Kennzeichen<br />
für Leistung ist nicht die Ordnung im<br />
GC-TOF-MS für das Pestizid-Screening. Dank des <strong>GERSTEL</strong>-MPS mit der Option Automated Liner EXchange<br />
(ALEX) lassen sich auch „schmutzige“ Proben einfach handhaben.<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011 9
Kabelsalat, sondern die Gerätschaft, deren<br />
Ausstattung mit Blick auf die Vorderfront<br />
offensichtlich wird.<br />
Die meisten GC/MS-Systeme tragen<br />
einen <strong>GERSTEL</strong>-MPS, ausgestattet mit<br />
den unterschiedlichsten Funktionen und<br />
Optionen für eine umfangreiche automatisierte<br />
Probenvorbereitung: von Flüssigaufgabe<br />
über Large-Volume-Injektion bis<br />
Headspace-Technik und SPME.<br />
Die QuEChERS-Extraktionsmethode,<br />
weit verbreitet in der Pestizidanalytik<br />
zur Bestimmung auch sehr stark matrixhaltiger<br />
Proben, ist auch im Pestizidlabor<br />
des LAVES Teil der täglichen Routine;<br />
allerdings injiziert man automatisiert unter<br />
Einsatz der <strong>GERSTEL</strong>-Option Automated<br />
Liner EXchange (ALEX). Nach rund<br />
20 Injektionen wird der Liner automatisch<br />
gewechselt. Erdbeeren und andere komplexe<br />
Matrices stellen dank ALEX kein<br />
Problem dar.<br />
Dr. Suckrau positioniert sich am GC-<br />
Time-of-Flight-Massenspektrometer<br />
(TOF), auf dem die ersten Messungen<br />
einer Probe gefahren werden: „Das Screening<br />
mittels GC-TOF-MS und LC-TOF-<br />
MS liefert uns wichtige Anhaltspunkte<br />
über die für uns interessanten Inhaltsstoffe<br />
einer Probe, und wir können eine<br />
Vorstellung davon entwickeln, wie weiter<br />
verfahren werden muss, um zum Beispiel<br />
die tatsächlichen Höchstgehalte der Pestizide<br />
gemäß EG-Verordnung 396/2005<br />
bestimmen zu können.“ Die Quantifizierung<br />
erfolgt mittels Vierpunkt-Kalibrierung.<br />
Liegt eine Überschreitung der zulässigen<br />
Höchstgehalte vor, wird statistisch<br />
Das LAVES verfügt über ein umfangreiches Arsenal<br />
an Standardsubstanzen, die zu Referenzzwecken<br />
im Rahmen von Verdünnungsreihen eingesetzt<br />
werden können und der Quantifizierung dienen.<br />
Katja Kruse (vorn): „Mit dem MultiPurposeSampler lässt sich der Arbeitsalltag effizienter gestalten.“<br />
exakt und nachvollziehbar weitergearbeitet,<br />
nämlich mittels Standardaddition. Dabei<br />
werden die nachgewiesenen Pestizide<br />
der jeweiligen Probe zugesetzt. „Apropos<br />
Standardaddition“, sagt Dr. Suckrau, „kommen<br />
Sie einmal mit.“ Die Wissenschaftlerin<br />
marschiert in Richtung Fenster. Am<br />
Ende des Tisches biegt sie rechts ab und<br />
bleibt vor einer XL-Version der GERS-<br />
TEL-MPS-PrepStation stehen. „Seiner<br />
Spannweite wegen“, erklärt Suckraus Mitarbeiterin<br />
Katja Kruse, „nennen wir dieses<br />
MPS-Stand-alone-Gerät <strong>Co</strong>ndor.“<br />
Auch Laborroboter<br />
sind nur Menschen ...<br />
Alle GC/MS-Systeme im Raum tragen,<br />
am Rande bemerkt, Kosenamen: Sie heißen<br />
Casper, Ernie oder Bert, und man<br />
könnte meinen, nicht allein die „Sesamstraße“<br />
habe hier Pate gestanden. Durch die<br />
Namensgebung falle es leichter, bemerkt<br />
Dr. Suckrau, die verschiedenen Geräte und<br />
die darauf ausgeführten Arbeiten im Blick<br />
zu behalten. Unabhängig davon zeugt die<br />
konsequente Personalisierung von Maschinen<br />
wieder einmal aufs Neue von des Menschen<br />
Hang, Robotern menschliche Züge<br />
zu geben: die Maschine, Freund und Kollege<br />
...<br />
„Die PrepStation“, bemerkt Dr. Suckrau,<br />
„ist für uns überaus wichtig.“ Gemäß<br />
den Vorschriften der Europäischen Union<br />
zu Methodenvalidierung und Qualitätskontrolle<br />
im Rahmen der Pestizidanalytik<br />
gilt es, die Ergebnisse der Messung abzusichern;<br />
das LAVES besitzt zu diesem Zweck<br />
ein Arsenal hunderter Referenzsubstanzen,<br />
die zur Herstellung von Verdünnungsreihen<br />
eingesetzt werden können. „Wie sich<br />
herausgestellt hat“, setzt die Wissenschaftlerin<br />
ihre Erklärung fort, „liefert die Standardaddition<br />
bei der Absicherung von<br />
Höchstgehaltsüberschreitungen optimale<br />
Ergebnisse, und zwar sowohl für die GC/<br />
MS- als auch für die LC/MS-Analytik.“<br />
Bevor der „<strong>Co</strong>ndor“ seinen Platz im<br />
Labor eingenommen habe, sei sehr viel<br />
Zeit auf die Herstellung der Standardlösungen<br />
verwendet worden. Diese Arbeit sei<br />
nicht nur mit einer aufwendigen manuellen<br />
Tätigkeit verbunden gewesen, sie brachte<br />
zudem nicht immer den gewünschten<br />
Erfolg. Dr. Suckrau: „Mit der MPS-Prep-<br />
Station arbeiten wir heute nicht nur effizienter,<br />
wir erzielen damit zudem durch die<br />
Bank optimale, zuverlässige, sehr gut reproduzierbare<br />
Resultate.“<br />
Und das sei insbesondere für ein Landesamt<br />
sinnvoll und notwendig, das mit<br />
gerichtsfesten Analysenergebnissen nachhaltig<br />
zum Verbraucherschutz beitrage.<br />
Auf einer Wellenlänge: Seit 1997 arbeitet Dr. Iris<br />
Suckrau (l.) mit <strong>GERSTEL</strong> zusammen. Das erste<br />
Gespräch mit Vertriebsleiter Michael Gröger (r.)<br />
betraf das KaltAufgabeSystem (KAS).<br />
Weitere Informationen<br />
über den <strong>GERSTEL</strong>-MultiPurposeSampler<br />
(MPS) für die GC/MS, LC/MS und als<br />
Stand-alone-Version (PrepStation)<br />
unter www.gerstel.de<br />
10 <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011
Forensische Toxikologie<br />
Unterwegs in postmortaler und Drogenanalytik<br />
Dank der guten Zusammenarbeit mit<br />
der Gesellschaft für Toxikologische<br />
und Forensische Chemie (GTFCh)<br />
ist es <strong>GERSTEL</strong> gelungen, innovative<br />
analytische Lösungen auch für die<br />
forensisch-toxikologische Praxis zu<br />
entwickeln und im Rahmen turnusmäßiger<br />
Workshops der GTFCh erfolgreich<br />
einem interessierten Fachpublikum<br />
zu präsentieren.<br />
Alle Jahre wieder im Herbst führt die<br />
GTFCh einen internationalen Workshop<br />
durch, dessen Ziel es ist, das Wissen<br />
ihrer Mitglieder in puncto forensisch-chemischer<br />
Praxis zu erweitern und zu vertiefen.<br />
Der Workshop bietet auch Geräteherstellern<br />
die Möglichkeit, ihre für forensische<br />
Toxikologen interessanten Analysenlösungen<br />
im Rahmen einer Industrieausstellung<br />
sowie im Praxiseinsatz zu präsentieren.<br />
2010 war <strong>GERSTEL</strong> mit von der<br />
Partie. In dem damals von Prof. Thomas<br />
Daldrup vom Institut für Rechtsmedizin<br />
der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf<br />
ausgerichteten Workshop konnte<br />
das Unternehmen die Effektivität und<br />
Wirksamkeit der Stir Bar Sorptive Extraction<br />
(SBSE) mit dem <strong>GERSTEL</strong>-PDMS-<br />
Twister unter Beweis stellen: „Die Aufgabe<br />
bestand darin“, erklärt Dr. Oliver Lerch,<br />
„Drogen- beziehungsweise Arzneimittelwirkstoffe<br />
aus postmortalem Gehirngewebe<br />
zu screenen, was uns erfolgreich<br />
gelang“, schildert der promovierte Che-<br />
Paralleles Eindampfen<br />
mehrerer Proben<br />
miker aus der <strong>GERSTEL</strong>-Applikationsabteilung,<br />
unter dessen Federführung in<br />
enger Kooperation mit Susanne Sperling<br />
aus der Entwicklungsabteilung die grundlegenden<br />
methodischen Arbeiten im Labor<br />
sowie im Rahmen des Workshops vor Ort<br />
aus- und durchgeführt wurden. [1,2]<br />
Wenige Monate später, im Frühjahr<br />
2011, wurde das Unternehmen gebeten,<br />
sich auch an dem diesjährigen GTFCh-<br />
Workshop in Kiel aktiv zu beteiligen.<br />
Die Aufgabe lautete, den Cannabiswirkstoff<br />
Tetrahydrocannabinol (THC)<br />
sowie dessen Metaboliten aus Serum<br />
nach <strong>GERSTEL</strong>-Manier automatisiert<br />
zu bestimmen; der THC-Nachweis ist Teil<br />
der täglichen Praxis eines forensisch-toxikologischen<br />
Labors. Dr. Oliver Lerch: „In<br />
enger Zusammenarbeit mit Dr. Gertrud<br />
Rochholz, der Leiterin der forensischen<br />
Toxikologie des Instituts für Rechtsmedizin<br />
der Universität Kiel, und ihren Kollegen<br />
haben wir eine effiziente GC/MS-<br />
Mit der <strong>GERSTEL</strong>-MultiPosition Evaporation Station (mVAP)<br />
lässt sich die automatisierte Probenvorbereitung um einen<br />
effizienten Eindampfschritt erweitern. So lassen sich beispielsweise<br />
Nachweisgrenzen herabsetzen oder Lösungsmittel für die<br />
nachfolgende GC/MS- oder LC/MS-Analyse wechseln. mVAP ist eine<br />
modulare Option für den <strong>GERSTEL</strong>-MultiPurposeSampler (MPS): Bis<br />
zu 196 Proben in Autosampler-Vials lassen sich in Batches von bis zu sechs Proben automatisch<br />
einengen und in einem anderen Lösemittel wieder aufnehmen. Die Bedingungen zur Entfernung<br />
des Lösungsmittels, Vakuum, Temperatur und Agitation, sind frei wählbar und gewährleisten<br />
ein schonendes Eindampfen bei minimiertem Analytenverlust. Das Einengen mittels mVAP<br />
lässt sich mit dem ganzen Repertoire an Probenvorbereitungs- und Aufreinigungstechnologien<br />
kombinieren, beispielsweise mit der SPE, der dispersiven SPE (DPX) oder der Flüssigextraktion.<br />
Jeder Schritt, angefangen bei der Probenvorbereitung inklusive mVAP bis zur LC/MS- und GC/<br />
MS-Probenaufgabe, wird per Mausklick in der MAESTRO-Software eingestellt.<br />
Weitere Informationen: www.gerstel.de/de/Paralleles-Einengen-mVAP.htm<br />
Methode entwickelt, deren Probenvorbereitung<br />
auf der automatisierten Festphasenextraktion<br />
(SPE-Option des Multi-<br />
PurposeSampler, MPS) sowie der neuen<br />
<strong>GERSTEL</strong>-mVAP-Technik basiert.“<br />
Nach Positionierung der Probe auf einem<br />
Probenteller am Autosampler arbeitet das<br />
System voll automatisiert, sprich SPE,<br />
Eindampfen des Eluats, Wiederaufnahme<br />
in Derivatisierungsreagenz und Injektion<br />
in die GC/MS werden vom Autosampler<br />
durchgeführt.<br />
Die neue <strong>GERSTEL</strong>-MPS-SPEmVAP-GC/MS-Methode<br />
zum Nachweis<br />
von THC und seiner Metaboliten<br />
aus Serum erwies sich erfolgreich im Vergleich<br />
mit der bestehenden, nach GTFCh-<br />
Richtlinien validierten Methode und bietet<br />
darüber hinaus weiteres Potenzial: „Derzeit<br />
wird daran gearbeitet“, sagt Dr. Oliver<br />
Lerch, „die Methode weiter zu verfeinern<br />
und für den Routineeinsatz zu validieren.<br />
Ebenso wird darüber nachgedacht, weitere<br />
forensisch-toxikologische Anwendungen<br />
auf das automatisierte MPS-SPE-mVAP-<br />
GC/MS-System zu übertragen.“ Über die<br />
Ergebnisse könne man sich im forensischtoxikologischen<br />
Fachkreis möglicherweise<br />
schon im kommenden Jahr unterhalten:<br />
Man stehe im Gespräch mit den Veranstaltern<br />
über eine erneute Teilnahme des<br />
Unternehmens am nächsten GTFCh-<br />
Workshop 2013 in München.<br />
Weitere Informationen<br />
[1] Todesursachenforschung mit den<br />
Mitteln der Chemie (www.laborpraxis.<br />
vogel.de/management/berufundkarriere/<br />
weiterbildung/articles/287683/)<br />
[2] GC/MS-Screening von Gewebe auf<br />
Drogen- und Arzneimittelrückstände<br />
(www.laborpraxis.vogel.de/labortechnik/<br />
probenvorbereitung/extraktionsgeraete/<br />
articles/291<strong>32</strong>6/)<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011 11
Aromaprofiling von Whiskey<br />
Auf den Geschmack<br />
gekommen<br />
Die gaschromatographische Ermittlung von Geschmacksprofilen<br />
alkoholischer Getränke, die gelöste Feststoffe enthalten, kann<br />
sich als Herausforderung erweisen. Wie nämlich gelingt es,<br />
Haupt- und Spurenbestandteile gleichermaßen empfindlich und<br />
störungsfrei zu detektieren? Ein namhafter Spirituosenhersteller<br />
setzt mit Erfolg auf eine Kombination von statischer und<br />
dynamischer Headspace-Technik.<br />
andelsübliche destillierte Spirituosen<br />
H sind komplexe Mischungen unterschiedlichster<br />
Geschmacksverbindungen<br />
in einer dominanten Ethanol-Wasser-Matrix<br />
[1,2]. Die Geschmacksstoffe<br />
entstammen meist den zugrunde liegenden<br />
Produktionsprozessen wie Rohstoffextraktion,<br />
Fermentation und Destillation<br />
sowie, sofern zutreffend, der Reifung,<br />
etwa im Eichenfass. Von einigen Ausnahmen<br />
einmal abgesehen, sind die meisten<br />
Geschmacksstoffe destillierter Spirituosen<br />
GC-gängig. Ihre Matrix ist relativ<br />
rein, sodass eine direkte Aufgabe der<br />
Alkoholprobe in den GC meist ohne zeitraubende<br />
Probenvorbereitung möglich ist.<br />
Die Quantifizierung erfolgt durch einfache<br />
Split-Injektion in den GC und anschließende<br />
Flammenionisationsdetektion [3,4];<br />
höhere Ester und Säuren lassen sich ebenfalls<br />
durch Direktaufgabe von 5 bis 10 µL<br />
Probe und unter Einsatz eines PTV-Injektors<br />
zur Entfernung von Lösungsmittelresten<br />
gaschromatographisch bestimmen.<br />
Um niedrigere Nachweisgrenzen zu erreichen,<br />
lässt sich die Injektionsmenge von<br />
Fall zu Fall auf 50 bis 100 μL erhöhen; hierbei<br />
ist allerdings darauf zu achten, dass der<br />
Liner im Injektionseinlass nicht überlastet<br />
oder Analyten über das Splitventil verloren<br />
gehen. Daher ist eine genaue Abstimmung<br />
der Injektionsgeschwindigkeit sowie weiterer<br />
Methodenparameter notwendig [5].<br />
Wenn nicht-flüchtige Bestandteile<br />
die Matrix belasten<br />
Eine Direktaufgabe scheidet in der Regel<br />
aus, wenn die zu untersuchende Probe<br />
erhebliche Mengen nicht-flüchtiger<br />
Bestandteile beinhaltet. Bei Likören etwa<br />
kann der hohe Zuckeranteil störend sein;<br />
bei sehr alten Brandys und Whiskeys sind<br />
polyphenolische Verbindungen problematisch,<br />
die dem Reifungsprozess im Eichenfass<br />
entstammen. Wird bei der GC-Analyse<br />
dieser Proben nicht regelmäßig der<br />
Liner gewechselt, reichert sich das nichtflüchtige<br />
Material an und es besteht das<br />
Risiko, dass das Einlasssystem und die<br />
Trennsäule kontaminiert werden und die<br />
Analyse beeinträchtigen. Zuckerartefakte,<br />
die sich im heißen Einlassventil bilden,<br />
könnten zudem die Auswertung der Chromatogramme<br />
erschweren.<br />
Wenn sich also Spirituosen aus den<br />
genannten Gründen nicht direkt aufgeben<br />
lassen, bleibt dem Anwender keine andere<br />
Wahl, als auf alternative Extraktions- und<br />
Aufgabetechniken zurückzugreifen, die<br />
sich durch eine hohe Fracht unlöslicher<br />
Bestandteile in der Probe in ihrer Effizienz<br />
und Zuverlässigkeit nicht beeinträchtigen<br />
lassen. Hierzu zählen unter anderem<br />
die Festphasenmikroextraktion (Solid<br />
Phase Micro Extraction, SPME), die Stir<br />
12 <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011
Bar Sorptive Extraction (SBSE) mit dem<br />
<strong>GERSTEL</strong>-Twister, die HeadSpaceSorptive<br />
Extraction (HSSE) sowie die statische<br />
(HS) und dynamische Headspace-Technik<br />
(DHS). Alle genannten Techniken haben<br />
sich in der Laborpraxis bewährt und wurden<br />
vielfach in der Literatur beschrieben<br />
[6-12]. Ziel der vorliegenden Arbeit war<br />
es zu untersuchen, ob und wie sich mittels<br />
der sequenziellen Anwendung von statischer<br />
(HS) und dynamischer Headspace<br />
(DHS) Geschmacksprofile von in gereiftem<br />
Whiskey vorkommenden Haupt- und<br />
Nebenbestandteilen erstellen lassen.<br />
Dass die Kombination von HS und<br />
DHS auf einem Gerät sinnvoll und richtig<br />
ist, macht folgende Überlegung deutlich:<br />
Während Hauptaroma- und Geschmackskomponenten<br />
in der Regel in hoher Konzentration<br />
vorliegen, finden sich Nebenkomponenten<br />
meist nur in Spuren. Um<br />
Spurenverbindungen in hinreichender,<br />
sprich: analysierbarer Menge trappen zu<br />
können, wird die dynamische Headspace-<br />
Extraktion (DHS) eingesetzt. Die DHS<br />
auf Hauptkomponenten anzusetzen, wäre<br />
hingegen ein Zuviel des Guten; die Konsequenz<br />
wäre eine Überladung der Säule. Die<br />
konventionelle statische HS liefert dafür<br />
eine ausreichende Ausbeute an Analyten.<br />
Als Königsweg erweist sich allerdings,<br />
beide HS-Techniken auf einem Sampler zu<br />
kombinieren, um bedarfsorientiert schnell<br />
und effektiv wechseln zu können.<br />
Um die Empfindlichkeit für jeden<br />
Modus zu optimieren, wird ein KaltAufgabeSystem<br />
(KAS, PTV-Injektor, Solventvent-Modus)<br />
eingesetzt; die Analyten werden<br />
im gepackten Liner fokussiert, um sie<br />
anschließend punktförmig auf die Trennsäule<br />
überführen zu können. Eine kurze<br />
apolare Kapillarsäule (di = 0,15 mm) mit<br />
einem Phasenverhältnis von 19 ermöglicht<br />
eine schnelle Analyse und exzellente<br />
Trennung der interessanten Verbindungen.<br />
Als ideal erweist es sich, wie im weiteren<br />
Verlauf dieser Arbeit dargelegt wird,<br />
die beschriebenen Abläufe vollständig zu<br />
Abundance<br />
8000000<br />
6000000<br />
4000000<br />
2000000<br />
Abundance<br />
8000000<br />
6000000<br />
4000000<br />
2000000<br />
1<br />
2<br />
3<br />
10.00<br />
Time--> 20.00 30.00<br />
15.00 25.00 35.00<br />
Abb. 2 HS-Chromatogramm eines gereiften Whiskeys<br />
(Peakzuordnung siehe Tabelle rechts).<br />
2 3<br />
45 7 8<br />
6 9<br />
10 11<br />
8<br />
7<br />
10.00<br />
Time--> 20.00 30.00<br />
15.00 25.00 35.00<br />
Abb. 3 DHS-Chromatogramm eines gereiften<br />
Whiskeys (Peakzuordnung siehe Tabelle rechts).<br />
TDU-Röhrchen<br />
Probe<br />
Adsorbenz<br />
Bevorratung<br />
(4-200 ºC)<br />
Abb. 1 <strong>GERSTEL</strong>-MultiPurposeSampler<br />
(MPS) mit HS- und DHS-Option auf<br />
einem GC 7890 von Agilent Technologies.<br />
10 11<br />
Abb. 4 Schema des DHS-Prozesses.<br />
12<br />
14 1518<br />
13<br />
16<br />
12<br />
17<br />
17<br />
21<br />
27 33<br />
15 18<br />
21 27 33 38<br />
38<br />
31<br />
<strong>32</strong><br />
36<br />
34<br />
13<br />
14<br />
29 30<br />
19 26 35<br />
16 20 24<br />
22 23 37<br />
25 28<br />
Trapping<br />
20 - 70 ºC<br />
Gas<br />
Extraktion<br />
im DHS<br />
43<br />
39 40<br />
41 42<br />
Optionale<br />
Trocknung<br />
1 Propanol<br />
2 Ethylacetat<br />
3 Isobutanol<br />
4 3-Methylbutanal<br />
5 2-Methylbutanal<br />
6 1-Butanol<br />
7 1,1-Diethoxymethan<br />
8 Propansäureethylester<br />
9 n-Propylacetat<br />
10 3-Methyl-1-butanol<br />
11 2-Methyl-1-butanol<br />
12 Isobuttersäureethylester<br />
13 Isobutylacetat<br />
14 Buttersäureethylester<br />
15 Buttersäure-2&3-methyl-ethylester<br />
16 Isobutyraldehyd-diethylacetat<br />
17 Isoamylacetat<br />
18 2-Methyl-1-butylacetat<br />
19 Butyraldehyd-diethylacetal<br />
20 Acetaldehyd-ethyl-amylacetal<br />
21 Hexansäureethylester<br />
22 Hexylacetat<br />
23 Heptansäureethylester<br />
24 Nonanal<br />
25 ß-Phenylethylalkohol<br />
26 Octansäure<br />
27 Octansäureethylester<br />
28 Decanal<br />
29 ß-Phenylethylacetat<br />
30 Nonansäureethylester<br />
31 Decansäure<br />
<strong>32</strong> Ethyl-trans-4-decenoat<br />
33 Decansäureethylester<br />
34 Octansäure-3-methyl-butylester<br />
35 1-Ethylpropyloctanoat<br />
36 Caprinsäureisobutylester<br />
37 Dodecansäure<br />
38 Decansäureethylester<br />
39 Pentadecansäure-3-methyl-butylester<br />
40 Pentadecansäure-2-methyl-butylester<br />
41 Tetradecansäureethylester<br />
42 Ethyl-9-hexadecenoat<br />
43 Hexadecansäureethylester<br />
Tabelle 1 Im Whiskey-Aroma mittels<br />
HS-GC/MS und DHS-GC/MS<br />
nachgewiesene Verbindungen.<br />
Thermodesorption<br />
20 - 350 ºC<br />
Desorption im TDU<br />
Refokussierung<br />
im KAS<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011 13
automatisieren.<br />
Probenvorbereitung.<br />
10-mL-<br />
Headspace-Vials<br />
werden mit Proben<br />
befüllt und<br />
durch mit Septen<br />
bestückte<br />
Metallkappen<br />
verschlossen.<br />
Sobald die Vials<br />
auf den Probentellern<br />
des MPS<br />
platziert und die<br />
Parameter der<br />
MAESTRO-Steuersoftware per Mausklick<br />
gesetzt sind, erfordert die Untersuchung<br />
der Proben keine weitere manuelle<br />
Tätigkeit.<br />
Randbemerkung: Wässrige Proben<br />
beziehungsweise Proben mit einem hohen<br />
Wassergehalt können sich in der HS/<br />
DHS-Analyse als problematisch erweisen<br />
und die Präzision der Analyse beeinträchtigen.<br />
Als Gegenmaßnahme wird das<br />
KAS im Lösungsmittelausblendungsmodus<br />
(Solvent-vent mode) und mit einem<br />
Statische Headspace (HS)<br />
KAS:<br />
MPS:<br />
Tenax TA, Solvent-vent mode<br />
60 °C Inkubationstemperatur<br />
(10 min)<br />
2,5 mL Injektionsvolumen<br />
Dynamische Headspace (DHS)<br />
Probenfalle: Tenax TA<br />
DHS: 30 °C Fallentemperatur<br />
60 °C Inkubationstemperatur<br />
(10 min)<br />
50 mL Spülvolumen<br />
10 mL/min Spülfluss<br />
10 mL Trockenvolumen<br />
5 mL/min Trockenfluss<br />
TDU: solvent venting<br />
20 °C (1 min);<br />
720 °C/min; 110 °C (1 min);<br />
720 °C/min; 300 °C (3 min)<br />
<strong>GERSTEL</strong>-TDU<br />
KAS: Tenax TA Liner, Solvent-vent<br />
mode (60 mL/min) bei 0 kPa<br />
Splitless (2 min)<br />
20 °C (0,2 min); 10 °C/s;<br />
300 °C (5 min)<br />
Säule: 25 m CP-SIL 5CB (Varian)<br />
di = 0,15 mm, df = 2,0 μm<br />
Pneumatik: He, konstanter Fluss =<br />
0,5 mL/min<br />
Ofen: 40 °C (10 min); 10 °C/min;<br />
300 °C (6 min)<br />
MSD: Scan, mz = 28-350<br />
Tenax-gefüllten Liner betrieben, wodurch<br />
sich die Wasserlast signifikant reduzieren<br />
lässt. Bei Einsatz des Dynamic Headspace-Systems<br />
(DHS) werden die Analyten<br />
kontinuierlich aus dem Dampfraum<br />
über der Probe zum Adsorbens transportiert.<br />
Sofern nicht alle Feuchtigkeit entfernt<br />
wurde, ermöglicht das DHS-System<br />
die automatisierte Trocknung des Adsorbensröhrchens<br />
im Gasstrom.<br />
Die Desorption der Analyten erfolgt<br />
automatisiert in der ThermalDesorption-<br />
Unit (TDU); sie werden im KAS cryofokussiert<br />
und temperaturprogrammiert auf<br />
die Trennsäule gegeben, was zu einer sehr<br />
guten Peakform führt. Durch eine zusätzliche<br />
Lösungsmittelausblendung im TDU<br />
lassen sich unter anderem Fuselalkohole<br />
aus dem System entfernen.<br />
Ergebnis und Diskussion<br />
Um den von uns gewählten Analysenansatz<br />
auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen,<br />
wurde fassgereifter Whiskey mittels der<br />
Kombination von HS und DHS untersucht.<br />
Die statische HS brachte Chromatogramme<br />
(Abbildung 2) zutage, die von<br />
Fusel- oder höheren Alkoholen zusammen<br />
mit Ethylacetat und den wesentlichen<br />
geradkettigen Fettsäureestern bis zu Dodecansäure<br />
dominiert wurden. Ebenfalls zu<br />
sehen sind deutliche Signale von Aldehyden,<br />
Ethylestern und Acetalen im vorderen<br />
Elutionsbereich. Als besonders wichtig<br />
erweisen sich die Ethylester kurzkettiger<br />
Fettsäuren, ihres angenehmen Aromas<br />
wegen auch Fruchtester genannt. Beißend<br />
riechende Aldehyde sowie süß schmeckende<br />
Acetale verschiedener Alkohole<br />
können das Aroma ebenfalls beeinflussen.<br />
Das Chromatogramm der dynamischen<br />
Headspace wiederum zeigt ein<br />
ganz anderes Bild. Während Alkohole bis<br />
C 5 zum Teil verloren gehen und der entsprechende<br />
Bereich des Chromatogramms<br />
nur geringe Aussagekraft besitzt, liefert<br />
der restliche Bereich im Chromatogramm<br />
umso mehr und detailreichere Daten. Im<br />
Bild zeigen sich viele geradkettige und verzweigte<br />
Ester sowie einige Säuren; Nonanal<br />
und Decanal wurden zuvor schon in Bier,<br />
Wein und <strong>Co</strong>gnac nachgewiesen, Komponenten<br />
also, die auch vermehrt in der<br />
Geschmacks- und Duftstoffindustrie eingesetzt<br />
werden.<br />
Fazit: Die Ergebnisse beider Injektionsmethoden<br />
sind sehr gut reproduzierbar;<br />
diese benötigen normalerweise nicht<br />
den Einsatz interner Standards. Die Kombination<br />
statischer und dynamischer Headspace-Techniken<br />
bietet einen nützlichen<br />
komplementären Ansatz zur Profilierung<br />
von Haupt- und Nebenbestandteilen in<br />
alkoholischen Getränken. Das gilt insbesondere<br />
für solche, die nicht unerhebliche<br />
Mengen an gelösten Feststoffen enthalten;<br />
sie verbleiben als Rückstand im Vial<br />
und belasten das GC/MS-System nicht.<br />
Die HS- beziehungsweise DHS-Analyse<br />
erfolgt voll automatisiert auf ein und<br />
demselben Autosampler; eine Offline-Probenvorbereitung<br />
ist nicht erforderlich. Für<br />
beide Techniken ist die einzig benötigte<br />
Probenvorbereitung die Verdünnung der<br />
Probe in einem Headspace-Vial. In beiden<br />
Fällen wird ein KaltAufgabeSystem (KAS)<br />
als PTV-Injektor im Solvent-vent Modus<br />
genutzt, um eine bestmögliche Chromatographie<br />
zu erreichen. Die Anwendung des<br />
hier vorgestellten kombinierten Ansatzes<br />
stellt ein effektives Routine-Analyseprotokoll<br />
für diese spezifische Produktgruppe<br />
dar, wobei eine Kontamination des GC-<br />
Liners mit schlecht verdampfbaren Komponenten<br />
verhindert wird.<br />
Autoren<br />
Kevin Mac Namara, Frank McGuigan<br />
Irish Distillers-Pernod Ricard, Midleton Distillery,<br />
Midleton, <strong>Co</strong>rk, Ireland<br />
Andreas Hoffmann<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong>,<br />
Eberhard-<strong>Gerstel</strong>-Platz 1,<br />
45473 Mülheim an der Ruhr, Deutschland<br />
LITERATUR<br />
[1] Aroma of Beer, Wine and Distilled Beverages,<br />
L. Nykänen, H. Suomalainen, Eds.<br />
Akademie-Verlag: Berlin (1983).<br />
[2] R. de Rijke, R. ter Heide, In Flavour of<br />
Distilled Beverages; J. Piggott Ed.; Ellis<br />
Horwood: Chichester (1983) 192.<br />
[3] K. Mac Namara, J. High Res. Chrom. 7<br />
(1984) 641.<br />
[4] R. Madera, B. Suárez Valles, J. Chrom.<br />
Sci. 45 (2007) 428.<br />
[5] J. Staniewski, J. Rijks, J. Chrom. A 623<br />
(1992) 105-113.<br />
[6] A. Zalacain, J. Marín, G. L. Alonso, M. R.<br />
Salinas, Talanta 71 (2007).<br />
[7] K. Schulz, J. Dressler, E.-M. Sohnius,<br />
D. W. Lachenmeier, J. Chrom. A 1145<br />
(2007) 204-209.<br />
[8] J. C. R. Demyttenaere, J. L. Sánchez Martínez,<br />
M. J. Téllez Valdés, R. Verhé, P.<br />
Sandra, Proceedings of the 25th ISCC,<br />
Riva del Garda, Italy (2002).<br />
[9] P. Salvadeo, R. Boggia, F. Evangelisti, P.<br />
Zunin, Food Chem. 105 (2007) 1228.<br />
[10] B. Tienpont, F. David, C. Bicchi, P. Sandra,<br />
J. Microcol. Sep. 12(11) 577-584<br />
(2002).<br />
[11] C. Bicchi, C. <strong>Co</strong>rdero, E. Liberto, P. Rubiolo,<br />
B. Sgorbini, P. Sandra, J. Chrom. A<br />
1071 (2005) 111- 118.<br />
[12] J. R. Stuff, J. A. Whitecavage, A. Hoffmann,<br />
<strong>GERSTEL</strong> Application Note<br />
AN/2008/4.<br />
14 <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011
Klinische Chemie<br />
Überleben sichern<br />
Der Erfolg einer Organtransplantation hängt maßgeblich davon ab, ob der Körper das fremde Gewebe annimmt. Um<br />
Abstoßungsreaktionen zu verhindern, wird das Immunsystem mit Immunsuppressiva moduliert. Deren Konzentration<br />
im Blut muss regelmäßig überprüft werden, soll die Therapie erfolgreich verlaufen. Als analytisch zuverlässig erweist<br />
sich hierzu der Nachweis mittels LC-MS/MS. Die Analytik lässt sich vollständig automatisieren.<br />
m sich gegen Bakterien, Viren, Pilze,<br />
U Parasiten und andere schädliche<br />
Umwelteinflüsse zur Wehr zu setzen, hat<br />
Mutter Natur den Menschen mit einem<br />
wirkungsvollen Abwehrmechanismus ausgestattet:<br />
dem Immunsystem. Fremdkörper,<br />
die unseren Organismus attackieren<br />
oder in ihn eindringen, lösen eine Generalmobilmachung<br />
aller Schutztruppen aus;<br />
der Eindringling wird mit aller Macht<br />
bekämpft.<br />
Problematisch wird es, wenn unser<br />
Schutzschild entgegen seiner eigentlichen<br />
Funktion selbstzerstörerische Tendenzen<br />
zeigt oder entwickelt und körpereigenes<br />
Gewebe angreift, wie es bei Autoimmunerkrankungen<br />
der Fall ist. Oder wenn es<br />
Dank der Einbindung<br />
einer Zentrifuge<br />
erlaubt der MPS auch<br />
die Abtrennung von<br />
zellulären Bestandteilen<br />
und gefällten Proteinen<br />
im Verlauf der<br />
automatisierten<br />
Probenvorbereitung.<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011 15
sich gegen Gewebe wendet, das aus therapeutischen<br />
Gründen implantiert wurde,<br />
etwa im Fall einer Organverpflanzung. In<br />
der Regel stößt der Organismus fremde<br />
Organe nämlich ab. Der Patient stürbe,<br />
wäre die Medizin nicht in der Lage, das<br />
Immunsystem medikamentös mittels sogenannter<br />
Immunsuppressiva zu beeinflussen,<br />
das heißt, seine Fähigkeit, Fremdgewebe<br />
abzustoßen, herabzusetzen.<br />
MOVE<br />
Monovette vom Tray<br />
zum Monovetten-<br />
Schüttler<br />
MIX Mischen der Monovetten im Agitator bei RT und 750 U/min<br />
ADD 50 μl Blut ins Probevial<br />
MIX Mischen der Probelösung<br />
ADD Zugabe von 500 μl MeOH (80 %) / ZnSO 4 ins Vial<br />
ADD Zugabe des internen Standards (Ascomycin und Cyclosporin D)<br />
Waschen mit<br />
NaCl-Lösung<br />
Waschen mit<br />
NaCl-Lösung<br />
Waschen mit<br />
MeOH/ZnSO 4<br />
Waschen<br />
mit MeOH/ZnSO 4<br />
MOVE<br />
Vial vom Schüttler<br />
zur Zentrifuge<br />
MOVE<br />
Vial von der<br />
Zentrifuge zum Tray<br />
MIX Mischen der Probelösung<br />
WAIT Stillstand (1 min.)<br />
CENTRIFUGE Zentrifugieren für 10 min. bei 6000 U/min.<br />
INJECT Aufgabe der Probe ins LC-Ventil<br />
Stufen der automatisierten Probenvorbereitung, abgewickelt mit dem<br />
MultiPurposeSampler (MPS) und gesteuert von der <strong>GERSTEL</strong>-MAESTRO-Software.<br />
Waschen mit<br />
NaCl-Lösung<br />
Komponente Percursor Produkt-Ion 1 Produkt-Ion 2<br />
[M-Na]* [m/z] [m/z]<br />
Cyclosporin A 1224,8 1112,5 1084,5<br />
Everolimus 980,6 453,2 389,2<br />
Sirolimus 936,5 409,2 345,1<br />
Tacrolimus 826,5 616,2 415,1<br />
Cyclosporin D (ISTD) 1238,5 1126,5 n. a.<br />
Ascomycin (ISTD) 814,5 604,2 n. a.<br />
MS/MS-Massenübergänge für die überwachten Immunsuppressiva.<br />
nung erfolgt mit<br />
einer Agilent 1200<br />
Rapid Resolution<br />
LC, die Detektion<br />
mit einem Massenspektrometer<br />
Agilent 6410<br />
QQQ.<br />
Ein in das<br />
LC-MS/MS-<br />
System integrierter<br />
<strong>GERSTEL</strong>-MultiPurposeSampler<br />
(MPS) wurde für die voll automatisierte<br />
Probenvorbereitung der Vollblutproben<br />
eingesetzt.<br />
Der MPS war ausgestattet mit einem<br />
Monovetten-Tray, einem Barcodeleser,<br />
zwei Schüttlern sowie einer Zentrifuge.<br />
Die Injektion erfolgte im Anschluss an<br />
die Probenvorbereitungsschritte direkt<br />
in das LC-MS/MS-System. Die Trennung<br />
der immunsuppressiven Wirkstoffe<br />
erfolgte auf einer Phenomenex-Gemini-<br />
NX-C18-Säule mit 0,1 mM Natriumacetat<br />
in Wasser und Methanol als Eluenten<br />
(Fluss 0,55 mL/min). Das Triple-Quadrupol-MS<br />
wurde mit einer Elektronensprayionisierungsquelle<br />
bei positiver Polarität<br />
betrieben.<br />
Automatisierte<br />
Probenvorbereitung und Analyse<br />
Die mit den Blutproben gefüllten Monovetten<br />
werden mittels eigens zu diesem<br />
Zweck entwickelten Adaptern in das vorgesehene<br />
Tray des MPS eingesetzt; anschlie-<br />
Überwachung des Medikamentenspiegels<br />
im Blut maßgeblich<br />
für den Therapieerfolg<br />
Cyclosporin A, Everolimus, Sirolimus und<br />
Tacrolimus sind die am häufigsten eingesetzten<br />
immunsuppressiven Arzneimittelstoffe.<br />
Auf Grund individueller Variationen<br />
in der pharmazeutischen Wirkung<br />
erhalten Patienten meist Kombinationen<br />
unterschiedlicher Wirkstoffe. Der<br />
Einsatz von Immunsuppressiva geschieht<br />
nicht ohne Risiko: Bei zu niedriger Dosierung<br />
ist nach wie vor mit Abstoßungsreaktionen<br />
zu rechnen; bei zu hoher Dosierung<br />
hingegen kann die Widerstandskraft<br />
des Organempfängers z. B. gegen Infektionen<br />
erheblich beeinträchtigt werden. Um<br />
den Therapieverlauf und -erfolg überwachen<br />
und sicherstellen zu können, muss die<br />
Arzneimittelkonzentration laufend kontrolliert<br />
werden. Hierzu haben sich insbesondere<br />
LC-MS/MS-Methoden bewährt,<br />
wobei sich die Probenvorbereitung als kritisch<br />
erweist. Weil Offline-Techniken sehr<br />
zeitaufwendig sind, präferieren klinische<br />
Laboratorien automatisierte Verfahren in<br />
Kombination mit der LC-MS/MS.<br />
Im Auftrag eines namhaften deutschen<br />
Universitätsklinikums wurde von<br />
der TeLA <strong>GmbH</strong> in Zusammenarbeit<br />
mit Experten der Firma <strong>GERSTEL</strong> eine<br />
LC-MS/MS-Methode entwickelt, die<br />
eine effiziente und sichere automatisierte<br />
Aufbereitung von Vollblutproben und die<br />
anschließende Bestimmung immunsuppressiver<br />
Wirkstoffe erlaubt.<br />
Gleichzeitig wurde dem Wunsch nach<br />
einer individualisierten Aufzeichnung von<br />
Messverlauf und -ergebnissen Rechnung<br />
getragen. Die chromatographische Trenßend<br />
startet das automatisierte Probenvorbereitungsprotokoll.<br />
Gearbeitet wird<br />
mit einem einfachen Ausfällungsschritt<br />
anstelle der aufwendigen SPE-Aufreinigung.<br />
Das Online-Verfahren kombiniert<br />
das Lesen der Barcodes der Monovetten,<br />
das Mischen der Blutproben, die Zugabe<br />
von 0,1 M ZnSO 4 -Lösung in Methanol<br />
sowie der internen Standards (Ascomycin,<br />
Cyclosporin D), das Mischen und das<br />
Analysenbedingungen<br />
HPLC<br />
Säule<br />
Phenomenex Gemini,<br />
NX 5µm C18 150 x 2,0 mm<br />
Säulentemperatur 65 °C<br />
Mobile Phase A: 0,1 mmol/L Na<br />
(CH 3 COO) in Wasser<br />
B: MeOH<br />
Flussrate 0,55 mL/min<br />
Gradient 65 % B bei 0 min;<br />
95 % B bei 1,2 min<br />
100 % B bei 3 min;<br />
65 % B bei 3,1 min<br />
Injektionsvolumen 10 µL<br />
MS<br />
Modus<br />
ESI positiv<br />
Gasfluss 11 L/min<br />
Gastemperatur 340 °C<br />
Vernebler 40 psi<br />
Vcap<br />
4000 V<br />
MS-Modus MRM, 1 Segment<br />
mit 10 Übergängen<br />
Dwelltime 100 ms<br />
16 <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011
EICs der Immunsuppressiva (nur Quantifizierungsübergänge).<br />
Identifizierung von Tacrolimus mittels Quant/Qual-Verhältnis und<br />
des Spektrums der Produkt-Ionen.<br />
Kalibriergerade von Tacrolimus.<br />
Reproduzierbarkeitstest für Tacrolimus: 15 Blutproben wurden automatisch<br />
vorbereitet und analysiert, jede versetzt mit 3 ng/mL Tacrolimus.<br />
anschließende Zentrifugieren. Der Überstand<br />
wird in ein Autosamplervial überführt<br />
und daraus ein Aliquot entnommen<br />
und zur Analyse in das LC-MS/MS-System<br />
gegeben. Die LC-Methode ist optimiert,<br />
um Elutionszeiten von weniger als<br />
2,5 min. für die Immunsuppressiva und<br />
internen Standards zu erreichen.<br />
Im positiven Elektronenspray-Modus<br />
bilden Immunsuppressiva bevorzugt Natriumaddukte.<br />
Während der Methodenentwicklung<br />
stellte sich heraus, dass die<br />
LC-MS/MS-Methode mit Natriumacetat<br />
eine signifikant höhere Empfindlichkeit<br />
und bessere Langzeitstabilität aufwies.<br />
Das ganze Verfahren wurde vollständig<br />
validiert. Der festgelegte therapeutische<br />
Bereich für Everolimus, Sirolimus<br />
und Tacrolimus in Vollblut betrug<br />
1-50 ng/mL (Cyclosporin A: 20-1000<br />
ng/mL). Es wurde eine sechsstufige Kalibrierung<br />
für jede Verbindung ausgeführt.<br />
Die Kalibration verlief linear mit Korrelationskoeffizienten<br />
> 0,99 für alle Verbindungen<br />
über den gesamten Bereich. Die<br />
Methode zeigte darüber hinaus eine exzellente<br />
Wiederholpräzision innerhalb eines<br />
Tages und von Tag-zu-Tag. Der Variationskoeffizient<br />
lag bei Mehrfachinjektionen<br />
derselben Probe signifikant unter 10 Prozent.<br />
Die Detektionslimits lagen um den<br />
Faktor 10 unter dem niedrigsten Kalibrationsstandard.<br />
Schlussfolgerungen<br />
Das beschriebene System erlaubt eine automatisierte<br />
Probenvorbereitung mit unmittelbar<br />
folgender LC-MS/MS-Analyse der<br />
Immunsuppressiva in Vollblut. Zusätzlich<br />
sind Probenverfolgung und kundenspezifisches<br />
Berichtswesen Teil des Analysenprozesses.<br />
Die LC-MS/MS-Methode ist<br />
robust, präzise und richtig. Und sie hilft,<br />
Zeit und Kosten einzusparen.<br />
Autoren<br />
Norbert Helle, Meike Holtmann,<br />
TeLA <strong>GmbH</strong> Bremerhaven<br />
Dirk Bremer, <strong>GERSTEL</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong>,<br />
Mülheim an der Ruhr<br />
Frederick D. Foster,<br />
<strong>GERSTEL</strong> Inc., Baltimore, USA<br />
Für weitere Informationen:<br />
aktuell@gerstel.de<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011 17
Weitere<br />
Informationen über<br />
die verschiedenen<br />
verfügbaren Twister-<br />
Phasen erhalten Sie<br />
unter: www.gerstel.de/<br />
de/twister.htm<br />
Wasseranalytik<br />
(Nimm zwei) 2<br />
Mittels einer einfachen, aber wirkungsvollen Modifikation der Twister-<br />
Extraktionsmethode (SBSE) hat ein internationales Team von Applikationsspezialisten<br />
den Nachweis polarer Pestizide mit niedrigem K o/w und apolarer<br />
Pestizide mit hohem K o/w für sehr niedrige Konzentrationen (sub-µg/L) aus<br />
wässrigen Proben optimiert.<br />
Mit Schadstoffen belastetes Trinkwasser<br />
birgt ein hohes Gesundheitsrisiko,<br />
das es durch stete Kontrolle auszuschließen<br />
gilt. Zu den gefährlichen und damit zu<br />
überwachenden Kontaminationen zählen<br />
insbesondere flüchtige und schwerflüchtige<br />
organische Verbindungen meist anthropogenen<br />
Ursprungs, darunter Pestizide,<br />
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe<br />
(PAK) oder polychlorierte Biphenyle<br />
(PCB), die über das Abwasser, die Landwirtschaft<br />
oder Verbrennungsprozesse in<br />
die Umwelt und damit in den Trinkwasserkreislauf<br />
gelangen können. Alle genannten<br />
Verbindungen sind auf die eine oder<br />
andere Art kritisch zu bewerten, da sie auf<br />
den Menschen toxisch, karzinogen oder<br />
hormonaktiv wirken. Es steht daher außer<br />
Frage, dass mögliche Belastungen selbst in<br />
Mikro- oder Nanogrammmengen sensitiv<br />
nachzuweisen beziehungsweise sicher auszuschließen<br />
sind. Ein Vorhaben, das hohe<br />
Anforderungen an den Anwender und das<br />
Analyseverfahren stellt.<br />
Die ideale Extraktionstechnik<br />
Die Frage steht im Raum, wie eine Probe<br />
zu behandeln ist, um die problematischen<br />
Analyten in der Weise zu extrahieren,<br />
dass man sie möglichst vollständig, sensitiv<br />
und in einem Arbeitsgang zu packen<br />
bekommt, um möglichst effizient mit den<br />
vorhandenen Ressourcen an Zeit und Geld<br />
umzugehen. Auf der Suche nach der idea-<br />
len Methode kam die Stir Bar Sorptive<br />
Extraction (SBSE) mit dem <strong>GERSTEL</strong>-<br />
Twister in die engere Wahl. Die SBSE<br />
hatte sich in den zurückliegenden Jahren<br />
bereits in vielfacher Hinsicht zur Extraktion<br />
und Analyse auch von Spuren organischer<br />
Komponenten aus Wasser, Boden,<br />
Nahrungsmitteln, Getränken und biologischen<br />
Matrices bewährt.<br />
Der patentierte Twister, ein mit einem<br />
speziellen Sorbens beschichteter Rührfisch,<br />
extrahiert die Analyten, während er<br />
die Probe durchmischt; im Anschluss daran<br />
wird der Twister der Probe entnommen,<br />
trocken getupft und in einer dafür vorgesehenen<br />
Desorptionseinheit (ThermalDesorptionUnit,<br />
TDU) thermisch desorbiert,<br />
wobei die Analyten quantitativ auf den<br />
angeschlossenen Gaschromatographen<br />
überführt und im darin installierten PTV-<br />
Injektor (KaltAufgabeSystem, KAS) cryofokussiert<br />
und angereichert werden, um die<br />
Sensitivität der Messung und die chromatographische<br />
Trennleistung zu erhöhen.<br />
Die SBSE ist einfach zu handhaben<br />
und kommt ohne umfangreiche Probenvorbereitungsschritte<br />
aus. Die Thermodesorption<br />
ist vollständig automatisierbar. Der<br />
Twister verfügt gegenüber der SPME-Faser<br />
über ein sehr viel größeres Polymer- beziehungsweise<br />
Sorptionsvolumen im Bereich<br />
zwischen 24 und 124 µL; das der SPME-<br />
Faser liegt bei 0,5 µL. Die Konsequenz:<br />
Bei gleichzeitig guter Reproduzierbarkeit<br />
und hoher Wiederfindung weisen SBSE-<br />
18 <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011
<strong>GERSTEL</strong>-<br />
Twister<br />
30% NaCI<br />
Mit PDMS<br />
beschichteter<br />
<strong>GERSTEL</strong>-Twister<br />
<strong>GERSTEL</strong>-<br />
Twister<br />
1 h@1500 U/min<br />
1 h@1500 U/min<br />
Thermal Desorption Unit (TDU)<br />
TIC und EICs von Pestiziden in Flusswasser, erhalten<br />
mit der sequenziellen SBSE-TD-GC-RTL-MS-Methode.<br />
Schematische Darstellung<br />
der sequenziellen StirBar-<br />
SorptiveExtraction (SBSE).<br />
mit Quarzwolle<br />
gepackter<br />
KAS-Glasliner<br />
KaltAufgabeSystem (KAS)<br />
Analysen in der Regel erheblich niedrigere<br />
Nachweisgrenzen (sub-ng/L) auf, vor allem<br />
für hydrophobe Verbindungen. Unterm<br />
Strich erwies sich der <strong>GERSTEL</strong>-Twister<br />
als attraktive Alternative zu den herkömmlichen<br />
Vorgehensweisen.<br />
Definition der Wirksamkeit<br />
Wie sich die Wiederfindung eines Analyten<br />
mit der SBSE, und zwar unter Verwendung<br />
eines PDMS-Twisters, gestaltet,<br />
lässt sich mittels des jeweiligen<br />
n-Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten<br />
(K o/w ) abschätzen. Der K o/w ist ein<br />
dimensionsloser Wert, der das Verhältnis<br />
der Gleichgewichtskonzentration einer<br />
Chemikalie in einem Zweiphasensystem<br />
aus n-Oktanol und Wasser bei einer<br />
definierten Temperatur angibt. Ein K o/w<br />
> 1 bedeutet, die Substanz löst sich eher in<br />
unpolaren Lösemitteln, ein K o/w < 1 hingegen<br />
weist auf eine bessere Löslichkeit<br />
in Wasser hin. Für den PDMS-Twister<br />
gilt: Hydrophobe gelöste Stoffe mit einem<br />
hohen K o/w (log K o/w > 4) lassen sich mit<br />
hoher Wiederfindung direkt extrahieren.<br />
Die Wiederfindung gelöster Stoffe höherer<br />
Polarität (log K o/w < 4) lässt sich durch einen<br />
einfachen Zusatz von NaCl (20-30 %) verbessern.<br />
Allerdings führt die Zugabe von<br />
Salz zu einer Abnahme der Wiederfindung<br />
mancher stärker hydrophober Analyten.<br />
Indem man aber die SBSE mit zwei<br />
Twistern durchführt, wobei sich die Extraktionsbedingungen<br />
unterscheiden, gelingt es,<br />
ein erheblich breiteres Spektrum chemisch<br />
divergenter Verbindungen nachzuweisen.<br />
Wie die Praxis zeigt, lässt sich die SBSE<br />
von hydrophilen Analyten aus wässrigen<br />
Matrices durch Zugabe von Salz optimieren,<br />
jene von hydrophoben Komponenten<br />
durch organische Lösemittel wie Methanol.<br />
Bereits in früheren Arbeiten, bei denen<br />
wir zwei Twister-Rührstäbchen in jeweils<br />
unterschiedlichen Medien einsetzten,<br />
konnten wir den Nachweis von insgesamt<br />
85 Pestiziden, darunter polare Pestizide mit<br />
niedrigem K o/w und apolare Pestizide mit<br />
hohem K o/w , auch im Bereich sehr niedriger<br />
Konzentrationen (sub-μg/L), in wässrigen<br />
Proben in einem GC-Lauf verbessern<br />
( J. Sep. Sci. 2005, 28, 1083-1092).<br />
Erfolg auf ganzer Linie<br />
Damit war belegt, dass sich die SBSE als<br />
Multirückstandsmethode eignet. Schon<br />
damals wurde weiteres Optimierungspotenzial<br />
offenkundig. Eine wichtige<br />
Erkenntnis war, dass der Einsatz der sogenannten<br />
Dual-SBSE die negativen Auswirkungen<br />
des Salzes reduziert und die<br />
Wiederfindung hydrophiler Stoffe verbessert.<br />
Die Güte der Methode wurde<br />
unterstrichen von einer guten Linearität<br />
(r 2 > 0,9900) und einer hohen Sensitivität<br />
(Detektionslimit < 10 ng/L) für die meisten<br />
Zielverbindungen. Einziger Wermutstropfen:<br />
Es haperte noch an der Wiederfindung,<br />
die zwischen 11 und 72 Prozent<br />
lag, bei stärker hydrophoben Verbindungen<br />
(log K o/w > 6,0) sogar im Schnitt nur unter<br />
33 Prozent.<br />
Durch eine weitere Modifikation und<br />
Verbesserung der Dual-SBSE konnte das<br />
Defizit aus der Welt geschafft werden: Mit<br />
der neuen sequenziellen SBSE, die ebenfalls<br />
auf dem Einsatz zweier Twister basiert,<br />
ließen sich 80 Pestizide mit Wiederfindungsraten<br />
zwischen 82 und 113 Prozent<br />
bestimmen ( J. Chromatogr. A 2008, 1200,<br />
72-79).<br />
Sequenzielle SBSE in der Praxis<br />
Vorgehensweise: Ein 10-mL-<br />
Vial wurde mit 5 mL Probe<br />
befüllt, mit einem GER-<br />
STEL-Twister (24 µL<br />
PDMS) bestückt und mit<br />
einer Schraubkappe verschlossen.<br />
Die SBSE mehrerer Proben wurde<br />
simultan bei Raumtemperatur für 60<br />
Minuten mit einer Rührgeschwindigkeit<br />
von 1500 U/min auf einem<br />
Multipositionsmagnetrührer ausgeführt.<br />
Alle SBSE-Versuche erfolgten<br />
GC-Trennsäule<br />
mit dieser Rührgeschwindigkeit, um<br />
einen Vergleich mit der Doppel-SBSE<br />
zu ermöglichen. Nach der ersten Extraktion<br />
wurde das Rührstäbchen mit einer<br />
Pinzette entnommen, kurz in Wasser<br />
getaucht, getrocknet und in ein Thermodesorptionsröhrchen<br />
aus Glas überführt.<br />
Das Glasröhrchen wurde bis zur<br />
Analyse im geschlossenen Probentray des<br />
<strong>GERSTEL</strong>-MultiPurposeSamplers<br />
(MPS) aufbewahrt, auf dem die Probenvorbereitung<br />
automatisiert verlief.<br />
Der Probe wurde NaCl (30 %) zugesetzt,<br />
ein zweites Rührstäbchen hinzugefügt und<br />
das Vial wieder verschlossen. Die folgende<br />
zweite Extraktion erfolgte unter den gleichen<br />
Bedingungen wie die erste: Nach einer<br />
Stunde wurde auch dieses Rührstäbchen<br />
mit einer Pinzette herausgenommen, kurz<br />
in Wasser getaucht, getrocknet und in das<br />
Glasröhrchen gesetzt, in dem sich schon<br />
das erste Stäbchen befand. Zum Schluss<br />
wurde das Glasröhrchen automatisiert in<br />
die ThermalDesorptionUnit (<strong>GERSTEL</strong>-<br />
TDU) überführt. Eine weitere Probenvorbereitung<br />
war nicht erforderlich. Die beiden<br />
Rührstäbchen wurden desorbiert,<br />
indem die TDU,<br />
programmiert mit<br />
720 °C/min, von<br />
40 °C (0,5 min) auf<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011 19
280 °C (5 min) aufgeheizt wurde, bei einem Desorptionsfluss von 50<br />
mL/min. Als Trägergas wurde Helium eingesetzt. Die desorbierten<br />
Verbindungen wurden bei -100 °C auf einem mit Quarzwolle<br />
gepackten Liner im PTV-Injektor (KaltAufgabeSystem, GER-<br />
STEL-KAS) für die anschließende GC/MS-Analyse cryofokussiert.<br />
Nach der Desorption wurde das KAS mit 720 °C/min von ‐100 °C auf<br />
280 °C (5 min) programmiert aufgeheizt, um die getrappten Verbindungen<br />
auf die Trennsäule (HP-5 ms, 30 m x 0,25 mm ID,<br />
Filmdicke 0,25 µm, Agilent Technologies) zu überführen. Die Aufgabe<br />
erfolgte im Splitlosmodus mit einer Splitloszeit von 2 min.<br />
Die Ofentemperatur wurde programmiert aufgeheizt: mit 25<br />
°C/min von 70 °C (2 min) auf 150 °C, weiter mit 3 °C/min auf<br />
200 °C und abschließend mit 8 °C/min auf 300 °C; verwendet<br />
wurde die Retentionszeit-Locking-Datenbank von Agilent Technologies.<br />
Der Säulenvordruck war so eingestellt, dass Chlorpyrifos-Methyl<br />
bei einer konstanten Retentionszeit von 16,59 min<br />
eluierte. Das MS wurde im Scanmodus betrieben, mit Elektronenstoßionisation<br />
(Elektronenbeschleunigungsspannung: 70 V).<br />
Der Scanbereich wurde auf m/z 58 bis 510 eingestellt, bei einer<br />
Scanrate von 3,20 Scans/s.<br />
Erfolgreicher Einsatz in der Praxis<br />
Die Linearität der sequenziellen SBSE-Methode wurde über sechs<br />
Konzentrationsbereiche zwischen 20 und 1000 ng/L für 80 Pestizide<br />
in Wasser geprüft. Für jeden Bereich wurden Doppelbestimmungen<br />
durchgeführt. Für alle gelösten Stoffe wurde eine gute<br />
Linearität erreicht, mit einem Korrelationskoeffizienten (r²) von<br />
über 0,99. Die Detektionslimits (LOD) wurden mit wiederholten<br />
Analysen angereicherten Wassers bestimmt, das mit jeweils 20<br />
ng/L der Analyten versetzt worden war (niedrigste Konzentration<br />
der Kalibrationskurven). Für 67 gelöste Stoffe wurden sehr niedrige<br />
LODs im Bereich von 2,1-10 ng/L erhalten – auch im Scanmodus<br />
eines konventionellen Quadrupol-MS. Für 13 gelöste Stoffe<br />
lagen die LODs im Bereich von 11 bis 74 ng/L.<br />
Die Resultate der sequenziellen SBSE wurden schließlich mit<br />
denen der Dual-SBSE verglichen. Im Gegensatz zur Dual-SBSE<br />
liefert die sequenzielle SBSE eine ausgezeichnete Wiederfindung<br />
von mehr als 80 Prozent für 75 der nachgewiesenen Stoffe. Die<br />
Reproduzierbarkeit war gut, die RSDs lagen unter 10 Prozent, die<br />
Linearität (r²) lag bei über 0,99.<br />
Abschließend wurde die Methode mit Erfolg auf verschiedene<br />
Flusswasserproben angewendet, die für das Screening auf Pestizidrückstände<br />
den japanischen Flüssen Tama und Tsurumi entnommen<br />
worden waren. Die Bestimmung der Pestizide erfolgte<br />
mit sechs Wiederholungsanalysen oder Doppelanalysen mit<br />
Kalibrierungs-Standardaddition zwischen 20 und 100 ng/L. Elf<br />
Pestizide, die zu verschiedenen Pestizidarten gehören, wurden im<br />
Bereich von 7,2-52 ng/L bestimmt; die log K o/w -Werte der detektierten<br />
Pestizide lagen im Bereich von 2,79 (Fenobucarb) bis 5,40<br />
(Difenoconazol 1, 2). Darüber wurden mit dem Agilent-RTL-<br />
Pestizid-Scanner Pestizide gefunden, aber nicht quantifiziert, die<br />
nicht zu den Zielanalyten gehörten, z. B. Propetamphos (log K o/w<br />
2,50) und Isoprothiolan (log K o/w 2,79).<br />
Liste der mittels sequentieller SBSE bestimmten Pestizide.<br />
Detaillierte Informationen bietet die ,,AppNote 12|2OO8“ ,<br />
zu finden im lnternet unter: www.gerstel.de im Bereich der Applikationen.<br />
Weitere Informationen<br />
Nobuo Ochiai, Kikuo Sasamoto, Hirooki Kanda,<br />
<strong>GERSTEL</strong> K.K., 2-13-18 Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan;<br />
Edward Pfannkoch,<br />
<strong>GERSTEL</strong> Inc., 701 Digital Drive, Suite J, Linthicum, MD 21090, USA<br />
Wiederfindung (%)<br />
Theoretische<br />
Wiederfindung SBSE Sequentielle LOD<br />
Komponente log Kow (%) SBSE (w/NaCl) SBSE RSD (%) r 2 (ng/L)<br />
Pirimicarb 1.70 19 15 74 73 9.6 0.9995 6.0<br />
Dichlorvos 1.90 28 8 42 <strong>44</strong> 9.7 0.9978 6.1<br />
Ethiofencarb 2.04 35 8 48 39 11 0.9995 5.0<br />
Isoprocarb 2.30 49 19 80 69 8.7 0.9947 5.5<br />
Fensulforthion 2.35 52 18 77 79 12 0.9970 6.5<br />
Parathion-methyl 2.75 73 95 104 109 3.8 0.9999 9.6<br />
Malathion 2.75 73 85 87 98 4.4 0.9994 8.0<br />
Fenobucarb 2.79 75 41 90 86 8.7 0.9994 3.4<br />
Benfuresat 2.80 75 75 94 101 4.3 0.9994 6.1<br />
Mefenacet 2.80 75 70 92 96 10 0.9981 4.5<br />
Methiocarb 2.87 78 39 102 83 13 0.9962 5.3<br />
Thiometon 2.88 79 85 94 96 3.3 0.9998 12<br />
Cyproconazol 2.91 80 28 92 83 4.1 0.9987 6.4<br />
Etrimfos 2.94 81 96 92 98 5.3 0.9997 3.8<br />
Triadimenol 1,2 2.95 81 27 91 89 6.6 0.9985 11<br />
EPTC 3.02 83 99 101 102 4.8 0.9999 12<br />
Quinalphos 3.04 84 92 89 97 3.0 0.9985 10<br />
Dimethylvinphos 3.16 87 66 69 82 8.8 0.9999 4.2<br />
Metolachlor 3.24 89 82 94 96 4.2 0.9993 8.1<br />
Diethofencarb 3.29 90 75 94 97 5.4 0.9990 13<br />
Fenitrothion 3.30 91 95 97 102 3.1 0.9998 4.0<br />
Paclobutrazol 3.36 92 31 95 85 8.3 0.9986 4.7<br />
Pyraclofos 3.37 92 70 89 86 5.4 0.9972 11<br />
Quinomethionat 3.37 92 80 59 100 3.8 0.9997 3.6<br />
Phenthoate 3.47 93 89 77 96 6.5 0.9991 7.2<br />
Mycrobutanil 3.50 94 60 92 90 8.4 0.9992 6.7<br />
Chlorpropham 3.51 94 81 99 97 6.9 0.9997 8.3<br />
Thenylchlor 3.53 94 83 92 99 5.6 0.9993 3.1<br />
Ethoprophos 3.59 95 91 94 95 6.1 0.9999 9.4<br />
Edifenphos 3.61 95 76 72 96 12 0.9983 4.7<br />
Fenarimol 3.62 95 61 93 91 5.2 0.9974 12<br />
β-BHC 3.68 96 46 77 85 3.9 0.9995 5.3<br />
δ-BHC 3.68 96 66 85 90 4.5 0.9993 8.0<br />
Parathion 3.73 96 99 94 101 2.9 0.9995 4.6<br />
Butylat 3.85 97 96 70 100 5.4 0.9999 8.1<br />
Diazinon 3.86 97 96 80 98 5.6 0.9996 3.4<br />
Tebuconazol 3.89 97 69 96 94 7.7 0.9986 8.3<br />
Thiobencarb 3.90 97 99 98 103 5.6 0.9999 4.9<br />
Chlorobenzilate 3.99 98 98 88 99 6.0 0.9996 5.4<br />
Bitertanol 1,2 4.07 98 81 57 93 11 0.9940 10<br />
Fenthion 4.08 98 94 92 97 3.0 0.9995 3.6<br />
Propiconazole 1,2 4.13 99 97 99 101 7.8 0.9983 6.8<br />
E,Z-Chlorofenvinphos 4.15 99 93 80 97 5.3 0.9996 4.3<br />
Prirmiphos-methyl 4.20 99 94 76 94 4.0 0.9996 3.9<br />
E-Pyrifenox 4.20 99 98 100 100 4.5 0.9993 3.2<br />
Z-Pyrifenox 4.20 99 98 100 101 6.6 0.9997 4.9<br />
Terbufos 4.24 99 89 68 89 8.2 0.9987 2.1<br />
Mepronil 4.24 99 79 104 101 5.8 0.9995 7.2<br />
α-BHC 4.26 99 85 97 95 5.3 0.9995 3.4<br />
γ-BHC (Lindane) 4.26 99 82 91 93 5.6 0.9995 5.3<br />
Phosalon 4.29 99 98 85 100 10 0.9986 7.1<br />
Pretilachlor 4.29 99 97 91 106 3.3 0.9986 2.1<br />
EPN 4.47 100 100 86 99 8.1 0.9986 5.0<br />
Tolclofos-methyl 4.56 100 94 88 98 3.6 0.9997 3.4<br />
Esprocarb 4.58 100 98 86 101 5.0 0.9997 4.0<br />
Pyrimidifen 4.59 100 98 74 96 6.7 0.9977 16<br />
Tebufenpyrad 4.61 100 100 76 100 4.9 0.9995 5.7<br />
Isofenphos 4.65 100 96 82 99 2.7 0.9997 3.9<br />
Flutolanil 4.65 100 91 101 103 6.9 0.9993 7.1<br />
Chlorpyrifos 4.66 100 88 71 92 4.4 0.9997 3.3<br />
Flusilazole 4.89 100 99 99 100 6.9 0.9995 4.8<br />
Pendimethalin 5.18 100 96 78 98 5.4 0.9998 5.3<br />
Difenoconazole 1,2 5.20 100 98 73 100 9.0 0.9939 17<br />
Pyridaben 5.47 100 100 57 99 2.9 0.9976 5.1<br />
Cadusafos 5.48 100 95 81 98 6.2 0.9996 19<br />
Pyriproxyfen 5.55 100 96 72 99 5.6 0.9996 4.2<br />
Imibenconazole 5.64 100 98 60 101 9.3 0.9999 74<br />
Prothiofos 5.69 100 97 60 99 5.0 0.9996 4.1<br />
Cyfluthrin 1,2,3,4 5.74 100 100 58 100 3.4 0.9971 23<br />
p,p-DDD 5.87 100 96 70 98 3.7 0.9995 2.6<br />
p,p-DDE 6.00 100 94 51 97 3.8 0.9999 4.4<br />
Cypermethrin 1,2,3,4 6.38 100 100 53 96 1.4 0.9967 40<br />
Flucythrinate 1,2 6.56 100 97 50 99 2.4 0.9951 5.6<br />
Fenvalerate 1,2 6.76 100 100 52 99 4.9 0.9987 14<br />
Fluvalinate 1,2 6.81 100 102 52 96 6.7 0.9989 11<br />
Cyhalothrin 1,2 6.85 100 112 58 113 10 0.9965 7.6<br />
Tefluthrin 7.19 100 97 51 100 5.1 0.9959 7.4<br />
Permethrin 1,2 7.43 100 101 54 100 5.6 0.9983 5.4<br />
Silafluofen 8.20 100 100 53 98 1.4 0.9989 7.3<br />
Halfenprox 8.35 100 105 54 104 2.6 0.9995 3.9<br />
20 <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011
Biokraftstoff<br />
Nachhaltig abgefüllt<br />
Bei der Herstellung von Biodiesel fällt Glycerin an. Das Nebenprodukt muss aus dem biogenen Kraftstoff entfernt werden,<br />
da es den Dieselmotor beschädigen kann. Laut zugrunde liegenden EU- und US-Normen darf der Gehalt an freiem und<br />
Gesamtglycerin im Biodiesel gewisse Grenzwerte nicht überschreiten. Die Überprüfung dieser Grenzwerte erfolgt mittels<br />
GC/FID. Um die Durchführung der Analyse effizienter zu gestalten, erweist sich die Automatisierung der zeit- und arbeitsintensiven<br />
Probenvorbereitung als sinnvoll.<br />
Biodiesel ist ein dem mineralischen Dieselkraftstoff<br />
vergleichbarer Energieträger.<br />
Im Gegensatz zum konventionellen<br />
Dieselkraftstoff wird Biodiesel nicht aus<br />
Rohöl, sondern in aller Regel aus nachwachsenden<br />
Rohstoffen gewonnen: in den<br />
USA vorwiegend aus Sojaöl, hierzulande<br />
aus Raps beziehungsweise Rapsöl. Biodiesel<br />
zählt folgerichtig zu den erneuerbaren<br />
Energieträgern und erfüllt unter Einhaltung<br />
gewisser Kriterien den Aspekt der<br />
Nachhaltigkeit.<br />
Chemisch betrachtet, handelt es sich<br />
bei Biodiesel um Fettsäuremethylester<br />
(FAME). Eine exakte Unterscheidung des<br />
Endprodukts in der Nomenklatur erfolgt<br />
gemäß des eingesetzten Rohstoffs, wie<br />
die Bezeichnung Sojamethylester (SME)<br />
oder Rapsölmethylester (RME) verdeutlicht.<br />
Ungeachtet der Art und Herkunft<br />
des zugrunde liegenden biogenen Rohstoffs:<br />
FAMEs entstehen durch Umestern<br />
von Fetten und Ölen (Triglyceriden). Im<br />
Verlauf der basisch oder sauer katalysierten<br />
Reaktion wird der dreiwertige Alkohol<br />
Glycerin durch Methanol substituiert,<br />
um eine hinreichende Fließfähigkeit sowie<br />
einen ausreichenden Gefrierschutz des<br />
resultierenden Kraftstoffs zu gewährleisten.<br />
Mehr Effizienz dank<br />
Automatisierung<br />
Um sicherzustellen, dass Biodiesel frei<br />
von Glycerin ist, bedarf es einer geeigneten<br />
Analysenmethode. Die Europäische<br />
Norm EN 14105 wie auch das<br />
amerikanische Gegenstück, die „ASTM<br />
Method D6584“, sehen zur Bestimmung<br />
des Gehalts an freiem und Gesamtglycerin<br />
und an Mono-, Di- und Triglyceriden<br />
als Standard- beziehungsweise Referenzmethode<br />
die Trennung und Quantifizierung<br />
der Analyten mittels Gaschromatographie<br />
(GC) und Flammenionisationsdetektion<br />
(FID) vor.<br />
Um die Analyten bestimmen zu können,<br />
müssen sie zunächst mittels Derivatisierung<br />
in eine chromatographier- und<br />
detektierbare Form überführt werden.<br />
Von Hand eine mühsame, zeitaufwendige<br />
Arbeit, bemerkt Dr.<br />
John R. Stuff. Ziel war es,<br />
berichtet der Applikationschemiker<br />
der <strong>GERSTEL</strong><br />
Inc. aus Baltimore, USA,<br />
den manuellen Arbeitsaufwand<br />
und die Analysenzeit<br />
auf ein notwendiges<br />
Maß zu reducerin<br />
(SSG) an, das sich aufgrund seiner<br />
spezifisch höheren Dichte als Rückstand<br />
absetzt. Dieses Nebenprodukt besteht aus<br />
Glycerin, Wasser, Katalysator, überschüssigem<br />
Methanol und freien Fettsäuren.<br />
SSG ist giftig und brennbar, allerdings als<br />
Kraftstoff ungeeignet und als Begleitkomponente<br />
im Biodiesel unerwünscht, weil<br />
SSG sedimentieren und den Kraftstofffilter<br />
verstopfen kann. Aus dem Biodiesel<br />
entfernt, lässt es sich aufbereiten und an<br />
anderer Stelle wieder dem Prozess der Biodieselherstellung<br />
zuführen. Ebenso ist eine<br />
thermische Verwertung in Biogasanlagen<br />
möglich. SSG dient zudem als wichtiges<br />
Ausgangsprodukt zur Herstellung pharmazeutischen<br />
und industriell nutzbaren<br />
Glycerins.<br />
Biodiesel lässt sich in reiner Form als<br />
sogenannter B-100-Diesel in dafür ausgelegten<br />
Aggregaten einsetzen oder als biogener<br />
Zusatz in mineralischem Diesel verwenden.<br />
In Deutschland ist mit Inkrafttreten<br />
des Biokraftstoffquotengesetzes (Bio-<br />
KraftQG) im Jahr 2007 die Beimischung<br />
Glycerin als störendes<br />
Nebenprodukt<br />
Neben FAMEs beziehungsweise<br />
SME oder RME fällt<br />
bei der Biodieselproduktion<br />
sogenanntes Substandardglyvon<br />
bis zu fünf Prozent Biodiesel (B-5)<br />
zu herkömmlichem Diesel sogar verpflichtend.<br />
Ob ein Fahrzeug letzten Endes reinen<br />
Biodiesel oder einen rohölbasierten,<br />
mit biogenem Zusatz versehenen Kraftstoff<br />
tanken kann, hängt vom jeweiligen<br />
Dieselmotor ab.<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011 21
Zur Analyse von freiem und Gesamtglycerin in Biodiesel<br />
gemäß der ASTM Method D6584 eingesetztes<br />
GC/FID-System mit <strong>GERSTEL</strong>-DualRail-MPS.<br />
zieren, gleichzeitig den Probendurchsatz<br />
und die Flexibilität des Anwenders auf ein<br />
Maximum zu steigern. Zu diesem Zweck<br />
gingen Stuff und Kollegen dazu über, die<br />
Schritte der Probenvorbereitung nahezu<br />
eins zu eins auf einen Autosampler zu übertragen<br />
und mit der GC-Analyse zeitlich zu<br />
verschachteln.<br />
Zwei Spritzen für die<br />
Probenbehandlung<br />
Zur Analyse verwendeten Stuff und Kollegen<br />
einen GC 6890 von Agilent Technologies<br />
mit FID. Die automatisierte Probenvorbereitung<br />
erfolgte auf der Dual-<br />
Rail-Variante des MultiPurposeSamplers<br />
(<strong>GERSTEL</strong>-MPS). Zur Ausführung<br />
Chromatogramm eines Biodiesel-Standards.<br />
Chromatogramm einer mit dem MPS-GC/FID<br />
untersuchten realen Biodieselprobe.<br />
der verschiedenen Probenvorbereitungsschritte,<br />
einschließlich Derivatisierung,<br />
und zum Handling der erforderlichen verschiedenen<br />
Volumina wurde der MPS ausgestattet<br />
mit einer 10 µL-On-column- und<br />
einer 80-µL-Sideport-Spritze mit Dilutor-<br />
Modul. Analysiert wurde eine in räumlicher<br />
Nähe zum Labor gekaufte Biodieselprobe.<br />
Die Quantifizierung erfolgte mit Butantriol<br />
und 1,2,3-Tricaproylglycerin (Tricaprin)<br />
als interne Standards, eine Fünf-<br />
Punkt-Kalibrierung wurde mit in Pyridin<br />
gelöstem Glycerin, Monoolein, Diolein<br />
und Triolein erstellt. Gespült wurde mit<br />
Heptan, derivatisiert mit N-Methyl-Ntrimethylsilyltrifluoracetamid<br />
(MSTFA).<br />
Darauf aus, die Zahl der manuellen<br />
Arbeitsschritte zu reduzieren, programmierten<br />
Stuff und Kollegen den Multi-<br />
PurposeSampler (MPS) für die automatische<br />
Durchführung der Probenvorbereitung.<br />
Die für das Prozedere erforderlichen<br />
Befehle Add, Move, Mix, Dilute und<br />
Inject ließen sich einfach per Mausklick<br />
aus einem Menü der MAESTRO-Steuersoftware<br />
zusammenstellen und entsprechend<br />
den Erfordernissen variieren. Die<br />
MAESTRO-Steuersoftware arbeitet vollständig<br />
integriert in die ChemStation-<br />
Software von Agilent Technologies. „Der<br />
manuelle Arbeitsaufwand beschränkt sich<br />
letztlich auf die Einwaage von 100 mg<br />
Probe oder Standard in 10-mL-Headspacevials<br />
und deren Positionierung auf<br />
dem Probenteller des MPS“, erklärt John R.<br />
Stuff. Alle weiteren Schritte, vom Hinzufügen<br />
des internen Standards und des Derivatisierungsreagenz<br />
über Mixen, Inkubieren,<br />
Spülen und Probenaufgabe ins KAS, erfolgen<br />
voll automatisiert und intelligent zeitlich<br />
verschachtelt. Die vom MPS automatisiert<br />
ausgeführten Arbeitsschritte sehen<br />
wie folgt aus:<br />
1. Zugabe von 100 µL Butantriol-Lösung<br />
als interner Standard 1<br />
2. Zugabe von 100 µL Tricaprin-Lösung<br />
als interner Standard 2<br />
3. Zugabe von 100 µL<br />
Derivatisierungsreagenz<br />
4. Mischen (1 min)<br />
5. Warten (15 min)<br />
6. Verdünnen mit 8 mL Heptan<br />
7. Mischen (1 min)<br />
8. Probenaufgabe 1 µL On-column<br />
22 <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011
Die Proben lassen sich parallel zur GC-Analyse<br />
präparieren und punktgenau nach Ende des<br />
vorangegangenen Laufs ins System injizieren. Der<br />
Screenshot (MAESTRO-Sequence-Scheduler)<br />
illustriert die hohe Effizienz der Biodieselanalyse<br />
mittels MPS-GC/FID.<br />
Für die Bearbeitung einer Probe benötigte<br />
der MPS etwa 27 Minuten, die GC-<br />
Laufzeit wiederum beträgt in Summe 38<br />
Minuten, einschließlich einer siebenminütigen<br />
Abkühlphase. „Wir haben das System<br />
so getaktet“, sagt John R. Stuff, „dass wir<br />
einen optimalen Analysenverlauf gewährleisten<br />
können.“ Mit anderen Worten präpariere<br />
der MPS die Kalibrierlösung, dann<br />
die erste Probe, einschließlich Derivatisierung<br />
und Injektion ins KAS. Die Vorbereitung<br />
der nächsten Proben erfolge in der<br />
Art, dass sie immer dann aufzugeben ist,<br />
wenn der vorherige GC-Lauf einschließlich<br />
Abkühlungsphase beendet und der<br />
GC für die nächste Trennung bereit ist.<br />
John R. Stuff ist zufrieden: „Die Messergebnisse<br />
belegen eine sehr gute Linearität<br />
für die Standards und eine gute Wiederholbarkeit<br />
(RSD: 2,1 bis 3,5 Prozent) für<br />
die Biodieselprobe.“ Und dank der Automatisierung<br />
ließen sich nun ein beträchtliches<br />
Maß an Arbeitszeit auf andere Projekte<br />
verwenden oder Analysen über Nacht<br />
und am Wochenende durchführen.<br />
Analysenbedingungen<br />
KAS: On-column, 60 °C (0,05 min)<br />
0,2 °C/s 230 °C (2 min)<br />
0,5 °C/s 380 °C (10 min)<br />
Säule: 10 m Rtx-Biodiesel TG (Restek),<br />
ID = 0,<strong>32</strong> mm, df = 0,1 µm<br />
Trägergas: Helium, 3 mL/min<br />
(konstanter Fluss)<br />
GC-Ofen: 50 °C (1 min) 15 °C/min<br />
180 °C 7 °C/min<br />
230 °C 30 °C/min<br />
380 °C (10 min)<br />
FID: 380 °C<br />
Weitere Informationen<br />
<strong>GERSTEL</strong>-AppNote 1/2010,<br />
www.gerstel.de/<strong>pdf</strong>/p-gc-an-2010-01.<strong>pdf</strong><br />
Von lahmen Gäulen<br />
und schnellen Pferden<br />
Wenn hierzulande<br />
über<br />
sportliche<br />
Höchstleistungen<br />
diskutiert<br />
wird, fällt früher<br />
oder später<br />
der Begriff<br />
„Doping“, und<br />
es werden die<br />
Namen von<br />
Größen aus Radsport oder Leichtathletik<br />
genannt, die ihr Trainingsprogramm um die<br />
Einahme verbotener, leistungssteigender<br />
Präparate erweitert haben. Keiner der Diskutanten<br />
käme vermutlich auf die Idee, in<br />
diesem Zusammenhang auch an Tiere zu<br />
denken. Nicht so in Asien oder im Nahen<br />
Osten, wo etwa der Pferde- oder Kamelrennsport<br />
überaus beliebt und weitverbreitet<br />
ist. Dabei steht nicht nur der Spaß im<br />
Fokus, sondern vor allen Dingen auch Geld,<br />
viel Geld – für den Sieger und den, der<br />
beim Wetten auf das richtige Pferd gesetzt<br />
hat. Ein Reitstall, der seinem Glück auf die<br />
Sprünge helfen und sich nicht alleine auf ein<br />
hinreichendes Training verlassen will, um<br />
aus einem lahmen Gaul ein blitzschnelles<br />
Pferd zu machen, findet probate Lösungen<br />
im Chemiebaukasten: Doping aber ist auch<br />
im Pferderennsport kein Kavaliersdelikt, sondern<br />
illegal, also verboten.<br />
Will man über jeden Verdacht erhaben<br />
sein, führt kein Weg am Einsatz instrumental-analytischer<br />
Mittel vorbei. Damit<br />
Dopingsünder im Tiersport aufzuspüren, hat<br />
sich die Association of Official Racing Chemists<br />
(AORC) [1] zur Aufgabe gemacht. Die<br />
AORC ist eine vergleichsweise kleine Vereinigung<br />
mit nur rund 100 Mitgliedern in 26<br />
Dopinganalytik<br />
Ländern, die<br />
turnusmäßig<br />
Workshops<br />
abhält, um sich<br />
über neueste<br />
Entwicklungen<br />
in puncto<br />
Dopingmittel<br />
und Analysenmethoden<br />
auszutauschen.<br />
In diesem Jahr trafen sich die Experten<br />
im „Turf Club“, einem der führenden<br />
Ausrichter von Pferderennen in Singapur [2].<br />
Mit großem Erfolg präsentierte dort auch<br />
<strong>GERSTEL</strong> ein auf seiner Disposable Pipette<br />
Extraction (DPX) basierendes Verfahren<br />
zum Nachweis von Koffein und Diazepam<br />
aus Pferde-Urin. Unter Einbeziehung der<br />
Workshop-Teilnehmer wurde das Verfahren<br />
im Rahmen eines kleinen Wettbewerbes an<br />
dotierten Realproben getestet; sie wurden<br />
im Labor vor Ort extrahiert und per GC/MS<br />
vermessen. „Die Programmierung der DPX<br />
mittels der MAESTRO-Software erfolgte per<br />
TeamViewer-Fernsteuerung vom Ort des<br />
AORC-Meetings aus“, berichtet Dr. Oliver<br />
Lerch, im Foto neben Tan Surakanpinit von<br />
<strong>GERSTEL</strong> LLP, dem in Singapur ansässigen<br />
Schwesterunternehmen.<br />
Weitere Informationen<br />
[1] www.aorc-online.org/home/<br />
[2] www.turfclub.com.sg<br />
Mehr über die Analyse von Dopingmitteln<br />
in Pferdeharn lesen Sie in einer der<br />
nächsten Ausgaben der <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong>.<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> – Dezember 2011 23
<strong>GERSTEL</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong> • Postfach 10 06 26 • 45406 Mülheim an der Ruhr<br />
Deutsche Post AG<br />
Entgelt bezahlt<br />
45473 Mülheim<br />
Das lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe<br />
Im Internet<br />
Auf der Spur rätselhafter Feenkreise<br />
Für die Himba sind die Kreise im Boden der Wüste Namib<br />
nicht natürlichen Ursprungs. Sie gleichen auf geheimnisvolle<br />
Weise dem hierzulande seit Jahrhunderten bekannten Phänomen<br />
der Kornkreise, die mancher als Zeichen Außerirdischer<br />
interpretiert wissen möchte. Wissenschaftler der Universität<br />
von Pretoria in Südafrika haben es sich zum Ziel gesetzt, dem<br />
Geheimnis der mystischen Kreise in der Namib auf die Spur<br />
zu kommen – u. a. unter Einsatz des <strong>GERSTEL</strong>-Twisters und<br />
des <strong>GERSTEL</strong>-ThermalDesorptionSystems (TDS).<br />
DHS erleichtert Duftstoff-Profiling<br />
von Konsumgütern<br />
Um dem Geruchsgeheimnis eines Produkts auf die Spur zu<br />
kommen, bedarf es analytischer Raffinesse und einer ausgefeilten<br />
Analysentechnik. Wie sich herausgestellt hat, profitiert<br />
der Anwender bei der olfaktorischen Detektivarbeit von einer<br />
automatisierten Probenvorbereitung und einer Extraktionstechnik,<br />
die im Handumdrehen ein Maximum an Aufklärung bietet.<br />
Effiziente LC-MS/MS-Pestizidanalyse<br />
von QuEChERS-Extrakten<br />
Pestizidrückstände in Lebensmitteln lassen sich sicher<br />
und sensitiv bestimmen. Zur GC/MS- bzw. LC/MS-Analyse<br />
gelangen zunehmend QuEChERS-Extrakte, die aufgrund ihrer<br />
hohen Matrixlast jedoch aufzureinigen sind. Die konventionelle<br />
manuelle Vorgehensweise ist mit zahlreichen zeit- und arbeitsintensiven<br />
Schritten verbunden. Ihre Automatisierung erweist<br />
sich als sinnvoll und möglich.<br />
<strong>GERSTEL</strong> online: Hinweise zu Produkten,<br />
Terminen, Veranstaltungen und Applikationen<br />
sowie weitere Informationen über<br />
das Unternehmen und seine kundenorientierten<br />
Lösungen finden Sie im Internet<br />
unter www.gerstel.de. Dort finden Sie u. a.<br />
auch die vorliegende <strong>GERSTEL</strong> <strong>Aktuell</strong> <strong>44</strong><br />
sowie viele weitere Ausgaben als PDF-<br />
Datei zum Herunterladen.<br />
Apropos: Sollten<br />
Sie Fragen zu<br />
einem der<br />
Beiträge in dieser<br />
<strong>44</strong>. Ausgabe<br />
der „<strong>GERSTEL</strong><br />
<strong>Aktuell</strong>“ haben<br />
oder ergänzende<br />
Informationen<br />
wünschen,<br />
freuen wir uns<br />
auf Ihre E-Mail an<br />
aktuell@gerstel.de.<br />
Umfangreiches Informationsmaterial über<br />
die Produkte und Systemlösungen des<br />
Unternehmens finden Sie wie gewohnt im<br />
Internet unter www.gerstel.de<br />
www.gerstel.de<br />
Kundenzeitschrift der <strong>GERSTEL</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong> · Eberhard-<strong>Gerstel</strong>-Platz 1 · 45473 Mülheim an der Ruhr · Telefon + 49 2 08 - 7 65 03-0 · gerstel@gerstel.de<br />
<strong>Nr</strong>. <strong>44</strong> November 2011<br />
Dicke Luft?<br />
Wenn Heim und Büro<br />
krank machen<br />
BIODIESEL · KLINISCHE CHEMIE · PESTIZIDE · WASSER · WHISKEY<br />
ISSN 1618 - 5900<br />
www.gerstel.de<br />
S 00 135 - 8<strong>44</strong> - 01<br />
<strong>GERSTEL</strong>, Inc., USA<br />
+1 410 - 247 5885<br />
sales@gerstelus.com<br />
<strong>GERSTEL</strong> BRASIL<br />
+55 11 5665 8931<br />
gerstel_brasil@gerstel.com<br />
G L O B A L A N A L Y T I C A L S O L U T I O N S<br />
<strong>GERSTEL</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong>,<br />
Deutschland<br />
+49 208 - 7 65 03-0<br />
gerstel@gerstel.de<br />
<strong>GERSTEL</strong> AG, Schweiz<br />
+41 41 - 9 21 97 23<br />
gerstel@ch.gerstel.com<br />
<strong>GERSTEL</strong> K.K., Japan<br />
+81 3 57 31 53 21<br />
info@gerstel.co.jp<br />
<strong>GERSTEL</strong> LLP, Singapur<br />
+65 6622 5486<br />
sea@gerstel.com<br />
<strong>GERSTEL</strong> ® , GRAPHPACK ® und TWISTER ® sind eingetragene Marken der <strong>GERSTEL</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong>.<br />
Änderungen vorbehalten. <strong>Co</strong>pyright by <strong>GERSTEL</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong>