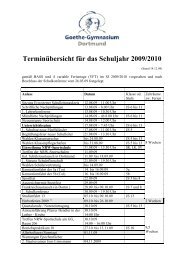Polizei - Goethe Gymnasium Dortmund
Polizei - Goethe Gymnasium Dortmund
Polizei - Goethe Gymnasium Dortmund
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Polizei</strong><br />
– Ausbildung und Einstellung<br />
– SEK<br />
– Personenschutz<br />
Referenten:<br />
Sven Wüstefeld<br />
Jan Spickhoff<br />
Ivo Kühnrich<br />
Timo Eichinger
Der <strong>Polizei</strong>beruf<br />
1. Einstellung und Ausbildung<br />
Der <strong>Polizei</strong>beruf bietet eine faszinierende und krisensichere Arbeit.<br />
Schon mit dem Studienbeginn sind die Anwärter finanziell und sozial abgesichert.<br />
In den folgenden Jahren bieten sich viele Spezialisierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.<br />
1.1 Voraussetzungen<br />
Um diesen Beruf ausüben zu können wird von den Bewerbern u.a. :<br />
– Ausgeprägte Teamfähigkeit,<br />
– Soziale Kompetenz,<br />
– Hohe Kommunikationsfähigkeit,<br />
– Sicheres Auftreten und Verhalten,<br />
– Gute Umgangsformen,<br />
– Gepflegtes äußeres Erscheinungsbild,<br />
– Große Flexibilität,<br />
– Dienstortnaher Wohnsitz,<br />
verlangt bzw. vorausgesetzt, da die <strong>Polizei</strong> den Staat repräsentiert und eine Vorbildfunktion zu<br />
erfüllen hat.<br />
Doch um sich überhaupt bewerben zu können, sind ebenfalls verschiedene Voraussetzungen zu<br />
erbringen. Dazu muss gesagt werden, dass die <strong>Polizei</strong> „Ländersache“ ist und somit die<br />
Einstellungsvoraussetzungen in anderen Bundesländern verschieden sein können.<br />
Die folgenden Voraussetzungen gelten für das Bundesland NRW.<br />
So wird eine zum Hochschulstudium berechtigende Schuldbildung (Abitur) oder ein als<br />
gleichwertig anerkannter Bildungsstand (FHR) vorausgesetzt, ebenso darf man am Einstellungstag<br />
das 32. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.<br />
Außerdem muss man aus ärztlicher Sicht polizeidiensttauglich und Deutsche/Deutscher, im Sinne<br />
des Artikels 116 des Grundgesetzes, oder EU-Angehörige/Angehöriger sein.<br />
Bewerberinnen/ Bewerber anderer Nationalität können unter bestimmten Voraussetzungen<br />
eingestellt werden, wobei keine allgemeine Prognose abgegeben werden kann, da jeder Fall einzeln<br />
entschieden wird.<br />
Bewerber dürfen gerichtlich nicht vorbestraft sein und/oder kein gerichtliches Straf- bzw.<br />
Ermittlungsverfahren anhängig haben.<br />
Die Bewerber müssen die Gewähr dafür bieten, dass Sie jederzeit für die freiheitlich demokratische<br />
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten. (z.B. Demonstrationen beschützen, obwohl<br />
man sich nicht mit den Ansichten der Demonstranten identifizieren kann, oder diese sogar ablehnt)<br />
Sie müssen nach Ihren charakterlichen und geistigen Anlagen für den <strong>Polizei</strong>dienst geeignet sein,<br />
was im späteren Auswahlverfahren geprüft wird.<br />
Die Bewerber müssen in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen leben, da bei Einstellung das<br />
Studium bezahlt wird und verschuldete Anwärter mit diesem Geld wahrscheinlich nicht<br />
wirtschaften können.(→ siehe ebenfalls Vorbildfunktion)<br />
Um den <strong>Polizei</strong>beruf ausüben zu können müssen Anwärter aus polizeiärztlicher Sicht diensttauglich<br />
sein. (→ ärztliche Auswahluntersuchung am 2. Tag des Auswahltests)
Seit dem Jahr 2007 ist für eine Bewerbung in NRW eine Mindestgröße (für Frauen 163cm – für<br />
Männer 168cm) festgelegt. Wünschenswert ist ein BMI zwischen 20 und 25, dieser muss aber<br />
mindestens 18 und kleiner als 27,5 sein. Zusätzlich müssen Bewerber im Besitz des Deutschen<br />
Sportabzeichens (nicht älter als 6 Monate), sowie im Besitz<br />
des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens in Bronze (nicht älter als 12 Monate) sein.<br />
Fremdsprachenkenntnisse in Englisch werden vorausgesetzt, was bedeutet, das man in Englisch<br />
sechs Jahre unterrichtet wurde.<br />
Ein Führerschein der Klasse B muss bis zum 01.08. des Einstellungsjahres erworben worden sein.<br />
Erfüllt man diese Forderungen, kann man sich jährlich für die Einstellung zum jeweiligen<br />
01.September des Jahres bewerben.<br />
Zurzeit ist eine Bewerbung für den Direkteinstieg in den gehobenen <strong>Polizei</strong>vollzugdienst des<br />
Landes Nordrhein-Westfalen für die Einstellung zum 01.09.2009 nicht mehr möglich, da die Frist<br />
bereits abgelaufen ist.<br />
Auch Bewerbungen für das Jahr 2010 werden derzeit noch nicht angenommen. .<br />
1.2 Der Auswahltest<br />
Nachdem die Vorauswahl (Prüfung aller Bewerbungskriterien /Prüfung der gesundheitlichen<br />
Voraussetzungen aufgrund der Aktenlage) abgeschlossen wurde wird man zum weiteren.<br />
Auswahlverfahren zugelassen.<br />
Tag 1:<br />
Am ersten Tag des Auswahlverfahrens werden computergestützte Tests zur Prüfung verschiedener<br />
Kompetenzen durchgeführt.<br />
- Analytische Fähigkeit<br />
(Flussdiagramme, Logische Schlüsse, Zahlensymbole, Datenanalyse, Tatsache vs. Meinung,<br />
Wortanalogien)<br />
- Lernfähigkeit (Gedächtnis)<br />
(Steckbriefe, Fotos von Verkehrssituationen, Texte)<br />
- Kommunikationsfähigkeit (schriftlich)<br />
(Korrektur von Wörtern, Sätzen oder Texten)<br />
- Soziale/Persönliche Kompetenzen<br />
- Berufsmotivation<br />
- Eigenständigkeit<br />
- Innovation<br />
- Fähigkeit zum strategischen Denken<br />
- Werteorientierung<br />
- Konfliktfähigkeit<br />
- Kooperationsfähigkeit<br />
- Teamfähigkeit<br />
- Entscheidungs- und Umsetzungsfähigkeit<br />
(Situationen aus dem polizeilichen Berufsleben werden anhand vorgegebener Antwortalternativen<br />
bewertet)<br />
Danach folgen ein Formalgespräch zur Bewerbung und computergestützte Tests zur<br />
Reaktionsschnelligkeit, Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.
Tag 2:<br />
Am zweiten Tag folgt eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der <strong>Polizei</strong>diensttauglichkeit.<br />
Zu den Tests gehören: Sehtest, Hörtest, EKG, Gebiss, BMI, Lungenvolumen und ggf. Röntgen der<br />
Lunge oder Wirbelsäule.<br />
Wenn sie diese Test bestanden haben sind sie nach den Kriterien der <strong>Polizei</strong>dienstverordnung<br />
(PDV 300) polizeidiensttauglich.<br />
Tag 3:<br />
Am dritten Tag des Auswahlverfahrens findet ein halbtägiges Assessement-Center statt.<br />
Zu diesem werden sie gesondert eingeladen, wenn sie die anderen Test erfolgreich bestanden haben.<br />
Im Assessement-Center wird folgendes durchgeführt:<br />
1. Rollenspiel (Kollegenkonflikt, ca. 5 – 10 min.)<br />
2. Vortrag mit anschließenden Fragen (ca 5 min.)<br />
3. Rollenspiel (Bürosituation, ca. 20 min.)<br />
4. Strukturiertes Auswahlgespräch ( 45 min.)<br />
Durch diese gestellten Szenen werden verschiedene Kompetenzen überprüft:<br />
- Analytische Fähigkeit<br />
- Einfühlungsvermögen<br />
- Ergebnisorientierung/Leistungsmotivation<br />
- Fähigkeit zum strategischen Denken<br />
- Flexibilität im Handeln<br />
- Kommunikationsfähigkeit (mündlich)<br />
- Konfliktfähigkeit<br />
- Kooperationsfähigkeit<br />
- Psychische Belastbarkeit<br />
- Selbstsicherheit<br />
- Teamfähigkeit<br />
Durch das strukturierte Auswahlgespräch,werden gesondert diese Kompetenzen überprüft:<br />
- Auftreten/Repräsentation<br />
- Berufsmotivation<br />
- Eigenständigkeit<br />
- Ergebnisorientierung/Leistungsmotivation<br />
- Grundlegende Arbeitsmethoden<br />
- Neutralität<br />
- Teamfähigkeit<br />
- Werteorientierung<br />
Das Auswahlgespräch ist aus einer Selbstvorstellung und einem freien Gespräch, sowie<br />
biografischer Fragen (Vergangenheit) und situativer Fragen (Zukunft) aufgebaut.<br />
Nach dem Gespräch erhält man eine Rückmeldung. Die eigentliche Zusage/Absage erhält<br />
man erst nach ein paar Wochen / manchmal auch nach Monaten.
1.3 Ausbildung<br />
Hat man das Einstellungsverfahren erfolgreich abgeschlossen, erhält man ein bezahltes Studium.<br />
Man studiert an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW im Fachbereich <strong>Polizei</strong> in<br />
Bielefeld, Duisburg, Gelsenkirchen, Hagen, Köln oder Münster.<br />
Das duale Studium dauert drei Jahre lang und gliedert sich in fachwissenschaftliche Studienzeiten,<br />
fachpraktische Studienzeiten und Projektstudienzeit. D.h. , man erhält zuerst das nötige theoretische<br />
Wissen an der Fachhochschule und darf dann praktische Erfahrung mit Ausbildern auf Streife<br />
sammeln.<br />
Das Studium wird bezahlt, deshalb hat man die Verpflichtung die jeweiligen Fachbereiche zu<br />
bestehen. Man hat die Möglichkeit Klausuren erneut zu Schreiben.<br />
Sollte man das Studium nicht bestehen oder vorzeitig abbrechen, so muss man einen Großteil<br />
(abgesehen von einem Sozialbetrag) des gezahlten Geldes zurückzahlen.<br />
Die <strong>Polizei</strong> hat jedoch kein Interesse an hohen Durchfallquoten, da bereits bei Studiumsbeginn eine<br />
Stelle für den Anwärter reserviert ist.<br />
Nach dem Studium:<br />
Nach dem Studium folgt der „<strong>Polizei</strong>vollzugsdienst rund um die Uhr“ als Streifenbeamter/in<br />
(Für ein Jahr verrichtet man seine Arbeit im Wach- und Wechseldienst und erhält knapp 1800€<br />
netto)<br />
Danach werden sie voraussichtlich drei Jahre lang in einer Hundertschaft der Bereitschaftsplozei<br />
eingesetzt. (Einsätze bei Großveranstaltungen, Demos, Durchsuchungen ….)<br />
Anschließend folgt erneut der Streifendienst.<br />
Mit dem 27. Lebensjahr erfolgt die Anstellung auf Lebenszeit.<br />
Im gehobenen Dienst kann man sich nach persönlicher Neigung und Befähigung für entsprechende<br />
Stellen intern Bewerben und hat die Möglichkeit andere Aufgaben zu übernehmen.<br />
Spezialisierungsmöglichkeiten:<br />
Ermittlungsbeamtin/Ermittlungsbeamter im Kriminalkommissariat einer <strong>Polizei</strong>inspektion<br />
• Ermittlungsbeamtin/Ermittlungsbeamter in der spezialisierten Kriminalitätsbekämpfung<br />
• Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter im Kommissariat Vorbeugung<br />
• Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter in Spezialeinheiten wie<br />
- Spezialeinsatzkommando (SEK)<br />
- Mobiles Einsatzkommando (MEK)<br />
- Verhandlungsgruppe (VG)<br />
• Diensthundführerin/Diensthundführer<br />
• <strong>Polizei</strong>fliegerstaffel (nur wenige Stellen!)<br />
• <strong>Polizei</strong>reiterstaffel (nur wenige Stellen!)<br />
• Lehrende/Lehrender in der Aus- und Fortbildung
SEK<br />
Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ist eine Spezialeinheit der <strong>Polizei</strong> .In Deutschland verfügen<br />
die <strong>Polizei</strong>en aller Bundesländer über mindestens ein SEK. Während früher auch im amtlichen<br />
Sprachgebrauch Sondereinsatzkommando verwendet wurde, wird es heute nur noch<br />
umgangssprachlich verwendet, da der Begriff wegen der gleichnamigen SS- Spezialeinheit belastet<br />
ist.<br />
SEKs sind für Terroristenbekämpfung, Geiselbefreiung und Zugriffe ausgebildet. Sie kommen bei<br />
besonderen Gefährdungslagen sowohl präventiv (zum Beispiel zum Schutz bei Staatsbesuchen), als<br />
auch operativ (auf Anforderung regulärer <strong>Polizei</strong>) zum Einsatz und sind vergleichbar mit den<br />
SWAT-Teams der US-amerikanischen <strong>Polizei</strong>.<br />
Das SEK kann organisatorisch der Bereitschaftspolizei, dem Innenministerium oder auch einer<br />
großen überörtlichen <strong>Polizei</strong>dienststelle angegliedert sein. In den meisten Bundesländern jedoch<br />
verstärkt sich die Tendenz, die SEK den Landeskriminalämtern (LKA) organisatorisch<br />
anzugliedern, möglichst gemeinsam mit den Mobilen Einsatzkommandos (MEK). Die Struktur der<br />
SEK im Detail ist von Bundesland zu Bundesland verschieden.<br />
Manche Bundesländer orientieren sich dabei an regionalen Kriminalitätsschwerpunkten. So haben<br />
beispielsweise Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz SEKs in mehreren größeren Städten<br />
eingerichtet, während in Bayern und Hessen zwei Einheiten existieren die jeweils für die Nord- und<br />
die Südhälfte des Landes zuständig sind. Flächenländer mit vergleichsweise geringer<br />
Gewaltkriminalität wie Brandenburg haben hingegen ein SEK zentral eingerichtet, meistens in der<br />
Landeshauptstadt..<br />
Die Mitglieder eines SEK sind speziell ausgebildete und intensiv trainierte <strong>Polizei</strong>beamte. Beim<br />
SEK finden nur <strong>Polizei</strong>beamte Verwendung, die bereits im regulären <strong>Polizei</strong>dienst tätig waren (i. d.<br />
R. mind. drei Jahre) und die sich einem schwierigen Auswahlverfahren stellen müssen, um in die<br />
Spezialeinheit aufgenommen zu werden. Gängig ist die Praxis einer Altersbegrenzung zwischen 23<br />
und 34 Jahren für die Bewerber. Rein formal ist Frauen der Zugang zu den SEKs nicht verwehrt,<br />
wenngleich bisher wenige Polizistinnen in der Lage waren, das Auswahlverfahren zu meistern.<br />
Einzige Ausnahme ist hier das SEK des Stadtstaates Hamburg (in Hamburg als Mobiles<br />
Einsatzkommandos (MEK) bezeichnet, da hier das MEK auch die Aufgaben eines SEK<br />
übernimmt), welches von Beginn an Frauen in allen Funktionen einschließlich den Zugriffskräften<br />
eingestellt hat. Laut den offiziellen Angaben der Einheiten selbst oder der jeweiligen<br />
Innenministerien dieser Länder gehörten oder gehören zum SEK Frankfurt Am Main ebenfalls<br />
Frauen.<br />
In der Regel wird von den Bewerbern nur ein geringer Anteil in das SEK aufgenommen. Das<br />
Anforderungsprofil setzt nicht nur auf eine überdurchschnittlich gute körperliche Kondition,<br />
sondern auch auf Charakterstärke, hohe Sozialkompetenz, Urteilsvermögen und Stressbelastbarkeit.<br />
Bei erfolgreich bestandenem Aufnahmetest, der sich in physische und psychische Tests sowie ein<br />
Stressbelastungsgespräch des Bewerbers mit einem Gremium der Einheit, vielerortens bestehend<br />
aus dem Kommandeur, seinem Stellvertreter, einen Psychologen und einem erfahrenen Mitglied der
Einheit, gliedert, erfolgt eine mehrmonatige Spezialausbildung, in der vor allem körperliche und<br />
psychische Belastbarkeit, aber auch das Eindringen in Gebäude, Fahr- und Klettertraining,<br />
Kampfsport (Ju-Jutsu) sowie umfassende Schießfertigkeit trainiert werden. Hierbei werden die<br />
SEK-Anwärter gezielt an die Grenzen ihrer körperlichen und psychischen Leistungsfähigkeit<br />
gebracht.<br />
Mitglieder eines SEK bekommen einen Gefahrenzuschlag von 150 € pro Monat zu ihrem Gehalt,<br />
wenngleich für sie oftmals andere Zulagen wegfallen können.<br />
Je nach Bundesland müssen die Beamten die Zugriffskräfte eines SEK beim Erreichen einer<br />
Altersgrenze, die bei etwa 45 Jahren liegt, wieder verlassen.<br />
SEK-Kräfte tragen schwere ballistische Westen und Helme , standardmäßig Pistolen und je nach<br />
Einsatzlage Maschinenpistolen , sowie Präzisionsschützen entsprechend Präzisionsgewehre<br />
verschiedener Ausführungen.<br />
Außerdem benutzen SEK-Kräfte zivile, meist stark motorisierte Einsatzfahrzeuge verschiedenster<br />
Fahrzeughersteller mit Tarnkennzeichen um im Alltagsverkehr nicht erkannt zu werden und um<br />
schnell zum Einsatzort gelangen zu können. Die hohe Motorleistung ist höchstwahrscheinlich auch<br />
darauf zurückzuführen, dass das SEK ggf. an Verfolgungsjagden der <strong>Polizei</strong> teilnimmt (z.B. um im<br />
Rahmen einer mobilen Geiselnahme in einem Kraftfahrzeug dieses gewaltsam zu stoppen).<br />
Weiterhin zeichnen sich SEK-Einsatzfahrzeuge durch spezielle Umbauten (z.B. zwei<br />
Magnetblaulichter statt eines um besser erkannt zu werden) aus. Hierzu werden aber aus<br />
Geheimhaltungsgründen keine weiteren Details genannt.<br />
Die Ausrüstung der SEKs kann von den Einheiten selbst ausgewählt werden (siehe Fahrzeuge) und<br />
ist nicht an die Beschaffungspolitik der übergeordneten Landespolizei gebunden. Allgemein aber<br />
haben sich im Bereich der Schusswaffen die Pistolen Glock 17und Sig Sauer P228 und die<br />
Maschinenpistole Heckler&Koch M5 durchgesetzt, im Bereich der Präzisionsgewehre das<br />
Heckler&Koch PSG1 und das Blaser R 93. Die Schutzausrüstung kann variieren und ist je nach<br />
Einsatzzweck bis zu 30 Kilogramm schwer. Seit Mitte der 1990er Jahre setzen immer mehr SEKs<br />
auch auf Schrotflinten zur Abwehr von Kampfhunden oder zur Öffnung von Türen. Weiterhin<br />
wurden von einigen der Einheiten auch Sonderwaffen angeschafft wie Präzisionsgewehre im<br />
übergroßen Kaliber 50 BMG , welche bei Einsatzlagen auf großen Freiflächen wie Flughäfen und<br />
Hafenanlagen aber auch auf Seen, bei Einsätzen im Hochgebirge (SEK Südbayern) und in Städten<br />
mit hohen Gebäuden wie Frankfurt am Main zum Einsatz kommen könnten.<br />
Um ihre Identität zu verbergen, tragen Beamte des SEK außerdem Sturmhauben . Die offizielle<br />
Begründung für diese Praxis ist der Schutz der Beamten und ihrer Angehörigen vor Racheakten und<br />
dem bei Enttarnung allgemein höherem öffentlichen Interesse des sozialen Umfelds und ferner die<br />
Erhaltung der Einsatzfähigkeit bei verdeckten Observationen bei denen die Beamten nicht im<br />
vorhinein erkannt werden sollen. Außerdem dient die Maske psychologischen Zwecken<br />
(Einschüchterung des Täters). Das SEK tritt sowohl in oben beschriebener „voller Kampfmontur“<br />
als auch zivil in Aktion, um bei Zugriffen auf Schwerkriminelle nicht von vorneherein erkannt zu<br />
werden oder aber wenn Beamte in ihrer Freizeit zu einem Einsatz beordert werden.
Im Alltag auf der Dienststelle tragen die SEK-Beamten Einsatzoverralls, die in den meisten<br />
Bundesländern mit einem SEK-internen Abzeichen, der sog. „SEK-Schwinge“, versehen sind.<br />
In puncto Einsatzhäufigkeit gibt es zwischen den Bundesländern durchaus Unterschiede; so sind die<br />
SEKs in Berlin, Frankfurt sowie im Ruhrgebiet am meisten mit Einsätzen belastet. Das SEK Berlin<br />
und Frankfurt bringen es seit Jahren auf Spitzenwerte von ca. 500 Einsätzen pro Jahr, die SEKs in<br />
NRW zusammen auf etwa 900 Einsätze.<br />
Insgesamt haben die einzelnen SEKs seit ihrer Aufstellung in den frühen 1970er Jahren bis zu<br />
mehrere tausend Einsätze bewältigt. In der Regel wurde nur bei einem verschwindend geringen<br />
Anteil dieser Einsätze von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. In keinem Bundesland übersteigt<br />
die Zahl des Schusswaffengebrauchs gegen Menschen (den Finalen Rettungsschuss mit<br />
eingeschlossen) die Marke von 10 Fällen.<br />
In manchen Bundesländern zählen zu den Spezialeinheiten auch die Mobilen Einsatzkommandos<br />
(MEK) und die Verhandlungsgruppen, die sich aus speziell als Unterhändler geschulten Beamten<br />
zusammensetzen. Die MEKs arbeiten sehr eng mit dem SEK zusammen und sind spezialisiert auf<br />
Observation sowie Einsätze zwischen wechselnden Orten (z. B. Omnibusentführungen), sog.<br />
mobile Lagen.<br />
SEKs sind, wie auch die GSG 9 der Bundespolizei , nach dem terroristischen Anschlag während der<br />
Olympischen Spiele 1974 in München gegründet worden. In der Folge dieser Ereignisse beschloss<br />
die Ständige Konferenz 1974 das „Konzept für die Aufstellung und den Einsatz von<br />
Spezialeinheiten der Länder und des Bundes für die Bekämpfung von Terroristen “. Dieser<br />
Beschluss kann als die Geburtsstunde der Spezialeinheiten in Deutschland angesehen werden.<br />
Spezialeinsatzkommandos stehen insbesondere bei Geiselnahmen, aber auch bei brisanten<br />
Entführungsfällen im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Beispiele hierfür waren das Gladbecker<br />
Geiseldrama im August 1988 oder die Kaperung eines Touristikbusses in Köln 1995, Geiselnahmen<br />
in Gefängnissen und ähnliches. Obwohl öffentlich viel beachtet, machen derartige Einsätze nur<br />
einen geringen Teil des SEK-Alltags aus. Die meisten SEK-Einsätze finden in den Medien und der<br />
Tagespresse kaum Erwähnung und haben auch die Vollstreckung von Haftbefehlen , die Reaktion<br />
auf Selbstversuche , die Begleitung von Gefangenentransporten oder den Einsatz gegen<br />
verbarrikadierte Personen zum Inhalt, allerdings werden auch Razzien im Bereich der organisierten<br />
Kriminalität (beispielsweise „Türsteherszene“ oder illegales Glücksspiel) durchgeführt. Zum<br />
Aufgabengebiet gehören weiterhin Personen- und Zeugenschutz-Maßnahmen. Früher wurden SEKs<br />
auch bei besonders gewalttätig verlaufenden Demonstrationen eingesetzt, allerdings haben sich seit<br />
den Auseinandersetzungen an der Baustelle der geplanten Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf<br />
in den späten 1980er Jahren in diesem Bereich die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, in<br />
Bayern auch Unterstützungskommando (USK) genannt, etabliert.
Personenschutz<br />
1.Staatlicher und privater Personenschutz<br />
Die Aufgabe der Personenschützer besteht darin, schutzwürdige Personen vor Angriffen zu<br />
bewahren. Schutzpersonen sind meist Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und deshalb einem<br />
erhöhtem Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind.<br />
Seit jeher hatten die Mächtigen dieser Welt Leibwächter, die für ihre persönliche Sicherheit sorgten.<br />
Die Frage nach den Anfängen des Berufs des Personenschützers wird dennoch nie eindeutig<br />
beantwortet werden können.<br />
Man muss zwischen staatlichem und privatem Personenschutz differenzieren. Der staatliche<br />
Personenschutz wird vom BKA und der GSG9, der Bundespolizei, übernommen.<br />
Der private Personenschutz wird von ca. 3000 privatwirtschaftlichen Sicherheitsdiensten<br />
ausgeführt. Sie alle sind zumeist mit Schusswaffen ausgerüstet und im Nahkampf ausgebildet, da<br />
sie sich stets in unmittelbarer Nähe zu ihren Schutzbefohlenen befinden, um diese vor Übergriffen<br />
zu bewahren. Ihre primäre Tätigkeit besteht vor allem darin, auffällige und verdächtige Personen<br />
ausfindig zu machen, um mögliche Gefährdungen zu verhindern.<br />
1.1 Gefährdungsstufen<br />
Da die Schutzpersonen unterschiedlichen Gefährdungen ausgesetzt sind, unterscheidet man in drei<br />
Gefährdungsstufen.<br />
Bei der höchsten Gefährdungsstufe ist die Schutzperson erheblicher Gefahr ausgesetzt.<br />
Hier ist in jedem Fall mit Übergriffen zu rechen. Deswegen werden diese Personen zu jeder Zeit,<br />
auch wenn sie sich im Ausland befinden, von mehreren Beamten des Personenschutzes begleitet<br />
und in besonders geschützten Limousinen chauffiert.<br />
Bei der zweit höchsten Gefahrenstufe ist die Schutzperson zwar nicht unmittelbar gefährdet, ein<br />
Anschlag ist trotzdem nicht auszuschließen. Aus diesem Grund wird die Schutzperson nicht immer<br />
von Personenschützern begleitet, aber zu besonderen Anlässen und zu bestimmten Zeiten ist ein<br />
höheres Maß an Schutz notwendig.<br />
Die dritte Gefahrenstufe bietet den niedrigsten Sicherheitsstandard. Zwar ist hier eine Gefährdung<br />
nicht vollständig auszuschließen, aber ihnen wird nur Schutz bei besonderen Anlässen gewährt.<br />
Dementsprechend sind in den niedrigeren Stufen weniger Beamte in unmittelbarer Nähe der<br />
Schutzpersonen anwesend.<br />
1.2 Ausbildung<br />
Die Ausbildung von Personenschützern ist sehr vielschichtig. Sie umfasst unter anderem<br />
Rechtskunde, taktische Aspekte, Verhaltensgrundsätze im Falle eines Angriffs, Beurteilung der<br />
Gefährdungslage einer Schutzperson, Einsätze bei Staatsbesuchen, Durchsuchungen von Gebäuden,<br />
Schieß- und Fahrausbildung und waffenlose Selbstverteidigung. Zusätzlich durchlaufen<br />
Personenschützer besondere Seminare zur Stress- und Konfliktbewältigung.<br />
Es gibt sowohl private Ausbildungsinstitutionen als auch staatliche <strong>Polizei</strong>schulen, die sich auf die<br />
Ausbildung von Personenschützern spezialisiert haben.<br />
In dem Beruf des Personenschützers gibt es verschiedenste Möglichkeiten zur Spezialisierung, z.B.<br />
eine Kommandoführerausbildung, Sprengstoffausbildung, mobile Einsätze oder Botschaftsschutz.<br />
Es lässt sich also festhalten, dass der Beruf des Personenschützers besonders vielseitig ist und ein<br />
spezielles Anforderungsprofil voraussetzt.