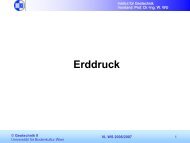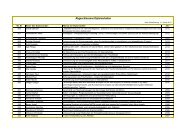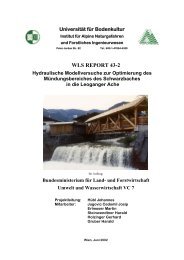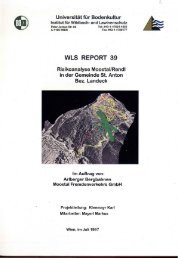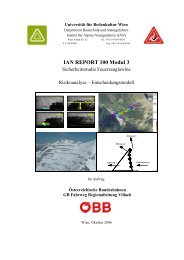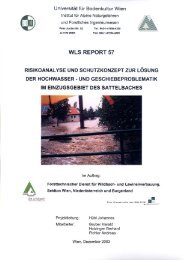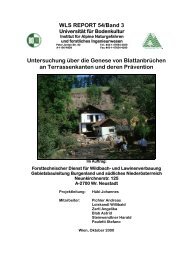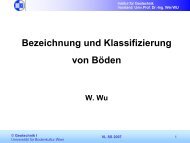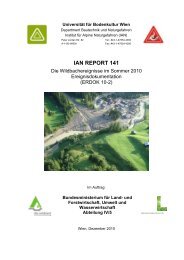Wurzelsysteme ingenieurbiologischer Bauweisen - Department für ...
Wurzelsysteme ingenieurbiologischer Bauweisen - Department für ...
Wurzelsysteme ingenieurbiologischer Bauweisen - Department für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
R. Stangl/W. Zenz/P. Weinbacher · <strong>Wurzelsysteme</strong> <strong>ingenieurbiologischer</strong> <strong>Bauweisen</strong><br />
<strong>Wurzelsysteme</strong> von Weidenspreitlagen (WSL)<br />
Die Wurzelkörper einer 14-jährigen Weidenspreitlage aus<br />
Lavendel- und Purpurweide tragen bedeutend zur Stabilisierung<br />
der Böschung bei. Die Asteinlagen sind im Oberboden<br />
gut verwachsen und fungieren als eigenständige<br />
Wurzelkörper, die als Stabilisierungselemente parallel zur<br />
Böschungsober fläche liegen. Sie weisen nach dem Einbau<br />
ein beträcht liches Dickenwachs tum auf und produzieren<br />
damit etwa 80 % der unterirdischen Biomasse (Bild 9 und<br />
10). Die Gesamtbiomasseproduktion der Lavendelweide<br />
ist etwa dreimal so hoch wie jene der Purpurweiden.<br />
Sie leisten in der Spreitlage den größten Beitrag zur<br />
Stabilisierung der Böschung. Die Grob- und Starkwurzeln<br />
der Purpurweiden zeigten eine effiziente Tiefener streckung<br />
mit beachtlicher Reichweite. Armdicke Vertikalwurzeln der<br />
Lavendelweiden stellen eine massive Tiefenver ankerung dar.<br />
Der Grobskelettgehalt des Schüttkörpers verhindert jedoch<br />
die Ausbreitung der Feinwurzeln in die Tiefe.<br />
5 Diskussion und Ausblick<br />
Bild 9: Wurzelbildung aus Asteinlagen einer Weidenspreit-<br />
27%<br />
Gesamtbiomasse [%] - 03 Passer<br />
6%<br />
oberirdisch Asteinlagen Wurzeln<br />
Bild 10: Biomasseverteilung einer 14-jährigen Weidenspreit-<br />
<strong>Wurzelsysteme</strong> von Weidenspreitlagen (WSL)<br />
Die Wurzelkörper einer 14-jährigen Weidenspreitlage aus<br />
Lavendel- und Purpurweide tragen bedeutend zur Stabilisierung<br />
der Böschung bei. Die Asteinlagen sind im Oberboden<br />
gut verwachsen und fungieren als eigenständige<br />
Wurzelkörper, die als Stabilisierungselemente parallel zur<br />
Böschungsober fläche liegen. Sie weisen nach dem Einbau<br />
ein beträcht liches Dickenwachs tum auf und produzieren<br />
damit etwa 80 % der unter irdischen Biomasse (Bild 9 und<br />
10). Die Gesamtbiomasse produktion der Lavendelweide<br />
ist etwa dreimal so hoch wie jene der Purpurweiden. Sie<br />
leisten in der Spreitlage den größten Beitrag zur Stabilisierung<br />
der Böschung. Die Grob- und Starkwurzeln der Pur-<br />
67%<br />
• Gehölzeinlagen, wie sie bei Heckenbuschlagen, Hangrosten<br />
und Holzkrainerwänden verwendet werden,<br />
bieten vor allem in steilem Gelände eine hervorragende<br />
mechanische Armierung.<br />
• Die eingelegten Gehölzsprosse, deren Durchmesser<br />
im Lauf der Jahre durch Dickenwachstum zunehmen,<br />
übernehmen die Rolle einer Hauptwurzel mit zentraler<br />
Funktion.<br />
• Durch ihre horizontale Position wird eine sehr gute Tiefenbewehrung<br />
bis etwa 2 m quer in den Hang hinein<br />
erreicht, die das artspezifische Wurzelnetz zusätzlich in<br />
ihrer stabili sierenden Wirkung unterstützt.<br />
• Durch Wurzelverwachsungen bilden sich beeindruckende<br />
Wurzelkollektive, die einen wesentlichen Beitrag<br />
zur Erhöhung der unter irdischen Biomasse leisten.<br />
• Die Asteinlagen von Weidenspreitlagen fungieren als<br />
eigenständige Wurzelkörper mit beacht lichem Dickenwachstum<br />
und tiefreichender Vertikalverankerung.<br />
Im Sinne der Baustatik ist speziell der Lagenbau ein stabilisierendes<br />
Bauwerk, die Sicherheit gegen Kippen und<br />
Gleiten kann berechnet werden. Florineth (2004) erwähnt<br />
außerdem die Trag fähigkeit durch die Druck- und Zugfestigkeit<br />
des Stammes, die Verbundfestigkeit zwischen<br />
Pflanze und Boden und die Wirkung der Pflanzen als<br />
Zuganker oder Dübel, wobei die zum Herausziehen benötigte<br />
Kraft ausschlaggebend ist. Von Schuppener (1994,<br />
2003) wurden ausführliche statische Berechnungen über<br />
die Wirkung der eingelegten Weidenäste veröffentlicht.<br />
Er prägte den Begriff „Lebend bewehrte Erde“.<br />
Für Weidenspreitlagen fasst Gerstgraser (2000) Angaben<br />
über maximale Belastbarkeiten inklusive Fußsicherung<br />
bis 480 N/m² berechnet als Schleppspannung<br />
zusammen. Er weist auf die mantelartige Schutzwirkung<br />
der jungen Sprosse, die sich bei Überströmung dachziegel<br />
artig übereinander legen, ebenso wie auf jene der<br />
Asteinlagen hin.<br />
Derzeit herrscht großer Bedarf in der Erforschung<br />
der zugrunde liegenden Mechanismen des zunehmenden<br />
Dickenwachstums der Asteinlagen und ihrer Wurzelneubildungen<br />
sowie der der damit verbundenen Erhöhung der<br />
statischen Wirksamkeit.<br />
Bautechnik und Naturgefahren 5