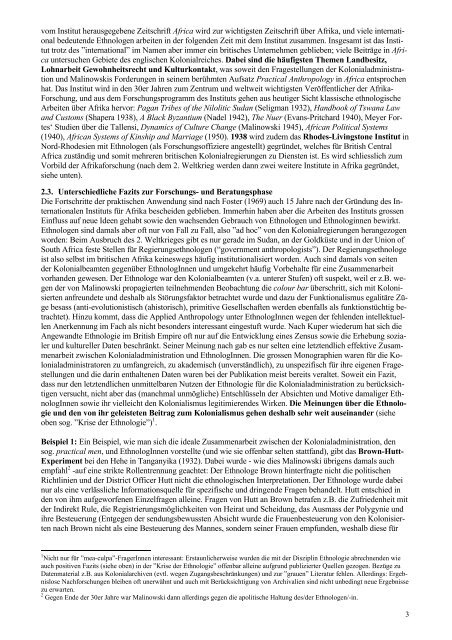handout 17.01.03 (pdf) - Ethnologisches Seminar
handout 17.01.03 (pdf) - Ethnologisches Seminar
handout 17.01.03 (pdf) - Ethnologisches Seminar
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
vom Institut herausgegebene Zeitschrift Africa wird zur wichtigsten Zeitschrift über Afrika, und viele international<br />
bedeutende Ethnologen arbeiten in der folgenden Zeit mit dem Institut zusammen. Insgesamt ist das Institut<br />
trotz des ”international” im Namen aber immer ein britisches Unternehmen geblieben; viele Beiträge in Africa<br />
untersuchen Gebiete des englischen Kolonialreiches. Dabei sind die häufigsten Themen Landbesitz,<br />
Lohnarbeit Gewohnheitsrecht und Kulturkontakt, was soweit den Fragestellungen der Kolonialadministration<br />
und Malinowskis Forderungen in seinem berühmten Aufsatz Practical Anthropology in Africa entsprochen<br />
hat. Das Institut wird in den 30er Jahren zum Zentrum und weltweit wichtigsten Veröffentlicher der Afrika-<br />
Forschung, und aus dem Forschungsprogramm des Instituts gehen aus heutiger Sicht klassische ethnologische<br />
Arbeiten über Afrika hervor: Pagan Tribes of the Nilolitic Sudan (Seligman 1932), Handbook of Tswana Law<br />
and Customs (Shapera 1938), A Black Byzantium (Nadel 1942), The Nuer (Evans-Pritchard 1940), Meyer Fortes‘<br />
Studien über die Tallensi, Dynamics of Culture Change (Malinowski 1945), African Political Systems<br />
(1940), African Systems of Kinship and Marriage (1950). 1938 wird zudem das Rhodes-Livingstone Institut in<br />
Nord-Rhodesien mit Ethnologen (als Forschungsoffiziere angestellt) gegründet, welches für British Central<br />
Africa zuständig und somit mehreren britischen Kolonialregierungen zu Diensten ist. Es wird schliesslich zum<br />
Vorbild der Afrikaforschung (nach dem 2. Weltkrieg werden dann zwei weitere Institute in Afrika gegründet,<br />
siehe unten).<br />
2.3. Unterschiedliche Fazits zur Forschungs- und Beratungsphase<br />
Die Fortschritte der praktischen Anwendung sind nach Foster (1969) auch 15 Jahre nach der Gründung des Internationalen<br />
Instituts für Afrika bescheiden geblieben. Immerhin haben aber die Arbeiten des Instituts grossen<br />
Einfluss auf neue Ideen gehabt sowie den wachsenden Gebrauch von Ethnologen und Ethnologinnen bewirkt.<br />
Ethnologen sind damals aber oft nur von Fall zu Fall, also ”ad hoc” von den Kolonialregierungen herangezogen<br />
worden: Beim Ausbruch des 2. Weltkrieges gibt es nur gerade im Sudan, an der Goldküste und in der Union of<br />
South Africa feste Stellen für Regierungsethnologen (“government anthropologists”). Der Regierungsethnologe<br />
ist also selbst im britischen Afrika keineswegs häufig institutionalisiert worden. Auch sind damals von seiten<br />
der Kolonialbeamten gegenüber EthnologInnen und umgekehrt häufig Vorbehalte für eine Zusammenarbeit<br />
vorhanden gewesen. Der Ethnologe war den Kolonialbeamten (v.a. unterer Stufen) oft suspekt, weil er z.B. wegen<br />
der von Malinowski propagierten teilnehmenden Beobachtung die colour bar überschritt, sich mit Kolonisierten<br />
anfreundete und deshalb als Störungsfaktor betrachtet wurde und dazu der Funktionalismus egalitäre Züge<br />
besass (anti-evolutionistisch (ahistorisch), primitive Gesellschaften werden ebenfalls als funktionstüchtig betrachtet).<br />
Hinzu kommt, dass die Applied Anthropology unter EthnologInnen wegen der fehlenden intellektuellen<br />
Anerkennung im Fach als nicht besonders interessant eingestuft wurde. Nach Kuper wiederum hat sich die<br />
Angewandte Ethnologie im British Empire oft nur auf die Entwicklung eines Zensus sowie die Erhebung sozialer<br />
und kultureller Daten beschränkt. Seiner Meinung nach gab es nur selten eine letztendlich effektive Zusammenarbeit<br />
zwischen Kolonialadministration und EthnologInnen. Die grossen Monographien waren für die Kolonialadministratoren<br />
zu umfangreich, zu akademisch (unverständlich), zu unspezifisch für ihre eigenen Fragestellungen<br />
und die darin enthaltenen Daten waren bei der Publikation meist bereits veraltet. Soweit ein Fazit,<br />
dass nur den letztendlichen unmittelbaren Nutzen der Ethnologie für die Kolonialadministration zu berücksichtigen<br />
versucht, nicht aber das (manchmal unmögliche) Entschlüsseln der Absichten und Motive damaliger EthnologInnen<br />
sowie ihr vielleicht den Kolonialismus legitimierendes Wirken. Die Meinungen über die Ethnologie<br />
und den von ihr geleisteten Beitrag zum Kolonialismus gehen deshalb sehr weit auseinander (siehe<br />
oben sog. ”Krise der Ethnologie”) 1 .<br />
Beispiel 1: Ein Beispiel, wie man sich die ideale Zusammenarbeit zwischen der Kolonialadministration, den<br />
sog. practical men, und EthnologInnen vorstellte (und wie sie offenbar selten stattfand), gibt das Brown-Hutt-<br />
Experiment bei den Hehe in Tanganyika (1932). Dabei wurde - wie dies Malinowski übrigens damals auch<br />
empfahl 2 -auf eine strikte Rollentrennung geachtet: Der Ethnologe Brown hinterfragte nicht die politischen<br />
Richtlinien und der District Officer Hutt nicht die ethnologischen Interpretationen. Der Ethnologe wurde dabei<br />
nur als eine verlässliche Informationsquelle für spezifische und dringende Fragen behandelt. Hutt entschied in<br />
den von ihm aufgeworfenen Einzelfragen alleine. Fragen von Hutt an Brown betrafen z.B. die Zufriedenheit mit<br />
der Indirekt Rule, die Registrierungsmöglichkeiten von Heirat und Scheidung, das Ausmass der Polygynie und<br />
ihre Besteuerung (Entgegen der sendungsbewussten Absicht wurde die Frauenbesteuerung von den Kolonisierten<br />
nach Brown nicht als eine Besteuerung des Mannes, sondern seiner Frauen empfunden, weshalb diese für<br />
1 Nicht nur für ”mea-culpa”-FragerInnen interessant: Erstaunlicherweise wurden die mit der Disziplin Ethnologie abrechnenden wie<br />
auch positiven Fazits (siehe oben) in der ”Krise der Ethnologie” offenbar alleine aufgrund publizierter Quellen gezogen. Bezüge zu<br />
Datenmaterial z.B. aus Kolonialarchiven (evtl. wegen Zugangsbeschränkungen) und zur ”grauen” Literatur fehlen. Allerdings: Ergebnislose<br />
Nachforschungen bleiben oft unerwähnt und auch mit Berücksichtigung von Archivalien sind nicht unbedingt neue Ergebnisse<br />
zu erwarten.<br />
2 Gegen Ende der 30er Jahre war Malinowski dann allerdings gegen die apolitische Haltung des/der Ethnologen/-in.<br />
3