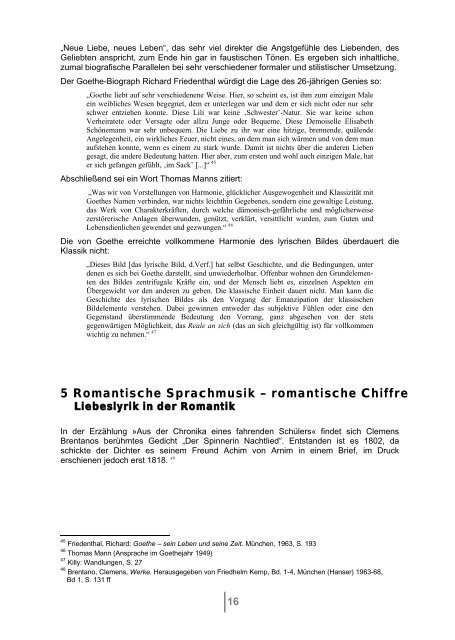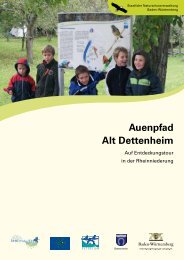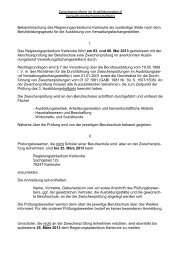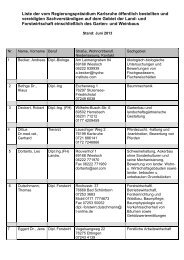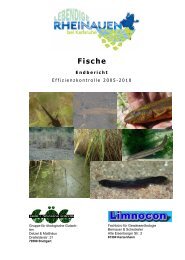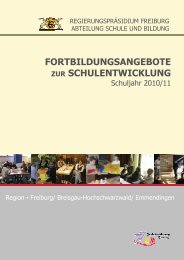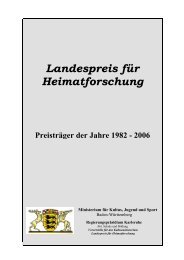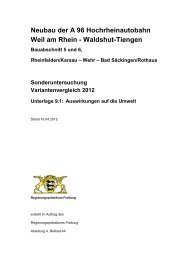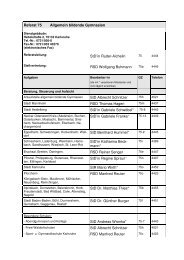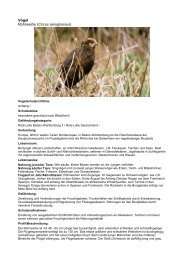Wandlungen des lyrischen Bildes in der Liebeslyrik - Materialsatz
Wandlungen des lyrischen Bildes in der Liebeslyrik - Materialsatz
Wandlungen des lyrischen Bildes in der Liebeslyrik - Materialsatz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Neue Liebe, neues Leben“, das sehr viel direkter die Angstgefühle <strong>des</strong> Liebenden, <strong>des</strong><br />
Geliebten anspricht, zum Ende h<strong>in</strong> gar <strong>in</strong> faustischen Tönen. Es ergeben sich <strong>in</strong>haltliche,<br />
zumal biografische Parallelen bei sehr verschiedener formaler und stilistischer Umsetzung.<br />
Der Goethe-Biograph Richard Friedenthal würdigt die Lage <strong>des</strong> 26-jährigen Genies so:<br />
„Goethe liebt auf sehr verschiedenene Weise. Hier, so sche<strong>in</strong>t es, ist ihm zum e<strong>in</strong>zigen Male<br />
e<strong>in</strong> weibliches Wesen begegnet, dem er unterlegen war und dem er sich nicht o<strong>der</strong> nur sehr<br />
schwer entziehen konnte. Diese Lili war ke<strong>in</strong>e ‚Schwester’-Natur. Sie war ke<strong>in</strong>e schon<br />
Verheiratete o<strong>der</strong> Versagte o<strong>der</strong> allzu Junge o<strong>der</strong> Bequeme. Diese Demoiselle Elisabeth<br />
Schönemann war sehr unbequem. Die Liebe zu ihr war e<strong>in</strong>e hitzige, brennende, quälende<br />
Angelegenheit, e<strong>in</strong> wirkliches Feuer, nicht e<strong>in</strong>es, an dem man sich wärmen und von dem man<br />
aufstehen konnte, wenn es e<strong>in</strong>em zu stark wurde. Damit ist nichts über die an<strong>der</strong>en Lieben<br />
gesagt, die an<strong>der</strong>e Bedeutung hatten. Hier aber, zum ersten und wohl auch e<strong>in</strong>zigen Male, hat<br />
er sich gefangen gefühlt, ‚im Sack’ [...]“ 45<br />
Abschließend sei e<strong>in</strong> Wort Thomas Manns zitiert:<br />
„Was wir von Vorstellungen von Harmonie, glücklicher Ausgewogenheit und Klassizität mit<br />
Goethes Namen verb<strong>in</strong>den, war nichts leichth<strong>in</strong> Gegebenes, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>e gewaltige Leistung,<br />
das Werk von Charakterkräften, durch welche dämonisch-gefährliche und möglicherweise<br />
zerstörerische Anlagen überwunden, genützt, verklärt, versittlicht wurden, zum Guten und<br />
Lebensdienlichen gewendet und gezwungen.“ 46<br />
Die von Goethe erreichte vollkommene Harmonie <strong>des</strong> <strong>lyrischen</strong> Bil<strong>des</strong> überdauert die<br />
Klassik nicht:<br />
„Dieses Bild [das lyrische Bild, d.Verf.] hat selbst Geschichte, und die Bed<strong>in</strong>gungen, unter<br />
denen es sich bei Goethe darstellt, s<strong>in</strong>d unwie<strong>der</strong>holbar. Offenbar wohnen den Grundelementen<br />
<strong>des</strong> Bil<strong>des</strong> zentrifugale Kräfte e<strong>in</strong>, und <strong>der</strong> Mensch liebt es, e<strong>in</strong>zelnen Aspekten e<strong>in</strong><br />
Übergewicht vor den an<strong>der</strong>en zu geben. Die klassische E<strong>in</strong>heit dauert nicht. Man kann die<br />
Geschichte <strong>des</strong> <strong>lyrischen</strong> Bil<strong>des</strong> als den Vorgang <strong>der</strong> Emanzipation <strong>der</strong> klassischen<br />
Bildelemente verstehen. Dabei gew<strong>in</strong>nen entwe<strong>der</strong> das subjektive Fühlen o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e den<br />
Gegenstand überstimmende Bedeutung den Vorrang, ganz abgesehen von <strong>der</strong> stets<br />
gegenwärtigen Möglichkeit, das Reale an sich (das an sich gleichgültig ist) für vollkommen<br />
wichtig zu nehmen.“ 47<br />
5 Romantische Sprachmusik – romantische Chiffre<br />
<strong>Liebeslyrik</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Romantik<br />
In <strong>der</strong> Erzählung »Aus <strong>der</strong> Chronika e<strong>in</strong>es fahrenden Schülers« f<strong>in</strong>det sich Clemens<br />
Brentanos berühmtes Gedicht „Der Sp<strong>in</strong>ner<strong>in</strong> Nachtlied“. Entstanden ist es 1802, da<br />
schickte <strong>der</strong> Dichter es se<strong>in</strong>em Freund Achim von Arnim <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Brief, im Druck<br />
erschienen jedoch erst 1818. 48<br />
45 Friedenthal, Richard: Goethe – se<strong>in</strong> Leben und se<strong>in</strong>e Zeit. München, 1963, S. 193<br />
46 Thomas Mann (Ansprache im Goethejahr 1949)<br />
47 Killy: <strong>Wandlungen</strong>, S. 27<br />
48 Brentano, Clemens, Werke. Herausgegeben von Friedhelm Kemp, Bd. 1-4, München (Hanser) 1963-68,<br />
Bd 1, S. 131 ff<br />
16