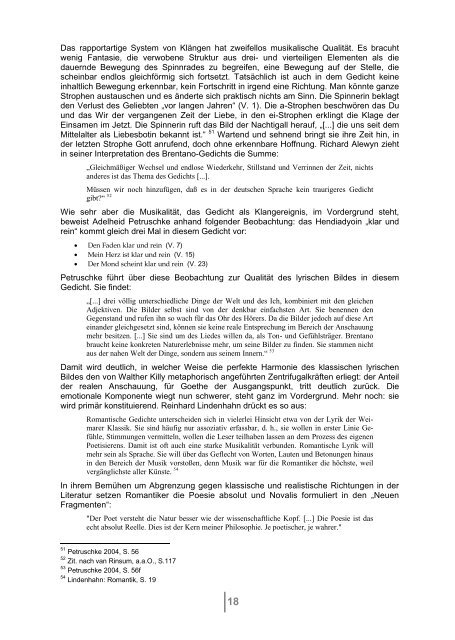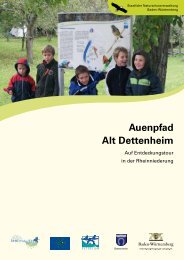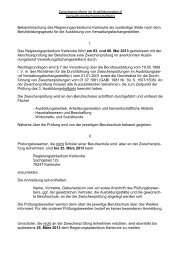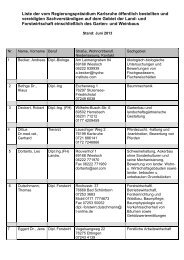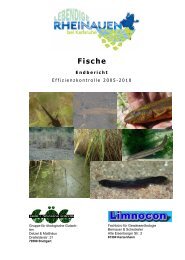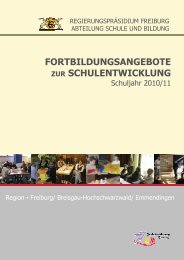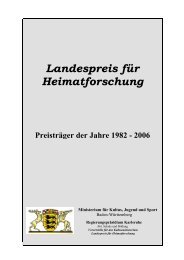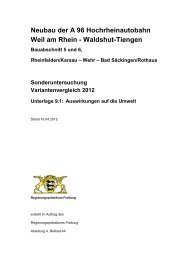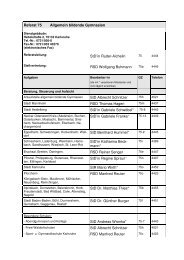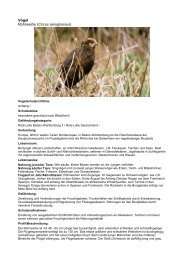Wandlungen des lyrischen Bildes in der Liebeslyrik - Materialsatz
Wandlungen des lyrischen Bildes in der Liebeslyrik - Materialsatz
Wandlungen des lyrischen Bildes in der Liebeslyrik - Materialsatz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das rapportartige System von Klängen hat zweifellos musikalische Qualität. Es bracuht<br />
wenig Fantasie, die verwobene Struktur aus drei- und vierteiligen Elementen als die<br />
dauernde Bewegung <strong>des</strong> Sp<strong>in</strong>nra<strong>des</strong> zu begreifen, e<strong>in</strong>e Bewegung auf <strong>der</strong> Stelle, die<br />
sche<strong>in</strong>bar endlos gleichförmig sich fortsetzt. Tatsächlich ist auch <strong>in</strong> dem Gedicht ke<strong>in</strong>e<br />
<strong>in</strong>haltlich Bewegung erkennbar, ke<strong>in</strong> Fortschritt <strong>in</strong> irgend e<strong>in</strong>e Richtung. Man könnte ganze<br />
Strophen austauschen und es än<strong>der</strong>te sich praktisch nichts am S<strong>in</strong>n. Die Sp<strong>in</strong>ner<strong>in</strong> beklagt<br />
den Verlust <strong>des</strong> Geliebten „vor langen Jahren“ (V. 1). Die a-Strophen beschwören das Du<br />
und das Wir <strong>der</strong> vergangenen Zeit <strong>der</strong> Liebe, <strong>in</strong> den ei-Strophen erkl<strong>in</strong>gt die Klage <strong>der</strong><br />
E<strong>in</strong>samen im Jetzt. Die Sp<strong>in</strong>ner<strong>in</strong> ruft das Bild <strong>der</strong> Nachtigall herauf, „[...] die uns seit dem<br />
Mittelalter als Liebesbot<strong>in</strong> bekannt ist.“ 51 Wartend und sehnend br<strong>in</strong>gt sie ihre Zeit h<strong>in</strong>, <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> letzten Strophe Gott anrufend, doch ohne erkennbare Hoffnung. Richard Alewyn zieht<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Interpretation <strong>des</strong> Brentano-Gedichts die Summe:<br />
„Gleichmäßiger Wechsel und endlose Wie<strong>der</strong>kehr, Stillstand und Verr<strong>in</strong>nen <strong>der</strong> Zeit, nichts<br />
an<strong>der</strong>es ist das Thema <strong>des</strong> Gedichts [...].<br />
Müssen wir noch h<strong>in</strong>zufügen, daß es <strong>in</strong> <strong>der</strong> deutschen Sprache ke<strong>in</strong> traurigeres Gedicht<br />
gibt?“ 52<br />
Wie sehr aber die Musikalität, das Gedicht als Klangereignis, im Vor<strong>der</strong>grund steht,<br />
beweist Adelheid Petruschke anhand folgen<strong>der</strong> Beobachtung: das Hendiadyo<strong>in</strong> „klar und<br />
re<strong>in</strong>“ kommt gleich drei Mal <strong>in</strong> diesem Gedicht vor:<br />
Åù Den Faden klar und re<strong>in</strong> (V. 7)<br />
Åû Me<strong>in</strong> Herz ist klar und re<strong>in</strong> (V. 15)<br />
Åü Der Mond sche<strong>in</strong>t klar und re<strong>in</strong> (V. 23)<br />
Petruschke führt über diese Beobachtung zur Qualität <strong>des</strong> <strong>lyrischen</strong> Bil<strong>des</strong> <strong>in</strong> diesem<br />
Gedicht. Sie f<strong>in</strong>det:<br />
„[...] drei völlig unterschiedliche D<strong>in</strong>ge <strong>der</strong> Welt und <strong>des</strong> Ich, komb<strong>in</strong>iert mit den gleichen<br />
Adjektiven. Die Bil<strong>der</strong> selbst s<strong>in</strong>d von <strong>der</strong> denkbar e<strong>in</strong>fachsten Art. Sie benennen den<br />
Gegenstand und rufen ihn so wach für das Ohr <strong>des</strong> Hörers. Da die Bil<strong>der</strong> jedoch auf diese Art<br />
e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> gleichgesetzt s<strong>in</strong>d, können sie ke<strong>in</strong>e reale Entsprechung im Bereich <strong>der</strong> Anschauung<br />
mehr besitzen. [...] Sie s<strong>in</strong>d um <strong>des</strong> Lie<strong>des</strong> willen da, als Ton- und Gefühlsträger. Brentano<br />
braucht ke<strong>in</strong>e konkreten Naturerlebnisse mehr, um se<strong>in</strong>e Bil<strong>der</strong> zu f<strong>in</strong>den. Sie stammen nicht<br />
aus <strong>der</strong> nahen Welt <strong>der</strong> D<strong>in</strong>ge, son<strong>der</strong>n aus se<strong>in</strong>em Innern.“ 53<br />
Damit wird deutlich, <strong>in</strong> welcher Weise die perfekte Harmonie <strong>des</strong> klassischen <strong>lyrischen</strong><br />
Bil<strong>des</strong> den von Walther Killy metaphorisch angeführten Zentrifugalkräften erliegt: <strong>der</strong> Anteil<br />
<strong>der</strong> realen Anschauung, für Goethe <strong>der</strong> Ausgangspunkt, tritt deutlich zurück. Die<br />
emotionale Komponente wiegt nun schwerer, steht ganz im Vor<strong>der</strong>grund. Mehr noch: sie<br />
wird primär konstituierend. Re<strong>in</strong>hard L<strong>in</strong>denhahn drückt es so aus:<br />
Romantische Gedichte unterscheiden sich <strong>in</strong> vielerlei H<strong>in</strong>sicht etwa von <strong>der</strong> Lyrik <strong>der</strong> Weimarer<br />
Klassik. Sie s<strong>in</strong>d häufig nur assoziativ erfassbar, d. h., sie wollen <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie Gefühle,<br />
Stimmungen vermitteln, wollen die Leser teilhaben lassen an dem Prozess <strong>des</strong> eigenen<br />
Poetisierens. Damit ist oft auch e<strong>in</strong>e starke Musikalität verbunden. Romantische Lyrik will<br />
mehr se<strong>in</strong> als Sprache. Sie will über das Geflecht von Worten, Lauten und Betonungen h<strong>in</strong>aus<br />
<strong>in</strong> den Bereich <strong>der</strong> Musik vorstoßen, denn Musik war für die Romantiker die höchste, weil<br />
vergänglichste aller Künste. 54<br />
In ihrem Bemühen um Abgrenzung gegen klassische und realistische Richtungen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Literatur setzen Romantiker die Poesie absolut und Novalis formuliert <strong>in</strong> den „Neuen<br />
Fragmenten“:<br />
"Der Poet versteht die Natur besser wie <strong>der</strong> wissenschaftliche Kopf. [...] Die Poesie ist das<br />
echt absolut Reelle. Dies ist <strong>der</strong> Kern me<strong>in</strong>er Philosophie. Je poetischer, je wahrer."<br />
51 Petruschke 2004, S. 56<br />
52 Zit. nach van R<strong>in</strong>sum, a.a.O., S.117<br />
53 Petruschke 2004, S. 56f<br />
54 L<strong>in</strong>denhahn: Romantik, S. 19<br />
18