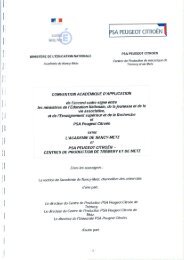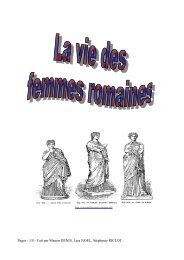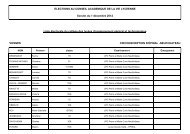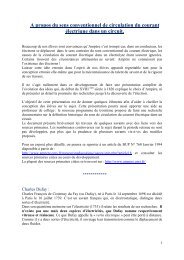Ueber Begriff und Gegenstand - Académie de Nancy-Metz
Ueber Begriff und Gegenstand - Académie de Nancy-Metz
Ueber Begriff und Gegenstand - Académie de Nancy-Metz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gottlob Frege - <strong>Ueber</strong> <strong>Begriff</strong> <strong>und</strong> <strong>Gegenstand</strong><br />
keine Ausnahme von unserer Regel anzumerken, es wären <strong>de</strong>nn alterthümliche<br />
Formeln, wie „Ein edler Rath“. Nicht ganz so einfach liegt die Sache beim<br />
bestimmten Artikel, beson<strong>de</strong>rs im Plural; aber [196] auf diesen Fall bezieht sich<br />
mein Kennzeichen nicht. Beim Singular ist die Sache, soviel ich sehe, nur dann<br />
zweifelhaft, wenn er statt <strong>de</strong>s Plurals steht, wie in <strong>de</strong>n Sätzen: „<strong>de</strong>r Türke belagerte<br />
Wien“, „das Pferd ist ein vierbeiniges Thier“. Diese Fälle sind so leicht als<br />
beson<strong>de</strong>re zu erkennen, dass unsere Regel durch ihr Vorkommen an Werth kaum<br />
einbüsst. Es ist klar, dass im ersten Satze „<strong>de</strong>r Türke“ Eigenname eines Volkes ist.<br />
Der zweite Satz ist wohl am angemessensten als Ausdruck eines allgemeinen<br />
Urtheils aufzufassen, wie: „alle Pfer<strong>de</strong> sind vierbeinige Thiere“, o<strong>de</strong>r: „alle<br />
wohlausgebil<strong>de</strong>ten Pfer<strong>de</strong> sind vierbeinige Thiere“, wovon später noch die Re<strong>de</strong><br />
sein wird 9 . Wenn nun Kerry mein Kennzeichen unzutreffend nennt, in<strong>de</strong>m er<br />
behauptet, in <strong>de</strong>m Satze „<strong>de</strong>r <strong>Begriff</strong>, von <strong>de</strong>m ich jetzt oben spreche, ist ein<br />
Individualbegriff“ be<strong>de</strong>ute <strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>n ersten acht Wörtern bestehen<strong>de</strong> Name<br />
sicherlich einen <strong>Begriff</strong>, so versteht er das Wort „<strong>Begriff</strong>“ nicht in meinen Sinne,<br />
<strong>und</strong> <strong>de</strong>r Wi<strong>de</strong>rspruch liegt nicht In meinen Festsetzungen. Niemand kann aber<br />
verlangen, dass meine Ausdrucksweise mit <strong>de</strong>r Kerry’s übereinstimmen müsse.<br />
Es kann ja nicht verkannt wer<strong>de</strong>n, dass hier eine freilich unvermeidbare<br />
sprachliche Härte vorliegt, wenn wir behaupten <strong>de</strong>r <strong>Begriff</strong> Pferdist kein <strong>Begriff</strong> 10 ,<br />
9<br />
Man ist jetzt, wie es scheint, geneigt, die Tragweite <strong>de</strong>s Satzes zu Übertreiben dass<br />
verschie<strong>de</strong>ne sprachliche Ausdrücke niemals vollkommen gleichwerthig seien <strong>und</strong><br />
dass ein Wort nie genau in einer an<strong>de</strong>rn Sprache wie<strong>de</strong>rgegeben wer<strong>de</strong>. Man könnte<br />
vielleicht noch weiter gehen <strong>und</strong> sagen, nicht einmal dasselbe Wort wer<strong>de</strong> von<br />
Menschen einer Sprache ganz gleich aufgefasst. Wieviel Wahrheit in diesen Sätzen<br />
ist, will ich nicht untersuchen, son<strong>de</strong>rn nur betonen, dass <strong>de</strong>nnoch nicht selten in<br />
verschie<strong>de</strong>nen Ausdrücken etwas Gemeinsames liegt, was ich <strong>de</strong>n Sinn <strong>und</strong> bei<br />
Sätzen im Beson<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n Gedanken nenne; mit an<strong>de</strong>rn Worten: es darf nicht<br />
verkannt wer<strong>de</strong>n, das man <strong>de</strong>nselben Sinn, <strong>de</strong>nselben Gedanken verschie<strong>de</strong>n<br />
ausdrücken kann, wobei <strong>de</strong>nn also die Verschie<strong>de</strong>nheit nicht eine solche <strong>de</strong>s<br />
Sinnes, son<strong>de</strong>rn nur eine <strong>de</strong>r Auffassung, Beleuchtung, Färbung <strong>de</strong>s Sinnes ist <strong>und</strong><br />
für die Logik nicht in Betracht kommt. Es ist möglich, dass ein Satz nicht mehr<br />
<strong>und</strong> nicht weniger Auskunft als ein an<strong>de</strong>rer gibt; <strong>und</strong> trotz aller Mannigfaltigkeit <strong>de</strong>r<br />
Sprachen hat die Menschheit einen gemeinsamen Schatz von Gedanken. Wenn<br />
man je<strong>de</strong> Umformung <strong>de</strong>s Ausdrucks verbieten wollte unter <strong>de</strong>m Vorgeben, dass<br />
damit auch <strong>de</strong>r Inhalt verän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>, so wür<strong>de</strong> die Logik gera<strong>de</strong>zu gelähmt; <strong>de</strong>nn<br />
ihre Aufgabe ist nicht wohl lösbar, ohne dass man sich bemüht, <strong>de</strong>n Gedanken in<br />
seinen mannigfachen Einkleidungen wie<strong>de</strong>rzuerkennen. Auch je<strong>de</strong> Definition wäre<br />
als falsch zu verwerfen.<br />
10 Aehnliches kommt vor, wenn wir mit Beziehung auf <strong>de</strong>n Satz „diese Rose ist<br />
roth“ sagen: das grammatische Prädicat „ist roth“ gehört zum Subjecte „diese<br />
Rose“. Hier sind die Worte „das grammatische Prädicat ‚ist roth’“ nicht<br />
grammatisches Prädicat, son<strong>de</strong>rn Subject. Gera<strong>de</strong> dadurch, dass wir es ausdrücklich<br />
Prädicat nennen, rauben wir ihm diese Eigenschaft.<br />
4



![Développement d'applications nationales [PDF - 67 Ko ]](https://img.yumpu.com/22700484/1/184x260/developpement-dapplications-nationales-pdf-67-ko-.jpg?quality=85)