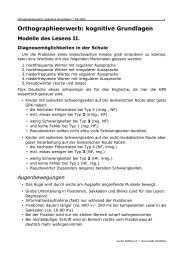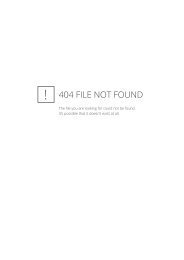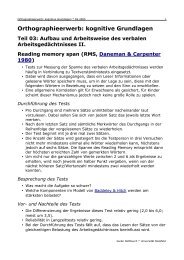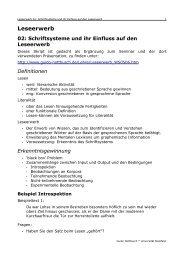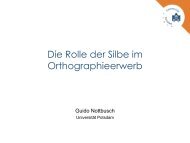Schriftspracherwerb - Guido Nottbusch
Schriftspracherwerb - Guido Nottbusch
Schriftspracherwerb - Guido Nottbusch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Schriftspracherwerb</strong> 1<br />
<strong>Schriftspracherwerb</strong><br />
Teil 04: Innere Regelbildung, Graphem-Phonem-Beziehungen<br />
und Fehlerdiagnose<br />
Repräsentation von Regularitäten<br />
• Die Regeln sind explizit und kodifiziert, d.h. sie sind bekannt und schriftlich fixiert.<br />
• Regularitäten sind nicht schriftlich fixiert und implizit, d.h. man folgt ihnen i.d.R. ohne sie<br />
zu kennen.<br />
• Die Norm ist nur das Ergebnis eines linguistischen Modells, d.h. nicht unbedingt die Beste<br />
aller Lösungen.<br />
Dieser Blickwinkel hat weit reichende Konsequenzen für den Rechtschreibunterricht: Die<br />
"metasprachliche Reflexion" und die "Teilhabe an der Erkenntnisgewinnung durch Einführung<br />
von Untersuchungsverfahren" wird als ein wesentlicher Teil des Sprachunterrichts angesehen.<br />
Wie sind Regeln/Regularitäten repräsentiert?<br />
Schreiben Sie die folgenden vier Sätze auf ein Blatt Papier. Die Sätze enthalten Pseudowörter, an<br />
denen die Anwendung orthographischen Muster- oder Regelwissens gut überprüft werden kann,<br />
da keine wortspezifischen Informationen vorhanden sein können. Es erfolgt eine Einbettung der<br />
Pseudowörter in ganze Sätze, um einen grammatischen Kontext zu geben; es treten auch<br />
"flektierte" Pseudowörter auf.<br />
1. hans pElst ?In diù Èkt«Èmeùr«.<br />
2. Èpeùt StrUpft g«ÈdAùb« ?aus deùm gAùl.<br />
3. È?iùda flAùmt ?In diù Èkal«ÈpaS«.<br />
4. Èpaul ralt :heùz« ?In diù ÈbrAùs«n.<br />
1. Dehnung<br />
In der Schule selten vermittelt, funktioniert die sogenannte "l-m-n-r-Regel" bei einer großen<br />
Mehrheit der mehrsilbigen Wörter: Folgt einem langen Vokal ein l, m, n, oder r, dann wird ein<br />
Dehnungs-h geschrieben.<br />
Èkt«Èmeùr« gAùl flAùmt ÈbrAùs«n g«ÈdAùb« Èheùz«<br />
Kottemehre Gahl flahmt Braßen G/gedabe H/hese<br />
2. Schärfung (Gelenkschreibung)<br />
Die Regel lautet vereinfacht: Wenn es für ein Wort eine Form mit Silbengelenk (SG) gibt (nach<br />
kurzem Vokal in betonter Silbe), dann wird der Buchstabe für das SG verdoppelt (Ausnahme: Dioder<br />
Trigrapheme).<br />
Èkt«Èmeùr« Èkal«ÈpaS« ralt pElst<br />
Kottemehre Kallepasche rallt (wg. rallen) pelst (wg. pel-sen)<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Potsdam
<strong>Schriftspracherwerb</strong> 2<br />
3. S-Graphie<br />
Die Regel lautet vereinfacht: /s/ als Silbengelenk wird verschriftet. Kommt /s/ in einer<br />
Wortform intervokalisch nach langem Vokal vor und bleibt in allen Wortformen stimmlos wird es<br />
verschriftet. In allen anderen Fällen wird /s/ oder /z/ mit verschriftet.<br />
pElst heùz« brAùs«n<br />
pelst (wg. pel-sen) Hese (stimmhaft) braßen<br />
4. Groß-/Kleinschreibung<br />
Die Pseudowörter müssen grammatisch analysiert werden, ob sie im Satz nominale Funktion<br />
besitzen oder nicht.<br />
Verben: pElst, StrUpft, flAùmt, ralt<br />
Nomen: Èkt«Èmeùr«, gAùl, Èkal«ÈpaS«, ÈbrAùs«n<br />
Adverb/Nomen: g«ÈdAùb«, :heùz«<br />
Fazit<br />
• weitgehend regelkonforme Schreibungen<br />
• reflexive Regelbegründungen auf Nachfrage nur schwer möglich: Nennung analoger Fälle<br />
• Dies deutet eher auf Musterwissen als auf Regelwissen hin!<br />
• weitgehend regelkonforme Schreibungen<br />
• reflexive Regelbegründungen auf Nachfrage nur schwer möglich: Nennung analoger Fälle<br />
• Dies deutet eher auf Musterwissen als auf Regelwissen hin!<br />
• Schreibungen können mit dem silbenphonologisch, morphologisch und grammatisch<br />
orientierten Orthographie-Ansatz vorhergesagt werden.<br />
• Schriftsprache wird in erster Linie nicht durch die Vermittlung operativer Regeln erworben,<br />
sondern muss selbsttätig gelernt werden.<br />
• Wissenstransfer bedeutet, dass man diesen Prozess unterstützt.<br />
• Im Unterricht müssen Lernsituationen geschaffen werden, in denen die Schreiblerner zum<br />
selbstgesteuerten Aufbau des produktiven Wissens gelangen.<br />
Erwerbsmodell von Thomé (2003)<br />
(siehe Skript zur zweiten Sitzung)<br />
Umgang mit Fehlern<br />
Der Orthographieerwerb besteht insbesondere darin, dass sich die Lerner aus der Schriftsprache,<br />
mit der sie umgehen, selbständig ein Regelsystem erarbeiten. Es handelt sich um einen Prozess<br />
der inneren Regelbildung. Sowohl der Prozess der Regelbildung als auch das daraus resultierende<br />
Regelsystem sind den Lernern weitgehend unbewusst. Dieser Prozess der inneren Regelbildung<br />
findet u.a. seinen Ausdruck in Fehlschreibungen der Lerner. Offensichtlich verläuft die innere<br />
Regelbildung nicht beliebig, sondern nach einem bestimmten Muster. Dies lässt sich in<br />
Stufenmodellen darstellen.<br />
Die Lehrkraft muss daher:<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Potsdam
<strong>Schriftspracherwerb</strong> 3<br />
• die diagnostische Kompetenz besitzen, beobachtete Fehler auf Prozesse der inneren<br />
Regelbildung zurückzuführen und<br />
• daraus Methoden entwickeln können, diese Regelbildung zu unterstützen.<br />
• Dieses Konzept bildet daher eine wesentliche Grundlage für eine Differenzierung im<br />
Rechtschreibunterricht.<br />
Typologie der Rechtschreibfehler<br />
Die Typologie geht von der Überlegung aus, dass es drei Haupttypen von Fehlern gibt:<br />
1. elementare phonographische Fehler<br />
2. falsche orthographische Markierungen<br />
a) fehlende Markierungen<br />
b) übergeneralisierte Markierungen<br />
3. Vertauschungsfehler<br />
elementare phonographische Fehler<br />
• Die elementare Phonem-Graphembeziehung wird nicht korrekt wiedergegeben.<br />
• Probleme bei der phonologischen Analyse (Segmentierung) eines Wortes<br />
• eine Lücke im PGK-Regelsystem<br />
fehlende/übergeneralisierte orthographische Markierungen<br />
• Alle über die elementaren Phonem-Graphembeziehungen hinausgehenden Schreibungen<br />
werden als markierte Fälle angesehen.<br />
• fehlende Markierung -> keine Hinweise auf ein entsprechendes orthographisches Wissen<br />
• Markierung an einer falschen Stelle bzw. Übergeneralisierung -> Ansätze eines Wissens im<br />
jeweiligen orthographischen Bereich<br />
Vertauschungsfehler<br />
• Unterscheidung zwischen markiertem und unmarkiertem Fall nicht feststellbar.<br />
Fehlerdiagnose<br />
• Betrachtung von Fehlern getrennt nach orthographischen Bereichen (z.B.: Phonographie,<br />
GKS, Schärfung, Dehnung, GZS, Interpunktion, etc.)<br />
• Würdigung der vorliegenden Kenntnisse ("Was kann das Kind schon?"), um anschließend<br />
die nächsten Inhalte festlegen zu können ("Was kann/soll das Kind als nächstes lernen?").<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Potsdam
<strong>Schriftspracherwerb</strong> 4<br />
1. Groß- und Kleinschreibung<br />
• Satzinitale Großschreibung: kommt nicht vor<br />
• Insgesamt 10 Nomen, davon 6 richtig groß<br />
• Klein- für Großschreibung: 6<br />
• Groß- für Kleinschreibung: 3<br />
• Adjektiv zwischen (unbestimmtem) Artikel und Substantiv groß (aber Substantiv auch groß)<br />
• * (Zeile 1)<br />
• * (Zeile 3)<br />
• * (Zeile 4)<br />
• aber: (Zeile 2/3)<br />
• Substantive direkt nach Artikel überwiegend korrekt<br />
• (Zeile 5)<br />
• (Zeile 6)<br />
• aber: * (Zeile 7)<br />
• Substantive ohne Artikel, nach Zahl(wort), Präposition + Artikel immer falsch<br />
• * (Zeile 4)<br />
• * (Zeile 7)<br />
• * (Zeile 8)<br />
• * (Zeile 8)<br />
Zahl der Fehler nimmt zum Ende hin zu. Noch starke Orientierung an Artikelwörtern (auch<br />
übergeneralisiert).<br />
21<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Potsdam
<strong>Schriftspracherwerb</strong> 5<br />
2. Getrennt- und Zusammenschreibung<br />
• * (Zeile 1)<br />
• * oder *<br />
Wortbegriff insgesamt gut. Erklärung der Fehler aus syntaktischer Perspektive nicht möglich.<br />
Vermutlich eher ein graphomotorisches Problem.<br />
3. S-Graphie<br />
• für <br />
• * für <br />
• * für <br />
• für ()<br />
• * für <br />
• * für <br />
• * für <br />
• aber:<br />
• (2x) korrekt!<br />
• <br />
• <br />
Alle Fehlerfälle enthalten ein stimmloses .<br />
Unsicherheit bei der Graphemunterscheidung.<br />
4. Phonographie<br />
• falscher Vokal in * und *<br />
• fehlende Umlautmarkierung in * (Zeile 1)<br />
• aber vorhandene Umlautmarkierung in (Zeile 7)<br />
Phonographie sonst sehr gut (fast 100% aller Laute verschriftet).<br />
5. Schärfung<br />
• fehlende Schärfungsmarkierungen (keine korrekte Anwendung vorhanden)<br />
• (3x)<br />
• <br />
• <br />
• <br />
6. Dehnung<br />
• fehlende Dehnungsmarkierung (Langvokal vor Sonorant), einmal korrekt in<br />
→ zu wenige Fälle, um zu einer Aussage zu gelangen.<br />
7. Interpunktion<br />
Außer eine Punkt am Schluss nicht vorhanden.<br />
8. Auslautverhärtung<br />
kommt nicht vor<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Potsdam
<strong>Schriftspracherwerb</strong> 6<br />
9. Grammatikfehler<br />
Spielen für diese Analyse keine Rolle.<br />
10. Sonstiges<br />
für "zwei": könnte Vermeidungsstrategie sein<br />
11. Fazit<br />
• s/z/ß<br />
• GKS<br />
• Schärfung<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Potsdam