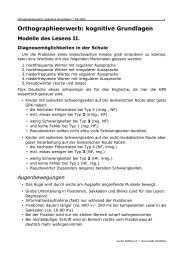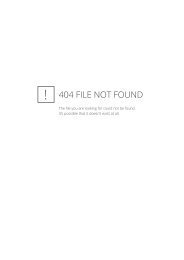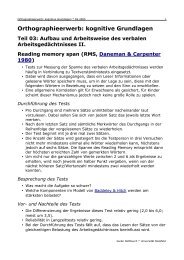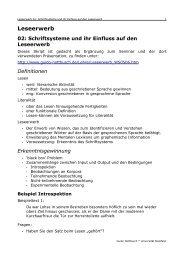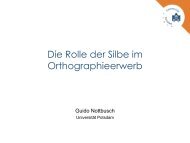Grundlagen der Sprachdidaktik - Guido Nottbusch
Grundlagen der Sprachdidaktik - Guido Nottbusch
Grundlagen der Sprachdidaktik - Guido Nottbusch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Sprachdidaktik</strong> 1<br />
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Sprachdidaktik</strong><br />
Teil 02: Mehrsprachigkeit & Begegnung mit<br />
Sprachen<br />
1. Begegnung mit Sprachen<br />
2. Fremdsprachenvermittlung in <strong>der</strong> Grundschule<br />
3. Sprachunterricht unter <strong>der</strong> Bedingung <strong>der</strong> Mehrsprachigkeit<br />
Ausgangspunkt: Kin<strong>der</strong> begegnen Sprachen<br />
Die Lebenswelt <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> ist nicht mehr auf die Muttersprache begrenzt.<br />
Durch<br />
• Migration<br />
• Massenmedien<br />
• mobiles Freizeitverhalten<br />
werden die Spracherfahrungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> immer vielfältiger.<br />
Migration<br />
Ergebnisse aus PISA 2000<br />
• Deutschland: ein Einwan<strong>der</strong>ungsland<br />
• Migrationsgruppen in Deutschland:<br />
• Arbeitsmigranten aus den ehemaligen Anwerbelän<strong>der</strong>n Süd- und<br />
Sudosteuropas,<br />
• Deutschstämmige Aussiedler,<br />
• Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber,<br />
• Zuwan<strong>der</strong>er aus <strong>der</strong> EU und sonstigen Län<strong>der</strong>n, die im Rahmen <strong>der</strong><br />
Arbeitsmobilität nach Deutschland kommen.<br />
• Rund die Hälfte aller 15-jährigen, <strong>der</strong>en Väter nicht in Deutschland<br />
geboren sind, ist selbst bereits seit ihrer Geburt in Deutschland.<br />
• Mehr als 70% <strong>der</strong> Jugendlichen haben vom Kin<strong>der</strong>garten bis zum Ende<br />
<strong>der</strong> Pflichtschulzeit durchgehend Bildungseinrichtungen in Deutschland<br />
besucht.<br />
• Seiteneinsteiger finden sich in nennenswertem Umfang nur noch bei<br />
Aussiedler- und Flüchtlingsfamilien.<br />
Quelle: Baumert, Jürgen u.a.: PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im<br />
internationalen Vergleich. Opladen: Leske und Budrich, 2001; Forum Schule Heft 1/2002<br />
Medien und Massenmedien<br />
Im Bereich Medien und Massenmedien herrscht eine starke Dominanz des<br />
Englischen vor:<br />
• in <strong>der</strong> Werbung<br />
• auf Verpackungen<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Sprachdidaktik</strong> 2<br />
• in <strong>der</strong> Musik<br />
• in Computerprogrammen und –spielen<br />
• ...<br />
mobiles Freizeitverhalten<br />
• Urlaub im Ausland<br />
• Begegnung mit an<strong>der</strong>ssprachigen Kin<strong>der</strong>n<br />
• internationale Küche<br />
• ...<br />
Typen mehrsprachiger Erziehung<br />
• Segregation: getrennte Klassen, Ziel: Einsprachigkeit in <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Muttersprache<br />
• Submersion: gemischte Klassen, Ziel: hauptsächlich Einsprachigkeit in<br />
<strong>der</strong> Mehrheitssprache ('dränknings-program').<br />
• Immersion: gemischte Klassen, Unterrichtssprache =<br />
Min<strong>der</strong>heitensprache ('Sprachbad')<br />
• Mischformen: z.B. schwedische hemspråksreform, Ziel:<br />
Zweisprachigkeit; Unterricht zunächst in <strong>der</strong> Muttersprache,<br />
Zweitsprache als Fach, dann fließen<strong>der</strong> Übergang.<br />
"Begegnung mit Sprachen in <strong>der</strong> Grundschule"<br />
(Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (1992). Run<strong>der</strong>lass<br />
des Kultusministeriums vom 13.2.1992)<br />
Ziel: Aufnahme <strong>der</strong> lebensweltlichen Erfahrung in den<br />
Unterricht<br />
Die Erfahrungen mit an<strong>der</strong>en Sprachen und fremden Kulturen müssen in<br />
<strong>der</strong> Schule in kindgerechter Weise aufgearbeitet werden. Ziele, die hierbei<br />
erreicht werden sollen:<br />
• Interesse an Sprachen<br />
• Interesse an Sprachen und Freude am Umgang mit ihnen wecken<br />
• Interkulturelle Erziehung<br />
• Schule als Ort <strong>der</strong> interkulturellen Begegnung<br />
• die Gleichwertigkeit von Sprachen und Kulturen bewusst machen<br />
• Vorurteile abbauen<br />
• Ethnozentrierte Denkweisen verhin<strong>der</strong>n<br />
• Vorbereitung auf eine multikulturelle mehrsprachige Gesellschaft<br />
• Toleranz gegenüber ausländischen Mitschülern/Mitbürgern<br />
• soziale Integration ausländischer Kin<strong>der</strong><br />
• Spiel – sprachliches Handeln – Kommunikation<br />
• Sprache als Kommunikationsmittel verstehen (Sprachbarrieren<br />
überwinden)<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Sprachdidaktik</strong> 3<br />
• im Spiel und beim sprachlichen Handeln erweiterte Möglichkeiten<br />
<strong>der</strong> Kommunikation erproben<br />
• Muttersprache besser erkennen<br />
• Erscheinungsformen <strong>der</strong> eigenen Muttersprache besser erkennen<br />
• mit den vielfältigen Ausprägungen <strong>der</strong> Muttersprache differenzierter<br />
umgehen<br />
Wählbare Sprachen<br />
Wo Kin<strong>der</strong> in ihrer Lebenswelt fremden Sprachen begegnen, werden diese<br />
zur Begegnungssprache:<br />
• Dies kann eine Nachbarschaftssprache sein, zum Beispiel<br />
Nie<strong>der</strong>ländisch o<strong>der</strong> Französisch im Grenzgebiet zu den Nie<strong>der</strong>landen<br />
o<strong>der</strong> Belgien.<br />
• Zweitens können dies Herkunftssprachen wie zum Beispiel Türkisch,<br />
Griechisch, Serbokroatisch, Polnisch, Russisch usw. sein.<br />
• Drittens können sich zum Beispiel durch Schüleraustausch im Rahmen<br />
von Städtepartnerschaften Begegnungen mit Partnersprachen<br />
ergeben.<br />
• Schließlich kann das vor allem die Weltsprache Englisch sein, die in den<br />
Medien am häufigsten auftritt.<br />
Hinweise für die Umsetzung<br />
• spielerischer, grundschulspezifischer Unterricht<br />
• Kreativität und Phantasie för<strong>der</strong>n<br />
• Motivation durch: Lie<strong>der</strong>, Spiele, Reime, Zungenbrecher, kleine<br />
Thematische Einheiten<br />
• lebensweltorientiert<br />
• dem Tätigkeits- und Bewegungsdrang <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> entsprochen<br />
• die Fähigkeiten zum Entdecken, Gestalten und Sprechen entwickeln<br />
• Angebot für alle Kin<strong>der</strong> (keine Arbeitsgemeinschaften)<br />
• dient nicht <strong>der</strong> Vorbereitung auf weiterführende Schulen<br />
• keine schriftlichen Übungen und Arbeiten zur Leistungsfeststellung und<br />
Leistungsbewertung<br />
Organisatorischer Rahmen<br />
• kleine Portionen, über die Woche verteilt (Klasse 1/2 = 20 Min. pro<br />
Woche; Klasse 3/4 = 45 Min. pro Woche)<br />
• Begegnung mit Sprache nicht nur im Fach Deutsch (Bio, Musik, Kunst,<br />
Geschichte...)<br />
Quelle: Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (1992): Begegnung mit Sprachen in <strong>der</strong><br />
Grundschule. Run<strong>der</strong>lass des Kultusministeriums vom 13.2.1992<br />
Begegnung mit Sprache<br />
• beruht auf dem Konzept "language awareness":<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Sprachdidaktik</strong> 4<br />
• Nachdenken über Sprache, angestoßen vom Vergleich ähnlicher und<br />
unterschiedlicher Strukturen<br />
• Sensibilisierung sowohl für die eigene als auch für die fremde<br />
Sprache<br />
• Sprachbegegnung führt zur Entwicklung von Sprachbewusstsein: S.<br />
ist eine metasprachliche Fähigkeit. Sprachbewusstsein ist das<br />
"Wissen über Sprache" bzw. die Fähigkeit zu metasprachlichen<br />
Urteilen über sprachliche Ausdrücke.<br />
Quelle: Bußmann (1990): Lexikon <strong>der</strong> Sprachwissenschaft<br />
• Reflexion über Sprache setzt Kenntnisse voraus<br />
• Die Hauptbegegnungssprache ist Englisch, weil die Lehrer sich nur hier<br />
in <strong>der</strong> Lage sehen, eigene Kenntnisse einzubringen.<br />
gewählte Begegnungssprache(n)<br />
• 75% Englisch<br />
• 9% Französisch<br />
• 6% Türkisch<br />
• 4% Nie<strong>der</strong>ländisch<br />
• 3% Italienisch<br />
• 3% an<strong>der</strong>e<br />
Qualifizierung <strong>der</strong> Lehrkräfte<br />
• viele Lehrerinnen glauben, dass die eigenen, meist schulisch<br />
erworbenen FS-Kenntnisse für die Durchführung von BmS nicht<br />
ausreichen<br />
Quelle: Hänisch, H. & Thürmann, E. (1994) Begegnung mit Sprachen in <strong>der</strong> Grundschule. Kurzfassung <strong>der</strong><br />
Ergebnisse einer Befragung von Schulleiterinnen und Schulleitern sowie <strong>der</strong>jenigen Lehrerinnen und Lehrern,<br />
die Begegnung mit Sprachen bereits praktizieren. Soest: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 1994<br />
Möglichkeiten <strong>der</strong> Umsetzung / Alternativen<br />
• Fremdsprachliche Lerngelegenheiten 'beim Schopfe packen'<br />
• Beteiligung <strong>der</strong> ausländischen Lehrer<br />
• Integration deutscher Kin<strong>der</strong> am Muttersprachlichen Unterricht<br />
Welche Lernbereiche können sinnvoll in das Thema integriert<br />
werden?<br />
• für die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Sprachen<br />
sensibilisieren -> Reflexion über Sprache<br />
• Erscheinungsformen <strong>der</strong> eigenen Muttersprache besser erkennen -><br />
Reflexion über Sprache<br />
• Die nur stützende Funktion des Lesens und des Schreibens muss in<br />
höheren Jahrgangsstufen ausgebaut werden. -> Umgang mit Texten,<br />
Textproduktion<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Sprachdidaktik</strong> 5<br />
Fremdsprachenvermittlung in <strong>der</strong> Grundschule<br />
Bericht „Fremdsprachen in <strong>der</strong> Grundschule - Sachstand und<br />
Konzeptionen“, Beschluss <strong>der</strong> Kultusministerkonferenz (KMK) vom<br />
01.03.2002.<br />
Die Kultusministerkonferenz (KMK) stellt fest, "dass in allen Län<strong>der</strong>n <strong>der</strong><br />
Fremdsprachenunterricht in <strong>der</strong> Primarstufe deutlich ausgeweitet wird.<br />
Dies betrifft vorrangig die Jahrgangsstufen 3 und 4, in einigen Län<strong>der</strong>n<br />
auch die Jahrgangsstufen 1 und 2."<br />
In einer zunehmenden Zahl <strong>der</strong> Bundeslän<strong>der</strong> herrsche Einigkeit<br />
darüber, "dass neben dem Begegnungskonzept das eher systematische<br />
und themenorientierte Fremdsprachenlernen auf <strong>der</strong> Grundlage eines<br />
(Rahmen-)Lehrplans mit ergebnisorientierter Progression" vorzusehen<br />
sein.<br />
Zur Begründung dieser Orientierung werden genannt:<br />
• verän<strong>der</strong>te Lebenswirklichkeit<br />
• günstige Lernvoraussetzungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> des betreffenden Alters<br />
Ziele<br />
• Im Gegensatz zu BmS weniger Umgang mit und Heranführung an<br />
Sprachen, son<strong>der</strong>n mehr sprachlich-fachliche Ziele, Lernen von<br />
Sprachen<br />
• Voraussetzungen für das weitere fachliche Lernen stärken<br />
• BmS: erweiterten Möglichkeiten <strong>der</strong> Kommunikation erproben vs. KMK:<br />
grundlegende fremdsprachliche Kompetenz<br />
Quelle: Grieshaber<br />
Umsetzung<br />
• lebensweltlicher Bezug<br />
• grundschulspezifische Arbeitsformen<br />
• authentische Materialien<br />
• soweit möglich; originale Begegnungen<br />
• Fremdsprache als Verständigungsmittel (insb. im Sachfachbereich)<br />
• Vorrang von Hörverstehen und Sprechen<br />
• dem Lesen und Schreiben kommt nur stützende Funktion zu<br />
Organisatorischer Rahmen<br />
• keine Beschränkung <strong>der</strong> angebotenen Sprachen, jedoch Hinweis auf die<br />
weiterführenden Schulen (-> Englisch, Französisch)<br />
• Fremdsprachenversorgung im Pflichtbereich <strong>der</strong> Jahrgangsstufen 3 und<br />
4 in fast allen Bundeslän<strong>der</strong>n bis spätestens 2004/05 angestrebt (in<br />
NRW seit 2003, nur Englisch)<br />
• weiterhin Begegnung mit Sprache in den Jahrgangsstufen 1 und 2 (in<br />
NRW seit 2003, alle Sprachen)<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Sprachdidaktik</strong> 6<br />
• ein bis zwei Wochenstunden, evtl. in Wochenarbeitsplan integriert<br />
(NRW: 2 Std.)<br />
• Ausweitung <strong>der</strong> Stundentafel<br />
• keine Auswahl nach Leistung<br />
• Benotung bisher nur in BW, in NRW nicht während <strong>der</strong> vierjährigen<br />
Erprobungsphase<br />
• Fortführung in weiter führenden Schulen<br />
• NRW<br />
• Anpassung <strong>der</strong> Lehrpläne<br />
• Vermehrtes Angebot bilingualen Unterrichts<br />
• kein flächendeckendes Vorziehen <strong>der</strong> 2. Fremdsprache ab Klasse 6<br />
• 3. Fremdsprache ab Klasse 8 wird in einigen Gymnasien erprobt<br />
Lehrerqualifikation<br />
• Fortbildungsmaßnahmen an VHS u.a.<br />
• schulinterne Fortbildungen<br />
• langfristig: Verankerung in <strong>der</strong> Lehrerausbildung<br />
Englisch in <strong>der</strong> Grundschule<br />
Die Zielsprache Englisch ist we<strong>der</strong> eine verfügbare Verständigungs- und<br />
Arbeitssprache, noch ruft sie innere Bil<strong>der</strong> hervor, wenn Geschichten<br />
erzählt o<strong>der</strong> Sachverhalte betrachtet werden.<br />
Prinzipien<br />
• Prinzip des Themen- und Situationsbezugs sprachlichen Lernens<br />
• Prinzip des spielerischen, darstellenden und gestaltenden Lernens<br />
• Prinzip <strong>der</strong> Authentizität<br />
• Prinzip des entdeckenden und experimentierenden Umgangs mit<br />
Sprache<br />
Strukturierung<br />
• Erlernen formelhafter Elemente (item learning)<br />
• Auseinan<strong>der</strong>setzung mit sprachlichen Phänomenen (system learning)<br />
• Identifizieren, Aufgreifen, Erinnern und funktionsgerechten<br />
Reproduzieren von festgefügten Redemitteln und formelhaften<br />
Wendungen (chunks)<br />
• Hypothesenbildung über die neue Sprache<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Sprachdidaktik</strong> 7<br />
Sprachunterricht unter <strong>der</strong> Bedingung <strong>der</strong><br />
Mehrsprachigkeit<br />
Quelle: learn-line, Englisch in <strong>der</strong> Grundschule<br />
Viele Kin<strong>der</strong> 'müssen' unter den Bedingungen <strong>der</strong> Mehrsprachigkeit<br />
aufwachsen. Positive o<strong>der</strong> negative Auswirkungen hängen ab von:<br />
• Unterrichtssprache<br />
• Status <strong>der</strong> beteiligten Sprachen<br />
• Gleichwertigkeit aber nicht Gleichrangigkeit<br />
Beispiel eines Seiteneinsteigers:<br />
"bitιenιtşulιgenzi dasihnihtşιraybenkan"<br />
• Rückgriff auf türkische Phonem-Graphem-Beziehungen<br />
• Türkisch hat sehr regelhafte Phonem-Graphem-Beziehungen (flache<br />
Orthographie)<br />
• Doppelkonsonanz nicht möglich (außer in Fremd- und Lehnwörtern) –<br />
führt zur Einfügung sog. Sprossvokale<br />
• Maximal verbundene lateinische Ausgangsschrift vs. unverbundene<br />
türkische Schreibschrift<br />
• intelligente systematische Fehlleistung vs. Lernbehin<strong>der</strong>ung<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Sprachdidaktik</strong> 8<br />
Bei in Deutschland aufgewachsenen Kin<strong>der</strong>n sind solche systematischen<br />
Interferenzen nicht mehr zu erwarten, da die entsprechenden Kenntnisse<br />
über die Muttersprache fehlen.<br />
"Peter guk Fersen willi guk ach Fersen. Mutter sag: Kannste du mit mir<br />
schüpüllen Peter sak ja Mamma. Mutter Schüpült und Peter trognet Peter<br />
is sehr sauer Mutter Schpült Peter deng wen die Teler kaput wierf dan<br />
kanich Cowboy film gugen wen die Teller kaput is dan Fernsen gugen."<br />
Die Verschriftung <strong>der</strong> nicht beherrschten Sprache erweist sich als sehr<br />
schwierig:<br />
• Dehnung/Schärfung findet kaum Anwendung – Vokalopposition<br />
gespannt/ungespannt hat im Türkischen keine<br />
bedeutungsunterscheidende Funktion<br />
• Endungen fehlen häufig<br />
• 'irgendwas' war da mit 'gucken'<br />
• Sprossvokale<br />
• 'Cowboy' ganzheitlich gelernt<br />
weiter führende Literatur zum Thema:<br />
Belke, Gerlind (2003): Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht.<br />
Sprachspiele, Spracherwerb, Sprachvermittlung. 3. Auflage.<br />
Hohengehren: Schnei<strong>der</strong>.<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld