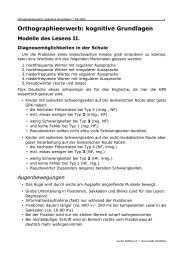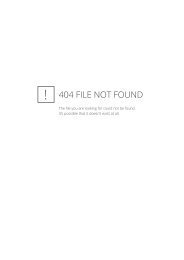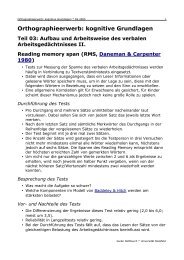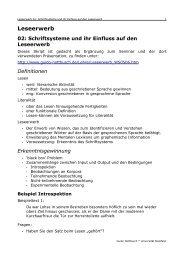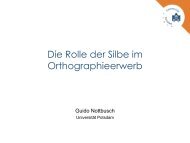Schriftspracherwerb - Guido Nottbusch
Schriftspracherwerb - Guido Nottbusch
Schriftspracherwerb - Guido Nottbusch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Schriftspracherwerb</strong> 1<br />
<strong>Schriftspracherwerb</strong><br />
Teil 07: Voraussetzungen des <strong>Schriftspracherwerb</strong>s: Aufbau und<br />
Arbeitsweise des Arbeitsgedächtnisses<br />
Allgemeine Intelligenz<br />
• IQ-Messungen korrelieren nur sehr schwach und unspezifisch mit den Lesefähigkeiten in<br />
den ersten beiden Schuljahren.<br />
• Der Anteil hoch intelligenter Kinder in der Gruppe der 'frühen' Leser ist zwar hoch, jedoch<br />
ist diese Gruppe insgesamt so heterogen, dass kein Zusammenhang angenommen werden<br />
kann.<br />
• Innerhalb der Gruppe der Kinder mit Leseschwierigkeiten ist der Anteil der<br />
überdurchschnittlich intelligenten Kinder relativ hoch.<br />
Spanne des verbalen Arbeitsgedächtnisses<br />
• Die Aufrechterhaltung des bisher erlesenen Teil des Wortes ist zentraler Bestandteil des<br />
Erlesens von Wörtern.<br />
Geschwindigkeit des Gedächtnisabrufs<br />
• starke Zusammenhänge zwischen dem Benennen von nicht-schriftlichen Stimuli und der<br />
Leseleistung<br />
Interpretationen:<br />
1. geringe Geschwindigkeit ist Folge eines nicht ausreichend ausgebildeten phonologischen<br />
Kodes (zentrales phonologisches Verarbeitungsdefizit),<br />
2. geringe Geschwindigkeit ist Ausdruck eines allgemeinen Defizits beim Zugriff auf<br />
Gedächtnisrepräsentationen<br />
Für 2. spricht, dass Maße der phonologischen Bewusstheit nicht mit der Abrufgeschwindigkeit<br />
korrelieren. Stattdessen korreliert schnelles Benennen mit dem Lesen von bekannten Wörtern,<br />
phonologische Bewusstheit mit dem Lesen von unbekannten Wörtern.<br />
Phonologische Bewusstheit<br />
Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne:<br />
• Aufgabe erfordert die Analyse lautlicher Aspekte der gesprochenen Sprache<br />
• Reimen, Silben segmentieren, Lautassoziationen, Vokale im Anlaut erkennen<br />
Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne:<br />
• Aufgabe erfordert den bewussten Umgang mit Phonemen<br />
• Lautsegmentierung, Phonemisolierung, Phonemersetzung, Phonemsynthese.<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Paderborn
<strong>Schriftspracherwerb</strong> 2<br />
Aufbau und Arbeitsweise des verbalen Arbeitsgedächtnisses<br />
Drei Stufen des menschliches Gedächtnisses<br />
• Sensorische Speicher: (Zwischen-)Speicherung des Abbildes des aktuellen Stimulus<br />
• visuell, Speicherungsdauer ca. 0.5 Sekunden<br />
• akustisch, Speicherungsdauer ca. 3 Sekunden<br />
• Kurzzeit-Gedächtnis: (Zwischen-)Speicherung der aktuell verarbeiteten Information<br />
• Langzeit-Gedächtnis: dauerhafte Speicherung des Wissens<br />
'Working Memory' (Baddeley & Hitch 1974)<br />
Aufgaben der 'Central executive'<br />
• Regulierung des Informationsflusses<br />
• Aufnahme von Information aus dem Langzeitgedächtnis<br />
• Verarbeitung der Information<br />
• Speicherung der Information<br />
Aufgaben des 'Visuo-spatial sketch pad'<br />
• Verarbeitung visueller/räumlicher Information<br />
• Kurzzeitspeicherung visueller/räumlicher Information<br />
Aufgaben des 'Phonological loop'<br />
• Verarbeitung verbaler Information<br />
• Kurzzeitspeicherung verbaler Information<br />
Aufbau des 'Phonological loop'<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Paderborn
<strong>Schriftspracherwerb</strong> 3<br />
Eigenschaften des 'Phonological loop'<br />
• der Inhalt des phonologischen Kurzzeitspeichers verfällt mit der Zeit<br />
• dieser wird durch die subvokale Wiederholung aufgefrischt<br />
• verbale und nonverbale Informationen gelangen auf verschiedenen Wegen in den Speicher<br />
Beispiele für die Arbeitsweise des 'Phonological loop'<br />
Artikulatorische Unterdrückung: Wenn gleichzeitig zu einer verbalen Gedächtnisaufgabe der<br />
Artikulationsapparat mit einer simplen Aufgabe belegt wird ("ta ta ta", "Coca-Cola …"), schrumpft<br />
die Merkfähigkeit erheblich.<br />
Wortlängeneffekt: Von einsilbigen Wörtern können längere Serien gemerkt werden als von<br />
längeren Wörtern (unabhängig von der Inputmodalität, s.o.).<br />
Wortlängeneffekt und Aussprachegeschwindigkeit: zweisilbige Wörter mit 'schneller'<br />
Aussprache (wicked, bishop) können besser gemerkt werden als Wörter mit 'langsamer'<br />
Aussprache (harpoon, Friday).<br />
Phonologische Ähnlichkeit: Listen ähnlicher Items (B, C, D, E ...) können wesentlich schlechter<br />
erinnert werden als Listen unähnlicher Items (B, F, H, S ...).<br />
Irrelevante verbale Information: Die Merkfähigkeit von Teilnehmern ist eingeschränkt, wenn Sie<br />
gleichzeitig nicht relevante verbale Information erhalten.<br />
Orthographische oder semantische Ähnlichkeiten: kein Einfluss.<br />
Phonologische Ähnlichkeit: kein Einfluss, wenn die Artikulation unterdrückt wird und der<br />
Stimulus non-verbal gegeben wird.<br />
Weiterführende Literatur: Gathercole & Baddeley (1993)<br />
Reading memory span (RMS, Daneman & Carpenter 1980)<br />
• Tests zur Messung der Spanne des verbalen Arbeitsgedächtnisses werden häufig in<br />
Verbindung zu Textverständnistests eingesetzt.<br />
• Dabei wird davon ausgegangen, dass ein Leser Informationen über gelesene Wörter<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Paderborn
<strong>Schriftspracherwerb</strong> 4<br />
speichern muss, um in der Lage zu sein, diese mit den folgenden Wörtern in Beziehung zu<br />
setzen und den Sinn zu erschließen.<br />
• Eine allgemeine Korrelation gilt für Erwachsene als gesichert, für Kinder scheint dieser<br />
Mechanismus jedoch noch keine große Rolle zu spielen.<br />
Durchführung des Tests<br />
• Pro Durchgang sind mehrere Sätze unmittelbar nacheinander laut vorzulesen. Dabei sollen<br />
Sie sich von jedem Satz das jeweils letzte Wort merken.<br />
• Nach dem letzten Satz sind sämtliche Merkwörter des Durchgangs in der Reihenfolge der<br />
vorgelesenen Sätze zu wiederholen.<br />
• Der Test beginnt mit je drei mal zwei Sätzen.<br />
• Die Anzahl der Sätze wird gesteigert bis die Testperson in drei Versuchen nicht mehr<br />
mindestens einmal alle Wörter wiederholen kann, höchstens jedoch auf sechs Sätze. Die<br />
Spanne des Reading Memory entspricht dann der höchsten erreichten Zahl von gemerkten<br />
Wörtern.<br />
• Um nicht nur die ganzzahligen Werte zwischen 2 und 6 als Ergebnisse zu erhalten, wird<br />
noch jeweils ein halber Punkt vergeben, wenn von der nächst höheren Satz/Wortanzahl<br />
mindestens zwei wiederholt werden konnten.<br />
Funktionen des verbalen Arbeitsgedächtnisses<br />
• Eine weitere mögliche Rolle des verbalen Arbeitsgedächtnisses liegt in der Speicherung<br />
kleinerer Einheiten:<br />
• Bei der Dekodierung unbekannter Wörter muss ein Leser in Analogie zum obigen<br />
Mechanismus Phoneme speichern, um diese mit den folgenden zum Wort zusammensetzen<br />
zu können.<br />
• Danach werden die Grapheme des Wortes nach und nach in Phoneme übersetzt (GPK).<br />
Literatur<br />
Baddeley,A.D. and Hitch,G. (1974) Working memory. In: G. A. Bower (Ed.), Recent advances in<br />
learning and motivation (pp. 47-90), Academic Press.<br />
Daneman, M. & Carpenter, P. A. (1980). Individual Differences in Working Memory and Reading.<br />
Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 19, 450-466.<br />
Gathercole, S. E. & Baddeley, A. (1993). Working memory and language. Hove [u.a.]: Erlbaum.<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Paderborn