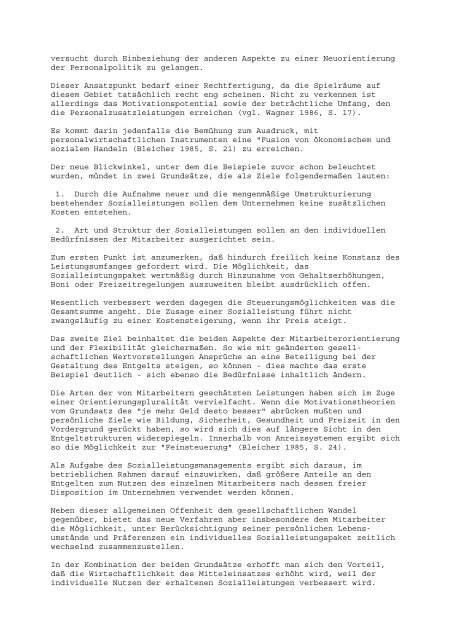Christof Schulte, Axel Dycke - Rainer Hampp Verlag
Christof Schulte, Axel Dycke - Rainer Hampp Verlag
Christof Schulte, Axel Dycke - Rainer Hampp Verlag
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
versucht durch Einbeziehung der anderen Aspekte zu einer Neuorientierung<br />
der Personalpolitik zu gelangen.<br />
Dieser Ansatzpunkt bedarf einer Rechtfertigung, da die Spielräume auf<br />
diesem Gebiet tatsächlich recht eng scheinen. Nicht zu verkennen ist<br />
allerdings das Motivationspotential sowie der beträchtliche Umfang, den<br />
die Personalzusatzleistungen erreichen (vgl. Wagner 1986, S. 17).<br />
Es kommt darin jedenfalls die Bemühung zum Ausdruck, mit<br />
personalwirtschaftlichen Instrumenten eine "Fusion von ökonomischem und<br />
sozialem Handeln (Bleicher 1985, S. 21) zu erreichen.<br />
Der neue Blickwinkel, unter dem die Beispiele zuvor schon beleuchtet<br />
wurden, mündet in zwei Grundsätze, die als Ziele folgendermaßen lauten:<br />
1. Durch die Aufnahme neuer und die mengenmäßige Umstrukturierung<br />
bestehender Sozialleistungen sollen dem Unternehmen keine zusätzlichen<br />
Kosten entstehen.<br />
2. Art und Struktur der Sozialleistungen sollen an den individuellen<br />
Bedürfnissen der Mitarbeiter ausgerichtet sein.<br />
Zum ersten Punkt ist anzumerken, daß hindurch freilich keine Konstanz des<br />
Leistungsumfanges gefordert wird. Die Möglichkeit, das<br />
Sozialleistungspaket wertmäßig durch Hinzunahme von Gehaltserhöhungen,<br />
Boni oder Freizeitregelungen auszuweiten bleibt ausdrücklich offen.<br />
Wesentlich verbessert werden dagegen die Steuerungsmöglichkeiten was die<br />
Gesamtsumme angeht. Die Zusage einer Sozialleistung führt nicht<br />
zwangsläufig zu einer Kostensteigerung, wenn ihr Preis steigt.<br />
Das zweite Ziel beinhaltet die beiden Aspekte der Mitarbeiterorientierung<br />
und der Flexibilität gleichermaßen. So wie mit geänderten gesellschaftlichen<br />
Wertvorstellungen Ansprüche an eine Beteiligung bei der<br />
Gestaltung des Entgelts steigen, so können - dies machte das erste<br />
Beispiel deutlich - sich ebenso die Bedürfnisse inhaltlich ändern.<br />
Die Arten der von Mitarbeitern geschätzten Leistungen haben sich im Zuge<br />
einer Orientierungspluralität vervielfacht. Wenn die Motivationstheorien<br />
vom Grundsatz des "je mehr Geld desto besser" abrücken mußten und<br />
persönliche Ziele wie Bildung, Sicherheit, Gesundheit und Freizeit in den<br />
Vordergrund gerückt haben, so wird sich dies auf längere Sicht in den<br />
Entgeltstrukturen widerspiegeln. Innerhalb von Anreizsystemen ergibt sich<br />
so die Möglichkeit zur "Feinsteuerung" (Bleicher 1985, S. 24).<br />
Als Aufgabe des Sozialleistungsmanagements ergibt sich daraus, im<br />
betrieblichen Rahmen darauf einzuwirken, daß größere Anteile an den<br />
Entgelten zum Nutzen des einzelnen Mitarbeiters nach dessen freier<br />
Disposition im Unternehmen verwendet werden können.<br />
Neben dieser allgemeinen Offenheit dem gesellschaftlichen Wandel<br />
gegenüber, bietet das neue Verfahren aber insbesondere dem Mitarbeiter<br />
die Möglichkeit, unter Berücksichtigung seiner persönlichen Lebensumstände<br />
und Präferenzen ein individuelles Sozialleistungspaket zeitlich<br />
wechselnd zusammenzustellen.<br />
In der Kombination der beiden Grundsätze erhofft man sich den Vorteil,<br />
daß die Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes erhöht wird, weil der<br />
individuelle Nutzen der erhaltenen Sozialleistungen verbessert wird.