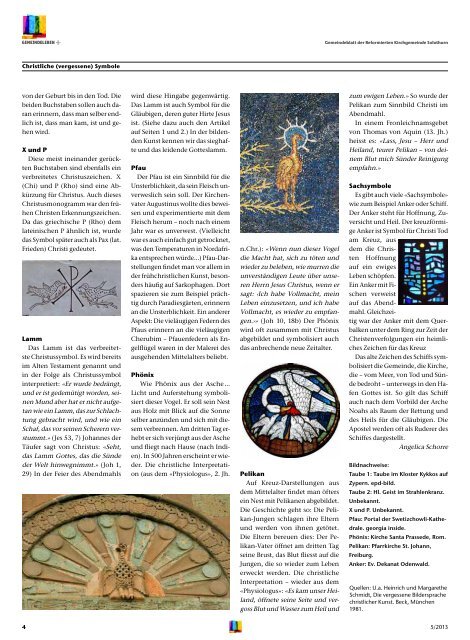Gemeindeblatt - Reformierte Kirchgemeinde Solothurn
Gemeindeblatt - Reformierte Kirchgemeinde Solothurn
Gemeindeblatt - Reformierte Kirchgemeinde Solothurn
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gemeindeleben +<br />
<strong>Gemeindeblatt</strong> der <strong>Reformierte</strong>n <strong>Kirchgemeinde</strong> <strong>Solothurn</strong><br />
Christliche (vergessene) Symbole<br />
von der Geburt bis in den Tod. Die<br />
beiden Buchstaben sollen auch daran<br />
erinnern, dass man selber endlich<br />
ist, dass man kam, ist und gehen<br />
wird.<br />
X und P<br />
Diese meist ineinander gerückten<br />
Buchstaben sind ebenfalls ein<br />
verbreitetes Christuszeichen. X<br />
(Chi) und P (Rho) sind eine Abkürzung<br />
für Christus. Auch dieses<br />
Christusmonogramm war den frühen<br />
Christen Erkennungszeichen.<br />
Da das griechische P (Rho) dem<br />
lateinischen P ähnlich ist, wurde<br />
das Symbol später auch als Pax (lat.<br />
Frieden) Christi gedeutet.<br />
Lamm<br />
Das Lamm ist das verbreitetste<br />
Christussymbol. Es wird bereits<br />
im Alten Testament genannt und<br />
in der Folge als Christussymbol<br />
interpretiert: «Er wurde bedrängt,<br />
und er ist gedemütigt worden, seinen<br />
Mund aber hat er nicht aufgetan<br />
wie ein Lamm, das zur Schlachtung<br />
gebracht wird, und wie ein<br />
Schaf, das vor seinen Scherern verstummt.»<br />
(Jes 53, 7) Johannes der<br />
Täufer sagt von Christus: «Seht,<br />
das Lamm Gottes, das die Sünde<br />
der Welt hinwegnimmt.» (Joh 1,<br />
29) In der Feier des Abendmahls<br />
wird diese Hingabe gegenwärtig.<br />
Das Lamm ist auch Symbol für die<br />
Gläubigen, deren guter Hirte Jesus<br />
ist. (Siehe dazu auch den Artikel<br />
auf Seiten 1 und 2.) In der bildenden<br />
Kunst kennen wir das sieghafte<br />
und das leidende Gotteslamm.<br />
Pfau<br />
Der Pfau ist ein Sinnbild für die<br />
Unsterblichkeit, da sein Fleisch unverweslich<br />
sein soll. Der Kirchenvater<br />
Augustinus wollte dies beweisen<br />
und experimentierte mit dem<br />
Fleisch herum – noch nach einem<br />
Jahr war es unverwest. (Vielleicht<br />
war es auch einfach gut getrocknet,<br />
was den Temperaturen in Nordafrika<br />
entsprechen würde…) Pfau-Darstellungen<br />
findet man vor allem in<br />
der frühchristlichen Kunst, besonders<br />
häufig auf Sarkophagen. Dort<br />
spazieren sie zum Beispiel prächtig<br />
durch Paradiesgärten, erinnern<br />
an die Unsterblichkeit. Ein anderer<br />
Aspekt: Die vieläugigen Federn des<br />
Pfaus erinnern an die vieläugigen<br />
Cherubim – Pfauenfedern als Engelflügel<br />
waren in der Malerei des<br />
ausgehenden Mittelalters beliebt.<br />
Phönix<br />
Wie Phönix aus der Asche …<br />
Licht und Auferstehung symbolisiert<br />
dieser Vogel. Er soll sein Nest<br />
aus Holz mit Blick auf die Sonne<br />
selber anzünden und sich mit diesem<br />
verbrennen. Am dritten Tag erhebt<br />
er sich verjüngt aus der Asche<br />
und fliegt nach Hause (nach Indien).<br />
In 500 Jahren erscheint er wieder.<br />
Die christliche Interpretation<br />
(aus dem «Physiologus», 2. Jh.<br />
n.Chr.): «Wenn nun dieser Vogel<br />
die Macht hat, sich zu töten und<br />
wieder zu beleben, wie murren die<br />
unverständigen Leute über unseren<br />
Herrn Jesus Christus, wenn er<br />
sagt: ‹Ich habe Vollmacht, mein<br />
Leben einzusetzen, und ich habe<br />
Vollmacht, es wieder zu empfangen.›»<br />
(Joh 10, 18b) Der Phönix<br />
wird oft zusammen mit Christus<br />
abgebildet und symbolisiert auch<br />
das anbrechende neue Zeitalter.<br />
Pelikan<br />
Auf Kreuz-Darstellungen aus<br />
dem Mittelalter findet man öfters<br />
ein Nest mit Pelikanen abgebildet.<br />
Die Geschichte geht so: Die Pelikan-Jungen<br />
schlagen ihre Eltern<br />
und werden von ihnen getötet.<br />
Die Eltern bereuen dies: Der Pelikan-Vater<br />
öffnet am dritten Tag<br />
seine Brust, das Blut fliesst auf die<br />
Jungen, die so wieder zum Leben<br />
erweckt werden. Die christliche<br />
Interpretation – wieder aus dem<br />
«Physiologus»: «Es kam unser Heiland,<br />
öffnete seine Seite und vergoss<br />
Blut und Wasser zum Heil und<br />
zum ewigen Leben.» So wurde der<br />
Pelikan zum Sinnbild Christi im<br />
Abendmahl.<br />
In einem Fronleichnamsgebet<br />
von Thomas von Aquin (13. Jh.)<br />
heisst es: «Lass, Jesu – Herr und<br />
Heiland, teurer Pelikan – von deinem<br />
Blut mich Sünder Reinigung<br />
empfahn.»<br />
Sachsymbole<br />
Es gibt auch viele «Sachsymbole»<br />
wie zum Beispiel Anker oder Schiff.<br />
Der Anker steht für Hoffnung, Zuversicht<br />
und Heil. Der kreuzförmige<br />
Anker ist Symbol für Christi Tod<br />
am Kreuz, aus<br />
dem die Christen<br />
Hoffnung<br />
auf ein ewiges<br />
Leben schöpfen.<br />
Ein Anker mit Fischen<br />
verweist<br />
auf das Abendmahl.<br />
Gleichzeitig<br />
war der Anker mit dem Querbalken<br />
unter dem Ring zur Zeit der<br />
Christenverfolgungen ein heimliches<br />
Zeichen für das Kreuz<br />
Das alte Zeichen des Schiffs symbolisiert<br />
die Gemeinde, die Kirche,<br />
die – vom Meer, von Tod und Sünde<br />
bedroht – unterwegs in den Hafen<br />
Gottes ist. So gilt das Schiff<br />
auch nach dem Vorbild der Arche<br />
Noahs als Raum der Rettung und<br />
des Heils für die Gläubigen. Die<br />
Apostel werden oft als Ruderer des<br />
Schiffes dargestellt.<br />
Angelica Schorre<br />
Bildnachweise:<br />
Taube 1: Taube im Kloster Kykkos auf<br />
Zypern. epd-bild.<br />
Taube 2: Hl. Geist im Strahlenkranz.<br />
Unbekannt.<br />
X und P. Unbekannt.<br />
Pfau: Portal der Swetizchowli-Kathedrale.<br />
georgia inside.<br />
Phönix: Kirche Santa Prassede, Rom.<br />
Pelikan: Pfarrkirche St. Johann,<br />
Freiburg.<br />
Anker: Ev. Dekanat Odenwald.<br />
Quellen: U.a. Heinrich und Margarethe<br />
Schmidt, Die vergessene Bildersprache<br />
christlicher Kunst. Beck, München<br />
1981.<br />
4 5/2013