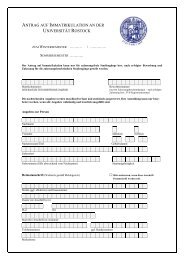Lehrbrief BNE 2011 - Wissenschaftliche Weiterbildung - Universität ...
Lehrbrief BNE 2011 - Wissenschaftliche Weiterbildung - Universität ...
Lehrbrief BNE 2011 - Wissenschaftliche Weiterbildung - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG<br />
Tilman Langer<br />
ZENTRUM FÜR QUALITÄTSSICHERUNG IN STUDIUM UND WEITERBILDUNG
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Universität Rostock<br />
Zentrum für Qualitätssicherung<br />
in Studium und <strong>Weiterbildung</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Erarbeitet von:<br />
Dipl.-Chem. Tilman Langner M.A.<br />
Angeroder Straße 1-2<br />
18461 Pöglitz<br />
tilman.langner@umweltschulen.de<br />
Universitätsdruckerei:<br />
Universität Rostock<br />
Zentrum für Qualitätssicherung<br />
in Studium und <strong>Weiterbildung</strong><br />
Ulmenstraße 69, 18057 Rostock<br />
Tel.: 0381/ 4981261<br />
umwelt-bildung.de@uni-rostock.de
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort ......................................................................................................5<br />
1. Einleitung ..................................................................................................7<br />
2. Nachhaltigkeit und Agenda 21 .................................................................9<br />
2.1 Auf dem Weg zur Nachhaltigkeitsidee ................................................... 10<br />
2.2 Nachhaltigkeit – Karriere einer Idee ....................................................... 16<br />
2.2.1 Brundtland-Bericht (1987) .......................................................... 16<br />
2.2.2 Konferenz von Rio (1992) .......................................................... 18<br />
2.2.3 Commission for Sustainable Development (1993) ..................... 19<br />
2.2.4 Charta von Aalborg (1994) ......................................................... 20<br />
2.2.5 Die Milleniumsziele (2001) ......................................................... 22<br />
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland ................................ 23<br />
2.3.1 Operationalisierung der Nachhaltigkeitsidee .............................. 23<br />
2.3.2 Staatsziel Nachhaltigkeit / Umweltschutz (1994) ....................... 29<br />
2.3.3 Studie Zukunftsfähiges Deutschland (1995) .............................. 30<br />
2.3.4 Konzept Nachhaltigkeit der Enquete-Kommission des 13. Deutschen<br />
Bundestages (1998) ........................................................ 31<br />
2.3.5 Nationale Nachhaltigkeitsstrategie (2002) ................................. 34<br />
2.3.6 Indikatorenberichte der Bundesregierung und Zukunftsfähiges<br />
Deutschland II ............................................................................ 41<br />
2.4 Zentrale Merkmale der Nachhaltigkeitsidee ........................................... 46<br />
2.5 Zwischenbilanz ...................................................................................... 59<br />
2.6 Zusammenfassung ................................................................................ 64<br />
3. Bildung für nachhaltige Entwicklung .......................................................67<br />
3.1 Die Herausforderung ............................................................................. 68<br />
3.1.1 Der Bildungsauftrag der Agenda 21 ........................................... 68<br />
3.1.2 Internationale Anbindung ........................................................... 81<br />
3.1.3 Erste Resonanz in Deutschland (1993-1998) ............................ 83<br />
3.2 Die Umsetzung ...................................................................................... 84<br />
3.2.1 <strong>BNE</strong> in der Schule (BLK-Modellprogramme „21“, „Transfer 21“) 84<br />
3.2.2 <strong>BNE</strong> in der frühkindlichen Bildung ............................................. 99<br />
3.2.3 UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ................. 105<br />
III
Inhaltsverzeichnis<br />
3.3 Versuch einer <strong>BNE</strong>-Definition ...............................................................108<br />
3.4 Beispielhafte Projekte / Lernarrangements ..........................................113<br />
3.4.1 Nachhaltigkeitsaudit an Schulen ..............................................114<br />
3.4.2 Simulationsspiele ......................................................................122<br />
3.5 Zwischenbilanz .....................................................................................133<br />
3.6 Zusammenfassung ...............................................................................139<br />
4. Lokale Agenda 21 .................................................................................143<br />
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse .............................................144<br />
4.1.1 Hamburg: Operationalisierung und Kommunikation .................145<br />
4.1.2 Düsseldorf: Rahmenbedingungen für <strong>BNE</strong> ..............................152<br />
4.1.3 Stralsund: Kommunaler Klimaschutz als Lernfeld der <strong>BNE</strong> .....158<br />
4.2 Methoden zur Bürgerbeteiligung ..........................................................169<br />
4.2.1 Open Space ..............................................................................170<br />
4.2.2 Zukunftswerkstatt .....................................................................174<br />
4.3 Lokale Agenda 21 – 20 Jahre nach Rio ...............................................177<br />
4.4 Zusammenfassung ...............................................................................179<br />
5. Abkürzungsverzeichnis .........................................................................181<br />
6. Quellenverzeichnis ................................................................................185<br />
7. Abbildungsverzeichnis ..........................................................................207<br />
8. Tabellenverzeichnis ..............................................................................209<br />
IV
Vorwort<br />
Vorwort<br />
Ich war einigermaßen überrascht, als das Fernstudienteam mir 2005 anbot,<br />
den Lehrabschnitt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (<strong>BNE</strong>)<br />
im Fernstudium Umwelt&Bildung zu übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt<br />
kannte und schätzte ich das Phänomen Fernstudium an der Uni<br />
Rostock schon seit einigen Jahren – als Ehepartner einer Umwelt&Bildungs-Studentin,<br />
als Partner von Dr. Heino Apel im Lehrabschnitt<br />
„Multimedia in der Umweltbildung“ und nicht zuletzt als frisch gebakkener<br />
M.A. Medien&Bildung. Das ganze Umfeld hier – das Team und<br />
die Studierenden – habe ich als außerordentlich inspirierend empfunden.<br />
Ich habe hier Motivation „getankt“, die ich für meine lokale Arbeit<br />
in Stralsund – oft an der Grenze zwischen Umweltbildung und Sozialarbeit<br />
– dringend brauchte. Zudem entwickelte sich die <strong>BNE</strong> nach meinem<br />
Eindruck dynamisch, mit meinem Engagement in einem<br />
Düsseldorfer Modellprojekt war ich Teil dieser Bewegung, und die<br />
Chance, mir dieses Arbeitsfeld noch etwas systematischer zu erschließen,<br />
hat mich sehr gereizt. So habe ich begeistert zugesagt.<br />
Nun steht eine dritte grundlegende Überarbeitung des <strong>Lehrbrief</strong>es an. In<br />
der Zwischenzeit sind Brüche ans Licht getreten, Ernüchterung ist aufgekommen,<br />
und die Begeisterung ist einer kritischen Distanz gewichen:<br />
Knapp 20 Jahre nach der Konferenz von Rio ist die Menschheit mit der<br />
Bewältigung der großen Nachhaltigkeits-Probleme (Hunger, Ungerechtigkeit,<br />
Verlust an Biodiversität, Klimawandel...) nicht viel weiter gekommen.<br />
Was hat sich vielleicht doch bewegt? Wo wächst Hoffnung?<br />
<strong>BNE</strong> will eine nachhaltige Entwicklung pädagogisch begleiten. Angesichts<br />
des Standes dieser Entwicklung ist das eine Zumutung für Bildungsakteure:<br />
Bildung kann kein Ersatz für verfehlte Politik sein.<br />
Inwieweit kann Bildung sinnvoll zu einer nachhaltigen Entwicklung<br />
beitragen? Welche Rolle als (künftige) pädagogische Akteure wollen<br />
Sie finden?<br />
Nachhaltigkeit sollte sich vor allem vor Ort in den Städten und Gemeinden<br />
entwickeln, dafür steht der Begriff der Lokalen Agenda 21. Spüren<br />
Sie etwas davon an Ihrem Wohnort? Kommunale Klimaschutzprozesse<br />
sind im Kommen – eignen sie sich vielleicht als Keimzellen der Nachhaltigkeit?<br />
Und wiederum: Welche Rollen können wir als Umweltbildner<br />
bzw. <strong>BNE</strong>-Akteure hier einnehmen?<br />
Somit ist dieser <strong>Lehrbrief</strong> eine Suche nach belastbaren Positionen, nach<br />
motivierenden Visionen und nach praktikablen Konzepten. Suchen Sie<br />
mit?<br />
Ich freue mich auf diese Begegnung und den Austausch mit Ihnen!<br />
Pöglitz, im Sommer <strong>2011</strong><br />
Tilman Langner<br />
5
1 Einleitung<br />
1 Einleitung<br />
Der <strong>Lehrbrief</strong> „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (<strong>BNE</strong>) soll im<br />
Wechselspiel mit den anderen Bausteinen des Moduls 1 dazu beitragen,<br />
dass Sie den gesellschaftspolitischen Handlungsrahmen einer <strong>BNE</strong> erkennen<br />
und sich kritisch mit den Elementen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen.<br />
Vor allem jedoch sollen Sie den Stellenwert von Bildung<br />
im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung reflektieren, das Konzept<br />
<strong>BNE</strong> kennen lernen und Motivationen finden, an dessen weiterer Ausgestaltung<br />
mitzuwirken. Dieser <strong>Lehrbrief</strong> gliedert sich dazu – neben<br />
dieser Einleitung und den Anlagen – in drei Abschnitte.<br />
Der Abschnitt „Nachhaltigkeit und Agenda 21“ ist dem Leitbild der<br />
Nachhaltigkeit und dessen politischer Umsetzung gewidmet.<br />
Das Kapitel 2.1 lädt Sie zunächst zu einem Rückblick darauf, wie sich<br />
die Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt in der Vergangenheit<br />
entwickelt haben, ein. Das soll Ihnen die historische Einordnung des<br />
Nachhaltigkeitsleitbildes erleichtern. Die Kapitel 2.2 und 2.3 widmen<br />
sich der politischen und gesellschaftlichen Verankerung der Nachhaltigkeit<br />
auf der internationalen bzw. nationalen Ebene. Sie sollen einen<br />
Eindruck davon gewinnen, welche „Karriere“ dieses Leitbild innerhalb<br />
weniger Jahre gemacht hat und welche unterschiedlichen Vorstellungen<br />
über eine nachhaltige Entwicklung bislang entwickelt wurden. Danach<br />
werden unter 2.4 zentrale inhaltliche Aspekte der Nachhaltigkeitsidee<br />
zusammengefasst und vertieft. Kapitel 2.5 bietet eine Zwischenbilanz;<br />
Kapitel 2.6 fasst diesen Abschnitt zusammen.<br />
Das Lernziel besteht hier nicht darin, dass Sie die Daten internationaler<br />
Konferenzen abspeichern. Wichtiger wäre, dass Sie sich damit vertraut<br />
machen, wie Wissen um eine nachhaltige Entwicklung geschaffen und<br />
strukturiert wird, denn das ist eine Grundlage für ihr künftiges didaktisches<br />
Wirken als UmweltpädagogInnen.<br />
Sie werden bei der Lektüre vermutlich den Eindruck gewinnen, dass<br />
Nachhaltigkeit zwar eine faszinierende Idee ist, dass wir aber von ihrer<br />
Realisierung weit entfernt sind. Das führt zu den Fragen, inwieweit eine<br />
solche Idee Grundlage für ein Bildungskonzept sein und was Bildung<br />
zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen kann. Dies ist Gegenstand<br />
des Abschnitts „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.<br />
Das Kapitel 3.1 beginnt mit einem Blick in das Kapitel 36 der Agenda<br />
21, in dem die Bildung beauftragt wird, zur nachhaltigen Entwicklung<br />
beizutragen. Diese Herausforderung gilt es u.a. darauf zu hinterfragen,<br />
ob Bildung überhaupt ein Instrument zur Umsetzung von Politik sein<br />
kann oder sollte. Des weiteren wird skizziert, welche Resonanz diese<br />
7
1 Einleitung<br />
Herausforderung international und national gefunden hat. Kapitel 3.2<br />
widmet sich der Umsetzung der <strong>BNE</strong>, und zwar vor allem im deutschen<br />
Schulwesen. Im Kapitel 3.3 wird der Versuch einer eher „engen“ <strong>BNE</strong>-<br />
Definition vorgelegt, die zwischen (und nicht über) der Umweltbildung<br />
und dem Globalen Lernen angesiedelt ist. Kapitel 3.4 stellt exemplarisch<br />
zwei konkrete Lernarrangements vor. Im Kapitel 3.5 wird eine<br />
Zwischenbilanz zum Stand der <strong>BNE</strong> in Deutschland gezogen. Unter 3.6<br />
wird der Abschnitt zusammengefasst.<br />
Auch in diesem Abschnitt sollen Sie nicht Meilensteine auswendig lernen<br />
oder vorgegebene Konzepte rezepthaft übernehmen. Daher wird<br />
auch hier pointiert auf Probleme, Widersprüche und „weiße Flecken“<br />
hingewiesen. Mir ist bewusst, dass ich Sie damit auf einen Balanceakt<br />
zwischen erwünschter Motivation und notwendiger kritischer Distanz<br />
einlade – ich hoffe, es gelingt.<br />
Der Abschnitt 4 widmet sich der Lokalen Agenda 21, also dem Versuch,<br />
eine nachhaltige Entwicklung vor Ort in den Städten und Gemeinden<br />
in Gang zu bringen. Ich möchte hier nicht versuchen, Ihnen einen<br />
systematischen Überblick zu geben. Ich möchte vielmehr am lokalen<br />
Beispielen Themen und Fragestellungen vertiefen, die in den Abschnitten<br />
2 und 3 bereits angerissen wurden: Wie kann die Partizipation der<br />
Bevölkerung arrangiert werden und was hat das mit Bildung zu tun?<br />
Wie können günstige Rahmenbedingungen für die <strong>BNE</strong> geschaffen<br />
werden? Wie kann Nachhaltigkeit operationalisiert und kommuniziert<br />
werden? – Ich grenze also das Spektrum der potenziell verhandelbaren<br />
Aspekte der Lokalen Agenda 21 stark ein, in der Hoffnung, dass damit<br />
ein in sich schlüssiger und vom Umfang her noch zu bewältigender<br />
<strong>Lehrbrief</strong> entsteht. Auch dieser Abschnitt endet mit einer Zwischenbilanz<br />
(4.3) und einer Zusammenfassung (4.4).<br />
Das in diesem <strong>Lehrbrief</strong> dargebotene Material geht teilweise recht stark<br />
in die Breite, und es werden verschiedene – auch einander widersprechende<br />
– Stimmen aus den Diskursen um Nachhaltigkeit und <strong>BNE</strong> wiedergegeben.<br />
Das soll Sie mit Hinblick auf die am Ende des Moduls zu<br />
erbringende Prüfungsleistung nicht beunruhigen. Für die Klausur sollten<br />
Sie insbesondere die grundlegenden Begriffe – nachhaltige Entwicklung,<br />
Agenda 21, Lokale Agenda 21, Bildungsauftrag der Agenda<br />
21, <strong>BNE</strong> – kennen und anwenden können. Wenn ich Sie stellenweise<br />
wesentlich umfangreicher mit Informationen versorge, dann möchte ich<br />
Sie damit zur Reflexion darüber anregen, wie zentrale Aspekte bzw.<br />
Denkmodelle des Nachhaltigkeitsdiskurses in der <strong>BNE</strong> didaktisch<br />
wirksam werden, und ich möchte Ihnen Anknüpfungspunkte für weitere<br />
Lehreinheiten Ihres Studiums – bis hin zur Masterarbeit – anbieten.<br />
8
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
Wie ist das Leitbild Nachhaltigkeit entstanden? Welche Rolle spielt es<br />
heute? Welche konkreten Aspekte umfasst es? Wie weit ist die Menschheit<br />
mit der nachhaltigen Entwicklung inzwischen vorangekommen?<br />
Diese Fragen sollen nachfolgend erörtert werden.<br />
Formal betrachtet, ist Entwicklung nicht mehr als der „Prozess der zeitlichen<br />
Änderung eines Zustandes“ – womit noch nichts über seine Qualität<br />
bzw. Orientierung ausgesagt ist. Eine nachhaltige Entwicklung<br />
meint einen (mehr oder weniger) kontinuierlichen Prozess, der zu qualitativ<br />
besseren Zuständen führen soll (CONRAD 2000, S.5). Nachhaltige<br />
Entwicklung wird somit im Sinne von „Entwicklung zur Nachhaltigkeit“<br />
verstanden. Nach der bekanntesten Definition ist nachhaltige<br />
Entwicklung „eine Entwicklung, in der die Bedürfnisse der Gegenwart<br />
befriedigt werden, ohne dabei künftigen Generationen die Möglichkeit<br />
zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse zu nehmen“ (VEREINTE<br />
NATIONEN 1990, S. 26 1 ). Dabei werden insbesondere die (Konzepte<br />
der) Grundbedürfnisse aller Menschen sowie die Grenzen der Tragfähigkeit<br />
der globalen Ökosysteme anerkannt. 2<br />
Begriffliche<br />
Annäherungen<br />
Nachhaltigkeit ist der mit nachhaltiger Entwicklung angestrebte Zustand.<br />
Da dieser Zustand bei weitem nicht erreicht ist und da er auch<br />
analytisch nicht präzise beschrieben ist, kann Nachhaltigkeit nach wie<br />
vor (nur) als Idee bzw. Leitbild bezeichnet werden.<br />
Zur Frage, was Nachhaltigkeit bzw. eine nachhaltige Entwicklung konkret<br />
bedeuten, welche Konzepte hilfreich oder welche Maßnahmen erforderlich<br />
sind, gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Meinungen, die<br />
im Wettstreit miteinander stehen. Dies soll nachfolgend mit dem Begriff<br />
Nachhaltigkeitsdiskurs gefasst werden.<br />
Die Agenda 21 schließlich ist ein politisches Dokument, das von der internationalen<br />
Staatengemeinschaft 1992 auf der UN-Konferenz für<br />
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro verabschiedet wurde.<br />
1. Die in der Bundesrepublik Deutschland (West) erschienene Ausgabe (HAUFF 1987) hat<br />
eine geringfügig abweichende Formulierung.<br />
2. „Sustainable development is development that meets the needs of the present without<br />
compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within<br />
it two key concepts: 1. The concept of “needs”, in particular the essential needs of the<br />
world`s poor, to which overriding priority should be given; and 2. The idea of limitations<br />
imposed by the state of technology and social organization on the environment ability to<br />
meet present and future needs“ (Vereinte Nationen, zitiert nach http://www.undocuments.net/ocf-02.htm)<br />
9
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
2.1 Auf dem Weg zur Nachhaltigkeitsidee<br />
Schon vor langen Zeiten haben Menschen über das Verhältnis von<br />
Mensch und Umwelt nachgedacht und ihr diesbezügliches Wissen gesammelt<br />
und weitergegeben.<br />
Mensch-Umwelt-<br />
Beziehungen in<br />
Religionen<br />
Bereits im Alten Testament (im 3. Buch Mose, Kapitel 11) finden sich<br />
Gesetzesvorschriften, die dazu dienen sollten, im alten Palästina eine<br />
schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen zu sichern und die biologischen<br />
Gleichgewichte aufrecht zu erhalten. So war die Schweinehaltung<br />
verboten, weil Schweine Nahrungskonkurrenten des Menschen<br />
sind. Wiederkäuer, welche vom Menschen nicht verwertbare Pflanzen<br />
fressen, durften hingegen gehalten und geschlachtet werden. Von den<br />
frei lebenden Tieren waren z.B. die Aasfresser, Greifvögel, Eulen und<br />
Störche geschützt, weil diese als Gesundheitspolizei oder als Fressfeinde<br />
der Nagetiere bzw. der Heuschrecken dem Menschen dienlich waren.<br />
(KIBBEL/MÜLLER 2002, S. 6, HÜTTERMANN 1997)<br />
OPITZ (1998) verweist darauf, dass es in allen großen Weltreligionen<br />
Empfehlungen bzw. Regelungen zum Schutz von Tieren und für eine<br />
(weitgehend) fleischlose Ernährung gegeben hat, was u.a. angesichts<br />
der enormen Energieverluste bei der „Umwandlung“ von pflanzlicher<br />
in tierische Nahrung auch heute einen sinnvollen Beitrag zu einer nachhaltigen<br />
Sicherung der Ernährung sowie zum Umwelt- und Klimaschutz<br />
darstellen würde.<br />
GARDNER (2010 a und b) betont, dass die Religionen auch heute noch<br />
eine wichtige Triebkraft für gesellschaftliche Veränderungen sein können.<br />
Als Beispiele führt er u.a. die Anti-Apartheid-Bewegung und die<br />
Bürgerrechtsbewegung in den USA an, die wesentlich von Religionsgemeinschaften<br />
bzw. religiösen Menschen mit getragen worden sind.<br />
Buddhisten haben in Thailand Bäume in gefährdeten Wäldern ordiniert,<br />
„sie damit für die Dorfbewohner zum geheiligten Objekt gemacht“<br />
(GARDNER 2010 a, S. 62) und so Initiativen zum Schutz dieser Wälder<br />
angestoßen. Das Islamische Bankwesen will der Allgemeinheit dienen,<br />
Geld wird als unproduktiv angesehen, Zinsen zu verlangen wird als verwerflich<br />
betrachtet, und die Realwirtschaft (Waren und Dienstleistungen)<br />
hat einen höheren Stellenwert als die Finanzwirtschaft. Die<br />
„buddhistische Ökonomie“ nach E.F.Schumacher dient dem spirituellen<br />
Ziel der Erleuchtung. „In Konsumgesellschaften ist die Suche nach<br />
Wunscherfüllung ein wesentlicher Motor, für Buddhisten ist sie die<br />
Quelle allen Leidens. Aus der buddhistischen Perspektive ist der Konsum<br />
daher irrational...“ (GARDNER 2010 a, S. 68).<br />
Dennoch sind die Religionen nicht die Hüterinnen der Nachhaltigkeit;<br />
auch sie haben sich in widerspruchsvollen Wegen entwickelt, und z.B.<br />
10
2.1 Auf dem Weg zur Nachhaltigkeitsidee<br />
das Alte Testament als Sammlung von Texten verschiedener Autoren,<br />
die über mehrere Jahrhunderte hinweg entstanden sind und später weiter<br />
bearbeitet wurden, enthält auch Aussagen, die einen Herrschaftsanspruch<br />
des Menschen über die Natur begründen können.<br />
Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde erstmals in der deutschen Forstwirtschaft<br />
des frühen 18. Jahrhunderts verwendet. Zu dieser Zeit waren<br />
die natürlichen Wälder in Deutschland weitestgehend vernichtet. Den<br />
ersten Schlag hatten ihnen ab etwa dem Jahr 1000 umfangreiche<br />
Brandrodungen versetzt. Später hatte die Praxis der Waldbeweidung<br />
das Nachwachsen neuer Bäume verhindert und Landschaften hervorgebracht,<br />
die wir noch heute in den Bildern der Romantiker bewundern.<br />
Schließlich hatte die Frühindustrialisierung zu einer enormen Zunahme<br />
des Bedarfes an Holz als Energieträger und Baustoff geführt – um z.B.<br />
eine Tonne Eisen zu schmelzen, wurden 50 m 3 Brennholz benötigt, und<br />
auch Materialien wie Salz oder Glas wurden unter hohem Energieaufwand<br />
gewonnen (DÖRFLER/DÖRFLER, S. 14-16). J. Evelyn hatte in England<br />
bereits 1664 eine wirtschaftlich gefährliche Holzknappheit<br />
befürchtet. Hans Carl von Carlowitz (1645-1714), Oberberghauptmann<br />
in Kursachsen und damit ein Vertreter der Holz verbrauchenden Montanwirtschaft,<br />
sprach in seiner Publikation „Sylvicultura Oeconomica“<br />
(1713) erstmals von einer nachhaltenden Nutzung des Waldes. Er plädierte<br />
dafür, mit Holz sparsam umzugehen, Bäume zu pflanzen und zu<br />
säen und Surrogata zu suchen, also Holz, wo möglich, durch andere Materialien<br />
zu ersetzen. Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte der deutsche<br />
Forstwissenschaftler Faustmann eine Formel zur Optimierung der<br />
Forstwirtschaft. (OTT/DÖRING 2008, S. 22-23) „Nachhaltigkeit ist also<br />
ursprünglich ein Konzept der Waldbewirtschaftung, bei der die Produktionskraft<br />
des Waldes (eine ökologische Größe) und die Holzernte (eine<br />
ökonomische Größe) so aufeinander abgestimmt werden, dass sich ein<br />
auf Dauer optimaler Ertrag ergibt.“ (ebd.) Raubbau am Wald in der heutigen<br />
Zeit ist damit allerdings nicht ausgeschlossen, wie Sie vermutlich<br />
wissen.<br />
Die Krise der Wälder<br />
und die Forstwirtschaft<br />
als Wiege der<br />
Nachhaltigkeit<br />
Alleine mit den Mitteln der Forstwirtschaft hätten die Wälder angesichts<br />
der fortschreitenden Industrialisierung übrigens nicht gerettet<br />
werden können; hierzu hat auch ganz wesentlich der Wechsel zum<br />
Brennstoff Kohle beigetragen – nebenbei auch eine der ersten Weichenstellungen<br />
für den anthropogenen Treibhauseffekt. (BROT FÜR DIE<br />
WELT/EED/BUND 2008, S. 36)<br />
Neben der Begründung der modernen Forstwirtschaft führte diese Misere<br />
der Wälder auch zur Entwicklung von Gegenbewegungen, welche<br />
die Natur bewahren und sie gezielter als bislang zum Gegenstand von<br />
Bildung und Erziehung machen wollten. Der Romantiker ARNDT<br />
(1815) kritisierte, „wie der heilloseste und ruchloseste Unfug mit edlen<br />
Bäumen und Wäldern getrieben ist und ganze Forsten ausgehauen und<br />
Bewegungen zum<br />
Schutz der Natur<br />
11
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
ganze Bezirke entblößt sind, weil der einzelne Besitzer mit der Natur<br />
auf das willkürlichste schalten und walten kann.“ Die ersten Verbände<br />
zum Schutz von Heimat, Natur und Umwelt gründeten sich, so im Jahr<br />
1904 der Bund Heimatschutz (BOLSCHO/SEYBOLD 1996, S. 22). Friedrich<br />
Fröbel (1782-1852) gründete Kindergärten, die er als „Gärten für<br />
Kinder“ verstand. Später entstanden „Landerziehungsheime“ (ebd. S.<br />
80). Die Ziele dieser Bewegungen schlugen sich auch in der Umweltbildung<br />
des 20. Jahrhunderts nieder. So wurden die bundesdeutschen<br />
Schulen 1953 dazu angehalten, ihren Blick auf „erzieherische und gemütsbildende<br />
Werte von Naturschutzbewegungen und Landschaftspflege“<br />
zu richten (KULTUSMINISTERKONFERENZ 1953). GÖPFERT<br />
(1987) proklamierte die Konzeption der „naturnahen Bildung und Erziehung“;<br />
er wollte durch emotionale, sinnhafte, ganzheitliche Naturerfahrungen<br />
Liebe zur Natur erwecken und damit Grundlagen dafür<br />
schaffen, dass sich Menschen für deren Bewahrung einsetzen (siehe<br />
auch BOLSCHO/SEYBOLD 1996, S. 85f). Die Naturpädagogik von COR-<br />
NELL (1991 a + b) kommt auch im 21. Jahrhundert zur Anwendung.<br />
Globalisierung der<br />
Umweltprobleme im<br />
20. Jahrhundert<br />
Umweltbewegung als<br />
Protestbewegung<br />
Umweltpolitik als<br />
Ordnungspolitik<br />
Bis zum frühen 20. Jahrhundert wurden die ökologischen Auswirkungen<br />
der Industrialisierung noch überwiegend auf lokaler Ebene wahrgenommen;<br />
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden dann<br />
zunehmend auch überregionale und globale Probleme erkannt. Der Verbrauch<br />
von endlichen Ressourcen wuchs weltweit exponentiell an, verbunden<br />
mit einer Zunahme des Abfallaufkommens sowie der Wasserund<br />
Luftbelastungen. Zudem wurden konkrete Techniken als bedrohlich<br />
empfunden – allen voran, bereits seit den 50er Jahren, die „Atomtechnik“<br />
(Kernspaltung). Publikationen wie „Silent Spring“ (CARSON<br />
1962), „Die Grenzen des Wachstums“ (MEADOWS et.al. 1972) oder in<br />
der Bundesrepublik Deutschland „Ein Planet wird geplündert“ (GRUHL<br />
1975) machten diese Probleme öffentlich.<br />
Das Aufleben der Umwelt- und Bürgerbewegung kann als Reaktion auf<br />
dieses Problembewusstsein verstanden werden (BOLSCHO/SEYBOLD<br />
1996). So gründeten sich bspw. in der Bundesrepublik 1972 der Bundesverband<br />
Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), 1976 der Bund für<br />
Umwelt und Naturschutz (BUND), 1979 die Bundespartei „Die Grünen“<br />
und 1980 Greenpeace. Diese Bewegungen verstanden sich explizit<br />
als kritisch gegenüber der herrschenden Gesellschaft. Sie wollten einerseits<br />
vor der drohenden ökologischen Katastrophe warnen, postulierten<br />
jedoch auch gesellschaftspolitische Gegenentwürfe (beispielhaft siehe<br />
GRUHL 1975, S. 225ff). Diese Gesellschaftskritik fand u.a. in der Ökopädagogik<br />
ihren Niederschlag, die sich „gegen ökonomisch-technische<br />
Naturausbeutung“ und die diese stützenden „Denk- und Handlungsstrukturen“<br />
wendete (BEER/DE HAAN 1984).<br />
Der Staat reagierte auf diese Probleme zunächst mit ordnungspolitischen<br />
Maßnahmen. Exemplarisch hierfür ist das Abfallbeseitigungsge-<br />
12
2.1 Auf dem Weg zur Nachhaltigkeitsidee<br />
setz von 1972 (DEUTSCHER BUNDESTAG 1972), das sich lediglich auf<br />
die Abfallbeseitigung konzentrierte, also auf die Strategie, Abfälle einzusammeln,<br />
sie zu wenigen vorgegebenen Plätzen zu verbringen und<br />
sie somit – scheinbar – ordentlich zu beseitigen.<br />
Zur Stützung solcher staatlicher Strategien wurde an das Pflicht- und<br />
Ordnungsgefühl der Bürger appelliert. Der Umweltbildung wurde dabei<br />
eine funktionelle Rolle zugewiesen. Das Umweltprogramm der Bundesregierung<br />
von 1971 war nur umzusetzen, wenn „alle Gruppen und<br />
Kräfte unserer Gesellschaft“ es bejahen und mitwirken. „Das aber setzt<br />
Umweltbewußtsein bei jedem Bürger voraus...“ „Das zur Abwehr von<br />
Umweltgefahren notwendige Wissen muß in den Schul- und Hochschulunterricht<br />
sowie in die Erwachsenenbildung einbezogen werden.<br />
Umweltbewußtes Verhalten muß als allgemeines Bildungsziel in die<br />
Lehrpläne aller Bildungsstufen aufgenommen werden.“ (DIE BUNDES-<br />
REGIERUNG 1971)<br />
Es zeigte sich jedoch schnell, dass die ordnungspolitischen Instrumente<br />
zu kurz griffen, z.B. als sich offiziell ausgewiesene Abfalldeponien in<br />
für die Umwelt und die Gesundheit von Bürgern bedrohliche Altlasten<br />
verwandelten (siehe THIELE 1992). Folgerichtig baute die Bundesregierung<br />
in den 80er Jahren ihr umweltpolitisches Instrumentarium aus und<br />
statuierte beispielsweise in einem neuen Abfallgesetz (DEUTSCHER<br />
BUNDESTAG 1986) erstmals ein Abfallverwertungsgebot. Zudem gerieten<br />
Berührungen zwischen bislang getrennt betrachteten Umweltmedien<br />
wie Abfall und Wasser (mit Klärschlamm bzw. Deponiesickerwasser<br />
als Schnittstellen) in den Blickpunkt.<br />
Damit erweiterte sich auch der Themenkatalog der umweltpolitisch motivierten<br />
Erziehung der Bürger erheblich. In vielen westdeutschen Städten<br />
entstanden kommunale Abfall- und Umweltberatungen, die z.B.<br />
Getrenntsammlung und Recycling oder den Verzicht auf Verpackungen<br />
propagierten (vgl. beispielhaft: HOFFMANN/MÜLLER 1992). Diesen Aktivitäten<br />
lagen teilweise naive Vorstellungen zugrunde, wonach Bildungsmaßnahmen<br />
zu einem veränderten (Umwelt-)Bewusstsein und<br />
dieses zu umweltgerechtem Handeln führen sollte (zur Kritik daran vgl.<br />
BOLSCHO 1997, PREUSS 1997 und KRUSE 2005). Auch in den Empfehlungen<br />
zu „Umwelt und Unterricht“ der KULTUSMINISTERKONFERENZ<br />
(1980) wird die Umweltbildung als Instrument umweltpolitischen Handelns<br />
angesehen.<br />
Umweltbildung zwischen<br />
staatlicher Aufgabenzuteilung<br />
und<br />
Problem- und Handlungsorientierung<br />
Umweltpädagogen haben diese staatliche Aufgabenzuteilung und die<br />
damit implizierte individualistische Ausrichtung – also die Hoffnung,<br />
Umweltbewusstsein des Einzelnen könne die Umweltprobleme der Gesellschaft<br />
lösen – durchaus kritisiert (ausführlich in WOLF 2005, S. 92-<br />
101). BOLSCHO, EULEFELD, SEYBOLD (1980, S. 16f) rückten die Erwartungen<br />
an die Umweltbildung zurecht. Demnach kann die Umweltbil-<br />
13
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
dung Probleme thematisieren, untersuchen, vergleichen, Fragen stellen,<br />
Antworten suchen und Denken und Handeln begleiten. Umweltbildung<br />
kann weniger Fakten feststellen und verbreiten als Menschen in den<br />
Prozess des Umgangs mit der Umwelt einbeziehen. Die Konzeption einer<br />
problem- und handlungsorientierten Umweltbildung will diese Kritik<br />
berücksichtigen. Umweltbildung soll nach BOLSCHO, EULEFELD,<br />
SEYBOLD (1980, S. 17f) Schülern die Auseinandersetzung mit ihrer natürlichen,<br />
sozialen und gebauten Umwelt ermöglichen, die Fähigkeit<br />
zum Problemlösen in komplexen Systemen fördern und Schüler für die<br />
Beteiligung am politischen Leben befähigen.<br />
Exkurs: Mensch-Umwelt-Beziehungen in der DDR<br />
Wenn sich dieses Kapitel an den Verhältnissen in der Bundesrepublik<br />
(West) orientiert, soll damit die Geschichte der DDR nicht negiert<br />
werden. Die gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Verhältnisse<br />
führten hier zu ganz speziellen Umweltproblemen (PETSCHOW/<br />
MEYERHOFF/THOMASBERGER 1990), so z.B. zu einer hohen Luftbelastung<br />
mit Schwefeldioxid durch die Nutzung der einheimischen<br />
Braunkohle als wichtigstem Energieträger; dass die Braunkohle z.B.<br />
mit dem Karbid-Acetylen-Verfahren auch aus Ausgangsstoff für die<br />
chemische Industrie genutzt wurde, hatte weitere – allerdings regional<br />
begrenzte – Umweltbelastungen zur Folge.<br />
In der DDR wurde, aufbauend auf dem Landeskulturgesetz (VOLKS-<br />
KAMMER DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 1970), seit<br />
den 70er Jahren ein umweltrechtliches Regelwerk geschaffen. Dieses<br />
sollte zwar einerseits den Umweltschutz im Sinne des Klassenkampfes<br />
instrumentalisieren (vgl. ebd., Präambel), andererseits aber reichte<br />
es z.B. mit dem speziellen Recyclingsystem zur Erfassung von<br />
„Sekundärrohstoffen“ (MINISTERIUM FÜR MATERIALWIRTSCHAFT<br />
1986) bis in die Lebenswelt der Bürger.<br />
Auch in der DDR entstand in den 70er und 80er Jahren eine Umweltbewegung,<br />
die sich vor allem in der Gesellschaft für Natur und Umwelt<br />
(GNU) des Kulturbundes der DDR sowie in kirchlichen<br />
Umweltgruppen organisierte (WENSIERSKI 1986, BEHRENS/HOFF-<br />
MANN 2007). Auch diese Umweltbewegung verstand sich als gesellschaftskritisch.<br />
Gesellschaftspolitische Gegenentwürfe (BAHRO<br />
1977) konnten allerdings, anders als in der Bundesrepublik, nicht im<br />
eigenen Lande publiziert oder gar praktiziert werden. Schon kleinere<br />
unabhängige Aktionen zum Umweltschutz weckten das Misstrauen<br />
und die Abwehr der Staatsorgane.<br />
14
2.1 Auf dem Weg zur Nachhaltigkeitsidee<br />
Dennoch gelang es Umweltgruppen, ein Profil zu entwickeln, bei<br />
dem oftmals der Erwerb von Wissen, praktische Aktivitäten im Natur-<br />
und Umweltschutz sowie kleine Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit<br />
Hand in Hand gingen (vgl. beispielhaft KUHN 1996, BERG 1999,<br />
KRÜGER/PRIEBE o.J., SRU 1996, S. 226-230).<br />
In einer weiteren Entwicklungsphase – vor allem in den 90er Jahren –<br />
wurden neue umweltpolitische Analyse- und Steuerungsinstrumente<br />
geschaffen. Hierzu gehören das Öko-Audit (EG 1993, EG 2001, EG<br />
2009), die Ökosteuer (NUTZINGER/ZAHRNT 1989, UMWELTBUNDES-<br />
AMT 2002, VIATKOV 2007) oder das Contracting (WEIZSÄCKER/LO-<br />
VINS/LOVINS 1996, S. 180). Diese Instrumente orientieren auf das<br />
Machbare anstatt vor drohenden Katastrophen zu warnen, sie setzen auf<br />
eine Stärkung der Verursacher (insbesondere der gewerblichen Wirtschaft)<br />
anstatt auf Konfrontation, Agitation bzw. ordnungspolitische<br />
Regulierung. Sie sind von einer mehrere verschiedene Teilaspekte integrierenden<br />
Sichtweise geprägt. So dient z.B. das Öko-Audit der Stärkung<br />
des Umweltschutzes in Unternehmen, dabei werden alle jeweils<br />
relevanten Umweltauswirkungen einbezogen (neben den Abfällen z.B.<br />
auch die Rohstoffe, Materialien und Vorprodukte inklusive deren Gewinnung<br />
sowie die Freisetzung von Abwasser, Abgasen oder Lärm).<br />
Bei der Produktlinienanalyse oder der Ökobilanz wird der gesamte Lebenszyklus<br />
eines Produkts – von der Gewinnung der Rohstoffe über die<br />
Nutzung bis zur Verwertung bzw. Entsorgung nach Gebrauch – analysiert.<br />
Diese integrative Sichtweise erreichte mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit<br />
einen vorläufigen Höhepunkt. Ausgangspunkt war einerseits die<br />
Erkenntnis, dass viele Umweltprobleme globalen Charakter angenommen<br />
haben und daher auch nur durch gemeinsames Engagement der internationalen<br />
Staatengemeinschaft zu lösen sind und andererseits die<br />
Einsicht, dass Umweltprobleme nicht zu Lasten der berechtigten Entwicklungsinteressen<br />
vor allem der Länder des Südens gelöst werden<br />
können. Zentrale Merkmale dieses Leitbildes werden im Kapitel 2.4 näher<br />
vorgestellt, seine Resonanz im Bildungswesen ist Gegenstand des<br />
Kapitels 3.<br />
Integrative<br />
Instrumente der<br />
Umweltpolitik<br />
Nachhaltigkeit als<br />
hoch integrative<br />
Sichtweise<br />
Dieser kurze Abriss soll Ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, dass<br />
die Art und Weise, wie der Mensch über sein Wechselverhältnis mit der<br />
Umwelt nachdenkt – die Informationen, die er einbezieht, die Wertungen,<br />
Schlussfolgerungen, die er trifft – sich im Laufe der Zeit verändert<br />
haben. (Sie können das in anderen Lehrabschnitten des Moduls 1 vertiefen).<br />
Die Dynamik dieser Veränderungen nimmt gegenwärtig eher zu<br />
als ab, erkennbar z.B. an der „Halbwertszeit“ von politischen Verlaut-<br />
15
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
barungen oder Umweltgesetzen. Was hier vorrangig am Beispiel der<br />
Material- und Abfallwirtschaft skizziert wurde, gilt auch für andere Bereiche<br />
der Mensch-Umwelt-Beziehungen. Damit entwickeln sich nicht<br />
nur die Grundlagen der Umweltbildung permanent weiter, sondern neues<br />
Wissen, neue Sichtweisen, Instrumente, Technologien verändern die<br />
Weise, wie der Mensch mit der Umwelt umgeht, was wieder neue Ausgangssituationen<br />
für die Reflexion der Mensch-Umwelt-Beziehungen<br />
schafft. 3 Der Nachhaltigkeitsdiskurs reiht sich in diese Entwicklung<br />
ein, und es besteht kein Anlass zu der Vermutung, dass sie damit einen<br />
Abschluss findet.<br />
2.2 Nachhaltigkeit – Karriere einer Idee<br />
2.2.1 Brundtland-Bericht (1987)<br />
Das Leitbild der Nachhaltigkeit im heute üblichen Sinne wurde 1987<br />
von der UN-Kommission für Umwelt und Entwicklung in dem Bericht<br />
„Our Common Future“ formuliert.<br />
Brundtland-<br />
Kommission<br />
Basierend auf der UN-Resolution 38/161 vom 19.12.1983, hatten die<br />
Vereinten Nationen eine Kommission gegründet, die einen Bericht zu<br />
den globalen Problemen und Strategieempfehlungen für eine stabile<br />
Entwicklung erarbeiten sollte. Die Kommission unter Leitung der ehemaligen<br />
norwegischen Premierministerin und Umweltministerin Gro<br />
Harlem Brundtland nahm später die Bezeichnung „Weltkommission für<br />
Umwelt und Entwicklung“ an, bzw. sie wird auch als „Brundtland-<br />
Kommission“ bezeichnet.<br />
Der Bericht thematisiert Herausforderungen wie das Bevölkerungswachstum<br />
einzugrenzen, die Ernährung der Weltbevölkerung sicherzustellen,<br />
die Artenvielfalt und die Ökosysteme zu erhalten oder eine<br />
ökologisch vertretbare und gerechte Energieversorgung zu gewährleisten.<br />
3. Auf analoge Weise hat der Weg zum Nachhaltigkeitsleitbild auch Ausgangspunkte in der<br />
Reflexion der (ökonomischen, sozialen) Beziehungen zwischen Menschen. Das soll hier<br />
aber nicht ausgeführt werden.<br />
16
2.2 Nachhaltigkeit – Karriere einer Idee<br />
Exkurs: Die Globale Herausforderung<br />
Trotz ermutigender Fortschritte der Menschheit – so dem Rückgang<br />
der Säuglingssterblichkeit, der Zunahme der Lebenserwartung der<br />
Menschen und einer im globalen Maßstab steigenden Nahrungsmittelproduktion<br />
– sieht die UN-Kommission für Umwelt und Entwicklung<br />
aus der Perspektive des Jahres 1987 Entwicklungen, die für die<br />
Menschen und den Planeten Erde bedrohlich sind:<br />
Es gibt in absoluten Zahlen mehr hungrige Menschen als je zuvor, bei<br />
weiterhin steigender Tendenz. Die Zahl der Analphabeten, die Zahl<br />
der Menschen ohne sauberes Wasser und ordentliche Wohnung und<br />
die Zahl der Menschen, denen es an Brennholz mangelt, steigen<br />
(VEREINTE NATIONEN 1990, S. 20). Gleichzeitig steigt die Industrieproduktion,<br />
sie ist in den vergangenen 100 Jahren „um das 50fache<br />
gestiegen, davon entfallen vier Fünftel auf die Zeit nach 1950“ (ebd.,<br />
S. 22). Die Kluft zwischen reichen und armen Ländern wächst.<br />
Während Menschen hungern, veröden jedes Jahr 6 Millionen Hektar<br />
an dringend benötigter produktiver Landfläche. Jährlich werden 11<br />
Millionen Hektar Wald zerstört, meist entsteht nur minderwertiges<br />
Ackerland daraus, das die Bauern, die es bewirtschaften, nicht ernähren<br />
kann (ebd., S.20). Die wichtigsten Fischarten, die 95% des Weltfischfangs<br />
sichern, sind durch Überfischen bedroht (ebd., S. 260).<br />
Die Emissionen z.B. an Schwefeldioxid und Kohlendioxid aus der<br />
Verbrennung von Kohle, Öl und Gas steigen; der (schwefel-)saure<br />
Regen zerstört vor allem in Europa Wälder, Seen und das architektonische<br />
Erbe; ein globaler Klimawandel vor allem in Folge der Kohlendioxid-Emissionen<br />
wird befürchtet – er hätte wiederum<br />
Auswirkungen z.B. auf den Verlauf der Klimazonen und damit auch<br />
auf die Situation der landwirtschaftlichen Anbauflächen.<br />
Innerhalb der 900 Tage, in denen die Kommission arbeitete (Oktober<br />
1984 – April 1987) erreichte in Afrika eine durch die Dürre ausgelöste<br />
Umwelt- und Entwicklungskrise mit einer Million Todesopfern<br />
ihren Höhepunkt; ein Unfall in einer Pestizidfabrik im indischen<br />
Bhopal tötete über 2000 Menschen und schädigte mehr als 200.000<br />
schwer; in Tschernobyl explodierte ein Kernreaktor, der nukleare<br />
Fallout breitete sich über weite Teile Europas aus; zudem starben geschätzte<br />
60 Millionen Menschen an Durchfallerkrankungen, die<br />
durch verschmutztes Trinkwasser bzw. Unterernährung hervorgerufen<br />
wurden (ebd., S.22).<br />
17
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
Es wird immer offensichtlicher, dass Fragen der (sozialen und) wirtschaftlichen<br />
Entwicklung nicht von Umweltfragen getrennt werden<br />
können. „Armut ist eine Hauptursache und eine Hauptfolge globaler<br />
Umweltprobleme. Es ist daher müßig, Umweltprobleme ohne eine<br />
umfassendere Perspektive meistern zu wollen, die auch die Ursachen<br />
für die Armut in der Welt und die internationale Ungleichheit einbezieht.“<br />
(ebd., S. 21)<br />
Nachhaltigkeit als<br />
Leitbild<br />
Auch angesichts schwerwiegender Probleme vertritt die Kommission<br />
die Überzeugung, dass die Menschen eine Zukunft aufbauen können,<br />
die glücklicher, gerechter und sicherer ist. Dafür ist allerdings entschiedenes<br />
politisches Handeln notwendig. Dafür entwirft die Kommission<br />
das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung, das heißt „eine Entwicklung,<br />
in der die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden, ohne dabei<br />
künftigen Generationen die Möglichkeit zur Befriedigung ihrer<br />
eigenen Bedürfnisse zu nehmen“ (VEREINTE NATIONEN 1990, S. 26 4 ).<br />
Es ist ein Verdienst des Brundtland-Berichtes, dass erstmals eine größere<br />
öffentliche Aufmerksamkeit für die Nachhaltigkeitsidee gewonnen<br />
werden konnte und dass konkrete Maßnahmen aufgezeigt wurden. Damit<br />
gehört dieser Bericht mit zu den Ereignissen, welche die Konferenz<br />
von Rio initiiert haben.<br />
2.2.2 Konferenz von Rio (1992)<br />
Die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung<br />
(UNCED) fand im Juni 1992 in Rio de Janeiro statt. Auf der Konferenz<br />
von Rio wurden die Deklaration von Rio und die Agenda 21 (BUNDES-<br />
UMWELTMINISTERIUM 1992) verabschiedet. Zudem wurden die Klimaschutzkonvention<br />
und die Artenschutzkonvention unterzeichnet und die<br />
Walddeklaration verabschiedet, welche hier nicht weiter behandelt werden<br />
sollen.<br />
Agenda 21<br />
Mit der Deklaration von Rio und der Agenda 21 erklärte die Konferenz<br />
eine nachhaltige zukunftsfähige Entwicklung („sustainable development")<br />
zur zentralen Zukunftsaufgabe unserer Gesellschaften für das<br />
21. Jahrhundert. Entsprechende Entwicklungsprozesse sollten auf globaler,<br />
nationaler, regionaler und lokaler Ebene angeschoben werden. Es<br />
wurden Maßnahmen in der Umwelt-, Entwicklungs-, Sozial- und Wirt-<br />
4. Die in der Bundesrepublik Deutschland (West) erschienene Ausgabe (HAUFF 1987) hat<br />
eine geringfügig abweichende Formulierung.<br />
18
2.2 Nachhaltigkeit – Karriere einer Idee<br />
schaftspolitik gefordert. Dieser Beschluss wurde von 178 Staaten, darunter<br />
Deutschland, unterzeichnet.<br />
Die Agenda 21 ist in vier Hauptabschnitte und 40 Kapitel eingeteilt. Die<br />
Hauptabschnitte befassen sich mit<br />
1. der sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen einer nachhaltigen<br />
Entwicklung,<br />
2. der Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen für die<br />
Entwicklung,<br />
3. der Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen sowie<br />
4. Möglichkeiten der Umsetzung.<br />
Das für die <strong>BNE</strong> wichtigste Kapitel ist Kap. 36 „Förderung der Schulbildung,<br />
des öffentlichen Bewusstseins und der beruflichen Aus- und<br />
Fortbildung“. Daneben sind für die <strong>BNE</strong> u.a. Kap. 25 „Kinder und Jugendliche<br />
und nachhaltige Entwicklung“ sowie 28 „Initiativen der<br />
Kommunen zur Unterstützung der Agenda 21“ relevant.<br />
Die einzelnen Kapitel sind im Wesentlichen gleich strukturiert: Die<br />
Handlungsgrundlagen werden skizziert, Ziele werden benannt, Maßnahmen<br />
aufgezeigt und notwendige Instrumente zur Umsetzung angegeben.<br />
2.2.3 Commission for Sustainable Development (1993)<br />
1993 wurde, wie in der Agenda 21 vorgeschlagen, die UN-Kommission<br />
für nachhaltige Entwicklung (Commission for Sustainable Development<br />
/ CSD) gegründet. Sie ist ein Unterorgan des UN-Wirtschafts- und<br />
Sozialrates (ECOSOC). Ihre Mitglieder werden vom ECOSOC gewählt.<br />
53 Staaten, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, sind<br />
Mitglied. Sie werden in der Regel durch Umweltminister vertreten. Daneben<br />
sind NGOs und diverse Teilnehmer mit Beobachterstatus vertreten.<br />
Der Sitz der CSD ist New York. Die CSD soll jährlich die<br />
Umsetzung der Agenda 21 bilanzieren und die weitere Entwicklung abstecken.<br />
Auf der 6. jährlichen Sitzung 1998 wurden Beschlüsse zu Bildung<br />
und Kommunikation gefasst, u.a. wurden die Regierungen<br />
aufgefordert, auf allen Ebenen des Bildungssystems Ziele einer nachhaltigen<br />
Entwicklung in die Lehr- und Lernprogramme zu integrieren<br />
(BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2002, S. 5-6).<br />
19
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
2.2.4 Charta von Aalborg (1994)<br />
Am 24.-27. Mai 1994 fand im dänischen Aalborg die Europäische Konferenz<br />
über zukunftsbeständige Städte und Gemeinden statt (ICLEI<br />
1994). Sie wurde von der Stadt Alborg und der Europäischen Kommission<br />
veranstaltet und vom Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen<br />
ausgerichtet. Die Teilnehmer verabschiedeten die Charta<br />
der Europäischen Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit<br />
(kurz: Charta von Aalborg, im Original: Charter of European<br />
Cities & Towns Towards Sustainability). Die Städte und<br />
Gemeinden bekennen sich hier zu ihrer Verantwortung für eine nachhaltige<br />
Entwicklung, die u.a. daraus resultiert, dass ca. 80% der europäischen<br />
Bevölkerung in städtischen Gebieten leben und dass die<br />
kommunale Ebene die bevölkerungsnäheste Ebene und der Rahmen ist,<br />
wo Umweltprobleme wahrgenommen werden. Auch gemäß Kapitel 28<br />
der Agenda 21 (BUNDESUMWELTMINISTERIUM 1992, S. 231-232) gehören<br />
die Kommunen zu den wichtigsten Akteuren für eine nachhaltige<br />
Entwicklung.<br />
Nachhaltige Entwicklung wird in der Charta von Aalborg als ein „kreativer,<br />
lokaler, gleichgewichtssuchender Prozess“ verstanden. Es werden<br />
kommunale Aktionsfelder der nachhaltigen Entwicklung definiert wie<br />
z.B. die soziale Gerechtigkeit, die Strukturen der Flächennutzung, die<br />
innerstädtische Mobilität, die Verantwortung für das Weltklima und die<br />
Rolle der Bürger.<br />
Initiierung Lokaler<br />
Agenda 21 Prozesse<br />
Bedeutung hat die Charta von Aalborg vor allem deshalb erlangt, weil<br />
sie Ausgangspunkt für eine Kampagne europäischer zukunftsbeständiger<br />
Städte und Gemeinden war. In den Folgejahren haben europaweit<br />
viele Kommunen – nach intensiver öffentlicher Diskussion – die Charta<br />
unterzeichnet und damit formell den Prozess zur Aufstellung einer eigenen<br />
Lokalen Agenda 21 begonnen.<br />
Die Lokale Agenda 21 ist Gegenstand des Kapitels 4 in diesem <strong>Lehrbrief</strong>.<br />
Exkurs: Welthandel, WTO und Nachhaltigkeit<br />
Wir würden diesen Streifzug durch einige Stationen des internationalen<br />
Nachhaltigkeitsdiskurses mit einem blinden Auge absolvieren,<br />
wenn wir nicht-nachhaltige Entwicklungen und deren Triebkräfte außen<br />
vor lassen würden. Mit Rückgriff auf COSBEY (2006) soll daher<br />
wenigstens kurz die Rolle der WTO gewürdigt werden.<br />
20
2.2 Nachhaltigkeit – Karriere einer Idee<br />
Nur drei Jahre nach der Konferenz von Rio – im Jahr 1995 – wurde<br />
die Welthandelsorganisation WTO gegründet, aber schon seit 1947<br />
hatten sich (zunächst 27) Staaten im Rahmen von GATT (General<br />
Agreement on Tariffs and Trade) dem Ziel verschrieben, Zollschranken<br />
abzubauen und für alle Mitgliedsstaaten akzeptable Handelsregeln<br />
zu schaffen. Seit Beginn der 90er Jahre rückte (bei GATT bzw.<br />
WTO) die Liberalisierung des Welthandels – also der möglichst weitgehende<br />
Abbau jeglicher Handelshemmnisse – in den Mittelpunkt.<br />
Nun manifestiert sich Umweltpolitik oftmals gerade in Regulierungsmaßnahmen<br />
wie z.B. Grenzwerten, Ge- oder Verboten; Konflikte<br />
mit der Handelsliberalisierung waren daher vorprogrammiert.<br />
Bereits 1991 kam es zu einem solchen Konflikt: Aus Gründen des<br />
Delphinschutzes hatten die USA die Einfuhr von Thunfisch aus Ländern<br />
verboten, bei denen Fangpraktiken üblich waren, die zu einem<br />
hohen Beifang an Delphinen führten, bzw. – stärker noch – „die nicht<br />
nachweisen konnten, dass ihre Fangmethoden den US-Standards des<br />
Delphinschutzes entsprachen“ (ebd., S. 239). Dagegen beschwerte<br />
sich Mexiko – und bekam vom Schiedsgericht der GATT Recht.<br />
Auch wenn das Urteil letztlich nicht wirksam wurde, zeigte sich doch<br />
die Problematik: Die rechtsverbindlichen Verträge, welche die Staaten<br />
im Zuge der Handelsliberalisierung eingehen, können dazu führen,<br />
dass Anliegen des Umweltschutzes oder der nicht<br />
rechtsverbindlichen Agenda 21 als illegal erklärt werden.<br />
Anhand von Madagaskar beschreibt COSBEY (ebd, S. 251-253),<br />
dass arme Länder des Südens aus strukturellen Gründen oft gar nicht<br />
in der Lage sind, Vorteile aus der Liberalisierung des Handels zu ziehen.<br />
COSBEY (ebd., S. 245) verweist auf weitere Umweltmaßnahmen, die<br />
in der WTO „als potenzielle Handelshemmnisse angeführt wurden“.<br />
So hatte z.B. Japan gegen die EU-Chemikalienverordnung REACH<br />
Beschwerde geführt, nach welcher neue und bestehende Chemikalien<br />
registriert werden müssen. Argentinien hatte sich gegen „Mindeststandards<br />
für Wärmeeffizienz in importierten Wasserkochern und<br />
obligatorische Informationen über Effizienzstufen“ gewehrt.<br />
Immerhin wurde inzwischen eine Verpflichtung auf das Ziel der<br />
nachhaltigen Entwicklung in die Präambel der WTO-Erklärung aufgenommen.<br />
In anderen zwischenstaatlichen Handelsverträgen ist<br />
nicht einmal das der Fall.<br />
21
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
2.2.5 Die Milleniumsziele (2001)<br />
Im September 2000 verabschiedeten 189 UN-Mitgliedsstaaten auf ihrem<br />
bis dahin größten Gipfeltreffen die Milleniumserklärung (VEREIN-<br />
TE NATIONEN 2000). Diese Agenda für die internationale Politik legte<br />
vier Handlungsfelder fest, die für eine globale Zukunftssicherung unerlässlich<br />
sind:<br />
• Frieden, Sicherheit und Abrüstung,<br />
• Entwicklung und Armutsbekämpfung,<br />
• Schutz der gemeinsamen Umwelt sowie<br />
• Menschenrechte, Demokratie und gute Regierungsführung.<br />
Nachfolgend erstellte eine internationale Arbeitsgruppe (u.a. Vertreter<br />
der UN, der Weltbank, der OECD) einen Zielkatalog, den der UN Generalsekretär<br />
Kofi Annan im September 2001 als "Road Map for the Implementation<br />
of the Millennium Declaration" der UN-<br />
Generalversammlung vorlegte. Diese sogenannten Milleniumsziele<br />
(MDG, Millenium Development Goals) bauen auf international vereinbarten<br />
Entwicklungszielen der großen UN-Konferenzen der 90er Jahre<br />
sowie auf der OECD/DAC-Resolution „Shaping the 21 st Century“ von<br />
1996 auf (VAN DE SAND 2005). Die unterzeichnenden Länder stellten<br />
sich die Ziele, bis 2015<br />
1. die extreme Armut und den Hunger zu bekämpfen<br />
2. allen Menschen eine Primarschulbildung zu ermöglichen<br />
3. die Gleichstellung der Geschlechter zu verbessern und die<br />
Rolle der Frauen zu stärken<br />
4. die Kindersterblichkeit zu senken<br />
5. die Gesundheitsversorgung für Mütter zu verbessern<br />
6. HIV/AIDS, Malaria und andere schwere Krankheiten zu<br />
bekämpfen<br />
7. eine ökologische Nachhaltigkeit zu sichern<br />
8. eine globale Entwicklungspartnerschaft aufzubauen. (MIL-<br />
LENIUMKAMPAGNE o.J., dort auch umfangreiches Datenmaterial<br />
zum Stand der Umsetzung)<br />
Diese Ziele werden durch Zielvorgaben untersetzt, z.B. zu Ziel 1: „bis<br />
zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevölkerung, dessen Einkommen<br />
weniger als 1 Dollar pro Tag beträgt, und den Anteil der Menschen, die<br />
Hunger leiden, zu halbieren, sowie bis zu demselben Jahr den Anteil der<br />
22
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
Menschen, die hygienisches Trinkwasser nicht erreichen oder es sich<br />
nicht leisten können, zu halbieren“ (VEREINTE NATIONEN 2000, S. 12-<br />
13)<br />
Mit den MDGs werden bereits in der Agenda 21 bzw. anderen UN-Verlautbarungen<br />
beschriebene Aufgaben bekräftigt, allerdings stellen die<br />
MDGs diesen Dokumenten gegenüber eine Einengung und Abschwächung<br />
dar:<br />
• Das Ziel, bis 2015 den Anteil der extrem armen Menschen<br />
zu halbieren, belässt dann immer noch ca. 900 Millionen<br />
Menschen in extremer Armut. Viele Länder z.B. in Lateinamerika<br />
liegen über dem Einkommensniveau von 1US$,<br />
ohne dass damit dort das Problem der Armut bewältigt wäre.<br />
• Das Entwicklungsverständnis ist gegenüber dem eine ökologisch<br />
tragfähige und sozial gerechte Entwicklung umfassenden<br />
Ansatz der Agenda 21 verengt.<br />
• Schließlich bleibt die Verantwortung des Nordens vage. Präzise<br />
quantitative und zeitliche Vorgaben – so sie denn überhaupt<br />
in den MDGs vorkommen – beziehen sie sich fast<br />
ausschließlich auf sektorale Entwicklungsprozesse im<br />
Süden wie Bildung oder Gesundheit.<br />
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
Unter dem Eindruck ihrer internationalen Karriere fand die Nachhaltigkeitsidee<br />
auch Resonanz in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Resonanz<br />
und die damit verbundene Weiterentwicklung sollen hier<br />
anhand weniger Stationen in chronologischer Reihenfolge skizziert<br />
werden. Insofern ist dieses Kapitel auch eine Fortsetzung von Kap. 2.1.<br />
Zunächst jedoch soll die Operationalisierung als ein grundlegendes Erfordernis<br />
einer nachhaltigen Entwicklung dargestellt werden.<br />
2.3.1 Operationalisierung der Nachhaltigkeitsidee<br />
Da Nachhaltigkeit kein fertiger Bauplan sondern ein Leitbild ist, musste<br />
dieses zunächst operationalisiert (für empirische Analysen bzw. politisches<br />
oder z.B. auch Alltagshandeln handhabbar gemacht) werden.<br />
Hierauf wird bereits in der Agenda 21 im Kapitel 40 „Informationen für<br />
die Entscheidungsfindung“ hingewiesen. Herkömmliche Indikatoren<br />
wie das Bruttosozialprodukt sind demnach nicht ausreichend, um eine<br />
nachhaltige (oder nicht nachhaltige) Entwicklung abzubilden. Daher<br />
sollte die Informationsgrundlage für eine nachhaltige Entwicklung<br />
23
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
grundlegend verbessert werden. (BUNDESUMWELTMINISTERIUM 1992,<br />
S. 282-283, vgl. auch SRU 1994 sowie SRU 1998, S. 48-124).<br />
Nicht alleine Deutschland musste sich dieser Aufgabe stellen; auf jeder<br />
Ebene, die sich am Leitbild der Nachhaltigkeit orientieren will, braucht<br />
man die Selbstvergewisserung durch empirische Daten. Das gilt insbesondere<br />
auch für Kommunen im Rahmen der Lokalen Agenda 21 (s.<br />
Kap. 4) oder für Schulen im Rahmen des Nachhaltigkeitsaudits (Kap.<br />
3.4.1). Wenn Sie sich im Modul 5 mit der Evaluation von Bildungsprozessen<br />
befassen, werden Sie methodische Parallelen entdecken, denn<br />
auch bei der Bildungsevaluation müssen Sie aus Ihren (didaktischen)<br />
Leitvorstellungen messbare Größen ableiten.<br />
Das Vorgehen bei der Operationalisierung soll hier in Anlehnung an<br />
GRUNWALD/KOPFMÜLLER (2006) skizziert werden.<br />
Leitbild<br />
Konzeptionen<br />
Das Leitbild Nachhaltigkeit liefert grundlegende Orientierungen, so<br />
z.B., Politik an der Idee der Gerechtigkeit auszurichten oder die Grenzen<br />
der Tragfähigkeit der Ökosysteme einzuhalten.<br />
Diese Orientierungen bedürfen der Konkretisierung, denn erst dann<br />
können sie angemessen in gesellschaftliches Handeln und praktische<br />
Politik umgesetzt werden. Konzeptionen leisten diese Konkretisierung<br />
(ebd., S. 37-58). Solche Konzeptionen können sich unterschiedlichen<br />
Fragen widmen und diese unterschiedlich beantworten.<br />
• Die Frage danach, welches „Kapital“ nach welchen Regeln<br />
von Generation zu Generation weitergegeben werden sollte,<br />
wird von den Konzeptionen der starken bzw. schwachen<br />
Nachhaltigkeit beantwortet (Details beim Aspekt ethischmoralische<br />
Fundierung im Kap. 2.4).<br />
• Der Frage, ob konkrete gesellschaftliche Zielvorgaben<br />
bereits am Beginn einer nachhaltigen Entwicklung festgelegt<br />
oder erst im Prozessverlauf ausgehandelt werden sollen,<br />
widmen sich die Konzeptionen der substanziellen bzw. der<br />
prozeduralen Nachhaltigkeit (Details beim Aspekt kommunikative,<br />
prozessorientierte Ausrichtung im Kap. 2.4).<br />
• Die Frage nach der Gewichtung der ökologischen, ökonomischen<br />
bzw. sozialen Dimension gesellschaftlicher Entwicklung<br />
wird von Ein-Säulen-Konzeptionen (vgl. Studie<br />
Zukunftsfähiges Deutschland unter Kap. 2.3.3 sowie die<br />
Positionen des Sachverständigenrates für Umweltfragen<br />
(SRU)), von Mehr-Säulen-Konzeptionen (vgl. Konzept<br />
Nachhaltigkeit im Kapitel 2.3.4 sowie) bzw. von integrativen<br />
Ansätzen (vgl. die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie<br />
unter 2.3.5) beantwortet.<br />
24
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
Indikatoren sind Umstände oder Merkmale, die als (beweiskräftige)<br />
Anzeichen oder Hinweise auf etwas anderes dienen (DUDENVERLAG<br />
2006). Im Kapitel 40 der Agenda 21 wird gefordert, auf internationaler<br />
wie nationaler Ebene Indikatorensysteme zur Erfassung der nachhaltigen<br />
Entwicklung aufzustellen (BUNDESUMWELTMINISTERIUM 1992, S.<br />
282ff). Mit Nachhaltigkeitsindikatoren sollen u.a. Zustände und Entwicklungen<br />
(Trends) charakterisiert, Fehlentwicklungen identifiziert<br />
und kommuniziert 5 , Handlungsbedarf abgeleitet und Erfolge kontrolliert<br />
werden (GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2006, S. 59).<br />
Indikatoren und<br />
Zielwerte, Diagnose<br />
Bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren kann auf eine teilweise<br />
jahrzehntelange Praxis der Erhebung ökonomischer, ökologischer<br />
und sozialer Indikatoren zurückgegriffen werden. Einer der<br />
bekanntesten (ökonomischen) Indikatoren ist das Bruttoinlandsprodukt.<br />
GRUNWALD/KOPFMÜLLER (2006, S. 59-65) systematisieren verschiedene<br />
Indikatorensysteme, z.B. nach<br />
• inhaltlich-strukturellen Gesichtspunkten: Beim Pressure-<br />
State-Response Ansatz der OECD wird beispielsweise stark<br />
vereinfachend zwischen anthropogenen Umweltbelastungen<br />
(Ursachen / Druck), deren Wirkungen (Zustand der<br />
Umwelt) und Gegenmaßnahmen unterschieden, und für alle<br />
drei kausalen Aspekte werden Indikatoren gesucht. Dieser<br />
Ansatz wurde Anfang der 90er Jahre entwickelt und u.a. auf<br />
die Klimaveränderung, die Zerstörung der Ozonschicht oder<br />
die Eutrophierung angewendet. Die CSD hat den Ansatz in<br />
den Jahren seit 1995 weiterentwickelt, dabei „pressure“<br />
durch „driving force“ ersetzt und den kausalen Zusammenhang<br />
zwischen den drei Kategorien aufgehoben (GOMM/<br />
WILLKE 2000). Bei mehrdimensionalen oder integrativen<br />
Nachhaltigkeitskonzepten (siehe oben) stößt der Pressure-<br />
State-Response Ansatz jedoch an Grenzen.<br />
• dem Grad der räumlichen Aggregation: Indikatoren können<br />
z.B. auf kommunaler, nationaler oder globaler Ebene erhoben<br />
werden.<br />
• dem Grad der inhaltlichen Aggregation: Es kann zwischen<br />
eindimensionalen Indikatoren (z.B. Ressourcenverbrauch,<br />
BIP) und Dimensionen übergreifenden Indikatoren (z.B.<br />
Ressourcenproduktivität als Quotient aus Bruttoinlandsprodukt<br />
und Ressourcenverbrauch) unterschieden werden. Eine<br />
besonders hohe Stufe der Aggregation wird mit Indizes<br />
5. Aus der Erfahrung mit schulischen Nachhaltigkeitsaudits (Kap. 3.4.1) möchte ich<br />
ergänzen, dass es auch wichtig ist, Erfolge und Stärken zu identifizieren, zu<br />
kommunizieren und gezielt auszubauen.<br />
25
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
erreicht; besonders bekannt ist z.B. der Human Development<br />
Index (HDI), den die Vereinten Nationen seit 1992 für<br />
mehr als 150 Staaten erheben und der die Aspekte Lebenserwartung,<br />
Bildung und Lebensstandard vereint.<br />
Mit den Indikatoren werden Merkmale von Zuständen bzw. Prozessen<br />
(IST) erfasst. Zudem sind Zielwerte (SOLL) erforderlich, welche die<br />
anzustrebende Merkmalsausprägung beschreiben. Derartige Zielwerte<br />
sind keine Naturkonstanten, sie werden in der Regel (mehr oder weniger<br />
demokratisch) in einem gesellschaftlichen Diskurs ausgehandelt<br />
(GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2006, S. 63). Wenn IST-Werte erfasst und<br />
SOLL-Werte festgelegt sind, können beide miteinander verglichen werden.<br />
Dies führt zu einer Bewertung, einer Diagnose. GRUNWALD/KOPF-<br />
MÜLLER (2006, S. 65-69) nehmen eine solche Nachhaltigkeitsdiagnose<br />
für Deutschland vor; hier in diesem <strong>Lehrbrief</strong> finden Sie Beispiele für<br />
Zielwerte bzw. Diagnosen in den Kapiteln 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 4.1.1 und<br />
4.1.3.<br />
Strategien und<br />
Maßnahmen<br />
Je nachdem, wie die Bewertung ausfällt, werden bestimmte Strategien<br />
bzw. Maßnahmen erforderlich, um bereits erreichte Erfolge auszubauen<br />
bzw. Defizite zu überwinden.<br />
Eine volkswirtschaftlich relevante und aus Nachhaltigkeitssicht problematische<br />
Strategie ist die Wachstumsstrategie, die seit 1967 im Stabilitäts-<br />
und Wachstumsgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert<br />
ist. GRUNWALD/KOPFMÜLLER (2006, S. 71-75) führen diese Strategie<br />
und mögliche Alternativstrategien näher aus.<br />
Effizienz, Suffizienz und Konsistenz hingegen sind Strategien, welche<br />
eine nachhaltige Entwicklung unterstützen (vgl. Kapitel 2.4 unter ökonomisch-ökologischer<br />
Neuorientierung).<br />
GRUNWALD/KOPFMÜLLER (2006, S. 78-81) weisen darauf hin, dass diese<br />
drei Strategien zwar auf die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit<br />
anwendbar seien, nicht aber auf ebenso nachhaltigkeitsrelevante<br />
Probleme wie Staatsverschuldung oder Bildungsdefizite. So wie sie integrative<br />
Konzeptionen (siehe oben) für angemessen halten, befürworten<br />
sie auch integrative Strategieansätze. Als ein Beispiel führen sie das<br />
Konzept Nachhaltigkeit der Enquete-Kommission des 13. Deutschen<br />
Bundestages (siehe nachfolgend Kapitel 2.3.4) an, wo exemplarische<br />
Untersuchungen in den drei Handlungsfeldern Bodenversauerung, Informations-<br />
und Kommunikationstechnik sowie Bauen und Wohnen<br />
angestellt und dabei jeweils ökologische, ökonomische und soziale<br />
Aspekte integriert werden.<br />
Derartige Strategien müssen schließlich in konkrete Maßnahmen münden.<br />
Von der politischen Ebene aus können z.B. Gesetze (bzw. unterge-<br />
26
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
setzliche Regelwerke) erlassen oder Förderprogramme aufgelegt<br />
werden. Als Beispiele – hier für die Umsetzung der Effizienzstrategie –<br />
können die Vorschriften zum Energiepass für Gebäude nach einer EU-<br />
Verordnung oder die finanzielle Förderung der Wärmedämmung an<br />
Gebäuden dienen.<br />
Die hier beschriebene Operationalisierung ist kein einmaliger linearer<br />
Prozess. Mindestens sind die Ergebnisse der Maßnahmen durch eine erneute<br />
Datenerfassung und Bewertung zu überprüfen; in der Praxis werden<br />
jedoch auch z.B. Konzeptionen oder Indikatorensysteme<br />
weiterentwickelt, so dass dann in einem folgenden Zyklus auf ein verbessertes<br />
Instrumentarium zurückgegriffen werden kann.<br />
Exkurs: Nachhaltigkeitsindikatoren in der <strong>BNE</strong><br />
Die Bemühungen um eine Operationalisierung der Nachhaltigkeitsidee<br />
haben, auch in Verbindung mit der Effizienzstrategie, verschiedene<br />
„Indikatoren“ hervorgebracht, welche zentrale Aspekte der<br />
Nachhaltigkeit illustrieren und daher auch Eingang in die Bildung gefunden<br />
haben.<br />
MIPS = Material Input pro Serviceeinheit. Das Modell will den<br />
Ressourcenverbrauch für die Erfüllung bestimmter menschlicher<br />
Bedürfnisse quantifizieren und den Blick auf effizientere Alternativen<br />
zur Bedürfnisbefriedigung lenken (SCHMIDT-BLEEK 1993 und<br />
1998). Dazu ein Beispiel: Legen Sie Wert darauf, einen Fernseher zu<br />
besitzen? Oder möchten Sie einfach nur einen Spielfilm sehen?<br />
Letzteres ließe sich z.B. auch realisieren, indem Sie einen Fernseher<br />
nicht kaufen sondern leasen (die Verantwortung für das Produkt bis<br />
hin zur späteren Entsorgung bleibt beim Hersteller/Leasinggeber),<br />
indem Sie eine DVD an dem evtl. ebenfalls im Haushalt befindlichen<br />
PC abspielen, den Film aus dem Internet downloaden oder ins<br />
Kino gehen / fahren. Es entsteht somit ein ganzen Spektrum an<br />
Optionen, das Ihnen zur Erfüllung Ihres Bedürfnisses zur Verfügung<br />
steht. Sofern MIPS-Daten vorliegen, können Sie die Option auswählen,<br />
welche relativ (pro gesehenem Film) den geringsten Materialeinsatz<br />
erfordert. – Da wir Güter (mit Ausnahme sogenannter<br />
Verbrauchsgüter wie z.B. Nahrungsmittel) nutzen, um damit Dienstleistungen<br />
zu realisieren, können vergleichbare Überlegungen auch<br />
für diverse andere Bereiche angestellt werden – so auch für diese<br />
Publikation, die Sie gerade lesen (Papierversion vs. Online-Version<br />
vs. Besuch einer Fortbildungsveranstaltung...). – Das Projekt „Mips<br />
für Kids“ vom WUPPERTAL-INSTITUT (2002) will dieses Konzept<br />
Kindern vermitteln.<br />
27
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
Der Begriff ökologischer Rucksack wurde SCHMIDT-BLEEK (1998)<br />
entwickelt. Er steht für „die Gesamtheit aller Primärmaterialien... die<br />
bei der Herstellung eines Stoffes oder Produktes... der Umwelt entnommen<br />
werden, aber nicht in den Stoff oder das Produkt eingehen.“<br />
(BROT FÜR DIE WELT/EED/BUND 2008, S.143) So hat ein Fahrrad einen<br />
ökologischen Rucksack von 400 kg, ein PC von 0,5-1,5 t und ein<br />
einfacher Herrenschuh von ca. 700 kg. EDUCATION GROUP GMBH<br />
(<strong>2011</strong>) bietet eine Übersicht zu entsprechenden Unterrichtskonzepten.Spezifische<br />
CO 2 -Emissionen fokussieren auf die Klimarelevanz<br />
der Produktion bzw. des Konsums von Gütern und Dienstleistungen.<br />
Die aus Ihrem Stromverbrauch resultierenden CO 2 -Emissionen sind<br />
auf Ihrer Stromrechnung ausgewiesen, wenn sie Ihnen zu hoch erscheinen,<br />
können Sie den Stromanbieter wechseln. Autohersteller<br />
geben an, wie viel CO 2 ihre Fahrzeuge pro gefahrenen Kilometer<br />
ausstoßen, der VCD hat daraus Kaufempfehlungen für verschiedene<br />
Nutzertypen erstellt (www.besser-autokaufen.de/). Die Bahn hat in<br />
ihre Online-Fahrplanauskunft einen „UmweltMobilCheck“ integriert,<br />
wo Sie die CO 2 -Emissionen einer Bahnfahrt mit einer entsprechenden<br />
Autofahrt bzw. Flugreise vergleichen können (vgl.<br />
www.reiseauskunft.bahn.de/). Auch zur Klimarelevanz von Lebensmitteln<br />
gibt es Daten (vgl. GRABOLLE/LOITZ 2007). – Für die <strong>BNE</strong><br />
können Sie derartige Indikatoren nutzen, um mit Lernenden den eigenen<br />
CO 2 -Fußabdruck zu ermitteln oder eine CO 2 -Bilanz der<br />
Schule/Bildungseinrichtung zu erstellen (LANGNER <strong>2011</strong> und <strong>2011</strong>a,<br />
LANDESINSTITUT FÜR LEHRERBILDUNG UND SCHULENTWICKLUNG<br />
<strong>2011</strong>).<br />
Mit dem Begriff des virtuellen Wassers soll der Blick darauf gelenkt<br />
werden, dass in den von uns konsumierten Produkten auch die wertvolle<br />
Ressource Wasser steckt. Auch hierzu gibt es umfängliche Informationen<br />
und spezielle Bildungsangebote (www.virtuelleswasser.de/).<br />
Der ökologische Fußabdruck ist die Fläche, die eine Gesellschaft<br />
zur Versorgung mit Ressourcen und zur Entsorgung der Abfälle und<br />
Emissionen benötigt – also die Summe der Flächen für Bauland für<br />
Wohnungen, die Acker- und Weideflächen für Nahrung, Verkehrsflächen,<br />
etc. Diesen Wert kann man einerseits für die gesamte Weltbevölkerung<br />
und andererseits für den einzelnen Menschen ermitteln<br />
und somit abschätzen, wie intensiv wir Menschen die Tragfähigkeit<br />
der Erde ausnutzen.<br />
28
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
Daraus können letztlich sehr bildhafte und plakative Schlussfolgerungen<br />
abgeleitet werden, etwa dass die Menschheit schon jetzt die<br />
Ressourcen von 1,2 Erden brauche (BROT FÜR DIE WELT/EED/BUND<br />
2008, S. 121). OTT/DÖRING (2008, S. 176) kritisieren den ökologischen<br />
Fußabdruck und das dem zugrunde liegende Konzept des Umweltraumes<br />
aufgrund der darin enthaltenen „äußerst komplizierten<br />
Umrechnungen“ verschiedenster Parameter in Flächenangaben. –<br />
Beispiele für „Footprintrechner“ werden von LANGNER <strong>2011</strong>a vorgestellt.<br />
Mit solchen Indikatoren(systemen) kann jedermann – im Privatleben<br />
oder auch in organisierten Bildungsprozessen – Anhaltspunkte für eine<br />
nachhaltige Ausrichtung des eigenen Lebens gewinnen, und tatsächlich<br />
können wir als „Verbraucher, Wähler, Geldanleger etc.“<br />
(MILKE/ROSTOCK 2010 S,19) eine nachhaltige Entwicklung mit vorantreiben.<br />
Diese Mitgestaltungsmöglichkeiten werden jedoch durch<br />
nicht nachhaltige Strukturen oder Rahmenbedingungen konterkariert<br />
und behindert, z.B. wenn die Pauschalflugreise die billigste Urlaubsoption<br />
ist oder Verkehrssysteme Autofahrer bevorteilen und schwächere<br />
Verkehrsteilnehmer benachteiligen (ebd.). In der Bildung gilt<br />
es daher, eine Balance zu finden und einerseits individuelle Handlungsmöglichkeiten<br />
aufzuzeigen, andererseits aber auch strukturelle<br />
Veränderungen einzufordern bzw. diese aktiv mit zu gestalten.<br />
Ferner sollten diese Indikatoren bzw. die darauf aufbauenden Tools<br />
nicht dazu verleiten, auf dem einen Auge sehend und auf dem anderen<br />
blind zu werden. So kann Ihnen z.B. der UmweltMobilCheck der<br />
Bahn dabei helfen, für eine Geschäftsreise von Hamburg nach München<br />
die umweltverträglichste Option zu finden. Aber vielleicht ließe<br />
sich die Besprechung, zu der Sie fahren wollen, auch als Skype-Konferenz<br />
organisieren? – Gerade in der Bildungsarbeit sollten daher die<br />
Rechenergebnisse der o.g. Tools nicht als absolute Wahrheiten<br />
missverstanden werden: Es sind Näherungswerte, die auf Annahmen<br />
und Hochrechnungen basieren, und die dort festgelegten Systemgrenzen<br />
stimmen nicht zwangsläufig mit Ihren Denkweisen, Bedürfnissen<br />
und Möglichkeiten überein.<br />
2.3.2 Staatsziel Nachhaltigkeit / Umweltschutz (1994)<br />
Im Jahr 1994 wurde das Prinzip der Nachhaltigkeit mit dem Focus auf<br />
Umweltschutz als Staatsziel im Grundgesetz verankert: „Der Staat<br />
schützt auch in Verantwortung für künftige Generationen die natürlichen<br />
Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsrechtlichen Ordnung<br />
durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht<br />
29
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
durch die vollziehende Gewalt und Rechtssprechung.“ (Artikel 20a<br />
Grundgesetz).<br />
2.3.3 Studie Zukunftsfähiges Deutschland (1995)<br />
Im Herbst 1995 wurde die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ vorgestellt<br />
(BUND/MISEREOR 1996). Als Herausgeber hatten sich der<br />
Umweltverband BUND und die Organisation der Entwicklungszusammenarbeit<br />
MISEREOR zusammengetan.<br />
Konzept des<br />
Umweltraums<br />
Leitbilder zur Nachhaltigkeitskommunikation<br />
Die Studie nimmt explizite Bezug auf das Gerechtigkeitspostulat der<br />
Agenda 21 (siehe Kap. 2.4). Daraus wird abgeleitet, dass (1.) die künftigen<br />
Generationen die gleichen Rechte auf eine intakte Natur haben<br />
wie wir und (2.) dass weltweit jeder Mensch das gleiche Recht hat, die<br />
globalen Umweltressourcen zu nutzen – solange die Menschheit damit<br />
die Umwelt nicht übernutzt. Nach dem Vorbild niederländischer Studien<br />
wird somit einer Gesellschaft entsprechend ihrer Bevölkerungszahl<br />
ein „Umweltraum“ zugemessen, den sie nutzen kann. Deutschland verbraucht<br />
demnach deutlich mehr Umweltraum, als ihm aufgrund der Bevölkerungszahl<br />
zusteht. Dazu schreibt VENRO (2000, S. 7): „Das im<br />
Norden verwirklichte Wohlstandsniveau ist nicht universalisierbar. So<br />
gesehen, ist auch Deutschland nach den Maßstäben einer global zukunftsfähigen<br />
Entwicklung fehlentwickelt, d.h. selbst ein ´Entwicklungsland´.“<br />
BUND/MISEREOR kommen zu dem Schluss, dass wir in<br />
Deutschland wesentliche Ressourcenverbräuche und Emissionen bis<br />
2050 um 80-90% reduzieren müssten (Details siehe Tabelle 2 im Kap.<br />
2.3.6). Darauf zielende Strategien wie Effizienz bzw. Suffizienz werden<br />
im Kap. 2.4 angesprochen.<br />
Den Schwerpunkt der Studie bilden jedoch Leitbilder für den Veränderungsprozess<br />
der Gesellschaft. Die Studie überwindet die Reduktion der<br />
Umweltproblematik auf Zahlen und bietet neue Wertehaltungen an. Zukunftsfähiger<br />
könnte die Bundesrepublik demnach werden, wenn die<br />
Gesellschaft ein „rechtes Maß für Zeit und Raum“ finden oder „eine<br />
lernfähige Infrastruktur“ aufbauen würde. Wer sich an „Gut leben statt<br />
viel haben“ orientiert, kann demnach persönliches Glück mit einem<br />
nachhaltigen Lebensstil verbinden. – Derartige positive Leitbilder gehören<br />
heute in den „Werkzeugkasten“ der Nachhaltigkeitskommunikation<br />
bzw. auch der <strong>BNE</strong>; es wird kaum noch als zeitgemäß angesehen,<br />
im Sinne einer „Katastrophenpädagogik“ nur mit Schreckensszenarien<br />
zu arbeiten.<br />
30
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
2.3.4 Konzept Nachhaltigkeit der Enquete-Kommission<br />
des 13. Deutschen Bundestages (1998)<br />
Die Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt –<br />
Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen<br />
Entwicklung“ wurde am 1.6.1995 vom 13. Deutschen Bundestag eingesetzt.<br />
Die Kommission legte 1998 ihren Abschlussbericht „Konzept<br />
Nachhaltigkeit“ vor (DEUTSCHER BUNDESTAG 1998).<br />
Mit ihrem Abschlussbericht erhebt die Kommission den Anspruch, einen<br />
gangbaren Weg zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsidee aufzuzeigen.<br />
Dazu werden Ziele, Instrumente und Maßnahmen sowie<br />
Verantwortliche benannt (ebd., S. 5). Damit zeigt die Kommission exemplarisch<br />
den notwendigen Weg zur Aufstellung der gesamtgesellschaftlichen<br />
Nachhaltigkeitskonzepte auf; im Kap. 3 vertieft sie ihre<br />
Vorstellungen zu einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.<br />
Das Leitbild einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung wird<br />
hier weiter gefasst als von der Enquete-Kommission des 12. Deutschen<br />
Bundestages (welche sich einem nachhaltigen Umgang mit Stoff- und<br />
Materialströmen gewidmet hatte) und vom SRU (welcher dezidiert von<br />
einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung sprach und spricht). Die<br />
Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des 13.<br />
Deutschen Bundestages integrierte durchgängig die drei Säulen Ökologie,<br />
Ökonomie und Soziales und schuf damit die Grundlage dafür, dass<br />
das „Nachhaltigkeitsdreieck“ eines der bekanntesten mentalen Modelle<br />
im Nachhaltigkeitdiskurs wurde (siehe Abb. 2 im Kap. 2.4).<br />
Die Kommission formuliert u.a. Managementregeln als strategische<br />
Handlungsprinzipien in diesen Dimensionen, und nur dieser Teil des<br />
Konzepts soll hier ausführlicher wiedergegeben werden (siehe Kasten)<br />
6 .<br />
Drei-Säulen-Konzept<br />
Managementregeln<br />
Den umfangreichsten Teil des Konzeptes bilden die exemplarischen<br />
Untersuchungen in den drei Handlungsfeldern Bodenversauerung, Informations-<br />
und Kommunikationstechnik sowie Bauen und Wohnen.<br />
Zu jedem Handlungsfeld werden Hintergründe beschrieben, Leitbilder<br />
und Ziele dargestellt, eine Status- und Trendanalyse durchgeführt sowie<br />
Ziele, Strategien und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Dabei werden<br />
stets die ökologische, die ökonomische und die soziale Dimension<br />
berücksichtigt.<br />
6. Erste – damals noch alleine auf die Stoffstromwirtschaft bezogene – Managementregeln<br />
wurden bereits im Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und<br />
der Umwelt“ (DEUTSCHER BUNDESTAG 1994) formuliert. Der SRU (1994, S.10)<br />
formulierte das Vorsorgegebot, das im Kasten „Managementregeln...“ in der<br />
Ökologischen Dimension als Nr. 5 angeführt ist.<br />
31
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
Zudem befasst sich der Bericht mit dem Innovationsaspekt einer nachhaltigen<br />
Entwicklung.<br />
Managementregeln der Enquete-Kommission des 13. Deutschen<br />
Bundestages (DEUTSCHER BUNDESTAG 1998)<br />
Managementregeln für die ökologische Dimension (ebd., S. 46)<br />
1. „Die Abbaurate erneuerbarer Ressourcen soll deren<br />
Regenerationsrate nicht überschreiten. Dies entspricht der<br />
Forderung nach Aufrechterhaltung der ökologischen Leistungsfähigkeit,<br />
d.h. (mindestens) nach Erhaltung des von<br />
den Funktionen her definierten ökologischen Realkapitals.<br />
2. Nicht-erneuerbare Ressourcen sollen nur in dem Umfang<br />
genutzt werden, in dem ein physisch und funktionell<br />
gleichwertiger Ersatz in Form erneuerbarer Ressourcen<br />
oder höherer Produktivität der erneuerbaren sowie der<br />
nicht erneuerbaren Ressourcen geschaffen wird.<br />
3. Stoffeinträge in die Umwelt sollen sich an der Belastbarkeit<br />
der Umweltmedien orientieren, wobei alle Funktionen<br />
zu berücksichtigen sind, nicht zuletzt auch die „stille“<br />
und empfindlichere Regelungsfunktion.<br />
4. Das Zeitmaß anthropogener Einträge bzw. Eingriffe in die<br />
Umwelt soll in einem ausgewogenen Verhältnis zum Zeitmaß<br />
der für das Reaktionsvermögen der Umwelt relevanten<br />
natürlichen Prozesse stehen.<br />
5. Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschliche<br />
Gesundheit und die Umwelt durch anthropogene Einwirkungen<br />
sind zu vermeiden.“<br />
Managementregeln für die ökonomische Dimension (ebd., S. 48)<br />
1. „Das ökonomische System soll individuelle und gesellschaftliche<br />
Bedürfnisse effizient befriedigen. Dafür ist die<br />
Wirtschaftsordnung so zu gestalten, daß sie die persönliche<br />
Initiative fördert (Eigenverantwortung) und das<br />
Eigeninteresse in den Dienst des Gemeinwohls stellt<br />
(Regelverantwortung), um das Wohlergehen der derzeitigen<br />
und der künftigen Bevölkerung zu sichern. Es soll so<br />
organisiert werden, dass es auch gleichzeitig die übergeordneten<br />
Interessen wahrt.<br />
32
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
2. Preise müssen dauerhaft die wesentliche Lenkungsfunktion<br />
auf Märkten wahrnehmen. Sie sollen dazu weitestgehend<br />
die Knappheit der Ressourcen, Senken,<br />
Produktionsfaktoren, Güter und Dienstleistungen wiedergeben.<br />
3. Die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs sind so zu<br />
gestalten, daß funktionsfähige Märkte entstehen und aufrechterhalten<br />
bleiben, Innovationen angeregt werden,<br />
dass langfristige Orientierung sich lohnt und der gesellschaftliche<br />
Wandel, der zur Anpassung an zukünftige<br />
Erfordernisse nötig ist, gefördert wird.<br />
4. Die ökonomische Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft<br />
und ihr Produktiv-, Sozial- und Humankapital müssen im<br />
Zeitablauf zumindest erhalten werden. Sie sollten nicht<br />
bloß quantitativ vermehrt, sondern vor allem qualitativ<br />
ständig verbessert werden.“<br />
Managementregeln für die soziale Dimension (ebd., S. 51f)<br />
1. „Der soziale Rechtsstaat soll die Menschenwürde und die<br />
freie Entfaltung der Persönlichkeit sowie Entfaltungschancen<br />
für heutige und zukünftige Generationen<br />
gewährleisten, um auf diese Weise den sozialen Frieden<br />
zu bewahren.<br />
2.a. Jedes Mitglied der Gesellschaft erhält Leistungen von der<br />
solidarischen Gesellschaft:<br />
1. entsprechend geleisteter Beiträge für die sozialen<br />
Sicherungssysteme,<br />
2. entsprechend Bedürftigkeit, wenn keine Ansprüche<br />
an die solidarischen Sicherungssysteme bestehen.<br />
2.b. Jedes Mitglied der Gesellschaft muß entsprechend seiner<br />
Leistungsfähigkeit einen solidarischen Beitrag für die<br />
Gesellschaft leisten.<br />
3. Die sozialen Sicherungssysteme können nur in dem<br />
Umfang wachsen, wie sie auf ein gestiegenes wirtschaftliches<br />
Leistungspotential zurückgehen.<br />
4. Das in der Gesellschaft insgesamt und auch in den einzelnen<br />
Gliederungen vorhandene Leistungspotential soll für<br />
künftige Generationen zumindest erhalten werden.“<br />
33
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
2.3.5 Nationale Nachhaltigkeitsstrategie (2002)<br />
Grundlage für<br />
Regierungshandeln<br />
Entstehungsgeschichte<br />
Nach den bisher skizzierten Diskussionsbeiträgen von beratenden wissenschaftlichen<br />
bzw. politischen Gremien muss das Leitbild der Nachhaltigkeit<br />
letztlich (auch) in Regierungshandeln münden. Bereits auf<br />
der Konferenz von Rio wurde die Umsetzung der Agenda 21 in erster<br />
Linie als Aufgabe der Regierungen angesehen. Als eine „entscheidende<br />
Voraussetzung“ dafür wurden „politische Konzepte, Pläne, Leitsätze<br />
und Prozesse auf nationaler Ebene“ angesehen (BUNDESUMWELTMINI-<br />
STERIUM 1992, S.9). Per Beschluss der UN-Sondervollversammlung<br />
von 1997 wurden die Unterzeichnerstaaten aufgefordert, ihre nationalen<br />
Nachhaltigkeitsstrategien spätestens 2002 fertig zu stellen.<br />
Erste Schritte zur Erarbeitung einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie<br />
wurden seit 1996 unter der damaligen Bundesumweltministerin Merkel<br />
unternommen. 1998 legte das Bundesumweltministerium ein umweltpolitisches<br />
Schwerpunktprogramm vor, das die Themenschwerpunkte<br />
Schutz der Erdatmosphäre, Schutz des Naturhaushalts, Ressourcenschonung,<br />
Schutz der menschlichen Gesundheit, umweltschonende<br />
Mobilität und Verankerung einer Umweltethik enthält. Es wurde allerdings<br />
vom Bundeskabinett nicht verabschiedet. (BUNDESUMWELTMINI-<br />
STERIUM 1998, zur Diskussion dazu siehe SRU 2000, S. 99-105 und<br />
SRU 2002, S. 147-169).<br />
Die Rot-Grüne Koalition nahm die Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie<br />
in ihre Koalitionsvereinbarung auf. Im Jahr 2000 richtete sie<br />
einen Staatssekretärsausschuss für Nachhaltige Entwicklung sowie einen<br />
Rat für Nachhaltige Entwicklung ein. Ende 2001 legte der Staatssekretärsausschuss<br />
den Entwurf einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie<br />
vor. Die Bundesregierung verabschiedete dann die nationale Nachhaltigkeitsstrategie<br />
unter dem Titel „Perspektiven für Deutschland“ im<br />
Jahr 2002. Obwohl die Bundesrepublik 1971 mit ihrem ersten Umweltprogramm<br />
noch eine Rolle als Vorreiter im internationalen Maßstab innehatte,<br />
gehörte sie damit zu den letzten Staaten, die eine<br />
Nachhaltigkeitsstrategie aufstellten (SRU 2000, S.21 und 89ff sowie<br />
SRU 2002, S. 28ff und 162ff).<br />
Gliederung der<br />
Strategie<br />
Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie enthält sieben Kapitel:<br />
A) Von der Idee zur Strategie<br />
B) Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung: Hier wird das<br />
Leitbild entlang der Themenfelder Generationengerechtigkeit,<br />
Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und Internationale<br />
Verantwortung ausgebreitet. Damit rückt die<br />
Bundesregierung von dem Drei-Säulen-Modell (siehe<br />
oben), ab und bringt ein integratives Konzept zum Tragen.<br />
34
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
Hier werden auch Managementregeln aufgestellt, die Leitlinien<br />
für eine gute Praxis im Bezug zu den Themenfeldern<br />
beschreiben (siehe unten).<br />
C) Strategie als gesellschaftlicher Prozess<br />
D) Indikatoren und Ziele: Hier werden die Themenfelder mit<br />
Indikatoren und Zielen operationalisiert.<br />
E) Schwerpunkte einer nachhaltigen Entwicklung: Hier werden<br />
ausführlicher sieben Schwerpunkte der Politik der Bundesregierung<br />
beschrieben. Sie werden teilweise mit konkreten<br />
Pilotprojekten gefördert, so der Schwerpunkte „Energie effizient<br />
nutzen – Klima wirksam schützen“ durch das Pilotprojekt<br />
„Erneuerbare Energien und Effiziente Energienutzung<br />
in Brennstoffzellen“.<br />
F) Global Verantwortung übernehmen: Dieses Kapitel kann als<br />
achter Schwerpunkt angesehen werden.<br />
G) Erfolgskontrolle und Weiterentwicklung der Strategie<br />
Nationale Nachhaltigkeitsstrategie (DIE BUNDESREGIERUNG 2002,<br />
S. 50ff): „Managementregeln der Nachhaltigkeit“<br />
Grundregel<br />
Jede Generation muss ihre Aufgaben selbst lösen und darf sie nicht<br />
den kommenden Generationen aufbürden. Sie muss zugleich Vorsorge<br />
für absehbare zukünftige Belastungen treffen. Das gilt für die Erhaltung<br />
der natürlichen Lebensgrundlagen, für die wirtschaftliche<br />
Entwicklung sowie den sozialen Zusammenhalt und den demographischen<br />
Wandel.<br />
Akteure<br />
1. Bürgerinnen und Bürger, Produzenten und Verbraucher,<br />
Wirtschaft und Gewerkschaften, Wissenschaft, Kirchen<br />
und Verbände sind mit dem Staat wichtige Akteure der<br />
nachhaltigen Entwicklung. Sie sollten sich am öffentlichen<br />
Dialog über das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung<br />
beteiligen und sich eigenverantwortlich in ihren<br />
Entscheidungen und Maßnahmen an diesen Zielen orientieren.<br />
35
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
2. Die Unternehmen tragen für ihre Produkte die Verantwortung.<br />
Dazu gehört die Information der Verbraucher über<br />
gesundheits- und umweltrelevante Eigenschaften der Produkte<br />
sowie über nachhaltige Produktionsweisen. Der<br />
Verbraucher trägt die Verantwortung für die Auswahl des<br />
Produkts sowie dessen sozial und ökologisch verträgliche<br />
Nutzung.<br />
Handlungsbereiche<br />
3. Erneuerbare Naturgüter (wie z.B. Holz oder Fischbestände)<br />
dürfen auf Dauer nur im Rahmen ihrer Fähigkeit<br />
zur Regeneration genutzt werden. Nicht erneuerbare<br />
Naturgüter (wie z.B. Mineralien oder fossile Energieträger)<br />
dürfen auf Dauer nur in dem Umfang genutzt werden,<br />
wie ihre Funktionen durch andere Materialien oder<br />
durch andere Energieträger ersetzt werden können. Die<br />
Freisetzung von Stoffen oder Energie darf auf Dauer nicht<br />
größer sein als die Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme<br />
– z.B. des Klimas, der Wälder und der Ozeane.<br />
4. Gefahren und unvermeidliche Risiken für die menschliche<br />
Gesundheit sind zu vermeiden.<br />
5. Der durch technische Entwicklungen und den internationalen<br />
Wettbewerb ausgelöste Strukturwandel soll wirtschaftlich<br />
erfolgreich sowie ökologisch und sozial<br />
verträglich gestaltet werden. Zu diesem Zweck sind die<br />
Politikfelder so zu integrieren, dass wirtschaftliches<br />
Wachstum, hohe Beschäftigung, sozialer Zusammenhalt<br />
und Umweltschutz Hand in Hand gehen.<br />
6. Energie- und Ressourcenverbrauch sowie die Verkehrsleistung<br />
müssen vom Wirtschaftswachstum entkoppelt werden.<br />
Zugleich ist anzustreben, dass der<br />
wachstumsbedingte Anstieg der Nachfrage nach Energie,<br />
Ressourcen und Verkehrsleistungen durch Effizienzgewinne<br />
mehr als kompensiert wird.<br />
7. Auch die öffentlichen Haushalte sind der Generationengerechtigkeit<br />
verpflichtet. Bund, Länder und Kommunen<br />
sollen möglichst bald ausgeglichene Haushalte aufstellen<br />
und in einem weiteren Schritt kontinuierlich den Schuldenstand<br />
abbauen.<br />
36
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
8. Eine nachhaltige Landwirtschaft muss natur- und umweltverträglich<br />
sein und die Anforderungen an eine artgerechte<br />
Tierhaltung und den vorsorgenden, insbesondere<br />
gesundheitlichen Verbraucherschutz beachten.<br />
9. Um den sozialen Zusammenhalt zu stärken, sollen<br />
• Armut und sozialer Ausgrenzung soweit wie möglich<br />
vorgebeugt,<br />
• allen Bevölkerungsschichten Chancen eröffnet werden,<br />
sich an der wirtschaftlichen Entwicklung zu<br />
beteiligen<br />
• alle am gesellschaftlichen und politischen Leben teilhaben.<br />
10. Die internationalen Rahmenbedingungen sind so zu<br />
gestalten, dass die Menschen in allen Ländern ein menschenwürdiges<br />
Leben nach ihren eigenen Vorstellungen<br />
führen und an den wirtschaftlichen Entwicklungen teilhaben<br />
können. Umwelt und Entwicklung bilden eine Einheit.<br />
In einem integrierten Ansatz soll die Bekämpfung<br />
der Armut<br />
• mit der Achtung der Menschenrechte,<br />
• mit wirtschaftlicher Entwicklung, Schutz der Umwelt<br />
sowie<br />
• verantwortlichem Regierungshandeln verknüpft werden.“<br />
37
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
Tabelle 1: Themenfelder und Schlüsselindikatoren der Nationalen<br />
Nachhaltigkeitsstrategie (DIE BUNDESREGIERUNG 2002)<br />
Generationengerechtigkeit Lebensqualität<br />
1. Ressourcenschonung (Energie-1und Rohstoffproduktivität)<br />
Wirtschaftlicher Wohlstand (Bruttoinlandsprodukt<br />
je Einwohner)<br />
2. Mobilität (Transportintensität – Verkehrsleistung je<br />
2. Klimaschutz (Emission der<br />
1000 € BIP sowie Anteil des Schienenverkehrs an<br />
sechs Treibhausgase des Kyotoprotokoll)<br />
der Güterverkehrsleistung)<br />
3. Ernährung (Anteil der Fläche des ökologischen<br />
3. erneuerbare Energien (Anteil Landbaus, Stickstoff-Überschuss)<br />
erneuerbarer Energien am Ener-4gieverbrauch) Luftqualität (Schadstoffbelastungsindex aus SO 2 ,<br />
NO x , VOC und NH 3 )<br />
5. Gesundheit (vorzeitige Sterblichkeit vor einem Alter<br />
4. Flächeninanspruchnahme<br />
von 65 Jahren)<br />
(Zunahme der Siedlungs- und<br />
6. Kriminalität (Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle)<br />
Verkehrsfläche)<br />
5. Artenvielfalt (Entwicklung derSozialer Zusammenhalt<br />
Bestände ausgewählter Tierarten)<br />
1. Beschäftigung (Erwerbstätigenquote)<br />
2. Perspektiven für Familien (Ganztagsbetreuungsangebote<br />
in den alten Ländern)<br />
6. Staatsverschuldung (Staatsdefizit<br />
von Bund, Ländern, Kommunen<br />
und<br />
3. Gleichberechtigung (Verhältnis der Bruttoverdienste<br />
Frauen-Männer)<br />
Sozialversicherungssystemen)<br />
4. Integration ausländischer Mitbürger (Anteil ausländischer<br />
7. Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge<br />
Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss)<br />
(Verhältnis Bruttoanlagen-Internationalinvestition zum<br />
Verantwortung<br />
Bruttoinlandprodukt) 1. Entwicklungszusammenarbeit (Anteil der öffentli-<br />
8. Innovation (Private und öffentliche<br />
Ausgaben für Forschung und<br />
Bildung)<br />
9. Bildung(Ausbildungsabschlüsse<br />
der 25jährigen sowie Studienanfängerquote)<br />
chen Entwicklungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen)<br />
2. Marktöffnung (Einfuhren der EU aus Entwicklungsländern)<br />
Eine kritische Würdigung legte der SRU (2002, S. 162-169) vor:<br />
Stärken • Die Nachhaltigkeits-Strategie ist institutionell sinnvoll verankert.<br />
Die Verantwortung liegt beim Kabinett und dem<br />
Kanzleramt; der Staatssekretärsausschuss bildet eine sinnvolle<br />
Arbeitsebene. Es gibt grundsätzliche Verfahrensvorgaben.<br />
Der Rat für Nachhaltigkeit wirkt beratend mit.<br />
38
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
• In den umweltpolitischen Aspekten werden die zentralen<br />
Verursachungsbereiche Energie, Verkehr, Landwirtschaft,<br />
Bau- und Siedlungswesen angesprochen.<br />
• Die hier angeführten Managementregeln gehen im Umweltbereich<br />
noch über die der Enquete-Kommission „Schutz des<br />
Menschen und der Umwelt“ hinaus.<br />
• Einige wichtige Ziele wurden quantifiziert und mit Fristen<br />
versehen, so dass überprüft werden kann, ob sie erreicht<br />
werden.<br />
• Mit der Definition nachhaltiger Entwicklung als „eine wirtschaftlich<br />
leistungsfähige, sozial gerechte und ökologisch<br />
verträgliche Entwicklung“ (DIE BUNDESREGIERUNG 2002,<br />
S. 1) bewegt sich die Bundesregierung an der Grenze zur<br />
Hyperkomplexität und zur Auflösung des Nachhaltigkeitsbegriffs.<br />
• Ziele und Indikatoren werden durcheinander gebracht bzw.<br />
gleichgesetzt, d.h. es werden eher willkürlich gesetzte Teilziele,<br />
die zudem teilweise nicht hinreichend repräsentativ<br />
sind, als Indikatoren verwendet. So sollen Fortschritte beim<br />
Artenschutz an der Entwicklung der Bestände von 10 Vogelarten<br />
sowie des Seehundes gemessen werden. Das könnte<br />
eine Symbolpolitik befördern, bei der speziell diese Arten<br />
geschützt und andere wesentliche Aspekte wie den Schutz<br />
der Vielfalt an Lebensräumen vernachlässigt werden. Generell<br />
lassen die Indikatoren ein „unangemessen positives Bild<br />
der Entwicklung“ zu, z.B. der Indikator Schadstoffbelastung<br />
der Luft. Es sollten auch Indikatoren einbezogen werden,<br />
die problematischere Entwicklungen abbilden, so den Pestizideinsatz<br />
in der Landwirtschaft.<br />
• Themenzuschnitt und Schlüsselindikatoren sind nicht<br />
immer schlüssig. Ein Thema wie die Kriminalitätsbekämpfung<br />
(gemessen an der Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle<br />
und eingeordnet unter Lebensqualität) mag zwar<br />
gesellschaftlich relevant sein, seine Bedeutung für Nachhaltigkeit<br />
ist aber fragwürdig.<br />
• Beim Klimaschutz hatte der Nachhaltigkeitsrat vorgeschlagen,<br />
zusätzlich bis 2020 eine Reduktion des Kohlendioxidemission<br />
um 40% gegenüber 1990 aufzunehmen, das ist aber<br />
nicht erfolgt.<br />
• Es fehlen weitgehend Ziele für den Umweltzustand, z.B. für<br />
den Zustand des Grundwassers.<br />
Schwächen:<br />
39
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
• In den acht Handlungsfeldern wird vor allem die aktuelle<br />
Politik der Bundesregierung abgebildet; in langfristigen<br />
Strategien bleibt das Papier eher vage.<br />
Überprüfung der<br />
Strategie<br />
Indikatorenberichte<br />
Fortschrittsberichte<br />
Die Bundesregierung will nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die<br />
Strategie selbst regelmäßig überprüfen. Dazu werden Indikatorenberichte<br />
und Fortschrittsberichte vorgelegt. (DIE BUNDESREGIERUNG<br />
2002, S. 326ff, BUNDESUMWELTMINISTERIUM 2010)<br />
Die Indikatorenberichte werden vom Statistischen Bundesamt herausgegeben.<br />
In der klaren Sprache der Statistiker wird hier für jeden der 21<br />
Indikatoren dargestellt, wie sich die Situation in den vergangenen Jahren<br />
(meist seit 1990) entwickelt hat, welcher Stand aktuell erreicht ist<br />
und welcher Zielwert (in der Regel für das Jahr 2020) angestrebt wird.<br />
Die Daten werden analysiert; mit politischen Bewertungen hält sich das<br />
Statistische Bundesamt zurück. Bislang wurden drei Indikatorenberichte<br />
zur nachhaltigen Entwicklung in Deutschland veröffentlicht (STATI-<br />
STISCHES BUNDESAMT 2007, 2008, 2010).<br />
In den Fortschrittsberichten soll nicht die Datenbasis aktualisiert, sondern<br />
vor allem die Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickelt werden.<br />
Bislang sind erschienen:<br />
• Fortschrittsbericht "Perspektiven für Deutschland" (DIE<br />
BUNDESREGIERUNG 2004)<br />
• "Wegweiser Nachhaltigkeit" (DIE BUNDESREGIERUNG<br />
2005)<br />
• Fortschrittsbericht "Für ein nachhaltiges Deutschland" (DIE<br />
BUNDESREGIERUNG 2008)<br />
Der nächste Bericht ist für Frühjahr 2012 geplant. Unter www.dialognachhaltigkeit.de/<br />
war die Bevölkerung im Zeitraum 20.6.-18.9.<strong>2011</strong><br />
zur Mitwirkung aufgerufen. Anfang August – zur Halbzeit der Dialogphase<br />
– hatten sich 1045 Teilnehmer registriert und insgesamt 233 Beiträge<br />
verfasst. Obwohl Dialog Nachhaltigkeit im Internet sehr gut<br />
sichtbar ist (u.a. Dank der Verlinkung von prominenten Seiten der Bundesregierung),<br />
hat die Website nur wenige Besucher und ist in den sozialen<br />
Medien kaum präsent. 7 Der Nachhaltigkeitsdialog bleibt damit<br />
weitgehend eine Angelegenheit von Insidern, was auch bereits vom<br />
SRU (2002, S. 162-169) kritisiert worden war.<br />
7. Eigene Recherche mit www.seitwert.de, 2.8.<strong>2011</strong>; die Angaben zu den Besucherzahlen<br />
bezieht seitwert vom Online-Dienst Alexa, es handelt sich dabei nicht um absolute<br />
Angaben, sondern lediglich um Hochrechnungen, die anhand des Surfverhaltens der User<br />
ermittelt werden, die die Alexa Toolbar in ihrem Browser installiert haben.<br />
40
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
2.3.6 Indikatorenberichte der Bundesregierung und<br />
Zukunftsfähiges Deutschland II<br />
Die beiden ersten Indikatoren der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie<br />
zielen auf den Ressourcenschutz: Die Energieproduktivität und die Ressourcenproduktivität<br />
8 sollen sich gegenüber den Ausgangspunkten<br />
(1990 bzw. 1994) bis zum Jahr 2020 verdoppeln. Die Statistik weist<br />
aus, dass beide Parameter bereits um ca. 40% gesteigert werden konnten<br />
(STATISTISCHES BUNDESAMT 2010, S. 4-7, vgl. Abb. 1). Dennoch<br />
sind wir von dem angestrebten Ziel noch weit entfernt; die Bemühungen<br />
– insbesondere der Bundesregierung – zur Zielerreichung müssten<br />
verschärft werden. Noch kritischer wird der Blick, wenn man – wie es<br />
das Statistische Bundesamt dankenswerter Weise macht – ergänzend<br />
die absoluten Zahlen mit in den Blick nimmt. Dabei wird deutlich, dass<br />
Wirtschafts- und Wohlstandswachstum die Effizienzgewinne weitgehend<br />
auffressen; der absolute Energieverbrauch sowie die Rohstoffentnahme<br />
bzw. die Rohstoffimporte haben sich im jeweils betrachteten<br />
Zeitraum nur um ca. 10% verringert, und ein erheblicher Teil dieser Reduzierung<br />
entfällt, durch die Wirtschaftskrise bedingt, auf das Jahr 2009<br />
(vgl. auch nachfolgend Tab. 2).<br />
Anhand des Indikatorenberichts 2010 sowie der 2008 vorgelegten Studie<br />
„Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt“ (BROT<br />
FÜR DIE WELT/EED/BUND 2008) soll versucht werden, das zuvor reichlich<br />
abstrakt dargebotene Thema Operationalisierung besser zu veranschaulichen.<br />
Ressourcenproduktivität<br />
8. Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt) je Einheit Energieverbrauch bzw.<br />
Ressourcenverbrauch (abiotisches Primärmaterial)<br />
41
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
Abb. 1:<br />
Rohstoffproduktivität und Wirtschaftswachstum in Deutschland (STA-<br />
TISTISCHES BUNDESAMT 2010, S. 8)<br />
Klimaschutz<br />
Erneuerbare Energien<br />
Beim Klimaschutz hat Deutschland das für 2010 aufgestellte Ziel – eine<br />
Reduktion der Treibhausgasemission (sechs Gase des Kyoto-Protokolls,<br />
gemessen in CO2-Äquivalenten) auf 79% des Standes von 1990 –<br />
bereits im Jahr 2007 erreicht. Bis 2020 will die Bundesregierung die<br />
Emissionen auf 60% reduzieren. (ebd., S. 10-11) Es bleibt abzuwarten,<br />
wie sich der <strong>2011</strong> beschlossene Atomausstieg auswirken wird; wenn<br />
Atomkraftwerke in großem Stil durch Kohlekraftwerke ersetzt werden,<br />
läuft das den Klimaschutzzielen entgegen. Auch der Verkehrsbereich –<br />
und zwar insbesondere der Güterverkehr und der gesamte Flugverkehr<br />
– entwickeln sich, klimapolitisch gesehen, in die falsche Richtung (vgl.<br />
STATISTISCHES BUNDESAMT 2010, S. 32-33 und BROT FÜR DIE WELT/<br />
EED/BUND 2008, S. 149-152 und 175-181).<br />
Erfreulich ist die Entwicklung bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien,<br />
welcher als Vorzeigeprojekt der Bundesregierung gelten kann. Im<br />
Jahr 2009 wurden 8,9% des Primärenergieverbrauchs und 16,1% des<br />
42
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
Brutto-Stromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren Energien gewonnen.<br />
Damit wurden die Ziele der Bundesregierung deutlich übertroffen.<br />
(STATISTISCHES BUNDESAMT 2010, S. 12-13) Allerdings sind<br />
auch die erneuerbaren Energien nicht unproblematisch, es sei hierzu auf<br />
die Diskussionen zu Bioenergien („Tank oder Teller“) und auf die Notwendigkeit,<br />
die Stromnetze an die Erfordernisse eines sich verändernden<br />
Strommarktes anzupassen, verwiesen.<br />
Tabelle 2: Zukunftsfähigen Deutschland – Zwischenbilanz<br />
(BROT FÜR DIE WELT/EED/BUND 2008; S. 130-131, Auswahl)<br />
Umweltindikator Mittelfristiges UmweltzielLangfristiges<br />
(2010)*<br />
Umweltziel<br />
(2050)*<br />
Energie<br />
Primärenergieverbrauch mindestens – 30%<br />
mindestens – 50%<br />
fossile Brennstoffe<br />
– 25%<br />
– 80-90%<br />
Kernenergie<br />
– 100 %<br />
erneuerbare Energien + 3-5 % pro Jahr<br />
Energieproduktivität + 3-5 % pro Jahr<br />
Material<br />
nicht erneuerbare Rohstoffe – 25%<br />
Materialproduktivität + 4-6% pro Jahr<br />
Fläche<br />
Siedlungs- und Verkehrsflä-Absolutche Stabilisierung; keine Neubelegung<br />
Landwirtschaft<br />
flächendeckende Umstellung auf ökologischen<br />
Landbau, Regionalisierung der<br />
Nährstoffkreisläufe<br />
Emissionen / Stoffabgabe<br />
Kohlendioxid<br />
– 35%<br />
Schwefeldioxid<br />
– 80-90%<br />
Biozide in der Landwirt-schaft 100%<br />
*Die Ziele wurden 1995 aufgestellt, vgl. BUND/MISEREOR 1996<br />
Veränderung<br />
1995-2005<br />
+1,4%<br />
-3,7%<br />
+5,8%<br />
– 80-90% +5,1%<br />
– 80-90% -5,2%<br />
rund +10% pro Jahr<br />
rund +1,6% pro Jahr<br />
rund +0,8% pro Jahr<br />
Unverändert<br />
rund +10% pro Jahr<br />
-67,6%<br />
+2,8%<br />
Um kommenden Generationen noch einen finanziellen Handlungsspielraum<br />
zu sichern, ist es dringend erforderlich, das Staatsdefizit abzubauen.<br />
Als Messlatte dienen hierbei die „Maastrichtkriterien“, nach denen<br />
die Neuverschuldung der europäischen Staaten maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts<br />
ausmachen soll. 2009 wurde zudem die sogenannte<br />
„Schuldenbremse“ im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland<br />
verankert. Ab 2016 darf demnach der Bund nur noch maximal 0,35%<br />
des BIP an Krediten aufnehmen (bereinigte Nettokreditaufnahme).<br />
Staatsverschuldung<br />
Die Maastrichtkriterien hatte Deutschland 2002-2005 überschritten.<br />
2006 wurden sie wieder eingehalten, 2007 und 2008 war der Bundes-<br />
43
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
haushalt sogar fast ausgeglichen. Im Jahr 2009 erhöhte sich das Staatsdefizit<br />
dann wieder auf 3,1%. Das STATISTISCHE BUNDESAMT (2010, S.<br />
18-19) schätzt diese jüngste Entwicklung als sehr kritisch ein.<br />
Bildung<br />
Entwicklungen im Bildungssystem werden mit vier unterschiedlichen<br />
Indikatoren gemessen. Dabei hat sich die Bundesregierung im Themenfeld<br />
Generationengerechtigkeit drei Ziele gestellt:<br />
1. Der Anteil der jungen Erwachsenen, die im Alter von 25<br />
Jahren weder das Abitur erworben haben, noch sich in einer<br />
beruflichen Ausbildung befinden, ist zu verringern (Zielwert:<br />
9% im Jahr 2010 und 4,5% im Jahr 2020). Im Jahr<br />
2008 wurde ein Stand von 11,8% erreicht.<br />
2. Der Anteil der jungen Erwachsenen, die im Alter von 25<br />
Jahren bereits eine Hochschulausbildung abgeschlossen<br />
haben, ist zu steigern (Zielwerte: 10% im Jahr 2010 und<br />
20% im Jahr 2020). Im Jahr 2008 wurden 8,8% erreicht.<br />
3. Der Anteil der Jugendlichen, die ein Studium aufnehmen,<br />
soll erhöht werden (Zielwert: 40% jedes Jahrgangs im Jahr<br />
2010). Bei einem (vorläufigen) Wert von 39,8% im Jahr<br />
2009 ist dieses Ziel nahezu erreicht. Allerdings bleibt<br />
Deutschland damit weiterhin hinter anderen Ländern<br />
zurück; im Mittelwert der OECD-Länder betrug die Studienanfängerquote<br />
im Jahr 2007 56% (Australien 86%, Polen<br />
78%, Neuseeland 76%, Slowakei 74%, Island und Schweden<br />
73%, Finnland 71%).<br />
Der Trend aller drei Indikatoren verläuft im Wesentlichen positiv. Allerdings<br />
ist die Geschwindigkeit der Entwicklung beim erstgenannten<br />
Indikator deutlich zu gering. (STATISTISCHES BUNDESAMT 2007, S. 24-<br />
29)<br />
Zusätzlich wird im Themenfeld sozialer Zusammenhalt / Integration<br />
das Ziel verfolgt, den Anteil der ausländischen Schüler, die wenigstens<br />
einen Hauptschulabschluss erreichen, deutlich zu erhöhen; er soll bis<br />
zum Jahr 2020 auf dem Niveau liegen wie bei deutschen Schülern, also<br />
auch bei ca. 95%. Für die ausländischen Schüler hat sich dieser Wert<br />
von 1996 (80,3%) bis 2008 (85%) allmählich erhöht; die Entwicklung<br />
ist jedoch noch zu langsam. (STATISTISCHES BUNDESAMT 2010, S. 58-<br />
59)<br />
Diese vier Indikatoren lassen den Schluss zu, dass wir mit der Entwicklung<br />
des deutschen Bildungssystems an der Spitze (Abitur, Hochschule)<br />
erfolgreicher sind als am Ende (junge Menschen ohne Schulabschluss<br />
bzw. Berufsausbildung). Ein Fortschreiben dieser Entwicklung verschärft<br />
die Ungleichheit in der Gesellschaft.<br />
44
2.3 Resonanz der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland<br />
Von den bereits getroffenen Einschätzungen zur Tauglichkeit der Indikatoren<br />
einmal abgesehen, zeigt der Indikatorenbericht einige begrüßenswerte<br />
Erfolge, aber auch viele Defizite der nachhaltigen<br />
Entwicklung in Deutschland. Es gibt erfolgreiche Vorzeigeprojekte,<br />
aber die breite Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in der Tagespolitik,<br />
zumal in der für das Bildungssystem relevanten föderalen Struktur<br />
der Bundesrepublik, ist problematisch.<br />
Fazit<br />
Exkurs: Zum Einsatz von Indikatoren<br />
Die Frage, wie Nachhaltigkeit operationalisiert werden kann, mit<br />
welchen Indikatoren der Zustand einer Gesellschaft oder einer Bildungsmaßnahme<br />
in Hinblick auf Nachhaltigkeit beurteilt werden<br />
kann, ist einer der roten Fäden, die sich durch alle drei Hauptkapitel<br />
dieses <strong>Lehrbrief</strong>s ziehen. Dem sollen – in Anlehnung an SIEMER/<br />
RAMMEL/ELMER (2006) – wenigstens einige kritische Gedanken entgegengestellt<br />
werden.<br />
• Indikatoren sind kein Selbstzweck, sondern nur ein Hilfsmittel.<br />
Der Aufwand für die Kontrollebene sollte gegenüber<br />
dem Aufwand für die eigentlich relevante operative<br />
Arbeit – Nachhaltigkeit entwickeln, innovativ sein, lebendige<br />
kreative menschliche Bildungsprozesse gestalten –<br />
nicht in den Vordergrund treten.<br />
• Indikatoren dienen dazu, nicht direkt beobachtbare Phänomene<br />
zu erfassen. Zu diesem Zweck kann es erforderlich<br />
sein, viele Informationen zu sammeln und zu<br />
verarbeiten. Man bewegt sich damit im Spannungsfeld<br />
zwischen Komplexität (möglichst alle relevanten Phänomene<br />
möglichst präzise abbilden) und Praktikabilität<br />
(z.B. Ergebnisse so einfach gestalten, dass sie in der<br />
Gesellschaft kommuniziert werden können).<br />
• Hinter der Arbeit mit Indikatoren steht die Hoffnung, eine<br />
nachhaltige Entwicklung gezielt steuern zu können. Es ist<br />
nicht belegt, dass Indikatoren ein wirkungsvolles Instrument<br />
dazu sind, d.h. dass die Kenntnis vom Ernst der<br />
Lage zu Verbesserungen führt.<br />
• Daten entstehen (bzw. sind vorhanden) vor allem dort, wo<br />
Probleme erkannt sind. Es besteht damit die Gefahr, dass<br />
Indikatoren weniger auf neue zukunftsrelevante Probleme<br />
aufmerksam machen, sondern vielmehr bestehende Strukturen<br />
konservieren.<br />
45
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
• Über die Indikatorenauswahl können Themen oder Handlungsfelder<br />
auch ausgeblendet und letztlich ausgeschlossen<br />
werden, z.B. vom Diskurs oder von<br />
Finanzzuweisungen. (ebd., S. 19-22)<br />
Nichtsdestoweniger: In jedem (brauchbaren) Indikator stecken Vorstellungen<br />
über die Bewertung – und damit Werte. Wer Indikatoren<br />
aufstellt, muss sich (in der Regel im Team) seiner Werte versichern<br />
bzw. Werte erarbeiten – und das kann für die Umweltbildung oder<br />
<strong>BNE</strong> hoch spannend sein.<br />
2.4 Zentrale Merkmale der Nachhaltigkeitsidee<br />
Wenngleich sich die Kapitel 2.2 und 2.3 vordergründig an einer Chronologie<br />
und an den verschiedenen politischen Ebenen (international –<br />
national) orientierten, wurden dort bereits verschiedene Aspekte der<br />
Nachhaltigkeitsidee vorgestellt. Hier sollen nun wesentliche Aspekte<br />
dieser Idee noch einmal systematisiert und auch kritisch hinterfragt<br />
werden (die LeserInnen mögen diesen akademische Diskurs immer<br />
auch im Spiegel der Zwischenbilanzen der Kapitel 2.3.6 und 2.5 sehen).<br />
In der Struktur sowie in einigen wesentlichen Argumentationslinien orientiere<br />
ich mich dabei an FISCHER (1997, S. 27ff und 2000). Er bezeichnet<br />
die hier angesprochenen Merkmale als „Kristallisationspunkte, die<br />
gemeinsam zur Nachhaltigkeitsidee verschmelzen“ (FISCHER 2000).<br />
Inter- und<br />
intragenerationelle<br />
Gerechtigkeit<br />
Die bereits zitierte Nachhaltigkeits-Definition des Brundtlandberichtes<br />
zielt, wie auch die Agenda 21, unmittelbar auf Gerechtigkeit zwischen<br />
heutigen und künftigen Generationen (intergenerationelle Gerechtigkeit).<br />
In beiden Dokumenten wird jedoch auf einer zweiten Ebene auch<br />
Gerechtigkeit zwischen den heute lebenden Menschen (intragenerationelle<br />
Gerechtigkeit) eingefordert, und zwar sowohl in der globalen Dimension<br />
(Norden – Süden, entwickelte Länder – Entwicklungsländer)<br />
als auch innerhalb jeder Gesellschaft (dort z.B. zwischen Arm und<br />
Reich sowie zwischen den Geschlechtern).<br />
Gerechtigkeit ist dabei einerseits ein Ziel einer nachhaltigen Entwicklung,<br />
andererseits auch deren Voraussetzung, denn die ungerechte Verteilung<br />
des Zugangs zu knappen Ressourcen (z.B. Boden, Trinkwasser)<br />
ist auch die Ursache von nicht nachhaltigen Entwicklungen: von gesellschaftlichen<br />
und sozialen Konflikten oder einer verschärften Ausbeutung<br />
der Umwelt (GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2006, S. 30).<br />
So plausibel und unterstützenswert die Forderung nach Gerechtigkeit<br />
auch ist, so schwierig ist die für politisches Handeln notwendige Operationalisierung.<br />
Was kann überhaupt unter Gerechtigkeit verstanden<br />
46
2.4 Zentrale Merkmale der Nachhaltigkeitsidee<br />
werden, welcher der oben genannten Ebenen bzw. Dimensionen ist welches<br />
Gewicht beizumessen und wie können geeignete Maßstäbe entwickelt<br />
werden?<br />
FISCHER (1997, S. 39ff) weist darauf hin, dass in der Agenda 21 und im<br />
Nachhaltigkeitsdiskurs überwiegend Verteilungsgerechtigkeit gefordert<br />
werde. Das sehen auch OTT/DÖRING (2008, S.59ff) so, sie stellen<br />
hierfür einen anspruchsvollen absoluten Standard in Verbindung mit einem<br />
komparativen Standard vor (vgl. Exkurs: Die Theorie der starken<br />
Nachhaltigkeit).<br />
In der Frage nach der Bezugsebene verweist FISCHER (1997, S. 39ff)<br />
darauf, dass in den letzten 300 Jahren nahezu jede Generation insgesamt<br />
bessere Lebensbedingungen angetroffen hat bzw. sich schaffen konnte<br />
als die Generation ihrer Eltern. Dazu gehören nicht nur der Lebensstandard,<br />
sondern auch der Stand von Wissenschaft und Technik und damit<br />
die Möglichkeiten, die begrenzten Ressourcen zu nutzen. Er plädiert daher<br />
für einen Gegenwartsbezug, d.h. die Konzentration auf die intragenerationelle<br />
Gerechtigkeit. BUND/MISEREOR (1995, S.7) hingegen<br />
halten beide Bezugsebenen für gleichermaßen relevant, sie konzentrieren<br />
sich dabei auf die globale Dimension, also die weltweit gerechte<br />
Verteilung der verfügbaren Ressourcen (des Umweltraumes). DIE BUN-<br />
DESREGIERUNG (2002) spricht in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie alle<br />
oben genannten Bezugsebenen an. Als Beitrag zur Generationengerechtigkeit<br />
versteht sie u.a. die Ressourcenschonung, den Schutz der Artenvielfalt,<br />
den Abbau der Staatsverschuldung und die Bildung. Mit Blick<br />
auf die heutige Generation sollen die Lebensqualität gesteigert (u.a.<br />
durch wirtschaftlichen Wohlstand und Gesundheit) und der soziale Zusammenhalt<br />
in der Gesellschaft gefördert werden (u.a. mit Aspekten<br />
wie Beschäftigung, Gleichberechtigung und Integration ausländischer<br />
Mitbürger). Zudem will die Bundesregierung auch global Verantwortung<br />
übernehmen, z.B. für die Bekämpfung der Armut oder den weltweiten<br />
Umweltschutz.<br />
Die HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG (2002, S. 20) verweist dezidiert darauf,<br />
dass die in der Gerechtigkeitsfrage weithin gebräuchliche Unterscheidung<br />
zwischen „Nord“ und „Süd“ in die Irre führe: Die entscheidende<br />
Trennungslinie in dieser Welt verlaufe hingegen quer zu jeder Gesellschaft<br />
zwischen den globalen Reichen und den lokalen Armen. An dieser<br />
Stelle setzt auch die fundamentale Herrschaftskritik an, die z.B.<br />
SPEHR (1996) und EBLINGHAUS/STICKLER (1998) am Diskurs um die<br />
Nachhaltigkeit üben. „Die Ökokrise ist“ demnach „Ausdruck einer<br />
Herrschaftskrise“, verursacht durch „herrschaftsförmige Strukturen...<br />
wie etwa den Kolonialismus, den Staat, das Kapitalverhältnis, das Patriarchat,<br />
große Organisationen etc.“ (ADLER/SCHACHTSCHNEIDER<br />
2010, S. 23). Das Nachhaltigkeitsleitbild greift demnach zu kurz, bzw.<br />
es ist sogar kontraproduktiv, weil es die Machtfrage verschleiert. Nur<br />
47
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
die „Abwicklung des Nordens“, also die „Zurückdrängung des herrschaftsförmigen<br />
Zugriffs auf Natur und Arbeit“ (ebd., S.33) und Selbstbestimmung<br />
der Menschen bieten die Grundlagen für ein tragfähiges<br />
Verhältnis von Mensch und Natur.<br />
Die Frage, welche Größen geeignet sind um Gerechtigkeit zu bemessen,<br />
kann hier nur angerissen werden. BUND/MISEREOR (1996) und BROT<br />
FÜR DIE WELT/EED/BUND (2008, S. 116ff) nutzen das Modell des<br />
„Umweltraums“. OTT/DÖRING (2008, S.176) kritisieren dieses, für sie<br />
geht es darum, das „Naturkapital“ nachhaltig und gerecht zu nutzen<br />
(vgl. Exkurs: Das Konzept der starken Nachhaltigkeit).<br />
Ethisch-moralische<br />
Fundierung<br />
Das Postulat der Gerechtigkeit verweist bereits auf ein zweites Merkmal<br />
der Nachhaltigkeitsidee: ihre ethisch-moralische Fundierung. Gerechtigkeit<br />
oder die Verantwortung für die Umwelt oder für andere<br />
Menschen lassen sich nicht naturwissenschaftlich und auch kaum ökonomisch<br />
begründen, sondern nur auf der Basis von Werte-Entscheidungen.<br />
Dabei sind die ethischen Verpflichtungen auf der abstrakten Ebene<br />
(z.B. Verantwortung gegenüber künftigen Generationen) noch einigermaßen<br />
konsensfähig – komplizierter wird es im Detail, so etwa wenn<br />
diese Verpflichtungen begründet oder konkretisiert werden sollen. Das<br />
soll nachfolgend in einer sehr starken Verkürzung skizziert werden.<br />
Grundsätzlich können nämlich zwei umweltethische Grundpositionen<br />
unterschieden werden:<br />
• Aus der physiozentrischen Perspektive ist der Natur prinzipiell<br />
ein Eigenwert zuzuschreiben; sie muss daher um<br />
ihrer selbst willen geachtet und geschützt werden. Aus dieser<br />
Perspektive kritisiert z.B. PIECHOCKI (2001) grundsätzlich<br />
das in der heutigen Zeit vorherrschende instrumentelle<br />
Bild von der Natur (Umwelt), bei dem der Mensch die Natur<br />
ganz überwiegend als Ressource ansieht, über die er nach<br />
Belieben verfügen kann. Er plädiert statt dessen für ein Verständnis<br />
von Mit-Welt.<br />
• Aus der anthropozentrischen Perspektive hat die Natur<br />
keinen moralischen Eigenwert, wohl aber kann der Mensch<br />
ihr Wert zuweisen. Natur- bzw. Umweltschutz wird damit<br />
nicht ausgeschlossen, aber er ist alleine aus einem Eigeninteresse<br />
der Menschen (Erhalt und Sicherung der für das<br />
menschliche Leben benötigten Ressourcen, Erfüllung weiterer<br />
menschlicher Bedürfnisse) heraus motiviert.<br />
Es gibt viele Stimmen, die das Leitbild der Nachhaltigkeit auf eine anthopozentrischen<br />
Ethik zurückführen; der behutsame Umgang mit der<br />
Natur entspringt demnach einem wohlverstandenen Eigeninteresse der<br />
Menschen, vgl. z.B. CONRAD (2000) und GRUNWALD/KOPFMÜLLER<br />
48
2.4 Zentrale Merkmale der Nachhaltigkeitsidee<br />
(2006, S. 21). OTT/DÖRING (2008, S. 59) sehen den Anthropozentrismus<br />
hingegen nicht als konstitutiv für eine Theorie der Nachhaltigkeit<br />
an – ihnen stellt sich auch die „Frage nach möglichen moralischen Verpflichtungen<br />
gegenüber Naturwesen, die dann auch innerhalb sicherer<br />
ökologischer Grenzen zu beachten wären (bspw. Walfang).“<br />
Hier soll noch eine andere ethische Frage zumindest angerissen werden:<br />
Wenn wir künftigen Generationen die gleichen Chancen einräumen<br />
wollen, wie wir sie haben, dann verdienen unsere Hinterlassenschaften<br />
eine nähere Betrachtung. Der SRU (2002, S. 59) unterscheidet folgende<br />
Formen von vererbbarem „Kapital“:<br />
1. Sachkapital (z.B. Infrastruktur)<br />
2. Naturkapital (z.B. Grundwasser, Tier- und Pflanzenarten)<br />
3. kultiviertes Naturkapital (z.B. Vieherden, Lachsfarmen,<br />
Forste)<br />
4. Sozialkapital (moralisches Orientierungswissen, Institutionen)<br />
5. Humankapital (Bildung, Fähigkeiten) und<br />
6. gespeichertes und abrufbares Wissenskapital (Bibliotheken,<br />
Internet).<br />
Wie sollte dieses Kapital bewertet, bewirtschaftet und vererbt werden?<br />
Im Sinne der Gerechtigkeit sollte den nachfolgenden Generationen<br />
mindestens ein gleichwertiger Kapitalbestand vererbt werden, wie wir<br />
ihn heute nutzen. Angesichts dessen können zwei verschiedene Konzepte<br />
ausgemacht werden (vgl. bspw. GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2006,<br />
S. 37-39):<br />
Nach dem Konzept der schwachen Nachhaltigkeit kommt es vor allem<br />
darauf an, den Gesamtbestand des Kapitals zu erhalten. Demnach ist es<br />
zulässig, Naturkapital zu verbrauchen, wenn dafür Ersatz geschaffen<br />
wird. Die Kapitalformen können damit also gegenseitig substituiert<br />
werden.<br />
Nach dem Konzept der starken Nachhaltigkeit ist die Substitution nur<br />
sehr eingeschränkt möglich. Insbesondere Naturkapital gilt hier als<br />
nicht substituierbar. Diese Position leuchtet auch aus naturwissenschaftlicher<br />
Sicht ein, wenn man „Natur“ nicht nur eindimensional als<br />
Ressource betrachtet. Angesichts der vielfältigen Elemente in einem<br />
Ökosystem und der komplexen Wechselwirkungen zwischen ihnen ist<br />
zu bezweifeln, ob eine Vermehrung anderer Kapitalformen die Verluste<br />
ausgleichen kann, die das Aussterben von Arten, die Devastierung von<br />
Böden oder die Veränderung des Klimas bedeuten. Nach diesem Kon-<br />
49
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
zept sollte jede Generation nicht nur den Gesamtbestand an Kapital sichern,<br />
sondern auch die einzelnen Formen. Der SRU (2002, S. 68)<br />
spricht sich für die starke Nachhaltigkeit aus.<br />
Exkurs: Die Theorie der starken Nachhaltigkeit<br />
Konrad Ott, Professor für Umweltethik an der Universität Greifswald<br />
und von 2000 bis 2008 Mitglied des SRU, vertritt zusammen mit Ralf<br />
Döring die Theorie der starken Nachhaltigkeit. OTT/DÖRING (2008,<br />
S. 178) verstehen nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung hin<br />
zur Nachhaltigkeit und definieren diese konzeptionell über:<br />
„a) den egalitären humanistischen Standard, b) den komparativen<br />
Standard der Zukunftsverantwortung, c) die CNCR und die Managementregeln,<br />
d) die drei Leitlinien sowie e) über die Anerkennung des<br />
moralischen Status für empfindungsfähige Mitgeschöpfe in Ansehung<br />
ihrer natürlichen Habitate.“<br />
Die grundlegende Idee der Nachhaltigkeit ist demnach inter- und intragenerationelle<br />
Gerechtigkeit. Diese bezieht sich nicht auf beliebige<br />
Sachverhalte, sondern auf<br />
• die Chance, Bedürfnisse zu befriedigen und Fähigkeiten<br />
auszuüben,<br />
• Zugang „zu natürlichen und kulturellen Ressourcen“ und<br />
• „die Bereitstellung von Gütern i.w.S.“ (ebd., S. 45).<br />
Es geht also letztlich um Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit<br />
(„egalitärer Standard“). Es geht z.B. nicht um Gerechtigkeit im juristischen<br />
Sinne (ebd., S. 64-65). Es geht, wie OTT/VOGET (2007) präzisieren,<br />
um Lebensqualität und nicht zwingend um Lebensstandard.<br />
Wir können heute nicht präzise wissen, welche Ansprüche künftige<br />
Generationen in diesem Sinne an uns haben, und wir können ihnen<br />
nicht „Wohlfahrt, Lebensfreude oder Glück an sich“ hinterlassen,<br />
wohl aber „eine Ausstattung an Gütern und Infrastrukturen“, welche<br />
die Chance auf jene bieten (OTT/DÖRING 2008, S. 64).<br />
Die Forderung, dass wir die begrenzte Tragfähigkeit der Ökosysteme<br />
respektieren müssen, ist ein essenzieller Teil dieser Idee. „Dass die<br />
Lebenden die natürlichen Lebensgrundlagen nicht plündern dürfen,<br />
ist selbst ein Grundsatz intergenerationeller Gerechtigkeit.“ (ebd., S.<br />
57)<br />
50
2.4 Zentrale Merkmale der Nachhaltigkeitsidee<br />
In der Frage, was denn der Maßstab für Gerechtigkeit sein könne,<br />
kombinieren OTT/DÖRING (ebd., S. 78ff) zwei unterschiedliche Standards.<br />
Einerseits sollen künftige Generationen nicht schlechter gestellt<br />
und nicht schlechter mit Gütern ausgestattet werden als die<br />
heutigen („komparativer“, vergleichender, steigernder Standard).<br />
Zudem aber sollte jeder Mensch (über das nackte Überleben – „basic<br />
needs“ – hinaus) mindestens die Chance bekommen, grundlegende<br />
menschliche Fähigkeiten auszuleben, also z.B. „bis zum Ende eines<br />
vollständigen menschlichen Lebens leben zu können... Bindungen zu<br />
Dingen und Personen zu unterhalten... in Anteilnahme für und in Beziehung<br />
zu Tieren, Pflanzen und zur Welt der Natur zu leben... das eigene<br />
Leben und nicht das von irgendjemand anderem zu leben.“ In<br />
diesem von NUSSBAUM (2003) entwickelten Fähigkeitenansatz sehen<br />
OTT/DÖRING (2008, S. 88) einen geeigneten „(anspruchsvollen) humanitären<br />
Sockel“ für den komparativen Standard, und zwar im Heute<br />
und in der Zukunft.<br />
Zum ethischen Fundament der Nachhaltigkeit gehört schließlich eine<br />
Antwort auf die Frage, inwieweit nicht-menschliche Lebewesen und<br />
ihre Lebensansprüche mit zu bedenken sind. OTT/DÖRING (ebd., S.<br />
172ff) plädieren für einen „graduellen Sentientismus“, also dafür, die<br />
höher entwickelten, empfindungsfähigen Mitgeschöpfe mit einzubeziehen.<br />
Das führt dann u.a. zu der Konsequenz, dass deren Lebensräume<br />
(Habitate) hochrangige Schutzgüter darstellen.<br />
Im Folgenden verlassen OTT/DÖRING (ebd., S. 179ff) die ethische<br />
Ebene. Sie führen den Begriff des „Naturkapitals“ ein und ermöglichen<br />
so die hier notwendige ökonomische Diskussion. Sie arbeiten<br />
heraus, dass es notwendig – oder angesichts aller Ungewissheit über<br />
die Ansprüche künftiger Generationen zumindest sicherer – ist, das<br />
Naturkapital zu erhalten (CNCR, constant natural capital rule). Dabei<br />
ist es essenziell, das Naturkapital nicht als homogene Größe misszuverstehen.<br />
Unter dem Blickwinkel einer gerechten Nutzung und Vererbung<br />
muss vielmehr zwischen (lebendigen bzw. nicht lebendigen)<br />
Fonds und Vorräten unterschieden werden.<br />
• Es gibt lebendige Fonds (z.B. Wälder, Fische) und nichtlebendige<br />
(wohl aber belebte) Fonds (z.B. Wasser,<br />
Boden). Diese stiften vielfältigen Nutzen (so dient uns<br />
Wasser u.a. als Lebensmittel, als Lösungsmittel, als Wärmespeicher<br />
und -überträger, als Transportmedium, zur<br />
Bewässerung, für spirituelle und religiöse Zwecke und<br />
vieles mehr). Fonds können genutzt werden und regenerieren<br />
sich, wenn sie nicht übernutzt werden.<br />
51
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
• Vorräte (z.B. Erdöl) werden hingegen verbraucht. Sie bilden<br />
sich in den für Menschen relevanten Zeiträumen<br />
nicht nach, so dass wir – dem Gerechtigkeitspostulat folgend<br />
– als Ausgleich für den Verbrauch funktional gleichwertige<br />
Alternativen schaffen müssen (z.B. durch Aufbau<br />
der Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien und<br />
nachwachsender Rohstoffe).<br />
Ein grundlegendes Problem nicht-nachhaltiger Entwicklung ist es,<br />
Fonds als Vorräte anzusehen und sie wie solche zu verbrauchen – die<br />
Fischerei auf den Weltmeeren und die Zerstörung der Primärwälder<br />
sind dafür augenfällige Beispiele.<br />
Sogenannte „Managementregeln“ können als Leitplanken für eine<br />
nachhaltige Nutzung des Naturkapitals dienen (DEUTSCHER BUN-<br />
DESTAG 1998, SRU 2002, vgl. Kap. 2.3.4 und 2.3.5 in diesem <strong>Lehrbrief</strong>).<br />
Zudem sollte bewusst in Naturkapital investiert werden, dies<br />
führen OTT/DÖRING (ebd., S. 261ff) u.a. am Beispiel der Fischereiwirtschaft<br />
aus.<br />
Ebenfalls zum Instrumentarium einer nachhaltigen Entwicklung werden<br />
die „Leitlinien“ Effizienz, Suffizienz und Resilienz gezählt,<br />
mehr dazu nachfolgend unter ökonomisch-ökologische Neuorientierung.<br />
Eine so verstandene Nachhaltigkeit muss in konkreten Handlungsfeldern<br />
umgesetzt werden, dazu gehören „Landnutzungssysteme, Naturschutz,<br />
Gewässer- und Meeresschutz, Klima- und Energiepolitik,<br />
Umweltmedien (Luft, Boden, Wasser), Mobilität“ (ebd., S. 334). Für<br />
diese Handlungsfelder lassen sich dann spezifische Bündel von Zielen<br />
aufstellen, so etwa Ziele des Klimaschutzes, diese wiederum sollen<br />
mit speziellen Konzepten umgesetzt werden.<br />
Retinität<br />
(Gesamtvernetzung)<br />
Einzelentscheidungen des Menschen (z.B. in der Politik, in der Wirtschaft,<br />
Kaufentscheidung eines Verbrauchers) sind in ein komplexes<br />
Netzwerk von Ursachen und Wirkungen eingebunden, die sowohl die<br />
menschlichen Zivilisationssysteme als auch die Ökosysteme betreffen.<br />
Der SRU (1994 S. 54-55) führt die Vokabel der Gesamtvernetzung oder<br />
Retinität (lat. rete – das Netz) ein, und sieht darin „die entscheidende<br />
umweltethische Bestimmungsgröße und damit das Kernstück einer umfassenden<br />
Umweltethik... Will der Mensch seine personale Würde im<br />
Umgang mit sich selbst und anderen wahren“ (und sich daher in seiner<br />
Ethik von der Natur abgrenzen, siehe anthropozentrische Perspektive),<br />
„so kann er der darin implizierten Verantwortung für die Natur nur ge-<br />
52
2.4 Zentrale Merkmale der Nachhaltigkeitsidee<br />
recht werden, wenn er die ´Gesamtvernetzung´ all seiner zivilisatorischen<br />
Tätigkeiten und Erzeugnisse mit dieser ihn tragenden Natur zum<br />
Prinzip seines Handelns macht.“ In anderen Worten: Der Mensch ist<br />
einzigartig, und dieser Einzigartigkeit sowie der Gesamtvernetzung seiner<br />
Handlungen entspringt auch seine Verantwortung gegenüber der<br />
Natur. Der SRU (1994, S. 9) sieht im Sustainability-Konzept die „notwendige<br />
und konsequente Operationalisierung des Retinitätsprinzips“.<br />
In verschiedenen Nachhaltigkeitskonzeptionen wurde auf verschiedene<br />
Weise versucht, diese Gesamtvernetzung zu strukturieren und sie damit<br />
fassbarer zu machen (GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2006, S. 37-58).<br />
Ein-Säulen-Konzepte räumen der Ökologie den Vorrang ein. Der SRU<br />
(2002, S. 67-68) vertritt ein derartiges ökologischen Verständnis von<br />
Nachhaltigkeit und sieht die notwendige Integration des Umweltschutzes<br />
in alle Politikbereiche für zentral an (vgl. auch SRU 2002, S. 167,<br />
wo Aktivitäten der Bundesregierung zur Integration des Umweltschutzes<br />
in die Ressorts/Bereiche Energie, Landwirtschaft, Verkehr, Bau,<br />
Entwicklungszusammenarbeit, Finanzen, Forschung, Gesundheit und<br />
Sozialpolitik aufgelistet und als Erfolg bewertet werden). BUND/MI-<br />
SEREOR (1996) beziehen sich ausdrücklich auf das Gerechtigkeitspostulat,<br />
rücken dann aber das Konzept des Umweltraums in dem<br />
Mittelpunkt ihrer Studie, um Umweltindikatoren aufzustellen und Umweltziele<br />
festzulegen. Auch der in diesem <strong>Lehrbrief</strong> nicht behandelte<br />
Syndromansatz des WGBU (1996) kann als ein Versuch gewertet werden,<br />
die Gesamtvernetzung mit dem Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit<br />
zu ordnen.<br />
GRUNWALD/KOPFMÜLLER (2006, S. 46) führen zwei zentrale Argumente<br />
gegen Ein-Säulen-Konzepte an: So erforderten die Umsetzung<br />
des Gerechtigkeitspostulats und die Übernahme von Verantwortung es<br />
prinzipiell, alle Dimensionen gesellschaftlicher Entwicklung einzubeziehen.<br />
Ferner könne die ethische Frage, auf welche Hinterlassenschaften<br />
künftige Generationen einen Anspruch haben (zu vermeidende<br />
Risiken eingeschlossen), sich nicht alleine ökologisch beantworten lassen.<br />
Drei-Säulen-Konzepte sind eine Antwort auf derartige Kritik. Die<br />
Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ hat ein<br />
Modell propagiert, welches Ökologisches, Ökonomisches und Soziales<br />
als gleichwertige Säulen vereint (DEUTSCHER BUNDESTAG 1998). In einer<br />
anderen Darstellung – als „Nachhaltigkeitsdreieck“ – hat sich diese<br />
Sichtweise als eines der bekanntesten mentalen Modelle im Nachhaltigkeitsdiskurs<br />
etabliert (vgl. Abb. 1).<br />
Teilweise wird dieses Dreieck um eine vierte „Dimension“ (z.B. Kulturelles<br />
oder – bei VENRO 2005, S. 4 – um die politische Stabilität, d.h.<br />
53
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
Frieden, Menschenrechte, Demokratie und Gleichberechtigung) erweitert.<br />
Abb. 2:<br />
Das Nachhaltigkeitsdreieck – ein brauchbares mentales Modell im<br />
Nachhaltigkeitsdiskurs?<br />
GRUNWALD/KOPFMÜLLER (2006, S. 52-53) verweisen auf Probleme<br />
dieser Modelle. Einerseits bestehe die Gefahr einer Überfrachtung des<br />
Nachhaltigkeitsleitbildes – mit der Tendenz, zu einem Ein-Säulen-Konzept<br />
zurückzukehren. Andererseits verleiteten die Drei-Säulen-Modelle<br />
dazu anzunehmen, der Nachhaltigkeitsbegriff könne isoliert auf die drei<br />
Teilbereiche angewendet werden, es gäbe also so etwas wie eine „ökologische,<br />
ökonomische und soziale Nachhaltigkeit unabhängig voneinander“<br />
(ebd., S. 53, vgl. auch BROT FÜR DIE WELT/EED/BUND 2008, S.<br />
26). OTT/DÖRING (2008, S. 38-39) kritisieren die Säulen als eine „Art<br />
Wunschzettel, in die jeder Akteur eintragen kann, was er für wichtig<br />
hält“ – so könnten z.B. auf lokaler Ebene auch „Betreuungszeiten im<br />
Kinderhort und der Warmbadetag für Senioren im örtlichen Hallenbad<br />
zu Zielen nachhaltiger Entwicklung“ werden, und die ökonomische<br />
Säule sei offen für jegliche Ziele einer wirtschaftlichen Entwicklung.<br />
Dieses Modell sei somit „der große „Weichspüler“ der Nachhaltigkeitsidee“.<br />
Integrative Nachhaltigkeitskonzepte versuchen, insbesondere den<br />
zweiten Kritikpunkt zu überwinden. Sie gehen davon aus, „dass die der<br />
Nachhaltigkeitsidee zugrunde liegenden normativen Prämissen Zukunftsverantwortung<br />
und Verteilungsgerechtigkeit dimensionenübergreifend<br />
angelegt sind.“ (GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2006, S. 53)<br />
Zudem gibt es vielfältige Verflechtungen zwischen der ökologischen,<br />
der ökonomischen und der sozialen Dimensionen, weshalb diese nicht<br />
54
2.4 Zentrale Merkmale der Nachhaltigkeitsidee<br />
isoliert betrachtet werden sollten (ebd.). DIE BUNDESREGIERUNG (2002)<br />
folgt offenbar derartigen Überlegungen und gliedert im Nationalen<br />
Nachhaltigkeitskonzept ihre Aktivitäten in vier „quer“ zu traditionellen<br />
politischen Ressorts zugeschnittene Themenfelder: Generationengerechtigkeit,<br />
Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und Internationale<br />
Verantwortung (vgl. Kap. 2.3.5).<br />
Eine nachhaltige Entwicklung ist nicht ohne eine ökonomisch-ökologische<br />
Neuorientierung denkbar. „Die Zukunft der Menschheit wird davon<br />
abhängen, ob es gelingt, zu einer Wirtschaftsweise zu gelangen, die<br />
sich innerhalb der Nutzungsgrenzen des Naturhaushalts bewegt und<br />
dennoch allen Menschen ein lebenswertes Dasein ermöglicht.“ (ICLEI<br />
1998 S. 18) FISCHER (2000) spricht von einem neuen Verständnis des<br />
Wirtschaftens, „das sich vom traditionellen wirtschaftlichen Fortschritts-<br />
und Wachstumsmodell loslöst.“<br />
Ökonomischökologische<br />
Neuorientierung<br />
Eine nachhaltige Entwicklung kann u.a. als Gegenpol zur Idee der nachholenden<br />
Entwicklung verstanden werden, nach welcher Entwicklungsländer<br />
möglichst zum Wirtschaftsmodell und Wohlstandsniveau der<br />
Industrieländer aufschließen sollten (HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG 2002,<br />
RIECKMANN 2010, S. 2). 9<br />
Dieses neue Verständnis findet seinen Ausdruck u.a. in den Managementregeln,<br />
wie sie bereits in den Kapiteln 2.3.4 und 2.3.5 vorgestellt<br />
wurden.<br />
Zudem sollen verschiedene, einander ergänzende Strategien als Leitplanken<br />
für diese ökonomisch-ökologische Neuorientierung dienen:<br />
• Die Effizienzstrategie zielt darauf, die erwünschten Produkte<br />
bzw. Dienstleistungen mit einem möglichst geringen<br />
Material- und Energieeinsatz zu erzeugen, bzw. – andersherum<br />
gedacht – den Wirkungsgrad des Material- und Energieeinsatzes<br />
zu erhöhen. WEIZSÄCKER/LOVINS/LOVINS<br />
(1996) halten eine Erhöhung der Energieeffizienz um den<br />
9. BROT FÜR DIE WELT/EED/BUND (2008, S. 69-71) weisen angesichts dessen darauf hin,<br />
dass bis ca. 1780 die wirtschaftlich am weitesten entwickelten Teile Chinas (das Yangtse-<br />
Delta) und Europas (England) hinsichtlich Wirtschaft und Technik auf gleichem Stand<br />
waren. Der dann folgende rasche Aufstieg Englands zur führenden Industriemacht war<br />
u.a. dadurch möglich, dass dieses sich in erheblichem Ausmaß zusätzliche biotische<br />
Ressourcen (aus den damaligen Kolonien) und Energieressourcen (die heimische Kohle)<br />
einverleiben konnte. Die Yangtse-Region, der das damals nicht möglich war, blieb dann in<br />
der Entwicklung zurück. – Angesichts von Klimawandel, Peak Oil und Rückgang der<br />
Biodiversität sowie angesichts des „Fehlens“ neuer Kolonien müssen die Bedingungen,<br />
denen England (Europa, Nordamerika) ihren Aufstieg verdanken, damit als historisch<br />
einmalig gelten. Diese Art der Entwicklung ist nicht sinnvoll auf alle andere Regionen der<br />
Welt übertragbar. (Es bleibt abzuwarten, wie sich Chinas aktuelles Engagement in Afrika<br />
langfristig auf beide Seiten auswirken wird.)<br />
55
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
Faktor Vier für erforderlich und auch für machbar.<br />
SCHMIDT-BLEEK (1993, 1998, 2000) fordert eine Erhöhung<br />
der Materialeffizienz um den Faktor 10.<br />
• Allerdings besteht die Gefahr, dass Effizienzgewinne durch<br />
eine Steigerung des Wohlstandes oder ein Wachstum der<br />
Bevölkerung wieder „aufgefressen“ werden. Die Suffizienzstrategie<br />
setzt hier an, sie steht für einen Lebensstil der<br />
Bescheidenheit und Selbstbegrenzung. Es verspricht selbst<br />
in einem reichen Land wie Deutschland wenig Erfolg,<br />
unverblümt für eine Askese zu werben. BUND/MISEREOR<br />
(1995 und 1996) haben daher versucht, Suffizienz mit positiven<br />
Leitbildern wie „Gut leben statt viel haben“ zu verbinden.<br />
• Die Konsistenzstrategie schließlich nimmt qualitative<br />
Aspekte des Umweltverbrauchs in den Focus. Die vom<br />
Menschen in Gang gesetzten Stoff- und Energieströme sollen<br />
sich danach an den Qualitäten der Naturkreisläufe orientieren.<br />
Hierzu gehört auch die Substitution, also der<br />
Austausch umweltschädlicher gegen umweltfreundliche<br />
Stoffe. Beispiele liefern BRAUNGART/MCDONOUGH (2008).<br />
• Die Resilienzstrategie zielt darauf, die Naturkapitalien zu<br />
erhalten. Dies kann durch deren schonende Nutzung (siehe<br />
die zuvor genannten Strategien), aber auch durch Investitionen<br />
in das Naturkapital geschehen (OTT/DÖRING 2008).<br />
Ein nachhaltiges Wirtschaften muss einerseits durch einen Wertewandel<br />
eingeleitet werden, andererseits ist eine Veränderung der politischen<br />
Rahmenbedingungen erforderlich, dazu gehören z.B. Ökosteuern oder<br />
eine Liberalisierung der Energiemärkte. MANIATES (2010, S. 184) stellt<br />
dar, dass es bereits heute vielfältige praktikable Ansätze gibt, nachhaltiger<br />
zu produzieren (z.B. den „Top-Runner“-Ansatz in Japan, nach<br />
dem die gesetzlichen Standards für die Energieeffizienz von Geräten<br />
sich an den jeweils besten auf dem Markt befindlichen Geräten orientieren)<br />
und aus der Wirtschaft heraus nachhaltiges Konsumverhalten<br />
anzuregen (z.B. Neukunden werden vom Energieversorger automatisch<br />
auf Ökostrom eingestuft, wenn sie das nicht wollen, können sie zu einem<br />
anderen Stromprodukt wechseln).<br />
Strittig ist, wie weit diese Neuorientierung gehen muss. PIECHOCKI<br />
(2001) vertritt eine recht weitgehende Position, er kritisiert den der<br />
Marktwirtschaft in ihrer heutigen Ausprägung innewohnenden Zwang<br />
zum Wirtschaftswachstum als eine der zentralen Ursachen für die Naturzerstörung.<br />
BROT FÜR DIE WELT/EED/BUND (2008, S. 28) warnen<br />
davor, dass das Wirtschaftswachstum inzwischen „mehr Nachteile als<br />
Vorteile produziert“. 10<br />
56
2.4 Zentrale Merkmale der Nachhaltigkeitsidee<br />
Nachhaltigkeit ist zukunftsorientiert und zugleich utopisch. Das Leitbild<br />
der Nachhaltigkeit ist eine Utopie, aber nicht im Sinn „illusorischer<br />
Sorglosigkeit“ sondern „als Ausdruck eines Aufbruchs in eine offensiv<br />
auf Gewinnung neuer Perspektiven ausgerichteten Zukunft" (FISCHER<br />
2000) – gerade auch angesichts der Einengung der Zukunftsoptionen<br />
durch ökonomische, ökologische und soziale Probleme.<br />
Der<br />
zukunftsorientierte<br />
und utopische<br />
Charakter<br />
In dem seit der Aufklärung vorherrschenden Fortschrittsdenken der<br />
Moderne war (ist) alles (oder fast alles) machbar, Zukunft ist demnach<br />
in einem unendlichen Spektrum von Möglichkeiten gestaltbar. Andererseits<br />
war die Umweltdebatte (vgl. Kap. 2.1) eher von Hoffnungslosigkeit<br />
gekennzeichnet und von einer Position, nach der die Zukunft<br />
angesichts von Ressourcenknappheit und irreversibler Umweltbelastung<br />
kaum noch Gestaltungsspielräume offen lässt. Zwischen diesen<br />
beiden Extrempositionen geht es im Nachhaltigkeitsdiskurs darum, innerhalb<br />
bestimmter Grenzen (Leitplanken) Gestaltungsspielräume zu<br />
eröffnen bzw. zu erhalten, damit auch künftige Generationen über ihr<br />
Leben selbst bestimmen können. (FISCHER 2000)<br />
Dieses Merkmal ist ein Grund dafür, warum Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung nicht alleine mit der traditionellen Vermittlung vorgegebener<br />
Wissensbestände auskommt, sondern vielmehr Fähigkeiten und<br />
Kompetenzen vermitteln will, sich in einer – in bestimmten Grenzen –<br />
offenen Zukunft zurechtzufinden.<br />
Die Migration von Menschen, und noch mehr von Kapital, Waren, Rohstoffen<br />
oder Schadstoffen nimmt globale Ausmaße an. RIECKMANN<br />
(2010, S. 1, mit Rückgriff auf WGBU 1996) versteht unter dem Globalen<br />
Wandel das „komplexe Zusammenspiel von globalen Umweltveränderungen,<br />
ökonomischer Globalisierung, kulturellem Wandel und<br />
einem wachsenden Nord-Süd-Gefälle“. Das Globale Lernen sucht darauf<br />
pädagogische Antworten.<br />
Der globale,<br />
universale Ansatz<br />
Die Agenda 21 will die globalen Probleme des beginnenden 21. Jahrhunderts<br />
lösen, Nachhaltigkeit ist eine globale Herausforderung, was<br />
lokale und regionale Aktivitäten wie die Lokale Agenda 21 oder kommunalen<br />
Klimaschutz ausdrücklich einschließt.<br />
GRUNWALD/KOPFMÜLLER (2006, S. 36) fordern, Attribute wie nachhaltig<br />
ohne weitere Erläuterung nur für die globale Entwicklung zu verwenden.<br />
Auf regionaler oder z.B. auch lokaler Ebene können lediglich<br />
Beiträge zu dieser globalen Nachhaltigkeit geleistet werden; eine Region<br />
kann jedoch für sich nicht nachhaltig sein.<br />
10. Fünf Denkansätze, die derartige Kritik aufnehmen und einen fundamentalen<br />
gesellschaftlich-ökonomischen Systemwechsel anstreben, stellen ADLER/<br />
SCHACHTSCHNEIDER 2010 (Teil A) vor.<br />
57
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
FISCHER (1997, S. 46-51) weist hingegen auf Probleme dieses globalen<br />
Anspruchs hin. Er sieht die Gefahr, dass wir nur noch eine „Astronautenperspektive“<br />
einnehmen, dass Diagramme statt Akteuren in den Mittelpunkt<br />
rücken, dass wir uns mit Kalkulationen aber nicht mit Ethik<br />
befassen und Stabilität statt Schönheit suchen.<br />
Hier ist die Bildung herausgefordert, sinnvolle lokale Zugänge zu den<br />
globalen Aspekten der Nachhaltigkeit zu schaffen.<br />
Kommunikative,<br />
prozessorientierte<br />
Ausrichtung<br />
Nachhaltigkeit ist ein normatives Leitbild, das auf Werteurteilen basiert.<br />
Dem klassischen Ansatz politischer Steuerung würde es entsprechen,<br />
das Leitbild so zu operationalisieren und umzusetzen, wie im<br />
Kapitel 2.3.1 beschrieben. Ein solches Vorgehen entspricht einem substanziellen<br />
Nachhaltigkeitsverständnis. „Angesichts der Komplexität<br />
des Nachhaltigkeitsbegriffs und der Vielfalt ökologischer und sozioökonomischer<br />
Systeme bestehen jedoch Zweifel an einer so weitgehenden<br />
Konkretisierbarkeit.“ (GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2006, S. 40)<br />
Einen konzeptionellen Ausweg bietet hier, die Nachhaltigkeit als regulative<br />
Idee im Sinne Kants zu verstehen. Damit haben Definitionen der<br />
Nachhaltigkeit nur einen vorläufigen und hypothetischen Charakter;<br />
Nachhaltigkeit wird zu einem „orientierenden Rahmen für einen langfristigen<br />
Such-, Erfahrungs- und Lernprozess.“ (ebd., vgl. auch DEUT-<br />
SCHER BUNDESTAG 1998, S. 72 und MICHELSEN 2005)<br />
Bei einem prozeduralen Nachhaltigkeitsverständnis steht hingegen<br />
von Anfang an der Weg im Vordergrund. Gefährdungseinschätzungen,<br />
Handlungsbedarfe und Maßnahmen würden demnach nicht in langfristiger<br />
Perspektive von oben vorgegeben, sondern „beim Laufen“ zwischen<br />
den Akteuren ausgehandelt bzw. selbstorganisiert umgesetzt<br />
(GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2006, S. 40-41).<br />
Weitgehend durchgesetzt hat sich das substanzielle Verständnis mit<br />
Nachhaltigkeit als regulativer Idee. Wenn die Agenda 21 der Stärkung<br />
der Rolle wichtiger Gruppen einen Hauptabschnitt (Teil III) widmet,<br />
geht es daher nicht nur darum, diesen Gruppen Aufgaben bei der Umsetzung<br />
einer von oben vorgegebenen Politik zuzuweisen; vielmehr<br />
wird eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung<br />
gefordert und die Partizipation als grundlegendes Element<br />
der nachhaltigen Entwicklung angesehen<br />
(BUNDESUMWELTMINISTERIUM 1992, S. 217, vgl. auch RIECKMANN<br />
2010 S. 5-6).<br />
Der Aspekt der Partizipation wird im Kapitel 4 wieder aufgegriffen.<br />
58
2.5 Zwischenbilanz<br />
2.5 Zwischenbilanz<br />
Nach der Jahrtausendwende wurde mehrfach und auf verschiedenen<br />
Ebenen Zwischenbilanz zur nachhaltigen Entwicklung gezogen. Dazu<br />
gehören:<br />
• die UN-Konferenz in Johannesburg (26.8 – 4.9.2002) und<br />
der Millennium+5 Gipfel in New York (14. – 16.9.2005)<br />
• das 30-Jahre-Update zur Studie „Die Grenzen des Wachstums“<br />
(MEADOWS/RANDERS/MEADOWS 2007), die neue<br />
Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ (BROT FÜR DIE<br />
WELT/EED/BUND 2010) sowie die jährlichen Berichte des<br />
Worldwatch-Instituts<br />
• die IPCC-Berichte und das Millennium Ecosystem<br />
Assessment (MA), bei denen weltweit Erkenntnisse aus<br />
aktuellen Forschungsvorhaben zum Klimawandel bzw. zum<br />
Zustand und zur Leistungsfähigkeit der Ökosysteme zusammengeführt<br />
werden.<br />
• Zu erwähnen ist ferner die „Conference on Sustainable<br />
Development – Rio+20“ die Mai 2012 in Rio de Janeiro<br />
stattfinden wird.<br />
Darauf aufbauend, wird nachfolgend eine Zwischenbilanz gezogen,<br />
diese kann allerdings nur Schlaglichter werfen.<br />
Tendenziell als positiv kann die Verankerung einer nachhaltigen Entwicklung<br />
eingeschätzt werden. Das betrifft verschiedene Aspekte.<br />
„Rio war ein Wendepunkt. Vorher wurden Umweltfragen belächelt, danach<br />
wurden sie ernst genommen.“ (HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG 2002,<br />
S. 10) Viele Staaten in allen Teilen der Welt begannen erst in Folge der<br />
Rio-Konferenz damit, Umweltpolitik als Regierungsaufgabe anzusehen<br />
und z.B. Umweltaktionspläne aufzustellen oder Umweltgesetze zu erlassen.<br />
Nationale Nachhaltigkeitsstrategien wurden verabschiedet.<br />
Nach MURSWIEK (2002, S. 1) gibt es in der EU und in Deutschland<br />
kaum noch ein Regierungs- oder Parteiprogramm, das nicht verkündet,<br />
der Nachhaltigkeit dienen zu wollen. Auf internationaler Ebene wurde<br />
mit Konventionen wie dem Klimarahmenabkommen oder der Konvention<br />
über biologische Vielfalt das Völkerrecht erweitert. Auch auf dieser<br />
Ebene wurden neue Strukturen geschaffen, so z.B. die CSD.<br />
Verankerung einer<br />
nachhaltigen<br />
Entwicklung<br />
Viele nichtstaatliche Akteure haben den Geist von Rio aufgegriffen, so<br />
die bestehenden oder neu gegründeten Bürgerbewegungen, aber auch<br />
Kommunen oder Unternehmen. Sie konnten sich auf Teil 4 der Agenda<br />
21 berufen und in ihrem Verantwortungsbereich viele kleine Schritte im<br />
59
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung umsetzen (HEINRICH-BÖLL-<br />
STIFTUNG 2002, S. 11).<br />
Hinsichtlich der Operationalisierung des Leitbildes gab es Fortschritte.<br />
Auf den verschiedenen politischen Ebenen – von der globalen bis zur<br />
lokalen – wurden Ziele und Indikatoren bestimmt, Managementregeln<br />
und Nachhaltigkeitsstrategien aufgestellt. Das Wissen um die „Leitplanken“,<br />
innerhalb derer eine zukunftsfähige Entwicklung möglich ist,<br />
wurde erweitert.<br />
Allerdings ist nachhaltige Entwicklung als Suchprozess noch immer auf<br />
einen relativ geschlossenen Kreis aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft<br />
sowie NGO´s beschränkt. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist großen<br />
Teilen der Bevölkerung nicht bekannt, allerdings stoßen zentrale Inhalte<br />
des Begriffes – wie die Gerechtigkeit oder die Maxime, nicht mehr<br />
Ressourcen zu verbrauchen als nachwachsen – auf hohe Zustimmung<br />
(KUCKARTZ 2000, BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FOR-<br />
SCHUNG 2002, S. 10, vgl. auch WIPPERMANN et. al 2009).<br />
Gerechtigkeit<br />
„Der tiefe Graben, der die Menschheit in Arm und Reich spaltet, und die<br />
ständig wachsende Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den<br />
Entwicklungsländern stellen eine große Bedrohung für die weltweite<br />
Prosperität, Sicherheit und Stabilität dar... Die Schäden an der Umwelt<br />
nehmen weltweit zu. Der Verlust der biologischen Vielfalt hält an, die<br />
Fischbestände werden weiter erschöpft, Wüsten verschlingen immer<br />
mehr fruchtbares Land, die nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderung<br />
sind bereits augenfällig, Naturkatastrophen werden immer häufiger<br />
und verheerender, die Krisenanfälligkeit der Entwicklungsländer<br />
steigt, und durch die Verschmutzung von Luft, Wasser und Meeren<br />
wird Millionen von Menschen nach wie vor ein menschenwürdiges Leben<br />
versagt... Mit der Globalisierung haben diese Probleme eine neue<br />
Dimension gewonnen... Wir laufen Gefahr, diese weltweiten Ungleichheiten<br />
festzuschreiben...“ (VEREINTE NATIONEN 2002, S. 2-3).<br />
Die reichsten 25% der Weltbevölkerung erzielen – in Kaufkraftparitäten<br />
– etwa 75% des weltweiten Einkommens (BROT FÜR DIE WELT/EED/<br />
BUND 2010, S. 79, nach Daten von MILANOVIC 2005). Etwa 2,7 Milliarden<br />
Menschen leben von weniger als 2 US$ (Kaufkraftparität) pro<br />
Tag, 1,1 Milliarden von ihnen müssen sogar mit weniger als 1 US$ täglich<br />
auskommen. Der Prozentsatz extrem armer Menschen hat seit ca.<br />
1980 abgenommen, das ist vor allem der Entwicklung in China zu verdanken.<br />
Aufgrund des Bevölkerungswachstums steigt die absolute Zahl<br />
der extrem armen Menschen aber. (BROT FÜR DIE WELT/EED/BUND<br />
2010, S. 82)<br />
Die 500 Mio wohlhabenden Menschen (ca. 7% der Weltbevölkerung)<br />
verursachen ca. 50% aller anthoropogenen CO 2 -Emissionen; die 3 Mil-<br />
60
2.5 Zwischenbilanz<br />
liarden Armen hingegen nur ca. 6% (ASSADOURIAN 2010, S. 37 und PA-<br />
CALA 2007). Würden alle Menschen so leben und konsumieren wie die<br />
US-Amerikaner – d.h. Pro-Kopf-Jahreseinkommen von gut 45.000<br />
US$, ökologischer Fußabdruck von 9,4 ha – dann könnte die Erde nur<br />
ca. 1,4 Milliarden Menschen verkraften (wir Europäer verbrauchen etwas<br />
weniger Ressourcen). Selbst bei einem im heutigen globalen Maßstab<br />
mittleren Lebensniveau – d.h. Pro-Kopf-Jahreseinkommen von gut<br />
5.000 US$, ökologischer Fußabdruck von 2,2 ha – wäre die Tragfähigkeit<br />
der Erde mit ca. 6,2 Milliarden Menschen ausgeschöpft. (ASSA-<br />
DOURIAN 2010, S. 38) Zu ähnlichen Aussagen kommen BROT FÜR DIE<br />
WELT/EED/BUND (2010, S. 72ff). Somit „läuft bei einem begrenzten<br />
Umweltraum die ungleiche Aneignung der Naturressourcen auf einen<br />
Entzug von Überlebensmitteln für arme Länder hinaus.“ (ebd., S. 77)<br />
Selbst wenn man die Tauglichkeit von Umweltraum und ökologischem<br />
Fußabdruck als Denkmodellen kritisch sieht, ist diese Schlussfolgerung<br />
damit nicht hinfällig.<br />
Die anspruchsvollen Programme der Agenda 21 wurden nicht in dem<br />
Maße finanziert wie geplant. Das UNCED-Sekretariat hatte den Finanzbedarf<br />
für die Umsetzung der Agenda 21 in den armen Ländern auf ca.<br />
600 Milliarden US$ jährlich geschätzt. 11 Davon sollten 125 Milliarden<br />
US$ aus der regulären Entwicklungshilfe fließen, für welche die Industrieländer<br />
0,7% ihres Bruttosozialproduktes zur Verfügung stellen<br />
wollten. In der Praxis haben die Industrieländer jedoch zwischen 1992<br />
und 2000 ihre Entwicklungshilfe von 69 Milliarden US$ auf 53 Milliarden<br />
US$ reduziert. (HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG 2002, S. 12)<br />
Dabei sind Arme vielleicht eher „verhinderte Akteure und nicht zu kurz<br />
gekommene Versorgungsempfänger“ (BROT FÜR DIE WELT/EED/<br />
BUND 2010, S. 198). In seinem aktuellen Bericht „Hunger im Überfluss“<br />
zeigt das WORLDWATCH INSTITUTE (<strong>2011</strong>) anhand mehrerer Beispiele,<br />
wie Bäuerinnen und Bauern (überwiegend) in Afrika durch<br />
verbesserte landwirtschaftliche Praktiken die Bodenfruchtbarkeit fördern,<br />
die Erträge steigern und dadurch den Hunger überwinden können.<br />
Ein anderes Beispiel ist der faire Handel. In Deutschland wurden 2008<br />
Fairtrade-Waren im Wert von rund 213 Millionen Euro verkauft – das<br />
sind 50% mehr als 2007 (FAIRTRADE DEUTSCHLAND 2009). Im Jahr<br />
2009 lag der Umsatz bereits bei 264 Millionen Euro (erneutes Wachstum<br />
um 26%), weltweit wird der Umsatz der Branche auf 3,4 Milliarden<br />
Euro geschätzt, auch hier mit steigender Tendenz. Damit ist der faire<br />
Handel noch immer ein Nischenmarkt, aber immerhin „profitierten“ davon<br />
bereits „1,2 Millionen Kleinbauern und Plantagenarbeiter in 60<br />
Entwicklungsländern“ (FAIRTRADE DEUTSCHLAND 2010).<br />
11. Demgegenüber wurden 2006 weltweit 1.204 Milliarden US$ für Rüstung ausgegeben<br />
(SIPRI 2007).<br />
61
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
VENRO (2000, S. 7) fordert konsequenter Weise eine „Abkehr von einem<br />
paternalistischen Entwicklungshilfedenken“ und stattdessen eine<br />
Entwicklungszusammenarbeit, die sich als globale Strukturpolitik versteht.<br />
Umwelt<br />
Mit Rückblick auf die von der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen<br />
und der Umwelt“ des 13. Deutschen Bundestages aufgestellten<br />
Managementregeln (vgl. Kap. 2.3.4) können folgende Einschätzungen<br />
getroffen werden<br />
Erhalt der Regenerationsfähigkeit bei der Nutzung erneuerbarer<br />
Naturgüter: Der WWF schätzt, dass heute pro Jahr weltweit etwa<br />
30.000 Tier- bzw. Pflanzenarten allein im tropischen Regenwald aussterben,<br />
das entspricht 68 Arten pro Tag oder 3 Arten pro Stunde. In den<br />
nächsten 10 Jahren werden wahrscheinlich 2,5% aller heute bekannten<br />
Tier- und Pflanzenarten ausgestorben sein (WWF/TRAFFIC DEUTSCH-<br />
LAND 2001). Wenn man das genetische Potenzial der Tier- und Pflanzenarten<br />
als erneuerbare Ressource ansieht, dann ist die Ausrottung von<br />
Arten ein gravierendes Beispiel für Missmanagement. Noch drastischer<br />
muss das Urteil ausfallen, wenn es aufgrund ethischer Positionen gefällt<br />
wird, die der Natur – z.B. den Arten oder den einzelnen Individuen – einen<br />
Eigenwert bzw. Eigenrechte zuweisen.<br />
Bewirtschaftung nicht-erneuerbarer Naturgüter: Der weltweite Energieverbrauch<br />
ist zwischen 1950 und 2000 um ca. 3,5% jährlich gestiegen<br />
(MEADOWS/RANDERS/MEADOWS 2007, S. 86). Es ist davon<br />
auszugehen, dass wir beim Erdöl im ersten Viertel des neuen Jahrtausends<br />
das Fördermaximum erreichen, d.h. danach lässt sich die Förderung<br />
nicht mehr steigern sondern wird zurückgehen (LEGGETT 2006).<br />
Die Vorräte an Gas und vor allem an Kohle reichen noch länger; allerdings<br />
sind dem vertretbaren Verbrauch u.a. wegen der Freisetzung von<br />
Kohlendioxid enge Grenzen gesetzt. – Die Abkopplung des bundesdeutschen<br />
Energieverbrauchs vom Wirtschaftswachstum durch eine<br />
(langsame) Effizienzsteigerung nach der Ölkrise 1973 und die weltweit<br />
zunehmende Nutzung regenerativer Energieträger weisen angesichts<br />
dieser Probleme tendenziell in die richtige Richtung.<br />
Die Nutzung der Ressource Boden ist ein Negativbeispiel. Boden kann<br />
neu gebildet werden, allerdings in so langen Zeiträumen, so dass er für<br />
die Menschen als nicht erneuerbare Ressource gilt. Boden ist zudem in<br />
seiner Komplexität und in seinen vielfältigen Funktionen (z.B. Lebensraum<br />
für Bodenlebewesen, Substrat für Pflanzen, Wasserfilter, Fläche<br />
für Aktivitäten des Menschen etc.) nicht substituierbar – bestenfalls<br />
sind Substitute für Einzelfunktionen vorstellbar. In den vergangenen<br />
1000 Jahren haben die Menschen weltweit ca. 2 Milliarden produktives<br />
Ackerland in Ödland verwandelt, das ist mehr als die heute genutzte<br />
Ackerfläche. Zudem sind 38% der heute genutzten Ackerflächen degra-<br />
62
2.5 Zwischenbilanz<br />
diert (MEADOWS/RANDERS/MEADOWS 2007, S. 61). Wie das STATISTI-<br />
SCHE BUNDESAMT (2010) bilanziert, werden in Deutschland jeden Tag<br />
mehr als 100 ha Boden für Siedlungs- und Verkehrsfläche verbraucht<br />
und somit ihren natürlichen Funktionen entzogen. Hinzu kommen Bodenverluste<br />
durch Erosion oder andere Formen der Degradation.<br />
Freisetzung von Stoffen oder Energie: Die Emissionen an Kohlendioxid,<br />
Methan und anderen Treibhausgasen wachsen exponentiell an.<br />
Parallel dazu ist alleine in den 100 Jahren von 1906 bis 2005 die globale<br />
bodennahe Mitteltemperatur um 0,74°C angestiegen (UMWELTBUN-<br />
DESAMT 2007). Inzwischen ist weitgehend unstrittig, dass die globale<br />
Durchschnittstemperatur weiter ansteigen wird. Als kritische Marke,<br />
oberhalb derer mit einem abrupten, beschleunigten und unkontrollierbaren<br />
Klimawandel zu rechnen ist, gilt ein Temperaturanstieg um 2°C<br />
gegenüber den Werten vor Beginn der Industrialisierung (LEGGETT<br />
2006, S. 111-112, UMWELTBUNDESAMT 2007).<br />
Mit dem Kyoto-Protokoll sollte weltweit der Ausstoß an Treibhausgasen<br />
begrenzt werden. Die Bundesrepublik hat ihre darin eingegangenen<br />
Verpflichtungen erfüllt (STATISTISCHES BUNDESAMT 2010, vgl. Kap.<br />
2.3.6 in diesem <strong>Lehrbrief</strong>). Das sollte aber nur als ein Teilerfolg angesehen<br />
werden, äußerst kritisch ist, dass die Staaten dieser Welt bislang<br />
kein Folgeabkommen für das 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll vereinbaren<br />
konnten.<br />
Zeitmaß anthropogener Einträge bzw. Eingriffe in die Umwelt: Die<br />
natürlichen Systeme der Erde können neue Tier- und Pflanzenarten hervorbringen,<br />
Boden neu bilden oder Kohlendioxid absorbieren. Die oben<br />
beschriebenen Eingriffe des Menschen in die Umwelt sind deswegen<br />
problematisch, weil sie die Geschwindigkeit dieser natürlichen Prozesse<br />
ganz erheblich übertreffen und daher früher oder später Grenzen der<br />
Tragfähigkeit überschreiten. Zudem sind – darauf weisen MEADOWS/<br />
RANDERS/MEADOWS (2007, S. 1-2) – unsere Wahrnehmung und unsere<br />
Reaktion auf die Entwicklungen verzögert, d.h. die Chance, rechtzeitig<br />
und damit sachte umzusteuern, wird regelmäßig vertan (ein interessanter<br />
Aspekt für die Bildung).<br />
Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschliche Gesundheit<br />
und die Umwelt: Die Erzeugung radioaktiver Stoffe in der Energie-<br />
und Rüstungsindustrie bei gleichzeitigem Fehlen sicherer<br />
Entsorgungsmöglichkeiten ist ein Beispiel dafür, wie diese Managementregel<br />
permanent verletzt wird. Der deutsche Atomausstieg hätte<br />
ein Schritt einer nachhaltigen Entwicklung werden können, wenn es gelungen<br />
wäre, die Weichen so zu stellen, dass die stillzulegenden Kraftwerkskapazitäten<br />
durch Effizienzgewinne und Einsparungen<br />
kompensiert bzw. durch umweltverträgliche erneuerbare Energieträger<br />
ersetzt werden.<br />
63
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
Während ich dieses Update schreibe (Sommer <strong>2011</strong>), gehen Berichte<br />
vom Hunger in Ostafrika durch die Medien. Auf meinem Schreibtisch<br />
liegt der Bericht „Hunger im Überfluss“ vom WORLDWATCH INSTITUTE<br />
(<strong>2011</strong>), in dem auf diese neue Katastrophe bereits hingewiesen wird (S.<br />
15). Schon vor über zehn Jahren schätzte VENRO (2000, S. 7) ein:<br />
„Noch nie hat die Menschheit über so viele technische und finanzielle<br />
Ressourcen verfügt, die genutzt werden könnten, um massenhaften<br />
Verarmungsprozessen entgegenzusteuern. Es geht weniger um das<br />
Können, als vielmehr um den politischen Willen, um die Durchsetzung<br />
von Interessen, um das Entwickeln von Ideen, Energien, Strategien und<br />
den Einsatz von Ressourcen.“ Das betrifft die anderen Aspekte der<br />
Nachhaltigkeit gleichermaßen, und das führt unmittelbar zu der Frage,<br />
was Bildung in diesem Kontext will und kann.<br />
2.6 Zusammenfassung<br />
Anliegen dieses Abschnittes war es, Sie mit dem Leitbild Nachhaltigkeit<br />
bekannt zu machen.<br />
Dazu wurde zunächst – von der ökologischen Perspektive her – die Entstehung<br />
dieses Leitbildes skizziert. Die Auswahl der historischen Stationen<br />
ist auch subjektiv bedingt (Sie mögen einen anderen Blick auf<br />
diese Entwicklung haben): Entscheidend, auch mit Hinblick auf die didaktische<br />
Herausforderungen der <strong>BNE</strong>, ist, dass Sie verstehen, wie<br />
stark umwelt- bzw. nachhaltigkeitsrelevantes Wissen (z.B. Konzepte,<br />
Denkmodelle, Daten und Bewertungen) vorläufigen Charakter hat. Es<br />
steht (wie generell jedes andere Wissen auch, aber mit besonders hoher<br />
Dynamik) unter dem Vorbehalt, durch aktuelleres Wissen präzisiert,<br />
korrigiert oder auch widerlegt zu werden.<br />
Im Folgenden wurde die rasante internationale Karriere der Nachhaltigkeitsidee<br />
beleuchtet. Die Definition der Brundtland-Kommission sowie<br />
die Bedeutung und wesentliche Inhalte der Agenda 21 sollten Sie nun<br />
kennen, und Sie sollten z.B. die Milleniumsziele in den durch die Agenda<br />
21 ausgelösten internationalen Entwicklungsprozess einordnen können.<br />
Auch die im Kapitel 2.3 angestellten Betrachtungen über die Resonanz<br />
der Nachhaltigkeitsidee in Deutschland orientieren sich formell an einzelnen<br />
historischen Stationen, Akteuren und Dokumenten. Vor allem<br />
aber möchte ich Sie hier – stärker als unter 2.2 – zu einer systematischen<br />
Reflexion dieser einzelnen Ereignisse führen und Ihnen vermitteln, wie<br />
(vielfältig) Wissen über Nachhaltigkeit organisiert werden kann. Den<br />
„roten Faden“ für diese systematische Reflexion liefert die im Kapitel<br />
2.3.1 vorgestellte Aufgabe, das Nachhaltigkeitsleitbild zu operationali-<br />
64
2 Nachhaltigkeit und Agenda 21<br />
sieren. Ich hoffe sehr, dass Sie die Einblicke in diese Denkmodelle nicht<br />
als lästige Mühe empfinden, sondern dass Sie vielmehr erkennen, wie<br />
eng dies mit einer Kernaufgabe jeder Didaktik – der Auswahl und<br />
Strukturierung des Lehr- bzw. Lernstoffs – verbunden ist. Wo das sinnvoll<br />
und möglich ist, verweise ich Sie daher bereits hier darauf, wie diese<br />
Wissensorganisation in der <strong>BNE</strong> produktiv genutzt werden kann.<br />
Das Kapitel 2.4 versucht, die zentralen Merkmale der Nachhaltigkeitsidee<br />
unter rein systematischen Gesichtspunkten vorzustellen. Auch damit<br />
möchte ich Sie bereits auf das nachfolgende Bildungskapitel<br />
verweisen, denn die nachhaltige Entwicklung bietet nicht nur Themen<br />
oder Denkmodelle für die <strong>BNE</strong>; ihre Prinzipien wie Gerechtigkeit oder<br />
Partizipation fordern das Bildungssystem vielmehr auch in struktureller<br />
und methodischer Hinsicht heraus. Der in einem Exkurs vorgestellten<br />
Theorie der starken Nachhaltigkeit werden Sie im Kapitel 3.3 wieder<br />
begegnen, wenn versucht wird, den Begriff der <strong>BNE</strong> zu definieren.<br />
Die unter 2.5 gezogene Zwischenbilanz bedient sich zwar allgemein zugänglicher<br />
Quellen, aber die Auswahl der hier angesprochenen Aspekte,<br />
die Verknüpfungen zwischen Daten und Zielen sowie folglich auch<br />
die Wertungen sind natürlich auch subjektiv (und damit nichts, was z.B.<br />
in einer Klausur abgefragt werden könnte). Fühlen Sie sich herausgefordert,<br />
in den für Ihre pädagogische Arbeit relevanten Aspekten Ihre<br />
eigene Zwischenbilanz zu ziehen!<br />
65
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
„Probleme lassen sich nicht mit den Denkweisen lösen, die zu ihnen geführt<br />
haben.“ (Albert EINSTEIN o.J.)<br />
Einige globale Probleme, mit denen die Menschheit im 21. Jahrhundert<br />
konfrontiert ist, sowie Ansätze neuer Denkweisen haben Sie im Kapitel<br />
2 kennen gelernt. Was kann nun Bildung zu einer nachhaltigen Entwicklung<br />
beitragen? Kann sie (sollte sie) Wissen vermitteln, Bewusstsein<br />
schaffen, das Denken bzw. Handeln der Menschen verändern...?<br />
Was sagt die Agenda 21 über die Rolle der Bildung aus? Was ist Bildung<br />
für nachhaltige Entwicklung und wie kann sie umgesetzt werden?<br />
Welche Projekte und Lernarrangements wurden bisher entwickelt und<br />
welche Ergebnisse wurden dabei erzielt? Und schließlich: In welchem<br />
Verhältnis steht die <strong>BNE</strong> zur Umweltbildung und zum Globalen Lernen?<br />
Eine nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die zu mehr Nachhaltigkeit<br />
führt. Bildung für nachhaltige Entwicklung will diese Entwicklung<br />
unterstützen. In einer ersten Näherung wollen wir Bildung für<br />
nachhaltige Entwicklung daher als pädagogische Antwort auf den<br />
Nachhaltigkeitsdiskurs verstehen.<br />
Begriffliche<br />
Annäherungen<br />
Das BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (2002, S. 4)<br />
schreibt dazu: „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist mehr als<br />
Umweltbildung. Sie unterscheidet sich von der Umweltbildung ebenso<br />
wie von der entwicklungspolitischen Bildung durch einen breiteren und<br />
umfassenderen Ansatz, der ökologische, ökonomische und soziale<br />
Aspekte integriert („Dreieck der Nachhaltigkeit“). Bildung für eine<br />
nachhaltige Entwicklung soll zur Realisierung des gesellschaftlichen<br />
Leitbilds einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Agenda 21 beitragen<br />
und hat zum Ziel, die Menschen zur aktiven Gestaltung einer<br />
ökologisch verträglichen, wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial gerechten<br />
Umwelt unter Berücksichtigung globaler Aspekte zu befähigen.<br />
Mit geeigneten Inhalten, Methoden und einer entsprechenden Lernorganisation<br />
hat Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in allen Bildungsbereichen<br />
die Aufgabe, Lernprozesse zu initiieren, die zum<br />
Erwerb von für eine nachhaltige Entwicklung erforderlichen Analyse-,<br />
Bewertungs- und Handlungskompetenz beitragen.“<br />
Eine andere und erhellende Definition bieten: VEREINTE NATIONEN<br />
(2005, S.1): „Die Bildung für nachhaltige Entwicklung stärkt und entwickelt<br />
die Möglichkeiten von einzelnen Personen, Gruppen, Gemeinschaften,<br />
Organisationen und Ländern, Einschätzungen und<br />
Entscheidungen zu Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung zu treffen.<br />
Sie kann Einstellungen und fixe Meinungen von Menschen ändern, so-<br />
67
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
mit unsere Welt sicherer, gesünder und wohlhabender machen und dadurch<br />
die Lebensqualität verbessern. Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung kann zu kritischer Betrachtung, stärkerem Bewusstsein<br />
und neuer Kraft führen, wodurch neue Visionen und Konzepte entstehen<br />
und neue Methoden und Instrumente entwickelt werden können.“<br />
3.1 Die Herausforderung<br />
3.1.1 Der Bildungsauftrag der Agenda 21<br />
Kapitel 36 der Agenda<br />
21: Bildung als<br />
Möglichkeit der<br />
Umsetzung einer<br />
nachhaltigen<br />
Entwicklung<br />
„Bildung / Erziehung, öffentliche Bewusstseinsbildung und berufliche<br />
Ausbildung stehen mit fast allen Programmbereichen der Agenda 21 in<br />
Verbindung.“ (BUNDESUMWELTMINISTERIUM 1992, S. 261) Bildungsaufgaben<br />
werden in fast allen Kapiteln der Agenda 21 explizite als Umsetzungsmöglichkeiten<br />
angesprochen. So enthält das Kapitel 3<br />
„Armutsbekämpfung“ die Maßnahme: „den Armen Zugang zum Primar-Erziehungswesen<br />
zu verschaffen.“ (ebd., S. 20) Im Kapitel 9<br />
„Schutz der Erdatmosphäre“ wird u.a. vorgeschlagen, Maßnahmen zur<br />
Aufklärung und Bewusstseinsförderung „zum Thema sparsame Energienutzung<br />
und umweltverträgliche Energieträger“ zu fördern (ebd., S.<br />
70).<br />
Das Kapitel 36 bündelt diese Querschnittsaufgabe. Unter Bezug auf die<br />
Prinzipien der Konferenz von Tiflis 1977 (UNESCO 1978) umfasst es<br />
folgende Programmbereiche:<br />
a) Neuausrichtung der Bildung auf eine nachhaltige Entwicklung<br />
b) Förderung der öffentlichen Bewusstseinsbildung<br />
c) Förderung der beruflichen Ausbildung<br />
A Neuausrichtung der Bildung auf eine nachhaltige Entwicklung<br />
Handlungsgrundlage<br />
In der Agenda 21 werden Bildung/Erziehung als Prozess gesehen, „mit<br />
dessen Hilfe die Menschen als Einzelpersonen und die Gesellschaft als<br />
Ganzes ihr Potenzial voll ausschöpfen können“. Das bezieht sich nicht<br />
nur auf die formelle Bildung (z.B. in allgemein bildenden Schulen) sondern<br />
z.B. auch auf die öffentliche Bewusstseinsbildung (siehe Programmbereich<br />
B) und die informelle Bildung<br />
(BUNDESUMWELTMINISTERIUM 1992, S. 261).<br />
Diese Formen der Bildung werden als „unabdingbare Voraussetzung<br />
für die Herbeiführung eines Bewußtseinswandels“ und als entscheidend<br />
68
3.1 Die Herausforderung<br />
„für die Schaffung eines ökologischen und eines ethischen Bewußtseins<br />
sowie von Werten und Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen,<br />
die mit einer nachhaltigen Entwicklung vertretbar sind“ angesehen.<br />
Schließlich wird vorgeschlagen, dass sich eine umwelt-/entwicklungsorientierte<br />
Bildung bzw. Erziehung nicht nur mit der Umwelt im herkömmlichen<br />
Sinne („mit der Dynamik der physikalischen/<br />
biologischen...Umwelt“), sondern auch mit der sozioökonomischen<br />
Umwelt und der menschlichen Entwicklung befassen sollte (ebd., S.<br />
261).<br />
Basierend auf diesen Einschätzungen, werden folgende Ziele proklamiert<br />
(ebd., S. 261):<br />
Ziele<br />
a) Der Zugang zur Grunderziehung soll verbessert werden.<br />
Weltweit sollen „mindestens 80 Prozent der Mädchen und<br />
80 Prozent der Jungen im Primarschulalter“ eine solche<br />
Grunderziehung „im Rahmen der formalen Schulbildung<br />
oder der nonformalen Bildung“ erhalten. Die Quote der<br />
Analphabeten unter den Erwachsenen soll gegenüber 1990<br />
um wenigstens 50% reduziert werden. Dabei gilt es insbesondere,<br />
die Rückstände bei der Bildung der Frauen gegenüber<br />
den Männern auszugleichen.<br />
b) Weltweit soll möglichst rasch und in der größtmöglichen<br />
Breite ein Umwelt- und Entwicklungsbewusstsein entwikkelt<br />
werden.<br />
c) Allen Bevölkerungsgruppen (auch allen Altersgruppen)<br />
sollte Zugang zur umwelt- und entwicklungsorientierten<br />
Bildung im Verbund mit Sozialerziehung ermöglicht werden.<br />
d) Umwelt- und Entwicklungskonzepte sollen in alle Bildungsprogramme<br />
integriert werden, insbesondere sollen auch Entscheidungsträger<br />
weitergebildet werden.<br />
Zur Umsetzung dieser Ziele werden insgesamt 15 Maßnahmen mit verschiedenen<br />
Addressaten vorgeschlagen (ebd., S. 261-263).<br />
Maßnahmen<br />
Die Länder (deren Regierungen und Behörden) sollten z.B.<br />
• die nationale Bildungsplanung so vorantreiben, dass der<br />
Zugang zu Bildung für alle erleichtert wird<br />
• Strategien erarbeiten, nach denen Umwelt- und Entwicklung<br />
als Querschnittsthema auf allen Ebenen des Bildungswesens<br />
einbezogen werden können<br />
69
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
• dabei externe Partner wie z.B. nichtstaatliche Umwelt- und<br />
Entwicklungsorganisationen angemessen einbeziehen und<br />
unterstützen<br />
• die <strong>Weiterbildung</strong> von Lehrkräften, Erziehern, Verwaltungsfachkräften<br />
und Bildungsplanern zur umwelt- und entwicklungsorientierten<br />
Bildung/Erziehung organisieren<br />
• Schulen Unterstützung bei der Erarbeitung eigner Umweltarbeitspläne<br />
verschaffen<br />
• die Entwicklung und den Einsatz innvoativer Methoden fördern<br />
und gleichzeitig „geeignete traditionelle Systeme zur<br />
Wissensvermittlung in örtlichen Gemeinschaften anerkennen“<br />
• Aktivitäten von Universitäten, sonstige Aktivitäten im tertiären<br />
Sektor sowie Netwerke unterstützen.<br />
• <strong>Weiterbildung</strong> im Bereich Umwelt und Entwicklung fördern<br />
• die Ausbildungschancen von Frauen in nicht traditionellen<br />
Bereichen fördern und stereotype Ausrichtung der Lehrplänen<br />
nach Geschlechtszugehörigkeit abschaffen<br />
• „das Recht der eingeborenen Bevölkerungsgruppen bestätigen,<br />
ihre Erfahrungen und ihr Wissen über eine nachhaltige<br />
Entwicklung zu nutzen, um im Bereich der Bildung und<br />
Ausbildung eine Rolle zu spielen“.<br />
Die Vereinten Nationen<br />
• sollen ihre Bildungsprogramme überprüfen, um neue Prioritäten<br />
zu setzen und die vorhandenen Mittel neu zu verteilen.<br />
• können Aufgaben des Monitorings und der Evaluation übernehmen<br />
sowie darüber Bericht erstatten.<br />
International sowie national sollte(n)<br />
werden.<br />
• der Informationsaustausch zur Bildung verstärkt<br />
• „Leistungszentren für die interdisziplinärer Forschung und<br />
Bildung im Bereich der Umwelt- und Entwicklungswissenschaften,<br />
des Umwelt- und Entwicklungsrechts“ sowie des<br />
Umweltmanagements geschaffen<br />
• nonformale Bildungsmaßnahmen gefördert<br />
70
3.1 Die Herausforderung<br />
Die Kosten werden für die Jahre 1993-2000 auf jährlich 8-9 Mrd. US$<br />
geschätzt. Einige konkrete Maßnahmen zur Absicherung bzw. Ergänzung<br />
dieser Finanzierung werden angeführt (ebd., S. 263-264).<br />
Instrumente zur<br />
Umsetzung<br />
B Förderung der öffentlichen Bewusstseinsbildung<br />
Es wird eingeschätzt, dass es aufgrund „ungenauer bzw. unzulänglicher<br />
Informationen“ noch immer an „Bewußtsein mit Hinblick auf die<br />
Wechselbeziehungen zwischen der Gesamtheit der anthropogenen Aktivitäten<br />
und der Umwelt“ mangelt. „Insbesondere in Entwicklungsländern<br />
fehlt es an entsprechenden Technologien und entsprechendem<br />
Sachverstand.“ (ebd., S. 264)<br />
Dementsprechend wird folgendes Ziel verfolgt (ebd., S. 264): „Förderung<br />
einer breitangelegten öffentlichen Bewußtseinsbildung“, die zu einer<br />
„Stärkung von Einstellungen, Wertvorstellungen und<br />
Handlungsweisen, die mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar<br />
sind“, beiträgt. Dabei sollten Verantwortung und Durchführung jeweils<br />
auf der am besten geeigneten Ebene – insbesondere der lokalen – angesiedelt<br />
sein.<br />
Die Maßnahmen (ebd., S. 264-265) zielen insbesondere darauf, dass die<br />
Länder (welche die Agenda 21 unterzeichnet haben und daher direkt angesprochen<br />
sind), in einem äußerst breiten Rahmen nach Bündnispartnern<br />
für die öffentliche Bewusstseinsbildung suchen. Generell wird<br />
angeregt, beratende Gremien zu stärken, die Abstimmung und Vernetzung<br />
zwischen den verschiedenen Akteuren zu fördern und die Öffentlichkeit<br />
an Diskussionen über umweltpolitische Maßnahmen und<br />
Bewertungen zu beteiligen. Bildungseinrichtungen in allen Sektoren<br />
sowie nichtstaatliche Organisationen werden ausdrücklich als potenzielle<br />
Partner genannt: Die Medien oder die Unterhaltungs- und Werbebranche<br />
sollen einbezogen werden, auch mit dem Ziel, „deren<br />
Erfahrungen mit der Beeinflussung von öffentlichen Verhaltens- und<br />
Verbrauchsmustern zu ergründen ... und von deren Methoden umfassenden<br />
Gebrauch“ zu machen. Moderne Kommunikationstechnologien<br />
mit hoher Breitenwirkung sollen genutzt werden. Die Länder sollen<br />
umweltverträgliche (Bildungs-)Angebote für Freizeit und Tourismus<br />
fördern, z.B. im Kooperation mit Museen, Zoos oder Nationalparken.<br />
Handlungsgrundlage<br />
Ziele<br />
Maßnahmen<br />
„Länder und das System der Vereinten Nationen sollen die Interaktion<br />
mit eingeborenen Bevölkerungsgruppen verstärken und diese gegebenenfalls<br />
(sich) in die Bewirtschaftung, Planung und Entwicklung ihrer<br />
örtlichen Umwelt einbeziehen.“ Traditionelles Wissen und traditionelle<br />
Formen der Weitergabe dieses Wissens, insbesondere in ländlichen Gebieten,<br />
sollen gefördert werden.<br />
71
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Das System der Vereinten Nationen soll u.a. seine Maßnahmen prüfen,<br />
seinen Aktionsradius vergrößern und systematische Erhebungen über<br />
den Erfolg von Bewusstseinsbildungsprogrammen durchführen. „UNI-<br />
CEF, UNESCO, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen<br />
(UNDP) sowie nichtstaatliche Organisationen sollen unterstützende<br />
Programme zur Beteiligung von Jugendlichen und Kindern an Umweltund<br />
Entwicklungsfragen schaffen“. Männer und Frauen (und Familien)<br />
sollen für eine nachhaltige Entwicklung mobilisiert werden. „Das öffentliche<br />
Bewußtsein soll im Hinblick auf die Anwendung von Gewalt<br />
in der Gesellschaft geschärft werden.“<br />
Instrumente zur<br />
Umsetzung<br />
Für 1993-2000 werden Kosten in Höhe von durchschnittlich 1,2 Milliarden<br />
US$ pro Jahr veranschlagt (ebd., S. 265).<br />
C Förderung der beruflichen Ausbildung<br />
Handlungsgrundlage<br />
Ziele<br />
Die berufliche Ausbildung wird als „eine der wichtigsten Voraussetzungen<br />
für die Entwicklung der menschlichen Ressourcen und für die<br />
Erleichterung des Übergangs in eine nachhaltige Welt“ angesehen<br />
(ebd., S. 265).<br />
Zu den darauf aufbauend proklamierten Zielen (ebd., S. 265-266) gehören<br />
u.a.:<br />
• „die Einführung oder Erweiterung von Berufsbildungsprogrammen,<br />
die den Umwelt- und Entwicklungsbedürfnissen<br />
gerecht werden, mit einem gesicherten Zugang ... unabhängig<br />
von Sozialstatus, Alter, Geschlecht, Hautfarbe oder<br />
Religionszugehörigkeit“<br />
• der Ausbau nationaler Kapazitäten insbesondere im Bereich<br />
der wissenschaftlichen Aus- und Fortbildung.<br />
Maßnahmen<br />
Die Maßnahmen (ebd., S. 266-267) zielen u.a. auf:<br />
• die Bildungsplanung (Ermittlung des Ausbildungsbedarfs<br />
und Prüfung von Maßnahmen zu dessen Deckung)<br />
• generell die Sicherstellung einer beruflichen Ausbildung,<br />
sowie Einbindung von Umwelt- und Entwicklungsfragen<br />
bzw. des Umweltmanagements in die Ausbildung<br />
• die Verantwortung der Länder und der Bildungseinrichtungen,<br />
aber z.B. auch der nationalen Berufsverbände und der<br />
Gewerkschaften<br />
• die Integration von Ausbildung in Entwicklungs(hilfe)projekte.<br />
72
3.1 Die Herausforderung<br />
Instrumente zur Umsetzung<br />
Für den Zeitraum 1993-2000 wird mit Kosten von ca. 5 Mrd. US$ pro<br />
Jahr gerechnet.<br />
Bewertung / Diskurs<br />
Bildung (bzw. Erziehung, siehe unten) wird in der Agenda 21 als Möglichkeit<br />
zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung verstanden<br />
(deswegen im Teil IV – Möglichkeiten der Umsetzung – behandelt) und<br />
damit in eine Reihe neben Finanzressourcen bzw. Finanzierungsmechanismen<br />
(Kap. 33), internationale Rechtsinstrumente und -mechanismen<br />
(Kap. 39) oder die Wissenschaft (Kap. 35) gestellt.<br />
Damit werden zwei verschiedene Seiten von Bildung angesprochen:<br />
• Bildung als Recht des Menschen<br />
• Bildung als Instrument der Politik.<br />
Das soll nachfolgend vertieft werden, da es m. E. für ein Verständnis<br />
der Herausforderung – und für berechtigte Abgrenzungen – essenziell<br />
ist.<br />
Bildung ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass sich Menschen<br />
entfalten und am Prozess der Nachhaltigkeit partizipieren können.<br />
„Jeder hat das Recht auf Bildung”, heißt es in Artikel 26 (1) der<br />
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Auch in den Milleniumszielen<br />
(vgl. Kap. 2.2.5) wird das Recht auf Bildung betont.<br />
Bildung als Recht des<br />
Menschen<br />
Wer unzureichend gebildet ist, hat in einer modernen Gesellschaft<br />
schlechte Chancen bei der individuellen Verwirklichung, im Berufsleben<br />
oder hinsichtlich der Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung.<br />
Die Agenda 21 fordert daher im Kapitel 36<br />
(BUNDESUMWELTMINISTERIUM 1992, S. 261-267) u.a. einen generellen<br />
Zugang zur Grunderziehung im Rahmen der formalen Schulbildung<br />
oder nonformalen Bildung, eine Senkung der Analphabetenquote bei<br />
Erwachsenen um mindestens 50% gegenüber 1990 mit besonderer Berücksichtigung<br />
der Frauen, und räumt auch der beruflichen Ausbildung<br />
einen hohen Stellenwert ein. Es wäre verfehlt, die Umsetzung dieses<br />
Menschenrechts mit Verweis auf die allgemeine Schulpflicht in<br />
Deutschland als erfüllt anzusehen, denn auch im hoch entwickelten<br />
Deutschland hängen die Bildungschancen der Kinder ganz wesentlich<br />
von ihrer sozialen Herkunft ab (KULTUSMINISTERKONFERENZ 2002).<br />
Problematisch ist ferner, dass die pädagogischen Begriffe Bildung und<br />
Erziehung weitgehend undifferenziert nebeneinander gestellt werden;<br />
Bildung vs. Erziehung<br />
73
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
dies geht zu Lasten der Klarheit dieses Auftrages. Das ist beileibe keine<br />
Wortklauberei, vielmehr stehen diese Begriffe in der deutschen Debatte<br />
12 für unterschiedliche Konzepte, die zudem auch noch von verschiedenen<br />
Autoren unterschiedlich interpretiert werden, vgl. Exkurs<br />
„Lernen, Bildung und Erziehung“. Sie werden sich im Modul 3 „Didaktik<br />
der Umweltbildung“ vertiefend mit diesen Begriffen und Konzepten<br />
auseinandersetzen (vgl. auch FAULSTICH-WIELAND/FAULSTICH).<br />
Exkurs: Lernen, Bildung und Erziehung<br />
Der Begriff Lernen wird verwendet, um den Erwerb von Wissen und<br />
Können, von festgelegten Auffassungen, Methoden und Regeln zu<br />
beschreiben. Lernen dient dazu, bekannte und sich wiederholende Situationen<br />
zu bewältigen und wirkt somit system- und lebensformerhaltend.<br />
So verstandenes Lernen wurde vom CLUB OF ROME (1979,<br />
S. 30) als „tradiertes Lernen“ bezeichnet. Dieses Lernen ist auch heute<br />
noch erforderlich, in diesem Sinne erlernen wir z.B. eine Sprache,<br />
die Grundrechenarten oder das Verhalten im Straßenverkehr. Angesichts<br />
der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – angesichts ständig<br />
neuer und komplizierter Situationen, in denen sich die<br />
Menschheit befindet – reicht es jedoch nicht mehr aus (siehe auch<br />
Exkurs: Das menschliche Dilemma und die Grenzen des Lernens).<br />
Erziehung ist ziel- und zweckorientiert. Die Heranwachsenden sollen<br />
die Zwecke der Gesellschaft kennen lernen und an ihnen tätig interessiert<br />
werden (DEWEY 1993). Erziehungsziele sind dabei<br />
kulturrelevant und im Laufe der Zeit veränderbar. Hinter den Zielen<br />
stehen Normen und Werte, z.B. die aus dem Alten Testament überlieferten<br />
10 Gebote, die Menschenrechte oder evtl. künftig das Leitbild<br />
der Nachhaltigkeit. Die Spannbreite der Erziehungskonzepte<br />
reicht vom „herstellenden Machen“, bei dem die Erzieher die zu Erziehenden<br />
formen wie ein Handwerker sein Werkstück (z.B. Durkheim)<br />
bis hin zur Vorstellung Rousseaus, nach dem der Erzieher –<br />
wie ein Gärtner – das eigene Wachsen des Kindes begleitet und<br />
schützt (MAROTZKI 2003, S. 16-19).<br />
Bildung bezieht sich auf den Grad der Reflexivität des Individuums<br />
(die Fähigkeit, sich selbst „über die Schulter zu sehen“) und auf die<br />
Flexibilität in den Selbst- und Weltbildern (die Fähigkeit, sich selbst<br />
und die Welt auch mit anderen Augen zu sehen). Bildung zielt daher<br />
gerade darauf, unbekannte und offene Situationen zu meistern (MA-<br />
ROTZKI 2003, S. 22-29). Auch diese pädagogische Basiskategorie hat<br />
verschiedene Interpretationen erfahren.<br />
12. Der englische Begriff „education“ umfasst hingegen den Bildungs- und den<br />
Erziehungsaspekt.<br />
74
3.1 Die Herausforderung<br />
Wilhelm v. Humboldt sieht Bildung – in Opposition zum Erziehungsbild<br />
der Aufklärung – als Recht und Bestimmung des Menschen.<br />
„Der wahre Zweck des Menschen“ ist danach „die höchste<br />
und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen“<br />
(HUMBOLDT 1792/1980, S. 64).<br />
Nach KLAFKI (1985) ist Bildung differenziertes gesellschaftliches<br />
Problembewusstsein, sie befähigt den Menschen zur Selbstbestimmung,<br />
Mitbestimmung und Solidarisation.<br />
Der Begriff Erziehen fokussiert damit auf die Tätigkeit des Erziehers.<br />
Die Begriffe Lernen und Bildung fokussieren auf die Tätigkeiten des<br />
Lernenden bzw. des sich Bildenden. Bildung kann (wie auch der<br />
Aufbau von Kompetenzen) angeregt, ermöglicht und gefördert, nicht<br />
aber didaktisch „bewirkt“ werden. (vgl. MAROTZKI 2003, S. 24)<br />
Im Gegensatz zu noch älteren Vorstellungen vom Lernen als<br />
Wissenstransfer, verstanden Piaget (1896-1980) oder auch klassische<br />
konstruktivistische Ansätze (in den 1970er bis 1980er Jahren)<br />
Bildung primär als Selbstbildung, welche schon im Kindesalter vom<br />
Individuum selbst „ausgelöst und gesteuert wird und lediglich eine<br />
lernanregende und die kindliche Entwicklung stimulierende<br />
Umgebung benötigt.“ (GISBERT 2004, S. 19) Diese Position gilt<br />
inzwischen als überholt, statt dessen wird in neueren<br />
Bildungskonzeptionen „Bildung als soziale Ko-Konstruktion<br />
definiert, d.h. als sozialer Prozess, der im Kontext stattfindet und an<br />
dem Kinder, Eltern, Fachkräfte und andere Erwachsene aktiv<br />
beteiligt sind, und dies bereits ab der Geburt des Kindes.“ (ebd.)<br />
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ würde damit für ein Konzept<br />
stehen, das Menschen befähigen will, ihre eigenen Potenziale in einer<br />
Welt zu entfalten, die von den in der Agenda 21 beschriebenen Problemen<br />
und Herausforderungen geprägt ist. Ein Konzept der „Erziehung<br />
zur Nachhaltigkeit“ würde hingegen stärker die Interessen der Gesellschaft<br />
gegenüber dem Einzelnen betonen. – Nachfolgend wird allerdings<br />
weiterhin durchweg der Begriff „Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung“ verwendet, der sich im deutschen Sprachgebrauch ganz<br />
überwiegend durchgesetzt hat, unabhängig davon, ob nun der Bildungsoder<br />
der Erziehungsaspekt im Vordergrund steht.<br />
75
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Exkurs: Das menschliche Dilemma und Grenzen des Lernens<br />
Das menschliche Dilemma ist die Dichotomie (die Diskrepanz, das<br />
Auseinanderklaffen) zwischen einer wachsenden, selbst verschuldeten<br />
Komplexität aller Verhältnisse und der nur schleppenden Entwicklung<br />
unserer eigenen Fähigkeiten. So beschrieb der CLUB OF<br />
ROME bereits 1979 die existenzielle Herausforderung, der Lehrende<br />
und Lernende in modernen Gesellschaften gegenüber stehen.<br />
Fast 30 Jahre danach ist diese Herausforderung nicht kleiner geworden<br />
(vgl. RIECKMANN 2010, S. 40). Die Komplexität der Lebensverhältnisse<br />
wächst weiterhin – und immer schneller –, der Trend zur<br />
Individualisierung und Pluralisierung hält an. In unserer modernen<br />
Gesellschaft sind drei Typen von Krisen auszumachen (HEITMEYER<br />
1997), welche die Rahmenbedingungen für Bildung (nachfolgend<br />
wird auf die schulische Bildung fokussiert) drastisch verändern:<br />
Strukturkrisen: Die Gesellschaft bekommt die Folgen des Strukturwandels<br />
nicht in den Griff. So ist z.B. der zukunftsfähige Umbau des<br />
deutschen Arbeitsmarktes noch längst nicht gelöst, nach Jahren mit<br />
hoher Arbeitslosigkeit ist nun eher der Fachkräftemangel ein Problem.<br />
Diese Krisen treffen die Schulbildung z.B. dann, wenn<br />
• die öffentliche Hand nicht die Mittel bereitstellt, die wünschenswert<br />
wären,<br />
• in ganzen Landstrichen die Schülerzahlen drastisch<br />
schrumpfen (was auf den demographischen Wandel als<br />
eine andere Strukturkrise verweist) und Schulen geschlossen<br />
werden müssen (wie in den neuen Bundesländern)<br />
oder<br />
• Schüler sich fragen, warum sich angesichts der Lage auf<br />
dem Arbeitsmarkt das Lernen für sie überhaupt lohnen<br />
sollte.<br />
76
3.1 Die Herausforderung<br />
Regulationskrisen: Werte und Normen unterliegen der Pluralisierung.<br />
Das eröffnet einerseits dem einzelnen Menschen ungeahnte<br />
Möglichkeiten der eigenen Entfaltung. Aber der Kernbereich unstrittiger<br />
Normen in der Gesellschaft sinkt, ebenso die Bereitschaft zu ihrer<br />
Anerkennung. Der Bereich strittiger Normen wächst hingegen.<br />
Das spiegelt sich ganz unmittelbar auch in Schulen wider, wo es keine<br />
homogenen Klassenverbände mehr gibt, sondern Ansammlungen<br />
von Individuen aus ganz unterschiedlichen Milieus, mit ganz unterschiedlichen<br />
Lebensentwürfen, Einstellungen, Werten und Interessen<br />
und wo ein Lernarrangement, das in einer Klasse „funktioniert“,<br />
in der nächsten Klasse scheitern kann.<br />
Kohäsionskrisen betreffen die soziale Anerkennung, Zugehörigkeit,<br />
Bindung. Der Gesellschaft kommen die Kernbereiche der Vergemeinschaftung<br />
abhanden. Autorität bzw. Anerkennung bekommt ein<br />
Lehrer heute nicht mehr durch sein Amt – er muss sich diese in der<br />
täglichen Auseinandersetzung mit den Schülern hart erarbeiten. Gleiches<br />
gilt für den Aufbau eines Klassenverbandes oder für die Stellung<br />
jedes einzelnen Schülers darin.<br />
Die Funktionalität der herkömmlichen gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen,<br />
die auf zentraler Planung und Kontrolle der Ausführung<br />
basieren, sinkt. Der einzelne Mensch muss immer stärker<br />
Verantwortung übernehmen, Probleme definieren und Positionen beziehen.<br />
Dies gilt heute nicht mehr nur für die „Führungseliten“, die<br />
Verantwortung in Wirtschaft oder Gesellschaft übernehmen, sondern<br />
für jeden Menschen auch im Privatleben, bei der Suche nach dem eigenen<br />
Lebenskonzept in einer pluralen Gesellschaft, die keine eindeutigen<br />
Vorgaben und Orientierungen vermittelt.<br />
In einer hoch komplexen und hoch dynamischen Gesellschaft reicht<br />
es daher nicht mehr aus, sich während des Schulbesuchs oder während<br />
der Ausbildung einen Vorrat an Sachwissen anzueignen. Der<br />
Umgang mit Komplexität und Unsicherheit wird zu einem wesentlichen<br />
Ziel – und damit ist das Konzept „Bildung“ gefragt (vgl. auch<br />
RIECKMANN 2010, S. 40ff).<br />
Auch weil Sachwissen in vielen Lebensbereichen heutzutage schnell<br />
veraltet und Sachinformationen in zunehmender Fülle zur Verfügung<br />
stehen, verliert der reine Wissenserwerb an Bedeutung. Es wird zunehmend<br />
wichtiger, ein Leben lang zu lernen und die dafür notwendigen<br />
lernmethodischen Kompetenzen zu entwickeln (vgl. GISBERT<br />
2004).<br />
77
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Bildung als<br />
Instrument?<br />
In mehreren Passagen der Agenda 21 (z.B. Kap. 36.3 sowie 36.8, 36.9)<br />
wird ein Zusammenhang zwischen Bildung (Erziehung, öffentlicher<br />
Bewusstseinsbildung, Information), Bewusstsein und Verhaltensweisen<br />
postuliert. Derartige Kausalketten mögen auf den ersten Blick plausibel<br />
erscheinen. Dennoch muss vor der Annahme gewarnt werden,<br />
Bildung führe zwangsläufig zu einem vorab intendierten Bewusstsein,<br />
dieses würde sich zwangsläufig in einem „bewussten“ Verhalten niederschlagen<br />
und somit ließe sich Bildung als Instrument einsetzen, um<br />
eine nachhaltige Gesellschaft zu schaffen.<br />
Die Möglichkeiten, mit pädagogischen Mitteln konkretes Alltagsverhalten<br />
im Sinne der Nachhaltigkeit oder anderer politischer Ideen zu beeinflussen,<br />
sind eher gering. Umweltbezogenes Wissen, Einstellungen<br />
und Verhalten korrelieren kaum miteinander (GRUNENBERG/KUCK-<br />
ARTZ 2005). Bildungsexterne Faktoren beeinflussen das Handeln insgesamt<br />
wesentlich mehr, als Bildung es kann (vgl. SCHAHN 1997, S.34f,<br />
PREUSS 1997, S.63f, BURCHARDT 1996). Zu diesen Faktoren gehören<br />
z.B.:<br />
• die verfügbaren Handlungsalternativen (z.B.: Habe ich die<br />
Möglichkeit, vegetabile Abfälle im eigenen Garten zu kompostieren<br />
bzw. sie einem speziellen Sammelsystem zur Verfügung<br />
zu stellen? Reicht mein Haushaltsgeld, um fünf<br />
Personen mit Öko-Lebensmitteln zu versorgen?),<br />
• individuelle Kosten-Nutzen-Abwägungen (z.B.: „Rentiert“<br />
sich der Aufwand für die Getrennthaltung von Abfällen in<br />
Relation zu der damit erzielbaren gesellschaftlichen Wertschätzung,<br />
zu einer eventuellen Kosteneinsparung bei den<br />
Müllgebühren bzw. zur Befriedigung des Gewissens?) und<br />
• die Erfahrungen mit den Resultaten der eigenen Handlungen<br />
(z.B. Warum sollte ich auf einen leckeren Fisch verzichten,<br />
wenn ihm das nicht mehr das Leben rettet, weil er bereits im<br />
Laden auf Eis liegt?).<br />
• Auch z.B. prominente Vorbilder (vgl. MILKE/ROSTOCK<br />
2010) können als ein (potenzieller) Einflussfaktor angesehen<br />
werden, der außerhalb klassischer Bildungsaktivitäten<br />
angesiedelt ist.<br />
WIPPERMANN et.al (2009, S. 9) können anhand einer 2008 durchgeführten<br />
repräsentativen Befragung der bundesdeutschen Bevölkerung nachweisen,<br />
dass dem Umwelt- und Klimaschutz in den sozialen Milieus der<br />
Etablierten, der Postmateriellen und der Konservativen die höchste Bedeutung<br />
beigemessen wird. Aber: „Am wenigsten umweltbelastend<br />
verhalten sich die traditionellen Milieus... aufgrund ihrer ausgeprägten<br />
Orientierung an Sparsamkeit und Bescheidenheit“ – diese können sich<br />
78
3.1 Die Herausforderung<br />
„umweltschädigende Anschaffungen und Verhaltensweisen“ oftmals<br />
schlichtweg nicht leisten.<br />
Bildung als Instrument für die Umformung des Einzelnen im Interesse<br />
politischer Ideen zu verwenden, wäre zudem auch fragwürdig, weil damit<br />
die Grenzen zur Indoktrination überschritten würden. Bereits in der<br />
Geschichte der Umweltbildung gab es Stimmen, die sich gegen eine Instrumentalisierung<br />
wandten (vgl. Kap. 2.1). Im aktuellen Diskurs um<br />
die Bildung für nachhaltige Entwicklung warnt z.B. APEL (2005) davor,<br />
„der Bildung Aufgaben zuzumuten, die die Politik gerade nicht lösen<br />
kann – oder will“. Daher sollte eindeutig zwischen „einem Engagement<br />
für eine nachhaltige Gesellschaftsentwicklung... was ein originär politischer<br />
Prozess ist“ und dem pädagogischen Bemühen um eine <strong>BNE</strong> getrennt<br />
werden (vgl. auch DIECKMANN/PAULSEN 2003, S. 13, DE HAAN<br />
et. al 2008, S.123 und RIECKMANN 2010, S. 9). – Das schließt nicht aus,<br />
dass aus der Bildung heraus auch Forderungen an die Politik gestellt<br />
werden können (siehe folgendes Beispiel) und dass Know-how der Bildung<br />
auch in den politischen Entwicklungsprozessen benötigt wird<br />
(vgl. Kap. 4).<br />
Schüler in Düsseldorf hatten sich im Rahmen des Nachhaltigkeitsaudits<br />
(vgl. Kap. 3.4.1) mit Mobilität und Verkehr befasst und dabei herausgefunden,<br />
dass ihre Lehrer unter bestimmten Umständen kostengünstiger<br />
Bus und Bahn fahren können als sie selbst. Daraufhin wurde nicht versucht,<br />
die Schüler zu agitieren, dass sie dennoch in möglichst großem<br />
Umfang den öffentlichen Nahverkehr nutzen mögen. Vielmehr konnte<br />
das Problem über die Strukturen des Lokale-Agenda-Prozesses (vgl.<br />
Kap. 4.1.2) an die Politik gegeben werden. Dies hat mit dazu beigetragen,<br />
dass die Stadt Düsseldorf ab 2002 ein besonders günstiges Schülerticket,<br />
das sogenannte „Schoko-Ticket“ eingeführt hat.<br />
(VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR 2007 sowie HULDA-PANKOK-GE-<br />
SAMTSCHULE 2002)<br />
Die Agenda 21 enthält somit keinesfalls ein fertiges Bildungskonzept.<br />
Sie ist auch als Lehrmaterial kaum geeignet. Die Agenda 21 ist ein politisches<br />
Dokument, der darin enthaltene Bildungsauftrag muss operationalisiert<br />
werden, wie die Aufträge der anderen Kapitel auch.<br />
Bildungsauftrag der<br />
Agenda 21<br />
operationalisieren<br />
Dabei ist die Operationalisierung ein Prozess, in dem verschiedene Akteure<br />
mit jeweils eigenen Auffassungen und Interessen nach Definitionen,<br />
Kriterien und geeigneten Maßnahmen suchen. Es kann daher nur<br />
mehr oder weniger gut begründete Ausformungen des Konzepts, nicht<br />
aber die eine objektiv richtige Definition von <strong>BNE</strong> geben.<br />
79
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Einige der Lesarten des Bildungsauftrages der Agenda 21, die sich bisher<br />
herauskristallisiert haben, werden in Tabelle 3 vorgestellt.<br />
Tabelle 3: Lesarten des Bildungsauftrages der Agenda 21<br />
Lesart Details Quellen / Verweise<br />
Bildung (Grundausbildung,<br />
berufli-<br />
Agenda 21, Kap. 36 A+C,<br />
Milleniumsentwicklungsziel<br />
Nr. 2,<br />
che Bildung) für<br />
alle<br />
Öffentliche<br />
Bewusstseinsbildung<br />
Politische Bildung<br />
Synthese aus<br />
Umweltbildung,<br />
Globalem Lernen<br />
und weiteren<br />
Ansätzen<br />
Grundlegende<br />
Anforderung an<br />
Bildung im 21.<br />
Jahrhundert<br />
Bildung ist Voraussetzung für<br />
eine (einigermaßen) selbstbestimmte<br />
Teilhabe der Menschen<br />
am gesellschaftlichen<br />
Leben; Bildung als Menschenrecht;<br />
Zugang zu Bildung als<br />
ein Aspekt der Gerechtigkeit<br />
Der Erziehungsaspekt überwiegt<br />
hier; Problem ist die<br />
schwache Kausalität Bildung/<br />
Erziehung – Bewusstsein –<br />
Handeln<br />
Bürger haben das Recht auf<br />
politische Partizipation, z.B. in<br />
Umweltfragen. Sie sollen befähigt<br />
werden, dieses Recht auch<br />
wahrzunehmen. Lernen als<br />
gesellschaftsverändernde Praxis.<br />
<strong>BNE</strong> vereinigt Ansätze der<br />
Umweltbildung, entwicklungspolitischen<br />
Bildung, des interkulturellen<br />
Lernens, der<br />
Friedenserziehung, der Konsumerziehung,<br />
der Gesundheitserziehung<br />
und der politischen<br />
Bildung<br />
Bildung soll Schlüsselkompetenzen<br />
vermitteln, die benötigt<br />
werden, um die Anforderungen<br />
des 21. Jahrhunderts zu bestehen,<br />
welche ganz wesentlich<br />
von einer nachhaltigen Entwicklung<br />
bestimmt sind.<br />
Allgemeine Erklärung der<br />
Menschenrechte<br />
Agenda 21, Kap. 36 B<br />
Prinzip 10 der Rio-Deklaration,<br />
Aarhus-Konvention über die<br />
Zugänglichkeit von Umweltinformationen,<br />
Empowerment-Ansatz von<br />
VENRO (2005, S. 8-10),<br />
Lokale Agenda 21, kommunale<br />
Klimaschutzprozesse<br />
Positionspapier von ANU/<br />
DGU/GbU 1998<br />
DEUTSCHER<br />
2005, S. 3,<br />
BUNDESTAG<br />
einzelne Sets in den BLK-<br />
Modellprogrammen „21“<br />
und „Transfer 21“<br />
Konzept der Gestaltungskompetenzenin<br />
den BLK-<br />
Modellprogrammen „21“<br />
und „Transfer 21“,<br />
Kompetenzkonzept<br />
OECD (2005)<br />
der<br />
80
3.1 Die Herausforderung<br />
„Bedeutung und Umfang von Begriffen stehen in einem gegenläufigen<br />
Verhältnis zueinander.“ (OTT/DÖRING 2008, S. 20) Hier geht es darum,<br />
den Begriff der <strong>BNE</strong> mit Bedeutung zu füllen, es sollte daher gerechtfertigt<br />
sein, schon an dieser Stelle das Spektrum der Lesarten einzugrenzen.<br />
„Bildung für alle“ ist eine berechtigte Forderung – aber gleichwohl<br />
wenig geeignet, zur Definition von <strong>BNE</strong> beizutragen. „Öffentliche Bewusstseinsbildung“<br />
hat derart geringe Überschneidungen mit dem oben<br />
vorgestellten Bildungsbegriff, dass sie ebenfalls wenig zur Definition<br />
von <strong>BNE</strong> beitragen kann. Beide Lesarten werden daher nachfolgend<br />
nicht weiter berücksichtigt.<br />
3.1.2 Internationale Anbindung<br />
Verschiedene internationale Organisationen haben sich nach der Konferenz<br />
von Rio mit dem Bildungsauftrag der Agenda 21 befasst. Diese<br />
internationale Anbindung soll hier nur gestreift werden; informieren Sie<br />
sich ggf. ausführlicher im Bericht der Bundesregierung zur <strong>BNE</strong> (BUN-<br />
DESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2002, S. 5-8).<br />
Die UNESCO ist die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,<br />
Wissenschaft und Kultur. Die UNESCO nimmt die Aufgaben der<br />
Vereinten Nationen zur Umsetzung des Kapitels 36 der Agenda 21<br />
wahr. In dieser Funktion hat sie 1997 das Dokument „Educating for a<br />
Sustainable Future: A Transdisciplinary Vision for a Concerted Action“<br />
vorgelegt. Hier werden Prinzipien der <strong>BNE</strong> verdeutlicht.<br />
Die Rolle der<br />
UNESCO<br />
Die UNESCO ist mit zwei eigenen umfangreichen Programmen an der<br />
Umsetzung der Agenda 21 beteiligt.<br />
• „Der Mensch und die Biosphäre“ (Man and the Biosphere<br />
MAB) wurde 1970 als erstes zwischenstaatliches Umweltprogramm<br />
der UNESCO verabschiedet. Hier werden<br />
Modelle für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Biosphäre<br />
konzipiert, in repräsentativen Landschaften – den<br />
UNESCO-Biosphärenreservaten – erprobt und bewertet<br />
(BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG<br />
2002, S. 6).<br />
• Management of Social Transformations (MOST, seit 1993).<br />
Für den Zeitraum 2005-2014 hat die UNESCO die UN-Dekade „Bildung<br />
für nachhaltige Entwicklung ausgerufen“ (vgl. Kapitel 3.2.3).<br />
2009 fand in Bonn die Halbzeit-Konferenz zur UN-Dekade statt. (BUN-<br />
DESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2009, S. 9)<br />
81
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Die Rolle der UNECE<br />
Die UNECE ist die Ökonomische Kommission der Vereinten Nationen<br />
für Europa und damit eine von fünf regionalen Kommissionen der Vereinten<br />
Nationen.<br />
Auf ihrer Konferenz der Umwelt- und Kultusminister 2005 in Vilnius /<br />
Litauen hat die UNECE eine Strategie zur <strong>BNE</strong> verabschiedet (VEREIN-<br />
TE NATIONEN 2005) und ein Rahmendokument für die Implementation<br />
dieser Strategie beschlossen. Die <strong>BNE</strong>-Strategie soll einen Beitrag zur<br />
UN-Dekade leisten. Sie soll die Mitgliedsstaaten ermutigen, <strong>BNE</strong> in ihre<br />
Bildungssysteme (einschließlich informelle Bildung) zu integrieren<br />
und dabei die verschiedenen Fachressorts koordiniert vorgehen zu lassen.<br />
Die Strategie soll in drei Phasen bis zum Jahre 2015 umgesetzt werden<br />
(DEUTSCHER BUNDESTAG 2005, S. 7).<br />
Die Rolle der OECD<br />
In der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung<br />
sind die weltweit wichtigsten Industriestaaten zusammengeschlossen.<br />
Die OECD hat 1998 die nachhaltige Entwicklung als<br />
Schlüsselkomponente für die politische Strategie ihrer Mitgliedsstaaten<br />
aufgegriffen (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG<br />
2002, S. 7).<br />
1997 starteten die Mitgliedsstaaten der OECD ihre unter dem Kürzel<br />
PISA bekannte internationale Lernstandserhebung bei Schülern. Mit<br />
PISA soll überprüft werden, inwieweit Schülerinnen und Schüler gegen<br />
Ende ihrer Pflichtschulzeit die Kenntnisse und Fähigkeiten erworben<br />
haben, die für eine umfassende Beteiligung an der Gesellschaft erforderlich<br />
sind. PISA konzentrierte sich zunächst auf die Kenntnisse und<br />
Fähigkeiten in den Bereichen Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften<br />
und Problemlösung. Allerdings wurden bei der PISA-Studie 2006 auch<br />
Umweltwissen und die Rolle von Umweltthemen in Lehrplänen erfasst<br />
(BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2009, S. 10).<br />
Mit der DeSeCo-Studie (OECD 2005) legte die OECD einen konzeptionellen<br />
Referenzrahmen vor, mit dem die Kompetenzmessung auf<br />
neue Bereiche ausgeweitet werden soll. Dieses Kompetenzkonzept orientiert<br />
sich ausdrücklich an den Herausforderungen bzw. normativen<br />
Ansprüchen einer nachhaltigen Entwicklung (DEUTSCHER BUNDESTAG<br />
2005, S. 7). Wir werden im Kapitel 3.2.1 darauf zurückkommen.<br />
Resonanz in der EU<br />
Die EU hat 1998 in ihrem Positionspapier „Education and Awareness<br />
Raising“ 15 wesentliche Aspekte einer Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
beschrieben (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FOR-<br />
SCHUNG 2002 S. 7-8).<br />
Europäische Bildungsprogramme wie Sokrates, Leonardo oder Youth<br />
for Europe können auch für die Förderung der Umweltbildung bzw. der<br />
<strong>BNE</strong> genutzt werden.<br />
82
3.1 Die Herausforderung<br />
3.1.3 Erste Resonanz in Deutschland (1993-1998)<br />
Schon bald nach der Konferenz von Rio würdigten die die Bundesregierung<br />
beratenden Expertengremien die Rolle der Bildung im Kontext der<br />
nachhaltigen Entwicklung.<br />
Der Rat der Sachverständigen für Umweltfragen befasste sich in seinem<br />
Gutachten von 1994 ausführlich mit dem Leitbegriff der dauerhaft-umweltgerechten<br />
Entwicklung und mit Instrumenten zu seiner Verwirklichung.<br />
In diesem Zusammenhang wurden u.a. ethische Verflechtungen<br />
sowie bildungspolitische Instrumentarien untersucht (SRU 1994 S.<br />
164-176). Dabei betont der SRU unter anderem, dass er „die entscheidende<br />
ökologische Schlüsselqualifikation in dem grundlegenden Verstehen<br />
des umweltethischen Prinzips der Retinität“ sieht (ebd., S. 164,<br />
Hervorhebung im Original). Zudem entwirft er ein umfangreiches Paket<br />
von Instrumenten und Maßnahmen für eine Umweltbildungspolitik.<br />
Die Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des<br />
13. Deutschen Bundestages widmet sich in ihrem Abschlussbericht<br />
auch dem Innovationsaspekt der Nachhaltigkeit und verweist dabei auf<br />
die Rolle der Bildung (DEUTSCHER BUNDESTAG 1998, S. 373-375). Sie<br />
fordert<br />
SRU<br />
Enquete-Kommission<br />
• ein Popularisierungskonzept für die Idee der Nachhaltigkeit<br />
(ähnlich der AIDS-Aufklärung),<br />
• ein Machbarkeitskonzept (das praktikable Ansätze wie<br />
bspw. fifty/fifty in breiterem Maße zur Anwendung bringt)<br />
und<br />
• ein Bildungskonzept, das u.a. auf Reflexivität abzielt, auf<br />
die Fähigkeit, bisheriges Wissen und Verhalten zu überdenken<br />
und ggf. zu verändern.<br />
Ebenfalls 1998 veröffentlichten drei Verbände der Umweltbildung ein<br />
Bildungsprogramm für nachhaltige Entwicklung (ANU/DGU/GBU<br />
1998). Sie erkennen darin die Herausforderung einer <strong>BNE</strong> an und sprechen<br />
sich für eine doppelte Strategie aus:<br />
ANU, DGU, GbU<br />
a) Die bisher etablierte Umweltbildung wird auch weiterhin als<br />
eigenständiger Bereich benötigt, sie sollte erhalten und<br />
gestärkt werden. (Die dazu als notwendig angesehenen<br />
Maßnahmen werden hier nicht weiter ausgeführt.)<br />
b) Eine Weiterentwicklung der Umweltbildung zu einer Bildung<br />
für nachhaltige Entwicklung ist notwendig.<br />
83
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Im Vergleich zur bisher etablierten Umweltbildung hat sich die <strong>BNE</strong><br />
demnach veränderten Aufgaben und erweiterten Prämissen zu stellen:<br />
• Grundorientierung an der Idee der globalen, intra- und intergenerationellen<br />
Gerechtigkeit<br />
• Einbeziehung von im Nachhaltigkeitsdiskurs gewonnenen<br />
exakteren Kriterien für sozial, ökologisch, ökonomisch verträgliche<br />
Entwicklung („Indikatoren“)<br />
• Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen ökologischen,<br />
ökonomischen und sozialen Dimensionen der Entwicklung.<br />
Daraus ergeben sich für die <strong>BNE</strong> Thematiken, die:<br />
• „...sich auf die Rahmenbedingungen unseres Lebens, insbesondere<br />
auf Energie- und Stoffströme, Technikfolgeabschätzungen,<br />
Produktion, Transport und Medien beziehen...<br />
• ...sich auf Konsummuster, Lebensstile und Wertevorstellungen<br />
beziehen...<br />
• ...zur Kompetenzerweiterung und Handlungsfähigkeit im<br />
Sinne des sustainable developments beitragen“ (ANU/<br />
DGU/GBU 1998)<br />
KMK, BLK<br />
Auf der Ebene der Kultusministerkonferenz und der Bund-Länder-<br />
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung wurden<br />
schließlich die Weichen zur Umsetzung der <strong>BNE</strong> im föderalen deutschen<br />
Bildungssystem gestellt, vgl. nachfolgend Kap. 3.2.1.<br />
3.2 Die Umsetzung<br />
Angesichts der bisher gemachten Ausführungen liegt es auf der Hand,<br />
dass Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht alleine auf Schulen beschränkt<br />
werden kann. Die Umsetzung in Schulen bildet zwar hier den<br />
Schwerpunkt, daneben soll aber auch die frühkindliche Bildung beleuchtet<br />
(Kap. 3.2.2) und die informelle Bildung (im Kap. 4.1.3) zumindest<br />
gestreift werden.<br />
3.2.1 <strong>BNE</strong> in der Schule (BLK-Modellprogramme „21“ und<br />
„Transfer 21“)<br />
Das Modellprogramm „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“<br />
(Kurztitel: BLK-Programm „21“) sowie das Nachfolgeprogramm<br />
84
3.2 Die Umsetzung<br />
„Transfer 21“ sind die bisher umfangreichsten Aktivitäten zur Integration<br />
der <strong>BNE</strong> in das deutsche Schulsystem. Das BLK-Programm „21“<br />
wurde im Zeitraum vom 1.8.1999 bis zum 31.7.2004 realisiert. In dem<br />
durch die Bundesregierung sowie 15 Bundesländer 13 getragenen und<br />
(inklusive Transfer) mit insgesamt 23 Millionen Euro ausgestatteten<br />
Programm haben knapp 200 Modellschulen damit experimentiert, den<br />
Anspruch einer Bildung für nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Das<br />
in den Jahren 2004-2008 laufende Programm „Transfer 21“ diente einer<br />
breiten Implementierung; 2586 Schulen beteiligten sich. Programmträger<br />
war die Freie Universität Berlin mit dem Institut für erziehungswissenschaftliche<br />
Zukunftsforschung. Die Projektleitung lag bei Prof. Dr.<br />
Gerhard de Haan. Programmkoordinator war Eberhard Welz von der<br />
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport des Landes Berlin.<br />
(BLK 1998; DE HAAN/HARENBERG 1999, BLK 2005, BUNDESMINISTE-<br />
RIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2009)<br />
Die Agenda 21 als politisches Dokument eignet sich nicht als Lehrmaterial;<br />
auch die Strategie, Lehreinheiten zu den einzelnen Kapiteln der<br />
Agenda 21 zu produzieren, würde der Herausforderung der Nachhaltigkeit<br />
nicht ausreichend gerecht werden. Zur Begründung des BLK-Modellprogramms<br />
„21“ holen DE HAAN/HARENBERG (1999) daher weiter<br />
aus.<br />
Ausgangsüberlegungen<br />
Sie sehen Nachhaltigkeit als Modernisierungsszenario an, das die Bedrohungsszenarien<br />
der Umweltdebatte überwindet (ebd., S. 18). SIE<br />
verweisen nicht nur auf die Grundgedanken der Nachhaltigkeitsidee,<br />
sondern betonen:<br />
• Es gibt Parallelen bzw. Schnittmengen zwischen Grundprinzipien<br />
der nachhaltigen Entwicklung und aktuellen Bildungs-<br />
und Schulreformkonzepten, so z.B. „Partizipation,<br />
Reflexivität, Selbstevaluation und -organisation, regionale<br />
und lokale Identität“. Schulen, die sich mit Hinblick auf die<br />
Nachhaltigkeit entwickeln, sollten demnach auch Fortschritte<br />
in den Feldern der Schulreform erzielen. (ebd., S.<br />
27)<br />
• Die großen Themenfelder des Nachhaltigkeitsdiskurses sind<br />
weitgehend deckungsgleich mit den Innovationsfeldern, die<br />
für die künftige Entwicklung Deutschlands (als Industrienation,<br />
in Bezug auf Wissenschaft und Forschung sowie als<br />
Wissensgesellschaft) eine herausragende Rolle spielen. Zu<br />
den Schnittmengen gehören u.a. die Themen Bauen und<br />
Wohnen, Dienstleistung und Konsum, Energie und Roh-<br />
13. Das Saarland ist erst 2002 hinzugekommen, Thüringen ist ausgeschieden, Sachsen hat<br />
sich nicht beteiligt.<br />
85
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
stoffe sowie Gesundheit und Lebensprozesse. Wenn Schulen<br />
die Schüler auf ihre Zukunft hin ausbilden sollen – so<br />
die Argumentationslinie – müssen sie diese Themen mit<br />
berücksichtigen. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist<br />
damit „generell der Innovation in der schulischen Bildung in<br />
hohem Maße dienlich.“ (DE HAAN/HARENBERG 1999, S. 34)<br />
Bildungspolitisches<br />
Ziel: Integration von<br />
<strong>BNE</strong> in die schulische<br />
Regelpraxis.<br />
Übergeordnetes Lernziel:<br />
Gestaltungskompetenz<br />
Vor diesen Hintergründen wollten die Modellprogramme die Integration<br />
der Bildung für nachhaltige Entwicklung in die schulische Regelpraxis<br />
befördern. Dabei wurde keine Erziehung zu nachhaltigem Verhalten<br />
angestrebt, vielmehr sollten die Lernenden zu eigenständigen Urteilen<br />
und zu innovativem Handeln im Sinne der Nachhaltigkeit befähigt werden.<br />
Als übergeordnetes Lernziel postulierten DE HAAN/HARENBERG<br />
(1999, S. 60) die „Gestaltungskompetenz für nachhaltige Entwicklung<br />
... Mit Gestaltungskompetenz wird das nach vorne weisende Vermögen<br />
bezeichnet, die Zukunft von Sozietäten, in denen man lebt, in aktiver<br />
Teilhabe im Sinne nachhaltiger Entwicklung modifizieren und modellieren<br />
zu können.“<br />
Dieses Konzept der Gestaltungskompetenzen hat in Deutschland eine<br />
große Verbreitung gefunden, es wird (bis hin zu den <strong>BNE</strong>-Berichten der<br />
Bundesregierung) vielfach zitiert, und viele Bildungsprojekte nehmen<br />
darauf Bezug – daher soll es auch hier vorgestellt werden. Andererseits<br />
gilt es jedoch, eine rezepthafte Übernahme des Konzepts sowie didaktische<br />
Monokulturen zu vermeiden – daher werden auch Brüche thematisiert<br />
und Alternativen skizziert.<br />
86
3.2 Die Umsetzung<br />
Exkurs: Der Kompetenzbegriff<br />
Kompetenzen sind „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren<br />
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte<br />
Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen<br />
und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen<br />
in variablen Situationen erfolgreich und<br />
verantwortungsvoll nutzen zu können“ (WEINERT 2001, S.27).<br />
RYCHEN (2008, S. 16) weist darauf hin, dass der Kompetenzbegriff<br />
auf einem holistischen Verständnis beruhe, „nämlich dass Kognition<br />
und Emotion verbunden sind...“ und dass dies „im Übrigen auch<br />
durch neurowissenschaftliche Erkenntnisse untermauert“ werde.<br />
RIECKMANN (2010, S. 46) betont, dass Kompetenzen Handlungsdispositionen<br />
beschreiben, was nicht mit der Performance oder Handlungsausführung<br />
gleichgesetzt werden dürfe. „Kompetenzen sind<br />
entwicklungsfähig und damit erlernbar.“ (RIECKMANN 2010, S. 50,<br />
unter Bezug auf RYCHEN 2001)<br />
„Kompetenzen werden durch Handeln und Interaktion in formalen<br />
und informellen Bildungskontexten entwickelt.“ So formuliert es<br />
RYCHEN (2008, S. 21) und stellt damit einen auch für die <strong>BNE</strong> hilfreichen<br />
Wegweiser auf. TSCHEKAN (<strong>2011</strong>) befasst sich mit der Frage,<br />
wie Kompetenzen im Schulunterricht gefördert werden können.<br />
Im deutschsprachigen Raum (und insbesondere in der Berufsbildung)<br />
werden folgende Klassen von Kompetenzen unterschieden:<br />
personale, aktivitäts- und umsetzungsorientierte, fachlich-methodische<br />
und sozial-kommunikative Kompetenzen (RIECKMANN 2010, S.<br />
49-50). Die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz für die<br />
naturwissenschaftlichen Fächer in Deutschland (mittlerer Schulabschluss)<br />
umfassen die Kompetenzbereiche Fachwissen, Erkenntnisgewinnung,<br />
Kommunikation und Bewertung<br />
(KULTUSMINISTERKONFERENZ 2005 a, b, c).<br />
In einer bereits 1993 dokumentierten Studie wurden umfängliche<br />
Quellen ausgewertet und dabei 654 „Schlüsselqualifikationen“ identifiziert.<br />
Zu den 20 am häufigsten genannten zählten „Kommunikationsfähigkeit,<br />
Kooperationsfähigkeit, Denken in Zusammenhängen,<br />
Flexibilität, Kreativität, Selbständigkeit, Problemlösefähigkeit, …<br />
Verantwortungsgefühl und -bewusstsein, … abstraktes Denken, logisches<br />
Denken und selbständiges Lernen.“ (DIDY et. al. 1993)<br />
87
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Gestaltungskompetenz<br />
und ihre Teilkompetenzen<br />
Die Vorstellung davon, was Gestaltungskompetenz – also das zentrale<br />
Lernziel der <strong>BNE</strong> – sei wurde erst während der Laufzeit der Programme<br />
ausdifferenziert. In ihrem Gutachten zum Modellprogramm führen DE<br />
HAAN/HARENBERG (1999, S. 57ff) sechs didaktische Prinzipien an, die<br />
sich aus dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ergeben und denen<br />
jeweils mehrere Schlüsselqualifikationen zugeordnet werden können. 14<br />
In späteren Veröffentlichung werden sieben „Teilkompetenzen“ der<br />
Gestaltungskompetenz angeführt, noch später werden diese dann auf<br />
zehn bzw. zwölf erweitert (DE HAAN 2008, DE HAAN et.al 2008, FREIE<br />
UNIVERSITÄT BERLIN 2007 und o.J.), vgl. auch Tabelle 4.<br />
Diese mehrfache Modifikation weist bereits darauf hin, dass das Konzept<br />
der Gestaltungskompetenz – wie auch andere pädagogische Konzepte<br />
– nur als ein vorläufiges und auch hinterfragbares Konstrukt<br />
betrachtet werden kann. Wer dieses für die eigene Arbeit übernehmen<br />
möchte, sollte selbstverständlich auch prüfen, inwieweit es sich für die<br />
eigenen Ziele, Zielgruppen und Rahmenbedingungen eignet, bzw. welche<br />
Alternativen es gibt.<br />
In diesem Zusammenhang ist auf die Arbeit von RIECKMANN (2010)<br />
hinzuweisen. In einer international angelegten Delphi-Studie hat er in<br />
Zusammenarbeit mit Bildungsexperten aus Europa und Südamerika ein<br />
Set von „Schlüsselkompetenzen“ für die <strong>BNE</strong> entwickelt, das – regional<br />
unterschiedliche Schwerpunktsetzungen eingeschlossen – international<br />
anwendbar sein soll. Dabei legt er die Genese offen, er stellt<br />
insbesondere dar, auf welchen Weltsichten (Weltprobleme, Verständnis<br />
einer nachhaltigen Entwicklung, Wege zu bzw. Voraussetzungen und<br />
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung, Ziele der <strong>BNE</strong>)<br />
die Schlüsselkompetenzen beruhen. Das so entstandene Set umfasst 12<br />
Schlüsselkompetenzen; teilweise sind diese den Teilkompetenzen der<br />
Gestaltungskompetenz identisch bzw. ähnlich, es gibt aber auch eine<br />
ganze Reihe von Unterschieden, die RIECKMANN (2010, S.163-180)<br />
ausführlich diskutiert. 15<br />
14. Auf eine Wiedergabe an dieser Stelle wird verzichtet, Sie finden das Gutachten auf<br />
Stud.IP.<br />
15. Z.B.: Kompetenzen beinhalten immer auch motivationale Aspekte, daher hält<br />
RIECKMANN (2010, S. 168) es für unsinnig, die „Kompetenz zur Motivation“ als eigene<br />
Kategorie zu führen.<br />
88
3.2 Die Umsetzung<br />
Tabelle 4: Kompetenzkonzepte für die <strong>BNE</strong> (nach RIECKMANN, 2010, S. 166 und 172)*<br />
Gestaltungskompetenz (DE HAAN ET. AL In der Delphi-Studie identifizierte Schlüsselkompetenzen<br />
2008: 183-195)<br />
Kompetenz zur Perspektivübernahme Kompetenz zu Empathie und Perspektivenwechsel<br />
Kompetenz zur Antizipation<br />
Kompetenz zum vorausschauenden Denken<br />
Kompetenz zur disziplinenübergreifenden Kompetenz zum interdisziplinären Arbeiten<br />
Erkenntnisgewinnung<br />
Kompetenz zum Umgang mit unvollständigen<br />
und überkomplexen Informationen Umgang mit Komplexität<br />
Kompetenz zum vernetzten Denken und<br />
Kompetenz zur Kooperation<br />
Kompetenz zur Zusammenarbeit in (heterogenen)<br />
Gruppen<br />
Kompetenz zur Bewältigung individueller Bewertungskompetenz<br />
Entscheidungsdilemmata<br />
Kompetenz zur Partizipation<br />
Partizipationskompetenz<br />
Kompetenz zur Motivation<br />
Kompetenz zur Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz<br />
Kompetenz zur Reflexion auf Leitbilder Kompetenz zum kritischen Denken<br />
Kompetenz zum moralischen Handeln Kompetenz zum gerechten und umweltverträglichen<br />
Handeln<br />
Kompetenz zum eigenständigen Handeln Kompetenz zur Planung und Umsetzung<br />
innovativer Projekten und Vorhaben<br />
Kompetenz zur Unterstützung anderer Kompetenz zu Empathie und Perspektivenwechsel<br />
*Im Original (RIECKMANN, 2010, S. 166) enthält die Tabelle noch eine erste Spalte mit den<br />
DeSeCo-Schlüsselkompetenzen, diese wurde hier weggelassen. Die Schlüsselkompetenzen<br />
sind in der Formulierung von RIECKMANN, 2010, S. 172 wiedergegeben.<br />
Sowohl DE HAAN (2008) als auch RIECKMANN (2010) verweisen darauf,<br />
dass ihre Kompetenzsets enge Beziehungen zu den Schlüsselkompetenzen<br />
der OECD (bzw. DeSeCo) haben. Das halte ich allerdings für<br />
konstruiert, weshalb diese Schlüsselkompetenzen nachfolgend separat<br />
als Exkurs vorgestellt werden.<br />
Exkurs: Das Kompetenzmodell der OECD<br />
Die OECD hat ein System von Schlüsselkompetenzen vorgelegt,<br />
welche Menschen benötigen, um sich in der heutigen, von Herausforderungen<br />
wie Globalisierung, Modernisierung und Vernetzung geprägten<br />
Welt zurechtzufinden. (Sie finden das Dokument auf<br />
Stud.IP) Es enthält neun Kompetenzen, die insgesamt drei Kategorien<br />
zugeordnet werden. (OECD 2005, RYCHEN 2008)<br />
89
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Kompetenzkategorie 1: Interaktive Anwendung von Medien und<br />
Mitteln (Tools)<br />
• Fähigkeit zur interaktiven Anwendung von Sprache, Symbolen<br />
und Text<br />
• Fähigkeit zur interaktiven Nutzung von Wissen und Informationen<br />
• Fähigkeit zur interaktiven Anwendung von Technologien<br />
Kompetenzkategorie 2: Interagieren in heterogenen Gruppen<br />
• Fähigkeit, gute und tragfähige Beziehungen zu anderen Menschen<br />
zu unterhalten<br />
• Kooperationsfähigkeit<br />
• Fähigkeit zur Bewältigung und Lösung von Konflikten<br />
Kompetenzkategorie 3: Eigenständiges Handeln<br />
• Fähigkeit zum Handeln im größeren Kontext<br />
• Fähigkeit, Lebenspläne und persönliche Projekte zu gestalten<br />
und zu realisieren<br />
• Fähigkeit zur Wahrnehmung von Rechten, Interessen, Grenzen<br />
und Bedürfnissen<br />
Es sei betont, dass mit der Aufstellung von Kompetenzen noch nichts<br />
darüber gesagt ist, wie diese erworben werden können, bzw. wie der<br />
Kompetenzerwerb pädagogisch unterstützt werden kann. Das heißt,<br />
wenn Sie eigene Bildungsprojekte entwerfen, dann ersetzt die Bezugnahme<br />
auf vorliegende Sets von Kompetenzen keinesfalls die notwendige<br />
lerntheoretische Fundierung.<br />
Hoher Anspruch<br />
Im Vergleich zu einschlägigen Befunden über die Beziehungen von Jugendlichen<br />
zu Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit (vgl. Exkurs: Natur<br />
obskur) erscheinen die <strong>BNE</strong>-Gestaltungskompetenzen außerordentlich<br />
anspruchsvoll – auch wenn die Überschneidungen nur punktuell sind.<br />
90
3.2 Die Umsetzung<br />
Exkurs: Natur obskur<br />
Verschiedene soziologische Untersuchungen befassen sich mit dem<br />
Verhältnis des Menschen zur Umwelt. So lassen das BMU und das<br />
UBA seit 1991 regelmäßig eine repräsentative Umfrage zum Umweltbewusstsein<br />
durchführen; auch z.B. in der Shell-Jugendstudie<br />
spielen derartige Aspekte immer wieder eine Rolle.<br />
BRÄMER (2006 a und b) hat für seinen Jugendreport Natur ´06 ca.<br />
2200 Jugendliche der Klassen 6 bis 9 überwiegend in Nordrhein-<br />
Westfalen befragt und kommt u.a. zu folgenden (überwiegend) ernüchternden<br />
Ergebnissen:<br />
Das Zeitbudget der Jugendlichen ist von der Clique und den Medien<br />
bestimmt. Unternehmungen in der Natur werden seltener, obwohl<br />
noch immer 61% der Jugendlichen den nächsten Wald innerhalb von<br />
fünf Fußminuten erreichen können.<br />
Naturnutzung und Naturschutz sind für die Jugendlichen zwei weitgehend<br />
getrennte Welten. Auf der einen Seite haben viele Jugendliche<br />
ein fast ehrfürchtiges Verhältnis zu einer romantisch verklärten<br />
Natur, auf der anderen Seite scheint ihnen der Gedanke an eine verantwortungsvolle<br />
Nutzung der Natur zunehmend zu entgleiten.<br />
Sie beurteilen die produktive Nutzung der Natur außerordentlich kritisch,<br />
so z.B. das Fällen von Bäumen und das Jagen von Rehen. Natürliche<br />
Rohstoffe für alltägliche Produkte sind wenig bekannt;<br />
Ausnahmen bilden einige Küchenprodukte, die gut schmecken und<br />
lokal produziert werden (können), so z.B. Sahne oder Pudding.<br />
Damit ist auch grundlegend das Verständnis für Nachhaltigkeit vermauert,<br />
bei der es ja ganz zentral auch um das „Wie“ der Naturnutzung<br />
geht. Den meisten Jugendlichen fällt nichts zur Thema<br />
Nachhaltigkeit ein; bei Multiple-Choice-Fragen zu einzelnen Aspekten<br />
der Nachhaltigkeit „lagen die meisten Antwortquoten im Bereich<br />
der Ratewahrscheinlichkeit.“<br />
„Nach wie vor ersetzt eine ausgeprägte Sauberkeitsästhetik und bambihafte<br />
Verniedlichung der Natur (Tiere nicht stören, Pflanzen nicht<br />
beschädigen) ein profundes Nachhaltigkeitsbewusstsein.“<br />
Ermutigende Anzeichen sieht BRÄMER (ebd.) dort, wo Jugendliche<br />
regelmäßig den Wald besuchen, und zwar insbesondere auch abseits<br />
pädagogischer Betreuung<br />
91
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Unterrichts- und Organisationsprinzipien<br />
einer<br />
<strong>BNE</strong><br />
Interdisziplinäres<br />
Wissen<br />
Zur Vermittlung der Gestaltungskompetenzen im Schulwesen schlugen<br />
DE HAAN/HARENBERG (1999, S. 59ff) drei einander ergänzende Unterrichts-<br />
und Organisationsprinzipien vor. Diese bildeten zugleich als<br />
Module die inhaltliche Struktur des BLK-Modellprogramms „21“. Jedes<br />
dieser Unterrichts- und Organisationsprinzipien wurde durch mehrere<br />
einzelne Aspekte unterlegt. In der Struktur des BLK-<br />
Modellprogramms „21“ bildeten diese Aspekte die Themen für sogenannte<br />
„Sets“, in denen Schulen gemeinsam arbeiteten:<br />
Das Prinzip „Interdisziplinäres Wissen“ knüpfte an die Notwendigkeit<br />
„vernetztes Denken", an das Schlüsselprinzip der Retinität (der Vernetzung<br />
von Natur und Kulturwelt) sowie der Entwicklung von Problemlösungskompetenzen<br />
an. Ziel war u.a. die Verankerung entsprechender<br />
Inhalte und Arbeitsformen in den Curricula der Länder sowie in den<br />
Programmen der einzelnen Schulen.<br />
Im BLK-Modellprogramm „21“ wurde dieses Prinzip in folgenden Sets<br />
umgesetzt:<br />
• Syndrome globalen Wandels 16 ,<br />
• Umwelt und Entwicklung 17 ,<br />
• Nachhaltiges Deutschland 18 ,<br />
• Gesundheit und Nachhaltigkeit.<br />
Partizipatives Lernen<br />
Das Prinzip „Partizipatives Lernen“ griff die zentrale Forderung der<br />
Agenda 21 nach Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen am Prozess<br />
der nachhaltigen Entwicklung auf und verwies auf eine lebenslange<br />
Förderung lerntechnischer und -methodischer Kompetenzen.<br />
Im BLK-Modellprogramm „21“ wurde dieses Prinzip in folgenden Sets<br />
umgesetzt:<br />
• Partizipation in der Lokalen Agenda 21,<br />
• Gemeinsam für eine nachhaltige Region,<br />
• Nachhaltigkeitsindikatoren entwickeln.<br />
16. Das Set bediente sich des vom WBGU (1996) vorgelegten Syndromkonzeptes und bindet<br />
dieses in die Schulbildung ein.<br />
17. Dieser Aspekt nutzte Grundlagen, die schon lange vorher in Bereichen wie dem Globalen<br />
Lernen, in der Eine-Welt-Zusammenarbeit oder mit analytischen Modellen wie Global<br />
Footprints oder dem ökologischen Rucksack gelegt worden waren.<br />
18. Hier wurde auf BUND/MISEREOR (1995 und 1996) zurückgegriffen, nach welcher<br />
positive Leitbilder für nachhaltiges Handeln propagiert werden (vgl. Kap. 2.3.3).<br />
92
3.2 Die Umsetzung<br />
Beim Prinzip „Innovative Strukturen“ wurd davon ausgegangen, dass<br />
die Schule als Ganzheit bildungswirksam ist, und es wurden Parallelen<br />
zu aktuellen schulischen Reformfeldern thematisiert.<br />
Innovative Strukturen<br />
Im BLK-Modellprogramm „21“ wurde dieses Prinzip in folgenden Sets<br />
umgesetzt:<br />
• Nachhaltigkeitsaudit an Schulen 19 ,<br />
• Schülerfirmen zwischen Ökonomie und Ökologie 20 ,<br />
• Schulprofil „nachhaltige Entwicklung" 21 ,<br />
• Neue Formen externer Kooperation 22 .<br />
Die Modellprogramme, die explizite mit dem Anspruch der Innovation<br />
angetreten waren (DE HAAN/HARENBERG 1999, S. 34, 35), greifen somit<br />
stark auf bereits vorher entwickelte Ansätze zurück. Ihnen kommt<br />
jedoch der Verdienst zu, diese Ansätze wertgeschätzt und den beteiligten<br />
Schulen Freiräume zur Weiterentwicklung bzw. Implementation eröffnet<br />
zu haben. Zudem wurde mit den drei Prinzipien der Blick darauf<br />
gerichtet, dass das deutsche Bildungssystem grundlegende inhaltliche,<br />
methodische und organisatorische Veränderungen benötigt.<br />
Die BLK-Modellprogramme „21“ wurde in Kooperation von Bund und<br />
Ländern umgesetzt. Dabei konnten die Länder entscheiden, welche der<br />
oben angeführten Aspekte sie an welchen Standorten umsetzen wollten.<br />
Somit entstanden „Sets“, d.h. Zusammenschlüsse von Schulen die aufgrund<br />
ihrer inhaltlichen und räumlichen Nähe (gleicher Aspekt, gleicher<br />
Standort) ihre <strong>BNE</strong>-Arbeit parallel entwickeln und sich dabei<br />
austauschen bzw. miteinander kooperieren konnten.<br />
Organisation der<br />
Modellprogramme<br />
Im Modellprogramm „21“ wurden 28 Sets realisiert (BLK 2005). In jedem<br />
Set wurden zunächst die Arbeitsstrukturen geschaffen und Schulen<br />
19. Das „Nachhaltigkeitsaudit“ an Schulen basierte auf dem Öko-Audit, das bereits 1992 in<br />
einer Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (EG 1993) beschrieben und bereits seit<br />
1996 von mehreren Schulen erfolgreich als innovative Struktur für schulische<br />
Umweltbildung adaptiert worden war (vgl. Kap. 3.4.1).<br />
20. Auch Schülerfirmen gab es bereits zuvor. Die DEUTSCHE KINDER- UND JUGENDSTIFTUNG<br />
(o.J.) hat seit 1995 einen entsprechenden Schulversuch in Sachsen realisiert, und die<br />
ALEXANDER-VON-HUMBOLDT-SCHULE VIERNHEIM hat bereits 1994 eine Schülerfirma<br />
gegründet, die als schulische „Energie-Agentur“ mit ökonomischen Mitteln das<br />
Energiesparen befördert.<br />
21. Hier wurde auf die bereits in vielen Bundesländern laufenden Bestrebungen zur<br />
Entwicklung von Schulen mit Hilfe von Schulprofilen bzw. Schulprogrammen<br />
zurückgegriffen.<br />
22. Dieser Aspekt bediente sich der außerordentlich positiven Erfahrungen, wie sie z.B. über<br />
Jahre hinweg im GÖS-Programm des Landes Nordrhein-Westfalen gesammelt worden<br />
waren.<br />
93
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
gewonnen. Die Schulen haben dann ihre Aspekte erprobt und ihre Arbeit<br />
schrittweise weiterentwickelt. Schließlich wurden Projektergebnisse,<br />
Handreichungen und andere verallgemeinerungsfähige Erkenntnisse<br />
publiziert.<br />
Mit dem nachfolgenden BLK-Modellprogramm „Transfer 21“ sollte im<br />
Zeitraum 2004-2008 der Transfer in die Breite realisiert werden. Es<br />
wurden neue Schulen einbezogen, Multiplikatoren ausgebildet, weitere<br />
Materialien publiziert, etc. (PROGRAMM TRANSFER-21 o.J.).<br />
Ergebnisse<br />
Evaluation des BLK-<br />
Programms „21“<br />
Die Modellprogramme haben den beteiligten Schulen die Möglichkeit<br />
gegeben, zu experimentieren, sich weiter zu entwickeln und viele konkrete<br />
und beispielhafte Aktionen zu realisieren. Die Schulen haben eine<br />
große Vielfalt an Ideen, Konzepten und Erfahrungen produziert. Ein<br />
konkretes Beispiel wird im Kap. 3.4.1 vorgestellt. Einen Überblick zu<br />
den Veröffentlichungen bietet die Projekthomepage www.transfer-<br />
21.de.<br />
Das Programm wurde auf vier Ebenen evaluiert (BLK 2005, S. 11-12):<br />
• zentrale Programmevaluation mit den Zielen (1) Auskunft<br />
über den Stand der Erreichung der Programmziele, (2) Präzisere<br />
Beschreibung der Gelingensbedingungen von <strong>BNE</strong><br />
• länderspezifische Vorhaben in Schleswig-Holstein, Hessen,<br />
Saarland<br />
• externe Evaluation der Koordinierungsstelle<br />
• Unterstützung der Selbstevaluation an den Programmschulen.<br />
Die Ergebnisse wurden in Abschlussberichten publiziert (BLK 2005,<br />
PROGRAMM TRANSFER-21 o.J.). Einige Aspekte sollen nachfolgend<br />
vorgestellt werden.<br />
Verankerung von <strong>BNE</strong><br />
in der schulischen<br />
Regelpraxis<br />
Die im Rahmen des Modellprogramms „21“ erreichte Verankerung der<br />
<strong>BNE</strong> in den Schulen wird im Abschlussbericht als generell sehr erfolgreich<br />
eingeschätzt (BLK 2005, S. 13-21; die dazu gehörende Datenbasis<br />
wurde von RODE 2005, S. 58ff veröffentlicht). Unter anderem wird hervorgehoben:<br />
• Die Programmschulen haben <strong>BNE</strong> in Schulprogrammen<br />
und anderen innerschulischen Selbstverpflichtungen verankert<br />
(als Regelfall, d.h. es gibt auch Ausnahmen).<br />
• Sie haben <strong>BNE</strong> strukturell in stabilen schulischen Steuergruppen<br />
verankert und damit das sonst oftmals verbreitete<br />
Einzelkämpfertum überwunden.<br />
94
3.2 Die Umsetzung<br />
• Die Schulen haben <strong>BNE</strong> zum integralen Baustein des Unterrichts<br />
gemacht, sie nehmen diese als Bereicherung des<br />
Unterrichtsalltags und als Beitrag zur Entwicklung bzw.<br />
Sicherung der Bildungsqualität wahr.<br />
• <strong>BNE</strong> gewinnt an Bedeutung bei der Entwicklung von Lehrund<br />
Rahmenplänen bzw. -richtlinien.<br />
• Die Kooperation mit außerschulischen Partnern wurde<br />
intensiviert und institutionalisiert, „außerschulische Stützsysteme“<br />
wurden somit geschaffen.<br />
Im Modellprogramm „Transfer 21“ wurde eine Expansion auf 10% der<br />
Schulen in den beteiligten Ländern sowie die Ausweitung auf Grundschulen<br />
und Ganztagsschulen angestrebt. Mit 2586 Schulen (12,1%)<br />
konnte das quantitative Ziel übererfüllt werden. Allerdings widmeten<br />
sich die Schulen der <strong>BNE</strong> in sehr unterschiedlicher Tiefe, daher wurde<br />
zwischen Kernschulen (238 Schulen), Kooperationsschulen (1421) und<br />
Kontaktschulen (927) unterschieden. (PROGRAMM TRANSFER-21 o.J.,<br />
S. 45)<br />
In dem 68 Seiten umfassenden Abschlussbericht (BLK 2005) werden<br />
dem zentralen Lernziel des Modellprogramms gerade einmal drei Seiten<br />
gewidmet; in der 147 seitigen Abschlussevaluation (RODE 2005)<br />
sind es fünf Seiten.<br />
Transfer in die Breite<br />
Gestaltungskompetenz<br />
und Teilkompetenzen<br />
Es wird eingeschätzt, dass sich die „Thematisierung und systematische<br />
Förderung von Gestaltungskompetenz bzw. Teilkompetenzen ... insgesamt<br />
bewährt“ hat „wenn auch zu Beginn Schwierigkeiten zu überwinden<br />
waren“. Hindernisse werden u.a. in einer noch mangelnden<br />
Absicherung in Rahmenplänen, Schulgesetzen bzw. Curricula und in<br />
der zeitlichen Belastbarkeit der Lehrkräfte gesehen. Zudem wird eingestanden,<br />
dass das Konzept innerschulisch kaum evaluierbar ist, da die<br />
Operationalisierung noch aussteht (BLK 2005, S. 21-24).<br />
Der Abschlussbericht (ebd.) liefert hierzu kein empirisches Datenmaterial.<br />
Aus der Abschlussevaluation (RODE 2005, S. 132-136) geht hervor,<br />
dass nicht einmal der Versuch unternommen wurde, den<br />
Kompetenzgewinn bei den Schülern zu messen. Statt dessen wurden lediglich<br />
subjektive Selbsteinschätzungen der Schüler erhoben. Dabei<br />
wurden<br />
• die Einstellungen der Schüler zu Fragen der Nachhaltigkeit<br />
und<br />
• ihre Wahrnehmung der eigenen Zuwächse an Gestaltungskompetenz<br />
95
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
abgefragt. Dabei wird z.B. der Grad an Zustimmung zu der Aussage<br />
„Ich bin jetzt eher bereit, mein eigenes Verhalten zu ändern (z.B. sparsamer<br />
mit Energie und Wasser umzugehen)“ als ein Maß für die Einstellungen<br />
zur Nachhaltigkeit genutzt. Analog dazu sollen mit der<br />
Zustimmung zu Aussagen wie „Ich kann jetzt komplizierte Zusammenhänge<br />
besser verstehen.“ die Zuwächse an Gestaltungskompetenz abgebildet<br />
werden. Ungeklärt bleibt dabei u.a., wie realistisch die<br />
Selbsteinschätzungen der Schüler sind und auch ob alle Schüler die Fragen<br />
auf die gleiche Weise interpretiert haben. Da keine Kontrollgruppen<br />
einbezogen wurden, bleibt ferner die Wirkungszurechnung zum<br />
Modellprogramm ungeklärt.<br />
Im Rahmen von Transfer 21 konzentrierte sich die Evaluation auf den<br />
Transfer. Zum Erwerb von Gestaltungskompetenz heißt es im Abschlussbericht:<br />
„Da in den Ländern zu diesem Punkt allgemeine Aussagen<br />
formuliert wurden, wird erst die in der Transferforschung erhobene<br />
Evaluation zeigen, in welcher Quantität und Qualität Gestaltungskompetenz<br />
bei den Schülern realisiert werden konnte...“ (PROGRAMM<br />
TRANSFER-21 o.J., S.54).<br />
Die beiden Modellprogramme bleiben damit den Nachweis, ihr zentrales<br />
Lernziel erreicht zu haben, weitgehend schuldig.<br />
Mit dieser kritischen Einschätzungen soll keinesfalls die engagierte Arbeit<br />
der vielen beteiligten Schulen diskreditiert werden. Die wissenschaftliche<br />
Begleitforschung zu organisieren bzw. durchzuführen und<br />
damit die Wirksamkeit des Konzepts nachzuweisen, war Aufgabe der<br />
Projektstelle in Berlin.<br />
<strong>BNE</strong> als Innovation?<br />
Die <strong>BNE</strong> war Ende der 90er Jahre als innovatives Konzept angetreten,<br />
das Schwächen der Umweltbildung überwinden wollte. In der Vorbereitung<br />
auf das schulbezogene BLK-Modellprogramm „21“ würdigten<br />
DE HAAN/HARENBERG (1999, S. 49-53) zwar die Umweltbildung als<br />
„Innovationsauslöser“, andererseits führten sie mehrere Kritikpunkte<br />
an, die es mit dem Modellprogramm zu überwinden gäbe. Einige davon<br />
sollen nachfolgend wieder aufgegriffen werden:<br />
„Die Flucht in die Idylle der Natur“ (ebd.): Dieser Vorwurf war schon<br />
damals einseitig – seit Jahrzehnten gibt es in der Umweltbildung immer<br />
auch Strömungen, welche sich der Gesellschaft zuwenden, die herrschenden<br />
Verhältnisse kritisieren und die Lernenden zur Partizipation<br />
befähigen wollten (siehe folgender Exkurs).<br />
„Das exotische Flair der Umweltbildung“: Hiermit kritisierten DE<br />
HAAN/HARENBERG (ebd.) zu Recht eine schulische Umweltbildung, die<br />
auf singuläre Projekte setzt und mit dem sonstigen Schulbetrieb (Schulleben,<br />
Zensuren,...) nichts zu tun hat. Heute sind nachhaltigkeits-rele-<br />
96
3.2 Die Umsetzung<br />
vante Themen Bestandteil vieler Rahmenpläne und somit auch im<br />
Unterricht verankert (am Beispiel des Klimaschutzes: LANGNER <strong>2011</strong><br />
und <strong>2011</strong>h). Einige Schulen haben auch daran gearbeitet, den ganzen<br />
Schulbetrieb nachhaltiger zu gestalten, z.B. im Set „Nachhaltigkeitsaudit“<br />
der BLK-Modellprogramme (vgl. Kap. 3.4.1).<br />
„Die Dominanz fachbezogener Lehrkonzepte“: Gemeint war, dass<br />
das ganze Bildungssystem der Tradition verpflichtet sei, gesichertes<br />
Fachwissen an Schüler weiterzugeben. „Solange „Wissenschaftsorientierung“<br />
ausschließlich als „Fachwissenschaftsorientierung“ verstanden<br />
wird, kann Bildung für nachhaltige Entwicklung jedoch nicht ihrem Gegenstand<br />
angemessen ausfallen.“ (DE HAAN/HARENBERG ebd., S. 51).<br />
Diese Kritik ist auch heute noch weitgehend aktuell. Moderne Lehrpläne<br />
weisen zwar auch Themengebiete aus, die Fächer verbindend bearbeitet<br />
werden sollen, aber die fachwissenschaftliche Sicht überwiegt<br />
weiterhin.<br />
„Das Unvermögen, starre Strukturen und eingefahrene Lehrmethoden<br />
zu lockern“: <strong>BNE</strong>, so DE HAAN/HARENBERG (ebd., S. 51) sei<br />
„Teil eines radikalen strukturellen Wandels der Gesellschaft“, welcher<br />
auch Organisationen zum Lernen zwinge und andere Formen des Lehrens<br />
und Lernens erfordere. Es ist ein Verdienst der BLK-Modellprogramme,<br />
dass in dieser Hinsicht vielfältige Methoden und Projekte<br />
ausprobiert und auf der Projekthomepage publiziert wurden.<br />
„Die unzureichende wissenschaftliche Begleitforschung“: Dieser<br />
Kritikpunkt war berechtigt; allerdings hat auch die wissenschaftliche<br />
Begleitforschung zu den BLK-Modellprogrammen ganz erhebliche<br />
blinde Flecken, da sie das übergeordnete Lernziel „Gestaltungskompetenz“<br />
weitgehend ausklammert. Dabei wäre es für die Entwicklung der<br />
<strong>BNE</strong> dienlich gewesen, empirisch fundierte Antworten zu folgenden<br />
Fragen zu erhalten: In welchem Maße konnten sich die beteiligten<br />
Schüler Gestaltungskompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung aneignen?<br />
Welche Unterrichts- und Organisationsprinzipien und welche<br />
Module sind besonders geeignet, den Erwerb von Gestaltungskompetenzen<br />
zu fördern? Welche didaktischen Prinzipien oder sonstigen Erkenntnisse<br />
und Ratschläge können Bildungspraktikern, die künftig neue<br />
Lernarrangements zur <strong>BNE</strong> entwickeln möchten, als Leitfaden an die<br />
Hand gegeben werden? Welche Werkzeuge können Lehrpersonen nutzen,<br />
um den Erwerb der Gestaltungskompetenzen durch ihre Schüler<br />
selbst zu evaluieren?<br />
„Die stückwerkhafte Umweltbewußtseinsforschung“: Das Umweltbewusstsein<br />
der Deutschen ist in den vergangenen Jahren mehrfach und<br />
gründlich untersucht worden (vgl. www.umweltbewusstsein.de). Das<br />
geht bis dahin, dass milieuspezifischen Umwelteinstellungen erforscht<br />
und daraus Schlussfolgerungen für die Umweltkommunikation abgelei-<br />
97
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
tet wurden (WIPPERMANN et. al 2009). Es liegt nun an den Bildungsakteuren,<br />
diese Erkenntnisse aufzugreifen.<br />
Es lässt sich zusammenfassen, dass diese mit der Einführung des <strong>BNE</strong>-<br />
Begriffs und mit den BLK-Modellprogrammen geweckten Hoffnungen<br />
bislang teilweise erfüllt sind.<br />
Exkurs: Umweltbildung – ein Blick zurück<br />
Eine problem- und handlungsorientierte Umwelterziehung sollte<br />
nach BOLSCHO, EULEFELD, SEYBOLD (1980, S. 17f) „Schülern die<br />
Auseinandersetzung mit ihrer natürlichen, sozialen und gebauten<br />
Umwelt erschließen... die Fähigkeit zum Problemlösen in komplexen<br />
Systemen fördern...“ und „Schüler für die Beteiligung am politischen<br />
Leben... befähigen.“<br />
MICHELSEN et.al. (1986) setzten sich mit damals populären didaktischen<br />
Kriterien ökologisch orientierter Bildung auseinander, diese<br />
waren: Zukunftsorientierung, Lernen aus Betroffenheit, Lernen aus<br />
Erfahrung, reflexives Lernen, ganzheitliches Lernen, vernetztes (interdisziplinäres)<br />
Denken sowie Handlungsorientierung. Sie wiesen<br />
darauf hin, dass diese Kriterien durchaus ihre blinden Flecken haben,<br />
die es zu überwinden gelte. So fragt die Zukunftsorientierung (antizipatives<br />
Lernen) nach wünschenswerten oder wahrscheinlichen Zukünften<br />
und versucht, daraus heute erforderliche Schritte abzuleiten –<br />
dies bedürfe aber durchaus des ergänzenden geschichtlichen Blicks<br />
auf die Ursachen der aktuellen Umweltprobleme. Sie würdigten das<br />
Lernen aus Erfahrung – gleichzeitig wiesen sie darauf hin, dass einige<br />
schwerwiegende Umweltprobleme nicht sinnlich erfahrbar sondern<br />
nur aufgrund erheblicher Abstraktionsleistungen<br />
nachvollziehbar seien, dass also die Erfahrungs- durch eine Wissenschaftsorientierung<br />
komplementiert werden müsse.<br />
BUDDENSIEK (1991) suchte Wege zur Öko-Schule und legte dafür<br />
ein umfassendes Gedankengebäude vor. Gesellschaftliche Ausgangsbedingungen<br />
sah er insbesondere in der Notwendigkeit einer<br />
ökonomisch-ökologischen Wende und in der „Risikogesellschaft“<br />
(BECK 1986). Zu den Zielen der Umwelterziehung rechnete er, die<br />
Lebensgrundlagen und deren Vernetztheit kennen sowie ökologisch<br />
handeln zu können und zu wollen. Es entwickelte einen ökologischen<br />
Problemrahmen, arbeitete Segmente (Themen/Aspekte) für die Umwelterziehung<br />
heraus und begründete deren Auswahl.<br />
98
3.2 Die Umsetzung<br />
Er entwickelte modellhaft „ökologische Lernwege“. Buddensiek<br />
setzte sich sehr kritisch mit dem Schulsystem auseinander, was in der<br />
Aussage gipfelte: „Solange die Schule sich nicht auf ihre Gesamtverantwortung<br />
für die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden … besinnt,<br />
wäre es besser, die Finger von der Umwelterziehung zu<br />
lassen.“ (ebd., S. 134) Der erforderliche ökologische Umbau von<br />
Schule berühre u.a. die Schulorganisation, die Pädagogik und die<br />
Öffnung der Schule. Buddensiek zeigte, wie Schulen ein Netz von<br />
Lernorten aufbauen können, um ihren Schülern über deren Schullaufbahn<br />
hinweg Lernpfade für ökologisches und soziales Lernen zu bieten.<br />
Er stellte die Schulen von Tvind (Dänemark) vor, die bereits in<br />
den 70er Jahren eine Großwindanlage errichtet und damit ein Zeichen<br />
für die Energiewende gesetzt haben. Der Lehrerpersönlichkeit<br />
sowie der Lehrerbildung widmete ein eigenes Kapitel. Die einzelnen<br />
Diskussionsstränge führte er schließlich zu einer Skizze der idealtypischen<br />
Schule „Ökotopia“ zusammen.<br />
3.2.2 <strong>BNE</strong> in der frühkindlichen Bildung<br />
Die frühkindliche Bildung / Elementarpädagogik umfasst die Institutionen<br />
Kinderkrippe, Kindergarten und Kindertagesstätte. Ein bereichsspezifisches<br />
<strong>BNE</strong>-Konzept für die frühkindliche Bildung, das<br />
hinsichtlich der theoretischen Fundierung und der systematischen Implementierung<br />
mit den beiden BLK-Modellprogrammen für Schulen<br />
vergleichbar wäre, gibt es in Deutschland nicht. Damit ist es hier nur<br />
möglich, auf wenige laufende Projekte zu verweisen und Anknüpfungspunkte<br />
in der Debatte um die frühkindliche Bildung zu suchen.<br />
Leuchtpol will die Bildung für nachhaltige Entwicklung am Beispiel<br />
von Energie und Umwelt in Kindergärten fördern. Kinder sollen „spielerische<br />
und bewusste Zugänge zu ihrer Umwelt und insbesondere zum<br />
Phänomen Energie ... finden.“ (LEUCHTPOL o.J. a)<br />
Leuchtpol<br />
Zu diesem Zweck bietet Leuchtpol Fortbildungen für Erzieherinnen an.<br />
Diese sollen das Gelernte dann in ihren Einrichtungen umsetzen und<br />
werden dabei auch von Leuchtpol unterstützt. Daneben werden einzelne<br />
Aktionen durchgeführt, so z.B. die Aktion „Ein Tag ohne Strom“, an<br />
der sich 2010 ca. 200 Kitas beteiligten. (LEUCHTPOL o.J. b)<br />
Mit acht Regionalbüros ist Leuchtpol bundesweit präsent. Bis 2012 will<br />
das Projekt 10% der deutschen Kitas, also ca. 4.000 Einrichtungen erreichen.<br />
(LEUCHTPOL o.J. a)<br />
99
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Das Projekt wird von der Leuchtpol gemeinnützige Gesellschaft zur<br />
Förderung von Umweltbildung im Elementarbereich mbH durchgeführt.<br />
Der alleinige Gesellschafter ist die Arbeitsgemeinschaft Naturund<br />
Umweltbildung (ANU) e.V. Es wird von der Leuphana Universität<br />
Lüneburg unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. Ute Stoltenberg wissenschaftlich<br />
begleitet und evaluiert. Das Projekt wird vom Energiekonzern<br />
E.ON finanziert. (LEUCHTPOL o.J. c)<br />
Die Leuchtpol gGmbH bindet zur Umsetzung weitere Bildungsakteure<br />
ein, so wurden die Regionalbüros in bereits etablierte Umwelt-(bildungs-)einrichtungen<br />
integriert, und es gibt „Mitmachaktionen“, bei<br />
denen externe Partner, finanziert durch Leuchtpol, mit Kitas kooperieren.<br />
Das Projekt wird exzellent vermarktet. Dank seiner Größe und einer offensiven<br />
PR ist es beinahe täglich aufs Neue in den Medien präsent 23 .<br />
Leuchtpol ist als bislang einzige bundesweite <strong>BNE</strong>-Maßnahme für den<br />
Elementarbereich im Nationalen Aktionsplan vertreten (DEUTSCHE<br />
UNESCO-KOMMISSION o.J.a).<br />
<strong>Weiterbildung</strong> zur<br />
NaturkindergärtnerIn<br />
Die <strong>Weiterbildung</strong> will „die TeilnehmerInnen auf der Basis eigener Erfahrungen<br />
befähigen, die Natur mit ihrem Reichtum als eine unerschöpfliche<br />
(religions-)pädagogische Quelle zu erkennen und dem<br />
Alltag der Kinder im Kindergarten eine neue, gesündere Prägung zu geben.“<br />
(ÖKUMENISCHES INFORMATIONSZENTRUM et. al. o.J.)<br />
In vier einwöchigen Kursen, die sich über einen Zeitraum von einem<br />
Jahr erstrecken, werden u.a. folgende Themen verhandelt:<br />
• Kinder brauchen Feuer und Wärme / Erde und Wurzeln /<br />
Wasser und Bewegung / Luft und Freiheit<br />
• Die Zukunft unserer Kinder zwischen Umweltkatastrophen<br />
und Ökooptimismus<br />
• Befreiungen von Behinderungen (Sicherheit im Naturkindergarten)<br />
• Waldkindergarten, Bauernhofkindergarten<br />
• Verschiedene Ernährungsformen und ihre Berechtigung<br />
• Natur mit allen Sinnen im Jahreskreis erleben<br />
• Farben der Natur – Naturfarben zum Spielen & Renovieren<br />
23. Quelle: Eigene Beobachtung anhand eines Google-Alerts. Dieser von Google kostenlos<br />
bereitgestellte Service liefert dem Abonnenten täglich Links zu allen neuen Webseiten<br />
(einschließlich – sofern öffentlich zugänglich – Foren, Blogs oder Online-Ausgaben von<br />
Tageszeitungen), die ein vorgegebenes Stichwort enthalten.<br />
100
3.2 Die Umsetzung<br />
• Der Umweltkindergarten – gesund, baubiologisch, fair<br />
(ebd.)<br />
Am Ende der <strong>Weiterbildung</strong> wählen die Teilnehmerinnen einen Aspekt<br />
aus, setzen diesen in ihrer Einrichtung um und dokumentieren dies in einer<br />
Hausarbeit. Die Herangehensweise ist daher mit der von Leuchtpol<br />
vergleichbar, allerdings ist die <strong>Weiterbildung</strong> zur NaturkindergärtnerIn<br />
thematisch breiter aufgestellt, und hier wird nicht explizite auf die <strong>BNE</strong><br />
verwiesen. Schließlich ist die Reichweite sehr begrenzt, bislang wurden<br />
zehn <strong>Weiterbildung</strong>en durchgeführt, die jeweils 20 Teilnehmerinnen<br />
kamen überwiegend aus Mitteldeutschland.<br />
Die <strong>Weiterbildung</strong> wird vom Diakonischen Werk Braunschweig, dem<br />
Ökumenischen Informationszentrum Dresden und dem Umweltbüro<br />
Nord e.V. getragen.<br />
KITA21 ist im Kern ein Auszeichnungsverfahren für Kindertagesstätten,<br />
die sich in der <strong>BNE</strong> engagieren. Auf dem Weg dahin können die<br />
Einrichtungen Unterstützung in Anspruch nehmen, z.B. in Form von<br />
Workshops, Handreichungen und individueller Beratung. (S.O.F. o.J. a)<br />
KITA21<br />
Das Projekt will ausdrücklich Gestaltungskompetenz fördern, in offensichtlicher<br />
Anlehnung an die BLK-Modellprogramme (DE HAAN 2002,<br />
DE HAAN et.al 2008) dazu wird gerechnet:<br />
• „Weltoffenheit<br />
• Achtung und Wertschätzung gegenüber Natur und Umwelt<br />
• Toleranz gegenüber anderen Menschen, Meinungen und<br />
Andersartigem<br />
• gemeinsam an einem Problem arbeiten und zu Lösungen<br />
kommen können<br />
• sich bewusst werden, dass das eigene Handeln für sich<br />
selbst und andere von Bedeutung ist“ (S.O.F. o.J. b)<br />
Zur Frage, wie <strong>BNE</strong> umgesetzt werden könne, wird darauf verwiesen,<br />
• „Themen aus dem Alltag der Kitas, wie Wasser, Energie,<br />
Ernährung, Konsum, Mobilität und Natur erleben“ aufzugreifen,<br />
• die Kinder, aber auch die Eltern sowie externe Partner einzubinden<br />
• die Kita als Lernort zukunftsfähig zu gestalten, z.B.<br />
Umgang mit Energie, Gestaltung des Außengeländes“ (ebd.)<br />
101
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
KITA21 ist ein Projekt der S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung.<br />
Es ist auf Hamburg und Umgebung beschränkt.<br />
Diskussion<br />
Die Elementarpädagogik legt Grundlagen dafür, dass Kinder den Herausforderungen<br />
ihres späteren Lebens gewachsen sind. Insofern ist es<br />
„wichtig, die Ziele und Inhalte der frühkindlichen Bildungs- und Erziehungspläne<br />
auf das Ziel – eine Kultur der Nachhaltigkeit – abzustimmen.“<br />
(PRAMLING SAMUELSSON/KAGA, 2010, S. 103) Wenn man<br />
berücksichtigt, dass Klein- bzw. Vorschulkinder andere Bedürfnisse<br />
und Lernvoraussetzungen aufweisen als ältere Kinder oder Jugendliche,<br />
dann erscheint es plausibel, dass ein für die Schule entwickeltes <strong>BNE</strong>-<br />
Konzept nicht einfach auf die Elementarpädagogik übertragen werden<br />
kann.<br />
Exkurs: Lernen lernen<br />
GISBERT (2004) geht davon aus, dass Menschen heutzutage ihr Leben<br />
lang lernen müssen, dass sie daher die Fähigkeit erwerben müssen,<br />
eigenverantwortlich und selbstgesteuert zu lernen und dass die<br />
Grundlagen für diese Fähigkeit bereits im frühsten Kindesalter gelegt<br />
werden. Dabei sind „das „Lernen des Lernens“ und das „Lernen von<br />
Inhalten“ untrennbar miteinander verknüpft.“ (ebd., S. 25) Die Elementarpädagogik<br />
solle daher lernmethodische Kompetenzen von<br />
Kindern fördern, allerdings solle sie „die Aufgaben der Schule nicht<br />
in vorgezogener Weise übernehmen“ (ebd., S. 17).<br />
Die Autorin analysiert die bundesdeutsche und internationale Fachdiskussion<br />
zur Elementarpädagogik kritisch, was nachfolgend nur<br />
anhand von zwei Beispielen illustriert werden soll.<br />
ELSCHENBROICH (2001) hat in der viel beachteten Publikation „Weltwissen<br />
der Siebenjährigen“ eine Liste von ca. 70 Erfahrungen und<br />
Gefühlen, Fragen sowie Bildungs- und Wissensinhalten vorgelegt,<br />
mit denen Kinder bis zu ihrem siebenten Lebensjahr in Berührung<br />
gekommen sein sollten. Sie hält damit den Eltern bzw. der Elementarpädagogik<br />
einen Spiegel vor und macht Erstrebenswertes – und<br />
auch Mängel – deutlich. Die Liste basiert auf Gesprächen mit über<br />
150 Personen, sie ist jedoch nicht lerntheoretisch oder entwicklungspsychologisch<br />
fundiert und kann damit „keine Grundlage für ein Bildungskonzept<br />
sein“ (GISBERT 2004, S. 46).<br />
102
3.2 Die Umsetzung<br />
Jean Piaget hat mit seiner konstruktivistischen Entwicklungspsychologie<br />
die Elementarpädagogik stark beeinflusst. Nach Piagets Theorie<br />
konstruieren „Individuen ihr Wissen selbsttätig und aktiv auf<br />
Grundlage von Erfahrungen“ (GISBERT 2004, S. 83). Von Geburt an<br />
haben Kinder „ein gewisses Verständnis für die Vorgänge in ihrer<br />
Umgebung, das ihnen hilft, die erlebten Vorgänge immer tiefer und<br />
umfassender zu begreifen. Jede neue Information wiederum führt dazu,<br />
die Interpretation von Erfahrungen zu verändern, so dass ein Zyklus<br />
entsteht, der sich über die gesamte Lebensspanne erstreckt.“<br />
Dabei strebt der Mensch eine zunehmend bessere Organisation seines<br />
Wissens und letztlich eine zunehmend bessere Anpassung an seine<br />
Umwelt an. (ebd.) Nach Piaget durchläuft jedes Kind zwischen 0<br />
und ca. 12 Jahren nacheinander vier unterschiedliche kognitive Stufen,<br />
in jeder dieser Stufen kann es spezifische Lern- und Entwicklungsfortschritte<br />
machen. Die Beobachtungen, auf die sich Piaget<br />
stützte und somit letztlich auch seine Schlussfolgerungen sind jedoch<br />
durch zahlreiche neuere Untersuchungen revidiert worden. So hatte<br />
Piaget postuliert, dass das Denken von Kindern in der Lebensphase<br />
von 2 bis 6 Jahren egozentrisch sei. LEMPERS/FLAVELL/FLAVELL<br />
(1977) beobachteten jedoch, „dass schon 2-Jährige, wenn man sie<br />
bittet, ihrer Mutter ein Bild zu zeigen, das Bild so drehen, dass die<br />
Mutter es sehen kann und nicht sie selbst.“ (GISBERT 2004, S. 99) Sie<br />
deuteten dies mit der Fähigkeit, eine andere Perspektive zu übernehmen<br />
– eine Fähigkeit, welche Kinder in diesem Alter nach Piaget<br />
noch nicht haben dürften. – Somit hat Piaget „die Fähigkeiten der<br />
Kinder konsistent unterschätzt“ (GISBERT 2004, S. 108), andererseits<br />
war seine Theorie, gerade dadurch dass sie Widerspruch, weitere Untersuchungen<br />
und Revision herausgefordert hat, für die Wissenschaft<br />
sehr produktiv.<br />
GISBERT (ebd., S. 9), aber auch DAHLBERG (2010) und FTHENAKIS<br />
(2010) halten die Auffassung von Bildung als Ko-Konstruktion für<br />
zeitgemäß, an welcher neben den Kindern auch die Eltern, die Erzieherinnen<br />
bzw. Lehrer sowie weitere Erwachsene mitwirken.<br />
103
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
GISBERT (2004, S. 118) unterscheidet zwei Bereiche des Wissens von<br />
Kindern: einerseits „so genannte privilegierte Wissensdomänen, in<br />
denen bereits Säuglinge und Kleinkinder komplexes Wissen aufweisen<br />
und im Laufe der Entwicklung elaborierte implizite Theorien erwerben.“<br />
So wissen Kinder bereits im Alter von drei Monaten dass,<br />
„Objekte auch dann weiterhin existieren, wenn man sie nicht mehr<br />
sieht“, d.h. sie haben das physikalische Konzept der Objektpermanenz<br />
verinnerlicht (ebd. S. 121). Schon Säuglinge interessieren sich<br />
besonders für Gesichter und Augen, sie „versuchen, mit Menschen<br />
und Tieren zu kommunizieren“ und nehmen damit eine „der wesentlichen<br />
Unterscheidungen auf dem Gebiet der Biologie... zwischen belebten<br />
und unbelebten Objekten“ vor. (ebd. S. 123) „Dennoch sind<br />
sich Kinder vor dem 10. Lebensjahr über die Lebendigkeit und die<br />
Eigenschaften von Pflanzen noch unsicher...“ (ebd., S. 124).<br />
Im Gegensatz dazu stehen die nichtprivilegierten Wissensdomänen,<br />
zu denen insbesondere die Metakognition gehört. „Das Denken über<br />
das eigene Denken und Lernen gehört zu jenen Gebieten, die Kinder<br />
nur dann erwerben, wenn sie unterrichtet werden.“ (ebd. S. 118)<br />
PRAMLING (1986) konnte zeigen, „dass Kinder im Vorschulalter ihre<br />
Lernprozesse kaum als solche wahrnehmen.“ (ebd. S. 165)<br />
PRAMLING (1996, vgl. auch PRAMLING SAMUELSSON/CARLSSON<br />
2007) entwickelte daher einen metakognitiven Ansatz der Frühpädagogik,<br />
der „darauf zielt, bei den Kindern ein Bewusstsein für ihre<br />
Lernprozesse zu schaffen, ihre intuitiven Theorien über das Lernen<br />
zu verändern und Kompetenzen der Selbststeuerung zu vermitteln.“<br />
(GISBERT 2004, S. 170) Erzieherisches Handeln sollte demnach u.a.<br />
davon geleitet sein, „sowohl die Inhalte als auch das Lernen selbst“<br />
zu betonen, die Kinder „sollten ein Bewusstsein dafür entwickeln,<br />
dass sie lernen, was sie lernen und wie sie es lernen.“ Die Reflexion<br />
über das Lernen soll gefördert werden. Unterschiedliche Denkansätze<br />
der Kinder sollten herausgearbeitet und bewusst als Ressource für<br />
den Lernprozess genutzt werden. (ebd., S. 170-172)<br />
Das von Pramling ausgearbeitete metakognitive Curriculum für die<br />
Frühpädagogik zielt nicht darauf, dass die Kinder bereits Basisfähigkeiten<br />
erwerben, die den ersten Klassenstufen vorbehalten sind –<br />
wohl aber sollen sie deren Bedeutung entdecken (ebd., S. 190). So<br />
kennen manche Kinder in der Kindertagesstätte bereits einzelne<br />
Buchstaben, sie sollten z.B. „zu der Einsicht geführt werden, dass<br />
man mit der Schriftsprache Botschaften austauschen kann.“ (ebd., S.<br />
171)<br />
104
3.2 Die Umsetzung<br />
Entsprechende zielgruppenspezifische und wissenschaftlich begründete<br />
<strong>BNE</strong>-Konzeptionen liegen den eingangs vorgestellten Projekten eher<br />
nicht zugrunde. Die <strong>Weiterbildung</strong> zur NaturkindergärtnerIn nimmt gar<br />
keinen expliziten Bezug auf die <strong>BNE</strong>, was nach Einschätzung des BUN-<br />
DESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (2009, S. 17) für eine<br />
ganze Reihe <strong>BNE</strong>-relevanter Projekte in diesem Bildungsbereich gilt.<br />
Leuchtpol und KITA21 stellen ihre <strong>BNE</strong>-Bezüge nur sehr knapp dar. –<br />
Auch eine wissenschaftliche Evaluation fehlt; bei Leuchtpol ist diese<br />
immerhin vorgesehen.<br />
In der frühkindlichen Bildung besteht daher weiterer Diskussions-, Forschungs-<br />
und Entwicklungsbedarf. Worauf könnte eine frühkindliche<br />
<strong>BNE</strong> aufbauen (Vorwissen, intuitive Theorien, dem individuellen Entwicklungsstand<br />
des Kindes entsprechende Lerndispositionen)? Und<br />
letztlich auch: Ist <strong>BNE</strong> wirklich ein geeignetes Konzept in der frühkindlichen<br />
Bildung – oder sollte hier nicht zunächst ganz generell die Entwicklung<br />
der Kinder gefördert werden (z.B. ihre lernmethodische<br />
Kompetenzen, z.B. Freude am Forschen und Entdecken, z.B. erste Naturerfahrungen)?<br />
3.2.3 UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“<br />
(2005-2014)<br />
Die Vereinten Nationen haben 2002 für die Jahre 2005-2014 die Weltdekade<br />
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen und die<br />
UNESCO mit der Koordinierung betraut. Damit ist die Vision verbunden,<br />
„allen Menschen Bildungschancen zu eröffnen, die es ermöglichen,<br />
sich Wissen und Werte anzueignen sowie Verhaltensweisen und<br />
Lebensstile zu erlernen, die für eine lebenswerte Zukunft und eine positive<br />
gesellschaftliche Veränderung erforderlich sind.“ (UNESCO<br />
2005).<br />
In Deutschland griff die Deutsche UNESCO-Kommission diese Initiative<br />
auf. Sie verabschiedete 2003 die „Hamburger Erklärung“ und rief<br />
darin zu einer „Allianz Nachhaltigkeit Lernen“ auf. (DEUTSCHE<br />
UNESCO-KOMMISSION 2003). Die Kommission wendete sich darin zunächst<br />
an die Verantwortlichen in Bund, Ländern und Gemeinden sowie<br />
an weitere interessierte Kreise und empfahl Maßnahmen für die<br />
Umsetzung der Dekade, die später in einen nationalen Aktionsplan<br />
mündeten (siehe unten). Sie wendete sich zudem an die UNESCO und<br />
schlug für jedes Jahr der Dekade ein Thema vor.<br />
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wirkt innerhalb der<br />
Bundesregierung federführend. Die Deutsche UNESCO-Kommission<br />
erhielt vom Deutschen Bundestag den Auftrag, die über die staatliche<br />
Ebene hinausreichenden nationalen Aktivitäten im Rahmen der UN-<br />
Beteiligte Institutionen<br />
in Deutschland<br />
105
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Dekade zu koordinieren. Dazu berief die Kommission ein Nationalkomitee<br />
als beratendes und steuerndes Gremium ein. Dieses Nationalkomitee<br />
hat u.a. einen Runden Tisch der Allianz Nachhaltigkeit Lernen<br />
einberufen und Arbeitsgruppen gegründet.<br />
Nationaler<br />
Aktionsplan<br />
Ziele des Nationalen<br />
Aktionsplans<br />
2005 wurde der Nationale Aktionsplan der <strong>BNE</strong> für Deutschland veröffentlicht<br />
(DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION 2005). Er dient dem Ziel,<br />
„den Gedanken der nachhaltigen Entwicklung in allen Bereichen der<br />
Bildung in Deutschland zu verankern“ (ebd., S. 10).<br />
Für die Weiterentwicklung der <strong>BNE</strong> in Deutschland werden vier „strategische<br />
Ziele“ verfolgt (ebd., S. 10) :<br />
1. Weiterentwicklung und Bündelung der Aktivitäten sowie<br />
Transfer guter Praxis in die Breite,<br />
2. Vernetzung der Akteure der Bildung für nachhaltige Entwicklung,<br />
3. Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung von Bildung<br />
für nachhaltige Entwicklung,<br />
4. Verstärkung internationaler Kooperationen.<br />
Diese Ziele werden durch Teilziele unterlegt. In einem Maßnahmekatalog<br />
(DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION o.J.a) werden zudem beispielhaft<br />
Projekte vorgestellt, die der Umsetzung der vier strategischen Ziele<br />
dienen und dabei bundesweite Relevanz haben. Dieser Maßnahmeplan<br />
wird – wie auch der gesamte Aktionsplan – im Laufe der UN-Dekade<br />
fortgeschrieben (DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION 2008).<br />
Dekade-Projekte<br />
Im Rahmen der UN-Dekade werden Akteure bzw. Interessenten dazu<br />
aufgerufen, sich in der „Allianz Nachhaltigkeit Lernen“ zusammenzufinden.<br />
Seit 2005 ruft das Nationalkomitee bundesweit Projekte und Initiativen<br />
dazu auf, sich als „Offizielle Dekadeprojekte“ zu bewerben<br />
und damit die dezentrale Umsetzung der UN-Dekade zu forcieren. Über<br />
1.000 Projekte wurden bis Sommer <strong>2011</strong> ausgezeichnet (DEUTSCHE<br />
UNESCO-KOMMISSION o.J.b). Seit 2007 können auch Kommunen für<br />
ihre <strong>BNE</strong>-Aktivitäten ausgezeichnet werden.<br />
Die Anerkennung als Dekadeprojekte wird durch eine Jury des Nationalkomitees<br />
ausgesprochen. Die so anerkannten Projekte erhalten die<br />
Berechtigung, das Logo der Dekade zwei Jahre lang für ihre Öffentlichkeitsarbeit<br />
zu nutzen. Auf diese Weise entsteht eine (bedingt durch die<br />
relativ unkonkrete Ausschreibung erfrischend bunte) Sammlung interessanter<br />
Beispielprojekte, die Sie im www.bne-portal.de abrufen können.<br />
106
3.2 Die Umsetzung<br />
Die FREIE UND HANSESTADT HAMBURG (2005) untersetzte als erstes<br />
Bundesland den Nationalen Aktionsplan auf Landesebene. Der Hamburger<br />
Aktionsplan enthält ähnliche Bausteine wie der Nationale Aktionsplan,<br />
insbesondere einen ausführlichen Maßnahmekatalog, eine<br />
Auflistung der relevanten Akteure und eine Definition von <strong>BNE</strong>.<br />
Hamburger<br />
Aktionsplan<br />
Definition Bildung für nachhaltige Entwicklung im Hamburger<br />
Aktionsplan<br />
Die Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit wird (und Bildung für<br />
nachhaltige Entwicklung soll damit):<br />
• „Schlüsselthemen einer nachhaltigen Entwicklung aufgreifen<br />
und behandeln, insbesondere zu den Themen<br />
Energie und Klimaschutz, Konsum und Lebensstile, Biodiversität<br />
und Lebensräume, Bauen und Wohnen, Ernährung<br />
und Gesundheit, Verteilungsgerechtigkeit,<br />
Armutsbekämpfung, Menschenrechte, Welthandel,<br />
Migration und kulturelle Vielfalt, internationale Zusammenarbeit,<br />
• Aspekte der Geschlechtergerechtigkeit sowie interkulturelle<br />
und generationenübergreifende Perspektiven dabei<br />
berücksichtigen,<br />
• ökologische Themenfelder mit sozialen und wirtschaftlichen<br />
Aspekten verknüpfen,<br />
• lokale oder globale Nachhaltigkeitsdefizite aufzeigen<br />
und entsprechende Lösungswege entwickeln,<br />
• Nachhaltigkeitsstrategien (Effizienz = Erhöhung des<br />
Wirkungsgrades, Suffizienz = Hinlänglichkeit, Konsistenz<br />
= Orientierung an Naturkreisläufen und Substitution<br />
= Austausch umweltschädlicher gegen umweltfreundliche<br />
Stoffe) erlebbar und nachvollziehbar machen,<br />
• Kompetenzen, die Zukunft zu gestalten, fördern, die<br />
Menschen befähigen, an einer nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung<br />
mitwirken zu können (z.B. vorausschauend<br />
denken, weltoffen und neuen Perspektiven<br />
zugänglich sein, partizipieren können, an der Nachhaltigkeit<br />
orientiert planen und agieren zu können, Empathie,<br />
Engagement und Solidarität zeigen, sich und andere motivieren<br />
können, auf individuelle wie kulturelle Leitbilder<br />
reflektieren können, mit Komplexität und Ungewissheit<br />
umgehen),<br />
107
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
• Methoden einsetzen, die selbstorganisiertes Lernen und<br />
die Beteiligung vieler Menschen an Entscheidungsprozessen<br />
ermöglichen (z. B. Zukunftswerkstätten und -konferenzen,<br />
Open Space, Planungszellen, Simulationsspiele,<br />
Planspiele, Rollenspiele),<br />
• zukunftsfähige Leitbilder entwickeln und transportieren<br />
helfen (z. B. „Gut leben statt viel haben“ oder „Von linearen<br />
zu zyklischen Produktionsprozessen“),<br />
• die Bildungsstätte selbst zum Lernort über Nachhaltigkeit<br />
und zum Gegenstand des Unterrichts machen und<br />
sie nicht nur als Kulisse begreifen, vor der das Lernen<br />
stattfindet.“<br />
Diese Definition stellt Leitplanken auf, an denen sich Bildungspraktiker<br />
bei der Konzeption, Umsetzung und Evaluation ihrer Bildungsangebote<br />
orientieren können; ich habe das für meine Arbeit als sehr hilfreich<br />
empfunden. Sie hat aber auch Nachteile: Zunächst werden hier Kriterien,<br />
die ganz verschiedenen Betrachtungsebenen (Nachhaltigkeit und<br />
Pädagogik, Ziele und Mittel) entstammen, unsortiert nebeneinander gestellt.<br />
Vor allem aber basiert diese Definition auf der Inhaltsebene auf<br />
dem Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, sie trägt damit dessen<br />
Nachteile – vor allem die große Unschärfe in der Abgrenzung von Themen<br />
(vgl. Kap. 2.4) – mit in die Bildung.<br />
Weitere Aktionspläne<br />
auf Länderebene<br />
Empfehlungen der<br />
KMK und der DUK zur<br />
<strong>BNE</strong><br />
Inzwischen haben weitere Länder entsprechende <strong>BNE</strong>-Aktionspläne<br />
vorgelegt (vgl. www.bne-portal.de).<br />
Die Kultusministerkonferenz (KMK) und die Deutsche UNESCO-<br />
Kommission (DUK) haben 2007 gemeinsam Empfehlungen zur <strong>BNE</strong><br />
veröffentlicht, in denen sie auch ausdrücklich Bezug auf die UN-Dekade<br />
nehmen (KMK/DUK 2007). Das nur sieben Seiten umfassende Papier<br />
ist vor allem deshalb erwähnenswert, weil sich damit die<br />
Kultusminister der Bundesländer für die Stärkung der <strong>BNE</strong> aussprechen.<br />
Wer sich als Umweltbildungspraktiker mit der Bildungspolitik<br />
seines Bundeslandes auseinandersetzen muss, wird in diesem Papier<br />
evtl. eine brauchbare Argumentationshilfe finden.<br />
3.3 Versuch einer <strong>BNE</strong>-Definition<br />
Grundlegungen<br />
Wenn mit „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ein neues Bildungskonzept<br />
begründet wird, dann sollte eine Definition dieses Begriffs<br />
(dieses Konzepts)<br />
108
3.3 Versuch einer <strong>BNE</strong>-Definition<br />
• sich auf eine Theorie der Nachhaltigkeit – und nicht auf den<br />
zunehmend unscharfen alltagssprachlichen Gebrauch des Begriffes<br />
„Nachhaltigkeit“ – beziehen; hier wird die Theorie der starken<br />
Nachhaltigkeit als Bezug gewählt (OTT/DÖRING 2008, OTT/<br />
VOGET 2007, vgl. Kap. 2.4, Exkurs: Die Theorie der starken Nachhaltigkeit)<br />
• ebenso lern-/bildungstheoretisch begründet sein; hier wird ein<br />
Verständnis von Lernen als Ko-Konstruktion zugrunde gelegt<br />
• etwas Neues konstituieren; dabei geht es meiner Meinung nach im<br />
Kern darum, dass Fragen nach Gerechtigkeit und Fragen nach<br />
dem Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen aufeinander<br />
bezogen werden<br />
• damit dann auch bereits bestehende „benachbarte“ Bildungskonzeptionen<br />
wie die Natur- bzw. Umweltbildung, die entwicklungspolitische<br />
Bildung bzw. das Globale Lernen anerkennen und nicht<br />
danach trachten, sie zu vereinnahmen.<br />
Basierend auf diesen Prämissen, wird nachfolgend versucht, <strong>BNE</strong> zu<br />
definieren:<br />
Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
• fördert Werte und Kompetenzen, die dazu beitragen können, die<br />
Gesellschaft nachhaltig zu gestalten [1]<br />
• greift die beiden großen Diskussionsstränge im Nachhaltigkeitsdiskurs<br />
auf und bezieht sie aufeinander, d.h. sie<br />
• sucht nach inter- und intragenerationeller Gerechtigkeit<br />
und analysiert und kritisiert dementsprechend<br />
inter- und intragenerationelle Ungerechtigkeit [2]<br />
und<br />
• fördert die Erforschung unserer natürlichen Lebensgrundlagen<br />
und deren Achtung als unabdingbare Voraussetzung<br />
für ein gutes Leben aller Menschen [3]<br />
• macht „Leitplanken“ einer nachhaltigen Entwicklung – so die<br />
Regel des konstanten Naturkapitals, die Managementregeln und<br />
Nachhaltigkeitsstrategien wie Effizienz, Suffizienz, Resilienz –<br />
erfahrbar und nachvollziehbar [4]<br />
• greift „Schlüsselthemen“ einer nachhaltigen Entwicklung auf<br />
[5]<br />
109
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
• basiert auf einem Bildungsverständnis, nach dem Wissen von<br />
Lehrenden, Lernenden und ggf. weiteren Beteiligten gemeinsam<br />
geschaffen („konstruiert“) wird und setzt daher Methoden<br />
ein, die partizipatives, konstruktives, forschendes, reflexives,<br />
diskursives Lernen unterstützen [6]<br />
• sucht und vermittelt Handlungsorientierungen in der Lebenswelt.<br />
[7]<br />
Werte und<br />
Kompetenzen<br />
[1] <strong>BNE</strong> als Bildungskonzept hat eine pädagogische Zielstellung im<br />
Kontext umwelt- und gesellschaftspolitischer Ziele bzw. Herausforderungen.<br />
Werte sollten hierbei – neben den Kompetenzen – als Zielkategorie herausgehoben<br />
werden, da die Idee der Nachhaltigkeit grundlegend auf<br />
Werten aufbaut. DE HAAN (2008) und RIECKMANN (2010) haben Sets<br />
von Kompetenzen vorgelegt, die als Orientierung dienen können (vgl.<br />
Kap. 3.2.1).<br />
Gerechtigkeit [2] Die Kernidee der (starken) Nachhaltigkeit ist, dass alle Menschen –<br />
heute und in Zukunft – die Chance bekommen zu überleben und darüber<br />
hinaus ihre menschlichen Fähigkeiten zu entfalten. Zudem sollte keine<br />
künftige Generation schlechter gestellt sein als die heutige. Es geht hier<br />
also um Verteilungs- und Chancengerechtigkeit in Gegenwart und Zukunft.<br />
„Nachbardisziplinen“ der <strong>BNE</strong> sind hier die entwicklungspolitische<br />
Bildung und das Globale Lernen. In dieser Nachbarschaft ist eine sinnvolle<br />
begriffliche Abgrenzung ebenso wünschenswert wie eine gegenseitige<br />
Anerkennung und Inspiration auf der inhaltlichen Ebene.<br />
Verbindungen zwischen Globalem Lernen und <strong>BNE</strong> werden z.B. in<br />
dem 2007 erschienenen „Orientierungsrahmen für den Lernbereich<br />
Globale Entwicklung im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung“<br />
geknüpft (KMK/BMZ 2007).<br />
Natürliche<br />
Lebensgrundlagen<br />
[3] Für die Theorie der starken Nachhaltigkeit ist es essenziell, unsere<br />
natürlichen Lebensgrundlagen – das „Naturkapital“ – nicht als eine homogene<br />
Größe anzusehen. Unter dem Blickwinkel einer gerechten Nutzung<br />
und Vererbung muss vielmehr zwischen (lebendigen bzw. nicht<br />
lebendigen) Fonds und Vorräten unterschieden werden (OTT/DÖRING<br />
2008, S. 219ff). Die ersten (z.B. Wälder, Fische, Boden) stiften Nutzen,<br />
können genutzt werden und regenerieren sich, wenn sie nicht übernutzt<br />
werden. Die zweiten (z.B. Erdöl) werden bei ihrer Nutzung aufgebraucht,<br />
sie bilden sich in den für Menschen relevanten Zeiträumen<br />
nicht nach, so dass sie „funktional substituiert“ (ebd.) werden müssen<br />
110
3.3 Versuch einer <strong>BNE</strong>-Definition<br />
(z.B. durch Aufbau der Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien<br />
und nachwachsender Rohstoffe).<br />
Die „Erforschung unserer Lebensgrundlagen“ kann eng an diese Theorie<br />
des Naturkapitals angelehnt werden. Es geht um das Verständnis davon,<br />
auf wie vielfältige Weise wir die Natur nutzen, es geht – um mit<br />
BRÄMER (2006) zu sprechen – nicht darum, die in den Köpfen Jugendlicher<br />
weit verbreitete „ausgeprägte Sauberkeitsästhetik und bambihafte<br />
Verniedlichung der Natur“ zu fördern. Die Vermittlung<br />
grundlegender Kenntnisse über natürliche Systeme bleibt dabei Gegenstand<br />
z.B. von Biologie und Geographie. Auch z.B. Naturerfahrungsbzw.<br />
Naturerlebnispädagogik bleiben berechtigte und eigenständige<br />
Konzeptionen außerhalb der <strong>BNE</strong>.<br />
Aus Sicht der <strong>BNE</strong> ist die Nutzung des Naturkapitals untrennbar mit der<br />
Frage verbunden, wer denn in welchem Umfang an dem Nutzen teilhat,<br />
bzw. wer in welchem Umfang eventuelle Lasten zu tragen hat – also mit<br />
der Frage nach Gerechtigkeit. Vergleichen Sie das mit der noch jungen<br />
Wissenschaftsdisziplin der Bionik, in welche Biologie, Chemie, Physik<br />
und Technik eingehen und in der letztlich das Lernen der Technik aus<br />
natürlichen Vorbildern organisiert wird. So wie die „reinen“ Naturwissenschaften<br />
weiterhin ihre Forschungsgebiete und ihre Berechtigung<br />
haben, so behalten nach der oben vorgeschlagenen Definition auch die<br />
Umweltbildung und das Globale Lernen ihre Berechtigung als eigenständige<br />
Konzepte. Auch z.B. RIECKMANN (2010, S. 11) sieht <strong>BNE</strong> und<br />
GL als gleichrangige Konzepte an.<br />
Ein Lernarrangement, in dem der faire Handel „nur“ aus ökonomischer<br />
und sozialer Perspektive thematisiert wird, wäre demnach ebenso wenig<br />
der <strong>BNE</strong> zuzurechnen wie ein Lernarrangement, in dem es „nur“ um die<br />
Herstellung und das Recycling von Papier geht. Wenn man das Thema<br />
Papier hingegen auf die Problematik der Rohstoffgewinnung (darunter<br />
Kahlschlag von Primärwäldern und somit Zerstörung des Lebensraumes<br />
der indigenen Bevölkerung) und auf den globalen Papierkonsum<br />
(Deutschland verbraucht mehr Papier als ganz Afrika) ausdehnt – und<br />
wenn man dabei weitere der o.g. Aspekte anwendet, dann kann <strong>BNE</strong><br />
entstehen. Beispielhaft hierfür kann das Projekt „Der Papierkoffer“<br />
vom EINE-WELT-LANDESNETZWERK MV E.V. (<strong>2011</strong>) stehen.<br />
Die Formulierung „ökologische Themenfelder mit sozialen und wirtschaftlichen<br />
Aspekten verknüpfen“ (Hamburger Aktionsplan, FREIE<br />
UND HANSESTADT HAMBURG 2005) halte ich hingegen für weniger<br />
glücklich, da sie im Sinne des bereits kritisierten „Nachhaltigkeitsdreiecks“<br />
dahingehend fehlinterpretiert werden könnte, dass ein additives<br />
Nebeneinander ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte für<br />
die <strong>BNE</strong> ausreichend sei.<br />
111
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Dass OTT/DÖRING (2008, S. 172-175), über einen reinen Anthropozentrismus<br />
hinaus, die Aufnahme (zumindest) höher entwickelter, empfindungsfähiger<br />
Tiere in die Moralgemeinschaft („Sentientismus“) für<br />
angemessen halten, wurde bereits in dem Exkurs im Kap. 2.4 betont.<br />
Die <strong>BNE</strong> sollte die Frage nach dem moralischen Eigenwert von Natur<br />
bei geeigneten Anlässen mit aufgreifen.<br />
Der über die Achtung hinaus gehende Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen<br />
ist Sache der Politik, nicht der Bildung.<br />
Leitplanken<br />
Schlüsselthemen<br />
Bildungsverständnis<br />
[6] <strong>BNE</strong> basiert auf einem Verständnis von Lernen als Ko-Konstruktion<br />
(vgl. auch Exkurs: Konstruktivistische Lerntheorien im Kap. 3.4.2).<br />
Aber auch wer sich die zentralen Merkmale der Nachhaltigkeitsidee –<br />
so etwa ihre kommunikative, prozessorientierte Ausrichtung und die<br />
Bedeutung der Partizipation – vor Augen hält, wird zu dem Schluss<br />
kommen, dass es in der <strong>BNE</strong> weniger darauf ankommt, Wissen zu vermitteln,<br />
als gemeinsam Wissen zu schaffen. Es gibt dafür viele geeignete<br />
Methoden; hier werden Simulationen bzw. Planspiele (Kap. 3.4.2),<br />
Open Space (Kap. 4.2.1) und Zukunftswerkstatt (Kap. 4.2.2) vorgestellt;<br />
ansonsten sei auf Ihr Modul 3 (Didaktik der Umweltbildung) verwiesen.<br />
Handlungsorientierungen<br />
[4] Die Regel des konstanten Naturkapitals sowie die Managementregeln<br />
gehören für OTT/DÖRING (2008) mit zum Kern der Theorie der<br />
starken Nachhaltigkeit. Effizienz, Suffizienz und Resilienz sind hingegen<br />
„Brückenprinzipien“ (zwischen Theoriekern und Anwendungsfällen,<br />
OTT/VOGET 2007 S.2). Für die Zwecke der <strong>BNE</strong> halte ich es für<br />
gerechtfertigt, diese Regeln und Prinzipien in einem Aspekt zu vereinen,<br />
obwohl sie aus Sicht der Theorie auf verschiedenen Kategorie-<br />
Ebenen stehen.<br />
[5] OTT/DÖRING (2008, S. 346-347) betrachten bspw. die Land- und<br />
Forstwirtschaft, die Umweltmedien (=Boden, Wasser, Luft) und den<br />
Naturschutz als paradigmatische Themen („Anwendungen“), die „im<br />
Gefüge der gesamten Theorie vorkommen müssen.“ Tourismus, Städtebau<br />
und Verkehrspolitik gehören sicher zur Theorie einer starken Nachhaltigkeit;<br />
für die Staatsverschuldung, die Studienanfängerquote oder<br />
die Zahl der Wohnungseinbrüche (wie sie in der Nachhaltigkeitsstrategie<br />
der Bundesregierung vorkommen, vgl. Kap. 2.3.5) sei das hingegen<br />
unsicher. – Es gibt demnach weitgehende Überschneidungen zu den<br />
Schlüsselthemen, wie sie z.B. in der Definition des Hamburger Aktionsplans<br />
genannt werden, aber keine vollständige Übereinstimmung.<br />
[7] Eine nachhaltige Entwicklung wird letztlich nur in konkreten Handlungen<br />
von Menschen erreicht. <strong>BNE</strong> soll diese den Lernenden nicht<br />
vorgeben – das wäre Indoktrination. Sie sollte aber aufzeigen, dass<br />
nachhaltiges Handeln notwendig und möglich ist, z.B. indem die Bil-<br />
112
3.4 Beispielhafte Projekte / Lernarrangements<br />
dungsstätte selbst zum Lerngegenstand gemacht wird (vgl. Kap. 3.4.1),<br />
indem nachhaltiges Handeln in einer Schülerfirma ausprobiert wird<br />
oder indem in einem konsumkritischen Stadtrundgang Nachhaltigkeitsdefizite<br />
und Konsumalternativen thematisiert werden.<br />
So wie die <strong>BNE</strong> hier verstanden wird, ist an Lernende ab Schulalter gedacht.<br />
In dieser engen Auslegung ist <strong>BNE</strong> eher kein Konzept für die<br />
frühkindliche Bildung. Wie bereits am Ende des Kapitels 3.2.2 angedeutet<br />
worden war, sollten dort eher die Grundlagen für eine spätere<br />
<strong>BNE</strong> gelegt werden – oder es müssten für diese Zielgruppe spezifische<br />
<strong>BNE</strong>-Konzepte entwickelt werden.<br />
Anwendbarkeit<br />
3.4 Beispielhafte Projekte / Lernarrangements<br />
In diesem Kapitel möchte ich zwei ganz unterschiedliche Beispiele einer<br />
Bildung für nachhaltige Entwicklung vorstellen.<br />
Das Nachhaltigkeitsaudit ist ein „großes“ Lernarrangement für die <strong>BNE</strong><br />
in Schulen. Hier geht es nicht nur um Bildung für einzelne Menschen,<br />
sondern hier soll über mehrere Jahre hinweg die ganze Schule in Richtung<br />
Nachhaltigkeit weiterentwickelt werden. Anhand dieses Beispiels<br />
lassen sich viele Merkmale der <strong>BNE</strong> illustrieren; allerdings hat Nachhaltigkeitsaudit<br />
nur eine eingeschränkte Verbreitung und ist daher für<br />
die Mehrzahl von Ihnen vermutlich nicht praxisrelevant.<br />
Simulationen und Planspielen hingegen dienen „nur“ dazu, einzelne<br />
Aspekte einer (nicht) nachhaltigen Entwicklung zu veranschaulichen.<br />
Sie können in unterschiedlichen Kontexten und mit verschiedenen Zielgruppen<br />
eingesetzt werden. Es sind eher „kleine“ Methoden bzw. Lernarrangements,<br />
die hier vorgestellten Beispiele erfordern 30 Minuten<br />
bis maximal einen Tag. Daher besteht durchaus die Chance, dass sie für<br />
Sie praxisrelevant sein können.<br />
Soweit das möglich ist, wird die Darstellung an die im Kap. 3.3 vorgestellte<br />
<strong>BNE</strong>-Definition zurück gekoppelt. Die Lernarrangements selber<br />
basieren aber auf einem breiteren <strong>BNE</strong>-Verständnis, und wenn Sie in<br />
den angegebenen Quellen recherchieren, werden Sie dort von der Theorie<br />
der starken Nachhaltigkeit kaum etwas finden.<br />
Weitere Beispiele sind in der Datenbank der offiziellen Projekte im<br />
Rahmen der UN-Dekade zur <strong>BNE</strong> unter www.bne-portal.de zu finden.<br />
113
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
3.4.1 Nachhaltigkeitsaudit an Schulen<br />
Beim Nachhaltigkeitsaudit orientieren sich Schulen in einem umfassenden<br />
Sinne am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung.<br />
• Sie erweitern ihren Bildungsauftrag zur Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung.<br />
• Sie begreifen sich als Polis, deren Mitglieder Nachhaltigkeit<br />
in einem partizipativen und diskursiven Prozess entwickeln.<br />
• Sie optimieren den Schulbetrieb, so dass z.B. Ressourcen<br />
eingespart und fairer Handel gefördert werden.<br />
Dies kann nicht von heute auf morgen realisiert werden, sondern nur in<br />
einem systematischen und langfristigen Entwicklungsprozess. Das<br />
Nachhaltigkeitsaudit ist ein Instrument, das Schulen helfen kann, diesen<br />
Prozess professionell zu managen und erfolgreich zu absolvieren.<br />
KURTZ 2005 stellt das Instrument vor und ordnet es in die Schulreformdebatte<br />
ein.<br />
Grundlegungen<br />
Beim Nachhaltigkeitsaudit wird die Schule als ein Mikrokosmos verstanden,<br />
für den eine nachhaltige Entwicklung angestrebt wird und für<br />
den daher das Leitbild der Nachhaltigkeit operationalisiert werden<br />
muss. Viele globale Aspekte des Nachhaltigkeitsdiskurses haben in der<br />
Schule ihre Entsprechung. Wenn eine Schule Energie einspart oder erneuerbare<br />
Energien nutzt, dann schont sie damit die Vorräte an fossilen<br />
Energieträgern (zu dem damit eng verbundenen Klimaschutz siehe<br />
OTT/DÖRING 2008, S. 295ff). Wenn eine Schule Teile des Schulgeländes<br />
entsiegelt, trägt sie dazu bei, dass der Boden (ein nicht-lebendiger<br />
aber belebter Fonds) nicht einfach nur eine Fläche ist, auf der man stehen<br />
oder Autos parken kann – sondern dass er weiteren Nutzen stiftet,<br />
also z.B. Regenwasser aufnimmt, das ansonsten kostenpflichtig in die<br />
Kanalisation eingeleitet werden müsste, oder Bäume wachsen lässt, die<br />
Schatten spenden und vielleicht sogar essbare Früchte tragen. Das<br />
Nachhaltigkeitsaudit soll es Schülern ermöglichen, derartige Schlüsselthemen<br />
einer nachhaltigen Entwicklung in dem für sie relevanten und<br />
durch sie mit gestaltbaren Raum „Schule“ kennen zu lernen. Dabei stehen<br />
oft noch die Frage nach der Gerechtigkeit und die Nutzung des Naturkapitals<br />
nebeneinander, aber bei Themen wie Papier und Wasser<br />
(vgl. weiter unten Tabelle 5) werden diese auch sinnvoll aufeinander<br />
bezogen.<br />
114
3.4 Beispielhafte Projekte / Lernarrangements<br />
Die Schulen bedienen sich dabei eines bereits an anderer Stelle – nämlich<br />
in der gewerblichen Wirtschaft unter dem Namen Öko-Audit – entwickelten<br />
Verfahrens.<br />
Exkurs: Öko-Audit<br />
Das Öko-Audit dient dazu, den Umweltschutz fest in gewerblichen<br />
Unternehmen bzw. in anderen Organisationen zu verankern. Dabei<br />
geht es den Unternehmen/Organisationen weniger um eine altruistisch<br />
verstandene Ökologie, vielmehr wollen sie im eigenen Interesse<br />
Risiken minimieren, die Effizienz im Umgang mit natürlichen<br />
Ressourcen erhöhen und somit Kosten senken oder ein positives<br />
Image in der Öffentlichkeit aufbauen. Die Europäische Union hat<br />
hierfür erstmals 1993 in der EMAS-Verordnung detaillierte Spielregeln<br />
festgelegt (EG 1993). Diese erste EMAS-Verordnung bezog<br />
sich nur auf die gewerbliche Wirtschaft. Die neueren Verordnungen<br />
EMAS II (EG 2001) und EMAS III (EG 2009) beziehen sich in einem<br />
umfänglichen Sinne auf Organisationen und schließen damit z.B.<br />
auch den Dienstleistungsbereich sowie öffentliche Verwaltungen<br />
und deren nachgeordnete Einrichtungen ein.<br />
EMAS steht für „Environmental Management and Audit Scheme“<br />
und bedeutet somit „Verfahren für ein Umweltmanagement und eine<br />
Umweltbetriebsprüfung“. Das Öko-Audit wird in der EMAS-Verordnung<br />
ausführlich beschrieben, hier sollen nur einige zentrale<br />
Aspekte in stark vereinfachter Form wiedergegeben werden:<br />
Organisationsinterne Strukturen: Umweltschutz wird als Management-Aufgabe<br />
verstanden und möglichst fest in die organisationsinternen<br />
Strukturen integriert. Die Zuständigkeiten für den<br />
Umweltschutz werden eindeutig festgelegt. Umweltrelevante Tätigkeiten<br />
und Prozesse werden so geplant, realisiert und kontrolliert,<br />
dass sich die Umweltauswirkungen verringern. Alle Arbeitsergebnisse<br />
werden nachvollziehbar dokumentiert. Die Öffentlichkeit wird informiert.<br />
Organisationsinternes Verfahren: Beim Öko-Audit durchlaufen<br />
die Organisationen einen langfristig angelegten, zyklisch strukturierten<br />
Verbesserungsprozess (vgl. auch Abb. 3).<br />
Organisationsübergreifendes Verfahren: Organisationen, die ein<br />
derartiges Umweltmanagementsystem unterhalten, können sich<br />
durch eine externe Prüfung („Validierung“) bescheinigen lassen, dass<br />
sie die Anforderungen der EMAS-Verordnung erfüllen. Nach bestandener<br />
Prüfung erhalten sie ein Prüfsiegel, mit dem sie für ihre Umweltleistungen<br />
werben dürfen.<br />
115
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Die EMAS-Verordnung stellt keine absoluten Umweltstandards auf<br />
(z.B. Ressourcenverbrauch oder Emissionen pro Beschäftigtem),<br />
sondern beschreibt Anforderungen an die Strukturen und Verfahren<br />
zum Umweltschutz. Das Öko-Audit gehört damit zu den im Kapitel<br />
2.1 erwähnten integrativen Instrumenten der Umweltpolitik.<br />
Weitere für Schulen relevante Managementsysteme beschreibt<br />
LANGNER (<strong>2011</strong>c).<br />
Abb. 3:<br />
Ablauf des Nachhaltigkeitsaudits (vereinfacht)<br />
Bereits Mitte der 90er Jahre kam die Idee auf, das Öko-Audit für Verwaltungen<br />
und deren nachgeordnete Einrichtungen wie z.B. Schulen<br />
nutzbar zu machen. Erste Pilotprojekte haben z.B. das MINISTERIUM<br />
FÜR UMWELT, ENERGIE UND VERKEHR DES SAARLANDES (1996) und<br />
die Stadt Nürnberg durchgeführt. Erste Schulen folgten, so die Internationale<br />
Gesamtschule Heidelberg und die Dammrealschule Heilbronn<br />
(TEICHERT 2000) und die GESAMTSCHULE SCHWERTE (1997a). Dabei<br />
gab es einerseits Schulen, die das gesamte EMAS-Verfahren mit Validierung<br />
absolvierten und somit unter Beweis stellten, dass sie den Um-<br />
116
3.4 Beispielhafte Projekte / Lernarrangements<br />
weltschutz genauso professionell organisieren können wie<br />
Unternehmen (BERUFSKOLLEG NEUSS WEINGARTSTRAßE <strong>2011</strong>). Andere<br />
Schulen nutzten einen Ansatz, der sich auf wesentliche Kernelemente<br />
des Audits konzentriert und damit den bürokratischen Aufwand gegenüber<br />
der EMAS-Verordnung deutlich reduziert (LANGNER 1998 und<br />
<strong>2011</strong>).<br />
Schon bald zeigte sich, dass das Öko-Audit eine „ökologische“ Schulentwicklung<br />
unterstützen und damit innovative Strukturen für die Umweltbildung<br />
schaffen kann. Daher wurde es in das BLK-<br />
Modellprogramm „21“ aufgenommen (vgl. Kap. 3.2.1). Unter dem<br />
Stichwort „Nachhaltigkeitsaudit“ sollte(n) insbesondere die pädagogische<br />
Dimension gestärkt, ökonomische und soziale Aspekte intensiver<br />
als bislang berücksichtigt und das Verfahren den Anforderungen für die<br />
Integration in die schulische Regelpraxis angepasst werden (DE HAAN/<br />
HARENBERG 1999, S. 82).<br />
Diese Herausforderung wurde in den vier Sets zum Nachhaltigkeitsaudit<br />
auf unterschiedliche Weise gelöst. Ich beziehe mich nachfolgend auf<br />
das Set in Düsseldorf. Dort haben die Schulen zunächst Öko-Audits absolviert<br />
und dann schrittweise auch nicht-ökologische Aspekte der<br />
Nachhaltigkeit einbezogen. Somit formulieren die Schulen selbst ihr<br />
Leitbild von einer nachhaltigen Entwicklung. Sie prüfen, wo sie aktuell<br />
stehen und stecken sich dann konkrete Ziele und planen konkrete Maßnahmen,<br />
um ihr Leitbild zu erreichen. Die notwendigen Strukturen (z.B.<br />
Zuständigkeiten, Gremien, Abläufe) werden eingerichtet („Management“).<br />
Ein Nachhaltigkeitsbericht dient dann der Kommunikation<br />
nach innen und außen. Nach 3-5 Jahren wird mit einer erneuten Bestandsaufnahme<br />
ein nächster Zyklus eingeleitet (vgl. Abb. 3 und LANG-<br />
NER <strong>2011</strong>d). – Auf dieser Basis kann die Umsetzung wesentlich<br />
zielgerichteter und konsequenter erfolgen, als es sonst oft bei schulischen<br />
Umweltprojekten der Fall ist.<br />
Die in Düsseldorf beteiligten Schulen eint das Interesse an der <strong>BNE</strong>,<br />
dennoch hat jede einzelne Schule das Öko-bzw. Nachhaltigkeitsaudit<br />
mit individuellen Akzentuierungen umgesetzt. Das soll aber nachfolgend<br />
nicht ausdifferenziert werden; statt dessen wird versucht, übergreifende<br />
Aspekte wiederzugeben. Original-Material aus den Schulen<br />
finden Sie unter www.umweltschulen.de/audit/duesseldorf.<br />
Das Nachhaltigkeitsaudit dient der nachhaltigen Entwicklung von<br />
Schulen auf drei zusammengehörenden Ebenen.<br />
Ziele und<br />
Kompetenzen<br />
Die Schule wird als Bildungseinrichtung angesehen, und ihr Auftrag<br />
wird zur Bildung für nachhaltige Entwicklung erweitert. Das bedeutet<br />
zunächst einmal, dass Lehrer und Schulleitung, aber auch Schüler oder<br />
Eltern den Bildungsauftrag ihrer Schule reflektieren und pädagogische<br />
117
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Leitbilder und Ziele entwickeln. Darauf aufbauend, entwickeln die<br />
Schulen vielfältige Lernarrangements, setzen diese um und verstetigen<br />
Bewährtes.<br />
Wenn Lehrer, Schüler und andere Akteure ihre Schule umweltgerecht<br />
bzw. nachhaltig gestalten, dann ist es unvermeidbar, dass sie auf Werten<br />
basierende Visionen und Leitbilder entwerfen, Konstrukte wie „Nachhaltigkeit“<br />
oder „Umweltschutz“ auf ihre Viabilität im Schulalltag hinterfragen,<br />
recherchieren und analysieren, bewerten und dabei Werte<br />
reflektieren, komplexe Veränderungsprozesse strukturiert planen und<br />
geplante Maßnahmen geduldig umsetzen, kommunizieren, motivieren,<br />
kooperieren, Rückschläge verarbeiten und Erfolge gemeinsam feiern.<br />
Den damit verbundenen Kompetenzerwerb dokumentiert das DÜSSEL-<br />
DORFER NETZWERK „BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG“<br />
(<strong>2011</strong>a). Im Unterschied zu DE HAAN/HARENBERG (1999) werden die<br />
Kompetenzen hier nicht als eine Voraussetzung für die Gestaltung einer<br />
nachhaltigen Gesellschaft verstanden, sondern eher als eine erwünschte<br />
Folge der Partizipation der Schüler an Gestaltungsprozessen.<br />
Abb. 4:<br />
Stufen der Schülerpartizipation<br />
Die Schule wird als Polis angesehen, in der viele Menschen gemeinsam<br />
leben, lernen und arbeiten. Diese Polis soll befähigt werden, sich möglichst<br />
selbstbestimmt zu entwickeln. Das erfordert und fördert die Kom-<br />
118
3.4 Beispielhafte Projekte / Lernarrangements<br />
munikation und die Partizipation aller Mitglieder der<br />
Schulgemeinschaft. Die Schulgemeinschaften entwickeln eigene Vorstellungen<br />
zur nachhaltigen Schulentwicklung und verankern diese in<br />
einem schriftlich fixierten Leitbild. Sie legen Verantwortung fest und<br />
überprüfen die Umsetzung. Damit wird Verbindlichkeit geschaffen. Positive<br />
Rückmeldungen finden Einzug in die Schulkultur, z.B. wenn den<br />
Schülern eine Bühne dafür geschaffen wird, ihre Arbeitsergebnisse zu<br />
präsentieren, wenn Akteure für ihre Leistungen Bestätigung erfahren<br />
bzw. auch Meinungen ausdrücklich abgefragt werden.<br />
Die Schule wird als Betrieb angesehen, dessen Nachhaltigkeitsauswirkungen<br />
optimiert werden. Dazu werden geeignete Themenfelder identifiziert<br />
und geeignete Strukturen geschaffen (siehe Tabelle 5).<br />
Tabelle 5: Themen im Nachhaltigkeitsaudit (Beispiele)<br />
Thema* Umsetzung<br />
Energie, Optimierung des Ressourcenverbrauchs an allen beteiligten Schulen, überwiegend<br />
durch nicht-investive Maßnahmen wie z.B. Kontrolle der Raum-<br />
Abfall,<br />
Wasser, temperaturen. Damit praktische Anwendung der Effizienz-Strategie. Für<br />
Klimaschutz<br />
und Sauberkeit. Einsparung von Bewirtschaftungskosten (Düsseldorf: vier-<br />
Schüler und Lehrer spürbare Verbesserungen z.B. hinsichtlich Raumklima<br />
stellige Euro-Beträge pro Schule und Jahr; Gesamtschule Schwerte:<br />
100.000 € in drei Jahren). Im Rahmen von fifty/fifty erfolgt ein Rückfluss<br />
von Teilen dieser Gelder an die Schulen zur Verbesserung der Sachausstattung,<br />
z.B. für die Schulgeländegestaltung. Reduzierung der CO 2 -Emissionen.<br />
Papier Mehrere Schulen haben den eigenen Papierverbrauch untersucht und teilweise<br />
auch Maßnahmen zum sparsamen Umgang mit Papier realisiert<br />
(PAULUSSCHULE DÜSSELDORF 2010, GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM<br />
DÜSSELDORF 2004, COMENIUS-GYMNASIUM DÜSSELDORF 2006).<br />
Nach einer Anfang 2009 in Kraft gesetzten Dienstanweisung beschafft und<br />
verwendet die Stadtverwaltung für den internen Bedarf – das schließt u.a.<br />
das Kopieren von Arbeitsblättern für Schüler mit ein – Recyclingpapier der<br />
Weißegrade ISO 70 bzw. 90 mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.<br />
Die Schulen wurden darüber per Brief informiert (UMWELTAMT DER LAN-<br />
DESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2009).<br />
Anfang 2010 wurde die Ausstellung „Papierwende“ der Arbeitsgemeinschaft<br />
Regenwald und Artenschutz e.V. aus Bielefeld nach Düsseldorf<br />
geholt, welche das Thema von Seiten der Ressourcen und der Gerechtigkeit<br />
anspricht. (DÜSSELDORFER NETZWERK BILDUNG FÜR NACHHALTIGE<br />
Wasser<br />
ENTWICKLUNG 2010)<br />
Das GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM DÜSSELDORF (o.J.) führt seit<br />
2001 regelmäßig einen „Wassermonat“ in der Jahrgangsstufe 8 durch.<br />
Dabei behandeln nahezu alle Fächer das Thema aus ihrer spezifischen Perspektive;<br />
in einem abschließenden Wasser-Gottesdienst oder in einer Ausstellung<br />
im Foyer der Schule werden diese Perspektiven dann<br />
zusammengeführt.<br />
119
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Eine Welt Eine-Welt-AG mit Laden (GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM <strong>2011</strong>),<br />
Togo-AG und Sponsorenlauf (AGNES-MIEGEL-REALSCHULE 2005), „Eine-<br />
Welt-Frühstück“ (KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ESSENER STRAßE 2005)<br />
* Zu weiteren Themen siehe DÜSSELDORFER NETZWERK BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENT-<br />
WICKLUNG <strong>2011</strong>b<br />
Didaktik und<br />
Methoden<br />
Rahmenbedingungen<br />
Schüler und Lehrer sowie teilweise auch Eltern und externe Partner haben<br />
Daten erfasst und die Nachhaltigkeit ihrer Schulen bewertet – d.h.<br />
sie haben gemeinsam Wissen geschaffen. Sie haben Veränderungsprozesse<br />
geplant und in demokratischen Verfahren Leitbilder legitimiert –<br />
und dabei konstruktive und partizipative Methoden wie die Zukunftswerkstatt<br />
(Kap. 4.2.2) genutzt. Sie haben vielfältige Maßnahmen umgesetzt<br />
– und sind damit über die Handlungsorientierung hinaus bis zum<br />
konkreten Handeln gekommen.<br />
Das Nachhaltigkeitsaudit zielt darauf, die in den Schulgemeinschaften<br />
vorhandenen Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung zu nutzen<br />
und zu fördern. Dennoch bleiben die Schulen auch von externen Faktoren<br />
abhängig.<br />
Hemmend wirken dabei Tendenzen im Bildungssystem, bei denen<br />
Schulen mit immer neuen externen Anforderungen konfrontiert werden<br />
oder sich die Personalausstattung der Schulen verschlechtert.<br />
Förderlich ist im Fall der Düsseldorfer Schulen die Kooperation mit der<br />
Stadt, der Wirtschaft und verschiedenen Organisationen. Diese Kooperation<br />
wurde im Düsseldorfer Netzwerk „Bildung für nachhaltige Entwicklung“<br />
institutionalisiert. Das BLK-Modellprogramm „21“ und der<br />
Lokale-Agenda-Prozess in der Landeshauptstadt Düsseldorf haben diese<br />
stützenden Strukturen ermöglicht (vgl. auch Kap. 4.1.2).<br />
Zusätzlichen Auftrieb hat die Entwicklung des Nachhaltigkeitsaudits<br />
durch die verschiedenen Diskurse um die Qualität von Schulen gewonnen,<br />
so im Zusammenhang mit den PISA-Studien und der Entwicklung<br />
von Schulprogrammen. Hier entsteht ein Bedarf an handhabbaren Instrumenten<br />
zur Schulentwicklung, den das Nachhaltigkeitsaudit – neben<br />
anderen Instrumenten – mit erfüllen kann.<br />
120
3.4 Beispielhafte Projekte / Lernarrangements<br />
Exkurs: Nachhaltigkeitszertifizierung Finnland<br />
In Finnland mit seinem einheitlichen Bildungssystem lässt sich die<br />
<strong>BNE</strong> wesentlich stringenter und effektiver implementieren als in<br />
Deutschland. Die hier skizzierte Nachhaltigkeitszertifizierung richtet<br />
sich an alle Bildungseinrichtungen in Finnland – von Kindergärten<br />
bis zu Hochschulen. Es geht hier nicht alleine um neue Unterrichtsprojekte,<br />
sondern Umweltbelange und Nachhaltigkeit sollen in Lehre,<br />
Management und Betriebsführung aufgenommen werden. Das<br />
ursprünglich rein umweltbezogene Zertifikationssystem wurde 2009<br />
auf Nachhaltigkeitskriterien erweitert.<br />
In allgemein bildenden Schulen soll die <strong>BNE</strong> (in ihrer pädagogischen<br />
Dimension) demnach darauf abzielen,<br />
• Wissen über eine nachhaltige Entwicklung zu vermitteln<br />
(ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle<br />
Umwelt, Nachhaltigkeitsprobleme)<br />
• Fähigkeiten zum Denken zu fördern (ganzheitliches, kritisches<br />
und in die Zukunft gerichtetes Denken)<br />
• Fähigkeiten zum Handeln zu fördern und Erfahrungen zu<br />
ermöglichen (Nutzung verschiedener Lernumgebungen,<br />
Anwendung nachhaltiger Handlungsweisen, Fähigkeit<br />
zur Partizipation und Einflussnahme).<br />
Analog dazu gibt es auch Kriterien für die berufliche Bildung, diese<br />
orientieren sich an der Struktur der national festgelegten beruflichen<br />
Schlüsselkompetenzen.<br />
Zudem sollen die teilnehmenden Bildungseinrichtungen ihre<br />
• ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit (z.B. verantwortungsvolle<br />
Beschaffung und nachhaltiger Konsum<br />
[auch in sozialer und kultureller Hinsicht], Recycling und<br />
Müllvermeidung, Ernährung und Gesundheit<br />
• soziale und kulturelle Nachhaltigkeit (z.B. Sicherheit in<br />
der Schule bzw. auf dem Schulweg, Fürsorge für Schüler<br />
und Lehrer, Vorbeugung gegenüber Schikane und Ausgrenzung<br />
sowie kulturelle Vielfalt und Internationalität)<br />
121
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Eine Simulation ist die Darstellung oder Nachbildung physikalischer,<br />
technischer, biologischer, psychologischer oder ökonomischer Prozesse<br />
durch mathematische oder physikalische Modelle, die eine wirklichkeitsnahe,<br />
jedoch einfachere, billigere oder ungefährlichere<br />
Untersuchung als das Original erlauben (DEUTSCHER TASCHENBUCH<br />
VERLAG). Simulationen können wissenschaftlichen Zwecken dienen,<br />
so werden in der Klimaforschung Erkenntnisse zum künftigen Verlauf<br />
des Klimawandels gewonnen, indem zunächst Szenarien z.B. zur geverbessern.<br />
Mit Lehrerfortbildungen, Materialien und Tools werden<br />
die Bildungseinrichtungen unterstützt. Dabei sollen alle Bildungseinrichtungen<br />
eigene Nachhaltigkeitsprogramme aufstellen; bis 2014<br />
sollen 15% – die besonders aktiven Bildungseinrichtungen – ein<br />
Nachhaltigkeitszertifikat erworben haben. (LAININEN 2010, LANG-<br />
NER <strong>2011</strong>b, vgl. Abb. 5)<br />
Abb. 5: Example: Energy theme in SD programme (LAININEN 2010)<br />
3.4.2 Simulationsspiele<br />
122
3.4 Beispielhafte Projekte / Lernarrangements<br />
sellschaftlichen (politischen, wirtschaftlichen, technischen...) Entwicklung<br />
entworfen und dann die Auswirkungen auf das Klima in<br />
Simulationen „berechnet“ werden. Simulationen können jedoch auch in<br />
der Bildung eingesetzt werden. Simulationen können schließlich – als<br />
Spiel – dem Vergnügen dienen.<br />
Spielen ist eine Tätigkeit, die aus Vergnügen an der Ausführung bzw.<br />
am Gelingen vollzogen wird (DEUTSCHER TASCHENBUCH VERLAG).<br />
Der Begriff Planspiel kommt von dem ursprünglich in Gesellschaftsspielen<br />
verwendeten Spielplan. Heute haben sich die Methode und die<br />
dabei verwendeten Instrumentarien weiterentwickelt und differenziert;<br />
Planspiele können z.B. auch am Computer (und dort ggf. auch einzeln,<br />
ohne andere Mitspieler) durchgeführt werden, oder es gibt Großgruppenplanspiele,<br />
die mit einem klassischen Spielplan überhaupt nicht zu<br />
bewältigen wären. Planspiele können sich in reinen Fantasiewelten bewegen.<br />
Sie können jedoch auch lebensweltliche Phänomene zum Gegenstand<br />
haben und dann auch pädagogisch eingesetzt werden. HUMM<br />
(2007) und REICH (2003ff) haben die Methode erhellend beschrieben.<br />
Es gibt somit eine Schnittmenge zwischen Simulation und Planspiel,<br />
und genau um diese geht es hier. Sie wird nachfolgend als Simulationsspiel<br />
bezeichnet. Vier solche Spiele für Jugendliche bzw. Erwachsene<br />
werden nachfolgend kurz vorgestellt und dann ausführlicher diskutiert.<br />
Fishbanks Ltd : Bei dieser Simulation von Dennis Meadows stellen sich<br />
die Teilnehmer der Herausforderung, im wirtschaftlichen Wettbewerb<br />
einen lebendigen Fonds zu nutzen. Am Beispiel der Fischerei auf den<br />
Weltmeeren lernen sie Probleme unseres aktuellen Wirtschaftens bzw.<br />
Strategien einer nachhaltigen Entwicklung kennen. In der Simulation<br />
sind sie zunächst Teil (Mitverursacher) dieser Probleme bzw. Anwender<br />
nachhaltiger Strategien. In der anschließenden Reflexionsphase<br />
strukturieren sie dann ihre Erkenntnisse und verbinden diese mit der Lebenswelt,<br />
also z.B. mit der realen Fischereiwirtschaft bzw. -politik, dem<br />
Natur- bzw. Artenschutz, mit ihren Handlungsoptionen als „Verbraucher“<br />
oder der Frage, wie wir kommunizieren und kooperieren müssten,<br />
um Naturkapital dauerhaft zu sichern. In der Originalversion wird das<br />
Systemverhalten am Computer errechnet 24 , davon abgesehen, spielt<br />
sich Fishbanks ganz überwiegend in der Interaktion der Teilnehmer<br />
bzw. zwischen Teilnehmern und Spielleiter ab. Es gibt zudem eine<br />
deutlich vereinfachte deutsche Version, die ohne Computer (und ohne<br />
die lizenzpflichtige Software) auskommt. Beide Versionen eignen sich<br />
für Gruppen von z.B. 20-25 Teilnehmern. Das Simulationsspiel ist bei<br />
LANGNER (<strong>2011</strong>e) ausführlicher beschrieben; OTT/DÖRING (2008, S.<br />
24. Ein solcher Computereinsatz ist meiner Meinung nach weit sinnvoller als bei vielen<br />
„Lernprogrammen“, in denen den Lernenden lediglich vorstrukturiertes Wissen<br />
dargeboten wird.<br />
123
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
261ff) bringen die Theorie der starken Nachhaltigkeit auf die Fischereiwirtschaft<br />
zur Anwendung.<br />
ecopolicy®: Den Klassiker von Frederic Vester gibt es als Brettspiel<br />
und als computergestütztes Spiel. Die Teilnehmer sollen ein Land nachhaltig<br />
regieren, sie haben dazu Ressorts wie Wirtschaft, Umwelt, Soziales<br />
und Bildung zu verwalten und können Aktionspunkte (welche für<br />
Geld und sonstige staatliche Interventionsmöglichkeiten stehen) auf<br />
diese Ressorts verteilen. Mit einem relativ einfachen Spielsystem (wenige<br />
Parameter) können anspruchsvolle Spielsituationen geschaffen<br />
werden. Eine transparente Gestaltung – vor allem bei der computergestützten<br />
Version – ermöglicht Einblicke hinter die Kulissen und fördert<br />
damit den Abgleich des simulierten Systems mit der Realität. Das Brettspiel<br />
ist für kleinere Gruppen (z.B. 4-6 Teilnehmer) ausgelegt, die computergestützte<br />
Version kann alleine gespielt werden, eignet sich aber<br />
auch als Grundlage für die Arbeit mit Gruppen. (LANGNER <strong>2011</strong>f)<br />
TriCO2olor: Bei dieser Simulation von UCS Ulrich Creative Simulations,<br />
myclimate und Ökozentrum Langenbruck kaufen die Spieler über<br />
einen längeren Zeitraum hinweg die Energie ein, die sie zum Leben<br />
brauchen. Sie können dabei entscheiden, ob sie die Vorräte an fossilen<br />
Energieträgern konsumieren, ob sie in Energieeffizienz investieren oder<br />
erneuerbare Energien einkaufen. Die Entscheidungen werden vor Ort<br />
am Spielbrett getroffen; die Auswirkungen dieser Entscheidungen auf<br />
Atmosphäre und Klima werden in einem online bereitgestellten Computersystem<br />
simuliert. Dabei sind die Spieler in Generationen aufgeteilt,<br />
das Spielset ist auf 4 Generationen mit je maximal 6 Spielern<br />
ausgelegt, und die Entscheidungen der älteren Generationen haben Auswirkungen<br />
auf die nachfolgenden Generationen. Dadurch werden die<br />
Nutzung des Naturkapitals und die intergenerationelle Gerechtigkeit<br />
sehr geschickt miteinander verbunden. (LANGNER <strong>2011</strong>g)<br />
Barreg-Tunnel-Spiel: Bei dieser Simulation von UCS Ulrich Creative<br />
Simulations geht es um die Verkehrsproblematik. Die Teilnehmer sind<br />
Berufspendler, die zwischen zwei Verkehrsmitteln wählen können, die<br />
Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf ihre Lebensqualität wird simuliert.<br />
Das Spiel kann mit einfachsten Mitteln in kurzer Zeit und in variablen<br />
Gruppengrößen durchgeführt werden. Um Ihnen das vorzustellen,<br />
wird hier auch die Anleitung abgedruckt.<br />
124
3.4 Beispielhafte Projekte / Lernarrangements<br />
Baregg-Tunnel-Spiel<br />
© Markus Ulrich, UCS Ulrich Creative Simulations, Zürich 1998<br />
(ucs@access.ch)<br />
Vorbereitung<br />
Für jeden Teilnehmenden (TN) je eine rotes und blaues Kärtchen,<br />
Format A6 (Postkartengrösse)<br />
Rahmenhandlung<br />
Geschichte schildern: Leben vor den Toren Zürichs (im Kanton Aargau),<br />
Arbeit in Zürich. Zeitprobleme. Arbeit, Familie, knappe Freizeit.<br />
Alternative: Zug (öffentl. Verkehr) oder Auto?<br />
Spielziel<br />
• Möglichst viele Punkte machen (gegenüber TN erwähnen)<br />
• Die „Tragödie der Allmende“ (Übernutzung gemeinsamer<br />
Güter, z. B. Fischfang, Luftqualität, etc.) unmittelbar<br />
erfahren (gegenüber TN erst bei der Auswertung direkt<br />
oder indirekt erwähnen)<br />
Regeln und Ablauf<br />
• An jedem Tag wählen die TN (TeilnehmerInnen), ob sie<br />
mit Zug oder Auto zur Arbeit fahren:<br />
Rot: Auto, Blau: Zug<br />
• Bei Beginn einer Runde, entscheidet jeder TN ohne<br />
Absprache mit den andern, ob er/sie mit dem Zug oder<br />
dem Auto zur Arbeit fahren will. Nach etwa 30 Sekunden<br />
fahren sie los, d.h. sie halten das Kärtchen mit der Farbe<br />
ihrer Wahl hoch. Der/die SpielleiterIn zählt aus und<br />
bestimmt, ob Stau entstanden ist.<br />
• Wenn mehr als 50% der PendlerInnen mit dem Auto fahren,<br />
so entsteht auf der Autobahn vor dem Baregg-Tunnel<br />
ein Stau und die AutofahrerInnen verlieren viel Zeit.<br />
Bemerkung: Die %-Hürde kann variiert werden (Z. B.<br />
Stau ab 30% per Auto).<br />
125
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
• In jeder Runde gewinnen die TN Punkte. Diese bedeuten<br />
„Lebensqualität“ oder „Zeitgewinn“.<br />
Jeder TN erhält je nach Ausgang der Runde und seiner/<br />
ihrer Wahl Punkte:<br />
Auto mit Stau 0 Punkte<br />
Auto ohne Stau: 15 Punkte<br />
Zug: 5 Punkte<br />
• Insgesamt werden je nach Spielverlauf 3 bis 5 Runden<br />
gespielt. Danach erfolgt das „Debriefing“.<br />
Debriefing (Auswertung nach Simulationsspiel)<br />
• Fragen zu Gefühlen, Verhalten und Verständnis der Charakteristik<br />
des dargestellten Systems (Allmende-Tragödie).<br />
• Weitere Hinweise finden sich in den Anleitungen zu den<br />
Spielen "The New Commons Game" und "Stratagem".<br />
Diese Spiele sind bei UCS erhältlich (ucs@access.ch).<br />
Weitergabe des Baregg-Tunnel-Spiels<br />
Diese Spielbeschreibung darf frei kopiert und weitergegeben werden,<br />
unter der Bedingung, dass:<br />
• keine kommerzielle Verwertung stattfindet,<br />
• der folgende Copyright-Hinweis mit E-Mail-Addresse<br />
auf sämtlichen Kopien sichtbar ist:<br />
© Markus Ulrich, UCS Ulrich Creative Simulations,<br />
Zürich 1998 (ucs@access.ch)<br />
Grundlegungen<br />
Besonders die ersten drei Simulationsspiele eignen sich sehr gut dafür,<br />
die Theorie der starken Nachhaltigkeit zu veranschaulichen.<br />
Bei Fishbanks Ltd. und TriCO2lor nutzen die Spieler Naturkapital. Wenn<br />
sie sich dabei nur an kurzfristigen ökonomischen Profiten orientieren,<br />
führt das schnell zum Kollaps natürlicher Systeme. Die Folge ist, dass<br />
die wirtschaftliche Tätigkeit zum Erliegen kommt (Fishbanks Ltd. ), bzw.<br />
die nachfolgenden Generationen ihrer Chancen auf ein gutes Leben beraubt<br />
werden (beide Spiele, aber bei TriCO2lor ist das der Fokus). Fishbanks<br />
Ltd. eignet sich auch, um auszuprobieren, wie eine nachhaltige<br />
Nutzung lebendiger Fonds funktionieren kann, d.h. welche Nutzungsraten<br />
möglich sind, wie man die entsprechend notwendigen Erkenntnisse<br />
gewinnen und wie man Lasten und Nutzen zwischen den am Markt kon-<br />
126
3.4 Beispielhafte Projekte / Lernarrangements<br />
kurrierenden Akteuren gerecht und tragfähig verteilen kann. TriCO2lor<br />
hingegen wird eher langweilig, wenn die Spieler einen nachhaltigen<br />
Entwicklungspfad einschlagen.<br />
Bei ecopolicy ® stehen die Spieler vor der Frage, inwieweit sie im Rahmen<br />
ihrer Regierungstätigkeit in Sach-, Natur-, Sozial- oder Humankapital<br />
investieren wollen. Sie merken schnell, dass alleine die Stärkung<br />
der Wirtschaftskraft nicht zu gesellschaftlicher Wohlfahrt führt; von<br />
dieser Erkenntnis bis zu der Fähigkeit, das System nachhaltig zu steuern,<br />
ist es dann aber oft ein langer Weg, bei dem die Beziehungen zwischen<br />
den verschiedenen Parametern des Spielsystems (den Bereichen<br />
der Gesellschaft) verstanden und genutzt werden müssen.<br />
Das Barregg-Tunnel-Spiel greift Beziehungen zwischen Umweltverhalten<br />
und Lebensqualität auf einer wesentlich einfacheren und weniger<br />
existenziellen Ebene auf.<br />
Aber nicht nur wegen ihrer Themen, sondern auch wegen der Art des<br />
Lernens passen diese Simulationsspiele in das Konzept der <strong>BNE</strong>. Die<br />
Spieler stehen in engen Wechselwirkungen miteinander – so z.B. innerhalb<br />
eines jeden Fischereiunternehmen (Fishbanks Ltd. ) oder innerhalb<br />
einer jeden Generation (TriCO2lor) oder auch von Unternehmen zu Unternehmen<br />
bzw. von Generation zu Generation. In diese Beziehungen<br />
eingebunden, konstruieren sie – teils in erklärter Konkurrenz zueinander,<br />
teils in gemeinsamem Interesse – ihr Wissen über die Spielsysteme.<br />
Dazu müssen sie sich austauschen, Hypothesen über das Spielsystem<br />
entwickeln und prüfen, verhandeln, Strategien abgleichen, sowie ggf.<br />
gemeinsame Werte finden und Regeln für nachhaltige Entwicklungspfade<br />
aushandeln.<br />
Aus dieser Perspektive gehört eine nachträgliche Reflexion des Spielgeschehens<br />
untrennbar mit zu dem Lernarrangement, und aus dieser<br />
Perspektive wurden oben auch nur Simulationsspiele vorgestellt, die in<br />
Gruppen gespielt werden (können).<br />
Exkurs: Konstruktivistische Lerntheorien<br />
Der Konstruktivismus entwickelte sich seit Ende der 80er Jahre des<br />
20. Jahrhunderts als ein interdisziplinärer Forschungsbereich, der die<br />
Arbeitsweise menschlicher Kognition untersucht, ohne eine einheitliche<br />
Theorie hervorzubringen. Aus (radikal) konstruktivistischer<br />
Sicht wird das Gehirn als ein informationell geschlossenes System<br />
angesehen, mit dem der Mensch selbst sein Wissen aus eingehenden<br />
Informationen konstruiert.<br />
127
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Andere konstruktivistische Theorien lehnen eine ausschließlich auf<br />
das Individuum bezogene Perspektive ab und beziehen die sozialen<br />
Interaktionen mit ein. Beispielhaft soll dies anhand der konstruktivistischen<br />
Didaktik nach REICH (2004) skizziert werden.<br />
Demnach ist der Mensch bei der Konstruktion von Wissen nicht völlig<br />
frei, sondern an die Vorverständigungen seiner Kultur gebunden.<br />
Folgt man REICH (2004, S. 75), so gibt es damit kein universell gültiges<br />
Wissen sondern „nach- und nebeneinander mehrere »richtige<br />
Versionen« von Welten“. Wissen als Konstrukt des einzelnen Menschen<br />
kann „...als veränderlich, unabgeschlossen und auch fehlbar<br />
angesehen werden .... Das Lernen kann also keine reinen Wahrheiten<br />
auf Dauer abbilden...“ (REICH 2004, S. 161). REICH führt statt dessen<br />
u.a. folgende Grundannahmen über das Lernen an (ebd.):<br />
Lernen ist konstruktiv: „Wir sind die Erfinder unserer Wirklichkeit.“<br />
(ebd. S. 141) Lernen ist dabei an Handeln gebunden, Wissen<br />
wird grundsätzlich in Handlungen erworben (ebd. S. 69). Damit ist<br />
nicht nur Learning by doing gemeint – auch beim Lesen eines Textes<br />
oder beim Hören eines Vortrages setzen die Lernenden (mindestens)<br />
die aufgenommenen Informationen in Beziehung zum Lernkontext<br />
oder zu ihrem Vorwissen und konstruieren damit ihr Wissen aktiv.<br />
Der interaktionistische Konstruktivismus postuliert, dass wir in unseren<br />
Konstruktionen nicht völlig frei sind – wir sind vielmehr in Beobachtungen,<br />
Teilnahmen und Aktionen u.a. an kulturell vermittelte<br />
Vorverständigungen gebunden. Didaktische Prozesse laufen dabei<br />
auf den drei Ebenen der sinnlichen Gewissheit, der Konventionen<br />
oder der Diskurse ab (ebd. S. 69ff).<br />
Lernen ist re- und dekonstruktiv: „Wie sind die Entdecker unserer<br />
Wirklichkeit.“ (ebd. S. 142) bzw. „Es könnte auch noch anders sein!<br />
Wir sind die Enttarner unserer Wirklichkeit!“ (ebd. S. 143). Dabei ist<br />
selbst die Rekonstruktion mehr als bloße Abbildung von vorgegebenem<br />
Wissen – dieses wird vielmehr vom Lernenden modifiziert, eben<br />
re-konstruiert (ebd. S.165). Die konstruktivistische Didaktik erkennt<br />
die Rekonstruktionen als notwendig an (ebd. S. 252), will diese aber<br />
auf ein Mindestmaß beschränken (ebd. S. 141-143). Dekonstruktion<br />
meint, vorgegebene Wissensbestände infrage zu stellen, Auslassungen<br />
und mögliche andere Blickwinkel zu thematisieren (ebd. S. 143-<br />
144).<br />
128
3.4 Beispielhafte Projekte / Lernarrangements<br />
Lernen ist sozial (ebd. S. 171ff): Einerseits zielt Lernen auf Teilhabe<br />
an der Gesellschaft, so auf die Fähigkeit, sich anderen verständlich zu<br />
machen und sich zurechenbar zu verhalten. Andererseits erfordert<br />
Lernen die Teilnahme an Verständigungsgemeinschaften, die Rekonstruktion<br />
von Normen und kulturellem Hintergrundwissen. Weil<br />
Lernen sozial ist, gehören Inhalte und Beziehungen in Lehr-/Lernprozessen<br />
untrennbar zusammen und sind Kommunikation und Dialoge<br />
Grundlagen für Lernen (ebd. S. 52ff).<br />
Lernen ist situiert: „Menschliche Kognitionen entstehen zwischen<br />
intelligenten Individuen in sozialhistorisch definierten Kontexten, in<br />
denen sie miteinander interagieren.“ (ebd. S. 180) Didaktik muss daher<br />
die Situationen, in denen Lernende stehen, einbeziehen. So werden<br />
Handlungen weit stärker durch Kontexte bestimmt als durch<br />
Pläne, Strategien oder Konstruktionen (S. 181). Das führt dazu, Lernen<br />
als gemeinsame partizipative Praxis zu arrangieren, z.B. in Untersuchungen,<br />
Beobachtungen, Forschungen, in Evaluationen und in<br />
Diskursen (ebd. S. 183). Nach HÄUSLER (2004, S. 69-70) wird unter<br />
der Prämisse des situierten Lernens die Auswahl und Gestaltung von<br />
Lernorten und Lernumgebungen wichtig, zudem sollte die Lerngruppe<br />
selbst als Ressource für den Lernprozess genutzt werden. Situiertes<br />
Lernen erfordert damit – wie auch soziales Lernen –<br />
Kommunikation und Kooperation der Lernenden.<br />
Bei den hier vorgestellten Simulationsspielen geht es im Kern darum,<br />
aufzuzeigen, dass eine nachhaltige Entwicklung gestaltbar ist. Je nach<br />
den Entscheidungen, welche die Teilnehmer im Spielverlauf treffen,<br />
wird eine nachhaltige Entwicklung in dem betrachteten Ausschnitt aus<br />
der Realität erzielt – oder auch nicht. Es kann dabei pädagogisch sinnvoll<br />
und erwünscht sein, dass die Teilnehmer (zunächst) scheitern und<br />
das Spielsystem kollabiert – dies kann ein Bewusstsein dafür wecken,<br />
zu welchen Konsequenzen die Fortschreibung aktueller Entwicklungstendenzen<br />
in der realen Welt führen würde. Genauso sinnvoll und erstrebenswert<br />
ist aber auch ein Spielverlauf, bei dem sich die Teilnehmer<br />
der Gefahren bewusst werden und Wege (Entscheidungen, Regeln,<br />
Übereinkünfte) zu einer nachhaltigen Entwicklung finden. – Der Spielleiter<br />
wird nicht versuchen, einen dieser denkbaren Spielverläufe vorzugeben<br />
– das Spielergebnis soll ein Ergebnis der Teilnehmer sein.<br />
Ziele und<br />
Kompetenzen<br />
Inwieweit solche Simulationsspiele die Gestaltungskompetenz fördern,<br />
muss offen bleiben; das liegt nicht nur an fehlenden Untersuchungen<br />
sondern auch daran, dass der Kompetenzzuwachs aus einem maximal<br />
einen halben Tag umfassenden Lernarrangement realistisch als gering<br />
bezeichnet werden muss. Immerhin können die Simulationsspiele dazu<br />
129
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
beitragen, die Notwendigkeit von Kompetenzen für eine nachhaltige<br />
Entwicklung zu veranschaulichen. Insofern liegen z.B. folgende Bezüge<br />
zur Gestaltungskompetenz nach RIECKMANN (2010) nahe:<br />
• Kompetenz zu Empathie und Perspektivenwechsel: Die<br />
Teilnehmer können hier Rollen übernehmen, die ihnen im<br />
täglichen Leben verwehrt sind. Bei TriCO2lor spielt die<br />
Empathie für die künftigen Generationen eine Rolle.<br />
• Kompetenz zum vorausschauenden Denken: Um erfolgreich<br />
zu sein, müssen die Teilnehmer lernen, die künftigen Reaktionen<br />
des Systems auf ihre Entscheidungen und auf die<br />
(zunächst unbekannten) Entscheidungen der Mitspieler vorauszusehen<br />
und geeignete Strategien zu entwickeln.<br />
• Kompetenz zum interdisziplinären Arbeiten: Wissen aus der<br />
Ökonomie muss z.B. mit Wissen aus den Naturwissenschaften<br />
verknüpft werden, um zu tragbaren Entscheidungen zu<br />
kommen.<br />
• Kompetenz zur Zusammenarbeit in (heterogenen) Gruppen:<br />
Sofern die Simulationen in Teams gespielt werden, muss<br />
jeder seine ganze Persönlichkeit in sein Team einbringen.<br />
Unterschiedliche Sichtweisen, Hypothesen und Ideen müssen<br />
letztlich zu einer Entscheidung des Teams gebündelt<br />
werden. Auch bei Simulationen, in denen Einzelne gegeneinander<br />
antreten (Barreg-Tunnel-Spiel) kann eine Kooperation<br />
aller sinnvoll sein.<br />
Didaktik und<br />
Methoden<br />
Bei den hier vorgestellten Simulationsspielen werden soziale bzw. natürliche<br />
Systeme simuliert. Dabei werden Schlüsselthemen der Nachhaltigkeit<br />
aufgegriffen. Die Teilnehmer treten in das simulierte System<br />
ein und agieren dort folgenreich in Wechselwirkung mit anderen Teilnehmern.<br />
Damit erfahren sie den im Spielsystem ausgewählten Ausschnitt<br />
aus der Wirklichkeit sehr direkt.<br />
In dem geschützten Rahmen der Planspiele können Lernende sich auf<br />
komplexe praktische Situationen vorbereiten. Sie können mit dem<br />
Lerngegenstand aktiv experimentieren – so wie es in der Realität nicht<br />
möglich (nicht erlaubt, ethisch nicht vertretbar) wäre. Sie können Entscheidungen<br />
treffen, Risiken eingehen und dabei die Konsequenzen<br />
wahrnehmen, aber daran keinen Schaden nehmen.<br />
Die Simulationen können bei Bedarf angehalten, wiederholt, oder variiert<br />
– und damit an das Lerntempo der Teilnehmer angepasst – werden.<br />
Planspiele wecken – wie generell Spiele – in der Regel eine intrinsische<br />
Lernmotivation. Spiele aktivieren; sie sind unmittelbare Eigentätigkeit<br />
130
3.4 Beispielhafte Projekte / Lernarrangements<br />
der Lernenden. Die Bewältigung spielerischer Herausforderungen kann<br />
das gesamte menschliche Auffassungsvermögen beanspruchen, genaue<br />
Beobachtung und Wahrnehmung und rasche Verarbeitung des Wahrgenommenen<br />
fördern. Spiele erlauben es, eine vom Ich verschiedene Rolle<br />
einzunehmen. In der Rolle kann es der Spieler ggf. leichter lernen,<br />
Konflikte zu bearbeiten, zu verlieren, Regeln wahrzunehmen und einzuhalten;<br />
er kann Ausdauer und taktisches Verhalten entwickeln oder<br />
seine Frustrationstoleranz steigern. (LANGNER 2005)<br />
Eine didaktisch fruchtbare Nutzung der Simulationsspiele erfordert es,<br />
dass der eigentlichen Spielphase eine Einführung vorangeht und dass<br />
sich eine Auswertung anschließt, welche letztlich die wichtigste Phase<br />
ist.<br />
Simulierte Systeme sind keine realen Systeme, und sie reagieren damit<br />
nur so realitätsnah wie sie programmiert wurden. Die Ergebnisse sollten<br />
nicht als absolute Wahrheiten missverstanden, sondern vielmehr auch<br />
als Anlass zu einer kritischen Reflexion des Spielsystems genutzt werden.<br />
Besonders ecopolicy ® fordert diese Reflexion heraus, aber auch<br />
bei Fishbanks Ltd sollte sie Bestandteil der Auswertung sein.<br />
Tabelle 6: Simulationsspiele als konstruktivistische Lernumgebungen<br />
Merkmale konstruktivistischer Ausgewählte Merkmale von Simulationsspielen<br />
Lernumgebungen (JONASSEN<br />
1994)<br />
Repräsentation der Komplexität<br />
der Welt, Vermeidung von Vereinfachungen<br />
Die Simulationsspiele repräsentieren z.B. die komplexe<br />
Nutzung von Naturkapital durch die Menschen.<br />
Sie reduzieren diese Komplexität auf wenige<br />
Authentische Aufgabenstellungen<br />
im bedeutungsvollen Kontext<br />
Unterstützung der Wissenskonstruktion<br />
– nicht der Wissensreproduktion<br />
Parameter, ohne dabei simpel zu werden.<br />
Die Teilnehmer werden mit Aufgaben wie der Führung<br />
eines Unternehmens (Fishbanks Ltd ) oder eines<br />
Staates (ecopolicy ® ) betraut. Der Spielleiter kann<br />
die Authentizität zusätzlich erhöhen, z.B. indem er<br />
den Raum passend gestaltet und die Teilnehmer<br />
ihrer Rolle entsprechend – und nicht als Lernende –<br />
behandelt.<br />
Außer einer Einführung in die Rollen wird nichts<br />
vorgegeben. Die Teilnehmer agieren im Spiel zielorientiert<br />
(jeder will gewinnen) aufgrund von<br />
Hypothesen über die Auswirkungen ihres Handelns<br />
und über das Handeln der Mitspieler, die sie sich in<br />
Ermangelung von vorgegebenen Informationen bilden<br />
(müssen). Diese werden im Spielverlauf aufgrund<br />
eingehender Informationen weiterentwickelt.<br />
131
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Befähigen zur Reflexion von<br />
Erfahrungen<br />
Unterstützen multiple Repräsentationen<br />
der Realität<br />
Unterstützen durch Anregungen<br />
zur sozialen Aushandlung eine<br />
kollaborative Wissenskonstruktion<br />
(anstelle der wettbewerbsorientierten<br />
Optimierung von<br />
Behaltensleistungen)<br />
Bieten Lernkontexte, die realen<br />
oder fallbasierten Umgebungen<br />
nahe kommen. Keine vorab festgelegten<br />
Instruktionssequenzen<br />
Fördern kontext- und inhaltsbezogene<br />
Wissenskonstruktion<br />
Eine anschließende Reflexion ist untrennbarer<br />
Bestandteil aller Simulationsspiele in der <strong>BNE</strong>.<br />
Welche Aspekte und Ebenen dabei berührt werden,<br />
wird der Spielleiter u.a. anhand der Zielgruppe und<br />
der Lernziele festlegen.<br />
Die Realität wird mit den Rollen und Spielregeln,<br />
mit den Spielutensilien (z.B. Spielplan, Geld, etc.)<br />
sowie mit Angaben zum Systemverhalten (z.B.<br />
Darstellung von Entwicklungen als Diagramm)<br />
repräsentiert. Im Mittelpunkt stehen jedoch die<br />
sozialen Interaktionen der Teilnehmer, so dass diese<br />
mentale Repräsentationen der Realität aufbauen<br />
können, welche auch Argumente und Gegenargumente,<br />
Erfahrungen, Emotionen etc. mit einschließen.<br />
Soweit in den Simulationsspielen Teams gegeneinander<br />
antreten (Fishbanks Ltd ), werden die o.g.<br />
Hypothesen in diesen Teams erarbeitet. Es ist<br />
zudem möglich, dass Teams miteinander kooperieren<br />
und dazu Regeln (für den gemeinsamen Erfolg<br />
und für eine nachhaltige Entwicklung des Spielsystems)<br />
aushandeln.<br />
Jedes Simulationsspiel beginnt mit einer kurzen<br />
Instruktionssequenz, bei der die Teilnehmer in ihre<br />
Rollen eingeführt werden. Im Spiel wird dann Handeln<br />
in der realen Welt simuliert.<br />
Die Teilnehmer machen sich z.B. in der Reflexionsphase<br />
Gedanken darüber, inwieweit das Spielsystem<br />
die Realität abbildet und wie eine nachhaltige<br />
Entwicklung in den realen Systemen gefördert werden<br />
kann.<br />
Rahmenbedingungen<br />
Voraussetzung für die Nutzung der hier vorgestellten Simulationen<br />
bzw. Planspiele ist es in der Regel, dass ein Spielset gekauft wird. Dieses<br />
umfasst z.B. ein Computerprogramm, Spielmaterialien, Anleitungen<br />
für den Spielleiter und Hintergrundinformationen für die<br />
Einführung bzw. die Reflexionsphase. Einige einfache Spielsets gibt es<br />
auch kostenlos.<br />
Nach meiner Erfahrung sind die vorgegebenen Spielsets in aller Regel<br />
nicht zum sofortigen Einsatz in einem konkreten Lernarrangement geeignet.<br />
Der Spielleiter muss sich auf seine Rolle vorbereiten, dabei wird<br />
er das Spiel an seine Bedürfnisse (Zielgruppe, Kontext, persönlicher<br />
Stil...) anpassen. So kann es z.B. sinnvoll oder notwendig sein, Spielmaterialien<br />
aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen, Materialien<br />
für die Teilnehmer oder Spielpläne ansprechender zu gestalten oder ei-<br />
132
3.5 Zwischenbilanz<br />
ne eigene zielgruppengerechte Strategie für die Moderation der Reflexionsphase<br />
zu erarbeiten. In Einzelfällen können sogar Veränderungen<br />
am Spielsystem erforderlich sein (LANGNER <strong>2011</strong>g).<br />
Die hier vorgestellten Spiele erfordern mindestens einen halben Tag<br />
(das Baregg-Tunnel-Spiel ca. eine halbe Stunde). Angaben zu den<br />
Gruppengrößen wurden bereits gemacht. Eine unabdingbare Voraussetzung<br />
sind ausreichend große Räume mit beweglichem Mobiliar.<br />
3.5 Zwischenbilanz<br />
Der DEUTSCHE BUNDESTAG (2000) fasste einen Beschluss „Bildung für<br />
eine nachhaltige Entwicklung“. Darin erteilte er der Bundesregierung<br />
u.a. den Auftrag, einmal pro Legislaturperiode einen Bericht zu <strong>BNE</strong> zu<br />
erstellen. Bislang sind drei Berichte entstanden (BUNDESMINISTERIUM<br />
FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2002 und 2009 sowie DEUTSCHER<br />
BUNDESTAG 2005) 25 . Die Berichte geben Auskunft über:<br />
• Rahmenbedingungen der <strong>BNE</strong><br />
• Entwicklungen in den Bildungsbereichen<br />
• Aktivitäten der Bundesregierung und der einzelnen Ressorts<br />
• Aktivitäten der Länder<br />
• Stiftungswesen<br />
• sonstige Aktivitäten (Bildungsnetzwerke und Wettbewerbe).<br />
Die Berichte stellen auf aktuellem Stand zahlreiche Programme, Projekte<br />
und Maßnahmen vor, die z.B. für Ihre eigenen <strong>BNE</strong>-Aktivitäten<br />
(Auftragsakquisition, Partnerschaften etc.) interessant sein können.<br />
Das BMBF bemüht sich um eine Einordnung und Definition der <strong>BNE</strong>;<br />
die zu Beginn des Kapitels 3 zitierte <strong>BNE</strong>-Definition stammt aus diesem<br />
Bericht. Zudem betont das BMBF: „Partizipation ist als grundlegendes<br />
Element nachhaltiger Entwicklung und einer Bildung für<br />
nachhaltige Entwicklung zu begreifen.“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR<br />
BILDUNG UND FORSCHUNG 2002, S.5)<br />
Als wichtige Rahmenbedingung wird die Einbindung deutscher <strong>BNE</strong>-<br />
Aktivitäten in globale Strukturen und Organisationen besprochen (vgl.<br />
Kapitel 3.1.2 in diesem <strong>Lehrbrief</strong>). Die UN-Dekade zur <strong>BNE</strong> (vgl. Kapitel<br />
3.2.3) wird gewürdigt. Gesellschaftliche Akteure in Deutschland<br />
Einordnung und<br />
Definition der Bildung<br />
für nachhaltige<br />
Entwicklung<br />
Rahmenbedingungen<br />
für die <strong>BNE</strong><br />
25. Sie finden die Berichte als PDF-Dokumente auf Stud.IP unter Modul 1 / Dateien.<br />
133
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
werden kurz vorgestellt. (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND<br />
FORSCHUNG 2009, S. 8-16)<br />
<strong>BNE</strong> in den<br />
Bildungsbereichen<br />
Elementarpädagogik<br />
Das BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (2002, S.<br />
16-17) vertritt die Auffassung, dass die im Orientierungsrahmen zur<br />
<strong>BNE</strong> (BLK 1998) formulierten Gestaltungsgrundsätze auch für Kindertagesstätten<br />
Bedeutung hätten. Es verweist darauf, dass die gesamte Jugendhilfe<br />
von einer großen Vielfalt weitgehend autonomer Träger<br />
geprägt sei; das könnte auf einen Grund hinweisen, der eine systematische<br />
Verbreitung der <strong>BNE</strong> in der frühkindlichen Bildung erschwert.<br />
Die „naturnahe Gestaltung der Außenflächen, Beiträge zum Energiesparen,<br />
spielzeugfreie Phasen“ werden vom BMBF (ebd.) als „Innovationen<br />
im Kontext der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“<br />
gewürdigt; diese gehen aber bis dato „auf das persönliche Engagement<br />
der Teammitglieder in einzelnen Einrichtungen zurück.“ Ferner wird<br />
auf die bundesweit ca. 50 Wald- und Naturkindergärten verwiesen, „die<br />
jeweils zehn bis 20 Kinder betreuen“ (ebd.). – Es kann eingeschätzt<br />
werden, dass der somit im Jahr 2002 dokumentierte Stand weder eine<br />
konzeptionelle Weiterentwicklung von der Umweltbildung zur <strong>BNE</strong><br />
noch eine breite Implementation belegt.<br />
Immerhin kann das BMBF (ebd.) auch auf wenige Ansätze verweisen,<br />
die über die klassische Umweltbildung hinausgehen, und zwar auf die<br />
Arbeiten von<br />
• Ökoprojekt MobilSpiel zur Umsetzung der ökologischen<br />
Kinderrechte (KREUZINGER/UNGER 1999)<br />
• dem Staatsinstitut für Frühpädagogik in München zu<br />
Agenda 21 und Umweltbildung in Kindertagesstätten (REI-<br />
DELHUBER 2000)<br />
• der Universität Lüneburg zur Integration der <strong>BNE</strong> in die<br />
Ausbildung von Erzieherinnen und Erzieher (STOLTEN-<br />
BERG/SCHUBERT 2000).<br />
Sieben Jahre später beschreibt das BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG<br />
UND FORSCHUNG (2009, S. 17) den Stand so: Drei 26 Maßnahmen im<br />
Nationalen Aktionsplan zur UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“<br />
2005-2014 betreffen den Elementarbereich, darunter nur eine<br />
mit bundesweitem Horizont. Bislang wurden ca. 40 Projekte aus dem<br />
Elementarbereich als offizielle Dekade-Projekte ausgezeichnet. Das<br />
BMBF verweist ferner auf Maßnahmen in den Bundesländern, dazu<br />
sind aber in dem Teil des Berichts, der die Aktivitäten jedes einzelnen<br />
26. Inzwischen – Sommer <strong>2011</strong> – sind es fünf Maßnahmen, siehe DEUTSCHE UNESCO-<br />
KOMMISSION o.J.a<br />
134
3.5 Zwischenbilanz<br />
Bundeslandes vorstellt, keine substanziellen Informationen enthalten.<br />
(ebd.) – Wenn man berücksichtigt, dass der Nationale Aktionsplan ca.<br />
70 Maßnahmen umfasst und bislang über 1.000 Dekade-Projekte ausgezeichnet<br />
wurden, dann ist die frühkindliche Bildung in der <strong>BNE</strong> nach<br />
wie vor eindeutig unterrepräsentiert. Dem BMBF ist das bewusst, es<br />
gibt allerdings zu bedenken, „dass in den letzten Jahren zahlreiche Projekten<br />
angestoßen wurden, die als Maßnahmen für Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung gesehen werden können, aber von den Initiatoren<br />
selbst nicht in diesen Kontext gestellt werden.“ (ebd.)<br />
Der Schule wird eine zentrale Rolle in der <strong>BNE</strong> zugewiesen. Es wird<br />
eingeschätzt, dass Umweltbildung fest in der Schule verankert ist, sowohl<br />
in den Rahmenrichtlinien als auch in der Bildungspraxis. Die<br />
BLK-Modellprogramme (vgl. Kap. 3.2.2) werden ebenso gewürdigt<br />
wie die bundesweit ca. 190 „Umweltschulen in Europa“ 27 , die ca. 470<br />
GLOBE-Schulen und die UNESCO-Projektschulen. Auch die hohe<br />
Zahl von ca. 120 „Dekade-Projekten“ aus Schulen sei sehr erfreulich.<br />
(BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2009, S. 18)<br />
Schulische Bildung<br />
Allerdings wird über die Verankerung der <strong>BNE</strong> in den Rahmenplänen<br />
nichts gesagt. DE HAAN (2010, S. 29) kritisiert, „wie selten <strong>BNE</strong> – mit<br />
Ausnahme des Faches Geografie – in den Lehrplänen oder auch in den<br />
Bildungsstandards der Schulfächer näher konkretisiert wird.“ Er sieht<br />
das darin begründet, dass die Nachhaltigkeitswissenschaft „interdisziplinär<br />
und problemorientiert ausgerichtet“ sei, <strong>BNE</strong> solle daher besser<br />
als „Handlungsfeld“ verstanden und Fächer übergreifend organisiert<br />
werden (ebd.).<br />
LANGNER (<strong>2011</strong>h) belegt dazu, bezogen auf das Themengebiet Klimaschutz<br />
und basierend auf einer Sichtung der Rahmenpläne der Länder<br />
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen sowie Schleswig-<br />
Holstein, dass nahezu alle Unterrichtsfächer spezifische Beiträge zu einem<br />
solchen Handlungsfeld <strong>BNE</strong> leisten können.<br />
Auch die Verbesserung der allgemeinen Bildung wird als Aufgabe im<br />
Sinne der <strong>BNE</strong> gesehen (DEUTSCHER BUNDESTAG 2005, S. 13). Stichworte<br />
sind u.a. die (zu erhöhende) Bildungsqualität sowie der (zu überwindende)<br />
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und<br />
Bildungschancen bzw. -erfolg von Schülern. Ganztagsschulprogramme<br />
sollten als Rahmen für <strong>BNE</strong> genutzt werden.<br />
Hier sieht die Bundesregierung große Fortschritte. Es wird betont, dass<br />
eine wachsende Zahl von Unternehmen die nachhaltige Entwicklung<br />
Berufliche Aus- und<br />
<strong>Weiterbildung</strong><br />
27. Hier negiert der Bericht leider andere ähnlich gelagerte Aktivitäten wie die<br />
„Zukunftsschule Schleswig-Holstein“ oder die „Schule der Zukunft“ in Nordrhein-<br />
Westfalen.<br />
135
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
als Chance begreift, diese in das betriebliche Management integriert<br />
und sich auch entsprechend in der Aus- und <strong>Weiterbildung</strong> engagiert.<br />
Das BMBF hat diese Entwicklung mit Modellversuchen unterstützt,<br />
zahlreiche Ergebnisse sind auf dem Internetportal www.bibb.de/nachhaltigkeit<br />
veröffentlicht. (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND<br />
FORSCHUNG 2009, S. 20-21)<br />
Hochschule<br />
„Aktuell gibt es an zahlreichen Hochschulen Studienangebote, in denen<br />
Fragestellungen einer nachhaltigen Entwicklung behandelt werden.“<br />
(BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2009, S. 19)<br />
Dabei überwiegen Studiengänge mit nachhaltigkeitsrelevanten Themenschwerpunkten<br />
ganz eindeutig gegenüber z.B. reinen Nachhaltigkeitsstudiengängen.<br />
Eine Zahl von bislang 60 Dekade-Projekten<br />
belege, dass sich Hochschulen zunehmend in diesem Bereich engagieren<br />
würden.<br />
Im Bericht 2002 wurde noch betont, es gäbe Ansätze, den Umweltschutz<br />
z.B. mit Instrumenten wie dem Öko-Audit, der Ökobilanzierung<br />
oder Umweltbeauftragten in Hochschulen zu integrieren; vergleichbare<br />
Entwicklungen hin zu einer „nachhaltigen Hochschule“ bedürften hingegen<br />
weiterer Entwicklungsanstrengungen. (BUNDESMINISTERIUM<br />
FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2002) Im dritten Bericht von 2009 wird<br />
dieser interessante Aspekt leider nicht mehr thematisiert.<br />
Exkurs: Ein Blick in die Welt<br />
Für die internationale Ebene sei z.B. auf die bereits 1990 verabschiedete<br />
„Talloires-Erklärung“ verwiesen, in der sich Universitäten u.a.<br />
dazu verpflichten „eine Führungsrolle in der Stärkung des Bewusstseins<br />
für ökologische Herausforderungen einzunehmen, das Umweltwissen<br />
an der gesamten Hochschule zu verbessern und den<br />
Universitätsbetrieb so zu verändern, dass seine Umweltauswirkungen<br />
minimiert werden.“ (ORR 2010, S. 130; vgl. auch ULSF o.J.) Die<br />
Erklärung wurde bislang von über 350 Universitäten in 40 Ländern<br />
unterzeichnet (ebd.).<br />
ORR (ebd., S. 132) hatte im Jahr 2000 einen ersten Aufruf für CO 2 -<br />
neutrale Universitäten (in den USA) publiziert. Bis Sommer <strong>2011</strong> haben<br />
sich 667 Colleges bzw. Universitäten angeschlossen, 402 von ihnen<br />
haben bereits eigene Klimaaktionspläne verabschiedet<br />
(ACUPCC o.J.).<br />
ORR (ebd., S. 131) kritisiert, dass im Zeitraum 2001-2008 in den<br />
USA das Bildungsangebot der Hochschulen in Sachen Nachhaltigkeit<br />
eher ab- als zugenommen habe.<br />
136
3.5 Zwischenbilanz<br />
Mit Verweis auf Daten aus 1998 und 1999 (GIESEL/DE HAAN/RODE/<br />
SCHRÖTER/WITTE 2001 und DE HAAN/GIESEL/RODE 2002) wird ein<br />
umfangreiches Angebot der außerschulischen Umweltbildung konstatiert.<br />
Die ca. 4.600 Einrichtungen bundesweit weisen 25 bis 27 Millionen<br />
Teilnehmerstunden jährlich auf. Für die entwicklungspolitische<br />
Bildung liegen keine vergleichbaren Daten vor, hier wurden aber zumindest<br />
zentrale Themenschwerpunkte wie z.B. Umwelt und Entwicklung,<br />
Menschenrechte, Migration, Zukunft der Arbeit sowie<br />
Globalisierung und Weltwirtschaft ermittelt. Ausdrücklich wird der<br />
Mobilisierungseffekt großer entwicklungspolitischer Kampagnen gewürdigt.<br />
Auf die überwiegend ehrenamtlichen Strukturen, besonders im<br />
Bereich der entwicklungspolitischen Bildung wird verwiesen. Zudem<br />
wird betont, dass auch dieser Bereich sich der Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung öffnet. (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FOR-<br />
SCHUNG 2002)<br />
<strong>Weiterbildung</strong> und<br />
außerschulische<br />
Bildung<br />
Exkurs: „Rettet den Regenwald“ als Beispiel für <strong>BNE</strong>-relevante<br />
Kampagnen<br />
Kampagnen können ein geeignetes Mittel sein, um der Nachhaltigkeit<br />
dienende Entscheidungen z.B. in Regierungen oder Unternehmen<br />
zu erzwingen.<br />
Rettet den Regenwald! ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in<br />
Hamburg, welcher seit 1986 aktiv ist. Der Verein setzt sich für den<br />
Erhalt der Regenwälder, ihre Bewohner und soziale Reformen in den<br />
betroffenen Regionen ein. (RETTET DEN REGENWALD o.J.) Mit seinen<br />
einzelnen Aktionen und Kampagnen will der Verein erreichen<br />
dass<br />
• Nationalregierungen den Regenwald und ihre Bewohner<br />
vor der an kurzfristigen Profiten interessierten Ausbeutung<br />
schützen,<br />
• Politiker und andere Entscheider in Deutschland und<br />
anderen Industrieländern darauf Einfluss nehmen (z.B.<br />
mit politischem Druck, bei der Kreditvergabe, durch ihr<br />
Importverhalten),<br />
• Menschen in Deutschland verantwortlich leben und konsumieren<br />
und ihre Stimme gegen die Zerstörung des<br />
Regenwaldes erheben,<br />
• Einwohner der Regenwälder die Chance auf ein selbstbestimmtes<br />
Leben bekommen.<br />
137
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Der Verein initiiert Protestkampagnen gegen einzelne konkrete Projekte<br />
des Raubbaus (z.B. umweltzerstörende Ausbeutung von Bodenschätzen,<br />
Überflutung riesiger Waldflächen für Großstaudämme,<br />
Waldzerstörung zugunsten von Monokulturen). Dabei werden die<br />
Ursachen aufgezeigt und die Täter genannt. Es wird versucht, möglichst<br />
viele Menschen als Unterzeichner zu gewinnen, um so Entscheider<br />
zu beeinflussen. Die Unterzeichnung geschieht über die<br />
Vereinsplattform http://www.regenwald.org/. Im Jahr 2010 wurden<br />
25 Protestkampagnen realisiert, die jeweils 10.000 bis über 20.000<br />
Menschen unterzeichnet haben.<br />
Daneben werden Spendenkampagnen initiiert, auch diese beziehen<br />
sich auf ganz konkrete Projekte. Anfang <strong>2011</strong> waren auf der Website<br />
14 laufende Spendenaktionen aufgelistet.<br />
Damit eng verbunden ist die Informationsarbeit in Deutschland: Die<br />
Bevölkerung wird über deutsche Beteiligungen an der Regenwaldzerstörung,<br />
aber auch Möglichkeiten des verantwortungsvollen Konsums<br />
und des privaten Engagements aufgeklärt.<br />
Neben der mehrsprachigen Vereinsplattform nutzt der Verein soziale<br />
Netzwerke bzw. Dienste wie Facebook, flickr, twitter, youtube, vimeo<br />
und gibt die Zeitschrift Regenwald-Report (kostenlos als Papierausgabe<br />
und als PDF) heraus. Interessenten bzw. Unterzeichner<br />
früherer Kampagnen werden per E-Mail auf neue Kampagnen aufmerksam<br />
gemacht und zeitnah über Erfolge informiert.<br />
Die Kampagne agiert in einem Brennpunkt der Nachhaltigkeit. Sie<br />
wird von der Idee der Gerechtigkeit getragen und widmet sich dem<br />
Erhalt von Naturkapital. Sie liefert aktuelle Informationen über nicht<br />
nachhaltige Entwicklungen. Sie vermittelt die motivierende Botschaft:<br />
Es ist möglich zu helfen. Sie bietet Ansatzpunkte zur Bürgerbeteiligung.<br />
Und nicht zuletzt bietet sie sehr authentische<br />
Lernanlässe, das geht bis dahin, dass Betroffene aus den Regenwäldern<br />
als „Botschafter“ nach Deutschland geholt werden.<br />
Aktivitäten der<br />
Bundesregierung<br />
Die Aktivitäten der Bundesregierung nehmen in den Berichten einen<br />
großen Raum ein. Hier können nur wenige Einzelbeispiele wiedergegeben<br />
werden, die in Bezug zum Kontext dieses <strong>Lehrbrief</strong>es stehen.<br />
Das BMBF fördert die deutsche Organisationsstruktur zur UN-Dekade<br />
und deren Aktivitäten mit jährlich 450.000 €. In diesem Zusammenhang<br />
ist u.a. im Sommer 2007 das von der Deutschen UNESCO-Kommission<br />
betreute Internetportal www.bne-portal.de online gegangen, das eine<br />
138
3.6 Zusammenfassung<br />
der erfolgreichsten deutschsprachigen Websites zur <strong>BNE</strong> ist. 28 <strong>BNE</strong><br />
wurde auch in den Informationsdienst www.lehrer-online.de integriert.<br />
Das BMBF fördert seit 2007 ein Forschungsprojekt, das die Auswirkungen<br />
des BLK-Programms „Transfer 21“ untersuchen soll. (BUNDES-<br />
MINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2009, S. 28-43)<br />
Für den Verantwortungsbereich des BMU wird auf die regelmäßig<br />
durchgeführten Repräsentativbefragungen zum Stand des Umweltbewusstseins<br />
und des Umweltverhaltens hingewiesen (BUNDESMINISTE-<br />
RIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2002, S. 21; die für<br />
Umweltpädagogen außerordentlich interessanten Studien sind unter<br />
www.umweltbewusstsein.de abrufbar).<br />
Zu erwähnen sei ferner der ausgezeichnete Bildungsservice des BMU<br />
(www.bmu.de/bildungsservice/).<br />
Auch die Bundesministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br />
sowie für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung<br />
können als wichtige staatliche Akteure der <strong>BNE</strong> gelten.<br />
3.6 Zusammenfassung<br />
Ausgangspunkt für diesen Abschnitt war das Kapitel 36 der Agenda 21,<br />
in dem die Bildung aufgefordert wird, zu einer nachhaltigen Entwicklung<br />
beizutragen. Sie sollten diesen Bildungsauftrag in den Grundzügen<br />
kennen und auch verstanden haben, warum das kein einfaches „Rezept“<br />
für Bildung ist. Im Kapitel 3.1 wird ferner auf die internationale Anbindung<br />
und auf die erste Resonanz in Deutschland eingegangen – das ist<br />
eher notwendiger Hintergrund als klassischer „Lernstoff“.<br />
Kapitel 3.2 widmet sich der Umsetzung dieses Bildungsauftrags. Dabei<br />
werden die Schule, die frühkindliche Bildung sowie die UN-Dekade zur<br />
<strong>BNE</strong> betrachtet. Es wird dargestellt, wie die Implementation von <strong>BNE</strong><br />
organisiert wird und welche Ergebnisse – aber auch welche Lücken – es<br />
bislang gibt. Die durchgängige Frage ist jedoch, was <strong>BNE</strong> konkret<br />
meint. Die Antwort wird je nach Lesart des Bildungsauftrages der<br />
Agenda 21 unterschiedlich ausfallen; das in Deutschland sehr populär<br />
gewordene Konzept der Gestaltungskompetenzen sollten Sie jetzt kennen;<br />
eine beispielhafte <strong>BNE</strong>-Definition entstammt dem Hamburger Aktionsplan.<br />
28. Hier gemessen an einem „Seitwert“ von 43,74 (www.seitwert.de, 18.7.<strong>2011</strong>); in diesen<br />
Wert gehen u.a. die Zahl der Backlinks, die Gewichtung bei Google und Yahoo, Social<br />
Bookmarks, Wikipedia-Referenzierungen, die Zahl der Besucher und technische Details<br />
ein. Vergleiche mit anderen Websites kann jeder Interessent auf seitwert.de selber<br />
vornehmen.<br />
139
3 Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
Aus unterschiedlichen praktischen Kontexten – das beginnt z.B. bei<br />
Diskussionen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung<br />
(ANU) und endet nicht bei Ihren Masterarbeiten im Fernstudium<br />
Umwelt & Bildung – ist mir bewusst, wie unscharf der <strong>BNE</strong>-Begriff<br />
dennoch weiterhin ist. Ausgehend von der These, dass die Ursache dafür<br />
ganz wesentlich in einem unscharfen Nachhaltigkeitsbegriff liegt,<br />
wird im Kap. 3.3 eine <strong>BNE</strong>-Definition vorgeschlagen, welche auf einer<br />
konkreten Theorie der Nachhaltigkeit aufbaut.<br />
Letztlich, so vermute ich, interessieren Sie sich vor allem für die Bildungspraxis.<br />
Diese wird Ihnen endlich im Kapitel 3.4 geliefert. Zwei<br />
Lernarrangements werden dort besprochen, sie sollen lediglich als Beispiele<br />
für die Umsetzung der <strong>BNE</strong> dienen. Bitte stellen Sie Ihre eigenen<br />
Erfahrungen z.B. auf Stud.IP mit als Lernressource zur Verfügung!<br />
Die Bundesregierung hat inzwischen drei Berichte zur <strong>BNE</strong> vorgelegt.<br />
Diese bieten den Stoff für eine Zwischenbilanz, die im Kapitel 3.5 gezogen<br />
wird und die sich überwiegend auf die Verankerung der <strong>BNE</strong> in<br />
den verschiedenen Bildungsbereichen bezieht.<br />
Mehrfach wird in diesem Abschnitt auf interessante Aktivitäten, Programme<br />
oder Projekte nur hingewiesen; damit will ich Ihnen Anknüpfungspunkte<br />
für eigene Arbeiten bereitstellen, die Sie je nach<br />
persönlichem Interesse selber vertiefen können.<br />
Als letzte Irritation in diesem Abschnitt möchte ich Ihnen einige Fragen<br />
mit auf den Weg geben:<br />
Exkurs: Offene Fragen für die <strong>BNE</strong> (Idee und Zitate nach ORR,<br />
2010, S. 129)<br />
„Müssen wir die Natur lieben? Oder genügt eine grundlegende Umweltkompetenz,<br />
um in Harmonie mit ihr zu leben?“<br />
Inwieweit sind „die Systeme, die uns mit Nahrungsmitteln, Energie<br />
und Materialien versorgen“ durch Peak Oil oder den Klimawandel<br />
gefährdet – und müssen wir daher wieder „Fertigkeiten...erlernen, die<br />
notwendig sind, um uns stärker selbst versorgen zu können?“<br />
Brauchen wir einen grundlegenden gesellschaftlich/kulturellen Paradigmenwechsel<br />
– oder lässt sich Zukunftsfähigkeit auch erzielen,<br />
wenn die Menschheit immer zahlreicher und wohlhabender wird und<br />
die Natur immer wirksamer beherrscht? Im zweiten Falle „müssten<br />
die Lehrpläne der Zukunft wie die der Vergangenheit aussehen, nur<br />
mit einer noch stärkeren Gewichtung auf den Naturwissenschaften<br />
und technologischen Disziplinen.“<br />
140
3.6 Zusammenfassung<br />
„In welchem Maße ist die Natur noch „natürlich“ und kein vom Menschen<br />
manipuliertes Artefakt? Ist etwas an sich falsch an Plastikbäumen,<br />
soll heißen: an einer zunehmend konstruierten Natur? Wenn ja,<br />
was genau? Was ist natürlich und was nicht? Und welchen, wenn<br />
überhaupt einen, Unterschied macht das aus?“<br />
„Worin besteht der Zweck von Umwelterziehung gleich welcher Art,<br />
wenn die Natur sich durch den Zangengriff des raschen Klimawandels<br />
und des fortschreitenden Verlusts der biologischen und landschaftlichen<br />
Vielfalt radikal ändert?“<br />
Sind Menschen „wie Aldo Leopold, Wangari Maathai und Rachel<br />
Carson“, die ihr ganzes Leben für Umweltschutz/Nachhaltigkeit gewidmet<br />
haben, heute als Vorbilder noch relevant? „Oder genügt es<br />
zur Herstellung einer nachhaltigen Zukunft, wenn Ökokapitalisten,<br />
CO 2 -Broker und Umweltunternehmer große Geschäfte und das große<br />
Geld machen? Wenn ja, dann sollte Umwelterziehung den<br />
Schwerpunkt auf CO 2 -Management legen.“<br />
141
4 Lokale Agenda 21<br />
4 Lokale Agenda 21<br />
Im Kapitel 2 wurde das Leitbild der Nachhaltigkeit vorgestellt, dabei<br />
wurde ganz überwiegend die internationale bzw. nationale Bezugsebene<br />
gewählt. Nun ist es aber realistisch anzunehmen, dass Sie mit der<br />
Nachhaltigkeit eher vor Ort in Berührung kommen. Hier leben, wirtschaften<br />
und bauen, kaufen und konsumieren die Menschen. Entscheidungen<br />
über Straßenbau und Nahverkehr, über den Umgang mit Boden,<br />
über Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Energieversorgung<br />
und Abfallentsorgung werden überwiegend auf dieser Ebene getroffen<br />
29 . Hier können sich Menschen an der Gestaltung ihrer Lebensumgebung<br />
beteiligen.<br />
In diesem Sinne weist die Agenda 21 (siehe Kap. 2.2.2) den Kommunen<br />
eine tragende Rolle in der nachhaltigen Entwicklung zu. Mit der Unterzeichnung<br />
der Charta von Aalborg (Kap. 2.2.4) bekennen sich Kommunen<br />
zu dieser Verantwortung.<br />
Im Kapitel 3 haben Sie sich mit dem Konzept der <strong>BNE</strong> auseinandergesetzt.<br />
Auch hier verlief der rote Faden über die internationale und (vorrangig)<br />
über die nationale Bezugsebene. Doch vermutlich werden Sie<br />
sich auch mit der <strong>BNE</strong> eher auf der lokalen Ebene befassen. Hier befinden<br />
sich die Schulen, hier agieren die Umweltbildungseinrichtungen,<br />
hier lernen vielleicht auch Ihre eigenen Kinder.<br />
Das alles sind Gründe, sich in diesem letzten Abschnitt des <strong>Lehrbrief</strong>es<br />
der kommunalen Ebene zuzuwenden. Dazu wird zunächst der Begriff<br />
der Lokalen Agenda 21 eingeführt. Danach wird im Kap. 4.1 anhand<br />
von drei Beispielen vorgestellt, wie Kommunen eine nachhaltige Entwicklung<br />
befördern können. Mit Hinblick auf die vielfältigen Rollen,<br />
die Umweltpädagogen in kommunalen Nachhaltigkeitsprozessen spielen<br />
können, wird im Kap. 4.2 auf Methoden zur Bürgerbeteiligung eingegangen.<br />
Eine Zwischenbilanz zu Lokalen Agenda 21 folgt (Kap. 4.3);<br />
ich möchte hier bereits vorweg nehmen, dass Sie diese hinsichtlich des<br />
Umfanges und der Breitenwirksamkeit recht kritisch ausfällt, und ich<br />
hoffe umso mehr, dass in den Kapiteln 4.1 und 4.2 dennoch genügend<br />
Anknüpfungspunkte für Ihr Studium und Ihre Arbeit finden. Der Abschnitt<br />
endet dann unter 4.4 wieder mit einer Zusammenfassung.<br />
29. Allerdings gibt es auch gegenläufige Tendenzen: Mit der Liberalisierung der Strommärkte<br />
können die Endverbraucher ihren Stromlieferanten selbst aussuchen; in der<br />
Abfallwirtschaft wurde die Eigenverantwortung insbesondere der gewerblichen<br />
Abfallerzeuger zu Lasten der kommunalen Abfallwirtschaft gestärkt; mit der<br />
Privatisierung ihrer Wasserwerke oder ihrer kommunalen Wohnungsbestände hat in den<br />
vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Kommunen eigenen Gestaltungsspielraum<br />
abgegeben.<br />
143
4 Lokale Agenda 21<br />
Begriffliche<br />
Annäherungen<br />
Die Agenda 21, das politische Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert,<br />
wendet sich ganz überwiegend an die Staaten bzw. deren Regierungen.<br />
Da viele für eine nachhaltige Entwicklung relevante Prozesse<br />
auf lokaler Ebene – also in den Städten und Gemeinden – ablaufen,<br />
werden im Kapitel 28 der Agenda 21 die Kommunen in der ganzen Welt<br />
aufgerufen, ein eigenes Aktionsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung<br />
– eine sogenannte Lokale Agenda 21 – zu erarbeiten.<br />
ICLEI (1998, S. 25ff) versteht die Lokale Agenda 21 als politisches Dokument,<br />
als Prozess und als politische Kultur:<br />
Lokale Agenda 21 als<br />
politisches Dokument<br />
Lokale Agenda 21 als<br />
Prozess<br />
Lokale Agenda 21 als<br />
politische Kultur<br />
Als politisches Dokument ist die Lokale Agenda 21 ein kommunaler<br />
Aktionsplan. Hier beschreibt die Kommune, wie sie eine nachhaltige<br />
Entwicklung umsetzen will. Wie auch in der Agenda 21, werden dazu<br />
(im Idealfall) Leitbilder, Ziele, Instrumente, Maßnahmen, Akteure und<br />
Mittel sowie die Kriterien zur Erfolgsbemessung beschrieben.<br />
Für den Prozess zur Erarbeitung einer Lokalen Agenda 21 gibt es vielfältige<br />
Möglichkeiten. Wichtige Schritte dabei sind insbesondere das<br />
Aufstellen von Leitbildern, eine Bestandsaufnahme (inklusive der Festlegung<br />
von Indikatoren), das Aufstellen von Zielen, die Identifizierung<br />
von Potenzialen für die Umsetzung, die Festlegung von Maßnahmen,<br />
die Umsetzung sowie die Erfolgskontrolle (vgl. Kap. 2.3.1 Operationalisierung).<br />
„Quer“ zu diesen Schritten ist es u.a. erforderlich, das notwendige<br />
politische Mandat einzuholen (Ratsbeschluss) und die<br />
relevanten Akteure einzubinden.<br />
Als politische Kultur steht die Lokale Agenda 21 dafür, dass die Handlungsträger<br />
in Lokalpolitik und Verwaltung gemeinsam mit den Bürgerinnen<br />
und Bürgern, den örtlichen Organisationen und der<br />
Privatwirtschaft nach lokal angepassten Lösungen für eine nachhaltige<br />
Entwicklung suchen. Damit ist tendenziell eine Entwicklung von government<br />
(Regieren im Sinne einer top-down Steuerung) zu governance<br />
(Netzwerkartiges Regieren im Sinne einer flexiblen Steuerung) verbunden<br />
(vgl. SCHWALB/WALK 2007).<br />
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
Die Kommunen haben in ihren Lokale Agenda 21-Prozessen eine Vielzahl<br />
von Themen aufgegriffen, verschiedenste Organisationsformen<br />
und Arbeitsmethoden gewählt, ein breites Spektrum von Akteuren einbezogen,<br />
und sie waren damit in unterschiedlichem Maße erfolgreich.<br />
Wenn nachfolgend Einblicke in derartige Prozesse gegeben werden,<br />
dann kann und soll das nicht darauf hinauslaufen, dass Sie anschließend<br />
einen repräsentativen Querschnitt der Lokalen Agenda 21 in Deutsch-<br />
144
4 Lokale Agenda 21<br />
land kennen – die folgenden Abschnitte präsentieren lediglich Beispiele.<br />
• Dabei steht Hamburg für die Operationalisierung der Nachhaltigkeitsidee<br />
in Form eines Indikatorensets.<br />
• Düsseldorf steht dafür, wie die Lokale Agenda 21 gute Rahmenbedingungen<br />
für die <strong>BNE</strong> schafft.<br />
• Stralsund steht dafür, wie sich der kommunale Klimaschutz<br />
als ein neues nachhaltigkeits- und <strong>BNE</strong>-relevantes Aufgabenfeld<br />
etabliert.<br />
Wenn Sie weitere Aspekte der Lokalen Agenda 21 für wesentlich halten<br />
und dazu eventuell sogar Erfahrungen beisteuern können, sind Sie herzlich<br />
eingeladen, sich auf der Plattform Stud.IP zu Wort zu melden.<br />
4.1.1 Hamburg: Operationalisierung und Kommunikation<br />
Die Freie und Hansestadt Hamburg ist eine Metropole mit mehr als 1,7<br />
Mio Einwohnern (STATISTISCHES LANDESAMT DER FREIEN UND HAN-<br />
SESTADT HAMBURG 2003, S. 3). Gemeinsam mit Berlin und Bremen gehört<br />
Hamburg zu den deutschen Städten, die gleichzeitig den Status<br />
eines Bundeslandes besitzen.<br />
Die Stadt Hamburg unterzeichnete 1996 die Charta von Aalborg<br />
(GOMM/WILLKE 2000, S.30) und startete damit ihren Lokale Agenda 21<br />
Prozess.<br />
GOMM/WILLKE (2000) kritisierten, dass anfangs der Agenda-Prozess in<br />
Hamburg überwiegend projektbezogen geführt wurde und eine Diskussion<br />
darüber, was Nachhaltigkeit in der Hansestadt konkret bedeuten<br />
würde, ausgeblieben sei. Dem wollten Germanwatch und der 1996 gegründete<br />
Zukunftsrat Hamburg abhelfen. Germanwatch legte bereits<br />
1996 einen ersten Bericht vor, in dem die Zukunftsfähigkeit Hamburgs<br />
analysiert wurde (GERMANWATCH REGIONALGRUPPE HAMBURG 1996).<br />
Der Zukunftsrat Hamburg stellte erstmal im Jahr 1999 ein „Zeugnis für<br />
eine Zukunftsfähige Hansestadt“ aus, das damals noch auf 12 „Fächer“<br />
(Indikatoren) begrenzt war. Erfasst und bewertet wurden damals u.a.<br />
die Verschuldung der Stadt, die Jugendarbeitslosigkeit, die Kinderarmut,<br />
die CO 2 -Emissionen, die versiegelten bzw. nicht versiegelte Flächen<br />
in Hamburg und die Wahlbeteiligung bei der Bürgerschaftswahl<br />
(ZUKUNFTSRAT HAMBURG 1999, vgl. Abb. 6).<br />
Zeugnis für eine<br />
Zukunftsfähige<br />
Hansestadt<br />
145
4 Lokale Agenda 21<br />
Abb. 6:<br />
Zeugnis für eine Zukunftsfähige Hansestadt (ZUKUNFTSRAT HAM-<br />
BURG; nach einem Foto von Klaus Willke)<br />
Diese Indikatoren wurden ausgewählt, weil sie<br />
• „leicht verständlich und als Zukunftsfähigkeitsmaßstab<br />
plausibel sind,<br />
• die Nachhaltigkeitsdimensionen Wirtschaft, Soziales, Ökologie<br />
und Bürgerbeteiligung ansprechen und<br />
• mit Hamburger Daten aus mehreren Jahren „gefüllt“ werden<br />
konnten.“ (GOMM/WILLKE 2000, S.34)<br />
Das „Zeugnis für eine Zukunftsfähige Hansestadt“ wurde mit großem<br />
Aufwand publik gemacht, so wurde die Broschüre an alle relevanten öffentlichen<br />
Entscheidungsträger verschickt; das Zeugnis wurde zudem<br />
z.B. in vielen U-Bahnhöfen plakatiert (ebd., S. 40).<br />
HEINZ<br />
Inzwischen wurde das Indikatorenset zu HEINZ (Hamburger Entwicklungs-INdikatoren<br />
Zukunftsfähigkeit) umbenannt, die Datenbasis wurde<br />
mehrfach fortgeschrieben, und dabei wurde auch das<br />
Instrumentarium weiterentwickelt. HEINZ enthält 30 Nachhaltigkeitsziele,<br />
32 Indikatoren und 32 Zielwerte. (ZUKUNFTSRAT HAMBURG<br />
2006, 2007, 2010a und b)<br />
146
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
Die Nachhaltigkeitsziele beschreiben konkret, wie ein nachhaltiges<br />
Hamburg aussehen sollte. Dafür kommen sicherlich potenziell sehr viele<br />
Ziele infrage. Der Zukunftsrat wollte mit einer begrenzten Anzahl<br />
von Zielen die ganze Spannbreite aller möglichen Nachhaltigkeitsthemen<br />
möglichst gut abdecken. Dazu hat er sich an dem bereits in den Kapiteln<br />
2.3.4 bzw. 2.4 beschriebenen Drei-Säulen-Modell orientiert. Für<br />
jede der drei Säulen (Ökonomie – Ökologie – Soziales) hat er 10 Ziele<br />
aufgestellt; zusätzlich hat er die Partizipation als ein zentrales Mittel zur<br />
Umsetzung von Nachhaltigkeit mit einbezogen, so dass es insgesamt 31<br />
Ziele gibt. Viele dieser Ziele sind nicht eindimensional nur einer Säule<br />
der Nachhaltigkeit zuzuordnen. Sowohl die Auswahl der Ziele als auch<br />
deren Zuordnung zu den drei Säulen beinhalten subjektive Einschätzungen,<br />
was den Autoren auch bewusst ist. (ZUKUNFTSRAT HAMBURG<br />
2006, S. 2-4)<br />
Jedem Ziel wird (in der Regel) ein Indikator zugeordnet, der zumindest<br />
beispielhaft einen wesentlichen Aspekt des Ziels abbildet.<br />
Nachhaltigkeitsziele<br />
Indikatoren<br />
Bei vielen Indikatoren kann der Zukunftsrat auf belastbarere Daten zurückgreifen.<br />
So wurde als Ziel postuliert, dass die Struktur der öffentlichen<br />
Haushalte gesund sein möge. Das wird mit den Indikatoren<br />
• Finanzierungsdefizit im öffentlichen Haushalt in Prozent<br />
sowie<br />
• Zins / Steuer-Quote in Prozent<br />
unterlegt. Hier nutzt der Zukunftsrat Daten der Finanzbehörde Hamburg.<br />
(ZUKUNFTSRAT HAMBURG 2006 und 2010a)<br />
Andere Indikatoren stehen auf einer weniger soliden Datenbasis. So<br />
enthält HEINZ beispielsweise das Ziel, die Herstellung nachhaltiger<br />
Produkte zu fördern. Im Jahr 2006 wurde dazu der Indikator „Anteil des<br />
solar erzeugten Warmwassers am gesamten Warmwasserbedarf der<br />
Haushalte in Prozent“ 30 erhoben; im Jahr 2010 wurde auf die Erhebung<br />
eines solchen Indikators verzichtet. (ebd.)<br />
147
4 Lokale Agenda 21<br />
Zielwerte<br />
Bewertung und<br />
Schlussfolgerungen<br />
Nachhaltigkeits-<br />
Ampel<br />
Mit den Indikatoren wird zunächst die aktuelle Situation in der Hansestadt<br />
(IST) bzw. die Entwicklung über mehrere Jahre abgebildet (in offensichtlicher<br />
Anlehnung an die Indikatorenberichte des Statistischen<br />
Bundesamtes zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie enthält<br />
HEINZ 2010 auch entsprechende Zeitreihen in Diagrammform). Um diese<br />
Daten bewerten zu können, sind Zielwerte (SOLL) vonnöten. Der<br />
Zukunftsrat geht dabei davon aus, dass Nachhaltigkeit noch von den<br />
heute lebenden Generationen – also spätestens bis zum Jahr 2050 – erreicht<br />
werden muss. Aus diesen Zielvorstellungen werden pragmatische<br />
Etappenziele für den Zeithorizont 2020 abgeleitet, d.h. hiermit wird den<br />
Menschen, die heute in beruflicher, politischer oder privater Verantwortung<br />
stehen, eine Perspektive aufgezeigt, die sie selbst mit gestalten<br />
können und mit verantworten müssen (ZUKUNFTSRAT HAMBURG 2006,<br />
S. 6-7).<br />
Vergleicht man nun die Entwicklungen der vergangenen Jahre bzw. den<br />
aktuell erreichten Stand mit den Zielwerten, so wird eine Bewertung<br />
möglich, und es können entsprechende Schlussfolgerungen für das politische<br />
Handeln abgeleitet werden.<br />
Sämtliche Bewertungen werden in Kurzform zu einer sogenannten<br />
Nachhaltigkeits-Ampel zusammengefasst. Somit kann der Zukunftsrat<br />
übersichtlich darstellen, in welchen Bereichen Hamburg von den Zielwerten<br />
noch weit entfernt ist (rot), wo eine unklare Entwicklung besondere<br />
Aufmerksamkeit verdient (gelb) und wo absehbar ist, dass die<br />
Zielwerte erreicht werden können (grün).<br />
Die somit getroffene Gesamtbewertung soll nachfolgend in Form einer<br />
Presseerklärung des Zukunftsrats wiedergegeben werden.<br />
30. Solarthermie (= Wärmeerzeugung mit Sonnenenergie) kann in Haushalten im<br />
Wesentlichen für die Erwärmung von Trinkwasser oder zur Unterstützung der<br />
Raumheizung genutzt werden; nur die erstgenannte Option wird hier betrachtet. Die<br />
Datenbasis bilden (begründete) Schätzwerte: Bekannt ist, in welchem Umfang die<br />
Installation von Solarthermieanlagen zur Trinkwassererwärmung auf Wohngebäuden von<br />
der Stadt finanziell gefördert worden ist. Es wird abgeschätzt, dass zusätzlich eine gleiche<br />
Anzahl von Anlagen ohne staatliche Förderung installiert worden ist. Der aktuelle<br />
Bestand wird somit auf 17.000 MWh Solarthermie geschätzt. Das sind ca. 5% des<br />
Warmwasserbedarfs aller Haushalte der Hansestadt. Auf welcher Basis dieser Prozentsatz<br />
ermittelt wurde, wird nicht angegeben. Denkbar wäre z.B., die Anzahl der Haushalte mit<br />
Solaranlagen ins Verhältnis zur Zahl aller Haushalte zu setzen (was implizieren würde,<br />
dass alle Haushalte etwa gleich viel Warmwasser verbrauchen und dass die Haushalte mit<br />
Solaranlagen ihren gesamten Warmwasserbedarf solar erzeugen). Denkbar wäre auch,<br />
dass der Warmwasserbedarf aller Haushalte bzw. der Teilmenge mit Solaranlage zugrunde<br />
gelegt wird (was voraussetzen würde, dass dazu Datenmaterial beschafft werden kann).<br />
(ZUKUNFTSRAT HAMBURG 2006, S. 22-23)<br />
148
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
Umwelthauptstadt <strong>2011</strong> im Nachhaltigkeits-Check (Auszüge)<br />
„Mit HEINZ 2010 hat der Zukunftsrat Hamburg seine „Hamburger<br />
Entwicklungs-Indikatoren Zukunftsfähigkeit (HEINZ)“ erneut aktualisiert.<br />
Die ökologischen Kriterien haben sich durchschnittlich<br />
besser entwickelt als die sozialen. Die Neuverschuldung (Haushaltsdefizit)<br />
hat sich von 2008 zu 2009 vervielfacht. Die Nachhaltigkeits-<br />
Ampeln zeigen überwiegend rot, weil sich die Bewertung an konkreten<br />
Nachhaltigkeits-Zielzahlen für 2050 und abgeleiteten Etappenzielen<br />
für 2020 orientiert.<br />
Die Aktualisierung der Nachhaltigkeits-Indikatoren mit Werten von<br />
2009 zeigt, dass die Umwelthauptstadt <strong>2011</strong> in vielen ökologischen<br />
Bereichen auf dem richtigen Weg, aber vielfach noch nicht weit genug<br />
gegangen ist: Die CO 2 -Emissionen haben weiter abgenommen.<br />
Mit erheblichen Anstrengungen könnten sie die Zielzahlen für 2020<br />
noch erreichen: unter 6,5 Tonnen insgesamt und im Verkehr unter 2,3<br />
Tonnen pro Einwohner und Jahr...<br />
Die Entwicklungskurve der Siedlungs- und Verkehrsfläche hat sich<br />
seit 2006 zwar stark abgeflacht, 2009 sind im Saldo aber wieder 42 ha<br />
(mehr als zweimal die Binnenalster) neu hinzu gekommen. Die Beispiels-Indikatoren<br />
für regionale und fair gehandelte Produkte (deutsche<br />
Äpfel und Transfair-Kaffee) haben sich weiter zum Positiven<br />
entwickelt. Die auf über 600 gestiegene Mitgliederzahl der Umwelt-<br />
Partnerschaft zwischen Staat und Wirtschaft bleibt immer noch deutlich<br />
unter 1 % der Hamburger Betriebe. Das Abfallaufkommen sinkt<br />
nur langsam und bleibt mit 459 Tonnen pro Einwohner immer noch<br />
auf zu hohem Niveau...<br />
Bei den sozialen Indikatoren zeichnet sich noch nicht einmal durchgängig<br />
der Weg in die richtige Richtung ab: Wegen der Wirtschaftskrise<br />
sind 2009 die Arbeitslosenquote (10 %) und mit 133 pro 1000<br />
Einwohner auch die Anzahl der Sozialleistungsempfänger wieder angestiegen.<br />
Der Vergleich der 10 reichsten mit den 10 ärmsten Stadtteilen<br />
Hamburgs nach der durchschnittlichen Arbeitslosen- und<br />
Hartz IV-Empfänger-Quote zeigt eine weitere Vergrößerung des Abstands<br />
zwischen Arm und Reich bei der Quote der Empfänger staatlicher<br />
Transferleistungen... Positiv entwickelte sich dagegen der<br />
Bildungsbereich:<br />
149
4 Lokale Agenda 21<br />
Die Schulabbrecherquote sank für alle Schülerinnen und Schüler<br />
2009 auf 7,8 % und für ausländische Jugendliche auf 14,4 % - ein Erfolg,<br />
der jedoch noch erheblich gesteigert werden muss, soll Integration<br />
wirklich gelingen. Verbessert, wenn auch noch nicht<br />
ausgeglichen, hat sich auch das Verhältnis der Bruttoverdienste zwischen<br />
Männern und Frauen.<br />
Bei den eher strukturellen Indikatoren, die als Bedingungen für eine<br />
nachhaltige Entwicklung gelten können, tritt vor allem das stark gestiegene<br />
Finanzierungsdefizit des Hamburger Haushalts hervor: Wegen<br />
der Finanz- und Wirtschaftskrise lagen die Staatsausgaben 2009<br />
um 8,8 % über den Einnahmen und mussten durch eine entsprechende<br />
Kreditaufnahme finanziert werden. 2008 war fast ein ausgeglichener<br />
Haushalt erreicht worden. Dagegen blieb die Inflationsrate im<br />
Jahre 2009 eher moderat...“ (ZUKUNFTSRAT HAMBURG 2010b)<br />
Diskussion des<br />
Instruments<br />
Mit HEINZ hat der Zukunftsrat ein Indikatorenset geschaffen, das es erlaubt,<br />
den Stand einer nachhaltigen Entwicklung zu erfassen, zu bewerten<br />
und die Ergebnisse auch öffentlich zu kommunizieren.<br />
Besonders lobenswert ist es, dass der Zukunftsrat die Hintergründe des<br />
Indikatorensets transparent darlegt. So werden die zugrunde liegenden<br />
Einzeldaten veröffentlicht, Probleme der Datenerfassung oder Bewertung,<br />
Auslassungen und blinde Flecken des Instrumentariums werden<br />
offengelegt. Einige dieser Probleme sollen hier skizziert werden:<br />
Richtungssicherheit von Indikatoren: Will man einen Indikator zur<br />
Messung von Nachhaltigkeit verwenden, so ist es erforderlich, dass<br />
Veränderungen in der entsprechenden Größe Veränderungen in Hinsicht<br />
auf Nachhaltigkeit eindeutig abbilden. Besonders problematisch<br />
werden vom Zukunftsrat die wirtschaftlichen Indikatoren angesehen;<br />
hier wurde das Indikatorenset in seiner dritten Ausgabe (2006) noch<br />
einmal erheblich modifiziert. Ein Ziel ist es beispielsweise, die Leistungsfähigkeit<br />
von sozial- und umweltverträglichem Wirtschaften in<br />
Hamburg zu fördern. Der zuvor eingesetzte (und auch in der Nachhaltigkeitsstrategie<br />
der Bundesregierung verwendete) Indikator „Bruttoinlandsprodukt<br />
(BIP) je Erwerbstätigem“ wurde vom Zukunftsrat als<br />
nicht haltbar fallen gelassen, da das BIP auch durch nicht nachhaltige<br />
Entwicklungen wie Ressourcenverschwendung oder Rüstungsindustrie<br />
wächst. In der Konsequenz enthalten HEINZ 2006 und HEINZ 2010 keinen<br />
Indikator und auch folglich keine Zielwerte und Bewertungen für<br />
dieses Ziel. Das gleiche gilt für das Ziel, die Innovationsfähigkeit für eine<br />
nachhaltige Entwicklung zu stärken. Die bisherigen Indikatoren –<br />
die Zahl der Patentanmeldungen und der Anteil der Mittel für For-<br />
150
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
schung und Entwicklung am BIP – werden vom Zukunftsrat inzwischen<br />
ebenfalls als nicht richtungssicher eingestuft und wurden ersatzlos gestrichen<br />
(ZUKUNFTSRAT HAMBURG 2006, S. 27 und 2010).<br />
Status von Zielwerten: Mit den strategischen Zielen für 2050 und in<br />
den Zielwerten für 2020 setzt der Zukunftsrat bewusst hohe Maßstäbe,<br />
er geht z.B. beim Flächenverbrauch deutlich über die Nachhaltigkeitsziele<br />
der Bundesregierung hinaus. 31 Diese Zielwerte sind normative<br />
Setzungen; ähnlich wie für das Leitbild der Nachhaltigkeit gibt es hierfür<br />
keine „objektiven“ Begründungen. Die Vorgabe von Zielwerten ist<br />
dennoch für eine Bewertung der Situation bzw. der Entwicklung wesentlich,<br />
denn alleine ein positiver Trend gibt noch keinen Anlass zur<br />
Beruhigung, wenn der Zustand sehr weit vom Ziel entfernt und dessen<br />
Erreichen fraglich ist. (ZUKUNFTSRAT HAMBURG 2006).<br />
Systemgrenzen: Für jeden betrachteten Nachhaltigkeitsaspekt ist im<br />
Einzelfall zu klären, welcher Bezugsrahmen zur Formulierung von Zielen<br />
oder zur Bewertung verwendet werden soll. Bei dem Ziel, das Klima<br />
zu schützen, orientiert sich der Zukunftsrat an globalen Problemlagen –<br />
an der Zielvorstellung, dass langfristig jeder Mensch auf der Welt das<br />
gleiche „Emissionsrecht“ haben solle und dass dabei die globale bodennahe<br />
Mitteltemperatur maximal 2°C gegenüber dem vorindustriellen<br />
Niveau ansteigen dürfe. Der Zukunftsrat stellt daher für Hamburg folgende<br />
Zielwerte auf (maximale CO 2 -Emissionen pro Kopf und Jahr):<br />
6,5 t im Jahr 2020 und 1 t im Jahr 2050. Bei dem Ziel, die Armut zu bekämpfen,<br />
wäre das nicht angemessen. So ist z.B. der Schwellenwert der<br />
Weltbank für extreme Armut (1,00 US$ Einkommen pro Kopf und Tag)<br />
für Hamburg wenig hilfreich. Stattdessen wird der Anteil der Sozialleistungsempfänger<br />
an der Bevölkerung als Indikator verwendet.<br />
Die Datenerfassung für HEINZ wird aus Gründen des Aufwand durchweg<br />
auf das Land Hamburg beschränkt, auch wenn die Autoren einräumen,<br />
dass es für einige Indikatoren sinnvoller gewesen wäre, die<br />
gesamte Metropolregion einzubeziehen (ZUKUNFTSRAT HAMBURG<br />
2006, S.5).<br />
Wechselwirkungen zwischen Zielen: Nachhaltigkeit versteht der Zukunftsrat<br />
als „Gesamtbalance zwischen allen Teilzielen“ (ebd., S. 7).<br />
Dennoch gibt es Ziele, die zumindest in der kurzfristigen Perspektive in<br />
Konflikt zueinander stehen können. So erfordert eine gesunde Struktur<br />
der öffentlichen Haushalte, dass mit öffentlichen Mitteln möglichst<br />
31. In der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung wird gefordert, die<br />
Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr bis 2020 auf ¼ des Wertes der frühen<br />
90er Jahre (also auf 30 ha pro Tag) zu reduzieren. In HEINZ 2006 ist hingegen (für den<br />
Stadtstaat Hamburg) als Ziel festgeschrieben, ab sofort keinen neuen unversiegelten<br />
Boden für Siedlung und Verkehr zu verbrauchen.<br />
151
4 Lokale Agenda 21<br />
sparsam umgegangen wird; andererseits erfordert die Förderung von<br />
Bildung oder von Krippenplätzen, dass die Stadt Geld ausgibt. Im täglichen<br />
politischen Geschäft kommt es daher darauf an, solche öffentlichen<br />
Ausgaben zu identifizieren und zu reduzieren, die der<br />
Nachhaltigkeit nicht dienen bzw. ihr sogar zuwiderlaufen.<br />
Übertragbarkeit<br />
Implikationen für die<br />
<strong>BNE</strong><br />
Das Instrument – kommunale Nachhaltigkeitsindikatoren – ist grundsätzlich<br />
auf andere Kommunen übertragbar. Kleinere Kommunen können<br />
sicher nicht so viele Ressourcen in die Entwicklung eines eigenen<br />
Indikatorensets investieren als die Metropole Hamburg, aber das ist<br />
auch nicht unbedingt erforderlich, denn es liegen brauchbare – und oftmals<br />
auch individuell anpassbare – Indikatorensets für Kommunen vor<br />
(z.B. LUBW LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NA-<br />
TURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG 2009). Qualitäten des Hamburger<br />
Prozesses – so die diskursive Weiterentwicklung der Indikatoren oder<br />
die Information der Öffentlichkeit – sollten dabei mit übernommen werden.<br />
Wenn die <strong>BNE</strong> antritt, um Schlüsselthemen der Nachhaltigkeit zu vermitteln,<br />
Nachhaltigkeitsdefizite aufzuzeigen, Wertevorstellungen und<br />
Leitbilder zu entwickeln bzw. zu kommunizieren oder die Fähigkeit<br />
zum interdisziplinären Wissenserwerb und zu einem in die Zukunft gerichteten<br />
Denken zu vermitteln, dann bieten kommunale Nachhaltigkeitsindikatoren<br />
hervorragende Lernanlässe und thematische bzw. auch<br />
methodologische Grundlagen.<br />
4.1.2 Düsseldorf: Rahmenbedingungen für <strong>BNE</strong><br />
Düsseldorf ist die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Die prosperierende<br />
Großstadt hat knapp 590.000 Einwohner.<br />
Im Juni 1996 hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Düsseldorf die Erarbeitung<br />
einer Lokalen Agenda 21 für Düsseldorf beschlossen und die<br />
Charta von Aalborg unterzeichnet (LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF<br />
o.J. a).<br />
152
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
Für die Lokale Agenda 21 wurde folgende Struktur geschaffen (LAN-<br />
DESHAUPTSTADT DÜSSELDORF o.J. b):<br />
Struktur der Lokalen<br />
Agenda 21<br />
Abb. 7:<br />
Struktur der Lokalen Agenda 21 in der Landeshauptstadt Düsseldorf<br />
(LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF o.J. b)<br />
• Stadtrat und Verwaltung tragen die oberste Verantwortung<br />
für die Lokale Agenda 21. Die Stadtverwaltung soll nachhaltig<br />
handeln, z.B. beim Beschaffungswesen oder bei planerischen<br />
Aufgaben. Verschiedene Ämter der Stadt sind<br />
dafür zuständig, einzelne Agenda-Projekte umzusetzen bzw.<br />
die vier Fachforen zu betreuen. Schließlich ist eine städtische<br />
Mitarbeiterin – die beim Umweltamt angesiedelte<br />
Agenda-Koordinatorin – für die Gesamtkoordination der<br />
Lokalen Agenda 21 zuständig.<br />
• Eine Lenkungsgruppe beschließt Agenda-Projekte und<br />
entscheidet über die Verwendung von Haushaltsmitteln. Sie<br />
besteht aus Mitgliedern aller Fraktionen des Stadtrats, dem<br />
Umweltdezernenten sowie den Leitern von acht städtischen<br />
Ämtern. (ebd.)<br />
• Im Agenda Beirat tauschen sich die verschiedenen an der<br />
Lokalen Agenda 21 beteiligten Gruppen aus. Hier werden 8-<br />
10 x im Jahr Aktivitäten und Projekte beraten und aufeinander<br />
abgestimmt. Zum Beirat gehören die Sprecher der Fachforen,<br />
einzelne Vertreter der Netzwerke und ad-hoc-<br />
Gruppen sowie – ohne Stimmberechtigung – die Mitglieder<br />
der Lenkungsgruppe.<br />
• Des weiteren wurden vier Fachforen eingesetzt (Arbeit und<br />
Wirtschaft, Lebensraum Stadt, Ressourcenschonung sowie<br />
Lebensqualität / Lebensstile). Ihre Mitglieder sind Bürger<br />
und Vertreter von Gruppen, Institutionen und Firmen. In den<br />
Fachforen werden die Agenda Projekte entwickelt und (in<br />
153
4 Lokale Agenda 21<br />
Abstimmung mit der Lenkungsgruppe) umgesetzt, bzw. hier<br />
wird die Umsetzung durch Dritte organisiert. Die Fachforen<br />
realisieren Aktionen und betreiben Öffentlichkeitsarbeit.<br />
• Die Bürger der Stadt können in Fachforen mitwirken und<br />
sich in einzelnen Projekten engagieren, bzw. sie kommen<br />
mit vielen der Agenda-Projekte unmittelbar in Berührung<br />
und können dabei die nachhaltige Entwicklung ihrer Stadt<br />
mit befördern.<br />
In dieser Struktur sind bislang 39 Agenda-Projekte ins Leben gerufen<br />
worden, darunter der Firmenpreis für Düsseldorfer Hauptschulen, ein<br />
Second-Hand-Kaufhaus, drei Nord-Süd-Agenda-Partnerschaften, der<br />
(fair gehandelte) Düsseldorf Café, die SAGA Serviceagentur für Altbausanierung,<br />
Nachhaltigkeit im Sportverein sowie die partizipative<br />
Stadtplanung mit sogenannten Werkstattverfahren (LANDESHAUPT-<br />
STADT DÜSSELDORF o.J. c). Dass Düsseldorf im Jahr 2007 zur Bundeshauptstadt<br />
des fairen Handels gekürt wurde, ist u.a. mehreren<br />
erfolgreichen Agenda-Projekten zu verdanken (LANDESHAUPTSTADT<br />
DÜSSELDORF o.J. h).<br />
Die Liste der Projekte zeigt, in welchen Themenfeldern Politik und Verwaltung<br />
Handlungsspielräume für Partizipation der Bürger sehen bzw.<br />
in welchen nicht. So gibt es z.B. ein Agendaprojekt zum Ausbau des<br />
Radwegenetzes (LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF o.J. c), die Gesamtverkehrsplanung<br />
wird hingegen im Rahmen der Lokalen Agenda<br />
21 nicht verhandelt.<br />
Netzwerk Bildung für<br />
nachhaltige<br />
Entwicklung<br />
Das im Kapitel 3.4.1 vorgestellte Nachhaltigkeitsaudit ist auf der lokalen<br />
Ebene als Agenda-Projekt Nr. 16 verankert (ebd.), zudem war es in<br />
die <strong>BNE</strong>-Modellprogramme des Landes NRW sowie des Bundes eingebunden.<br />
Diese Verankerung auf drei Ebenen machte es möglich, dass<br />
das Düsseldorfer Netzwerk „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ gegründet<br />
werden konnte.<br />
Die wichtigsten Akteure in diesem Netzwerk sind ca. 20 Schulen, die<br />
Öko-bzw. Nachhaltigkeitsaudits durchgeführt haben bzw. sich anderweitig<br />
in der <strong>BNE</strong> engagieren. Sie informieren, beraten und motivieren<br />
sich gegenseitig auf den 4-5 Arbeitssitzungen, die pro Jahr durchgeführt<br />
werden. Sie nutzen das Netzwerk, um bilaterale Kooperationen anzubahnen<br />
oder gemeinsame Standpunkte zu entwickeln und diese gegenüber<br />
Politik und Verwaltung zu vertreten.<br />
Die Stadt Düsseldorf ist durch das Umweltamt, die Agenda-Koordinatorin<br />
und das Schulverwaltungsamt in dem Netzwerk vertreten. Das hat<br />
sich als sehr effizient erwiesen, weil die Schulen dadurch verlässliche<br />
154
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
Ansprechpartner haben, mit denen sie Aufgaben, Fragen und Probleme<br />
auf kurzem Wege klären können.<br />
Ferner arbeiten Unternehmen im Netzwerk mit, z.B. die Stadtwerke<br />
Düsseldorf bzw. die AWISTA GmbH (welche als Ver- bzw. Entsorger<br />
wichtige Partner der Schulen in Umweltfragen sind) oder Henkel<br />
KGaA, Vodafone AG und Xenotec Technik und Licht KG (welche selber<br />
Öko-/Nachhaltigkeits-Audits absolviert haben und daher Synergien<br />
mit den Schulen sehen). Besonders in den ersten Jahren der Arbeit haben<br />
diese Unternehmen den Schulen geholfen, die Logik des Umweltmanagements<br />
zu verstehen, schulinterne Managementsysteme<br />
aufzubauen und Einblicke in das betriebliche Umweltmanagement zu<br />
erhalten.<br />
Für die Koordination des Netzwerkes wurde seit 1999 ein Lehrer mit<br />
50% seiner Arbeitszeit eingesetzt; seinen Arbeitsplatz für diese Aufgaben<br />
hat er im Umweltamt. Der Koordinator leitet die Sitzungen und berät<br />
einzelne Schulen. Er bindet die vielfältigen Partner ein, vertritt die<br />
Interessen des Netzwerkes in der Kommune sowie auf Landes- und<br />
Bundesebene und trägt so dazu bei, dass die Schulen gute Rahmenbedingungen<br />
für ihre <strong>BNE</strong>-Aktivitäten haben. Die Landeshauptstadt hält<br />
diese Arbeit für so erfolgreich, dass sie nach Auslaufen der Modellprogramme<br />
„BLK 21“ bzw. „Transfer 21“ die Finanzierung des Netzwerkkoordinators<br />
übernommen hat.<br />
Staatliche Schulen in Deutschland werden in der Regel von den Kommunen<br />
bewirtschaftet; d.h. die Stadt Düsseldorf bezahlt z.B. die Wasser-,<br />
Energie- und Abfallrechnungen ihrer Schulen. Rein ökonomisch<br />
betrachtet, kann es daher den Schülern und Lehrern gleichgültig sein,<br />
wie viel Ressourcen ihre Schule verbraucht. Hier setzt das seit 1994 in<br />
Deutschland bekannte Modell Fifty/fifty 32 an: Kommune und Schule<br />
schließen eine Vereinbarung, nach der die Schule einen bestimmten<br />
Prozentsatz (z.B. 50%) des Geldes zur Verfügung gestellt bekommt,<br />
das sie durch intelligentes Verhalten der Schulgemeinschaft einspart.<br />
Die Schule kann dieses Geld nutzen, um die Lern- und Lebensqualität<br />
zu erhöhen, also z.B. die Schulbibliothek besser auszustatten, das<br />
Schulgelände zu begrünen bzw. dort ein Klettergerüst aufzustellen oder<br />
Umweltprojekte durchzuführen. Das kann die Motivation zu einem<br />
sparsamen Umgang mit Ressourcen erheblich erhöhen (LANGNER<br />
<strong>2011</strong>i).<br />
50:50<br />
50:50 Düsseldorf wurde 1996 vom städtischen Umweltamt zusammen<br />
mit dem Schulverwaltungsamt und dem Immobilienmanagement eingerichtet<br />
(LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF o.J. d). Das städtische Um-<br />
32. In vielen Kommunen heißt das Modell „Fifty/fifty“. In Düsseldorf wurde es 50:50<br />
genannt, da es hier bereits eine Obdachlosenzeitung mit dem Namen Fifty fifty gibt.<br />
155
4 Lokale Agenda 21<br />
weltamt unterstützt Schulen, indem es Messgeräte bzw. Arbeitskoffer<br />
für den Physikunterricht verleiht, Hausmeister fortbildet oder eine Mitarbeiterin<br />
zu Vorträgen in die Schulen entsendet.<br />
Ca. 50 Schulen sind bei 50:50 Düsseldorf registriert (LANDESHAUPT-<br />
STADT DÜSSELDORF o.J. e). Sie haben innerhalb von 10 Jahren zusammen<br />
1,2 Mio. € eingespart (LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF o.J. i).<br />
Daneben beteiligen sich auch Kindertagesstätten an 50:50.<br />
Kommunale<br />
Beschaffung<br />
Eine-Welt-Tage<br />
Klimaschutz in<br />
Schulen<br />
Auch um die Beschaffung von Material oder die Bewirtschaftung der<br />
Freiflächen kümmern sich in Deutschland meistens nicht die Schulen<br />
selber sondern die Kommunen. Die in diesem Zusammenhang für<br />
Schulen relevante Papierbeschaffung wurde bereits im Kap. 3.4.1 thematisiert.<br />
Die jedes Jahr im Herbst stattfindenden Eine-Welt-Tage in Düsseldorf<br />
sind ein ganzes Bündel an Kultur-, Informations- und Bildungsangeboten<br />
für jedermann mit weit über 100 Veranstaltungen. Die Landeshauptstadt<br />
unterstützt die Arbeit des Trägers – des Eine-Welt-Forums – und<br />
der angeschlossenen Gruppen (LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF o.J.<br />
f).<br />
Aufgrund eines Ratsbeschlusses von 2007 erstellte die Landeshauptstadt<br />
Düsseldorf ein Klimaschutzkonzept. Unter anderem angeregt<br />
durch 50:50, sind einige Schulen schon seit Jahren in diesem Themenfeld<br />
aktiv; um diese Ansätze zu verbreiten, gab die LANDESHAUPT-<br />
STADT DÜSSELDORF (2008) die Broschüre „Klassenziel Klimaschutz“<br />
heraus.<br />
2008-2009 führte das Junge Schauspielhaus Düsseldorf das Theaterstück<br />
zum Klimawandel "Was macht der Eisbär im Kühlschrank?" auf.<br />
Das Umweltamt stellte den Schulen begleitend ein umfangreiches Paket<br />
von Unterrichtsmaterialien und weiteren Unterstützungsangeboten zum<br />
Thema Klimaschutz zur Verfügung. (DÜSSELDORFER NETZWERK BIL-<br />
DUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 2008)<br />
Für den 13.-24. 9. 2010 organisierte das Umweltamt die „Düsseldorfer<br />
Klimawochen für Schulen“. Die Schulen konnten dabei 25 verschiedene<br />
Bildungsangebote kostenlos buchen, es wurden Kinofilme zum Klimaschutz<br />
gezeigt, kostenlose Lehrmaterialien bereitgestellt und ein<br />
kleines Förderprogramm für selbst organisierte Klimaprojekte aufgelegt.<br />
(UMWELTAMT DER LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF 2010)<br />
Kommunikation /<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Die Landeshauptstadt Düsseldorf verbreitet selber Informationen zur<br />
Lokalen Agenda 21, bzw. sie unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit zur<br />
<strong>BNE</strong> personell und finanziell.<br />
156
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
Dem Lokale Agenda 21-Prozess sind die Website http://www.duesseldorf.de/agenda21/index.shtml<br />
sowie eine zweimal im Jahr in 15.000<br />
Exemplaren erscheinende kostenlose Zeitschrift gewidmet. Hier wird<br />
regelmäßig auch über die <strong>BNE</strong>-Aktivitäten von Schulen berichtet. Das<br />
50:50-Programm sowie das Düsseldorfer Netzwerk „Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung“ haben zusätzlich eigene Online-Auftritte.<br />
Aus städtischen Mitteln wurden schulische Umwelterklärungen bzw.<br />
Nachhaltigkeitsberichte finanziert.<br />
Die Stadtverwaltung versteht solche Aktivitäten einerseits als Unterstützung<br />
der Lokalen Agenda 21 bzw. der <strong>BNE</strong> in den Schulen, andererseits<br />
aber auch als Teil des Stadtmarketings – die aktive und<br />
erfolgreiche Pressearbeit der beteiligten Schulen oder die positive nationale<br />
und internationale Resonanz auf das Online-Portal des Netzwerks<br />
haben erheblich mit dazu beigetragen, den schulischen <strong>BNE</strong>-<br />
Aktivitäten einen breiten Rückhalt in Politik und Verwaltung zu geben.<br />
Verbindungen zwischen Stadtmarketing und <strong>BNE</strong> können auch bei der<br />
Entente Florale gefunden werden. Die Stadt Düsseldorf hat 2007 den<br />
Bundeswettbewerb grüner Städte gewonnen (LANDESHAUPTSTADT<br />
DÜSSELDORF o.J. g). Im Rahmen der Bewerbung hat die Stadt mit großem<br />
(auch finanziellen) Engagement daran gearbeitet, das städtische<br />
Grün zu pflegen, zu vermehren und ansprechend zu präsentieren. Im<br />
Zuge dieser Aktivitäten wurden auch einige Schulgelände verbessert.<br />
So engagiert sich z.B. die Hulda-Pankok-Gesamtschule sehr für ihr<br />
Schulgelände; hier gibt es einen Schülergarten (mit Garten-AG), Obstbäume,<br />
viele grüne Rückzugsräume, die sich positiv (entspannend) auf<br />
das Verhalten der Schüler in den Pausen auswirken sowie ein sehr sehenswertes<br />
zwei Stockwerke großes Wandgemälde zur Eine-Welt-Thematik,<br />
das Schüler unter externer fachlicher Anleitung selbst geschaffen<br />
haben. Die Schule hat im April 2007 an einem Samstag einen Arbeitseinsatz<br />
zur Pflege des Schulgeländes veranstaltet, zu dem 300 Menschen<br />
(Schüler, Eltern, Lehrer) kamen. Im Rahmen der Entente Florale<br />
hat die Stadt Düsseldorf gleichzeitig Erd-, Pflanz- und Bauarbeiten auf<br />
dem Gelände der Gesamtschule durchführen lassen und somit den<br />
Grundstock dafür gelegt, dass ein weiteres großes Teilstück des Schulgeländes<br />
belebt werden kann. (HULDA-PANKOK-GESAMTSCHULE <strong>2011</strong>)<br />
Grenzen werden dem Engagement der Schulen durch die Schulpolitik<br />
gesetzt. Die Schulen stehen – wie auch bundesweit – unter dem Druck,<br />
sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Anforderungen wie die<br />
Qualitätsanalyse haben für die Schulen verständlicherweise eine höhere<br />
Priorität als (scheinbar) zusätzliche Nachhaltigkeitsaktivitäten; allerdings<br />
berichten Schulen, die bereits ein Nachhaltigkeitsaudit absolviert<br />
haben, dass sie dadurch auf die Qualitätsanalyse gut vorbereitet waren.<br />
Entente Florale<br />
Grenzen<br />
157
4 Lokale Agenda 21<br />
(DÜSSELDORFER NETZWERK BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICK-<br />
LUNG)<br />
Schwierig wird es auch, wenn Schulen den ihnen zugewiesenen Rahmen<br />
der Bildung und Partizipation überschreiten. Bereits 1997 hatten<br />
Schüler und Lehrer eines Berufskollegs die Situation „ihrer“ Straßenbahnhaltestelle,<br />
die zu Stoßzeiten sehr stark frequentiert wird, als unbefriedigend<br />
und gefährlich kritisiert und öffentlich Abhilfe gefordert.<br />
Diese Forderung wurde in den folgenden Jahren mehrfach wiederholt,<br />
zudem erarbeitete die Schule konkrete Verbesserungsvorschläge.<br />
(MAX-WEBER BERUFSKOLLEG UND WALTER-EUCKEN-BERUFSKOLLEG<br />
2001 und 2006) Erst Ende 2009 wurde die Haltestelle umgebaut, immerhin<br />
wurden dabei die Kritikpunkte der Schule teilweise berücksichtigt<br />
(DÜSSELDORFER NETZWERK BILDUNG FÜR NACHHALTIGE<br />
ENTWICKLUNG 2009).<br />
Übertragbarkeit<br />
Implikationen für die<br />
<strong>BNE</strong><br />
In der Gesamtheit aller Faktoren haben Schulen in Düsseldorf außerordentlich<br />
positive Rahmenbedingungen für die <strong>BNE</strong>. Das ist zum Teil<br />
dem glücklichen Zusammentreffen der Modellprogramme „BLK 21“ /<br />
„Transfer 21“ mit einer wirtschaftlich potenten Großstadt zu verdanken<br />
– diese Faktoren sind auf viele andere Städte und Gemeinden nicht<br />
übertragbar. Das tragende Prinzip, dass Schulen und Verwaltung wertschätzend<br />
und konstruktiv zusammenarbeiten, ist jedoch nicht an Modellprogramme<br />
oder die Kassenlage gebunden. Lokale bzw. regionale<br />
Netzwerke der Umweltbildung bzw. <strong>BNE</strong> gibt es auch in anderen Städten,<br />
so z.B. in Rostock oder Stralsund. Die Kampagne Fifty/fifty kann<br />
von jedem Schulträger angeboten werden. Synergien zwischen <strong>BNE</strong><br />
und Lokaler Agenda 21 können in vielen Kommunen gesucht und gefunden<br />
werden.<br />
Die Förderung der <strong>BNE</strong> ist erklärtes Ziel der hier vorgestellten Aktivitäten.<br />
Diese Aktivitäten, wie auch das Nachhaltigkeitsaudit als Lernarrangement<br />
der <strong>BNE</strong> und die hier entwickelten Materialien können auch<br />
anderenorts als Anregung dienen.<br />
4.1.3 Stralsund: Kommunaler Klimaschutz als Lernfeld der<br />
<strong>BNE</strong><br />
Die Hansestadt Stralsund liegt im Norden von Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Die Stadt hat ca. 58.000 Einwohner; die Einwohnerzahl hat sich<br />
von 1990 bis 2005 um gut 20% verringert und sich dann auf dem heutigen<br />
Niveau stabilisiert.<br />
Mandat<br />
Im Jahr 2007 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund, dass<br />
die Stadtverwaltung ein Klimaschutzkonzept aufstellen solle. Nach internen<br />
Planungen zum Vorgehen berief der Oberbürgermeister im März<br />
158
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
2009 den Klimarat der Hansestadt Stralsund ein. Dieser soll Politik und<br />
Verwaltung beraten und den Klimaschutzprozess begleiten. (HANSE-<br />
STADT STRALSUND 2009a)<br />
Die Stadtverwaltung bewarb sich um Fördermittel des Bundes 33 . Nach<br />
Eintreffen der Förderzusage konnte eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE)<br />
aus einem Ingenieurbüro 34 , einer wissenschaftlichen Einrichtung 35 und<br />
einem Umweltverein 36 mit der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes<br />
beauftragt werden. Dieser Auftrag schloss die Einbeziehung des Klimarates<br />
in die Konzepterarbeitung ausdrücklich mit ein.<br />
Die ARGE hat das Klimaschutzkonzept im Herbst 2010 an die Hansestadt<br />
übergeben. (HANSESTADT STRALSUND 2010) Die Bürgerschaft hat<br />
das Konzept im März <strong>2011</strong> mit großer Mehrheit angenommen und damit<br />
den Weg für die Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen<br />
freigemacht.<br />
Mit der Einberufung des Klimarats wurden Akteure aus verschiedenen<br />
Bereichen der Gesellschaft in den Klimaschutzprozess eingebunden,<br />
darunter Unternehmen (wichtige Energieverbraucher bzw. Energieerzeuger),<br />
Bildung und Forschung sowie Stadtverwaltung.<br />
Partizipation<br />
Der Klimarat hat in den ersten zwei Jahren seines Bestehens dreimal getagt.<br />
Er hat dabei grundlegende Fragen zum Vorgehen erörtert bzw. die<br />
Energie- und CO 2 -Bilanz sowie die im Konzept vorgeschlagenen Maßnahmen<br />
als Zwischenergebnisse zur Kenntnis genommen.<br />
Die meiste Arbeit wurde bzw. wird in den drei Arbeitskreisen des Klimarats<br />
geleistet (ebd. S. 14-17):<br />
• Im Arbeitskreis Energie (AKE) wurde die Energie- und<br />
CO 2 -Bilanz aufgestellt; hier wurde das Vorgehen abgestimmt,<br />
und die Mitglieder haben aus ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich<br />
Daten bereitgestellt. Zudem wurden im<br />
AKE Maßnahmen für den Sektor Energie und Gebäude<br />
erarbeitet und Potenziale zur Reduzierung von Energieverbrauch<br />
und CO 2 -Emissionen analysiert.<br />
• Der Arbeitskreis Verkehr (AKV) hat den Verkehrsakteuren<br />
konkrete Handlungsmöglichkeiten in Handlungsfeldern<br />
33. Siehe http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/de/kommunen<br />
34. UmweltPlan GmbH Stralsund, Projektleitung und zuständig für den Bereich Verkehr<br />
35. Fachhochschule Stralsund, zuständig für die Energie- und CO 2 -Bilanz sowie den Bereich<br />
Energie<br />
36. Umweltbüro Nord e.V., zuständig für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit<br />
159
4 Lokale Agenda 21<br />
wie der kommunalen Planung, dem motorisierten Individualverkehr,<br />
dem öffentlichen Personennahverkehr und dem<br />
Fußgänger- sowie Radverkehr aufgezeigt. Hier wurden<br />
Zuarbeiten zur Energie- und CO 2 -Bilanz geleistet und Maßnahmen<br />
für den Verkehrssektor erarbeitet.<br />
• Der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit (AKÖ) 37 hat konzeptionell<br />
und operativ gearbeitet, d.h. auch hier wurden<br />
Maßnahmen für das Klimaschutzkonzept erarbeitet, zudem<br />
hat der AKÖ mit ersten Aktionen öffentlich für den Klimaschutz<br />
geworben.<br />
Die Ergebnisse der Arbeitskreise sind unmittelbar in das Klimaschutzkonzept<br />
eingeflossen.<br />
Die Arbeitskreise rekrutieren sich einerseits aus dem Klimarat – jedes<br />
Klimaratsmitglied ist in der Regel in einem Arbeitskreis aktiv. Zudem<br />
arbeiten hier interessierte Bürger oder Vertreter weiterer Organisationen<br />
mit. Schließlich haben sich mehrere Studenten der Fachhochschule<br />
Stralsund im Rahmen von Fach- oder Diplomarbeiten am Klimaschutzkonzept<br />
beteiligt. Somit waren an der Erstellung des Konzepts insgesamt<br />
ca. 40 Personen einbezogen, die über 20 Organisationen<br />
repräsentieren.<br />
Energie- und CO 2 -<br />
Bilanz<br />
Als erstes Zwischenergebnis wurde von der FH Stralsund im Frühjahr<br />
2010 die Energie- und CO 2 -Bilanz vorgelegt (ebd., S. 31-42). Die Bilanz<br />
wurde nach der Methodik des Klimabündnis erstellt. Dabei wurde<br />
nach dem „Käseglockenprinzip“ vorgegangen, d.h. es wurden die dem<br />
Stadtgebiet zuzurechnenden klimarelevanten Sachverhalte erfasst 38 .<br />
Zudem wurde das LCA-Prinzip (Life Cycle Assessment) angewendet,<br />
d.h. die energiebedingten CO 2 -Emissionen werden „von der Wiege bis<br />
zur Bahre“ ermittelt 39 . Zur Bilanzierung wurde die Software EcoRegio<br />
verwendet.<br />
Auf dieser Grundlage wurde ermittelt, dass die Hansestadt Stralsund im<br />
Jahr 2007 ca. 381.000 t CO 2 erzeugt hat, das sind 6,56 t pro Kopf und<br />
Jahr.<br />
37. Der Arbeitskreis bzw. das Arbeitspaket bei der Konzepterstellung wurden<br />
„Öffentlichkeitsarbeit“ benannt, das schließt aber Bildung grundsätzlich mit ein.<br />
38. Das Bilanzgebiet schließt ein verwaltungsrechtlich nicht zu Stralsund gehörendes aber für<br />
die Stralsunder wichtiges Einkaufgebiet mit ein. Das „Käseglockenprinzip“ lässt sich am<br />
besten anhand eines Urlaubers illustrieren, der mit dem Auto, vom Festland kommend,<br />
nach Rügen will und dabei das Stadtgebiet durchquert: Die CO 2 -Emissionen aus der<br />
durch Stralsund führenden Teilstrecke werden in diesem Falle mit bilanziert.<br />
39. Auch dazu ein Beispiel: Für jede Kilowattstunde Elektroenergie, die in Stralsund<br />
„verbraucht“ wird, werden die anteiligen CO 2 -Emissionen mit bilanziert – auch wenn die<br />
Elektroenergie ganz überwiegend nicht in Stralsund „produziert“ wurde.<br />
160
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
Abb. 8: CO 2 -Emissionen nach Sektoren. Hansestadt Stralsund, 2007<br />
(Eigene Darstellung nach: HANSESTADT STRALSUND 2010)<br />
Die Bilanz ist fortschreibbar, sie eignet sich daher auch als Monitoring-<br />
Instrument für den weiteren Klimaschutzprozess.<br />
Mit dem Konzept wird das Ziel aufgestellt, „die CO 2 -Emissionen im<br />
Stadtgebiet alle fünf Jahre um 10 % beginnend 2010 zu verringern.“<br />
(ebd., S. 71) Dieses Ziel orientiert sich an dem Ziel des Klimabündnis,<br />
und mit dem Beitritt zum Klimabündnis hat die Stadt dieses Ziel bereits<br />
2009 bekräftigt (HANSESTADT STRALSUND 2009b).<br />
Das Klimaschutzkonzept beinhaltet insgesamt 36 Maßnahmen, mit denen<br />
das Klimaschutzziel erreicht werden soll (HANSESTADT STRAL-<br />
SUND 2010, S. 72-148). Zur Auswahl dieser Maßnahmen wurden<br />
Klimaschutzkonzepte anderer Kommunen gesichtet, die dort enthaltenen<br />
Maßnahmen wurden auf ihre Übertragbarkeit nach Stralsund hinterfragt,<br />
und die am besten geeigneten Maßnahmen wurden dann für die<br />
Stralsunder Verhältnisse detaillierter ausgearbeitet. Im Ergebnis werden<br />
für jede der 36 Maßnahmen Ziele genannt, das Energieverbrauchsund<br />
CO 2 -Minderungspotenzial abgeschätzt, wirtschaftliche Aspekte<br />
beleuchtet und Akteure sowie Handlungsschritte benannt. Dabei werden<br />
folgende Sektoren berücksichtigt:<br />
Klimaschutzziel<br />
Maßnahmen<br />
• Energie und Gebäude: 15 Maßnahmen, z.B.: Sanierung<br />
von Gebäudehüllen, Heizungsanlagenmodernisierung,<br />
161
4 Lokale Agenda 21<br />
Solarkollektoren und Photovoltaik sowie Ausbau der Fernwärme.<br />
• Verkehr: 8 Maßnahmen, z.B. fahrradfreundliche Stadt,<br />
Attraktivitätssteigerung des Busverkehrs, Ertüchtigung der<br />
Park+Ride-Parkplätze und Integration von Nahverkehrsinformationen<br />
in die Tourismusinformation.<br />
• Öffentlichkeitsarbeit: 13 Maßnahmen, z.B.: Klimaschutz-<br />
Website, Energiesparen in Schulen, Ökostrom für kommunale<br />
Liegenschaften, Solarflächenbörse. Zudem wurde hier<br />
auch die Maßnahme eines Klimaschutzmanagers eingeordnet.<br />
Szenarien und<br />
Modellrechnungen<br />
Die Fachhochschute Stralsund hat für den Zeithorizont 2050 fünf umweltpolitische<br />
Szenarien erstellt und dazu, basierend auf der Energieund<br />
CO 2 -Bilanz, Modellrechnungen durchgeführt. Damit konnte gezeigt<br />
werden, dass eine sehr weitgehende Reduzierung der CO 2 -Emissionen<br />
in Stralsund möglich ist. Es wurde aber auch deutlich, dass dafür<br />
nicht nur die im Klimaschutzkonzept vorgeschlagenen Maßnahmen<br />
umgesetzt, sondern auch Stadt-extern günstige Rahmenbedingungen<br />
geschaffen werden müssen.<br />
162
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
Abb. 9:<br />
Verringerung der CO 2 -Emissionen der Hansestadt Stralsund. Szenarienvergleich<br />
– Zeithorizont: 2050 (Eigene Darstellung nach: HANSE-<br />
STADT STRALSUND 2010)<br />
Szenario 1:<br />
Wärme: 50 % Heizbedarfsenkung; 10 % Effizienzsteigerung in allen<br />
Bereichen; solare Warmwasser-Bereitung; Mini-BHKW mit Biogas<br />
betrieben; Wärmepumpen mit Strom aus Mini-BHKW betrieben;<br />
Fernwärme aus Bio-HKW und Erdgaskesseln gespeist.<br />
Strom: Installation von Photovoltaikanlagen (14 MW) und Windkraftanlagen<br />
(2 MW); Reststrombedarf durch Strom-Mix von 2007<br />
gedeckt<br />
Verkehr: 25 % flüssige Biokraftstoffe; 50 % Strom (Mix 2007); 25 %<br />
Erdgas<br />
Szenario 2: Annahmen wie in Szenario 1, aber zusätzlich 100 % Bioerdgas<br />
im Wärmebereich<br />
Szenario 3: Annahmen wie in Szenario 2, aber zusätzlich 100 %<br />
CO 2 -neutrale Energiequellen im Strombereich<br />
Szenario 4: Annahmen wie in Szenario 3, aber zusätzlich 100 % Bioerdgas<br />
im Verkehrsbereich<br />
Szenario 5: Annahmen wie in Szenario 4, aber zusätzlich 100 %<br />
CO 2 -neutrale Energiequellen im Verkehrsbereich<br />
163
4 Lokale Agenda 21<br />
Konzeptionelle und<br />
operative<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Maßnahmen zur<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
im<br />
Klimaschutzkonzept<br />
Öffentlichkeitsarbeit wurde auf zwei unterschiedlichen Ebenen realisiert:<br />
• Auf der konzeptionellen Ebene wurden – wie auch für die<br />
anderen Sektoren – Maßnahmen für das Klimaschutzkonzept<br />
erarbeitet, die künftig umgesetzt werden sollen.<br />
• Zusätzlich wurde jedoch auch operativ gearbeitet, d.h.<br />
bereits im laufenden Klimaschutzprozess wurde die Öffentlichkeit<br />
informiert.<br />
Ca. 50% der CO 2 -Emissionen der Stadtverwaltung (und somit – in ganz<br />
grober Näherung – auch 50% der städtischen Energiekosten) entfallen<br />
auf Schulen. Daher wurde das Energiesparen in Schulen als Maßnahme<br />
in das Konzept aufgenommen. Andererseits haben die Schulen nur<br />
einen Anteil von ca. 1% an den insgesamt in Stralsund erzeugten CO 2 -<br />
Emissionen, d.h. ca. 99% werden an anderer Stelle erzeugt. Daher sollen<br />
mit anderen Maßnahmen auch vielfältige weitere Zielgruppen angesprochen<br />
werden, so z.B. Unternehmen, Hauseigentümer/Bauherren,<br />
private Haushalte und Hausmeister kommunaler Liegenschaften.<br />
Im Klimaschutzkonzept wird vorgeschlagen, auf der städtischen Website<br />
eine Klimaschutzwebsite einzurichten. Dabei ist zu berücksichtigen,<br />
dass das Internet eher von den gesellschaftlichen Leitmilieus und<br />
den hedonistischen Milieus genutzt wird (vgl. weiter unten den Exkurs:<br />
Die Lernenden im Fokus). Auch wenn diese Website eingerichtet ist,<br />
müssen daher weiterhin andere Medien bzw. Aktionsformate genutzt<br />
werden, so lassen sich z.B. traditionelle Milieus besser über lokale<br />
Printmedien wie Tageszeitungen oder (kommunale bzw. kirchliche)<br />
Gemeindeblätter erreichen (vgl. WIPPERMANN et. al 2009).<br />
Auch wenn die Maßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit überwiegend<br />
auf die Aufklärung der Bevölkerung zielen, ist doch die Schaffung<br />
von Ermöglichungsstrukturen mit gedacht. Mit der<br />
Solarflächenbörse soll eine Voraussetzung dafür geschaffen werden,<br />
dass Bürger, die über keine eigenen Flächen verfügen, dennoch (einzeln<br />
oder z.B. als Bürgersolarverein) in die Solarenergie investieren können.<br />
Und unter dem Titel „Energiesparen an Schulen“ versammeln sich<br />
mehrere Teilmaßnahmen, die darauf zielen, dass Schulen – über die reine<br />
Bildung hinaus – starke Akteure im Klimaschutz werden können.<br />
Operative<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Bereits seit Gründung des Klimarats hat der AKÖ öffentlich für den<br />
Klimaschutz geworben. Da der AKÖ ganz überwiegend ehrenamtlich<br />
und ohne eigenes Budget arbeitet, war das Spektrum der Handlungsmöglichkeiten<br />
eingeschränkt. Dennoch konnten u.a. folgende Aktivitäten<br />
realisiert werden (vgl. auch LANGNER <strong>2011</strong>j):<br />
164
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
Der alljährliche Stralsunder Umwelt- und Gesundheitsmarkt wurde<br />
2009 unter das Motto „Prima Klima für Stralsund!“ gestellt. Gemeinsam<br />
mit vielen weiteren Akteuren konnte ein vielfältiges Informationsangebot<br />
zu Themen wie Energieeffizienz im Haushalt, energiesparende<br />
Gebäude, Nutzung erneuerbarer Energien aufgestellt werden. Ca. 1000<br />
Besucher wurden erreicht.<br />
Beim Umwelt- und Gesundheitsmarkt 2010 präsentierte der AKÖ die<br />
Begehbare CO 2 -Bilanz, welche die wichtigsten Ergebnisse der Energie-<br />
und CO 2 -Bilanz als dreidimensionale Installation darbietet.<br />
Werner wurden Aktionen zum Tag der Erneuerbaren Energien 40 2010<br />
und <strong>2011</strong> organisiert, Presseinformationen herausgegeben und ein Bürgerinformationsblatt<br />
zum Klimaschutzkonzept erstellt.<br />
Diese Aktivitäten zielten darauf, möglichst viele Bürger über den Klimaschutzprozess<br />
zu informieren, für diesen Prozess zu werben und informelle<br />
Lernprozesse anzustoßen.<br />
Exkurs: <strong>BNE</strong> und informelles Lernen<br />
„Informelles Lernen“ kann unter verschiedenen Blickwinkeln definiert<br />
werden. Nimmt man die Organisationsform des Lernens als Ansatzpunkt,<br />
so sind „die Lernprozesse … informell, die ihren Platz<br />
außerhalb formaler Institutionen oder nonformaler Kursangebote haben<br />
und auch nicht von dieser Seite finanziert werden.“ (OVERWIEN<br />
2009, S. 24) Eine differenziertere Definition stammt von LIVINGSTO-<br />
NE (1999, S. 68f). Demnach ist informelles Lernen „...jede mit dem<br />
Streben nach Erkenntnissen, Wissen oder Fähigkeiten verbundene<br />
Aktivität außerhalb der Lehrangebote von Einrichtungen, Bildungsmaßnahmen,<br />
Lehrgänge oder Workshops“. Dabei legt der Lernende<br />
(einzeln oder gemeinsam mit anderen) die Ziele, Inhalte, Mittel etc.<br />
selber fest. Informelles Lernen ist mehr als die bloße Alltagswahrnehmung;<br />
es beginnt für Livingstone erst, wenn „die Lernenden<br />
selbst ihre Aktivitäten bewusst als signifikanten Wissenserwerb einstufen.“<br />
(ebd.)<br />
40. Vgl. www.energietag.de<br />
165
4 Lokale Agenda 21<br />
Zum Umfang des informellen Lernens (zu seinem Anteil an den<br />
Lernprozessen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens absolviert)<br />
gibt es unterschiedliche Angaben, was angesichts der begrifflichen<br />
Unschärfe nicht verwundern kann. FAURE (1973), der z.B. auch Bildungsmöglichkeiten<br />
wie Bibliotheken, Museen, Radio und Fernsehen<br />
mit einbezog, kam zu einem Anteil von 70%. „Tendenziell“ wird<br />
der Umfang des informellen Lernens in nordamerikanischen Untersuchungen<br />
zwischen 70% und 80% angegeben, in deutschen Studien<br />
liegen die Angaben teilweise deutlich darunter. (OVERWIEN 2009, S.<br />
36-37)<br />
Die Frage, inwieweit informelles Lernen zur <strong>BNE</strong> beitragen kann, ist<br />
wissenschaftlich noch kaum untersucht. GÖLL (2009) identifiziert informelle<br />
Lernprozesse in der Lokalen Agenda 21. RODEMANN (2009)<br />
hat Hinweise darauf gefunden, dass ein ehrenamtliches Engagement<br />
bei Greenpeace die Gestaltungskompetenz fördert. DÜX/SASS (2009)<br />
beschreiben den Kompetenzerwerb Jugendlicher durch freiwilliges<br />
Engagement in verschiedenen Kontexten.<br />
Weiter geht die Position von BRODOWSKI (2009, S. 70-71), die sich<br />
letztlich damit auf den Punkt bringen lässt, dass <strong>BNE</strong> ohne informelles<br />
Lernen undenkbar ist. Er betont, in der <strong>BNE</strong> gehe es weniger darum,<br />
fertige Nachhaltigkeits-Lösungen zu lehren, sondern „in erster<br />
Linie um die Veränderung mentaler Modelle und Aufmerksamkeitsregeln<br />
sowie um das Erlernen von inter- und transdisziplinären Lösungsstrategien<br />
aller gesellschaftlicher Akteure (Stakeholder).“<br />
Solches Lernen endet und manifestiert sich nicht in Bildungszertifikaten,<br />
sondern in den „tatsächlich ausgeübten Handlungs-, Kommunikations-<br />
und Lernmustern der Akteure“. Dabei muss geklärt<br />
werden, „welche Lernprozesse und Bildungsformen zu welchen Ergebnissen<br />
führen“ und wie formelles und informelles Lernen sinnvoll<br />
aufeinander bezogen werden können. Wenn informelle Lernprozesse<br />
im Sinne der <strong>BNE</strong> genutzt werden sollen, müssen dafür geeignete<br />
„Rahmenbedingungen und Implementierungsmöglichkeiten“ bereitgestellt<br />
werden, und es ist „Offenheit für strukturelle Veränderungen<br />
und Formen, diese gemeinsam zu vollziehen“, nötig.<br />
Übertragbarkeit<br />
Der kommunale Klimaschutz hat bereits jetzt eine hohe Dynamik, u.a.<br />
aufgrund der Stimulation durch Akteure wie das Klima-Bündnis und<br />
aufgrund der finanziellen Förderung durch die Bundesregierung. Für eine<br />
Übertragbarkeit in andere Kommunen bestehen daher gute Voraussetzungen,<br />
viele deutsche Kommunen sind bereits weiter als Stralsund,<br />
und in Stralsund wurde Know-How aus anderen kommunalen Klimaschutzprozessen<br />
gezielt genutzt.<br />
166
4.1 Einblicke in Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
Die im Klimaschutzkonzept der Hansestadt Stralsund vorgeschlagenen<br />
Maßnahmen sind derzeit (Sommer <strong>2011</strong>) noch nicht umgesetzt, und zu<br />
den bisherigen Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit wurde aus Gründen<br />
mangelnder Ressourcen keinerlei Wirkungsforschung durchgeführt.<br />
Die Hansestadt Stralsund kann daher hier „nur“ als Beispiel dienen, an<br />
dem generelle Verbindungen zwischen kommunalem Klimaschutz und<br />
<strong>BNE</strong> herausgearbeitet werden.<br />
Die Hansestadt Stralsund kann ferner als Beispiel dafür dienen, wie<br />
Vorgehensweisen aus der Lokalen Agenda 21 (Indikatoren aufstellen,<br />
Ist-Stand ermitteln, Ziele und Pläne formulieren, Partizipation, Einrichtung<br />
von Gremien...) im kommunalen Klimaschutz weiter genutzt werden.<br />
Die <strong>BNE</strong> sollte „Schlüsselthemen“ einer nachhaltigen Entwicklung<br />
aufgreifen (vgl. Kap. 3.3). Der Klimawandel ist zweifelsohne ein solches<br />
Schlüsselthema – aber er ist in seiner Komplexität und in seiner<br />
räumlichen bzw. zeitlichen Dimension (global und über Jahrzehnte) nur<br />
schwer vermittelbar. Kommunale Klimaschutzprozesse bieten die<br />
Chance, das Thema auf menschliche Dimensionen „herunter zu brechen“.<br />
Das sollte aber auch nicht zu einer Simplifizierung führen – wie<br />
also können Merkmale des Klimawandels wie Zeitverzögerung und<br />
Selbstverstärkung (BROT FÜR DIE WELT/EED/BUND 2008, S.37-41),<br />
die diesen so schwer beherrschbar machen, in der <strong>BNE</strong> angemessen thematisiert<br />
werden?<br />
Implikationen für die<br />
<strong>BNE</strong><br />
Kommunale Klimaschutzprozesse bieten die Chance, dass Bildungsakteure<br />
und Lernende eine aktive Rolle als Mitgestalter einer klimafreundlichen<br />
Gesellschaft einnehmen, anstatt nur einer drohenden<br />
Gefahr hilflos ausgesetzt zu sein. Sie bieten die Chance, dass Optionen<br />
für umweltfreundliches / verantwortliches Handeln geschaffen werden,<br />
anstatt die Bevölkerung nur von oben herab zu belehren. Sie bieten ferner<br />
die Chance, am konkreten Beispiel zu vermitteln, wie Wissen um eine<br />
nachhaltige Entwicklung geschaffen wird.<br />
Der Klimaschutz als umweltpolitischer Kontext bietet langfristige Entwicklungsziele.<br />
Das ist eine Chance für eine auf Gestaltung der Zukunft<br />
ausgerichtete Pädagogik. Es ist aber auch eine Herausforderung, und<br />
Lernarrangements bzw. Bildungsprojekte, die „vom Ende her” denken<br />
und z.B. das Leben in einer Gesellschaft thematisieren, in der künftig<br />
jeder Mensch weltweit nur noch 1 bis 2,5 t CO 2 pro Jahr produziert 41 –<br />
oder die die für dieses Leben notwendigen Werte suchen, Kompetenzen<br />
vermitteln etc. – sind bislang Mangelware.<br />
41. Bei HEINZ 2010 wird der Zielwert 1 t pro Kopf und Jahr genannt (ZUKUNFTSRAT<br />
HAMBURG 2010a), die im Klima-Bündnis vereinten Kommunen streben einen Zielwert<br />
von 2,5 t pro Kopf und Jahr an (KLIMA-BÜNDNIS <strong>2011</strong>)<br />
167
4 Lokale Agenda 21<br />
Auch wenn der Klimaschutz in der Bevölkerung eine relativ hohe Zustimmung<br />
genießt (WIPPERMANN et. al 2009), steht er doch in engem<br />
Zusammenhang zu anderen konfliktträchtigen Themenfeldern wie z.B.<br />
Kernenergie, Windkraft oder Bioenergie. Bildungsakteure sollten darauf<br />
vorbereitet sein, bzw. in ihren Lernarrangements solche Konflikte<br />
aktiv mit aufgreifen.<br />
Exkurs: Die Lernenden im Fokus<br />
Adressaten von umweltpolitischer Bildungs- bzw. Öffentlichkeitsarbeit<br />
sind letztlich konkrete Menschen. Nun können entsprechende<br />
Maßnahmen nicht für jeden einzelnen Menschen spezifisch zugeschnitten<br />
werden, aber eine globale Zielgruppe wie „die Verbraucher“<br />
ist ebenso wenig praktikabel, weil die darunter versammelten<br />
Individuen z.B. ganz unterschiedliche Lebensauffassungen und Lebensweisen<br />
haben können.<br />
In der kommerziellen Werbung werden Zielgruppen seit langem in<br />
soziale Milieus eingeteilt. Milieus bilden die soziale Lage, Werteorientierungen<br />
und Lebensstile der Menschen ab. Das in Deutschland<br />
bekannteste Modell der Sinus-Milieus ® gibt es seit Beginn der 80er<br />
Jahre; das aktuelle Modell für das gesamte Deutschland gibt es seit<br />
2001. Dieses Modell unterscheidet:<br />
• gesellschaftliche Leitmilieus (Etablierte, Postmaterielle<br />
und moderne Performer)<br />
• traditionelle Milieus (Konservative, Traditionsverwurzelte<br />
und DDR-Nostalgische)<br />
• Mainstream-Milieus (Bürgerliche Mitte und Konsum-<br />
Materialisten)<br />
• hedonistische Milieus (Experimentalisten und Hedonisten)<br />
(WIPPERMANN et. al 2009).<br />
168
4.2 Methoden zur Bürgerbeteiligung<br />
Sinus-Milieus ® als Zielgruppen<br />
WIPPERMANN et. al (2009) haben die milieuspezifischen Umwelteinstellungen<br />
der Deutschen in einer repräsentativen Umfrage untersucht<br />
und daraus Schlussfolgerungen für die Umweltkommunikation<br />
abgeleitet. Sie halten es für „dringend notwendig, dass sich die Umweltkommunikation<br />
zukünftig stärker an den konkreten Bedingungen<br />
der milieuspezifischen Lebenswelten der Menschen ausrichtet.<br />
Die Milieus der „Etablierten“, „Postmateriellen“, „Modernen Performer“<br />
sowie der „Bürgerlichen Mitte“ schlagen wir als Kernzielgruppen<br />
einer künftig verbesserten Umweltkommunikation vor, da diese<br />
Milieus vor allem eine sehr starke Leit- und Multiplikatorenfunktion<br />
für die Gesellschaft insgesamt ausüben. Dabei haben aber bislang nur<br />
die „Postmateriellen“ eine stark ausgeprägte Umweltaffinität in ihren<br />
Einstellungen.<br />
Die drei anderen Leitmilieus gilt es daher erst einmal intensiver davon<br />
zu überzeugen, dass tatsächlich mittels Umweltschutz eine verbesserte<br />
Lebensqualität zu erreichen ist. In Bezug auf die übrigen<br />
Milieus ist eine stark fokussierte, mit möglichst einfachen Botschaften<br />
und öffentlichen Vorbildern arbeitende Umweltkommunikation<br />
zu empfehlen.“ (ebd., S. 9)<br />
Die Lernenden unterscheiden sich aber nicht nur nach soziologischen,<br />
sondern auch nach lernpsychologischen Merkmalen. Das wird<br />
u.a. mit dem Begriff Lerntypen gefasst, auf den hier aber nicht näher<br />
eingegangen werden soll.<br />
4.2 Methoden zur Bürgerbeteiligung<br />
Die Agenda 21 richtet sich überwiegend an die Regierungen dieser Erde.<br />
Dennoch kann eine nachhaltige Entwicklung nur gelingen, wenn<br />
daraus eine Bürgerbewegung wird. Partizipation ist ein tragendes Element<br />
einer nachhaltigen Entwicklung, und der gesamte Teil III der<br />
Agenda 21 widmet sich der Beteiligung wichtiger Gruppen. Hier wird<br />
nicht nur die Rolle der Kommunen erörtert (Kapitel 28), sondern auch<br />
z.B. die der Frauen (Kapitel 24), der Kinder und Jugendlichen (Kapitel<br />
25), der nichtstaatlichen Organisationen (Kapitel 27) und der Privatwirtschaft<br />
(Kapitel 30). So heißt es z.B. im Kapitel 25: „Es ist zwingend<br />
erforderlich, daß Jugendliche aus allen Teilen der Welt auf allen für sie<br />
relevanten Ebenen aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden...“<br />
(BUNDESUMWELTMINISTERIUM 1992, S. 222). Sehr erhellend<br />
169
4 Lokale Agenda 21<br />
werden verschiedene Aspekte und Begründungen der Bürgerbeteiligung<br />
von REINERT (2003) und RENN (2003) herausgearbeitet.<br />
Partizipation wird in der Agenda 21 gleichermaßen als ein Recht der<br />
Bürger und eine Chance für eine nachhaltige Entwicklung verstanden.<br />
36% der Bundesbürger könnte es sich nach eigener Aussage vorstellen,<br />
sich im Umwelt-/Naturbereich zu engagieren, aber nur 4% engagieren<br />
sich bereits (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG<br />
2009, S. 68). Es besteht somit eine gewaltige Lücke zwischen Bereitschaft<br />
und tatsächlichem Engagement. Diese Lücke kann einerseits damit<br />
erklärt werden, dass es wesentlich leichter ist, sich verbal zu äußern<br />
als sich praktisch zu engagieren. Für unsere Zwecke im Fernstudium<br />
Umwelt&Bildung ist es aber wesentlich fruchtbarer, diese Lücke als<br />
Potenzial zu verstehen und zu fragen, wie das Potenzial für eine nachhaltige<br />
Entwicklung geweckt werden kann.<br />
Wie kann eine – über die repräsentative Demokratie hinausgehende –<br />
Partizipation auf kommunaler Ebene sinnvoll arrangiert werden? Welche<br />
Methoden sind dafür geeignet und welche Verbindungen zur <strong>BNE</strong><br />
können wir ziehen? Welche Rolle spielen überhaupt Methoden in der<br />
Bildungsarbeit und wie können sie eingesetzt werden? Nachfolgend<br />
werden konkrete Methoden der Bürgerbeteiligung vorgestellt, um die<br />
beiden ersten Fragen zu beantworten und um Sie darauf einzustimmen,<br />
dass Sie sich im Modul 3: Didaktik der Umweltbildung sowie Didaktische<br />
Modelle tiefer mit der dritten Frage auseinandersetzen werden. Zur<br />
Vertiefung seien die Handbücher von APEL ET.AL. (1998) sowie von<br />
LEY/WEITZ (2003) empfohlen.<br />
Die unten vorgestellten Methoden eint, dass sie nicht im Sinne des klassischen<br />
Unterrichts auf die Vermittlung von Wissen setzen; vielmehr<br />
dienen sie dazu, dass alle Teilnehmer gemeinsam Wissen erarbeiten,<br />
welches für Entscheidungen oder deren Umsetzung benötigt wird. Derartige<br />
Methoden wurden bereits lange vor der Konferenz von Rio entwickelt;<br />
nichtsdestoweniger können sie auch heute fruchtbringend in<br />
Lokale-Agenda-Prozessen oder der <strong>BNE</strong> eingesetzt werden.<br />
Gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsverfahren im Umwelt- und<br />
Planungsrecht werden hingegen nicht thematisiert.<br />
4.2.1 Open Space<br />
Die Methode wurde von dem US-amerikanischen Organisationsberater<br />
OWEN (2001) entwickelt. Ausgangspunkt war die – für ihn leidvolle –<br />
Erfahrung, dass bei Kongressen mitunter die Pausengespräche ergiebiger<br />
sind als das Vortragsprogramm. Dieses Potenzial will Open Space<br />
170
4.2 Methoden zur Bürgerbeteiligung<br />
aktivieren. Die Methode wird nachfolgend in Anlehnung an PETRI<br />
(2003) vorgestellt.<br />
Open Space will viele Menschen auf freiwilliger Basis in einen Diskussionsprozess<br />
einbinden. Die Teilnehmer sollen aktiviert werden, sie sollen<br />
Freiraum für einen kreativen Austausch zu den Aspekten des<br />
Themas, die ihnen besonders wichtig sind, erhalten.<br />
Ziele<br />
Als Fallbeispiel für einen Open Space kann die ANU Bundestagung<br />
„Umweltbildung und Globales Lernen – Die Kooperation der Zukunft!“<br />
gelten, die im November 2006 in Hannover stattfand. Die ANU (Arbeitsgemeinschaft<br />
Natur- und Umweltbildung e.V.) ist der Dachverband<br />
der außerschulischen Umweltbildungseinrichtungen und freien<br />
Umweltpädagogen. Die Open Space Konferenz diente dem Anliegen<br />
der Organisationsentwicklung, d.h. die ANU wollte die verschiedenen<br />
Akteure zusammenbringen, im Austausch mit Vertretern des Globalen<br />
Lernens die eigenen Konzepte reflektieren, die eigene Umweltbildungsarbeit<br />
im Sinne der <strong>BNE</strong> weiterentwickeln und neue Partnerschaften<br />
vorbereiten. (ANU o.J. a)<br />
Open Space ist eine Großgruppenmethode. Sie zeigt ihre Stärken bei<br />
Teilnehmerzahlen von mehreren Dutzend bis zu mehreren Hundert. Die<br />
als Fallbeispiel vorgestellte ANU Bundestagung hatte ca. 130 Teilnehmer<br />
(ANU o.J. a). Eine heterogene Teilnehmerstruktur (verschiedene<br />
Altersstufen, Kompetenzen oder kulturelle Hintergründe) ist förderlich.<br />
Teilnehmer<br />
Open space stellt relativ hohe Anforderungen an die Teilnehmer. Es ist<br />
ein gewisses Maß an Selbstvertrauen, Fach- und Methodenkompetenz<br />
erforderlich, um ohne Vorbereitung eine kleine Arbeitsgruppe erfolgreich<br />
zu leiten und die Arbeit dann auch noch für Außenstehende nachvollziehbar<br />
zu protokollieren.<br />
Bei Open Space wird weitestgehend auf eine zentrale Steuerung verzichtet;<br />
entsprechend gering sind die Anforderungen hinsichtlich Diskussionsleitern<br />
bzw. Moderatoren.<br />
Voraussetzungen<br />
Ein Rahmenthema, ein Ort und eine Zeitstruktur werden jedoch bereits<br />
in der Planungsphase vom Veranstalter festgelegt und den Teilnehmern<br />
mit der Einladung bzw. zu Beginn des Arbeitsprozesses vorgegeben.<br />
Das Thema sollte ausreichend komplex und ggf. auch konfliktbeladen<br />
sein, für die Teilnehmer eine hohe Relevanz besitzen und ausreichend<br />
offen für die partizipative Mitwirkung sein.<br />
Zudem werden ausreichend Raum, Zeit und Material benötigt:<br />
Als Raumausstattung werden ein Plenarsaal (für alle Teilnehmer) sowie<br />
ausreichend viele Arbeiträume für Kleingruppen benötigt. Bei gutem<br />
171
4 Lokale Agenda 21<br />
Wetter können Kleingruppen auch in ruhigen Eckem im Freien arbeiten.<br />
Der Zeitbedarf beträgt anderthalb bis maximal drei Tage. Pro Tag können<br />
vier Kleingruppenphasen zu je anderthalb Stunden durchgeführt<br />
werden, hinzu kommen die Plenumsphasen.<br />
Alle Arbeitsräume sollten mit gängigem Moderationsmaterial wie Papier,<br />
Stiften und Pinnwänden ausgestattet sein.<br />
Im Fallbeispiel der ANU Bundestagung war das Thema „Umweltbildung<br />
und Globales Lernen – Die Kooperation der Zukunft!“ vorgegeben.<br />
1,5 Tage waren für den Open Space reserviert. In diesem Zeitraum<br />
bildeten sich insgesamt 40 Arbeitsgruppen, z.B. zu folgenden Aspekten:<br />
• Wassertropfen spiegeln die Vielfalt der Welt<br />
• Wie kann <strong>BNE</strong> in Freiwilligendienste (FÖJ, FSJ) integriert<br />
werden?<br />
• Umweltbildung in und mit Osteuropa<br />
• Freiberufler – nachhaltig? Fördermöglichkeiten<br />
• Infoaustausch zum Film „We feed the world“<br />
• Netzwerke und internationale Kooperationen an Schulen,<br />
Unis, Medien<br />
• Welche Themen sind besonders geeignet für die Arbeit mit<br />
Gruppen mit Migrationshintergrund?<br />
• Jugendbildung zum Thema „Konsum und Globalisierung“.<br />
(ANU o.J. b)<br />
Ablauf<br />
Eine Open Space Konferenz beginnt mit einer Plenumsphase. Hier werden<br />
Thematik und Spielregeln vorgestellt. Die Teilnehmer werden eingeladen,<br />
eigene Aspekte oder Fragestellungen zum Konferenzthema<br />
vorzustellen und dazu jeweils einen Workshop anzubieten. Die Workshops<br />
werden auf die vorhandenen Räume und in das vorgegegebe<br />
Zeitraster eingepasst, so dass das Konferenzprogramm letztlich von den<br />
Teilnehmern selbst geschrieben wird.<br />
Die Kleingruppenphasen schließen sich an. In jeweils etwa anderthalb<br />
Stunden finden parallele Workshops statt, die von den Teilnehmern geleitet<br />
werden, welche das entsprechende Thema vorgeschlagen haben.<br />
Zur Arbeitsweise innerhalb der Workshops gibt es keine Vorgaben, von<br />
einer mehr oder weniger strukturierten Diskussion bis hin zu kreativen<br />
Arbeitstechniken ist alles erlaubt.<br />
172
4.2 Methoden zur Bürgerbeteiligung<br />
Am Ende eines Tages, am Beginn eines neuen Tages bzw. am Ende der<br />
Konferenz finden wieder Plenarsitzungen statt, wo bisheriges resümiert<br />
oder die Tagesordnung aktualisiert wird.<br />
Die Konferenzleitung sammelt am Ende bzw. im Nachgang die Protokolle<br />
der Workshopleiter ein und wertet diese aus, um ein Gesamtbild<br />
zu erstellen und dieses dem Veranstalter sowie allen Teilnehmern zur<br />
Verfügung zu stellen.<br />
Die ANU (o.J. a) hat die Tagungsdokumentation veröffentlicht. Sie umfasst<br />
die Protokolle der 40 Arbeitsgruppen sowie eine Dokumentation<br />
von 15 konkreten nächsten Schritten (Projektinitiativen etc.), die auf der<br />
Tagung verabredet wurden. Einen aktuellen Stand der Umsetzung hat<br />
die ANU leider nicht dokumentiert, so dass das hier auch nicht ausgewertet<br />
werden kann. Den in der Dokumentation enthaltenen Vorschlag<br />
„Biodiversität – als Thema für die nächste ANU Bundestagung“ hat die<br />
ANU offenbar umgesetzt – diese Tagung fand am 29.11. - 1.12. 2007 in<br />
Witzenhausen statt.<br />
Open Space kann eingesetzt werden, wenn ein Diskussions- und Entscheidungsprozess<br />
noch am Anfang steht oder eine grundlegende Neuorientierung<br />
fällig ist und die Gedanken vieler Menschen einbezogen<br />
werden sollen.<br />
Potenzial für die<br />
Bürgerbeteiligung<br />
PRILL (2003) skizziert, wie Open Space im Rostocker Stadtteil Groß<br />
Klein eingesetzt wurde, um über die Frage zu diskutieren, wie nach der<br />
Deutschen „Wende“ das Leben in dem Stadtteil wieder attraktiver gestaltet<br />
werden könnte. Die HANSESTADT LÜBECK hat Open Space zu<br />
Beginn ihres Lokale Agenda 21 Prozesses eingesetzt, um erste Themen<br />
zu sammeln, insgesamt waren hier ca. 1.000 Menschen beteiligt.<br />
Eine grundlegende Neuorientierung partizipativ zu gestalten, war auch<br />
Anliegen der ANU Bundestagung. Für die in der ANU vereinten Umweltpädagogen<br />
erfordert das Leitbild der Nachhaltigkeit eine deutliche<br />
Erweiterung des Horizonts und eine Neuorientierung der pädagogischen<br />
Konzepte. Auch wenn die ANU sich bereits 1998 ein erstes Mal<br />
zur <strong>BNE</strong> positioniert hatte (vgl. Kap. 3.1.3), herrscht an der Basis des<br />
Verbands noch immer ein erheblicher Orientierungsbedarf. Die Methode<br />
wurde hier also sinnvoll eingesetzt. Die Methode ist für die <strong>BNE</strong> interessant,<br />
denn sie aktiviert Teilnehmer und spricht ihre Kreativität an.<br />
Sie fördert ein in hohem Maße selbstbestimmtes Lernen; die Teilnehmer<br />
können nicht nur selber auswählen, welche Workshops sie besuchen,<br />
sondern sie können selber Workshops vorschlagen und leiten und<br />
dabei Erfahrungen machen, die ihnen andere Lernformen kaum ermöglichen.<br />
Potenzial für die <strong>BNE</strong><br />
173
4 Lokale Agenda 21<br />
4.2.2 Zukunftswerkstatt<br />
Die Methode Zukunftswerkstatt wurde von JUNGK/MÜLLERT (1985)<br />
entwickelt, sie fand in der Umwelt- und Friedensbewegung eine weite<br />
Verbreitung (als Online-Ressource siehe STIFTUNG MITARBEIT o.J.). In<br />
der nachfolgenden Darstellung der Methode orientiere ich mich an eigenen<br />
Erfahrungen beim Einsatz der Methode in Schulen 42 , die auf der<br />
Darstellung von JUNGK/MÜLLERT aufbauen.<br />
Ziele<br />
Mit einer Zukunftswerkstatt sollen konkrete Entscheidungen und konkretes<br />
Handeln partizipativ vorbereitet werden. Die Interessen der Betroffenen<br />
sollen mit einfließen, ihr Wissen und ihr Engagement sollen<br />
als Ressource für notwendige Veränderungen gewonnen werden.<br />
Ein passendes Fallbeispiel könnte sein, dass eine Schule ihr Schulgelände<br />
umgestalten will und dass dabei die Lehrer, Eltern und Schüler mit<br />
einbezogen werden sollen.<br />
Teilnehmer<br />
An einer Zukunftswerkstatt sollten Menschen teilnehmen, die von den<br />
Entscheidungen bzw. dem Handeln betroffen sind bzw. die die Verantwortung<br />
dafür tragen. Gruppengrößen von ca. 20 Teilnehmern sind ideal.<br />
Bei größeren Gruppen muss die Methode angepasst oder auf eine<br />
Teilmenge der Betroffenen begrenzt werden. Auch für jüngere Teilnehmer<br />
kann die Methode adaptiert werden; schon Kinder können z.B. mit<br />
Zeichnungen oder dem Bau von Modellen ihre Vorstellungen von ihrem<br />
Schulgelände zum Ausdruck bringen.<br />
Zudem wird ein Moderator benötigt, der die Werkstatt leitet; er (oder<br />
sie) sollte möglichst neutral (nicht in die zu verhandelnden Fragen und<br />
Probleme involviert) und neugierig (an den Fragen interessiert) sein.<br />
Der Moderator steuert den Diskussionsprozess, stellt Fragen, gibt aber<br />
nicht die Antworten. Er achtet darauf, dass die Teilnehmer wichtige<br />
Fragen konsequent zu Ende denken und sich nicht verzetteln. Er achtet<br />
darauf, dass die „Spielregeln“ und der Zeitplan eingehalten werden.<br />
Voraussetzungen<br />
Eine grundlegende Voraussetzung ist, dass die Teilnehmenden innerhalb<br />
der gewählten Themenstellung überhaupt Gestaltungsspielraum<br />
haben. Es wäre vermutlich weniger sinnvoll, wenn wir im Rahmen des<br />
Fernstudiums Umwelt&Bildung eine Zukunftswerkstatt zur Lösung der<br />
42. Die Gesamtschule Schwerte und das Berufskolleg Neuss Weingartstraße haben die<br />
Methode erfolgreich im Rahmen des Nachhaltigkeitsaudits eingesetzt. Die Schulen hatten<br />
bereits eine erste gründliche Bestandsaufnahme durchgeführt und haben dann in einer<br />
Zukunftswerkstatt Leitbilder entworfen, konkrete Entwicklungsziele festgelegt und<br />
Maßnahmen vorbereitet. In beiden Fällen wurden die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt<br />
anschließend formell legitimiert, z.B. durch einen Beschluss der Schulkonferenz.<br />
(GESAMTSCHULE SCHWERTE 1997b und BERUFSKOLLEG NEUSS WEINGARTSTRAßE 2000,<br />
S. 9)<br />
174
4.2 Methoden zur Bürgerbeteiligung<br />
Konflikte in Nah- und Mittel-Ost veranstalten würden – so nahe diese<br />
uns auch eventuell gehen und so sehr wir auch (z.B. über den Ölpreis)<br />
mit betroffen sind. Allerdings ist es eine Stärke der Methode, dass sie<br />
das Potenzial hat, Gestaltungsspielräume zu erweitern: Im Falle der<br />
Schulgeländegestaltung könnte man zunächst davon ausgehen, dass alleine<br />
der Schulträger zuständig ist, dass dieser kein Geld hat und somit<br />
keine Spielräume bestehen. Bei genauerer Betrachtung könnte sich<br />
dann herausstellen, dass es eine Vielzahl von Ideen gibt, die (fast) ohne<br />
Kosten umgesetzt werden können oder dass es über den Schulförderverein<br />
möglich ist, Fördermittel, Sach- und Zeitspenden oder Sponsorengelder<br />
einzuwerben und dass schließlich die Teilentsiegelung des<br />
Geländes zu erheblichen Kosteneinsparungen führt, weil dann die Gebühr<br />
für die Einleitung des Regenwassers in die öffentliche Kanalisation<br />
entfällt.<br />
Alle Teilnehmer sind in der Werkstatt gleichberechtigt, unabhängig von<br />
Position, Qualifikation und Alter. Jeder Teilnehmer ist auf seine Weise<br />
Experte für die zu verhandelnden Fragen. Zudem ist diese Grundhaltung<br />
die Basis dafür, dass auch eher zurückhaltende Menschen den Mut<br />
finden, ihre Gedanken einzubringen. Entsprechend fair und konstruktiv<br />
sollte diskutiert werden.<br />
Erforderlich sind weiterhin: ein ausreichend großer Raum mit beweglichem<br />
Mobiliar (ggf. auch zwei oder drei Räume, für Kleingruppenarbeit)<br />
sowie Moderationsmaterialien wie Stellwände, Packpapier,<br />
Kärtchen und Stifte.<br />
Für eine Zukunftswerkstatt sollten ein bis zwei Tage eingeplant werden.<br />
Eine Zukunftswerkstatt ist ein strukturierter Diskussionsprozess, der im<br />
Wesentlichen drei Phasen umfasst:<br />
Ablauf<br />
1. In der Kritikphase skizzieren die Teilnehmer den IST-Zustand.<br />
Dabei stehen die zu verändernden kritischen Aspekte im Mittelpunkt;<br />
positive Aspekte sollen aber keinesfalls verschwiegen werden.<br />
In dem Fallbeispiel Schulgeländegestaltung könnten die<br />
Teilnehmer das Schulgelände begehen, eine von Schülern vorbereitete<br />
Fotoausstellung besichtigen und ihre eigenen Meinungen<br />
zusammentragen. Dafür können Methoden wie Kärtchenabfrage<br />
oder stummes Schreibgespräch genutzt werden.<br />
2. In der Utopie- oder Perspektivphase entwirft die Gruppe Bilder<br />
von wünschenswerten Zukünften. Die Teilnehmer dürfen und sollen<br />
dabei die Realität weit verlassen und sich in Utopien verlieren.<br />
Jegliche Kritik („das ist ja unmöglich zu realisieren“) ist strikt verboten.<br />
Wenn sich (erwachsene) Teilnehmer darauf nicht recht einlassen<br />
mögen, kann es als Einstieg sinnvoll sein, kritische<br />
175
4 Lokale Agenda 21<br />
Aussagen aus der ersten Phase in ihr positives Gegenteil zu kehren<br />
und die Teilnehmer dann aufzufordern, diese nun positiven Vorstellungen<br />
weiter auszumalen. In der Regel arbeiten die Teilnehmer<br />
hier in Kleingruppen. Sie können ihre Visionen kreativ<br />
erarbeiten und z.B. eine Reportage zur Situation in 10 Jahren<br />
schreiben. Für das Beispiel der Schulgeländeumgestaltung bietet<br />
es sich z.B. an, aus geeigneten Materialien Modelle zu bauen oder<br />
aus Fotos und anderen Materialien Collagen herzustellen. Die<br />
Ergebnisse werden abschließend im Plenum präsentiert.<br />
3. In der Realisierungsphase werden konkrete Schritte erarbeitet,<br />
um die Utopien in die Realität umzusetzen (operative Ziele, Maßnahmen,<br />
Zeitpläne, Zuständigkeiten). Das ist eine sehr schwierige<br />
Phase, denn manche Visionen werden Visionen bleiben. Es kann<br />
daher hilfreich sein, die Utopien auf ihren „harten Kern“ zu hinterfragen.<br />
Wenn sich z.B. Schüler eine Eisbahn und ein Schwimmbad<br />
für ihre Schule gewünscht haben, dann drückt das vielleicht<br />
ganz generell den Wunsch nach Sport- und Bewegungsangeboten<br />
für die Pausen und Nachmittage aus; und für diesen Wunsch gibt<br />
es vielfältige praktikable Lösungen. Auch in dieser Phase können<br />
sich Kleingruppen- und Plenumsarbeit abwechseln.<br />
Anschließend wird der Moderator die Ergebnisse in einem Bericht zusammenfassen<br />
und somit die Umsetzung möglichst optimal vorbereiten.<br />
Während der drei Phasen werden Gedanken und Ergebnisse für alle<br />
sichtbar festgehalten, z.B. mit schriftlich auf Moderationskärtchen und<br />
Pinnwänden, mit Zeichnungen, Modellen oder Fotos. Dadurch können<br />
alle Teilnehmer nachvollziehen, welchen Weg sie bereits beschritten<br />
haben. Sie können es vermeiden, dass sie wichtige Gedanken unterwegs<br />
fallen lassen. Und sie schaffen für die Auswertungen eine ideale Arbeitsgrundlage.<br />
Es ist wichtig, klar zu strukturieren; die einzelnen Phasen müssen nacheinander<br />
abgearbeitet werden. Dafür muss jede Phase zu ihrer Zeit<br />
wirklich zu Ende gebracht werden. Der Prozess gerät durcheinander,<br />
wenn die Gruppe anfängt, die Ergebnisse früherer Phasen zu überarbeiten.<br />
Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Gruppe wirklich konkret<br />
wird. Sie kann nicht jedes Detail festlegen, sie sollte aber klar und verbindlich<br />
erarbeiten, wer nachfolgend welche Aufgaben übernimmt. Für<br />
die Realisierungsphase muss daher genügend Zeit eingeplant werden.<br />
Potenzial für die<br />
Bürgerbeteiligung<br />
Die Zukunftswerkstatt kann überall dort eingesetzt werden, wo Betroffene<br />
zu Mitwirkenden gemacht werden sollen und wo gesellschaftlich<br />
176
4.3 Lokale Agenda 21 – 20 Jahre nach Rio<br />
relevante Praxis konkret vorbereitet werden soll. BEER (2003) beschreibt<br />
z.B. eine jugendpolitische Zukunftswerkstatt „Kids im Kietz“.<br />
SEMMELMANN (2003) hat die Methode angewendet, um Perspektiven<br />
für ein vom Auslaufen bedrohtes Agendprojekt zu schaffen.<br />
Die Methode ist hervorragend dafür geeignet, Teilnehmer zu aktivieren,<br />
ihre Kreativität anzusprechen und sie zur Mitgestaltung zu motivieren.<br />
Sie fordert vielfältige Kompetenzen heraus, die im Rahmen der <strong>BNE</strong> eine<br />
Rolle spielen, so z.B. ein zukunftsgerichtetes Denken, Planungskompetenz,<br />
Kooperation und Teamfähigkeit. Wenn es gelingt, Ergebnisse<br />
einer Zukunftswerkstatt sichtbar in die Praxis umzusetzen, dann haben<br />
die Teilnehmer eine gute Erfahrung mit Partizipation gemacht.<br />
Potenzial für die <strong>BNE</strong><br />
Die Methode kann dafür genutzt werden, dass sich Bildungseinrichtungen<br />
in Richtung Nachhaltigkeit weiterentwickeln.<br />
4.3 Lokale Agenda 21 – 20 Jahre nach Rio<br />
Wie im Kapitel 4.1 gezeigt wurde, gibt es gute Beispiele dafür, dass<br />
Kommunen im Rahmen der Lokalen Agenda eine nachhaltige Entwicklung<br />
unterstützen. AGENDA-TRANSFER/INWENT (2007, S.10) bezeichnen<br />
die Lokale Agenda 21 als einen der „quantitativ bedeutsamsten<br />
Partizipationsprozesse in Deutschland.“<br />
Dennoch sind auch kritische Einschätzungen angebracht, diese sollen<br />
hier auf die quantitative Ebene beschränkt bleiben.<br />
Ende 1996 arbeiteten über 1.800 Kommunen in 64 Ländern an einer Lokalen<br />
Agenda 21 (ICLEI 1998, S.21). In einer aktuellen Publikation liefert<br />
ICLEI (<strong>2011</strong>, S.4) nur eine Angabe für das Jahr 2001 – demnach<br />
waren damals über 6.000 Kommunen in 113 Ländern involviert. ICLEI<br />
schätzt ein, dass seitdem mehrere tausend weitere Kommunen eine Lokale<br />
Agenda 21 begonnen haben; zuverlässige Zahlen liegen dazu aber<br />
offenbar nicht vor.<br />
Keine breite weltweite<br />
Bewegung von<br />
Kommunen<br />
Wenn man bedenkt, dass es alleine in Deutschland ca. 14.000 Kommunen<br />
gibt, dann wird deutlich, dass die nach der Konferenz von Rio erhoffte<br />
weltweite Bewegung von Kommunen für eine nachhaltige<br />
Entwicklung kaum in Gang gekommen ist.<br />
Nach GÖLL (2009, S. 75) haben in Deutschland 2.610 Kommunen einen<br />
Beschluss zur Lokalen Agenda 21 gefasst.<br />
177
4 Lokale Agenda 21<br />
„Sichtbarkeit“ der<br />
Lokalen Agenda 21 in<br />
Deutschland lässt<br />
nach<br />
Nimmt man die mediale Präsenz der Lokalen Agenda 21 in Deutschland<br />
als ein Indiz für ihre Dynamik, so drängt sich der Eindruck auf,<br />
dass die Lokale Agenda 21 hierzulande im Rückgang begriffen ist:<br />
• Die Lokale Agenda 21 wurde im <strong>BNE</strong>-Bericht 2002 der<br />
Bundesregierung noch mit einem eigenständigen Kapitel<br />
gewürdigt, in den Berichten 2005 und 2009 spielt sie nur<br />
noch eine marginale Rolle, z.B. als Teil von Maßnahmen<br />
einzelner Bundesländer (BUNDESMINISTERIUM FÜR BIL-<br />
DUNG UND FORSCHUNG 2002 und 2009 sowie DEUTSCHER<br />
BUNDESTAG 2005).<br />
• In den Fortschrittsberichten der Bundesregierung zur Nationalen<br />
Nachhaltigkeitsstrategie spielt die Lokale Agenda 21<br />
nahezu keine Rolle. Im Beitrag der kommunalen Spitzenverbände<br />
zum Fortschrittsbericht 2008 heißt es zwar „Nachhaltigkeit<br />
wird mehr und mehr zum zentralen Leitbild<br />
kommunaler Politik.“ (DIE BUNDESREGIERUNG 2008, S.<br />
196) Nachfolgend wird dann aber auf Handlungsfelder wie<br />
Klimaschutz und Flächenverbrauch eingegangen, aktuelle<br />
Angaben zum Stand der Lokalen Agenda 21 gibt es nicht.<br />
• Die Präsenz Lokaler Agenda-Initiativen im Internet hat<br />
deutlich nachgelassen. Der ehemals renommierte Informationsdienst<br />
www.agendaservice.de ist abgeschaltet. Eine im<br />
Jahr 2007 noch ca. 150 kommunale Websites zur Lokalen<br />
Agenda 21 aus Deutschland umfassende Linkliste 43 musste<br />
bis 2010 auf 60 Einträge gekürzt werden, weil die Mehrzahl<br />
der Websites inzwischen abgeschaltet worden waren.<br />
Für <strong>BNE</strong>-Akteure in Deutschland gibt es dennoch potenzielle Anknüpfungspunkte<br />
an die Lokale Agenda 21: Sie können – mit oder ohne formellen<br />
Lokale Agenda 21-Prozess – Ihr methodisches Know-How für<br />
die Moderation von Prozessen und die Einbeziehung der Bürger zur<br />
Verfügung stellen. Sie können Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen<br />
Kompetenzen für die Mitgestaltung vermitteln. Sie können mit erfolgreichen<br />
Bildungsprojekten Bürger für die Lokale Agenda 21 oder<br />
für andere Nachhaltigkeitsprozesse wie z.B. den kommunalen Klimaschutz<br />
begeistern. Sie können den Blick über den kommunalen Horizont<br />
erheben, gute Beispiele entdecken und die Übertragung guter<br />
Praxis auf Ihre Kommune einfordern.<br />
43. auf www.umweltschulen.de<br />
178
4.4 Zusammenfassung<br />
4.4 Zusammenfassung<br />
Das Kapitel 4 sollte Ihnen Einblicke in die Lokale Agenda 21 geben.<br />
Dabei war nicht vorgesehen, das Thema erschöpfend zu behandeln.<br />
Vielmehr sollten ausgewählte Themen und Fragestellungen aus den Kapiteln<br />
2 und 3 vertieft werden, bzw. ich wollte Ihnen Anknüpfungspunkte<br />
für weitere Lehrabschnitte im Rahmen Ihres Fernstudiums<br />
anbieten.<br />
Im Kapitel 4.1 wurden drei entsprechende kommunale Prozesse vorgestellt.<br />
Bewusst wurden dabei ganz unterschiedliche Kommunen und<br />
auch unterschiedliche Aspekte ausgewählt.<br />
Ein konstituierendes Merkmal einer nachhaltigen Entwicklung ist die<br />
Partizipation der Bürgerinnen und Bürger. Im Kapitel 4.2 wurden daher<br />
Methoden vorgestellt, mit denen die Partizipation – und vor allem die<br />
aktive Mitwirkung von Bürgern an der Konstruktion von Wissen über<br />
zukünftige Entwicklungen – arrangiert werden kann.<br />
Weder die Breite noch die Tiefe, in der Lokale Agenda 21-Prozesse bislang<br />
in den Kommunen der Welt verankert sind, sind befriedigend.<br />
Nach der Lektüre dieses Abschnitts sollten Sie eine Vorstellung davon<br />
haben, wie Sie auf kommunaler Ebene bzw. im Rahmen Ihrer Bildungsarbeit<br />
zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können.<br />
179
5 Abkürzungsverzeichnis<br />
5 Abkürzungsverzeichnis<br />
ABM Arbeitsbeschaffungsmaßnahme<br />
ACUPCC American College & University President's Climate Commitment<br />
AI Appreciative Inquriy / Wertschätzende Erkundung<br />
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (erworbenes<br />
Immundefektsyndrom)<br />
ANU Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung e.V.<br />
BBU Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V.<br />
BIP Bruttoinlandsprodukt<br />
BLK Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und<br />
Forschungsförderung<br />
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und<br />
Reaktorsicherheit<br />
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und<br />
Entwicklung<br />
<strong>BNE</strong> Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.<br />
CNCR Constant Nature Capital Rule (Regel vom konstanten Naturkapital)<br />
CO 2 Kohlendioxid<br />
CSD Commission for Sustainable Development / UN-<br />
Kommission für nachhaltige Entwicklung<br />
DAC Development Assistance Committee (eine Abteilung der<br />
OECD)<br />
DDR Deutsche Demokratische Republik<br />
DeSeCo Definition and Selection of Competencies / Studie der<br />
OECD zur Definition und Auswahl von Kompetenzen<br />
DGU Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung e.V.<br />
DUK Deutsche UNESCO-Kommission<br />
ECOSOC Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen<br />
EG Europäische Gemeinschaft<br />
EMAS Environmental Management and Audit Scheme (Verfahren<br />
für ein Umweltmanagement und eine<br />
Umweltbetriebsprüfung)<br />
EU European Union<br />
GATT General Agreement on Tariffs and Trade<br />
GbU Gesellschaft für berufliche Umweltbildung e.V.<br />
GNU Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR<br />
GÖS Gestaltung und Öffnung von Schule (ehemaliges<br />
schulpolitisches Förderprogramm in Nordrhein-Westfalen)<br />
HDI Human Development Index / Index der menschlichen<br />
Entwicklung<br />
HEINZ Hamburger Entwicklungs-INdikatoren Zukunftsfähigkeit<br />
181
5 Abkürzungsverzeichnis<br />
HIV Human Immunodeficiency Virus<br />
ICLEI Local Governments for Sustainability (Founded as the<br />
International Council for Local Environmental Initiatives<br />
(ICLEI) / Internationaler Rat für Kommunale<br />
Umweltinitiativen<br />
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change<br />
(IZwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen)<br />
KMK Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der<br />
Bundesrepublik Deutschland<br />
LCA Life Cycle Assessment<br />
LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz<br />
Baden-Württemberg<br />
MAB Man and the Biosphere / UNESCO-Programm Der Mensch<br />
und die Biosphäre<br />
MDG Millenium Development Goals /<br />
Milleniumsentwicklungsziele (der Vereinten Nationen)<br />
MIPS Material Input pro Serviceeinheit<br />
MOST Management of Social Transformations / UNESCO-<br />
Programm Gestaltung des sozialen Wandels<br />
M-V Mecklenburg-Vorpommern<br />
NGO non-governmental organization / nichtstaatliche<br />
Organisation<br />
NH 3 Ammoniak<br />
NDR Norddeutscher Rundfunk<br />
NOx Stickoxide<br />
NRW Nordrhein-Westfalen<br />
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development<br />
/ Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und<br />
Entwicklung<br />
PISA Programme for International Student Assessment /<br />
Internationale Lernstandserhebung bei Schülern<br />
REACH Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (EG-<br />
Verordnung zur Registrierung, Bewertung und Zulassung<br />
von Chemikalien)<br />
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute<br />
SO 2 Schwefeldioxid<br />
SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen<br />
UBA Umweltbundesamt<br />
UfU Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V.<br />
ULSF Association Of University Leaders For A Sustainable Future<br />
UN United Nations (Vereinte Nationen)<br />
UNCED United Nations Conference on Environments and<br />
Development / UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung<br />
UNDP United Nations Development Programme /<br />
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen<br />
182
5 Abkürzungsverzeichnis<br />
UNECE United Nations Economic Commission for Europe /<br />
Ökonomische Kommisssion der Vereinten Nationen für<br />
Europa<br />
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural<br />
Organization / Organisation der Vereinten Nationen für<br />
Erziehung, Wissenschaft und Kultur<br />
UNICEF United Nations Children's Fund / Kindrhilfswerk der<br />
Vereinten Nationen<br />
VENRO Verband Entwicklungspolitik Deutscher<br />
Nichtregierungsorganisationen e.V.<br />
VOC Volatile Organic Compounds / leichtflüchtige organische<br />
Verbindungen<br />
WGBU <strong>Wissenschaftliche</strong>r Beirat Globale Umweltveränderungen<br />
WTO World Trade Union / Welthandelsorganisation<br />
183
6 Quellenverzeichnis<br />
6 Quellenverzeichnis<br />
ACUPCC (o.J.): American College & University President's Climate Commitment.<br />
Online-Dokument; URL: http://www.presidentsclimatecommitment.org/, zuletzt<br />
überprüft: 19.7.<strong>2011</strong><br />
ADLER, FRANK/SCHACHTSCHNEIDER, ULRICH (2010): Green New Deal, Suffizienz<br />
oder Ökosozialismus? Konzepte für gesellschaftliche Wege aus der Ökokrise.<br />
München: oekom<br />
AGENDA-TRANSFER/INWENT (2007): Nachhaltigkeit: Das Plus vor Ort. Bonn. Zitiert<br />
nach GÖLL, EDGAR (2009): Lokale Agenda 21 und informelles Lernen. In:<br />
BRODOWSKI, MICHAEL et. al. (Hrsg.): Informelles Lernen und Bildung für eine<br />
nachhaltige Entwicklung. Opladen & Farmington Hills, MI: Verlag Barbara<br />
Budrich. S. 75<br />
AGNES-MIEGEL-REALSCHULE (2005): Togo-AG, Sponsorenlauf. Online-Dokument;<br />
URL: www.umweltschulen.de/audit/ami/togo_1.htm, zuletzt überprüft:<br />
10.8.<strong>2011</strong><br />
ALEXANDER-VON-HUMBOLDT-SCHULE VIERNHEIM (o.J.): EnergieAgentur Alexander-von-Humboldt-Schule<br />
Viernheim. Online-Dokument; URL: http://<br />
www.energieagentur-avh.de, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
ANU (o.J.) a: Umweltbildung und Globales Lernen – Die Kooperation der Zukunft!<br />
Online-Dokument; URL: http://www.umweltbildung.de/global.html, zuletzt<br />
überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
ANU (o.J.) b: Umweltbildung und Globales Lernen – Die Kooperation der Zukunft!<br />
Dokumentation. Online-Dokument; URL: http://www.umweltbildung.de/<br />
uploads/media/Doku_Anliegen_Teil1.pdf, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
ANU/DGU/GBU (1998): Bildungsprogramm für nachhaltige Entwicklung in der<br />
Bundesrepublik Deutschland<br />
APEL, HEINO (2005): <strong>BNE</strong>: Motor oder Service? Anmerkungen zum NAP. Diskussionsbeitrag<br />
auf der Mailingliste Umweltbildung 15.11.2005, umweltbildung@mlist.uni-frankfurt.de<br />
(Liste nicht mehr aktiv)<br />
APEL, HEINO/DERNBACH, DOROTHEE/KÖDELPETER, THOMAS/WEINBRENNER, PETER<br />
(Hrsg.; 1998): Wege zur Zukunftsfähigkeit – ein Methodenbuch. Bonn: Stiftung<br />
Mitarbeit<br />
ARNDT, ERNST-MORITZ (1815): in der Zeitschrift „Der Wächter“. Zitiert nach BOL-<br />
SCHO, DIETMAR/SEYBOLD, HANSJÖRG (1996): Umweltbildung und ökologisches<br />
Lernen: Ein Studien- und Praxisbuch. Berlin: Cornelsen Scriptor. S. 22<br />
ASSADOURIAN, ERIK (2010): Aufstieg und Fall unserer Konsumkultur. In: Worldwatch<br />
Institute (Hrsg.): Zur Lage der Welt 2010. Einfach besser leben. Nachhaltigkeit<br />
als neuer Lebensstil. München: oekom. S. 35-57<br />
BAHRO, RUDOLF (1977): Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus.<br />
Köln, Frankfurt. 2. erw. Auflage<br />
185
6 Quellenverzeichnis<br />
BECK, ULRICH (1986): Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne.<br />
Frankfurt am Main: Suhrkamp<br />
BEER, INGEBORG (2003): Zukunftswerkstatt – Kids im Kietz. In: LEY, ASTRID /<br />
WEITZ, LUDWIG (Hrsg.): Praxis Bürgerbeteiligung. Ein Methodenhandbuch.<br />
Bonn: Verlag Stiftung Mitarbeit / Agenda Transfer. S. 287<br />
BEER, WOLFGANG/DE HAAN, GERHARD (Hrsg., 1984): Ökopädagogik, Aufstehen gegen<br />
den Untergang der Natur. Weinheim: Beltz<br />
Behrens, Hermann/Hoffmann, Jens (Hrsg., 2007): Umweltschutz in der DDR. Analysen<br />
und Zeitzeugenberichte. München: oekom<br />
BERG, WIELAND (1999): Das Phantom. Die Aktivitäten der ÖAG Halle gegen die Asphaltierung<br />
der Heidewege 1988 und die Reaktionen des MfS. Halle: druckzuck<br />
BERUFSKOLLEG NEUSS WEINGARTSTRAßE (2000): Umwelterklärung 2000 Berufskolleg<br />
Neuss Weingartstraße. Online-Dokument; URL: http://www.umweltschulen.de/audit/neuss/ue/UE_2000.pdf,<br />
zuletzt überprüft: 27.7.<strong>2011</strong><br />
BERUFSKOLLEG NEUSS WEINGARTSTRAßE (<strong>2011</strong>): Öko-Audit Berufskolleg Neuss.<br />
Online-Dokument; URL: http://www.umweltschulen.de/audit/neuss/, zuletzt<br />
überprüft: 1.8.<strong>2011</strong><br />
BLK (1998): Bildung für nachhaltige Entwicklung – Orientierungsrahmen. Bonn<br />
BLK (2005): Bildung für nachhaltige Entwicklung („21“). Abschlussbericht des Programmträgers<br />
zum BLK-Programm. Bonn<br />
BOLSCHO, DIETMAR (1997): Umweltbewußtseinsforschung. In: MICHELSEN, GERD<br />
(Hrsg., 1997): Umweltberatung. Grundlagen und Praxis. Bonn: Economica<br />
Verlag GmbH. S. 23-33<br />
BOLSCHO, DIETMAR/EULEFELD, GÜNTER/SEYBOLD, HANSJÖRG (1980): Umwelterziehung.<br />
Neue Aufgaben für die Schule. München: Urban & Schwarzenberg<br />
BOLSCHO, DIETMAR/SEYBOLD, HANSJÖRG (1996): Umweltbildung und ökologisches<br />
Lernen: Ein Studien- und Praxisbuch. Berlin: Cornelsen Scriptor<br />
BRÄMER, RAINER (2006a): Natur obskur. München: oekom<br />
BRÄMER, RAINER (2006b): Jugendreport Natur ´06: Natur obskur. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.staff.uni-marburg.de/~braemer/report06.htm, zuletzt überprüft:<br />
10.8.<strong>2011</strong><br />
BRAUNGART, MICHAEL/MCDONOUGH, WILLIAM (2008): Cradle to Cradle. Jonathan<br />
Cape Ltd<br />
BRODOWSKI, MICHAEL (2009): Kompetenzerwerb durch informelles – kooperativ/<br />
kollektives Lernene – Aspekte zum Zusammenhang beider Lernformen im<br />
Rahmen der UN Dekade Bildung für Nachhaltige Entwicklung. In: BRODOW-<br />
SKI, MICHAEL et.al (Hrsg.): Informelles Lernen und Bildung für eine nachhal-<br />
186
6 Quellenverzeichnis<br />
tige Entwicklung. Opladen & Farmington Hills, MI: Verlag Barbara Budrich.<br />
S. 62-72<br />
BROT FÜR DIE WELT/EED/BUND (Hrsg., 2008): Zukunftsfähiges Deutschland in einer<br />
globalisierten Welt. Eine Studie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt,<br />
Energie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag<br />
BUDDENSIEK, WOLFGANG (1991): Wege zur Öko-Schule. Lichtenau und Göttingen:<br />
AOL & Die Werkstatt<br />
BUND/MISEREOR (1995): Zukunftsfähiges Deutschland. Ein Beitrag zu einer global<br />
nachhaltigen Entwicklung. Kurzfassung. Bonn.<br />
BUND/MISEREOR (1996): Zukunftsfähiges Deutschland. Ein Beitrag zu einer global<br />
nachhaltigen Entwicklung. Basel: Birkhäuser.<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (2002): Bericht der Bundesregierung<br />
zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Bonn<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (2009): Bericht der Bundesregierung<br />
zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Berlin. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.bmbf.de/pub/<br />
bericht_fuer_nachhaltige_entwicklung_2009.pdf, zuletzt überprüft 6.12.2010<br />
BUNDESUMWELTMINISTERIUM (1992): Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt<br />
und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro – Dokumente – Agenda 21.<br />
Bonn<br />
BUNDESUMWELTMINISTERIUM (1997): Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung<br />
in Deutschland, Bonn 1997<br />
BUNDESUMWELTMINISTERIUM (1998): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Entwurf<br />
eines umweltpolitischen Schwerpunktprogramms. Bonn<br />
BUNDESUMWELTMINISTERIUM (2010): Nationale Nachhaltigkeitsstrategie "Perspektiven<br />
für Deutschland". Online-Dokument; URL: http://www.bmu.de/<br />
nachhaltige_entwicklung/stategie_und_umsetzung/nachhaltigkeitsstrategie/<br />
doc/38935.php, zuletzt überprüft: 10.7.<strong>2011</strong><br />
BURCHARDT, ULLA (1996): Lernen für die Zukunft – nachhaltige Entwicklung und<br />
Umweltbildung. In: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Umweltbildung: Wegweiser<br />
zu einer nachhaltigen Entwicklung. Bonn, S. 31 – 37<br />
CARSON, RACHEL (1962): Silent Spring. Boston: Houghton Mifflin<br />
CLUB OF ROME (1979): Bericht für die achtziger Jahre – Zukunftschance Lernen.<br />
Hrsg. Aurelio Pecci. Wien/Zürich/Innsbruck<br />
COMENIUS-GYMNASIUM DÜSSELDORF (2006): Papierverbrauch am Comenius-Gymnasium.<br />
Können Schulhefte Bäume fällen? Online-Dokument; URL:<br />
www.umweltschulen.de/audit/comenius2006/projekt_papierverbrauch.htm,<br />
zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
187
6 Quellenverzeichnis<br />
CONRAD, JOBST (2000): Nachhaltige Entwicklung: einige begriffliche Präzisierungen<br />
oder der heroische Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. FFU-report<br />
00-07. Online-Dokument; URL: http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/ffu/publikationen/2000/conrad_jobst_20004/rep_00-07.PDF,<br />
zuletzt überprüft 10.8.<strong>2011</strong><br />
CORNELL, JOSEPH (1991a): Mit Kindern die Natur erleben. Mülheim an der Ruhr:<br />
Verlag an der Ruhr<br />
CORNELL, JOSEPH (1991b): Mit Freude die Natur erleben: Naturerlebnisspiele für alle.<br />
Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr<br />
COSBEY, AARON (2006): Handel und nachhaltige Entwicklung – zwei unvereinbare<br />
Ziele? In: Worldwatch Institute (Hrsg.): Zur Lage der Welt 2006. China, Indien<br />
und unsere gemeinsame Zukunft. Münster: Westfälisches Dampfboot. S. 235-<br />
259<br />
DAHLBERG, GUNILLA (2010): Kinder und Pädagogen als Co-Konstrukteure von Wissen<br />
und Kultur: Frühpädagogik in postmoderner Perspektive. In: FTHENAKIS,<br />
WASSILIOS E./OBERHUEMER, PAMELA (Hrsg.): Frühpädagogik international.<br />
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2. Auflage. S. 13-30<br />
DE HAAN, GERHARD (2008): Gestaltungskompetenz als Kompetenzkonzept der Bildung<br />
für nachhaltige Entwicklung. In: BORMANN, INKA/DE HAAN, GERHARD<br />
(Hrsg.): Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wiesbaden:<br />
VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 23-43<br />
DE HAAN, GERHARD (2010): Schule, Nachhaltigkeit, Zukunft. In: Worldwatch Institute<br />
(Hrsg.): Zur Lage der Welt 2010. Einfach besser leben. Nachhaltigkeit als<br />
neuer Lebensstil. München: oekom. S. 26-32<br />
DE HAAN, GERHARD/GIESEL, KATHARINA D./RODE, HORST (2002): Umweltbildung<br />
in Deutschland. Stand und Trends im außerschulischen Bereich. Berlin: Springer<br />
DE HAAN, GERHARD/HARENBERG, DOROTHEE (1999): Bildung für eine nachhaltige<br />
Entwicklung. Bonn: Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung<br />
(BLK)<br />
DE HAAN, GERHARD/KAMP, GEORG/LERCH, ACHIM/MARTIGNON, LAURA/MÜLLER-<br />
CHRIST, GEORG/NUTZINGER, HANS-GEORG (Hrsg., 2008): Nachhaltigkeit und<br />
Gerechtigkeit. Grundlagen und schulpraktische Konsequenzen. Berlin, Heidelberg:<br />
Springer<br />
DEUTSCHE KINDER- UND JUGENDSTIFTUNG (o.J.): Unser Chef geht in die 9b.<br />
DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION (2003): Nachhaltigkeit lernen: Hamburger Erklärung<br />
der Deutschen UNESCO-Kommission zur Dekade der Vereinten Nationen<br />
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014). Online-Dokument;<br />
URL: http://www.unesco.de/hamburger_erklaerung.html, zuletzt überprüft:<br />
10.8.<strong>2011</strong><br />
DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION (2005): Nationaler Aktionsplan für Deutschland.<br />
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Berlin<br />
188
6 Quellenverzeichnis<br />
DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION (2008): Nationaler Aktionsplan für Deutschland.<br />
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Berlin<br />
DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION (o.J.a): Maßnahmenkatalog nach Bildungsbereichen.<br />
Online-Dokument; URL: http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/02__UN-Dekade_20<strong>BNE</strong>/02__UN__Dekade__Deutschland/<br />
05__Dekade-Publikationen/<br />
Ma_C3_9Fnahmenkatalog_20nach_20Bildungsbereichen.html, zuletzt überprüft:<br />
18.7.<strong>2011</strong><br />
DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION (o.J.b): Ausgezeichnete Dekade-Projekte. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/<br />
de/02__UN-Dekade_20<strong>BNE</strong>/02__UN__Dekade__Deutschland/02__Dekade-<br />
Projekte/Ausgezeichnte_20Offizielle_20Dekade-Projekte.html, zuletzt überprüft:<br />
18.7.<strong>2011</strong><br />
DEUTSCHER BUNDESTAG (1972): Gesetz über die Beseitigung von Abfällen vom 10.<br />
Juni 1972, BGBl. 1972 I S. 873<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG (1986): Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von<br />
Abfällen vom 27. August 1986, BGBl. 1986 I, S. 1410, ber. durch BGBl. 1986<br />
I, S. 1501<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG (1994): Die Industriegesellschaft gestalten: Perspektiven für<br />
einen nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen. Bericht der<br />
Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“. Bonn: Economica<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG (1998): Konzept Nachhaltigkeit – Abschlussbericht der<br />
Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des 13. Deutschen<br />
Bundestages. Bonn<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG (2000): Beschluss „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“<br />
Bundestagsdrucksache 14/3319<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG (2005): Bericht der Bundesregierung zur Bildung für eine<br />
nachhaltige Entwicklung für den Zeitraum 2002 bis 2005. Drucksache 15/6012<br />
DEUTSCHER TASCHENBUCH VERLAG: dtv-Lexikon: in 24 Bänden, Bd. 17. München<br />
DEWEY, JOHN (1993): Demokratie und Erziehung. Weinheim/Basel<br />
DIECKMANN, ANNETTE/PAULSEN, BIRGIT (2003): Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
in Umweltzentren – Projektbericht. Berlin: UNESCO-Verbindungsstelle<br />
im Umweltbundesamt<br />
DIDY, H.J./FAY, E./KLOFT, C./VOGT, H. (1993): Einschätzungen von Schlüsselqualifikationen<br />
aus psychologischer Perspektive. Unveröffentlichtes Gutachten im<br />
Auftrag des Bundesinstituts für Berufsbildung. Bonn: Institut für Bildungsforschung.<br />
Zitiert nach: GISBERT, KRISTIN (2004): Lernen lernen. Lernmethodische<br />
Kompetenzen von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Weinheim und<br />
Basel: Beltz. S. 35<br />
189
6 Quellenverzeichnis<br />
DIE BUNDESREGIERUNG (1971): Umweltprogramm der Bundesregierung. BT-Drs. 4/<br />
2710<br />
DIE BUNDESREGIERUNG (2002): Perspektiven für Deutschland. Unsere Strategie für<br />
eine nachhaltige Entwicklung. Online-Dokument; URL: http://www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/__Anlagen/2006-2007/perspektiven-fuerdeutschland-langfassung,property=publicationFile.pdf/perspektiven-fuerdeutschland-langfassung,<br />
zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
DIE BUNDESREGIERUNG (2004): Perspektiven für Deutschland – Fortschrittsbericht<br />
2004. Online-Dokument; URL: http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/fortschrittsbericht_2004.pdf,<br />
zuletzt überprüft: 10.7.<strong>2011</strong><br />
DIE BUNDESREGIERUNG (2005): Wegweiser Nachhaltigkeit – Bilanz und Perspektiven;<br />
Kabinettsbeschluss vom 10. August 2005. Online-Dokument; URL:<br />
www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/<br />
wegweiser_nachhaltigkeit.pdf, zuletzt überprüft: 10.7.<strong>2011</strong><br />
DIE BUNDESREGIERUNG (2008): Für ein nachhaltiges Deutschland – Fortschrittsbericht<br />
2008 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie; Berlin, 2008. Online-Dokument;<br />
URL: www.bundesregierung.de/Content/DE/Publikation/<br />
Bestellservice/__Anlagen/2008-11-17-fortschrittsbericht-2008,property=publicationFile.pdf,<br />
zuletzt überprüft: 10.7.<strong>2011</strong><br />
DÖRFLER, MARIANNE/DÖRFLER, ERNST (1989): Zurück zur Natur? Leipzig, Jena,<br />
Berlin: Urania-Verlag. 2. Auflage<br />
DUDENVERLAG (Hrsg., 2006): Das Fremdwörterbuch. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich<br />
DÜSSELDORFER NETZWERK BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: Interne<br />
Mitteilungen und Protokolle der Netzwerktreffen<br />
DÜSSELDORFER NETZWERK BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (2008): Archiv<br />
2008. Online-Dokument; URL: http://www.umweltschulen.de/audit/<br />
duesseldorf/archiv_2008.html, zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
DÜSSELDORFER NETZWERK BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (2009): Archiv<br />
2009. Online-Dokument; URL: http://www.umweltschulen.de/audit/<br />
duesseldorf/archiv_2009.html, zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
DÜSSELDORFER NETZWERK BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (2010): Papierwende<br />
- die Ausstellung von ARA in Düsseldorf. Online-Dokument; URL:<br />
http://www.umweltschulen.de/audit/duesseldorf/archiv_papierausstellung.html,<br />
zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
DÜSSELDORFER NETZWERK BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (<strong>2011</strong>a):<br />
Nachhaltigkeit in Schulen – Kompetenzen. Online-Dokument; URL: http://<br />
www.umweltschulen.de/audit/duesseldorf/einf_kompetenzen.html, zuletzt<br />
überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
DÜSSELDORFER NETZWERK BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (<strong>2011</strong>b):<br />
Nachhaltigkeit in Schulen – Themen. Online-Dokument; URL: http://<br />
190
6 Quellenverzeichnis<br />
www.umweltschulen.de/audit/duesseldorf/einf_themen.html, zuletzt überprüft:<br />
25.7.<strong>2011</strong><br />
DÜX, WIEBKEN/SASS, ERICH (2009): Kompetenzerwerb Jugendlicher durch ein freiwilliges<br />
Engagement. In: BRODOWSKI, MICHAEL et.al (Hrsg.): Informelles<br />
Lernen und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Opladen & Farmington<br />
Hills, MI: Verlag Barbara Budrich. S. 169-180<br />
EBLINGHAUS, H./STICKLER, A. (1998): Nachhaltigkeit und Macht. Zur Kritik von Sustainable<br />
Development. Frankfurt: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation,<br />
3. Auflage<br />
EDUCATION GROUP GMBH (Hrsg., <strong>2011</strong>): Ökologischer Fußabdruck. Online-Dokument;<br />
URL: http://schule.at/index.php?url=themen&top_id=3591, zuletzt<br />
überprüft: 8.7.<strong>2011</strong><br />
EG (1993): Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates vom 29. Juni 1993 über die<br />
freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem<br />
für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung. Abl. EG<br />
Nr. L 168 S. 1 ber. Abl. EG 1995 Nr. L 203 S. 17<br />
EG (2001): Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates<br />
vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an<br />
einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung<br />
(EMAS). Abl. EG Nr. L 114/1 vom 24, 4, 2001<br />
EG (2009): Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des<br />
Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen<br />
an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung<br />
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie<br />
der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG<br />
EINE-WELT-LANDESNETZWERK MV E.V. (<strong>2011</strong>): Das Blatt wenden! Online-Dokument;<br />
URL: http://www.papierkoffer.de/, zuletzt überprüft: 9.8.<strong>2011</strong><br />
EINSTEIN, ALBERT (o.J.), zitiert nach: Human Culture Academy. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.hc-academy.com/HCA_DE/zitate.html, zuletzt überprüft:<br />
10.8.<strong>2011</strong><br />
ELSCHENBROICH, DONATA (2001): Weltwissen der Siebenjährigen. München: Verlag<br />
Antje Kunstmann<br />
FAIRTRADE DEUTSCHLAND (2009): 50 Prozent Plus für Fairtrade. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.fairtrade-deutschland.de/nc/top/presse/archiv-pressemitteilungen/detailseite-archiv-pressemeldungen/browse/9/article/50-prozent-plusfuer-fairtrade.html?tx_ttnews[pS]=1310580771&tx_ttnews[back-<br />
Pid]=139&cHash=a22e7aa331bbf61550f04deab76e949d , zuletzt überprüft:<br />
14.7.<strong>2011</strong><br />
FAIRTRADE DEUTSCHLAND (2010): Fairtrade wächst weltweit. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.fairtrade-deutschland.de/nc/top/presse/archiv-pressemitteilungen/detailseite-archiv-pressemeldungen/browse/2/article/fairtradewaechst-weltweit.html?tx_ttnews[pS]=1310580771&tx_ttnews[back-<br />
191
6 Quellenverzeichnis<br />
Pid]=139&cHash=f9e581d0d36b54b863e91f98d0aaa799 , zuletzt überprüft:<br />
14.7.<strong>2011</strong><br />
FAULSTICH-WIELAND, HANNELORE/FAULSTICH, PETER (Hrsg., 2008): Erziehungswissenschaft.<br />
Ein Grundkurs. Rowohlt.<br />
FAURE, EDGAR et.al. (1973): Wie wir leben lernen. Der UNESCO-Bericht über Ziele<br />
und Zukunft unserer Erziehungsprogramme. Reinbek. Zitiert nach: OVER-<br />
WIEN, BERND (2009): Informelles Lernen. Definitionen und Forschungsansätze.<br />
In: BRODOWSKI, MICHAEL et.al (Hrsg.): Informelles Lernen und Bildung<br />
für eine nachhaltige Entwicklung. Opladen & Farmington Hills, MI: Verlag<br />
Barbara Budrich. S. 23-34<br />
FISCHER, ANDREAS (1997): Bildung für nachhaltige Entwicklung. Rostock: Universität<br />
Rostock<br />
FISCHER, ANDREAS (2000): Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im sozial- und<br />
wirtschaftswissenschaftlichen Unterrricht (Einleitung). In: sowi-onlinejournal<br />
1 (2000). Online-Dokument; URL: http://www.sowi-onlinejournal.de/nachhaltigkeit/einl.htm,<br />
zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG – Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt –<br />
Projektstelle Nachhaltige Entwicklung (Hrsg., 2005): Hamburger Aktionsplan<br />
(HHAP) 2005/2006 der Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit zur Unterstützung<br />
der UN-Dekade Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (2005-2014).<br />
Online-Dokument; URL: http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/<br />
unesco/de/Downloads/Dekade__Publikationen__national/<br />
Hamburger_20Aktionsplan_202005.pdf, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN, ARBEITSBEREICH ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHE ZU-<br />
KUNFTSFORSCHUNG,<br />
PROGRAMM TRANSFER-21 (2007): Orientierungshilfe Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung in der Sekundarstufe I. Begründungen, Kompetenzen, Lernangebote.<br />
Berlin<br />
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN, ARBEITSBEREICH ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHE ZU-<br />
KUNFTSFORSCHUNG,<br />
PROGRAMM TRANSFER-21 (o.J.): Gestaltungskompetenz. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.transfer-21.de/index.php?p=222, zuletzt überprüft:<br />
10.8.<strong>2011</strong><br />
FTHENAKIS, WASSILIOS E. (2010): Implikationen und Impulse für die Weiterentwicklung<br />
von Bildungsqualität in Deutschland. In: FTHENAKIS, WASSILIOS E./<br />
OBERHUEMER, PAMELA (Hrsg.): Frühpädagogik international. Wiesbaden: VS<br />
Verlag für Sozialwissenschaften. 2. Auflage. S. 13-30<br />
GARDNER,GARY (2010a): Religionen im Dienste der Nachhaltigkeit. In: Worldwatch<br />
Institute (Hrsg.): Zur Lage der Welt 2010. Einfach besser leben. München:<br />
oekom. S. 60-69<br />
GARDNER,GARY (2010b): Ritual und Tabu als Schutzengel der Ökologie. In: Worldwatch<br />
Institute (Hrsg.): Zur Lage der Welt 2010. Einfach besser leben. München:<br />
oekom. S. 70-77<br />
192
6 Quellenverzeichnis<br />
GERMANWATCH REGIONALGRUPPE HAMBURG (1996): Lokal handeln – global denken.<br />
Zukunftsfähige City? Hamburg und die Agenda 21. Hamburg: Konkret<br />
Literatur Verlag.<br />
GESAMTSCHULE SCHWERTE (1997a): Gesamtschule Schwerte – Öko-Audit 1997. Online-Dokument;<br />
URL: www.umweltschulen.de/audit/schwerte/1997.html, zuletzt<br />
überprüft: 1.8.<strong>2011</strong><br />
GESAMTSCHULE SCHWERTE (1997b): Gesamtschule Schwerte – Öko-Audit-Prozess<br />
1997. Online-Dokument; URL: www.umweltschulen.de/audit/schwerte/<br />
1997_prozess.html, zuletzt überprüft: 1.8.<strong>2011</strong><br />
GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM DÜSSELDORF (2004): Geschwister-Scholl-<br />
Gymnasium: Müll vermeiden oder trennen. Papier - Herstellung, Verbrauch,<br />
Recycling. Online-Dokument; URL: http://www.umweltschulen.de/audit/<br />
scholl/muell_papier.html, zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM DÜSSELDORF (<strong>2011</strong>): Eine Welt Projekt. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.umweltschulen.de/audit/scholl/einewelt.html,<br />
zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM DÜSSELDORF (o.J.): Geschwister-Scholl-Gymnasium:<br />
Wassermonat März in Jahrgangsstufe 8. Online-Dokument; URL: http://www.umweltschulen.de/audit/scholl/wasser_monat.html,<br />
zuletzt<br />
überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
GIESEL, KATHARINA D./DE HAAN, GERHARD/RODE, HORST (2001): Außerschulische<br />
Umweltbildung in Zahlen. Die Evaluationsstudie der Deutschen Bundesstiftung<br />
Umwelt. Berlin: Erich-Schmidt-Verlag<br />
GISBERT, KRISTIN (2004): Lernen lernen. Lernmethodische Kompetenzen von Kindern<br />
in Tageseinrichtungen fördern. Weinheim und Basel: Beltz<br />
GÖLL, EDGAR (2009): Lokale Agenda 21 und informelles Lernen. In: BRODOWSKI,<br />
MICHAEL et.al (Hrsg.): Informelles Lernen und Bildung für eine nachhaltige<br />
Entwicklung. Opladen & Farmington Hills, MI: Verlag Barbara Budrich. S.<br />
75-84<br />
GOMM, EKKEHARD/WILLKE, KLAUS (2000): Indikatoren für eine zukunftsfähige Hansestadt.<br />
In: GERMANWATCH REGIONALGRUPPE HAMBURG (Hrsg.): Agenda 21.<br />
Hamburgs mühsamer Weg ins 21. Jahrhundert. Dritter Nord-Süd WatchBericht.<br />
Hamburg. S. 30-53<br />
GÖPFERT, HANS (1987): Naturbezogene Pädagogik. Weinheim: Beltz. 2. Auflage<br />
GRABOLLE, ANDREAS/LOITZ, TANJA (2007): Pendos CO 2 -Zähler. co2online gGmbH<br />
(Hrsg.). Pendos: München und Zürich. 2. Auflage<br />
GRUHL, HERBERT (1975): Ein Planet wird geplündert. Die Schreckensbilanz unserer<br />
Politik. Frankfurt am Main: Fischer<br />
GRUNENBERG, HEIKO/KUCKARTZ, UDO (2005): Umweltbewusstsein. Empirische Erkenntnisse<br />
und Konsequenzen für die Nachhaltigkeitskommunikation. In: MI-<br />
193
6 Quellenverzeichnis<br />
CHELSEN, GERD/GODEMANN, JASMIN (Hrsg.): Handbuch<br />
Nachhaltigkeitskommunikation. München: oekom. S. 196-206<br />
GRUNWALD, ARMIN/KOPFMÜLLER, JÜRGEN (2006): Nachhaltigkeit. Frankfurt/Main:<br />
Campus<br />
HANSESTADT LÜBECK (2007): Agenda 21 Lübeck. Online-Dokument; URL: http://<br />
www.luebeck.de/stadt_politik/rathaus/agenda/luebeck/publikationen.html,<br />
zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
HANSESTADT STRALSUND (2009a): Hansestadt Stralsund beruft Klimarat. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.stralsund.de/hst01/content1.nsf/docname/<br />
832801562007C920C125758B00360EB3?OpenDocument, zuletzt überprüft:<br />
25.7.<strong>2011</strong><br />
HANSESTADT STRALSUND (2009b): Stralsund gehört zum Klima-Bündnis. Online-<br />
Dokument; URL: http://www.stralsund.de/hst01/content1.nsf/docname/<br />
0703449A018F7C9BC1257650005A99A1?OpenDocument, zuletzt überprüft:<br />
25.7.<strong>2011</strong><br />
HANSESTADT STRALSUND (2010): Klimaschutzkonzept der Hansestadt Stralsund. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.stralsund.de/hst01/ressourcen.nsf/docname/Ressourcen_0C950F3C34F47C0FC125789A005500D9/$File/<br />
Klimaschutzkonzept.pdf?OpenElement, zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
HAUFF, VOLKER (Hrsg., 1987): Unsere Gemeinsame Zukunft: Der Brundtlandbericht<br />
der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Greven.<br />
HÄUSLER, RICHARD (2004): Erfundene Umwelt. Das Konstruktivismus-Buch für<br />
Öko- und andere Pädagogen. München: oekom<br />
HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG (2002): Das Jo´burg Memo. Ökologie – die neue Farbe der<br />
Gerechtigkeit. Memorandum zum Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung.<br />
Berlin. 2. Auflage der deutschen Ausgabe<br />
HEITMEYER, WILHELM (1997): Was treibt die Gesellschaft auseinander? Bundesrepublik<br />
Deutschland: Auf dem Weg von der Konsens- in die Konfliktgesellschaft.<br />
Frankfurt/Main: Suhrkamp. Zitiert nach: MAROTZKI, WINFRIED (2003): Bildungstheorie<br />
und neue Medien. Rostock: Universität Rostock<br />
HOFFMANN, LUTZ/MÜLLER, K.-P. (Hrsg., 1992): Öffentlichkeitsarbeit in der Abfallwirtschaft.<br />
Grundlagen / Umsetzungen / Wirkungen. Sehnde: Büro für Umwelt-Pädagogik<br />
HULDA-PANKOK-GESAMTSCHULE (2002): Schul-Check Nachhaltigkeit 2001. Düsseldorf<br />
HULDA-PANKOK-GESAMTSCHULE (<strong>2011</strong>): Schulgelände. Online-Dokument; URL:<br />
http://www.umweltschulen.de/audit/hpg/gelaende.html, zuletzt überprüft:<br />
25.7.<strong>2011</strong><br />
HUMBOLDT, WILHELM VON (1782/1980): Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der<br />
Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. In: FLITNER, A. V./GIEL, K. (Hrsg.):<br />
Humboldt, Werke in fünf Bänden. Bd 1. Darmstadt 1980<br />
194
6 Quellenverzeichnis<br />
HUMM, HANSRUEDI (2003): Wie gesellschaftliches Lernen zur Lust wird... In: LEY,<br />
ASTRID/WEITZ, LUDWIG (Hrsg.): Praxis Bürgerbeteiligung. Ein Methodenhandbuch.<br />
Bonn: Verlag Stiftung Mitarbeit / Agenda Transfer. S. 207-211<br />
HÜTTERMANN, ALOYS: Nachhaltige Entwicklung im Alten Testament. In: Wir und<br />
unsere Umwelt 2/1997 S. 22-23<br />
ICLEI (1994): Charta der Europäischen Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit<br />
(Charta von Aalborg). Online-Dokument; URL: http://<br />
www.apug.de/archiv/pdf/aalborg_charta.pdf, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
ICLEI (1998): Handbuch Lokale Agenda 21. Bonn: Bundesumweltministerium und<br />
Berlin: Umweltbundesamt<br />
ICLEI (<strong>2011</strong>): Rio+20: Towards the UN Conference on Sustainable Development<br />
2012. Online-Dokument; URL: http://iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Global/News_Items/Image_Documents_web_news_11/<br />
Rio_20_Briefing_Sheet_ICLEI.pdf, zuletzt überprüft: 1.11.2007<br />
JONASSEN, D. H. (1994): Learning with media: Restructuring the debate. In: Educational<br />
Tech-nology Research and Development, 42 (2) S. 31-39<br />
JUNGK, ROBERT/MÜLLERT, NORBERT (1985): Zukunftswerkstätten. Wege zur Wiederbelebung<br />
der Demokratie. München: Goldmann<br />
KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ESSENER STRAßE (2005): Eine Welt im Religionsunterricht.<br />
Online-Dokument; URL: http://www.umweltschulen.de/audit/kgs/einewelt.htm,<br />
zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
KIBBEL, HANS ULRICH/MÜLLER, JOHANNES (2002): Lokale Agenda 21. Rostock:<br />
Universität Rostock<br />
KLAFKI, WOLFGANG (1985): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim/Basel<br />
KLIMA-BÜNDNIS (<strong>2011</strong>): Unsere Ziele. Online-Dokument; URL: http://www.klimabuendnis.org/our-objectives0.html?&L=1,<br />
zuletzt überprüft: 27.7.<strong>2011</strong><br />
KMK/BMZ 2007: Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung im<br />
Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Online-Dokument; URL:<br />
http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/Downloads/<br />
Hintergrundmaterial__national/<br />
Orientierungsrahmen_20f_C3_BCr_20den_20Lernbereich_20Globale_20Ent<br />
wicklung.pdf, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
KMK/DUK (2007): Empfehlung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der<br />
Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) und der Deutschen<br />
UNESCO-Kommission (DUK) vom 15.06.2007 zur „Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung in der Schule“.<br />
KREUZINGER, STEFFI/ UNGER, HARALD (1999): Agenda 21. Wir bauen unsere Zukunft.<br />
Eine Mitmach-, Ideen- und Werkzeugkiste für Kinder und Jugendliche.<br />
Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr<br />
195
6 Quellenverzeichnis<br />
KRÜGER, M./PRIEBE, G. (o.J.): Die Gesellschaft für Natur und Umwelt stellt sich vor.<br />
In: Natur und Umwelt in Halle. Informationsblatt 16<br />
KRUSE, LENELIS (2005): Nachhaltigkeitskommunikation und mehr: die Perspektive<br />
der Psychologie. In: MICHELSEN, GERD/GODEMANN, JASMIN (2005): Handbuch<br />
Nachhaltigkeitskommunikation. München, oekom. S. 109-120<br />
KUCKARTZ, UDO (2000): Umweltbewusstsein in Deutschland. Ergebnisse einer repräsentativen<br />
Bevölkerungsumfrage. Berlin: Bundesumweltministerium<br />
KUHN, CHRISTOPH (1996): „Inoffiziell wurde bekannt...“. Maßnahmen des Ministeriums<br />
für Staatssicherheit gegen die Ökologische Arbeitsgruppe beim Kirchenkreis<br />
Halle. Gutachten zum Operativen Vorgang „Heide“. Magdeburg: Der<br />
Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen<br />
DDR in Sachsen-Anhalt (Hrsg.)<br />
KULTUSMINISTERKONFERENZ (1953): Beschluss der Kultusministerkonferenz vom<br />
30.9.1953 „Naturschutz und Landschaftspflege sowie Tierschutz“. Zitiert<br />
nach: BOLSCHO, DIETMA/SEYBOLD, HANSJÖRG (1996): Umweltbildung und<br />
ökologisches Lernen: Ein Studien- und Praxisbuch. Berlin: Cornelsen Scriptor.<br />
S. 80<br />
KULTUSMINISTERKONFERENZ (1980): Umwelt und Unterricht. Beschluss der Kultusministerkonferenz<br />
vom 17.10.1980. Online-Dokument; URL: http://<br />
www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1980/<br />
1980_10_17_Umwelt_Unterricht.pdf, zuletzt überprüft: 8.8.<strong>2011</strong><br />
KULTUSMINISTERKONFERENZ (2002): Bewertung der bundesinternen Leistungsvergleiche<br />
- PISA-E. Berlin. Online-Dokument; URL: http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2002/strateg.pdf,<br />
zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
KULTUSMINISTERKONFERENZ (2005a, Hrsg.): Bildungsstandards im Fach Biologie für<br />
den Mittleren Schulabschluss Beschluss vom 16.12.2004. München, Neuwied:<br />
Luchterhand<br />
KULTUSMINISTERKONFERENZ (2005b, Hrsg.): Bildungsstandards im Fach Chemie für<br />
den Mittleren Schulabschluss Beschluss vom 16.12.2004. München, Neuwied:<br />
Luchterhand<br />
KULTUSMINISTERKONFERENZ (2005c, Hrsg.): Bildungsstandards im Fach Physik für<br />
den Mittleren Schulabschluss Beschluss vom 16.12.2004. München, Neuwied:<br />
Luchterhand<br />
KURTZ, KLAUS (2005): Managementsystem „Nachhaltigkeits-Audit“. Vortrag auf der<br />
Informationsveranstaltung der Lokalen Agenda 21 in Düsseldorf und des<br />
NRW-Modellversuchs Agenda 21 in Schule und Jugendarbeit mit dem Titel<br />
Nachhaltig fit für die Zukunft Wege zur Verbesserung von Unterrichtsqualität,<br />
Schulkultur und Schulorganisation am 26. Januar 2005 in Düsseldorf. Online-<br />
Dokument; URL: www.umweltschulen.de/download/n_schulquali.pdf , zuletzt<br />
überprüft 10.8.<strong>2011</strong><br />
LAININEN, ERKKA (2010): Sustainable development criteria and certification system<br />
for educational establishments in Finland. Vortrag auf dem Internationalen Forum<br />
des Projekts EGS am 8.3.2010 in Järvenpää/Finnland. Online-Dokument;<br />
196
6 Quellenverzeichnis<br />
URL: www.umweltschulen.de/download/20100308_sd_certification.pdf, zuletzt<br />
überprüft: 17.7.<strong>2011</strong><br />
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF (o.J. a): Lokale Agenda 21 – Chronik. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.duesseldorf.de/agenda21/infos/chronik.shtml, zuletzt<br />
überprüft 10.8.<strong>2011</strong><br />
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF (o.J. b): Lokale Agenda 21 – Struktur. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.duesseldorf.de/agenda21/infos/struktur.shtml, zuletzt<br />
überprüft 10.8.<strong>2011</strong><br />
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF (o.J. c): Lokale Agenda 21 – Projekte. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.duesseldorf.de/agenda21/projekte/index.shtml, zuletzt<br />
überprüft 10.8.<strong>2011</strong><br />
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF (o.J. d): 50: 50. Online-Dokument; URL: http://<br />
www.duesseldorf.de/umweltamt/energie/energieprojekt50_50/index.shtml,<br />
zuletzt überprüft 10.8.<strong>2011</strong><br />
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF (o.J. e): Schulliste. Online-Dokument; URL: http://www.duesseldorf.de/umweltamt/energie/energieprojekt50_50/<br />
adressen_schulen.shtml, zuletzt überprüft 10.8.<strong>2011</strong><br />
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF (o.J. f): "Prima Klima": 23. Eine-Welt-Tage Düsseldorf.<br />
Online-Dokument; URL: http://www.duesseldorf.de/presse/pld/<br />
d2007/d2007_07/d2007_07_19/p22931.shtml. Zuletzt überprüft 10.8.<strong>2011</strong><br />
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF (o.J. g): Entente Florale. Online-Dokument; URL:<br />
http://www.duesseldorf.de/entente_florale/index.shtml, zuletzt überprüft<br />
10.8.<strong>2011</strong><br />
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF (o.J. h): Düsseldorf ist "Hauptstadt des Fairen<br />
Handels". Online-Dokument; URL: http://www.duesseldorf.de/agenda21/aktuell/hauptstadt_des_fairen_handels.shtml,<br />
zuletzt überprüft 10.8.<strong>2011</strong><br />
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF (o.J. i): Energieeinsparung in Schulen. Online-<br />
Dokument; URL: http://www.duesseldorf.de/umweltamt/energie/schulprojekte/schulen2.shtml,<br />
zuletzt überprüft 10.8.<strong>2011</strong><br />
LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF (2008): Klassenziel Klimaschutz. Düsseldorf<br />
LANDESINSTITUT FÜR LEHRERBILDUNG UND SCHULENTWICKLUNG (<strong>2011</strong>): Klimaschutz<br />
an Schulen. Online-Dokument; URL: http://www.li-hamburg.de/klimaschutz/,<br />
zuletzt überprüft: 23.7.<strong>2011</strong><br />
LANGNER, TILMAN (1998): Umweltschutz in Schulen. Pöglitz: Umweltbüro Nord e.V.<br />
LANGNER, TILMAN (2005): Computerspiele und Simulationen in der Umweltbildung.<br />
In: APEL, HEINO/WOLF, GERTRUD: Multimedia in der Umweltbildung. Wiesbaden:<br />
VS Verlag für Sozialwissenschaften<br />
LANGNER, TILMAN (<strong>2011</strong>): Klimadetektive in der Schule. Stralsund: Umweltbüro<br />
Nord e.V. 2. Auflage<br />
197
6 Quellenverzeichnis<br />
LANGNER, TILMAN (<strong>2011</strong>a): Footprint- und Klimaschutzrechner im Internet. Online-<br />
Dokument; URL: http://www.umweltschulen.de/net/footprintrechner.html,<br />
zuletzt überprüft: 1.8.<strong>2011</strong><br />
LANGNER, TILMAN (<strong>2011</strong>b): Umwelt- und Nachhaltigkeitszertifizierung für Bildungseinrichtungen<br />
in Finnland. Online-Dokument; URL: www.umweltschulen.de/<br />
audit/nachhaltigkeitszertifizierung-finnland.html, zuletzt überprüft: 1.8.<strong>2011</strong><br />
LANGNER, TILMAN (<strong>2011</strong>c): Schulqualität und nachhaltige Entwicklung. Weitere Managementsysteme.<br />
Online-Dokument; URL: www.umweltschulen.de/audit/<br />
managementsysteme.html, zuletzt überprüft: 1.8.<strong>2011</strong><br />
LANGNER, TILMAN (<strong>2011</strong>d): Zehn Schritte zum Audit. Online-Dokument; URL:<br />
www.umweltschulen.de/audit/duesseldorf/ne_steps.html, zuletzt überprüft:<br />
1.8.<strong>2011</strong><br />
LANGNER, TILMAN (<strong>2011</strong>e): Fishbanks, Ltd. Online-Dokument; URL: www.umweltschulen.de/net/fishbanks.html,<br />
zuletzt überprüft: 1.8.<strong>2011</strong><br />
LANGNER, TILMAN (<strong>2011</strong>f): ecopolicy®. Online-Dokument; URL: www.umweltschulen.de/net/ecopolicy.html,<br />
zuletzt überprüft: 1.8.<strong>2011</strong><br />
LANGNER, TILMAN (<strong>2011</strong>g): triCO2lor. Online-Dokument; URL: www.umweltschulen.de/net/trico2lor.html,<br />
zuletzt überprüft: 1.8.<strong>2011</strong><br />
LANGNER, TILMAN (<strong>2011</strong>h): Klimaschutz im Fachunterricht. Online-Dokument;<br />
URL: www.umweltschulen.de/klima/fachunterricht.html, zuletzt überprüft:<br />
1.8.<strong>2011</strong><br />
LANGNER, TILMAN (<strong>2011</strong>i): Finanzielle Instrumente zum sparsamen Umgang mit<br />
Ressourcen. Online-Dokument; URL: www.umweltschulen.de/energie/<br />
negawatt2.html, zuletzt überprüft: 18.7.<strong>2011</strong><br />
LANGNER, TILMAN (<strong>2011</strong>j): Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz in der Hansestadt<br />
Stralsund. Online-Dokument; URL: http://www.umweltschulen.de/umweltbuero/klimaschutz_hansestadt_stralsund.html,<br />
zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
LEGGETT, JEREMY (2006): Peak Oil. Köln: Kiepheuer & Witsch<br />
LEMPERS, J.D./FLAVELL, E.R./FLAVELL, J.H. (1977): The development in very young<br />
children of tacit knowledge concerning visual perception. Genetic Psychology<br />
Monographs 95, S. 3-53<br />
LEUCHTPOL (o.J. a): Konzept und Ziele. Online-Dokument; URL: http://www.leuchtpol.de/ueber-leuchtpol/konzept-und-ziele/,<br />
zuletzt überprüft: 29.7.<strong>2011</strong><br />
LEUCHTPOL (o.J. b): Kitas geht raus – und macht was draus. Online-Dokument; URL:<br />
http://www.leuchtpol.de/aktionen-und-projekte/wettbewerb/, zuletzt überprüft:<br />
29.7.<strong>2011</strong><br />
LEUCHTPOL (o.J. c): Über Leuchtpol. Online-Dokument; URL: http://www.leuchtpol.de/ueber-leuchtpol/,<br />
zuletzt überprüft: 29.7.<strong>2011</strong><br />
198
6 Quellenverzeichnis<br />
LEY, ASTRID/WEITZ, LUDWIG (Hrsg., 2003): Praxis Bürgerbeteiligung. Ein Methodenhandbuch.<br />
Bonn: Verlag Stiftung Mitarbeit / Agenda Transfer<br />
LIVINGSTONE, DAVID W. (1999): Informelles Lernen in der Wissensgesellschaft. In:<br />
ARBEITSGEMEINSCHAFT<br />
QUALIFIKATIONS-ENTWICKLUNGS-MANAGEMENT<br />
(QUEM): Kompetenz für Europa – Wandel durch Lernen – Lernen im Wandel.<br />
Berlin, S. 65-92. Zitiert nach: OVERWIEN, BERND (2009): Informelles Lernen.<br />
Definitionen und Forschungsansätze. In: BRODOWSKI, MICHAEL et.al (Hrsg.):<br />
Informelles Lernen und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Opladen &<br />
Farmington Hills, MI: Verlag Barbara Budrich. S. 23-34<br />
LUBW LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-<br />
WÜRTTEMBERG (2009): Leitfaden Indikatoren im Rahmen einer Lokalen<br />
Agenda 21. Vierte, überarbeitete und erweiterte Auflage. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/57770/, zuletzt<br />
überprüft: 26.7.<strong>2011</strong><br />
MANIATES, MICHAEL (2010): Die gelenkte Wahl. Wie man nachhaltiges Verhalten<br />
steuern kann. In: Worldwatch Institute (Hrsg.): Zur Lage der Welt 2010. Einfach<br />
besser leben. Nachhaltigkeit als neuer Lebensstil. München: oekom. S.<br />
176-186<br />
MAROTZKI, WINFRIED (2003): Bildungstheorie und neue Medien. Rostock: Universität<br />
Rostock<br />
MAX-WEBER-BERUFSKOLLEG UND WALTER-EUCKEN-BERUFSKOLLEG (2001): Verkehr.<br />
Online-Dokument; URL: www.umweltschulen.de/audit/webeuck/2001/<br />
verkehr.htm, zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
MAX-WEBER-BERUFSKOLLEG UND WALTER-EUCKEN-BERUFSKOLLEG (2006): Verkehr.<br />
Online-Dokument; URL: www.umweltschulen.de/audit/webeuck/2006/<br />
verkehr.htm, zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
MEADOWS, DENNIS L./MEADOWS, DONELLA H./ZAHN, ERICH/MILLING, PETER<br />
(1972): Die Grenzen des Wachstums: Bericht des Club of Rome zur Lage der<br />
Menschheit. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt<br />
MEADOWS, DONELLA H./RANDERS, JØRGEN/MEADOWS, DENNIS L. (2007): Grenzen<br />
des Wachstums. Das 30-Jahre-Update. Stuttgart: S. Hirzel. 2., ergänzte Auflage<br />
MICHELSEN, GERD/KUNST, SABINE/MERTINEIT, KLAUS-DIETER/SCHULZ, THOMAS et.<br />
al. (1986): Öko-Werkstatt. Modell einer Mitarbeiterfortbildung für Erwachsenenbildner.<br />
Berlin: UNESCO-Verbdindungsstelle für Umwelterziehung im<br />
Umweltbundesamt<br />
MICHELSEN, GERD (2005): Nachhaltigkeitskommunikation: Verständnis – Entwicklung<br />
– Perspektiven. In: MICHELSEN, GERD/GODEMANN, JASMIN (Hrsg.):<br />
Handbuch Nachhaltigkeitskommunikation. München: oekom. S. 25-41<br />
MILANOVIC, BRANKO (2005): Worlds Apart: Global and International Inequality<br />
1950-2000. Princeton<br />
199
6 Quellenverzeichnis<br />
MILLENIUM-KAMPAGNE (<strong>2011</strong>): Die UN-Milleniumentwicklungsziele. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.un-kampagne.de/index.php?id=90, zuletzt überprüft:<br />
10.8.<strong>2011</strong><br />
MILKE, KLAUS/ROSTOCK, STEFAN 2010: Trotz Kopenhagen – auf vielen schnellen<br />
Wegen zu neuen Gewohnheiten. In: Worldwatch Institute (Hrsg.): Zur Lage<br />
der Welt 2010. Einfach besser leben. Nachhaltigkeit als neuer Lebensstil. München:<br />
oekom. S. 16-25<br />
MINISTERIUM FÜR MATERIALWIRTSCHAFT: (1986) Sekundärrohstoffwirtschaft. Berlin:<br />
Staatsverlag der DDR<br />
MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND VERKEHR DES SAARLANDES (1996): Bericht<br />
zur Umweltprüfung für das Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr<br />
des Saarlandes. Saarbrücken<br />
MURSWIEK, DIETRICH (2002): „Nachhaltigkeit“ - Probleme der rechtlichen Umsetzung<br />
eines umweltpolitischen Leitbildes. In: NuR 2002, S. 641-648<br />
NUSSBAUM, MARTHA (2003): Frauen und Arbeit – der Fähigkeitenansatz. In: Zeitschrift<br />
für Wirtschafts- und Unternehmensethik, Jg. 4, S. 8-30<br />
NUTZINGER, H. G.; ZAHRNT, A. (Hrsg., 1989): Öko-Steuern. Umweltsteuern und -abgaben<br />
in der Diskussion. Karlsruhe: Verlag. C.F. Müller<br />
OECD (2005): Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen. Zusammenfassung.<br />
Online-Dokument; URL: http://www.oecd.org/dataoecd/36/56/<br />
35693281.pdf, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
ÖKUMENISCHES INFORMATIONSZENTRUM E.V./DIAKONISCHES WERK DER EV.-LUTH.<br />
LANDESKIRCHE IN BRAUNSCHWEIG/UMWELTBÜRO NORD E. V. (o.J.): <strong>Weiterbildung</strong><br />
zur NaturkindergärtnerIn. Online-Dokument; URL: http://www.naturkindergarten.net/weiterbildung.htm,<br />
zuletzt überprüft: 1.8.<strong>2011</strong><br />
OPITZ, CHRISTIAN (1998): Ernährung für Mensch und Erde. Freiburg: Hans-Nietsch-<br />
Verlag. 4. Auflage<br />
ORR, DAVID W. (2010): Hochschulbildung – für die Zukunft. In: WORLDWATCH IN-<br />
STITUTE (Hrsg.): Zur Lage der Welt 2010. Einfach besser leben. Nachhaltigkeit<br />
als neuer Lebensstil. München: oekom. S. 127-134<br />
OTT, KONRAD/DÖRING, RALF (2008): Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit.<br />
Marburg: Metropolis-Verlag. 2. Auflage<br />
OTT, KONRAD/VOGET, LIESKE (2007): Ethische Dimensionen einer Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung. Online-Dokument; URL: http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/pm/de/Ausgabe__001/Downloads/01__Beitr_C3_A4ge/<br />
Ott__Voget.pdf, zuletzt überprüft: 7.8.<strong>2011</strong><br />
OVERWIEN, BERND (2009): Informelles Lernen. Definitionen und Forschungsansätze.<br />
In: BRODOWSKI, MICHAEL et.al (Hrsg.): Informelles Lernen und Bildung für<br />
eine nachhaltige Entwicklung. Opladen & Farmington Hills, MI: Verlag Barbara<br />
Budrich. S. 23-34<br />
200
6 Quellenverzeichnis<br />
OWEN, HARRISON (2001): Open Space technology. Ein Leitfaden für die Praxis. Stuttgart:<br />
Klett-Cotta<br />
PACALA, STEPHEN (2007): Equitable Solutions to Greenhouse Warming: On the Distribution<br />
of Wealth, Emissions ans Responsibility Within and Between Nations.<br />
Beitrag zur Globalen Entwicklungskonferenz des International Institute<br />
for Applied Systems Analysis, Wien.<br />
PAULUSSCHULE DÜSSELDORF (2010): Papier. Online-Dokument; URL: www.umweltschulen.de/audit/paulusschule/papier.html,<br />
zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
PETRI, KATRINA (2003): Open Space – Raum für Bürgerengagement und Kaffeepausen.<br />
In: LEY, ASTRID/WEITZ, LUDWIG (Hrsg.): Praxis Bürgerbeteiligung. Ein<br />
Methodenhandbuch. Bonn: Verlag Stiftung Mitarbeit / Agenda Transfer. S.<br />
183-189. Online-Version unter http://www.buergergesellschaft.de/politischeteilhabe/modelle-und-methoden-der-buergerbeteiligung/ideen-sammeln-kommunikation-und-energie-buendeln/open-space/103429/,<br />
zuletzt überprüft:<br />
25.7.<strong>2011</strong><br />
PETSCHOW, ULRICH/MEYERHOFF, JÜRGEN/THOMASBERGER, CLAUS (1990): Umweltreport<br />
DDR. Frankfurt am Main: Fischer<br />
PIECHOCKI, REINHARD (2001): Altäre des Fortschritts und der Aufklärung im 21. Jahrhundert.<br />
München und Heidelberg: Verlag C.H.Beck und Günter-Altner-Stiftung<br />
PRAMLING, INGRID (1986): The origin of the child's idea of learning through practice.<br />
In: European Journal of Psychology in Education 1, No 3, S. 31-46. Zitiert<br />
nach: GISBERT, KRISTIN (2004): Lernen lernen. Lernmethodische Kompetenzen<br />
von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Weinheim und Basel: Beltz<br />
PRAMLING, INGRID (1996): Understandig and empowering the child as a learner. In:<br />
OLSON, D.R./TORRANCE, N. (Hrsg.): The handbook of education and human<br />
development. Malden MA: Blackwell. S. 565-592) Zitiert nach: GISBERT, KRI-<br />
STIN (2004): Lernen lernen. Lernmethodische Kompetenzen von Kindern in<br />
Tageseinrichtungen fördern. Weinheim und Basel: Beltz<br />
PRAMLING SAMUELSSON, INGRID/CARLSSON, MAJ ASPLUND (2007): Spielend lernen.<br />
Stärkung lernmethodischer Kompetenzen. Troisdorf: Bildungsverlag EINS<br />
PRAMLING SAMUELSSON, INGRID/KAGA, YOSHI (2010): Spielend in die neue Welt.<br />
Über frühkindliche Erziehung und Nachhaltigkeit. In: Worldwatch Institute<br />
(Hrsg.): Zur Lage der Welt 2010. Einfach besser leben. Nachhaltigkeit als neuer<br />
Lebensstil. München: oekom. S. 102-108<br />
PREUSS, S. (1997): Strategien zur Förderung des Umwelthandelns. In: MICHELSEN,<br />
GERD (Hrsg., 1997): Umweltberatung. Grundlagen und Praxis. Bonn: Economica<br />
Verlag GmbH, S. 63-72<br />
PRILL, SUSANNE (2003): Open Space – Rostocker Stadtteil Groß Klein. In: LEY,<br />
ASTRID/WEITZ, LUDWIG (Hrsg.): Praxis Bürgerbeteiligung. Ein Methodenhandbuch.<br />
Bonn: Verlag Stiftung Mitarbeit / Agenda Transfer. S. 191<br />
201
6 Quellenverzeichnis<br />
PROGRAMM TRANSFER-21 (Hrsg., o.J.): Abschlussbericht des Projektträgers. 1. August<br />
2004 bis 31. Juli 2008. Berlin.<br />
REICH, KERSTEN (Hrsg., 2003ff): Methodenpool. Online-Dokument; URL: http://<br />
www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/didaktik/uebersicht.html, zuletzt überprüft:<br />
10.8.<strong>2011</strong><br />
REICH, KERSTEN (2004): Konstruktivistische Didaktik. Neuwied: Luchterhand.<br />
REIDELHUBER, ALMUT (2000): Umweltbildung. Ein Projektbuch für die sozialpädagogische<br />
Praxis mit Kindern von 3–10 Jahren. München.<br />
REINERT, ADRIAN (2003): Bürger(innen)beteiligung als Teil der lokalen Demokratie.<br />
In: LEY, ASTRID/WEITZ, LUDWIG (Hrsg.): Praxis Bürgerbeteiligung. Ein Methodenhandbuch.<br />
Bonn: Verlag Stiftung Mitarbeit / Agenda Transfer. S. 33-40<br />
RENN, ORTWIN (2003): Warum Beteiligung? Zur politischen Dimension des bürgerschaftlichen<br />
Engagements. In: LEY, ASTRID/WEITZ, LUDWIG (Hrsg.): Praxis<br />
Bürgerbeteiligung. Ein Methodenhandbuch. Bonn: Verlag Stiftung Mitarbeit /<br />
Agenda Transfer. S. 43-48<br />
RETTET DEN REGENWALD o.J.: Regenwald.org. Online-Dokument; URL: http://<br />
www.regenwald.org/, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
RIECKMANN, MARCO (2010): Die Globale Perspektive der Bildung für eine nachhaltige<br />
Entwicklung. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag<br />
RODE, HORST: Motivation, Transfer und Gestaltungskompetenz. Ergebnisse der Abschlussevaluation<br />
des BLK-Programms “21” 1999-2004. Berlin: Verein zur<br />
Förderung der Ökologie im Bildungsbereich e.V. Online-Dokument; URL: http://www.transfer-21.de/daten/evaluation/Abschlusserhebung.pdf,<br />
zuletzt<br />
überprüft: 10. 8. <strong>2011</strong><br />
RODEMANN, SUSANNE (2009): Gestaltungskompetenz durch freiwilliges Engagement<br />
bei Greenpeace. In: BRODOWSKI, MICHAEL et.al (Hrsg.): Informelles Lernen<br />
und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Opladen & Farmington Hills,<br />
MI: Verlag Barbara Budrich. S. 113-112<br />
RYCHEN, DOMINIQUE SIMONE (2001): Introduction. In: RYCHEN, DOMINIQUE SIMO-<br />
NE/SALGANIK, LAURA (Hrsg.): Defining and Selecting Key Competencies. Seattle,<br />
Toronto, Bern, Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers, S. 1-15<br />
RYCHEN, DOMINIQUE SIMONE (2008): OECD Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen<br />
– ein Überblick. In: BORMANN, INKA/DE HAAN, GERHARD (Hrsg.):<br />
Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wiesbaden: VS Verlag<br />
für Sozialwissenschaften. S. 15-22<br />
SCHAHN, J. (1997) : Die Diskrepanz zwischen Wissen, Einstellungen und Handeln –<br />
Sozialwissenschaftliche Erkenntnisse. In: MICHELSEN, GERD (Hrsg.): Umweltberatung<br />
– Grundlagen und Praxis. Bonn<br />
SCHMIDT-BLEEK, FRIEDRICH (1993): Wieviel Umwelt braucht der Mensch? MIPS -<br />
das Maß für ökologisches Wirtschaften. Basel/Berlin: Birkhäuser<br />
202
6 Quellenverzeichnis<br />
SCHMIDT-BLEEK, FRIEDRICH (1998): Das MIPS-Konzept – Faktor 10. München:<br />
Droemer<br />
SCHMIDT-BLEEK, FRIEDRICH (2000): Faktor 10 Manifesto. Online-Dokument; URL:<br />
http://www.factor10-institute.org/files/F10_Manifesto_d.pdf, zuletzt überprüft:<br />
10.8.201<br />
SCHWALB, LILIAN/WALK, HEIKE (Hrsg., 2007): Local Governance – mehr Transparenz<br />
und Bürgernähe? Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften<br />
SEMMELMANN, THOMAS (2003): Zukunftswerkstatt – Ökologische Stadt Herne. In:<br />
LEY, ASTRID/WEITZ, LUDWIG (Hrsg.): Praxis Bürgerbeteiligung. Ein Methodenhandbuch.<br />
Bonn: Verlag Stiftung Mitarbeit / Agenda Transfer. S. 288<br />
SIEMER, STEFAN HERMANN/RAMMEL, CHRISTIAN/ELMER, SONYA (2006): Pilotstudie<br />
zu Indikatoren einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wien: Forum Umweltbildung.<br />
Online-Dokument; URL: http://www.umweltbildung.at/cms/<br />
download/407.pdf, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
SIPRI (2007): SIPRI YEARBOOK 2007: Armaments, Disarmament and International<br />
Security. Online-Dokument; URL, http://www.sipri.org/yearbook/2007, zuletzt<br />
überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
S.O.F. (o.J. a): KITA21 – Die Zukunftsgestalter. Online-Dokument; URL: http://<br />
www.kita21.de/index.html, zuletzt überprüft: 1.8.<strong>2011</strong><br />
S.O.F. (o.J. b) Bildungsprojekte gestalten. Online-Dokument; URL: http://<br />
www.kita21.de/bildungsprojekte_gestalten0.html, zuletzt überprüft: 1.8.<strong>2011</strong><br />
SPEHR, CHRISTOPH (1996): Die Ökofalle. Nachhaltigkeit und Krise. Wien: Promedia<br />
SRU (1994): Umweltgutachten 1994. Für eine dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung.<br />
Stuttgart: Verlag Metzler-Poeschel<br />
SRU (1996): Umweltgutachten 1996. Zur Umsetzung einer dauerhaft-umweltgerechten<br />
Entwicklung. Stuttgart: Verlag Metzler-Poeschel<br />
SRU (1998): Umweltgutachten 1998. Umweltschutz: Erreichtes sichern – neue Wege<br />
gehen. Stuttgart: Verlag Metzler-Poeschel<br />
SRU (2000): Umweltgutachten 2000. Schritte ins nächste Jahrtausend. Stuttgart: Verlag<br />
Metzler-Poeschel<br />
SRU (2002): Umweltgutachten 2002. Für eine neue Vorreiterrrolle. Stuttgart: Verlag<br />
Metzler-Poeschel<br />
STATISTISCHES BUNDESAMT (2007): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Indikatorenbericht<br />
2006. Online-Dokument; URL: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/<br />
Fachveroeffentlichungen/UmweltoekonomischeGesamtrechnungen/<br />
Indikatorenbericht2006,property=file.pdf, zuletzt überprüft: 10.7.<strong>2011</strong><br />
STATISTISCHES BUNDESAMT (2008): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Indikatorenbericht<br />
2008. Online-Dokument; URL: http://www.destatis.de/jet-<br />
203
6 Quellenverzeichnis<br />
speed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/<br />
Fachveroeffentlichungen/UmweltoekonomischeGesamtrechnungen/<br />
Indikatorenbericht2008,property=file.pdf, zuletzt überprüft: 10.7.<strong>2011</strong><br />
STATISTISCHES BUNDESAMT (2010): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Indikatorenbericht<br />
2006. Online-Dokument; URL: http://www.bundesregie-<br />
rung.de/nsc_true/Webs/Breg/nachhaltigkeit/Content/__Anlagen/2010-07-28-<br />
indikatorenbericht-2010,property=publicationFile.pdf/2010-07-28-indikatorenbericht-2010,<br />
zuletzt überprüft: 10.7.<strong>2011</strong><br />
STATISTISCHES LANDESAMT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG (2003): Fakten<br />
und Analysen zum Thema Bevölkerung Einwohner und Haushalte Familien<br />
und Erwerbstätigkeit. Statistik.Magazin.Hamburg 17. Hamburg.<br />
STIFTUNG MITARBEIT (o.J.): Zukunftswerkstatt. Online-Dokument; URL: http://<br />
www.buergergesellschaft.de/politische-teilhabe/modelle-und-methoden-derbuergerbeteiligung/visionen-entwickeln-zukunft-gestalten/zukunftswerkstatt/<br />
103425/, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
STOLTENBERG, U./SCHUBERT, S. (2000): Zukunftsfähige Umweltbildung in der Ausbildung<br />
von Erzieherinnen und Erziehern. Projektbericht. Berlin<br />
TEICHERT, VOLKER (2000): Umweltmanagement in Schulen. Heidelberg: FEST<br />
THIELE, PETER: Bürgerbeteiligung am Beispiel der Sonderabfalldeponie Münchehagen.<br />
In: LANGNER, TILMAN (Hrsg., 1992): Bürgerbeteiligung in der Abfallwirtschaft.<br />
Halle: Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V.<br />
TSCHEKAN, KERSTIN (<strong>2011</strong>): Kompetenzorientiert unterrichten. Belin: Cornelsen<br />
Scriptor<br />
ULSF (o.J.): Talloires Declaration. Online-Dokument; URL: http://www.ulsf.org/<br />
programs_talloires.html, zuletzt überprüft: 19.7.<strong>2011</strong><br />
UMWELTAMT DER LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF (2009): Recyclingpapier an<br />
Schulen – das Umweltamt informiert. Online-Dokument; URL: http://<br />
www.umweltschulen.de/download/papierinfo.pdf, zuletzt überprüft:<br />
25.7.<strong>2011</strong><br />
UMWELTAMT DER LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF (2010): Düsseldorfer Klimawochen<br />
für Schulen. Online-Dokument; URL: http://www.umweltschulen.de/<br />
download/20100913_klimawochen.pdf, zuletzt überprüft: 27.7.<strong>2011</strong><br />
UMWELTBUNDESAMT (2002): Ökosteuer – sparen oder zahlen? Berlin<br />
UMWELTBUNDESAMT (2007): Klimaänderungen, deren Auswirkungen und was für<br />
den Klimaschutz zu tun ist. Berlin<br />
UNESCO (1978): Intergovernmental Conference on Environmental Education:<br />
Schlußbericht (Paris, UNESCO, 1978) Kapitel III<br />
UNESCO (2005): United Nations Decade of Education for Sustainable Development<br />
2005-2014. International Implementation Scheme (IIS). Paris. Zitiert nach:<br />
DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION/SEKRETARIAT UN-DEKADE (2005): Na-<br />
204
6 Quellenverzeichnis<br />
tionaler Aktionsplan für Deutschland. UN-Dekade „Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung“. Berlin. S. 3<br />
VAN DE SAND, KLEMENS (2005): Die MDG als Herausforderungen für die deutsche<br />
Entwicklungspolitik. In: dedBrief 2 (2005) 8-11<br />
VENRO (2000): Globales Lernen als Aufgabe und Handlungsfeld entwicklungspolitischer<br />
Nichtregierungsorganisationen. Online-Dokument; URL: http://<br />
www.venro.org/fileadmin/Publikationen/Einzelveroeffentlichungen/<br />
Globales_Lernen/arbeitspapier_10.pdf, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
VENRO (2005): Kurs auf eine nachhaltige Entwicklung – Lernen für eine zukunftsfähige<br />
Welt. Online-Dokument; URL: http://www.venro.org/fileadmin/Publikationen/Einzelveroeffentlichungen/Nachhaltige_Entwicklung/<br />
arbeitspapier15-dt.pdf, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
VEREINTE NATIONEN (Vollversammlung) (1990): Unsere gemeinsame Zukunft. Bericht<br />
der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Berlin: Staatsverlag<br />
der DDR<br />
VEREINTE NATIONEN (2000): Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen. Online-Dokument;<br />
URL: http://www.un-kampagne.de/fileadmin/downloads/erklaerung/millenniumerklaerung.pdf,<br />
zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
VEREINTE NATIONEN (2002): Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung Johannesburg<br />
(Südafrika), 26. August – 4. September 2002 (auszugsweise Übersetzung).<br />
Online-Dokument; URL: http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/<br />
application/pdf/johannesburg_declaration.pdf, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
VEREINTE NATIONEN, Wirtschafts- und Sozialrat, Wirtschaftskommission für Europa,<br />
Ausschuss für Umweltpolitik, Hochrangige Tagung der Umwelt- und Bildungsministerien<br />
(2005): UNECE-Strategie über die Bildung für nachhaltige<br />
Entwicklung. CEP/AC. 13/2005/3/Rev.1 vom 23.März 2005. Internetdokument;<br />
URL: http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/03541/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZp<br />
nO2Yuq2Z6gpJCDfXt3hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- , zuletzt überprüft<br />
15.7.<strong>2011</strong><br />
VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR 2007: SchokoTicket. Online-Dokument; URL: http://www.vrr.de/imperia/md/content/broschueren/schokoticket.pdf,<br />
zuletzt<br />
überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
VIATKOV, SOFIA (2007): Die Effizienz der Lenkungsfunktion von Ökosteuern. Grin<br />
Verlag<br />
VOLKSKAMMER DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK (1970): Gesetz über<br />
die planmäßige Gestaltung der sozialistischen Landeskultur in der Deutschen<br />
Demokratischen Republik – Landeskulturgesetz – vom 14. Mai 1970. Gesetzblatt<br />
der Deutschen Demokratischen Republik Teil I Nr. 12 vom 28. Mai 1970<br />
WEINERT, FRANZ E. (2001): Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene<br />
Selbstverständlichkeit. In: WEINERT, F.E. (Hrsg.): Leistungsmessungen<br />
in Schulen. Weinheim und Basel: Beltz<br />
205
6 Quellenverzeichnis<br />
WEIZSÄCKER, ERNST ULRICH VON/LOVINS, AMORY B./LOVINS, L. HUNTER (1996):<br />
Faktor vier. München: Droemer Knaur. 9., korrigierte Auflage<br />
WENSIERSKI, PETER (1986): Von oben nach unten wächst gar nichts. Umweltzerstörung<br />
und Protest in der DDR. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag<br />
GmbH<br />
WBGU (1996): Welt im Wandel – Herausforderung für die deutsche Wissenschaft.<br />
Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag<br />
WIPPERMANN, CARSTEN/FLAIG, BERTHOLD BODO/CALMBACH, MARC/KLEINHÜK-<br />
KELKOTTEN, SILKE (2009): Umweltbewusstsein und Umweltverhalten der sozialen<br />
Milieus in Deutschland. Berlin: Umweltbundesamt (Hrsg.). Online-<br />
Dokument; URL: http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3871.pdf,<br />
zuletzt überprüft: 26.7.<strong>2011</strong><br />
WOLF, GERTRUD (2005): Konstruktivistische Umweltbildung. Bielefeld: Bertelsmann<br />
WORLDWATCH INSTITUTE (Hrsg., <strong>2011</strong>): Zur Lage der Welt <strong>2011</strong>. Hunger im Überfluss.<br />
Neue Strategien gegen Unterernährung und Armut. München: oekom.<br />
WUPPERTAL-INSTITUT (2002): Mips für Kids. Umwelt und Lebenswelt - Wie Kinder<br />
gebrauchen und gestalten. Online-Dokument; URL: http://www.wupperinst.org/Projekte/mipskids/index.html,<br />
zuletzt überprüft: 8.8.<strong>2011</strong><br />
WWF/TRAFFIC DEUTSCHLAND (2001): Hintergrundinformation Ausgestorbene Arten.<br />
Online-Dokument; URL: www.wwf.de/imperia/md/content/pdf/arten/<br />
handel/ausgestorbene_arten.pdf, zuletzt überprüft: 10.8.<strong>2011</strong><br />
ZUKUNFTSRAT HAMBURG (1999): Indikatoren für eine zukunftsfähige Entwicklung<br />
Hamburgs. Hamburg<br />
ZUKUNFTSRAT HAMBURG (2006): HEINZ 2006. Hamburger Entwicklungs-INdikatoren<br />
Nachhaltigkeit. Online-Dokument; URL: http://www.zukunftsrat.de/<br />
download/HEINZ_2006-korrigierte%20Fassung.pdf, zuletzt überprüft:<br />
10.8.<strong>2011</strong><br />
ZUKUNFTSRAT HAMBURG (2007): Zukunftsrat zieht ernüchternde Bilanz: Hamburgs<br />
Entwicklung ist nicht zukunftsfähig. Online-Dokument; URL: http://www.zukunftsrat.de/download/Presse-Mitteilung%202007-01-01.pdf,<br />
zuletzt überprüft:<br />
10.8.<strong>2011</strong><br />
ZUKUNFTSRAT HAMBURG (2010a): HEINZ 2010. Hamburger Entwicklungs-INdikatoren<br />
Nachhaltigkeit. Online-Dokument; URL: http://www.zukunftsrat.de/<br />
download/heinz2010_ppp.pdf, zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
ZUKUNFTSRAT HAMBURG (2010b): Umwelthauptstadt <strong>2011</strong> im Nachhaltigkeits-<br />
Check. Online-Dokument; URL: http://www.zukunftsrat.de/download/<br />
heinz_pm2010.pdf, zuletzt überprüft: 25.7.<strong>2011</strong><br />
206
Anhang - Abbildungsverzeichnis<br />
7. Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1 Rohstoffproduktivität und Wirtschaftswachstum in Deutschland ................. 42<br />
Abb. 2 Das Nachhaltigkeitsdreieck – ein brauchbares mentales Modell im Nachhaltigkeitsdiskurs?<br />
................................................................................................ 54<br />
Abb. 3 Ablauf des Nachhaltigkeitsaudits (vereinfacht) .......................................... 116<br />
Abb. 4 Stufen der Schülerpartizipation ................................................................. 118<br />
Abb. 5 Example: Energy theme in SD programme .............................................. 122<br />
Abb. 6 Zeugnis für eine Zukunftsfähige Hansestadt ............................................. 146<br />
Abb. 7 Struktur der Lokalen Agenda 21 in der Landeshauptstadt Düsseldorf ...... 153<br />
Abb. 8 CO2-Emissionen nach Sektoren. Hansestadt Stralsund, 2007 ................. 161<br />
Abb. 9 Verringerung der CO2-Emissionen der Hansestadt Stralsund. Szenarienvergleich<br />
– Zeithorizont: 2050 ......................................................................... 163<br />
207
Anhang - Tabellenverzeichnis<br />
8. Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1:<br />
Themenfelder und Schlüsselindikatoren der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie<br />
............................................................................................... 38<br />
Tabelle 2: Zukunftsfähigen Deutschland – Zwischenbilanz .................................. 43<br />
Tabelle 3: Lesarten des Bildungsauftrages der Agenda 21 .................................. 80<br />
Tabelle 4: Kompetenzkonzepte für die <strong>BNE</strong> ......................................................... 89<br />
Tabelle 5: Themen im Nachhaltigkeitsaudit (Beispiele) ...................................... 119<br />
Tabelle 6: Simulationsspiele als konstruktivistische Lernumgebungen .............. 131<br />
209
210<br />
8. Tabellenverzeichnis