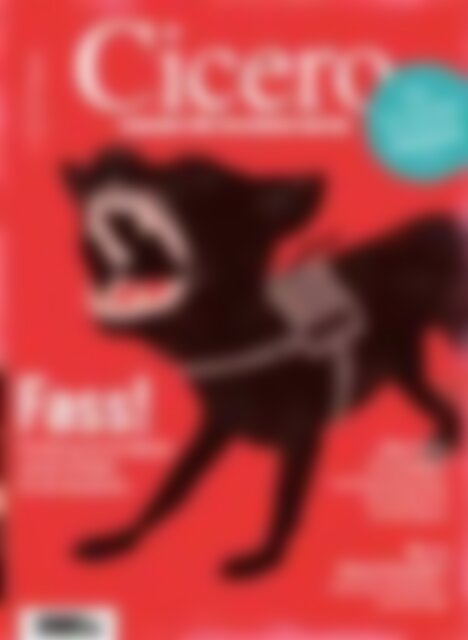Cicero Der Blutrausch der Medien (Vorschau)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nº12<br />
DEZEMBER<br />
2013<br />
€ 8.50<br />
CHF 13<br />
Neu!<br />
J E T Z T J E D E N M O N A T<br />
M I T E X T R A-SEITEN<br />
Li teraturen<br />
Fass!<br />
<strong>Der</strong> <strong>Blutrausch</strong> <strong>der</strong> <strong>Medien</strong><br />
und <strong>der</strong> Schaden<br />
für die Demokratie<br />
Österreich: 8.50 €, Benelux: 9.50 €, Italien: 9.50 €<br />
Spanien: 9.50 €, Finnland: 12.80 €<br />
12<br />
„ Beim Islam<br />
ist es heikler “<br />
<strong>Der</strong> Philosoph Rémi Brague<br />
über den Wettstreit<br />
<strong>der</strong> Weltreligionen<br />
Wer ist<br />
Edward Snowden?<br />
Porträt eines Rätselhaften –<br />
und seiner Jäger<br />
4 196392 008505
Die<br />
Kunst,<br />
voraus zu sein.<br />
<strong>Der</strong> neue Audi A8.<br />
*Optional erhältlich.<br />
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 11,7–5,9;<br />
CO 2<br />
-Emissionen in g/km: kombiniert 270–155.
Die Kunst, mit intelligenten Frontscheinwerfern den Fahrer zu<br />
entlasten und das Fahren sicherer zu machen. Erleben Sie die Technik,<br />
die intelligent ausleuchtet, was Sie sehen müssen. Und gleichzeitig<br />
das Blenden des Gegenverkehrs und vorausfahren<strong>der</strong> Fahrzeuge<br />
vermeidet. <strong>Der</strong> Audi Matrix LED-Scheinwerfer* – jetzt im neuen Audi A8.<br />
Mehr Informationen unter www.audi.de
calibre de cartier<br />
CHRONOGRAPH 1904-CH MC<br />
DAS NEUE CHRONOGRAPHEN-UHRWERK MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 1904-CH MC WURDE IN GRÖSSTER<br />
UHRMACHER TRADITION VON DEN UHRMACHERN DER CARTIER MANUFAKTUR KREIERT, ENTWICKELT UND<br />
GEBAUT. UM PERFEKTE PRÄZISION ZU ERREICHEN, WURDE DAS UHRWERK MIT VIRTUOSER TECHNIK<br />
AUSGESTATTET: EIN SCHALTRAD, UM ALLE FUNKTIONEN DES CHRONOGRAPHEN ZU KOORDINIEREN,<br />
EIN VERTIKALER KUPPLUNGSTRIEB, UM DIE AKKURATESSE DES STARTENS UND STOPPENS DER TIMER<br />
FUNKTION ZU VERBESSERN, EINE LINEARE RESET FUNKTION UND EIN DOPPELTES FEDERHAUS, UM EIN<br />
UNVERGLEICHLICHES ABLESEN DER ZEIT ZU GEWÄHRLEISTEN.<br />
42MM GEHÄUSE AUS STAHL, MECHANISCHES MANUFAKTUR–CHRONOGRAPHENUHRWERK, AUTOMATIK-<br />
AUFZUG, KALIBER 1904-CH MC (35 STEINE, 28.800 HALBSCHWINGUNGEN PRO STUNDE, CA. 48 STUNDEN<br />
GANG RESERVE), KALENDERÖFFNUNG BEI 6 UHR, ACHTECKIGE KRONE AUS STAHL, SILBER OPALIERTES<br />
ZIFFERBLATT, PROFILRILLEN MIT SILBER FINISH, ARMBAND AUS STAHL.<br />
ONLINE BOUTIQUE WWW.CARTIER.DE + 49 89 55984-221
ATTICUS<br />
N°-12<br />
HEISSGELAUFEN<br />
Titelbild: Jens Bonnke; Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
Oft reicht es, nach Großbritannien<br />
zu blicken, um zu ermessen,<br />
was gesellschaftlich auf uns zukommt.<br />
Die Bil<strong>der</strong> des gehetzten Limburger<br />
Bischofs in Rom erinnerten mich an den<br />
Fall Kelly. David Kelly war ein britischer<br />
Biowaffen experte und vor zehn Jahren<br />
vermuteter Kronzeuge für eine BBC-<br />
Geschichte, wonach die Blair-Regierung<br />
ein Irak-Dossier wahrheitswidrig aufgemotzt<br />
hatte. <strong>Der</strong> Wissenschaftler sah sich<br />
einem enormen Druck durch die Boulevardpresse<br />
ausgesetzt. Drei Wochen später<br />
lag er tot auf einem Acker. Selbstmord.<br />
Sind wir so weit davon entfernt?<br />
Ist das rechte Maß noch gewahrt? War<br />
Horst Köhler wirklich ein „Horst Lübke“<br />
und deshalb untragbar im Amt des<br />
Bundespräsidenten? Musste man seinem<br />
Nachfolger Christian Wulff auch noch<br />
den Anspruch auf den Ehrensold absprechen?<br />
Darf Bischof Tebartz-van Elst<br />
keinen Kaffee auf <strong>der</strong> Piazza trinken?<br />
War Rainer Brü<strong>der</strong>les dämlicher Ausfall<br />
wirklich diese Aufregung wert?<br />
Da läuft etwas schief. Da läuft etwas<br />
heiß. Die <strong>Medien</strong> stehen unter existenziellem<br />
ökonomischen Druck, <strong>der</strong> dazu<br />
verleitet, Tabus fallen zu lassen. In Großbritannien<br />
hatte eine Boulevardzeitung<br />
auf <strong>der</strong> Jagd nach exklusiven Storys<br />
Mobiltelefone von Politikern und Royals<br />
systematisch angezapft. Das Presserecht<br />
wird jetzt deshalb dort verschärft.<br />
<strong>Der</strong> rasende Takt <strong>der</strong> Online-<strong>Medien</strong><br />
gibt Richtung und Tempo einer zunehmend<br />
besinnungslosen Hatz vor. Heraus<br />
kommt Hochfrequenz-Journalismus,<br />
<strong>der</strong> keine Zeit mehr zum Nachdenken<br />
lässt. Es geht zu wie an <strong>der</strong> Schießbude:<br />
Je<strong>der</strong> darf mal draufhalten.<br />
<strong>Der</strong> frühere Kulturstaatsminister<br />
und Philosoph Julian Nida-Rümelin<br />
macht sich Gedanken über die Folgen<br />
<strong>der</strong> permanenten Skandalisierung<br />
für die Demo kratie ( ab Seite 20 ).<br />
Unsere Reporterin Merle Schmalenbach<br />
berichtet aus <strong>der</strong> Kampfzone führen<strong>der</strong><br />
deutscher Online-Portale ( ab Seite 28 ).<br />
„Weniger Hype, mehr Recherche“, for<strong>der</strong>t<br />
Georg Mascolo ( ab Seite 34 ), fünf<br />
Jahre lang Chefredakteur des Spiegel<br />
und einer <strong>der</strong> namhaften Investigativjournalisten<br />
des Landes. Susanne Gaschke,<br />
gelernte Journalistin und zurückgetretene<br />
Kieler Oberbürgermeisterin, berichtet<br />
über ihre Wochen im Sperrfeuer <strong>der</strong><br />
<strong>Medien</strong> ( ab Seite 32 ).<br />
Was tun? Besinnen, zur Ruhe kommen –<br />
und mehr Bücher lesen. Von dieser<br />
Aus gabe an finden Sie Literaturen jeden<br />
Monat auf vier Seiten in <strong>Cicero</strong>.<br />
Und zweimal im Jahr als eigenes Heft.<br />
Mit besten Grüßen<br />
CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
Chefredakteur<br />
5<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
PUSCHLAV (SCHWEIZ), 2005<br />
DER GEHILFE<br />
Während eines Ausfl ugs ins Schweizer Berggebiet Puschlav hielt unser<br />
Zug auf offener Strecke an. Neugierig steckten meine Frau und ich unsere<br />
Köpfe aus dem Fenster. Am Ende des Zugs: dichter Rauch. Zugbegleiter<br />
und Lokführer stiegen aus, man hantierte und debattierte. Schliesslich<br />
fragte jemand unter unserem Fenster nach einem Taschenmesser. Ich<br />
kramte mein Victorinox-Messer hervor. Wenige Minuten später setzte sich<br />
<strong>der</strong> Zug wie<strong>der</strong> in Bewegung. Die Bridenschraube des Bremsschlauchs sei<br />
locker gewesen, erklärte <strong>der</strong> Zug begleiter, als er mein Messer zurückbrachte.<br />
Er bedankte sich überschwänglich – als wäre ich ein Held. Ich nahm<br />
mir vor, den SBB vorzuschlagen, das gesamte Zugpersonal mit Victorinox-<br />
Messern auszustatten.<br />
Dieter Portmann, August 2005<br />
Victorinox-Produkte begleiten Sie – ein Leben lang. Was auch immer<br />
Sie damit erleben: Erzählen Sie es uns auf victorinox.com<br />
FLAGSHIP STORE DÜSSELDORF I KÖNIGSALLEE 88 I 40212 DÜSSELDORF<br />
BRAND STORE KÖLN I WALLRAFPLATZ 2 I 50667 KÖLN<br />
SWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES | WWW.VICTORINOX.COM
INHALT<br />
TITELTHEMA<br />
20<br />
DER SCHÄDLICHE SKANDAL<br />
Die Jagd auf Wulff, Steinbrück und Brü<strong>der</strong>le<br />
lehrt: Wir müssen zur Besinnung kommen<br />
Von JULIAN NIDA-RÜMELIN<br />
28<br />
DIE KLICKFABRIK<br />
Online-<strong>Medien</strong> folgen an<strong>der</strong>en Gesetzen.<br />
Ein Bericht aus <strong>der</strong> Schlagzeilenproduktion<br />
Von MERLE SCHMALENBACH<br />
Illustration: Jens Bonnke<br />
32<br />
„GNADENLOS DURCH DEN WOLF GEDREHT“<br />
Kiels Ex-Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke<br />
im Interview über die Mechanismen <strong>der</strong> <strong>Medien</strong><br />
Von ALEXANDER MARGUIER<br />
34<br />
MUT, STOLZ UND STORYS<br />
Was ist guter, zukunftstauglicher Journalismus?<br />
For<strong>der</strong>ungen an eine Profession<br />
Von GEORG MASCOLO<br />
7<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
BERLINER REPUBLIK WELTBÜHNE KAPITAL<br />
40 PAU STATT PFAU<br />
Bundestagsvizepräsidentin<br />
Petra Pau: Eine Außenseiterin<br />
wird zur Autorität<br />
Von TIMO STEIN<br />
42 UNTER KONTROLLE<br />
CSU-Generalsekretär<br />
Alexan<strong>der</strong> Dobrindt<br />
mo<strong>der</strong>nisiert sich nach oben<br />
Von GEORG LÖWISCH<br />
44 DER WERT DES MENSCHEN<br />
<strong>Der</strong> Mindestlohn ist keine<br />
Frage des Marktes. Weil<br />
Arbeiter keine Ware sind<br />
Von FRANK A. MEYER<br />
46 DAS GEISTERSCHIFF<br />
Von hier aus wollte die<br />
SPD Deutschland erobern:<br />
Das Willy-Brandt-Haus,<br />
Zentrale <strong>der</strong> Lähmung<br />
Von CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
49 FRAU FRIED FRAGT SICH …<br />
… ob wir in einer<br />
Wohlfühldiktatur leben<br />
Von AMELIE FRIED<br />
52 MACHT UND KAMERA<br />
Die Stasi hätte sie<br />
geliebt. Das Potenzial <strong>der</strong><br />
Datenbrille Google Glass<br />
Von ROLAND JAHN<br />
56 KOKETT UND KNALLHART<br />
James Clapper wirkt wie ein Opa, ist<br />
aber <strong>der</strong> Chef aller US-Geheimdienste<br />
Von WILLIAM DROZDIAK<br />
58 EIN ZÄHER BROCKEN<br />
Obamas Sicherheitsberaterin<br />
Susan Rice verteidigt die NSA<br />
Von ANSGAR GRAW<br />
60 DER COWBOY<br />
NSA-Chef Keith Alexan<strong>der</strong> ist<br />
sich keiner Schuld bewusst<br />
Von SHANE HARRIS<br />
64 DER VERRÄTER<br />
Wer ist <strong>der</strong> Mann, <strong>der</strong> die NSA<br />
entblößte? Rekonstruktion von<br />
Edward Snowdens Weg<br />
Von THOMAS SCHULER<br />
72 TRAU. SCHAU, WEM<br />
Sind die USA noch ein<br />
verlässlicher Partner?<br />
Von WILLIAM J. DOBSON<br />
76 JESUS KAM BIS SIBIRIEN<br />
Beten bei minus 40 Grad.<br />
Ein Fotoessay über die<br />
Religion des Wissarion<br />
Von DAVIDE MONTELEONE<br />
86 GESCHICKT EINGEFÄDELT<br />
Christoph Rickerl stellt<br />
Schnürsenkel her.<br />
Und ein Geflecht für<br />
Nobelpreisträger<br />
Von CAROLA SONNET<br />
88 DER PUNKROCK-STRATEGE<br />
Wie wird einer Milliardär,<br />
dem Geld egal ist?<br />
<strong>Der</strong> Weg von Jack Dorsey,<br />
Twitter-Erfin<strong>der</strong><br />
Von CHRISTINE MATTAUCH<br />
92 „ICH MÜSSTE DIE<br />
HÄLFTE ENTLASSEN“<br />
Ein Taxifahrer und sein<br />
Chef machen sich Gedanken<br />
über den Mindestlohn<br />
Von ALEXANDER MARGUIER<br />
94 EWIGER ETATSTREIT<br />
Was <strong>der</strong> zerbrechliche<br />
Haushaltskompromiss<br />
in den USA bewirkt<br />
Von HENRIK ENDERLEIN<br />
96 MEISTER DES GELDES<br />
Zentralbankchef<br />
Mario Draghi<br />
ist <strong>der</strong> mächtigste<br />
Mann <strong>der</strong> EU.<br />
Wie tickt er?<br />
Von TIL KNIPPER und<br />
JULIUS MÜLLER-MEININGEN<br />
46<br />
SPD: Das Haus des Scheiterns<br />
und <strong>der</strong> Lähmung<br />
64<br />
NSA: <strong>Der</strong> Mann, <strong>der</strong> die<br />
Überwacher vorführt<br />
96<br />
EZB: Ein Römer mo<strong>der</strong>nisiert<br />
Europas Geldpolitik<br />
Fotos: Michael Ruetz/Agentur Focus, Olaf Blecker; Illustration: Sebastian Haslauer<br />
8<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
STIL<br />
SALON<br />
CICERO<br />
STANDARDS<br />
104 „ES MUSS JA<br />
NICHT ÖDE SEIN“<br />
Was lehren uns die Vampire?<br />
Die Schauspielerin Tilda<br />
Swinton im Interview<br />
Von THOMAS ABELTSHAUSER<br />
106 WEISSE WEIHNACHT<br />
Rotwein im Ohrensessel?<br />
Weißwein ist die Strategie<br />
für diesen Winter!<br />
Von LENA BERGMANN<br />
110 DER HERR DER HÄUSER<br />
<strong>Der</strong> Schwede Lars Sjöberg erklärt<br />
die Liebe zu seinen neun Häusern<br />
Von ULRICH CLEWING<br />
118 WARUM ICH TRAGE,<br />
WAS ICH TRAGE<br />
Punk o<strong>der</strong> Prinzessin, in<br />
Berlin darf je<strong>der</strong> alles sein<br />
Von TIM RAUE<br />
110<br />
Ikeas Vorfahren:<br />
Die Häuser eines Sammlers<br />
120 GRÖSSER ALS WIR SELBST<br />
Die Geigerin Carolin Widmann<br />
verbindet die Alte mit <strong>der</strong> Neuen Musik<br />
Von VOLKER HAGEDORN<br />
122 SITZEN, REDEN, SCHLAFEN AUCH<br />
Die Brü<strong>der</strong> Joel und Ethan Coen<br />
gelten als Inbegriff des lässigen Kinos<br />
Von DIETER OSSWALD<br />
124 DER GEISTERBESCHWÖRER<br />
<strong>Der</strong> Schauspieler Ulrich Tukur singt<br />
und swingt und schrieb ein Buch<br />
Von BJÖRN EENBOOM<br />
126 KNARRE? GASPEDAL!<br />
Videospiele wie GTA bieten eine<br />
perfekte Flucht aus <strong>der</strong> Wirklichkeit<br />
Von ALEXANDER PSCHERA<br />
132 HOPES WELT<br />
Danke, du mich auch!<br />
Von DANIEL HOPE<br />
134 „BEIM ISLAM IST ES HEIKLER“<br />
Ein Gespräch mit dem französischen<br />
Religionsphilosophen Rémi Brague<br />
Von ALEXANDER KISSLER<br />
138 MAN SIEHT NUR,<br />
WAS MAN SUCHT<br />
Franz Marc in <strong>der</strong> Sammlung des<br />
Münchner Kunsthändlers Gurlitt<br />
Von BEAT WYSS<br />
140 LITERATUREN<br />
Bücher von Edith Wharton, Monika<br />
Maron, Stefan Weinfurter und an<strong>der</strong>en<br />
146 BIBLIOTHEKSPORTRÄT<br />
<strong>Der</strong> Architekt Richard Meier ist ein<br />
Kind <strong>der</strong> europäischen Mo<strong>der</strong>ne<br />
Von SEBASTIAN MOLL<br />
5 ATTICUS<br />
Von CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
10 STADTGESPRÄCH<br />
16 FORUM<br />
144 IMPRESSUM<br />
154 POSTSCRIPTUM<br />
Von ALEXANDER MARGUIER<br />
<strong>Der</strong> Titelkünstler<br />
Jens Bonnke illustriert<br />
regelmäßig für <strong>Cicero</strong> –<br />
mit Witz und Leichtigkeit.<br />
Selbst wenn es komplex<br />
wird, zeichnet Bonnke<br />
nie kompliziert, egal ob<br />
<strong>der</strong> Apparat des Verteidigungs<br />
ministeriums Thema<br />
ist o<strong>der</strong> die deutsche<br />
Meinungsforschung.<br />
Diesmal ging es um den<br />
Journalismus und die<br />
Jagd auf Politiker.<br />
Die Redaktion diskutierte<br />
viele Motive: Tontaubenschießen,<br />
die Schießbude<br />
auf dem Rummel, ein<br />
Halali in England. Bonnke<br />
entschied sich für etwas<br />
an<strong>der</strong>es: den blindwütigen<br />
Hund, <strong>der</strong> sich los gerissen<br />
hat und allein den<br />
Instink ten folgt.<br />
Fotos: Ingalill Snitt, Jonas Maron<br />
150 ALLE REIHEN FEST GESCHLOSSEN<br />
Im Dezember 1933 war<br />
<strong>der</strong> nationalsozialistische<br />
Einheitsstaat geschaffen<br />
Von PHILIPP BLOM<br />
152 DIE LETZTEN 24 STUNDEN<br />
Wach bleiben, den Tod erwarten<br />
Von RAINER MARIA WOELKI<br />
9<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
CICERO<br />
Stadtgespräch<br />
Die FDP sucht Trost und Geld, Computer verdrängen Menschen, ein<br />
Chefredakteur pendelt, ein Mandat wird vererbt, ein Skandal weggelächelt<br />
Modell Deutschneudorf:<br />
Erzgebirge <strong>der</strong> Hoffnung<br />
Mensch und Maschine:<br />
Digitale Ansage<br />
FDP braucht Geld:<br />
Kassenfüller Solms<br />
Im Restaurant Ganymed am Schiffbauerdamm,<br />
eines Mittags dieser Tage:<br />
Sitzt da hinten nicht <strong>der</strong> Dings, auch<br />
ohne seine Mütze – tatsächlich, ja: Dirk<br />
Niebel, FDP-Minister mit Restlaufzeit.<br />
Also: Hingehen, Smalltalk, ob man<br />
sich nicht mal wie<strong>der</strong> zum Essen treffen<br />
kann? Niebel sagt: „Sehr gerne!“ und<br />
zückt seine neue Karte. „Bundesminister<br />
a. D.“ steht da und: „Fe<strong>der</strong>al Minister<br />
for Economic Cooperation and Development<br />
(ret.)“. Kommunikationstechnisch<br />
hat für Niebel die Zukunft schon begonnen.<br />
<strong>Der</strong> Herr, <strong>der</strong> mit ihm am Tisch<br />
sitzt, heißt Heinz-Peter Haustein, seit<br />
1994 Bürgermeister von Deutschneudorf<br />
im Erzgebirge – in <strong>der</strong> Oktober-Ausgabe<br />
2012 von <strong>Cicero</strong> als Gemeinde <strong>der</strong><br />
Schatzsucher gefeiert. Deutschneudorf:<br />
liberales Paradies. Zwölf Gemein<strong>der</strong>äte,<br />
alle von <strong>der</strong> FDP. Haustein, FDP, zuletzt<br />
mit 95,07 Prozent <strong>der</strong> 1129 Einwohner<br />
gewählt. Vielleicht weiß so ein Sieger<br />
ja Rat für einen vom Wahldebakel zerzausten<br />
Berliner Liberalen. Guten Appetit,<br />
die Herren. swn<br />
Wie sieht wohl die Frau aus, die<br />
uns in <strong>der</strong> Berliner U-Bahn die<br />
Stationen ansagt o<strong>der</strong> die Unterbrechung<br />
einer Linie wegen Bauarbeiten.<br />
Ist sie blond? O<strong>der</strong> dunkel? Schlank<br />
o<strong>der</strong> drall? Selbst ihr Englisch ist <strong>der</strong> artig<br />
perfekt, dass Kenner <strong>der</strong> Londoner Tube<br />
Heimweh nach <strong>der</strong> Insel bekommen.<br />
Vor allem <strong>der</strong> Hüpfer über <strong>der</strong> zweiten<br />
Silbe, wenn sie „construction“ sagt –<br />
very british. Auch die Herrenstimmen,<br />
die in <strong>der</strong> S-Bahn aus den Lautsprechern<br />
dringen, hören sich ganz echt an.<br />
Ob sich hier wohl Schauspieler o<strong>der</strong><br />
Rundfunksprecher einen Nebenverdienst<br />
machen? O<strong>der</strong> eine Sekretärin<br />
aus <strong>der</strong> Chefetage <strong>der</strong> Berliner Verkehrsbetriebe<br />
BVG? Nichts von alledem,<br />
versichert <strong>der</strong>en Sprecher Klaus<br />
Wazlak. Früher wurden Radioprofis<br />
o<strong>der</strong> Schauspieler engagiert. Heute<br />
generiert <strong>der</strong> Computer die Ansage –<br />
sogar ohne analoge Vorlage: Man tippt<br />
den Text über eine Tastatur ein –<br />
fertig. „<strong>Der</strong> Mensch“, sinniert Wazlak,<br />
„wird zunehmend überflüssig.“ hp<br />
Nach ihrem kläglichen Scheitern bei<br />
<strong>der</strong> Bundestagswahl suchen die<br />
Liberalen einen Schatzmeister, <strong>der</strong> sich<br />
auf Parteienfinanzierung versteht.<br />
Denn <strong>der</strong> FDP stehen pro Jahr rund<br />
2,8 Millionen Euro weniger zur Verfügung<br />
als geplant und sie sitzt auf<br />
8,5 Millionen Euro Schulden. <strong>Der</strong><br />
künftige FDP-Chef Christian Lindner<br />
will einen alten Hasen mit dieser<br />
Aufgabe betrauen, <strong>der</strong> lange im Bundestag<br />
saß und sich auskennt: Hermann<br />
Otto Solms. <strong>Der</strong> war nämlich schon<br />
zweimal Schatzmeister, und besser als<br />
er kennt in <strong>der</strong> FDP keiner die Spen<strong>der</strong>szene,<br />
die den Liberalen allein 2011<br />
sechs Millionen Euro zufließen ließ.<br />
Sehr erpicht auf den Job ist Solms nicht.<br />
Er muss den geplanten Jahres etat von<br />
20 Millionen Euro um 25 Prozent kürzen.<br />
„Lust habe ich gar keine“, gestand er<br />
<strong>Cicero</strong>, „ich habe es schließlich lange<br />
genug gemacht.“ Es sei eine schwierige<br />
Aufgabe, Vertrauen in die Partei<br />
zurückzubringen. „Dazu gehören aber<br />
auch die Parteifinanzen.“ tz<br />
Illustrationen: Jan Rieckhoff<br />
10<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Wer großartige Kaffee-Kreationen liebt,<br />
baut auf Nespresso.<br />
www.nespresso.com
CICERO<br />
Stadtgespräch<br />
Zwischen Isar und Spree:<br />
Gespaltener Focus<br />
Matriarchat im Bundestag:<br />
Erbhof Lengsfeld<br />
USBotschafter im NSAStress:<br />
Charmante Umarmung<br />
Jörg Quoos sagt, bei ihm um die Ecke<br />
gebe es die besten Wiesn-Brathendl<br />
von München. <strong>Der</strong> Chefredakteur des<br />
Focus klingt wie einer, <strong>der</strong> sich auskennt,<br />
wenn er das Lindwurm-Stüberl<br />
empfiehlt. Er besitzt schon seit Jahren<br />
eine Hirschle<strong>der</strong>hose. Nur lei<strong>der</strong><br />
konnte er sie heuer nicht einsetzen.<br />
Focus sagte den geplanten gemeinsamen<br />
Redaktionsbesuch auf <strong>der</strong> Wiesn<br />
wegen Sparmaßnahmen ab.<br />
Quoos pendelt zwischen Berlin, wo<br />
er mit Frau und beiden Kin<strong>der</strong>n wohnt,<br />
und <strong>der</strong> Focus-Zentrale in München,<br />
wo er in einer Kollegen-WG untergekommen<br />
ist. Bayern ist Focus-Land,<br />
im Süden lebt das Gros <strong>der</strong> eher konservativen<br />
Leser. Deshalb ist München<br />
wichtig für Quoos, auch weil er dort<br />
einmal in <strong>der</strong> Woche seinen Verleger<br />
Hubert Burda trifft. Berlin ist aber auch<br />
wichtig, weil man dort unkompliziert<br />
Bundespolitiker trifft. Deshalb ziehen<br />
jetzt die Ressorts Politik und Kultur an<br />
die Spree, während Wirtschaft, Forschung<br />
und Technik in München bleiben.<br />
So spiegelt die persönliche Situation<br />
des Pendlers Quoos die seiner demnächst<br />
gespaltenen Redaktion. Nicht<br />
alle wollen mitziehen, viele zögern.<br />
Bis Mai will Burda mit Focus die<br />
Adresse Potsdamer Straße 7 bezogen<br />
haben und darin auf mehreren Etagen<br />
auch Büros o<strong>der</strong> ganze Redaktionen<br />
von Bunte, Superillu, Guter Rat o<strong>der</strong><br />
Harper’s Bazaar unterbringen – insgesamt<br />
mehr als 200 Mitarbeiter. Und die<br />
besten Wiesn-Hendl? Urmünchner<br />
wissen natürlich, dass das nur ein<br />
Werbespruch für Auswärtige ist. Doch<br />
sie lassen Fremden ihren Glauben. tom<br />
In <strong>der</strong> patriarchalischen Welt <strong>der</strong><br />
Bauern und Fürsten traten üblicherweise<br />
Söhne das Erbe ihrer Väter an.<br />
Auch <strong>der</strong> Deutsche Bundestag hat sich<br />
an diese Regel bisher gehalten. Dort<br />
sind, wenn überhaupt, immer nur<br />
Söhne ihren Vätern gefolgt. Doch bei<br />
<strong>der</strong> Bundestagswahl 2013 hat nach<br />
54 Jahren erstmals das Matriarchat<br />
sein Haupt erhoben. Vera Lengsfeld<br />
hörte auf und vermachte ihrem Sohn,<br />
dem promovierten Physiker Philipp<br />
Lengsfeld, ihr politisches Erbe im<br />
Bundestag. Feministinnen wäre eine<br />
Tochter vermutlich lieber gewesen.<br />
Doch das ficht Lengsfeld ganz und gar<br />
nicht an. Sie war von 1990 bis 1996<br />
für Bündnis 90/Die Grünen und bis<br />
2005 weitere neun Jahre für die CDU<br />
im Bundestag. „Ich bin selig, den<br />
Staffelstab so erfolgreich weitergegeben<br />
zu haben“, sagt sie stolz. Ihr Sohn,<br />
<strong>der</strong> im Wahlkreis Berlin-Mitte mit<br />
22,6 Prozent <strong>der</strong> Zweitstimmen kein<br />
Direktmandat errang, aber über die<br />
CDU-Landesliste in den Bundestag kam,<br />
kommentiert seinen Erfolg mit den<br />
Worten: „Für mich ist ein echter Traum<br />
in Erfüllung gegangen. Und es ist<br />
komisch – obwohl ich ein Neuling bin,<br />
fühlt sich vieles sehr vertraut an. Ich<br />
werde auch regelmäßig, etwa vom<br />
Sicherheitsdienst o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Fahrbereitschaft,<br />
auf meine Mutter angesprochen.“<br />
Was den „Staffelstab“ angeht, so hat<br />
Vera Lengsfeld damit gewiss nicht die<br />
Abgeordnetendiäten gemeint, son<strong>der</strong>n<br />
jenen Wi<strong>der</strong>standsgeist, <strong>der</strong> Mutter und<br />
Sohn schon zu DDR-Zeiten als Bürgerrechtler<br />
ausgezeichnet hat. il<br />
Politiker kennen drei Wege,<br />
Kontra henten zu neutralisieren:<br />
Anpöbeln – wie Pofalla einst Bosbach.<br />
Kopieren – ein Merkel-Trick. Umarmen<br />
– wie Seehofer die Kanzlerin nach<br />
ihrem Wahlsieg. In <strong>der</strong> NSA-Affäre<br />
sind die Rollen so verteilt: Deutschland<br />
pöbelt. US-Botschafter John B.<br />
Emerson umarmt.<br />
Als Berichte über eine Abhörstation<br />
auf dem Dach <strong>der</strong> US-Botschaft<br />
aufkamen, wurde Emerson mit empörten<br />
Briefen überschüttet. <strong>Cicero</strong><br />
bat um einen Rundgang durch das Gebäude,<br />
gern auch mit einem Techniker.<br />
Es kam: eine herzliche Einladung<br />
zum Interview. Emerson empfing<br />
im Erdgeschoss – umzingelt von vier<br />
strahlenden Mitarbeitern. Ausbüchsen,<br />
Dachgucken – war nicht. Stattdessen<br />
Charmeoffensive: <strong>Der</strong> Botschafter<br />
grüßte mit Handschlag, nickte, lächelte.<br />
Sein graues Jackett zierte ein Pin mit<br />
<strong>der</strong> deutschen und <strong>der</strong> amerikanischen<br />
Flagge. Die Journalisten fragten bissig,<br />
nach Merkels Handy, nach Snowden,<br />
dem Untersuchungsausschuss. Emerson<br />
verwies auf Obama, den BND, den<br />
Bundestag. Seine Lieblingsantwort:<br />
„Das ist eine hypothetische Frage.“<br />
So einnehmend sagte er das, so<br />
umwerfend nett, dass man ihm gar<br />
nicht mehr böse sein konnte. <strong>Der</strong> Botschafter<br />
schmeichelte, schäkerte und<br />
machte jeden Käse mit. Sogar auf ein<br />
Twitter-Interview ließ er sich ein.<br />
Hinterher bedankte er sich lachend:<br />
„That was really entertaining.“ Was<br />
für ein Diplomat: Er hatte seinen Spaß.<br />
Und Deutschland? Wird wohl keine<br />
Antworten mehr bekommen. ps<br />
Illustrationen: Jan Rieckhoff<br />
12<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
VERSCHENKEN SIE<br />
BESTNOTEN<br />
Üppige Noten von Eiche, Bratapfel und Zimt<br />
lassen Glenfiddich 18 Jahre zu einem idealen<br />
Geschenk werden. Glenfiddich 15 Jahre überzeugt<br />
mit warmen Gewürz noten und betören<strong>der</strong><br />
Honigsüße, Glenfiddich 12 Jahre mit subtilen<br />
Eichenaromen und charakteristischen Noten<br />
von frischer Birne.<br />
Verschenken Sie Glenfiddich –<br />
den meistausgezeichneten Single Malt <strong>der</strong> Welt.<br />
www.glenfi ddich.com<br />
Glenfi ddich ® Single Malt Scotch Whisky is a registered<br />
trademark of William Grant & Sons Ltd.<br />
ENJOY RESPONSIBLY.
Hoffentlich warnen bald alle Autos<br />
ihre Fahrer vor Falschfahrten.<br />
Mercedes-Benz weist den Weg.<br />
<strong>Der</strong> Verkehrszeichen-Assistent, eine Innovation von<br />
Mercedes-Benz Intelligent Drive. Vernetzt mit allen Sinnen.<br />
<strong>Der</strong> Verkehrszeichen-Assistent erkennt Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote und Einfahrtsverbotsschil<strong>der</strong><br />
an Autobahnauffahrten und warnt den Fahrer vor unbeabsichtigten Falschfahrten. Erleben Sie Mercedes-Benz<br />
Intelligent Drive live – bei Ihrem Mercedes-Benz Partner. www.mercedes-benz-intelligent-drive.com<br />
Erleben Sie bis zum 30.11.2013<br />
Intelligent Drive<br />
Eine Marke <strong>der</strong> Daimler AG<br />
Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 14,4–4,1/7,9–3,7/10,3–4,1 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 242–107<br />
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, son<strong>der</strong>n dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen<br />
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
g/km; Effizienzklasse: F–A+.<br />
Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Son<strong>der</strong>ausstattungen.
CICERO<br />
Leserbriefe<br />
FORUM<br />
Es geht um <strong>Medien</strong>schelte und Layout,<br />
um Siedlungspolitik und Seifenblasen<br />
Zum Beitrag „Räuber und Schreiber“ von Frank A. Meyer, November 2013<br />
Unerträgliche Überheblichkeit<br />
Vielen Dank, Frank A. Meyer, für Ihre treffende Entlarvung <strong>der</strong> Strategie planmäßiger<br />
Herabsetzung von Politikern durch selbst ernannte Berliner Leitmedien.<br />
Ich finde die Melange von Überheblichkeiten, Vorurteilen und psychologisierenden<br />
Vermutungen, verbunden mit <strong>der</strong> Selbsteinschätzung, journalistisch einflussreich<br />
zu sein, bei manchen Spiegel-, Focus- und Bild-Redakteuren oft unerträglich.<br />
Wenn das weiter Schule macht, wird ein <strong>der</strong>art verdorbener Journalismus<br />
es dem seriösen Journalismus schwer machen, mit fundierter Kritik an Politikern,<br />
wenn sie denn berechtigt ist, Gehör zu finden. Lei<strong>der</strong> ist diese Art von Kampagnen-<br />
o<strong>der</strong> Verdachtsjournalismus nicht auf Berlin beschränkt. Auch in <strong>der</strong> Bonner<br />
Provinz scheint sich das lokale Leitmedium, <strong>der</strong> General-Anzeiger, in seiner<br />
Berichterstattung über die ehemalige Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann<br />
und den aktuellen Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch an schlechten Berliner<br />
Vorbil<strong>der</strong>n zu orientieren.<br />
Dr. Hans Walter Schulten, Bonn<br />
Unsaubere Verquickung<br />
Frank A. Meyer spricht mir mit<br />
„Räuber und Schreiber“ aus dem<br />
Herzen. Es macht sich breit, dass<br />
Journalistinnen und Journalisten<br />
Politiker herabwürdigend kommentieren<br />
und bewerten; selbst in Sendungen<br />
wie „ZDF-Morgenmagazin“<br />
o<strong>der</strong> Phoenix: „Vor Ort“ erkennt<br />
man diese Tendenz, und die Onlinedienste<br />
<strong>der</strong> Tages- und Wochenpresse<br />
sind voll von entsprechenden<br />
Artikeln. Kommentare und Meinungen<br />
sind ja okay, aber Berichterstattung<br />
und investigativer Journalismus<br />
sollten damit nicht verquickt<br />
werden. Mein herzlicher Dank für<br />
sehr guten Journalismus gilt Frank<br />
A. Meyer und <strong>Cicero</strong>.<br />
Herbert Nau, München<br />
Notwendige ( Selbst )Zensur<br />
Als ein „Aufschrei“ gegen die rein<br />
polemisch reißerischen Kommentare<br />
<strong>der</strong> <strong>Medien</strong> innerhalb unserer<br />
Politlandschaft darf zu Recht <strong>der</strong><br />
Artikel des Herrn Frank A. Meyer<br />
vernommen werden und zur<br />
Besinnung aufrufen. Nicht <strong>der</strong><br />
„Totschlag“ hinsichtlich politischer<br />
Äußerungen soll das Ziel sein, womöglich<br />
mit <strong>der</strong> Absicht, Absatzzahlen<br />
<strong>der</strong> Zeitungen und Magazine zu<br />
erhöhen. Um die Freisetzung wahrer<br />
politischer Werte ist vorrangig<br />
zu ringen, um das Aufdecken von<br />
Lügen und falschen Versprechen.<br />
Zum Erhalt <strong>der</strong> Pressefreiheit möge<br />
deshalb die <strong>Medien</strong>welt sich selbst<br />
einer notwendigen Zensur unterwerfen,<br />
um weiterhin ihrer Aufgabe<br />
als vierte Gewalt innerhalb unserer<br />
Gesellschaft gerecht zu werden.<br />
Eduard Bie<strong>der</strong>mann, Hamburg<br />
Zum Beitrag „Die urbane Dekadenz“<br />
von Frank A. Meyer, Oktober 2013<br />
Tugenden über Bord<br />
So hat mir ein Beitrag noch nie aus<br />
dem Herzen gesprochen. Endlich<br />
wird einmal das Grundübel unserer<br />
Gesellschaft angesprochen. Es<br />
ist immer deutlicher, dass sämtliche<br />
bürgerlichen Tugenden über Bord<br />
geworfen werden.<br />
Holger Pietzsch, Gerat<br />
Zum neuen Layout von <strong>Cicero</strong>,<br />
Oktober und November 2013<br />
Inhalt geht vor Layout<br />
Ich finde das neue Layout nicht gut,<br />
aber das ist vielleicht Geschmackssache.<br />
Solange die Inhalte bleiben,<br />
okay! Das Cover mit <strong>der</strong> „Überraschungsklappe“<br />
war großartig.<br />
Friedhelm Holstein, Oberhausen<br />
Gelungene Bildsprache<br />
Die Neugestaltung des <strong>Cicero</strong><br />
kommt mo<strong>der</strong>n, aber wohltuend<br />
nicht mo<strong>der</strong>nistisch daher. Die<br />
großflächige Bildsprache und<br />
Typografie empfinde ich als gelungen.<br />
Ein wenig Nostalgie kommt<br />
bei mir auf; dabei denke ich an<br />
Twen aus den Sechzigern.<br />
Manfred Oebel-Hermann, Villnachern, CH<br />
Modischer Gesichtsverlust<br />
Mich bedrückt das Wissen, den<br />
<strong>Cicero</strong> fortan nicht mehr in seinem<br />
bekannten Gewand lesen zu können.<br />
Die neue Gestaltung des Inhalts<br />
nimmt ihm seine Klarheit, indem<br />
sie die Typografie aufweicht.<br />
Die Artikel ergeben sich … <strong>der</strong><br />
Beliebigkeit und verleiten so, darüber<br />
hinwegzublättern, statt zu verweilen.<br />
Ebenfalls bedauerlich ist <strong>der</strong><br />
Wegfall des Avatars <strong>der</strong> Autoren,<br />
<strong>der</strong> jedem Beitrag ein Gesicht gab.<br />
Das Bild <strong>der</strong> Gesamterscheinung<br />
fügt sich ein in eine mittlerweile<br />
zu oft gesehene gestalterische<br />
Mode und verliert dadurch sein<br />
Gesicht, das es einst hatte.<br />
Damit ich weiterhin Freude an<br />
diesem Magazin habe, muss ich<br />
also hoffen, in Zukunft auf die<br />
gute Qualität und Vielseitigkeit des<br />
Inhalts vertrauen zu können.<br />
Edward Greiner, Hamburg<br />
16<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
CICERO<br />
Leserbriefe<br />
Zum Beitrag „Deutsche Geschichte<br />
ist nicht tiefschwarz“ von Ulrich Sieg,<br />
Oktober 2013<br />
Fluch <strong>der</strong> bösen Tat<br />
Bismarck hat das deutsche Reich<br />
nicht „zu Hause“ geschaffen, son<strong>der</strong>n<br />
im Ausland – in Versailles,<br />
denn es war Krieg, ohne den die<br />
Reichsgründung nicht zustande gekommen<br />
wäre. „Das deutsche Volk“<br />
hatte daran keinen Anteil, son<strong>der</strong>n<br />
es waren nur Generäle und Fürsten<br />
zugegen. Einer (<strong>der</strong> persönlich<br />
nicht dabei war!) musste erst mit<br />
viel Geld zweifelhafter Herkunft<br />
bestochen werden, um zuzustimmen<br />
– keine gute Geschäftsgrundlage<br />
für einen Staat, dem „Ehre“<br />
als hohe Tugend galt.<br />
„Das ist <strong>der</strong> Fluch <strong>der</strong> bösen<br />
Tat, dass sie, fortzeugend, Böses<br />
muss gebären“ – hier zwei verlorene<br />
Kriege, die uns Millionen an Toten,<br />
Vermögensverluste unvorstellbaren<br />
Ausmaßes und fast die Hälfte des<br />
Staatsgebiets kosteten.<br />
Ob und in welchem Umfange<br />
wir daran schuldig o<strong>der</strong> mitschuldig<br />
waren, ist heute zweitrangig, denn<br />
zu än<strong>der</strong>n ist es nicht mehr. Wichtig<br />
ist, ob wir etwas daraus gelernt haben.<br />
Hoffen wir es.<br />
Walter Lutz, Nürnberg<br />
Zum Beitrag „Bush reloaded?“<br />
von Roger Cohen, September 2013<br />
Ohne Fragezeichen<br />
Erst jetzt hatte ich Gelegenheit, diesen<br />
Artikel zu lesen.<br />
Inhaltlich kann ich mich mit allen<br />
Einzelheiten identifizieren, allerdings<br />
hätte ich mir im Titel anstatt<br />
des Fragezeichens ein Ausrufungszeichen<br />
gewünscht. Beson<strong>der</strong>s jetzt,<br />
nach <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Syrienkrise.<br />
Gern würde ich den von Frau<br />
Seeling übersetzten Originaltext (in<br />
Englisch) an mehrere Freunde in<br />
den USA und in Israel senden.<br />
Peter Fuchs, Hemmingen<br />
Zum Beitrag „Pro Siedlungen“<br />
von Arthur Cohn, Oktober 2013<br />
Massive Schieflage<br />
Vielen Dank für den Artikel von<br />
Arthur Cohn mit seiner nüchternen<br />
und überzeugenden Darstellung <strong>der</strong><br />
rechtlichen Grundlagen des israelischen<br />
Siedlungsbaus. Diese Aspekte<br />
des Friedensprozesses werden lei<strong>der</strong><br />
in den <strong>Medien</strong> überwiegend übersehen<br />
beziehungsweise verschwiegen.<br />
Dadurch kommt es zu einer massiven<br />
Schieflage in <strong>der</strong> Beurteilung<br />
des Nahostkonflikts. Lei<strong>der</strong> überwiegen<br />
in <strong>der</strong> Öffentlichkeit und in<br />
den <strong>Medien</strong> die emotionalen Stimmen<br />
(siehe den Beitrag von Judith<br />
Hart mit Vokabular wie „dumm“<br />
und „hässlich“). Es muss daran erinnert<br />
werden, dass die Entstehung<br />
und Gründung des Staates Israel auf<br />
Völkerrecht basiert und was die Inhalte<br />
dieser Abkommen waren. Was<br />
ich am <strong>Cicero</strong> schätze, ist, dass auch<br />
sich stark wi<strong>der</strong>sprechende Sichtweisen<br />
nebeneinan<strong>der</strong> dargestellt<br />
und stehen gelassen werden.<br />
Vielen Dank dafür und weiter so!<br />
Katharina Kaiser, München<br />
Zum Gespräch zwischen Peter Sloterdijk<br />
und Martin Walser, November 2013<br />
Geistige Seifenblasen<br />
Beim „Gipfeltreffen <strong>der</strong> Geistesgrößen“<br />
(<strong>Cicero</strong>) überbieten sich Peter<br />
Sloterdijk und Martin Walser in<br />
<strong>der</strong> Kunst, Seifenblasen in die Luft<br />
zu pusten: Botho Strauß, Hans Magnus<br />
Enzensberger, Michael Krüger,<br />
Whitehead, Nietzsche, Sokrates,<br />
Platon, Bazon Brock, Giotto,<br />
Dostojewski, Karl Marx, Niklas<br />
Luhmann, Jean Gebser, Rorty, Arthur<br />
Schopenhauer werden in bunter<br />
Reihenfolge als Intelligenzbeweis<br />
<strong>der</strong> Geistesgrößen in die Luft<br />
geblasen. Walser zitiert 17 Zeilen<br />
lang druckreif aus Platons „Symposion“<br />
Gedanken über den Eros. Das<br />
Resümee: „Diese gesteigerte Schönheit,<br />
die nicht in eine Glanzpostille<br />
gehört“, ist nach Walsers Meinung<br />
„Frau Merkel“. Ich bin offenbar zu<br />
dumm, den Höhenflügen dieser<br />
Geistesgrößen zu folgen.<br />
Norbert Blüm, Bundesminister a. D., Bonn<br />
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.<br />
Wünsche, Anregungen und Meinungsäußerungen<br />
senden Sie bitte an redaktion@cicero.de<br />
Karikatur: Hauck & Bauer<br />
18<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Wir sind von<br />
Kopf bis Fuß auf<br />
Getriebe eingestellt.<br />
Willkommen im Land <strong>der</strong><br />
Pferdestärken.<br />
Nie<strong>der</strong>sachsen bewegt die Welt.<br />
Entdecken Sie die Region, in <strong>der</strong> Mobilität zu Hause<br />
ist. Wir bauen schicke Autos in Wolfsburg, wichtige<br />
Flugzeugteile in Stade, große Schiffe an <strong>der</strong> Nordsee.<br />
Und alles sonst, was die Menschheit auf Trab hält.<br />
www.innovatives.nie<strong>der</strong>sachsen.de<br />
Sie kennen unsere Pferde. Erleben Sie unsere Stärken.
TITEL<br />
Fass!<br />
DER<br />
SCHÄDLICHE<br />
SKANDAL<br />
Von JULIAN NIDA-RÜMELIN<br />
Wulff, Steinbrück, Brü<strong>der</strong>le, Gaschke:<br />
Die Aufregung über Politiker ist maßlos geworden.<br />
Die <strong>Medien</strong> skandalisieren gern das Persönliche<br />
und Private. Um die politische Verantwortung<br />
geht es allenfalls am Rande<br />
20<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
TITEL<br />
Fass!<br />
Die demokratische Staatsund<br />
Gesellschaftsform ist<br />
an Bedingungen geknüpft,<br />
die keineswegs selbstverständlich<br />
sind. Zu diesen<br />
Bedingungen gehört eine politische Öffentlichkeit.<br />
Die auch in Deutschland<br />
unterdessen zu beobachtende Skandalisierung<br />
<strong>der</strong> Politik stellt zweifellos Öffentlichkeit<br />
her, sie trägt aber zugleich<br />
zur Entpolitisierung bei. Das Ausmaß<br />
<strong>der</strong> Skandalisierung hat in einigen Län<strong>der</strong>n,<br />
vorneweg den USA und Italien, ein<br />
demokratiegefährdendes Ausmaß angenommen.<br />
Deutschland ist noch nicht so<br />
weit, und es besteht Hoffnung, dass es so<br />
weit erst gar nicht kommt. Voraussetzung<br />
ist, dass wir in Deutschland im Wortsinne<br />
zur Besinnung kommen. Einige Wochen<br />
nach <strong>der</strong> Bundestagswahl ist dafür vielleicht<br />
ein günstiger Zeitpunkt.<br />
Die wichtigste Ingredienz eines Skandals<br />
ist die moralische Fallhöhe. Im nach<br />
wie vor puritanischen Milieu <strong>der</strong> protestantischen<br />
weißen akademischen Mittelschicht<br />
<strong>der</strong> amerikanischen Ostküste<br />
besteht eine beträchtliche moralische<br />
Fallhöhe, sobald es um Sexualität geht.<br />
Ein bemerkenswerter Fall ist <strong>der</strong> des<br />
demokratischen Senators Anthony Weiner,<br />
<strong>der</strong> sein Internet-Techtelmechtel<br />
mit einer jungen Verehrerin versehentlich<br />
gegenüber allen seinen Twitter-Followern<br />
öffentlich machte. Die Aufregung<br />
war ebenso groß wie die Scheinheiligkeit<br />
selbst seriöser Zeitungen, auch in<br />
Deutschland, die sich über diesen Fall<br />
nicht nur mokierten, son<strong>der</strong>n sogleich<br />
das definitive Ende einer hoffnungsvoll<br />
begonnenen politischen Karriere diagnostizierten.<br />
Ein verheirateter Mann,<br />
<strong>der</strong> ein Techtelmechtel mit einer Verehrerin<br />
hat, sei natürlich moralisch nicht<br />
geeignet für politische Ämter. Politiker<br />
müssten schließlich Vorbil<strong>der</strong> sein, wie es<br />
durch alle politischen und intellektuellen<br />
Lager hinweg wie<strong>der</strong> und wie<strong>der</strong> betont<br />
wird. Es spricht für die Stadt New York,<br />
und für einen gewissen Reifeprozess in<br />
Teilen <strong>der</strong> Demokratischen Partei, dass<br />
Weiner zunächst dennoch eine Zeit lang<br />
als Kandidat für das Amt des New Yorker<br />
Bürgermeisters gehandelt wurde.<br />
Christian Wulff geriet kurz nach<br />
Amtsantritt in große mediale Turbulenzen,<br />
ausgelöst durch ein kaum glaubliches<br />
Maß menschlicher Nie<strong>der</strong>tracht:<br />
Die Justiz<br />
hat im Fall Wulff<br />
nichts aufgedeckt,<br />
was die<br />
Skandalisierung<br />
über Wochen<br />
und Monate<br />
rechtfertigen<br />
würde<br />
Hannoveraner Parteifreunde streuten<br />
eine vermeintliche Rotlichtvergangenheit<br />
<strong>der</strong> Präsidentengattin, das junge<br />
Paar reagierte nervös und ungeschickt.<br />
Ein schwer zu durchschauen<strong>der</strong> Komplex<br />
aus Boulevardjournalismus, politischer<br />
Macht und ökonomischem Lobbyismus<br />
brach auseinan<strong>der</strong>, Freundschaften wurden<br />
geopfert, persönliche Kränkungen,<br />
zerstörte Biografien. <strong>Der</strong> jüngste Bundespräsident,<br />
den die Republik je hatte,<br />
eine Zeit lang zum Symbol einer neuen<br />
Republik <strong>der</strong> Patchwork-Familien und <strong>der</strong><br />
Weltoffenheit stilisiert, ist aufgrund einer<br />
Kaskade von Skandalen und Skandälchen<br />
tief gefallen und zieht bis heute vor allem<br />
Verachtung auf sich. In auffälligem Kontrast<br />
dazu steht die bisherige strafrechtliche<br />
Aufarbeitung dieser Skandalserie. Da<br />
ist nichts aufgedeckt worden, was diese<br />
Skandalisierung, an <strong>der</strong> sich alle, auch die<br />
seriösen <strong>Medien</strong>, über Wochen und Monate<br />
beteiligt hatten, rechtfertigen würde.<br />
Und schließlich <strong>der</strong> hoffnungsvolle<br />
Kandidat <strong>der</strong> SPD für die Kanzlerschaft.<br />
Von zahlreichen <strong>Medien</strong>, darunter <strong>Cicero</strong><br />
und Spiegel, über Monate hinweg zur<br />
politischen Geheimwaffe verklärt, stolpert<br />
er nicht nur wegen Tapsigkeiten <strong>der</strong><br />
Wahlkampfplanung, son<strong>der</strong>n auch wegen<br />
seiner privaten Vortragstätigkeit in<br />
ein Kandidatenrennen, in dem er gleich<br />
vom Start weg persönlich nachhaltig beschädigt<br />
wird. Es ist nicht genau zu bestimmen,<br />
worin <strong>der</strong> gefühlte Skandal<br />
eigentlich bestand: Darin, dass Steinbrück<br />
Vortragshonorare in einer Höhe<br />
nahm, die für Normalsterbliche exorbitant<br />
erscheinen müssen? Darin, dass<br />
er dies für sein gutes Recht hielt? Darin,<br />
dass er in seinem Lebenswandel nicht<br />
ganz dem Durchschnitt <strong>der</strong> SPD-Wählerschaft<br />
entsprach? Jedenfalls war die –<br />
wie auch immer begründete – Skandalisierung<br />
politisch äußerst wirksam: Über<br />
Wochen hinweg ging es nicht um Inhalte,<br />
son<strong>der</strong>n lediglich um Stilfragen – rechtlich<br />
und politisch Relevantes war dabei<br />
nicht im Spiel.<br />
<strong>Der</strong> Tiefpunkt deutscher Skandalisierung<br />
des Politischen wurde jedoch<br />
mit <strong>der</strong> Brü<strong>der</strong>le-Affäre erreicht. Die<br />
Bemerkung des FDP-Politikers zu später<br />
Stunde an einer Hotelbar, dass nach<br />
seiner Einschätzung eine Journalistin<br />
gut ein Dirndl ausfüllen könne, Zitate<br />
über Kuheuter und weinseliges Auftreten<br />
in volkstümlichem Umfeld, reichten<br />
aus, um einen Skandal loszutreten, <strong>der</strong><br />
durchaus an US-amerikanische Vorbil<strong>der</strong><br />
gemahnte. Brü<strong>der</strong>le reagierte ertappt,<br />
hilflos und tief getroffen, was <strong>der</strong> Wahlkampagne<br />
<strong>der</strong> FDP dauerhaft schadete.<br />
Schließlich <strong>der</strong> Skandal um eine –<br />
jedenfalls prozedural, vielleicht auch<br />
inhaltlich – falsche Entscheidung <strong>der</strong><br />
neuen Kieler Oberbürgermeisterin Susanne<br />
Gaschke, einer Seiteneinsteigerin<br />
aus dem politischen Journalismus in die<br />
Politik. Auch hier steht das Ausmaß <strong>der</strong><br />
öffentlichen Erregung in keinem nachvollziehbaren<br />
Verhältnis zum Anlass:<br />
Eine allzu rasche Übernahme einer Verwaltungsempfehlung,<br />
um ein seit vielen<br />
Jahren ungelöstes Problem beherzt abzuräumen,<br />
Sturheit und Rechthaberei<br />
<strong>der</strong> Politiknovizin, Intrigen im Parteiumfeld,<br />
alte persönliche Konflikte neu<br />
aufgewärmt und eine offenbar in Schleswig-Holstein<br />
seit Jahrzehnten beson<strong>der</strong>s<br />
tief verankerte politische Misstrauenskultur<br />
reichten aus, um eine Tragödie zu inszenieren,<br />
die die Politikhoffnung physisch<br />
und psychisch angeschlagen auf dem<br />
Schlachtfeld zurückließ. Um politische Inhalte<br />
ging es dabei allenfalls am Rande.<br />
DIE IDEE VOM<br />
VORBILDLICHEN POLITIKER<br />
Skandale dieser Kategorie haben eine<br />
Gemeinsamkeit: Sie leben von <strong>der</strong> Idee<br />
<strong>der</strong> Vorbildhaftigkeit des einzelnen Politikers.<br />
In den USA ist es schon zu einer<br />
Art Gesetzmäßigkeit geworden, dass<br />
Illustration: Jens Bonnke (Seiten 20 bis 21)<br />
22<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Eintritt frei<br />
bis 16 Jahre<br />
Alfred Hitchcock, Frankfurt am Main, 1972 © Barbara Klemm<br />
BARBARA<br />
KLEMM<br />
Fotografien 1968 –2013<br />
Berliner Festspiele<br />
Martin-Gropius-Bau Berlin<br />
16. November 2013 – 9. März 2014<br />
Nie<strong>der</strong>kirchnerstr. 7, 10963 Berlin, Mi – Mo 10 – 19 Uhr, Di geschl.<br />
Online-Tickets: www.gropiusbau.de
TITEL<br />
Fass!<br />
Senatoren, die erneut kandidieren, nur<br />
dann abgelöst werden können, wenn<br />
ihnen eine außereheliche Affäre nachgewiesen<br />
o<strong>der</strong> oft genug auch nur angehängt<br />
wird. Dies kommt merkwürdigerweise<br />
bei Senatorinnen nicht vor, ob<br />
das daran liegt, dass Senatorinnen keine<br />
außerehelichen Affären haben o<strong>der</strong> ob<br />
das eher einem Geschlechterklischee geschuldet<br />
ist, mag hier offenbleiben. Die<br />
Skandalisierung funktioniert nach einem<br />
einfachen Muster: Wer Politiker ist, sollte<br />
Vorbild sein. Wer Vorbild ist, geht nicht<br />
fremd. Wer fremdgeht, betrügt seine<br />
Frau. Wer seine Frau betrügt, betrügt<br />
auch an<strong>der</strong>e. Wähler wollen sich nicht<br />
betrügen lassen. <strong>Der</strong> Betreffende ist also<br />
für die Politik ungeeignet.<br />
Wer diese Beurteilungsmuster infrage<br />
stellt, kann sich nicht darauf beschränken,<br />
Sind Politiker<br />
Vorbil<strong>der</strong>?<br />
Sollten sie<br />
überhaupt<br />
Vorbil<strong>der</strong> sein?<br />
Wenn ja, in<br />
welchem Sinne?<br />
den einen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Sün<strong>der</strong> zu exkulpieren,<br />
son<strong>der</strong>n sollte das Argumentationsmuster<br />
als solches infrage stellen: Sind<br />
Politiker Vorbil<strong>der</strong>? Sollten Politiker Vorbil<strong>der</strong><br />
sein? Wenn ja, in welchem Sinne?<br />
Es ist wünschenswert, dass Menschen<br />
sich bewegen, auf ihre Gesundheit<br />
achten, Sport treiben und sich fit halten<br />
wie Michelle Obama. In den USA ist<br />
daher <strong>der</strong> Politiker im Jogginganzug, begleitet<br />
von Bodyguards, schon ikonografisch<br />
geworden. Spätestens seit Jimmy<br />
Carters verbissenem Lauf bis zur völligen<br />
Erschöpfung weiß die politische<br />
Klasse auch um die Risiken dieser Inszenierung.<br />
Wollen wir nicht auch wissen,<br />
wie sich unsere Vorbil<strong>der</strong> aus <strong>der</strong><br />
Politik im Privaten, speziell im familiären<br />
Umfeld verhalten? Kümmern sie sich<br />
hinreichend um den Bildungserfolg ihrer<br />
Kin<strong>der</strong>? Sind sie tolerant gegenüber an<strong>der</strong>en<br />
Lebensformen beziehungsweise –<br />
je nach politischem Milieu – achten sie<br />
auf sittenstrengen Lebenswandel ihres<br />
Nachwuchses? Können wir uns einer Politikerin<br />
anvertrauen, <strong>der</strong>en halbwüchsiger<br />
Sohn durch Trunkenheit auffällt?<br />
Wie steht es eigentlich um den regelmäßigen<br />
Gottesdienstbesuch? Und natürlich<br />
interessiert uns auch <strong>der</strong> Gesundheitszustand<br />
unserer Repräsentanten.<br />
Die Veröffentlichung ärztlicher Atteste<br />
ist in den USA zur Selbstverständlichkeit<br />
geworden.<br />
Wollen wir das? Wollen wir, dass die<br />
öffentliche und die private Rolle <strong>der</strong>art<br />
vermengt werden? Und wenn nein, welches<br />
Argument spräche denn eigentlich<br />
dagegen?<br />
DIE VERMISCHUNG DES PRIVATEN<br />
MIT DEM ÖFFENTLICHEN<br />
Gegen die Vermengung <strong>der</strong> privaten und<br />
<strong>der</strong> öffentlichen Rolle spricht, dass die<br />
gesamte normative Ordnung <strong>der</strong> Demokratie<br />
von <strong>der</strong> urliberalen Idee <strong>der</strong> Trennung<br />
des Öffentlichen und des Privaten<br />
geprägt ist. Das mittelalterliche und frühneuzeitliche<br />
Dorf kannte diese Trennung<br />
nicht. Alle bekamen so gut wie alles mit<br />
und fühlten sich berechtigt, darüber zu<br />
urteilen. Es ist erst die Anonymisierung<br />
und Versachlichung städtischer Kultur,<br />
die Demokratie im mo<strong>der</strong>nen Sinne kulturell<br />
ermöglicht. Die eigene Wohnung<br />
wird vor Einblicken geschützt und das<br />
Familienleben vor Interventionen von<br />
Illustration: Jens Bonnke<br />
24<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
www.fischerverlage.de<br />
Die Geschichte<br />
<strong>der</strong> drei Mafia-Clans:<br />
»Eine hervorragende<br />
Sozialgeschichte<br />
und haarsträubende<br />
True-Crime-Story zugleich.«<br />
The Independent<br />
896 Seiten, gebunden, € (D) 24,99<br />
Sie stehen für Korruption,<br />
Sub ventionsbetrug, Menschenhandel,<br />
Erpressung und Mord.<br />
Je<strong>der</strong> dieser Mafiaclans hat<br />
seine eigene Geschich te, dunklen<br />
Rituale, Grausamkeiten und<br />
speziellen Geschäfts methoden.<br />
Die brutale Wahrheit hinter<br />
den Mythen, glänzend erzählt<br />
von Bestsellerautor John Dickie,<br />
spannend, packen<strong>der</strong> als<br />
je<strong>der</strong> Krimi.
TITEL<br />
Fass!<br />
außen. Wer seine Wohnung o<strong>der</strong> sein<br />
Haus verlässt, betritt dagegen die öffentliche<br />
Sphäre <strong>der</strong> Stadt, kleidet und verhält<br />
sich entsprechend.<br />
In <strong>der</strong> politischen Philosophie von<br />
Jean-Jacques Rousseau ist <strong>der</strong> bourgeois<br />
nicht etwa <strong>der</strong> Eigentümer von Produktionsmitteln,<br />
wie später bei Karl Marx, son<strong>der</strong>n<br />
<strong>der</strong>, <strong>der</strong> sich um die eigenen Interessen<br />
kümmert, während <strong>der</strong> citoyen, <strong>der</strong><br />
Bürger, Teil einer sittlichen Körperschaft<br />
ist, <strong>der</strong> gesetzgebenden Versammlung, in<br />
<strong>der</strong> die eigenen Interessen keine, das Gemeinwohl<br />
dagegen die allein ausschlaggebende<br />
Rolle spielt. <strong>Der</strong> Mensch wird damit<br />
nicht schizophren, obwohl er in einen<br />
Untertan als bourgeois und in einen Souverän<br />
als Gesetzgeber zerfällt.<br />
Rousseau hat diese Teilung nicht erfunden,<br />
wenn er auch ihre politischen und<br />
ethischen Implikationen radikalisierte.<br />
Bei Aristoteles über 2000 Jahre früher<br />
hieß <strong>der</strong> bourgeois noch idiotes, <strong>der</strong>, <strong>der</strong><br />
sich nur um das Eigene kümmert. Dagegen<br />
zeichnete sich <strong>der</strong> Vollbürger, <strong>der</strong> polites,<br />
dadurch aus, dass er sich in freiwilliger<br />
Kooperation mit an<strong>der</strong>en um die<br />
öffentlichen Angelegenheiten, um das<br />
Gemeinsame in <strong>der</strong> Stadt kümmert. <strong>Der</strong><br />
polites war nicht <strong>der</strong> Politiker, son<strong>der</strong>n<br />
eher <strong>der</strong> Bürger, <strong>der</strong> Verantwortung für<br />
seine Stadt, für die politische Gemeinschaft,<br />
in <strong>der</strong> er lebt, übernimmt.<br />
Idiotes war – noch – kein Schimpfwort.<br />
Aber Aristoteles äußert sich verächtlich<br />
über diejenigen, die nur das Eigene<br />
kennen, sei es, weil sie ein Leben<br />
des Genusses anstreben o<strong>der</strong> ein Leben<br />
des Reichtums. Die Guten streben nach<br />
einem Leben <strong>der</strong> Ehre (time), <strong>der</strong> Anerkennung,<br />
des Respekts, wohl wissend,<br />
dass das Faktum <strong>der</strong> Anerkennung noch<br />
kein Beleg für die eigene Vortrefflichkeit<br />
ist. Die Anerkennung kann irrtümlich<br />
sein. Ein Leben, das auf das Gute<br />
<strong>der</strong> Stadt gerichtet ist, ist ein erfülltes.<br />
Es bezieht seinen Inhalt aus <strong>der</strong> Erkenntnis<br />
dieses Guten. Es sei wie bei einem<br />
Bogenschützen, meint Aristoteles in <strong>der</strong><br />
„Nikomachischen Ethik“ gleich zu Beginn:<br />
Wenn das Ziel bekannt ist, wenn<br />
man weiß, was das Gute für die Stadt<br />
ist, ist es leichter, das Gute für den Einzelnen<br />
zu bestimmen. Das Eigene ist im<br />
Haus zu regeln. Ökonomie ist an ihrem<br />
Ursprung so etwas wie die Lehre einer<br />
guten Haushaltsführung. Ta politika, die<br />
Politiker sollten<br />
nach Kriterien<br />
des Gelingens<br />
und Scheiterns<br />
beurteilt werden.<br />
Nicht nach<br />
privaten<br />
Wertungen<br />
Zur Person<br />
JULIAN NIDA-RÜMELIN<br />
<strong>Der</strong> Philosoph, 58, entstammt<br />
einer Münchner Künstlerfamilie.<br />
Seine wissenschaftliche Laufbahn<br />
führte ihn über Minneapolis,<br />
Tübingen und Göttingen zurück<br />
nach München, wo er eine<br />
Professur an <strong>der</strong> LudwigMaximiliansUniversität<br />
hat. Er war<br />
Kulturstaatsminister im ersten<br />
Kabinett Schrö<strong>der</strong> und nimmt an<br />
den Verhandlungen über eine<br />
Große Koalition als Mitglied <strong>der</strong><br />
Arbeitsgruppe Kultur teil. Zum<br />
Thema erschienen von ihm:<br />
„Demokratie und Wahrheit“<br />
( C. H. Beck, 2006 ) und „Verantwortung“<br />
( Reclam, 2011 )<br />
Angelegenheiten <strong>der</strong> Polis, sind Aufgabe<br />
eines entfalteten Lebens als freier Bürger<br />
einer Stadt.<br />
Um hier nicht den Vorwurf romantischer<br />
Idealisierung heraufzubeschwören,<br />
sei eilig hinzugefügt: Natürlich,<br />
diese Konzeption im alten Athen<br />
beruhte auf Ausschließung <strong>der</strong> Frauen,<br />
<strong>der</strong> Sklaven und <strong>der</strong> metoiken, jener<br />
Halbbürger, die als Einwan<strong>der</strong>er nur<br />
über eingeschränkte Bürgerrechte verfügten<br />
und zu denen auch Aristoteles<br />
zählte. Aber die Trennung des Öffentlichen<br />
und des Privaten ist keine Erfindung<br />
des bürgerlichen Zeitalters, <strong>der</strong> politischen<br />
Mo<strong>der</strong>ne. Diese Trennung ist<br />
konstitutiv, sowohl für die historisch<br />
erste Form <strong>der</strong> Stadtdemokratie wie für<br />
die mo<strong>der</strong>ne Demokratie.<br />
Wir sind dabei, diese Trennung rückabzuwickeln.<br />
Die Neugier, die allgemein<br />
menschlich sein mag, gerichtet auf die<br />
persönlichen Angelegenheiten <strong>der</strong> Nachbarin,<br />
<strong>der</strong> Freunde, <strong>der</strong> nahen Verwandten,<br />
wird – medial vermittelt – ausgedehnt<br />
auf potenziell jede Person. Wenn<br />
das Schlaglicht medialer Aufmerksamkeit<br />
auf das private Leben gerichtet wird,<br />
ist nichts mehr vor <strong>der</strong> Neugier sicher,<br />
auch nicht die intimsten Bereiche <strong>der</strong><br />
Existenz. Eine ganze Branche lebt von<br />
diesem Phänomen.<br />
In <strong>der</strong> jüngsten Kulturgeschichte<br />
westlicher Gesellschaften hat es eine ungute<br />
Melange einer politisch linksstehenden<br />
o<strong>der</strong> sich als links definierenden Politisierung<br />
des Privaten seit den 68ern und<br />
einer Kommerzialisierung öffentlicher<br />
Neugier in bunten Blättchen, aber zunehmend<br />
auch in <strong>der</strong> seriösen Presse gegeben.<br />
Das Resultat ist die schleichende<br />
Zerstörung <strong>der</strong> normativen Grundlagen<br />
<strong>der</strong> Demokratie.<br />
DIE FUNKTION DES<br />
POLITISCHEN SKANDALS<br />
Demokratie verlangt nach einer öffentlichen<br />
Sphäre, in <strong>der</strong> nach öffentlichen<br />
Kriterien gewertet und beurteilt wird.<br />
Es ist <strong>der</strong> Austausch politischer Gründe,<br />
die diese öffentliche Sphäre ausmachen.<br />
Keine Demokratie ohne gemeinwohlorientierte<br />
Öffentlichkeit. Was ist gut für<br />
unser Land, für Europa, für die Welt?<br />
Welche Vorschläge gibt es, dieses zu erreichen?<br />
Welche Kosten und welche Nebenfolgen<br />
sind zu erwarten? Sind die<br />
Foto: Picture Alliance/dpa/Süddeutsche<br />
26<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
“Ein Meisterwerk!” DIE ZEIT<br />
Anzeige<br />
politischen Strategien zur Erreichung<br />
dieser Ziele in sich schlüssig, und in welcher<br />
Gesellschaft wollen wir leben?<br />
Politik gestaltet Lebensbedingungen<br />
über Gesetze und Institutionen. Politische<br />
Praxis hat ihre eigenen Kriterien<br />
des Gelingens und des Scheiterns.<br />
Nach diesen Kriterien gilt es zu urteilen,<br />
nach Kriterien politischer Öffentlichkeit,<br />
nicht nach den wie auch immer<br />
gestalteten, von partikularen Prägungen<br />
abhängigen, von Lebensform, Religion<br />
und Vorurteil bestimmten privaten Wertungen.<br />
Die Skandalisierung von Politikerinnen<br />
und Politikern ebnet den<br />
Unterschied zwischen öffentlich und<br />
privat ein. Sie zerstört damit eine unverzichtbare<br />
kulturelle Voraussetzung<br />
<strong>der</strong> Demokratie.<br />
Heißt dies, dass es in <strong>der</strong> Politik keinen<br />
Skandal mehr geben kann? Geht es<br />
nur um die sachliche Beurteilung des Für<br />
und Wi<strong>der</strong> von Projekten, Finanzierungen,<br />
institutionellen Vorkehrungen, Verträgen<br />
und Gesetzentwürfen? Ist in einer<br />
rationalen politischen Ordnung kein<br />
Raum für Empörung, für Skandal?<br />
<strong>Der</strong> Watergate-Skandal von Richard<br />
Nixon hat nicht nur dessen Präsidentschaft<br />
zu einem unrühmlichen Abschluss<br />
gebracht, son<strong>der</strong>n den Parteiund<br />
Wahlkampfstrategen in den USA<br />
für alle Zukunft Fesseln auferlegt. Es<br />
handelte sich hier um einen genuin politischen<br />
Skandal. Die politische Praxis,<br />
das Agieren als Politiker und die Form<br />
<strong>der</strong> Unterstützung von Politikern standen<br />
in <strong>der</strong> Kritik, nicht private Verfehlungen.<br />
Die großen Skandale <strong>der</strong> noch<br />
jungen Bundesrepublik, eine beachtliche<br />
Anzahl von ihnen mit dem Namen<br />
Franz Josef Strauß verbunden, waren –<br />
mit wenigen Ausnahmen – ebenfalls politische<br />
Skandale.<br />
Politische Verantwortlichkeit ist in<br />
<strong>der</strong> Demokratie eines <strong>der</strong> höchsten Güter.<br />
Genuin politische Skandale können klären,<br />
wo die Grenzen politischer Verantwortung<br />
liegen, wer ihr gerecht wird und<br />
wer nicht, sie sind wichtig für das Funktionieren<br />
<strong>der</strong> Demokratie. Genuin politische<br />
Skandale werden ausgelöst durch Handlungen<br />
im öffentlichen Amt. Sie fokussieren<br />
die öffentliche Aufmerksamkeit, bündeln<br />
die Kritik und führen im günstigsten<br />
Fall zu Verän<strong>der</strong>ungen, die die Demokratie<br />
stärken und nicht schwächen.
TITEL<br />
Fass!<br />
DIE KLICKFABRIK<br />
Schneller, aggressiver, emotionaler:<br />
Die Mechanismen <strong>der</strong> Online-Welt haben die<br />
<strong>Medien</strong> radikal verän<strong>der</strong>t<br />
Von MERLE SCHMALENBACH<br />
Manchmal, um zwei Uhr nachts,<br />
sitzt Jule Lutteroth im Pyjama<br />
vor ihrem Rechner und sammelt<br />
Leser ein. Etwas Wichtiges ist passiert.<br />
Irgendwo auf <strong>der</strong> Welt. Sie tippt<br />
eine Nachricht. Titel, Teaser, Text. Jedes<br />
Wort muss sitzen. Das gehört zu ihrem<br />
Job. Lutteroth arbeitet bei Spiegel<br />
Online. Sie darf nichts verpassen.<br />
Lutteroth, 45, berichtet von ihren<br />
Einsätzen im Pyjama nicht ächzend,<br />
auch nicht sarkastisch. Eher sachlich.<br />
Immer online sein, immer auf <strong>der</strong> Jagd<br />
nach News, nach Klicks, das ist zu ihrer<br />
Routine geworden. Die Zeitung <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne<br />
erscheint morgens, mittags, abends.<br />
24 Stunden am Tag. Aktualisiert wird im<br />
Minutentakt. Es gibt eine Klickquote. Sie<br />
misst, wie häufig die Nutzer einzelne Artikel<br />
aufrufen. Sie ist genauer und härter<br />
als die des Fernsehens, die erst am nächsten<br />
Tag vorliegt. Die Macher haben sie<br />
umgehend auf dem Schirm. In Echtzeit.<br />
Die Quote treibt die Online-<strong>Medien</strong> an,<br />
die den Zeitungen, Radios und Fernsehsen<strong>der</strong>n<br />
Druck machen. Sie hat die Branche<br />
verän<strong>der</strong>t.<br />
12.23 Uhr. Jule Lutteroth geht durch<br />
den Newsroom, lässt sich auf ihren Stuhl<br />
fallen. Sie trägt kurze Haare, eine große<br />
Brille. Auf dem Schreibtisch stehen drei<br />
Monitore. So kann sie gleichzeitig texten,<br />
in die Meldungen <strong>der</strong> Nachrichtenagenturen<br />
gucken und n-tv schauen. An <strong>der</strong><br />
Wand hängen sechs Bildschirme. BBC,<br />
CNN, Al Jazeera, die Online-Angebote<br />
von New York Times, Wall Street Journal<br />
und La Repubblica. Die Informationen<br />
prasseln auf Lutteroth ein.<br />
Sie greift zur Maus, öffnet ein Programm<br />
namens Metrix. Es zeigt ihr, welche<br />
Schlagzeilen sich gerade am besten<br />
klicken. Kleine Zahlen hocken auf den<br />
Artikeln, eine Eins, eine Fünf, eine Acht.<br />
Es ist die Schlagzeilen-Hitparade. Lutteroth<br />
öffnet das nächste Programm, sie<br />
sieht die genauen Statistiken. <strong>Der</strong> Artikel<br />
„So gestresst sind die Deutschen“ hat<br />
bis jetzt 52 426 Klicks erreicht. Dreimal<br />
am Tag, sagt Lutteroth, schaut sie sich die<br />
Zahlen an. Sie hat ein Gespür dafür entwickelt,<br />
was beim Leser ankommt.<br />
Lutteroth ist ein ruhiger Typ. Sie<br />
arbeitet seit 2001 bei Spiegel Online,<br />
stieg zur Chefin vom Dienst auf, dann<br />
zur stellvertretenden Chefredakteurin.<br />
Sie redet leise, bestimmt. Um sie herum<br />
Illustration: Jens Bonnke<br />
28<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
aust Stimmengewirr. Redakteure telefonieren,<br />
sie rattern mit den Tastaturen.<br />
Die Schreibtische stehen dicht an dicht,<br />
165 Menschen arbeiten für Spiegel Online,<br />
80 davon sitzen im Großraumbüro<br />
in Hamburg. Von hier aus jagt die Redaktion<br />
täglich bis zu 140 Artikel in die<br />
Welt. Eine Kommandozentrale. Wenn<br />
die Redakteure hier entscheiden, in eine<br />
Skandalgeschichte groß einzusteigen,<br />
verschärft sich das Problem für den Betreffenden<br />
– egal, ob er Brü<strong>der</strong>le, Steinbrück<br />
o<strong>der</strong> Tebartz-van Elst heißt. An<strong>der</strong>erseits:<br />
Etwas auszulassen, mal eine<br />
Pause einzulegen, würde bedeuten, <strong>der</strong><br />
Konkurrenz das Thema zu schenken.<br />
Lutteroth schiebt die Maus weiter. Sie<br />
hat sich Lesezeichen gesetzt, für Seiten<br />
wie Süddeutsche . de, Welt . de und FAZ . net.<br />
„Wir haben die Konkurrenz immer im<br />
Blick“, sagt sie. Alle machen das so. Deshalb<br />
ähneln sich die Themen, die Meinungen,<br />
die Gewichtungen.<br />
<strong>Der</strong> Stoffhunger ist riesig. Die<br />
Klickfabriken liefern. Spiegel Online<br />
bringt alle drei Stunden einen neuen<br />
Aufmacher. Ist die Nachrichtenlage langweilig,<br />
werden Themen zugespitzt. O<strong>der</strong><br />
alten Geschichten wird ein neuer Dreh<br />
verpasst. Hat ein Medium etwas Spannendes,<br />
setzen sich alle drauf, schaukeln<br />
sich gegenseitig hoch. Onliner, Agenturen,<br />
Radios, Zeitungen, Talkshows.<br />
In vielen Redaktionen des Landes<br />
sind die Ressourcen knapp. Die reichweitenstärksten<br />
Nachrichtenseiten sind<br />
Bild . de, Spiegel Online, Focus Online,<br />
Welt . de und Süddeutsche . de. Sich an<br />
eine ihrer Geschichten dranzuhängen,<br />
ist günstiger, als selbst welche zu recherchieren.<br />
<strong>Der</strong> Journalismus wird dadurch<br />
stromlinienförmiger, schneller, härter.<br />
Hypes entstehen. Und genauso schnell<br />
verpuffen sie.<br />
Neulich ging Thorsten Denkler ins<br />
Kino, es war 19 Uhr, „Die an<strong>der</strong>e Heimat“<br />
von Edgar Reitz lief, ein Film mit<br />
„Wenn ein<br />
Thema viele<br />
Menschen<br />
interessiert, ist<br />
es relevant. Und<br />
dann klickt es<br />
sich auch gut“<br />
Thorsten Denkler, Süddeutsche.de<br />
Überlänge. Als er nach 23 Uhr herauskam,<br />
sah er, was er verpasst hatte. Um<br />
19.45 Uhr war die Eilmeldung gekommen,<br />
dass Merkels Handy abgehört worden<br />
sein soll. Um 20.03 Uhr hieß es, Obama<br />
weise die Vorwürfe zurück. Süddeutsche.de<br />
brachte einen Artikel. Noch einen.<br />
Noch einen. Und noch einen. Alles<br />
passierte, während Denkler im Kino saß.<br />
Thorsten Denkler, 42, ist ein Veteran.<br />
Er war schon Berliner Korrespondent bei<br />
Süddeutsche.de, als es noch die D-Mark<br />
gab. Doch <strong>der</strong> Verlag zweifelte zwischendurch<br />
an <strong>der</strong> Online-Zukunft. Denkler<br />
ging zu T-Online, gründete eine Ich-AG,<br />
schrieb als freier Journalist. 2007 holte<br />
ihn Süddeutsche.de zurück. Seine Zeit<br />
war gekommen.<br />
Jetzt ist sein Tag eng getaktet. Morgens<br />
nach sieben: Rechner hochfahren.<br />
Kurz nach acht: erste Telefonkonferenz.<br />
Frühstück. Termine. Schreiben. Stift und<br />
Block braucht er nicht. Er tippt die Informationen<br />
direkt ins iPhone.<br />
Denkler kennt die Gesetze seiner<br />
Branche. „Personalisieren und Emotionalisieren,<br />
das ist die beste Art, Geschichten<br />
zu erzählen, seit es Sprache<br />
gibt. Es wäre ziemlich dumm, darauf<br />
zu verzichten, wenn wir versuchen, den<br />
Menschen politische Prozesse näherzubringen.“<br />
Politikerskandale passen perfekt<br />
in dieses Schema: Die Rollen sind<br />
klar verteilt, die Situation ist existenziell.<br />
Früher bekamen die Leser eine Zeitung<br />
auf den Frühstückstisch. Was drinstand,<br />
hatte die Redaktion entschieden. Heute<br />
suchen die Leser sich ihre Artikel im Internet<br />
selbst aus. Die Nachfrage bestimmt<br />
das Angebot.<br />
Für Denkler ist die Quote ein Fortschritt.<br />
Sie sorgt in seinen Augen für<br />
mehr Qualität, mehr Disziplin beim<br />
Schreiben. „Wenn ein Thema viele Menschen<br />
interessiert, dann ist es relevant.<br />
Und dann klickt es sich auch gut“, sagt<br />
er. Seine Logik: Wer auf die Quote achtet,<br />
achtet darauf, was die Leute wollen. Das<br />
sorge für bessere Texte. „In <strong>der</strong> Quote<br />
liegt also eine Chance, die von jenen vergeben<br />
wird, die sie verteufeln.“<br />
Aber manchmal, da stören ihn doch<br />
ein paar Dinge. Zum Beispiel die Hysterie<br />
um den Veggie-Day. O<strong>der</strong> die Art<br />
und Weise, wie im Januar über die Teilnahme<br />
<strong>der</strong> Stern-Journalistin Laura<br />
Himmelreich an einem Pressefrühstück<br />
von Rainer Brü<strong>der</strong>le berichtet wurde, den<br />
sie <strong>der</strong> Anmache bezichtigt hatte. Journalisten<br />
meldeten Himmelreichs Ankunft<br />
via Twitter. Redaktionen schalteten<br />
Live-Ticker. Alle umringten die<br />
Journalistin. „Das war Voyeurismus“,<br />
sagt Denkler.<br />
Einige Flure von Jule Lutteroths lautem<br />
Newsroom entfernt sitzt <strong>der</strong> Chef<br />
von Spiegel Online in seinem Büro und<br />
macht sich klein. Er senkt die Schultern,<br />
beugt sich nach vorne, faltet die Hände.<br />
Es ist eine bescheidene Körperhaltung<br />
für einen Mann mit so viel Macht.<br />
Rüdiger Ditz arbeitet seit fast<br />
14 Jahren bei Spiegel Online. Als er<br />
anfing, nahm kaum jemand das Portal<br />
ernst, Politiker ignorierten Interviewanfragen.<br />
Dann 2001, mit dem Fall<br />
des World Trade Centers, schossen die<br />
Klickzahlen in die Höhe. 2007, 2008 fiel<br />
immer häufiger das Wort „Leitmedium“.<br />
„Damals wurde uns gelegentlich angst<br />
und bange“, sagt Ditz.<br />
Heute kommt keiner mehr an Spiegel<br />
Online vorbei. Allein im September erzielte<br />
das Portal 980 277 502 Klicks. Fast<br />
eine Milliarde. Manche Hauptstadtjournalisten<br />
nutzen es als Startseite.<br />
29<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
TITEL<br />
Fass!<br />
Ditz sitzt in seinem Büro wie ein Wissenschaftler<br />
im Forschungslabor. Kein<br />
Laut dringt von außen herein. „Die <strong>Medien</strong><br />
haben in den vergangenen 25 Jahren<br />
ein irrsinniges Tempo aufgenommen“,<br />
sagt er. Erst kam das Radio, dann die<br />
TV-Stationen, dann die Online-Berichterstattung<br />
und schließlich das Social Web.<br />
„Was heute in die Welt gesetzt wird, verbreitet<br />
sich wie ein Lauffeuer.“ Politiker,<br />
die unter Beschuss stünden, hätten kaum<br />
Zeit zu reagieren. „Sie tun mir leid.“<br />
Ditz hat viel über die Skandale <strong>der</strong><br />
letzten Jahre nachgedacht, über Guttenberg,<br />
Wulff, die FDP. Über die Missgunst,<br />
den Neid, die Häme, die sie ausgelöst haben.<br />
Urreflexe seien das, die sich auch<br />
in den Leserkommentaren nie<strong>der</strong>schlagen<br />
würden. Und in den Klickzahlen.<br />
„Tebartz und Guttenberg waren bei uns<br />
in den Hochphasen ihrer Affären in den<br />
Top 10“, sagt er. Trotzdem: Die Quote,<br />
das betont er, habe keinen Einfluss auf<br />
das Politikressort. Tatsächlich sitzen die<br />
wahren Quotenrenner woan<strong>der</strong>s. Promimeldungen<br />
und Bil<strong>der</strong>strecken treiben<br />
die Zahlen hoch. Manche sagen dazu<br />
Klickhuren. Fast alle Online-<strong>Medien</strong><br />
greifen zu diesen Mitteln: Gute Werte<br />
bringen gute Werbeeinnahmen. Mit diesen<br />
Mechanismen kommt <strong>der</strong> politische<br />
Journalismus in Berührung.<br />
<strong>Der</strong> Qualitätsjournalismus sei „in<br />
ernster Gefahr“, hat Steffen Range 2007<br />
geschrieben. In einem Gutachten für die<br />
Friedrich-Ebert-Stiftung kritisierte er<br />
den Online-Journalismus. Reißerische<br />
Überschriften, eine verzerrte Nachrichtenauswahl.<br />
Range schrieb über seine eigene<br />
Branche, er war Online-Journalist.<br />
Viele Kollegen waren begeistert. Endlich<br />
sagte es mal einer. Denn das ist das<br />
Paradoxe <strong>der</strong> Branche: Sie ist selbstkritisch.<br />
Aber sie folgt trotzdem dem Gesetz<br />
des Klicks. Das Publikum wie<strong>der</strong>um<br />
schimpft über schrille Überschriften –<br />
und klickt.<br />
„Es geht nicht<br />
mehr nur um<br />
einen Rücktritt.<br />
Son<strong>der</strong>n um die<br />
komplette<br />
Vernichtung <strong>der</strong><br />
Person, die<br />
Auslöschung“<br />
Steffen Range, Schwäbische Zeitung<br />
Christoph Steegmans, 42, war früher<br />
Vize-Regierungssprecher und wurde<br />
dann Sprecher <strong>der</strong> scheidenden Bundesfamilienministerin<br />
Kristina Schrö<strong>der</strong>. Er<br />
kann jetzt sagen, was er denkt. Ministerin<br />
weg, Job weg. „Am Ende des Tages<br />
setzt sich das krawalligste Stück durch,<br />
die stärkste These macht das Rennen“,<br />
sagt er in seinem Büro im Ministerium.<br />
Er spricht von Überschriften, die die Leser<br />
anbrüllten, von Online-Artikeln, die<br />
„zur bloßen Startrampe für aggressive<br />
Leserkommentare“ geworden seien. Von<br />
Methoden, „bei denen nur noch die Erregungskurve<br />
zählt“. Steegmans Ohren<br />
sind gerötet.<br />
Über Bundesminister kann immer<br />
ein Shitstorm hereinbrechen, je<strong>der</strong> Patzer<br />
kann sich zur Riesenblamage auswachsen.<br />
Steegmans, ein selbstironischer<br />
Mann mit dicken Brillengläsern,<br />
hat sich jahrelang in dieser Welt bewegt.<br />
Jetzt muss er los, es ist Halloween. Wenn<br />
er nicht rechtzeitig zu Hause ist und die<br />
Tür öffnet, werfen die Kin<strong>der</strong> Eier an sein<br />
Haus. In <strong>der</strong> Klickwelt kann einem so etwas<br />
jeden Tag passieren, das ganze Jahr.<br />
Morgens, nach dem Aufstehen, geht<br />
Steegmans in die Küche. Während die<br />
Butter weich wird, liest er die Nachrichten<br />
auf seinem Krypto-Handy. Er kontrolliert<br />
sie im Bus, im Büro, immer. Alle<br />
15 Minuten schaut er bei Google News<br />
rein. Das ist sein Job.<br />
Steffen Range, <strong>der</strong> 2007 die kritische<br />
Studie schrieb, hat die Hektik <strong>der</strong><br />
Hauptstadt hinter sich gelassen. Er zog<br />
von Berlin nach Oberschwaben. Bei <strong>der</strong><br />
Schwäbischen Zeitung kann er in Ruhe<br />
arbeiten. Umgewöhnen musste er sich allerdings<br />
nach sechs Jahren Hauptstadt:<br />
Eines Herbstabends wollte er nach Feierabend<br />
in Leutkirch noch Linsen mit<br />
Spätzle essen. Es war erst Viertel nach<br />
neun, doch die Küche im Gasthof Mohren<br />
war bereits geschlossen, allenfalls<br />
einen Wurstsalat könne man noch machen.<br />
In <strong>der</strong> Provinz ist eben einfach mal<br />
Schluss, Pause, Feierabend.<br />
Heute, sagt er, än<strong>der</strong>e sich das Bewusstsein<br />
auch in den Verlagen. „<strong>Der</strong><br />
qualifizierte Klick ist wichtiger geworden.“<br />
Was nun entstehe, sei eine<br />
Zwei-Klassen-Gesellschaft im Internet:<br />
Auf <strong>der</strong> einen Seite gibt es die, die es sich<br />
leisten können, auf das vornehme Publikum<br />
zu setzen und weniger stark nach<br />
Quote zu entscheiden. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Seite: die, die jedem Nutzer hinterherhecheln,<br />
mit allen Methoden.<br />
Aber da ist noch etwas, das Range<br />
beobachtet hat. Es beschäftigt ihn. Er<br />
sagt, die Jagd auf Prominente sei härter<br />
geworden. „Es geht nicht mehr nur um einen<br />
Rücktritt. Son<strong>der</strong>n um die komplette<br />
Vernichtung <strong>der</strong> Person, die Auslöschung<br />
ihres Andenkens.“ Als Wulff schon am<br />
Boden lag, wurde ausgiebig berichtet,<br />
dass er sich beim Zapfenstreich ein Lied<br />
mehr als seine Vorgänger wünschte. Genüsslich<br />
fragten sich die Qualitätsmedien,<br />
ob Tebartz-van Elst Autist sei. Sein Bru<strong>der</strong><br />
dementierte, es klang verzweifelt.<br />
Alle diese Skandale haben mit berechtigten<br />
Vorwürfen <strong>der</strong> Presse begonnen,<br />
mit seriösem Journalismus. Aber<br />
dann sind sie ausgeartet, befeuert von<br />
Twitter, von Facebook, von den Leserkommentaren,<br />
von <strong>der</strong> Konkurrenz zwischen<br />
den Journalisten, von ihrem Ehrgeiz,<br />
sich an die Spitze <strong>der</strong> wütenden<br />
Bewegung zu setzen. Nach jedem neuen<br />
Detail zu schnappen, das einen neuen Artikel<br />
rechtfertigt, <strong>der</strong> einen Kick für das<br />
innere Belohnungssystem bedeutet. Und<br />
<strong>der</strong> den Druck auf den Gejagten erhöht.<br />
MERLE SCHMALENBACH ist freie<br />
Autorin in Berlin. Sie hat eine Zeitung aus<br />
Papier abonniert, liest aber trotzdem oft<br />
Nachrichten auf dem Handy<br />
30<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Neue Bücher von Diogenes<br />
Foto: © Marco Okhuizen / laif<br />
Foto: © Annalena McAfee<br />
Foto: Regine Mosimann © Diogenes Verlag<br />
Arnon Grünberg<br />
COUCHSURFEN<br />
und an<strong>der</strong>e Schlachten<br />
Leon<br />
de Winter<br />
Ein gutes Herz<br />
Ian McEwan<br />
Honig<br />
Herausgegeben<br />
und mit einem Vorwort von<br />
Ilija Trojanow<br />
Roman · Diogenes<br />
Roman · Diogenes<br />
Reportagen · Diogenes<br />
512 Seiten, Leinen<br />
€ (D) 22.90<br />
Ein junges marokkanisches Fußballteam<br />
hält Amsterdam in Atem. Ein dubioser<br />
jüdischer Geschäftsmann entdeckt plötzlich<br />
sein gutes Herz. Väter und Söhne<br />
finden schicksalhaft zueinan<strong>der</strong>, eine alte<br />
Liebesgeschichte flackert wie<strong>der</strong> auf, und<br />
ein namhafter Filmemacher bekommt<br />
einen metaphysischen Auftrag. <strong>Der</strong> neue<br />
atemberaubende Thriller von Leon de<br />
Winter!<br />
464 Seiten, Leinen, € (D) 22.90<br />
Auch als Diogenes Hörbuch<br />
Sex, Spionage, Fiktion und die Siebziger:<br />
Serena arbeitet beim britischen Geheimdienst<br />
MI5. Weil sie auch eine passionierte<br />
Leserin ist, wird die junge Frau auf eine<br />
literarische Mission geschickt. Ian McEwan<br />
lockt uns mit gewohnter Brillanz in<br />
eine Intrige um Verrat, Liebe und die Erfindung<br />
<strong>der</strong> eigenen Identität.<br />
»Das eigentliche Thema dieses klugen<br />
und vertrackten Romans über eine<br />
Spionage-Mission im Kalten Krieg ist<br />
die Grenze zwischen Phantasie und<br />
Realität.« The New York Times<br />
480 Seiten, Pappband<br />
€ (D) 21.90<br />
Eine abenteuerliche Reise durch die Gegenwart:<br />
Ob auf fremden Sofas beim<br />
Couchsurfing, auf Brautschau in <strong>der</strong> Ukraine,<br />
in Guantánamo o<strong>der</strong> Afghanistan<br />
– diese Reportagen führen dorthin, wo<br />
wir alleine nie hingekommen wären.<br />
Arnon Grünbergs Blick für das absurde<br />
Detail stimmt ebenso nachdenklich, wie<br />
er erheitert. Die besten Reportagen, ausgewählt<br />
von Ilija Trojanow.
TITEL<br />
Fass!<br />
„GNADENLOS DURCH<br />
DEN WOLF GEDREHT“<br />
Kiels zurückgetretene Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke<br />
über sinnlose Rituale in <strong>der</strong> Politik und die Irrwege <strong>der</strong> <strong>Medien</strong><br />
Frau Gaschke, Sie waren elf Monate<br />
lang Oberbürgermeisterin von Kiel.<br />
Ende Oktober sind Sie von diesem Amt<br />
zurückgetreten, nachdem es wochenlange<br />
Querelen wegen Ihrer Entscheidung<br />
gegeben hatte, einem Kieler Unternehmer<br />
mehrere Millionen Euro<br />
Steuerschuld zu erlassen. Was haben<br />
Sie in dieser Zeit über die Mechanismen<br />
<strong>der</strong> Politik gelernt?<br />
Susanne Gaschke: Als politische<br />
Journalistin habe ich die Politik ja jahrelang<br />
beschrieben. Aus dieser Erfahrung<br />
heraus kann ich sagen: <strong>Der</strong> Unterschied<br />
zwischen Theorie und Praxis ist gewaltig.<br />
Und ich glaube, diese Diskrepanz können<br />
Journalisten nur schwer nachvollziehen.<br />
Welchen praktischen Aspekt haben Sie<br />
unterschätzt?<br />
Das Oberbürgermeisteramt umfasst<br />
eine riesige Palette an inhaltlichen Themen,<br />
in die man sich einarbeiten muss –<br />
von den Stadtwerken über Straßen und<br />
Kanalisation bis hin zum Krippenplatz.<br />
Dazu kommen natürlich öffentliche Auftritte<br />
und die Arbeit mit den <strong>Medien</strong>.<br />
Das ist die eine Seite. Die an<strong>der</strong>e Seite<br />
ist die politische, also in meinem Fall<br />
die eigene Koalition mit einem schwierigen<br />
Koalitionspartner sowie die Opposition.<br />
An allen diesen Fronten muss<br />
man gleichzeitig gut sein, und das kann<br />
man eigentlich nur überleben, wenn die<br />
eigenen Leute permanent hinter einem<br />
stehen. Das wie<strong>der</strong>um erfor<strong>der</strong>t ein extrem<br />
hohes Maß an persönlicher Zuwendung<br />
und Aufmerksamkeit. Diesen Aspekt<br />
habe ich wahrscheinlich zugunsten<br />
inhaltlicher Fragen vernachlässigt.<br />
Vor Ihrer Wahl zur Oberbürgermeisterin<br />
waren Sie politische Journalistin<br />
bei <strong>der</strong> Zeit. Blicken Sie mit Ihren<br />
Zur Person<br />
SUSANNE GASCHKE kam<br />
1967 in Kiel zur Welt und wurde<br />
1987 Mitglied in <strong>der</strong> SPD. Von<br />
1997 an war sie Redakteurin<br />
bei Die Zeit und trat im<br />
vergangenen Jahr gegen<br />
Wi<strong>der</strong>stände in <strong>der</strong> eigenen<br />
Partei mit Erfolg als Kieler<br />
OBKandidatin an<br />
jüngsten Erfahrungen aus <strong>der</strong> Politik<br />
heute mit an<strong>der</strong>en Augen auf den<br />
Journalistenberuf?<br />
Ja, weil ich glaube, dass Journalisten<br />
sich oft überhaupt nicht im Klaren darüber<br />
sind, was sie Menschen antun können.<br />
Für mich war das zuletzt wirklich<br />
kein schöner Moment, wenn morgens um<br />
fünf Uhr die Lokalzeitung im Treppenhaus<br />
vor die Tür geworfen wurde. Natürlich<br />
habe ich mich dann selbst gefragt,<br />
was ich früher als Journalistin Betroffenen<br />
zugemutet habe. Da fallen mir immerhin<br />
zwei o<strong>der</strong> drei Sachen ein, für die<br />
ich Entschuldigungsbriefe schreiben will.<br />
Machen Journalisten es sich oft zu<br />
leicht, wenn sie die Arbeit von Politikern<br />
kritisieren? Zum Beispiel, weil ihnen<br />
die Detailkenntnis fehlt?<br />
Journalisten neigen zu Selbstgerechtigkeit.<br />
Viele kritisieren mit einer<br />
Härte und Gnadenlosigkeit, vertragen<br />
selbst aber nicht die geringste Kritik. Ich<br />
kenne das selbst. Und natürlich ist auch<br />
<strong>der</strong> Mangel an Detailkenntnis ein Problem.<br />
Wenn man als Verantwortlicher Entscheidungen<br />
zu treffen hat, merkt man<br />
erst mal, wie tief man sich in die Materie<br />
einarbeiten muss. Journalisten dagegen<br />
lassen sich nur sehr ungern durch<br />
abweichende Details von ihrer Meinung<br />
abbringen, wenn sie sich auf ihre Geschichte<br />
festgelegt haben. Das ist ein<br />
schweres Problem für den Journalismus.<br />
Ich glaube, die <strong>Medien</strong> brauchen einen<br />
Mechanismus, um ihre eigene Qualität<br />
zu sichern.<br />
Würden Sie, sollten Sie in den Journalistenberuf<br />
zurückkehren, etwas an Ihrer<br />
Arbeitsweise än<strong>der</strong>n in Anbetracht Ihrer<br />
eigenen Erfahrungen aus dem politischen<br />
Betrieb?<br />
Ganz bestimmt. Sowohl Politik wie<br />
auch <strong>Medien</strong> haben ja mit Problemen<br />
zu kämpfen – sei es Politikverdrossenheit,<br />
sei es Auflagenschwund. Dabei sind<br />
das eigentlich zwei Seiten <strong>der</strong>selben Medaille.<br />
Ich glaube, eine Berichterstattung,<br />
die einfühlsamer ist, die mehr verstehen<br />
und erklären will, würde auch <strong>der</strong> Politik<br />
zu einem besseren Ansehen verhelfen.<br />
Meiner Meinung nach sind die Leser<br />
dieser medialen „Alles ist Mist“-Attitüde<br />
längst überdrüssig. Genauso, wie<br />
<strong>der</strong> ständigen Besserwisserei von Journalisten.<br />
Das werde ich für meine künftige<br />
journalistische Arbeit mit Sicherheit<br />
noch mehr berücksichtigen.<br />
In Ihrer Rücktrittserklärung haben Sie<br />
beklagt, die „mediale Darstellung“ <strong>der</strong><br />
Vorgänge um den umstrittenen Erlass<br />
Foto: Antje Berghäuser für <strong>Cicero</strong><br />
32<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
<strong>der</strong> Steuerschuld habe zu dem „verzerrten<br />
Bild geführt“, Sie hätten diese Entscheidung<br />
allein und fachlich unkundig<br />
gefällt. Warum ist es denn gerade Ihnen<br />
als <strong>Medien</strong>profi nicht gelungen, dieses<br />
verzerrte Bild geradezurücken?<br />
An <strong>der</strong> Geschichte dieses 15 Jahre<br />
alten Gewerbesteuerfalls war ja von den<br />
zuständigen Fachleuten aus <strong>der</strong> Verwaltung<br />
ordentlich gearbeitet worden. Sie<br />
präsentierten mir am Ende eine richtige<br />
und plausible Lösung, <strong>der</strong> ich dann zugestimmt<br />
habe. Bis dahin hatte ich nichts<br />
damit zu tun. Wahrscheinlich hätte ich<br />
mich mit allen Beteiligten vor die Ratsversammlung<br />
stellen müssen, um klarzumachen,<br />
dass ich we<strong>der</strong> im Alleingang<br />
noch willkürlich abschließend entschieden<br />
habe. So hat sich dann medial die Geschichte<br />
eines angeblichen „Steuer deals“<br />
zwischen mir persönlich und diesem Unternehmer<br />
entwickelt. Diese Personalisierung<br />
hat eine Eigendynamik entwickelt,<br />
die nicht mehr zu stoppen war.<br />
Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt,<br />
dass aus <strong>der</strong> ganzen Geschichte<br />
ein Skandal mit allen dazugehörigen<br />
Mechanismen wird?<br />
Ich ahnte es zwei Tage vor <strong>der</strong> Ratsversammlung<br />
im August, als die Sache<br />
von den Kieler Nachrichten hochgezogen<br />
wurde. Als dann Anfang September auch<br />
noch <strong>der</strong> Name des Steuerschuldners<br />
durch Indiskretionen bekannt wurde,<br />
begann eine neue Eskalationsstufe. Von<br />
da an ging es wirklich nur noch um die<br />
Frage, ob ich persönlich das Geld <strong>der</strong><br />
Stadt verschenkt hätte. Mir war die<br />
ganze Zeit über völlig klar, in welcher<br />
Phase <strong>der</strong> Skandalisierung ich mich im<br />
Moment befinde. Aber alles theoretische<br />
Wissen nutzt einem in so einer Situation<br />
überhaupt nichts.<br />
Inwiefern haben Sie selbst zur Skandalisierung<br />
beigetragen, beispielsweise<br />
durch Ihren sehr emotionalen Auftritt<br />
vor <strong>der</strong> Kieler Ratsversammlung am<br />
22. August, in <strong>der</strong> Sie fragten, „ob ich<br />
das aushalten kann“?<br />
Und dann ist mir da auch noch die<br />
Stimme gekippt, was natürlich für eine<br />
Frau in <strong>der</strong> Politik ein totales No-Go ist.<br />
Außerdem habe ich wahrscheinlich überzogen<br />
auf die Kritik <strong>der</strong> Opposition reagiert<br />
– auch aus Enttäuschung, weil ich<br />
ja von diesen destruktiven politischen<br />
Rollenspielen wegkommen wollte. Das<br />
war schon eine Steilvorlage.<br />
Ist es für Politiker tödlich, Schwäche<br />
zu zeigen, weil dadurch erst recht <strong>der</strong><br />
Jagd instinkt bei den Journalisten geweckt<br />
wird?<br />
Ja, es ist tödlich. Das ist das Perverse,<br />
weil wir zugleich alle diese „Plastikpolitiker“<br />
kritisieren, diese gepanzerten<br />
Typen, die nur noch bedeutungslose<br />
Floskeln von sich geben. Das will eigentlich<br />
keiner. Aber wenn es jemand an<strong>der</strong>s<br />
macht, wird er eben gnadenlos durch den<br />
Wolf gedreht.<br />
Was bedeutet das für die politische<br />
Kultur?<br />
Dass wir weiter daran arbeiten müssen,<br />
einen Ausweg aus diesen Ritualen<br />
und destruktiven Rollenklischees zu finden.<br />
So, wie es ist, kann es nicht weitergehen.<br />
Wir müssen versuchen, in <strong>der</strong> Politik<br />
zu einer neuen Sprache zu finden,<br />
die erklärt anstatt zu vernebeln. Sonst<br />
gibt es am Ende einen politisch-medialen<br />
Komplex, <strong>der</strong> sich selbst zwar irgendwie<br />
aufrechterhält – aber mit <strong>der</strong> Welt darum<br />
herum nicht mehr viel zu tun hat.<br />
Sie sind als Oberbürgermeisterin angetreten<br />
mit dem Vorsatz, einen neuen<br />
Politikstil zu pflegen: mehr Offenheit,<br />
mehr Vertrauen zwischen Politikern<br />
und Bürgern, dafür weniger „hermetische<br />
Politikersprache“, wie Sie es genannt<br />
haben. Dieses Experiment muss<br />
„Manchmal<br />
bin ich wie<br />
Bambi auf die<br />
Waldlichtung<br />
gewandelt.<br />
Ich dachte<br />
wirklich, das<br />
finden alle toll“<br />
als gescheitert betrachtet werden. Sind<br />
Politik und <strong>Medien</strong> zu sehr in ihren jeweiligen<br />
Mechanismen gefangen, um<br />
diesem neuen Politikstil eine Chance<br />
zu geben?<br />
Erst einmal würde ich bestreiten,<br />
dass dieses Experiment komplett gescheitert<br />
ist. Als Oberbürgermeisterin habe<br />
ich fast alle Reden und Grußworte selbst<br />
formuliert, weil es mir eben darauf ankam,<br />
mit meiner eigenen Stimme zu sprechen<br />
– ohne Floskeln und Phrasen und<br />
mit echtem Interesse für praktische Lösungen.<br />
Für diese Form von Gesprächskultur<br />
habe ich bei vielen Menschen Anerkennung<br />
gefunden, auch bei solchen,<br />
die mir politisch nicht nahestehen. Ich<br />
hatte jedenfalls den Eindruck, es war <strong>der</strong><br />
Mühen wert, und würde es deshalb wie<strong>der</strong><br />
so machen. Und ich sehe schon, dass<br />
manche Politiker und <strong>Medien</strong>leute mittlerweile<br />
über ihr festgefahrenes Rollenverhalten<br />
nachdenken und sich gern daraus<br />
befreien würden. Da kommt langsam<br />
etwas in Gang.<br />
Was o<strong>der</strong> wen meinten Sie eigentlich in<br />
Ihrer Rücktrittsrede mit „testosterongesteuerten<br />
Politik- und <strong>Medien</strong>typen,<br />
die unseren Politikbetrieb prägen und<br />
deuten“?<br />
Es gibt diesen Politikberichterstatter-Machotypen,<br />
<strong>der</strong> sich ganz gut versteht<br />
mit dem Politapparatschik-Machotypen.<br />
Die waren übrigens auch nicht<br />
so doll für mich als Seiteneinsteigerin<br />
in die Politik.<br />
Waren Sie rückblickend nicht viel zu<br />
naiv, als Sie mit <strong>der</strong>art hehren Vorsätzen<br />
in die Politik gegangen sind?<br />
Nicht schön, das zuzugeben, aber:<br />
ja. Manchmal bin ich wie Bambi auf die<br />
Waldlichtung gewandelt und habe gesagt:<br />
„Hey Leute, ihr hattet hier in <strong>der</strong> Vergangenheit<br />
so ein paar seltsame Praktiken,<br />
die wir von jetzt an hinter uns lassen<br />
sollten.“ Ich dachte wirklich, das<br />
finden alle toll. Fanden sie natürlich<br />
nicht. Es ist eben ein Geben und Nehmen<br />
auf allen Ebenen. Das habe ich total<br />
unterschätzt. Aber ich finde, unsere<br />
Gesellschaft braucht Leute, die das unterschätzen.<br />
Und an<strong>der</strong>s machen wollen.<br />
Das Gespräch führte<br />
ALEXANDER MARGUIER<br />
33<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
TITEL<br />
Fass!<br />
MUT, STOLZ<br />
UND STORYS<br />
Von GEORG MASCOLO<br />
Die <strong>Medien</strong> stehen unter Druck. Ihre Macher sollten aber<br />
nicht jammern. Sie müssen sich Glaubwürdigkeit erobern,<br />
mit Leidenschaft recherchieren und provozieren. Dann bleibt<br />
Journalismus ein Traumberuf, <strong>der</strong> sich bezahlt macht<br />
Illustration: Jens Bonnke<br />
Am Tag, als <strong>der</strong> Kalte Krieg<br />
endete, war ich gerade<br />
25 Jahre jung geworden.<br />
Ich war ein mäßig erfahrener<br />
Fernsehreporter und in<br />
Ostberlin dabei, als die Mauer fiel. <strong>Der</strong><br />
Ort, an dem ich mit meinem Kamerateam<br />
drehte, war <strong>der</strong> Grenzübergang Bornholmer<br />
Straße.<br />
Dort wurde in jener Nacht Geschichte<br />
geschrieben.<br />
Tausende DDR-Bürger hatten sich<br />
vor dem Grenzübergang versammelt.<br />
Sie verlangten die sofortige Ausreise.<br />
In Sprechchören skandierten sie: „Tor<br />
auf, Tor auf.“ Die schwer bewaffneten<br />
Grenzer waren in <strong>der</strong> Defensive, zum<br />
ersten Mal seit 28 Jahren. Zum ersten<br />
Mal, seit <strong>der</strong> Ostblock sich entschieden<br />
hatte, seine eigenen Bürger einzusperren.<br />
Plötzlich wurde <strong>der</strong> Schlagbaum geöffnet.<br />
Die verängstigten Grenzer taten es ohne<br />
Befehl von oben, die Mauer war gefallen.<br />
Die Menschen hatten sie erstürmt.<br />
Die Bil<strong>der</strong> von <strong>der</strong> Bornholmer<br />
Straße sind hun<strong>der</strong>tfach gezeigt worden.<br />
2011 hat die Unesco sie zum Weltdokumentenerbe<br />
erklärt. In dieser Kategorie<br />
finden sich auch Beethovens Neunte<br />
Symphonie und die Gutenberg-Bibel.<br />
Darum bin ich Journalist geworden.<br />
Schon dieser eine Moment, diese eine<br />
Nacht hätte als Begründung genügt. Gibt<br />
es einen an<strong>der</strong>en Beruf, in dem man in<br />
historischen Momenten als Zeuge dabei<br />
sein darf und dafür auch noch bezahlt<br />
wird?<br />
Ich bin stolz auf meinen Beruf. Dieser<br />
Text wird also nicht <strong>der</strong> inzwischen<br />
gängige Abgesang auf unsere Branche.<br />
Ich liefere auch nicht die zehn Gebote<br />
zur Zukunft. Ich kenne sie gar nicht. Vor<br />
meinen Prognosen will ich gleich warnen:<br />
Wir Journalisten irren uns bekanntlich<br />
nicht weniger als alle an<strong>der</strong>en auch.<br />
Eher häufiger.<br />
Eine Tatsache ist schon: Wir erleben<br />
keine <strong>Medien</strong>krise. Wir erleben eine Revolution.<br />
Aber ich mag den Ton nicht, in<br />
dem über die Herausfor<strong>der</strong>ungen an die<br />
<strong>Medien</strong> gesprochen wird. Er schadet uns.<br />
Wenn wir selbst nicht an das glauben,<br />
was wir tun, warum sollen es dann an<strong>der</strong>e<br />
tun? Wenn wir heute über Journalismus<br />
sprechen, sind zwei unterschiedliche<br />
Betrachtungen notwendig. Eine ist die inhaltliche,<br />
die an<strong>der</strong>e die ökonomische.<br />
Die inhaltliche zwingt Journalisten<br />
zur Verän<strong>der</strong>ung, wir müssen uns auf<br />
neue Zeiten einstellen, weit mehr als<br />
wir dies bis heute getan haben. Unsere<br />
Karrieren sind unsicherer geworden, so<br />
wie die vieler an<strong>der</strong>er Professionen auch.<br />
<strong>Der</strong> journalistische Wettbewerb ist<br />
heute ein globaler geworden, geografischen<br />
Schutz im heimatlichen Markt gibt<br />
es kaum noch. Alles was sich klug, aufregend<br />
und unterhaltsam liest, ist nur einen<br />
Klick entfernt. Im virtuellen Kiosk liegt<br />
die New York Times neben <strong>der</strong> Neuen<br />
Zürcher und <strong>der</strong> Schaumburger Zeitung,<br />
bei <strong>der</strong> ich einmal angefangen habe.<br />
Papier verschwindet nicht, aber es<br />
schwindet. <strong>Der</strong> Begriff „Newspaper“<br />
wird allmählich irreführend. Was für<br />
ein Unterschied: Als ich bei <strong>der</strong> Schaumburger<br />
Zeitung mein Volontariat begann,<br />
war Journalismus ein knappes Gut. Was<br />
35<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
TITEL<br />
Fass!<br />
ins Haus kam, wurde auch gelesen, Vergleiche<br />
mit an<strong>der</strong>en Produkten selten<br />
angestellt.<br />
Die meisten Menschen unter 20 kennen<br />
nur die neue Welt. Sie sind wählerischer,<br />
kritischer, launischer. Sie sind für<br />
guten Journalismus zu begeistern, aber<br />
das müssen wir täglich und immer aufs<br />
Neue schaffen. Diese neue Generation<br />
<strong>der</strong> Leser bindet sich nicht gern – und<br />
wenn, dann nicht auf Dauer. Sie wissen<br />
um die Auswahl, die sich ihnen bietet.<br />
Ich lese wie viele in Deutschland den<br />
Blog des Schweizer Journalisten Constantin<br />
Seibt. Er schreibt: „Die entscheidende<br />
Qualität <strong>der</strong> Ware Zeitung war<br />
jahrzehntelang die Nicht-Enttäuschung.<br />
Solange man nicht ganz miserable Ware<br />
lieferte, blieben die Abonnenten bis zum<br />
Tod. Und heute? Journalisten und Verleger<br />
haben verlernt, was unser Publikum<br />
zur Kaufentscheidung bewegt: Begeisterung,<br />
Wagnisse, Brüche. Und das Eingeständnis<br />
von Fehlbarkeit.“<br />
Fair enough.<br />
Wie gehen wir Journalisten mit dieser<br />
neuen Wirklichkeit um? Viele von uns<br />
reagieren mit Unsicherheit, manchmal<br />
mit Trotz. Warum, bitte schön, will <strong>der</strong><br />
Leser, <strong>der</strong> Zuhörer, <strong>der</strong> Zuschauer plötzlich<br />
nicht mehr, was ihm so lange gefallen<br />
hat? Er will es nicht mehr, weil die Auswahl<br />
heute so ungleich größer ist, weil es<br />
News und ihre naheliegende Interpretation<br />
heute überall gibt. Und zwar sofort.<br />
Das Ritual <strong>der</strong> Zeitung am Frühstückstisch<br />
droht deshalb genauso zu<br />
verschwinden wie die erste Zigarette<br />
Anzeige<br />
zum Kaffee. In <strong>der</strong> S-Bahn lässt sich dieser<br />
Kulturbruch jeden Tag beobachten:<br />
Es raschelt kein Papier mehr, die Menschen<br />
halten ein Smartphone in <strong>der</strong> Hand.<br />
Nur <strong>der</strong> konzentrierte Blick ist geblieben.<br />
Nachrichtenangebote konkurrieren mit<br />
allen an<strong>der</strong>en Kommunikationsformen<br />
und Gadgets <strong>der</strong> digitalen Welt.<br />
Was bedeutet das für uns, die<br />
Journalisten?<br />
Zuerst einmal: Massenware funktioniert<br />
nicht mehr. Sie wird vom Leser als<br />
eben solche erkannt, nicht son<strong>der</strong>lich geschätzt<br />
und schon gar nicht bezahlt.<br />
Aus diesem Grund müssen wir unsere<br />
Zeitungen, unsere Magazine verän<strong>der</strong>n.<br />
Sie brauchen Haltung, originelle<br />
Meinungen, gute Autoren, eigene,<br />
aufregende Enthüllungen. Wagemut<br />
statt Bravheit ist gefragt, die über Jahrzehnte<br />
eingeübte Routine – das haben<br />
wir doch schon immer so gemacht – ist<br />
dabei <strong>der</strong> größte Feind. Ich weiß, wovon<br />
ich rede. Ich habe diesen Fehler selbst<br />
häufig gemacht.<br />
WIR JOURNALISTEN MÜSSEN uns <strong>der</strong><br />
Gleichförmigkeit <strong>der</strong> Meinung – inzwischen<br />
in deutschen <strong>Medien</strong> ein echtes Ärgernis<br />
– entziehen. Weniger Hype und<br />
mehr Recherche sind notwendig. Und die<br />
Lust zur Provokation sollten wir wie<strong>der</strong>entdecken,<br />
unser Gespür dafür, was unsere<br />
Leser am Küchentisch diskutieren<br />
o<strong>der</strong> diskutieren sollten. Es muss Spaß<br />
machen, die Zeitung zu lesen. Kurzum:<br />
Journalisten müssen ein Produkt mit<br />
Charakter machen!<br />
Für Regional- und Lokalzeitungen<br />
gilt, dass sie immer und überall in den<br />
Mittelpunkt stellen müssen, was eben<br />
nicht in jedem Newsportal zu haben ist:<br />
die Berichterstattung aus ihrer Region.<br />
Die starken Marken mit Tradition<br />
und Glaubwürdigkeit haben dabei große<br />
Chancen. Journalismus ist Vertrauenssache,<br />
und <strong>der</strong> Leser will wissen, ob er dem<br />
Absen<strong>der</strong> vertrauen kann. Darum sind<br />
es eben nicht die deutsche Telekom o<strong>der</strong><br />
Google, die die großen Nachrichtenportale<br />
betreiben.<br />
Unser Versprechen – von guten Journalisten<br />
recherchiert, überprüft und mit<br />
Gütesiegel ausgeliefert – hat auch in <strong>der</strong><br />
neuen Welt die entscheidende Bedeutung.<br />
Wir entlarven Gerüchte, wir liefern Kontext,<br />
Verständnis, Einordnung. Wir müssen<br />
sorgsam mit dem Vertrauen unserer<br />
Leser umgehen, denn sie haben ein gutes<br />
Gedächtnis dafür, was wir ihnen aufgeschrieben<br />
haben und welche „Experten“<br />
wir zu Wort kommen lassen.<br />
Philip Tetlock, Professor in Berkeley,<br />
hat 82 361 Vorhersagen <strong>der</strong> vergangenen<br />
20 Jahre auswerten lassen. Ergebnis: Diejenigen,<br />
die am meisten Aufmerksamkeit<br />
<strong>der</strong> <strong>Medien</strong> bekamen, waren am wenigsten<br />
zutreffend.<br />
Wenn heute über Journalismus gesprochen<br />
wird, ist viel von <strong>der</strong> ökonomischen<br />
Bedrohung die Rede. Eine an<strong>der</strong>e<br />
Bedrohung wird selten erwähnt, aber sie<br />
ist nicht weniger gefährlich. Es geht um<br />
unsere Autorität, unsere Glaubwürdigkeit.<br />
Um die steht es nicht gut, jede Umfrage<br />
beweist es. Journalisten schneiden<br />
Das gute Gespräch ist zurück.<br />
GALORE Interviews – das Beste aus zehn Jahren.<br />
• Das Magazin am Kiosk: 22. November.<br />
• Die Handy- und Tablet-App (iOS, Android): 29. November.<br />
• www.galore.de: 02. Dezember.<br />
Interviews
schlecht ab, meist nur knapp vor Politikern<br />
und Bankern. Das ist hart. Bei<br />
Transparency International Deutschland<br />
landeten Journalisten im Korruptionsindex<br />
gerade auf einem <strong>der</strong> hinteren<br />
Plätze. Das ist vernichtend. Ich komme<br />
darauf zurück.<br />
Erst einmal ist festzuhalten, dass es<br />
für uns Journalisten nicht mehr so weitergeht<br />
wie bisher. Unser Kunde, <strong>der</strong> Leser,<br />
ist anspruchsvoller geworden. Das<br />
ist unsere Herausfor<strong>der</strong>ung. Wenn wir<br />
unser Publikum verlieren, dann haben<br />
wir verloren. Verleger und Verlage haben<br />
auch eine Pflicht. Sie dürfen ihrem einzigen<br />
Produktionsmittel, dem Journalisten,<br />
ruhig etwas abverlangen. Aber schaffen<br />
sie auch ein Umfeld, in dem er den notwendigen<br />
Erfolg haben kann? Vorsicht<br />
vor <strong>der</strong> nächsten Sparrunde! Manch einer,<br />
<strong>der</strong> gedacht hat, dass er nur Fett abschneidet,<br />
hat tief ins Fleisch geschnitten.<br />
In das eigene.<br />
VERLEGER UND VERLAGE sollten misstrauisch<br />
werden, wenn ihre Chefredakteure<br />
sich als die fleißigsten Sparer erweisen.<br />
Das ist nicht ihr Job. Controller<br />
braucht es in je<strong>der</strong> Firma, aber sie entscheiden<br />
nicht über den Erfolg. Für die<br />
Beurteilung <strong>der</strong> Zukunft haben sie keine<br />
beson<strong>der</strong>e Qualifikation: Hätte ein Controller<br />
Christoph Kolumbus den Anker<br />
lichten lassen? Auf keinen Fall: unsichere<br />
Reise, unsichere Rendite, abgelehnt!<br />
Chefredakteure brauchen Unterstützung<br />
im Wettbewerb um die besten<br />
Journalisten. Sie brauchen solche, die<br />
Chefredakteure<br />
dürfen nicht<br />
die fleißigsten<br />
Sparer sein.<br />
Das ist nicht ihr Job.<br />
Ein Controller<br />
hätte Kolumbus<br />
auch nie den Anker<br />
lichten lassen<br />
Courage haben, Hartnäckigkeit, Leidenschaft,<br />
einen Sinn für Fairness und – ganz<br />
wichtig – für Ungerechtigkeit. Solche, die<br />
eine Lust darauf haben, die Welt zu erklären,<br />
und sich für ihren Leser interessieren.<br />
Sie brauchen solche, die <strong>der</strong> Macht<br />
niemals zu nahe kommen. Ein guter Journalist<br />
fremdelt mit den Mächtigen.<br />
Journalisten sind keine „Content-<br />
Lieferanten“, allein schon dieses Wort ist<br />
eine Beleidigung. Wenn <strong>der</strong> Journalist zu<br />
einem Rädchen im ganz großen Nachrichtengetriebe<br />
degradiert wird, ständig<br />
unter Druck, dann verliert er seine wichtigste<br />
Fähigkeit – den Spürsinn. Journalisten<br />
müssen unkorrumpierbar sein.<br />
Gegenüber ihren Quellen und denjenigen<br />
gegenüber, über die sie schreiben.<br />
Aber auch <strong>der</strong> Werbewirtschaft gegenüber.<br />
Halbseidenen Deals mit Anzeigenkunden<br />
müssen sich Journalisten wi<strong>der</strong>setzen.<br />
Ein guter Geschäftsführer mutet<br />
ihnen solche Deals erst gar nicht zu. <strong>Der</strong><br />
Journalist bekommt sein Geld nur dafür,<br />
dass er schreibt. Aber niemals dafür, was<br />
er schreibt.<br />
Ich habe die Bedrohung <strong>der</strong> Glaubwürdigkeit<br />
schon erwähnt. Sie zu verteidigen,<br />
ja, wie<strong>der</strong>zuerobern, ist die gemeinsame<br />
Aufgabe von Journalisten und<br />
Verlegern. Generationen vor uns haben<br />
hart für den guten Ruf unserer Marken<br />
gearbeitet. Jetzt ist es an uns, ihn zu verteidigen.<br />
Klingt das wie eine Mahnung?<br />
Ja, es ist auch eine. Unter Druck fallen<br />
lei<strong>der</strong> häufig Entscheidungen, die sich<br />
später als verheerend herausstellen.<br />
Unsere Zukunft wird also an<strong>der</strong>s<br />
aussehen als unsere Gegenwart, eine<br />
Landkarte für diese Reise gibt es nicht.<br />
Experimentierfreude und Mut sind die<br />
beste Ausrüstung für diese Reise. Die<br />
wahren Schätze finden sich am Ende <strong>der</strong><br />
Reise. Wem die Reisespesen gestrichen<br />
werden, <strong>der</strong> kann keinen Schatz finden.<br />
Es lässt sich viel lernen von denen,<br />
die Mut haben, wie etwa <strong>der</strong> britische<br />
Guardian. Er wird von einem brillanten<br />
Journalisten geführt, Alan Rusbridger.<br />
Ich bin stolz, dass er mein Freund ist.<br />
Nicht einmal, dass er davon überzeugt ist,<br />
dass guter Journalismus im Netz nicht<br />
bezahlt werden muss, hat mein Verhältnis<br />
zu ihm belastet.<br />
Im August 2012 heuerte Rusbridger<br />
den Blogger und Journalisten Glenn<br />
Anzeige<br />
Alte Nationalgalerie – Museumsinsel Berlin, Bodestr. 1–3, 10178 Berlin<br />
www.antongraffinberlin.de, www.smb.museum<br />
Geför<strong>der</strong>t durch:
TITEL<br />
Fass!<br />
Greenwald an, <strong>der</strong> dort seine Kolumnen<br />
veröffentlichte. Es war nur eines <strong>der</strong> vielen<br />
Experimente, die <strong>der</strong> Guardian wagt.<br />
Die Texte von Glenn Greenwald beeindruckten<br />
Edward Snowden, einen jungen<br />
Zivilangestellten des amerikanischen<br />
Geheimdiensts NSA so sehr, dass er sich<br />
an ihn wandte. Heraus kam die bisher<br />
bedeutendste Investigation dieses Jahres.<br />
Können Sie sich vorstellen, was dieser<br />
Scoop für den Guardian bedeutet?<br />
Wer von uns hier hat sich auf die Suche<br />
nach den Bloggern gemacht, bei denen<br />
sich <strong>der</strong> nächste Snowden melden wird?<br />
EIN WORT ZU den sozialen <strong>Medien</strong>: Facebook,<br />
Twitter, Instagram, wir interessieren<br />
uns für alles, wo kommuniziert wird.<br />
Hier empfohlen zu werden, ist so wichtig,<br />
wie es früher die Empfehlung auf dem<br />
Schulhof o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Aula <strong>der</strong> Universität<br />
gewesen ist. Nur sollten wir, welche Welt<br />
wir auch betreten, niemals die Regeln<br />
unseres Handwerks vergessen. Gründliche<br />
Recherche, richtig geht immer vor<br />
schnell. Das ist <strong>der</strong> Unterschied zwischen<br />
einem Gerücht und einer Nachricht.<br />
<strong>Der</strong> Inhalt also muss sich än<strong>der</strong>n,<br />
Leidenschaft statt Langeweile ist gefragt.<br />
Die Möglichkeiten <strong>der</strong> Digitalisierung<br />
sind atemberaubend, <strong>der</strong> Text, das<br />
bewegte Bild, die animierte Grafik – die<br />
Möglichkeit, dem beson<strong>der</strong>s interessierten<br />
Leser auch noch alle Dokumente und<br />
Interviews zur Verfügung zu stellen. In<br />
Echtzeit kann man mit ihm diskutieren,<br />
streiten, ihn um Hilfe bitten.<br />
Das Fazit: Chance und Risiko halten<br />
sich zumindest die Waage. Für Originalität<br />
und Klugheit wird es immer einen<br />
Markt geben. Wer sich diesem neuen, so<br />
viel härter gewordenen Wettbewerb nicht<br />
stellt, wird nicht überleben.<br />
Kommen wir zur ökonomischen<br />
Seite. Ich bin dafür kein Experte, und<br />
ich will es auch gar nicht sein. Ich halte<br />
es auch für schädlich, wenn sich Journalisten<br />
heute bei ihren Treffen zuerst fragen,<br />
wie es um ihr Geschäftsmodell steht,<br />
bevor sie über gute Geschichten reden.<br />
Soll doch bitte je<strong>der</strong> seinen Job machen.<br />
Aber blind sind wir auch nicht.<br />
Längst hat das begonnen, was man in<br />
an<strong>der</strong>en Branchen Konsolidierung nennt.<br />
Keiner hat es treffen<strong>der</strong> gesagt als Donald<br />
Graham, als er den Verkauf seiner<br />
geliebten Washington Post begründete:<br />
„Das Zeitungsgeschäft hat nicht aufgehört<br />
Fragen aufzuwerfen, auf die wir<br />
keine Antworten haben.“<br />
Ich glaube, dass die Zukunft noch<br />
immer ein Zuhause hat, es heißt Amerika.<br />
Ganz so weit wie dort sind wir in<br />
unserem Teil <strong>der</strong> Welt noch nicht, sonst<br />
könnte <strong>der</strong> Axel-Springer-Verlag einige<br />
seiner Blätter wohl kaum für 920 Millionen<br />
Euro verkaufen, während die<br />
Washing ton Post für 188 Millionen Euro<br />
den Besitzer wechselte. Dramatisch ist<br />
noch eine an<strong>der</strong>e Zahl aus den USA:<br />
Die New York Times Company verkaufte<br />
den Boston Globe für 70 Millionen<br />
Dollar, zehn Jahre zuvor haben sie<br />
dafür 1,1 Milliarden bezahlt. Nicht einmal<br />
die Pensionslasten hat <strong>der</strong> neue Eigentümer<br />
übernommen.<br />
Hören wir auf, uns zu beschweren.<br />
Wenn mir nichts Wesentliches entgangen<br />
ist, dann hat sich unsere Branche<br />
ja mit Hurra in das Abenteuer gestürzt,<br />
Journalismus im Netz zu verschenken<br />
und zu glauben, dass sich dies nicht auf<br />
den Verkauf auswirkt. Inzwischen wissen<br />
wir, dass aus Online-Lesern nur in<br />
den seltensten Fällen Stammleser des<br />
Printprodukts – o<strong>der</strong> seines digitalen<br />
Ebenbilds – werden. Jetzt wird mühsam<br />
versucht, diese Entwicklung zurückzudrehen:<br />
In Amerika verlangen 450 von<br />
1380 Tageszeitungen im Netz Geld, in<br />
Deutschland sind es 46 von 332. Viele,<br />
davon bin ich überzeugt, werden folgen.<br />
Ernst Elitz, <strong>der</strong> frühere Intendant<br />
des Deutschlandradios und heutige Direktor<br />
<strong>der</strong> „Berlin Media Professional<br />
School“, hat mit seinen Studenten einen<br />
Versuch gemacht: Sie verglichen den Auftritt<br />
einer großen deutschen Tageszeitung<br />
mit ihrer gedruckten Ausgabe. Um das<br />
Ergebnis zu demonstrieren, hielten sie<br />
die ersten beiden Seiten des Blattes hoch.<br />
Zusammengehalten wurde es nur noch<br />
vom weißen Rand und dem Logo. Dazwischen<br />
klaffte ein großes Loch, denn<br />
alle Texte waren tags zuvor schon auf <strong>der</strong><br />
Webseite zu lesen. Die Zeitung hatte sich<br />
auf dem Weg zum Kiosk, zum Leser in<br />
Luft aufgelöst.<br />
Wie lange soll dieser Unsinn noch<br />
weitergehen?<br />
Lernen wir von den Mutigen: Am<br />
28. März 2011 hat die New York Times<br />
ihr „Metered Model“ eingeführt, gerade<br />
sind die neuesten Zahlen veröffentlicht<br />
Zum Autor<br />
GEORG MASCOLO<br />
Er zählt zu den namhaften<br />
Ent hüllungs journalisten<br />
Deutschlands. Bis April war<br />
er Chefredakteur des Spiegel.<br />
Danach hat er sich als<br />
Gast dozent an <strong>der</strong> Harvard<br />
University mit dem transatlantischen<br />
Verhältnis und <strong>der</strong> NSA<br />
befasst. Ende Oktober traf er<br />
Edward Snowden in Moskau.<br />
Dieser Text basiert auf einer<br />
Grundsatzrede, die Mascolo<br />
bei <strong>der</strong> Jahrestagung des<br />
RingierVerlags in Belgrad hielt<br />
worden: Die Zeitung verdient 150 Millionen<br />
Dollar mit Digital Subscriptions.<br />
Ich habe damals mit dem damaligen<br />
Chefredakteur Bill Keller diskutiert, wir<br />
waren Partner bei <strong>der</strong> Berichterstattung<br />
über die Wikileaks-Dokumente. Meistens<br />
haben wir über gute Geschichten gesprochen.<br />
Aber – das muss ich zugeben –<br />
manchmal auch über Geschäftsmodelle.<br />
Ich habe den Mut <strong>der</strong> New York<br />
Times bewun<strong>der</strong>t: Sie war, damals, ziemlich<br />
allein. Es gab viel Wi<strong>der</strong>stand innerhalb<br />
<strong>der</strong> Zeitung, vor allem von jenen, die<br />
NYT.com zur meistgelesenen Webseite<br />
<strong>der</strong> Welt gemacht hatten. Die Washington<br />
Post höhnte noch, sie werde auf jeden<br />
Fall bei ihrem Gratismodell bleiben.<br />
<strong>Der</strong> Ausgang <strong>der</strong> Geschichte ist bekannt.<br />
Hören wir auf, nur die schlechten<br />
Nachrichten zur Kenntnis zu nehmen,<br />
wenn es um die Zukunft unseres Berufs<br />
geht. Wir sollten uns lieber anschauen,<br />
wo Geld in den Journalismus investiert<br />
wird. Jeff Bezos, <strong>der</strong> weitsichtige Grün<strong>der</strong><br />
von Amazon, kaufte die Washington<br />
Post, und Warren Buffett, <strong>der</strong> nicht<br />
dafür bekannt ist, in sterbende Industrien<br />
zu investieren, kauft gezielt Lokalzeitungen.<br />
Die beiden werden schon<br />
wissen, warum.<br />
Foto: Christian O. Bruch/laif<br />
38<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
BERLINER REPUBLIK<br />
„ Ein Überwachungsapparat<br />
liebt Fotos,<br />
denn er will alle<br />
Menschen erkennen.<br />
Ihre Anonymität zerstört er –<br />
durch Fotos “<br />
Roland Jahn, Beauftragter für die Stasi-Unterlagen, über die<br />
Gefahren <strong>der</strong> neuen Datenbrille Google Glass, Seite 52<br />
39<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
BERLINER REPUBLIK<br />
Porträt<br />
PAU STATT PFAU<br />
Im Bundestag ist die Vizepräsidentin Petra Pau eine Autorität. Obwohl sie <strong>der</strong> Linken<br />
angehört. Und obwohl sie mit ihrer Stimme zu kämpfen hat. Wie macht sie das?<br />
Von TIMO STEIN<br />
Foto: Jens Gyarmaty für <strong>Cicero</strong><br />
<strong>Der</strong> 5. Mai 2010 ist <strong>der</strong> Tag, an<br />
dem sie ihre Stimme verliert. Eigentlich<br />
ein typischer Mittwoch<br />
einer Sitzungswoche des Parlaments.<br />
Petra Pau, Linkenpolitikerin und Vizepräsidentin<br />
des Bundestags, soll die Enquetekommission<br />
Internet und Gesellschaft<br />
leiten. Phoenix überträgt live. Um<br />
14 Uhr betritt Pau den Saal, geht ans<br />
Pult, spricht zwei Sätze. Dann bricht ihre<br />
Stimme weg. Stille.<br />
In den Wochen darauf setzt Paus<br />
Stimme immer häufiger aus. Es wird ein<br />
Jahr dauern, bis sie die Kontrolle über<br />
ihr Sprechen zurückgewinnt. Klinikaufenthalte,<br />
Stimmtraining, sie kämpft. Sie<br />
habe an Rücktritt gedacht, sagt sie heute.<br />
Damals hätte sie das natürlich dementiert.<br />
Ausgerechnet ein CSU-Mann hilft<br />
ihr, Eduard Oswald, dabei kommt er aus<br />
jener Partei, die so leidenschaftlich gegen<br />
die Linke holzt. Aber er ist ihr Präsidiumskollege.<br />
Er lässt die Fernsehübertragung<br />
in seinem Büro mitlaufen, wenn<br />
Pau in ihrer Funktion als Bundestagsvize<br />
die Sitzungen leitet. Lässt ihre Stimme<br />
nach, steht er plötzlich hinter ihr, bereit,<br />
sie abzulösen. „Ich mach das hier mal zu<br />
Ende“, sagt er dann leise zu ihr.<br />
Gerade ist Petra Pau, 50 Jahre alt,<br />
wie<strong>der</strong>gewählt worden. Ihr Amt hat an<br />
Bedeutung gewonnen. Wenn es zur Großen<br />
Koalition kommt, hat das Regierungslager<br />
auch im Präsidium des Parlaments<br />
ein Übergewicht: Neben Bundestagspräsident<br />
Norbert Lammert von <strong>der</strong> CDU gibt<br />
es vier Vizepräsidenten von Union und<br />
SPD. Die Opposition hat im Präsidium nur<br />
die Grüne Claudia Roth – und Petra Pau.<br />
Sie muss also dafür sorgen, dass<br />
die Opposition an <strong>der</strong> Spitze des Parlaments<br />
sichtbar bleibt. Ausgerechnet eine<br />
1,63 Meter kleine Frau, <strong>der</strong>en Stimme immer<br />
noch im Duktus dauerhafter Heiserkeit<br />
zittert, Mitglied einer Partei, die all<br />
dem entgegensteht, was dieses Amt verkörpert:<br />
Überparteilichkeit, Mo<strong>der</strong>ation,<br />
Macht. Wie kann das funktionieren?<br />
An einem Herbstabend ist sie auf einer<br />
Veranstaltung in Berlin, es geht um<br />
den Nationalsozialistischen Untergrund.<br />
Ihr Thema. 19 Monate arbeitete sie im<br />
NSU-Untersuchungsausschuss. Paus<br />
Stimme fehlt noch die Tiefe, die Farbe.<br />
Auf dem Podium spricht sie mit technischer<br />
Hilfe. Sie trägt ein Headset. So<br />
wie sie es im Bundestag schon seit längerem<br />
macht. Mit auf dem Podium sitzt<br />
Eva Högl von <strong>der</strong> SPD. Sie verstehen sich.<br />
GRELLES LICHT VON OBEN. Paus rotes<br />
Haar schimmert gelb. Neben <strong>der</strong> Sozialdemokratin<br />
im Kostüm sieht die sommersprossige<br />
Linke in ihrem Ringelpullover<br />
fast aus wie ein Kind. Aber wenn<br />
sie spricht, wirkt sie nicht unsicher. Sie ist<br />
vorbereitet, bis ins Detail. Sie redet frei,<br />
fundiert, überzeugend. Ihre Augen springen<br />
hin und her, zum nächsten Kopf, zum<br />
nächsten Gedanken. Die Leute hören zu.<br />
Petra Pau ist quasi zweimal ihrer<br />
Partei beigetreten. In Berlin, Hauptstadt<br />
<strong>der</strong> DDR, war sie Lehrerin für Deutsch<br />
und Kunst. Schon mit 20 ging sie in die<br />
SED, als Nachwuchska<strong>der</strong> besuchte sie<br />
die Parteihochschule. Im Januar 1990<br />
marschierte Pau in die Kreisleitung <strong>der</strong><br />
PDS Hellersdorf. Sie wollte ihre Zugehörigkeit<br />
zur neuen Programmatik <strong>der</strong> PDS<br />
offiziell bekräftigen: Die Absage an jede<br />
Form des Stalinismus. Es war ihr Neuanfang.<br />
Sie wollte die Dinge klären.<br />
Im wie<strong>der</strong>vereinigten Deutschland<br />
begann ihre Politkarriere. Das Pau’sche<br />
Machtzentrum heißt Hellersdorf. 1991<br />
wurde sie im Problemkiez PDS-Bezirksvorsitzende.<br />
<strong>Der</strong> Sprung in den Bundestag<br />
gelang ihr im Herbst 1998. Vier Jahre<br />
später flog die PDS aus dem Parlament.<br />
Nur Gesine Lötzsch und Petra Pau holten<br />
Direktmandate. Zwei gegen den Rest des<br />
Bundestags. Sie saßen in einem hinteren<br />
Winkel des Parlaments, Beistelltische<br />
mussten sie sich erkämpfen. Pau lernte<br />
die Geschäftsordnung in- und auswendig,<br />
sie behauptete sich. Die Konkurrenz<br />
wurde hellhörig. Es sei kein Geheimnis,<br />
dass Joschka Fischer und Gerhard Schrö<strong>der</strong><br />
bei Lötzsch und ihr vorstellig wurden,<br />
um sie abzuwerben, sagt Pau heute.<br />
2005 schafft es die PDS wie<strong>der</strong>. Die<br />
Mehrheit lässt Lothar Bisky bei <strong>der</strong> Wahl<br />
zum Bundestagsvize durchfallen. <strong>Der</strong><br />
fragt Pau. Im April 2006 wird sie gewählt.<br />
Petra Pau ist eine Pragmatikerin,<br />
eine Realpolitikerin. Im Grunde sind das<br />
Schimpfworte für viele Linke. Aber Pau<br />
blendet ideologische Gräben einfach aus.<br />
Die Pfauen <strong>der</strong> Politik spreizen ihr Gefie<strong>der</strong>,<br />
sie stellen gern die Unterschiede<br />
in den Vor<strong>der</strong>grund, so laut wie möglich.<br />
Sie sucht das Gemeinsame. Sie spart an<br />
Lautstärke und findet umso mehr Gehör.<br />
Kürzlich erst bekam sie ein Dankschreiben<br />
vom erzkonservativen Norbert<br />
Geis. Sie präsidierte, als er im Juni seine<br />
letzte Bundestagsrede hielt, und verabschiedete<br />
ihn gebührend.<br />
Die gute Zusammenarbeit mit Politikern<br />
an<strong>der</strong>er Parteien zieht sich durch<br />
ihre Vita. Die Fähigkeit kann sie brauchen,<br />
wenn spätestens 2017 die Frage eines<br />
rot-rot-grünen Bündnisses auf Bundesebene<br />
wie<strong>der</strong> auf <strong>der</strong> politischen<br />
Agenda steht. Dann wird sie mo<strong>der</strong>ieren,<br />
Sektierer in die Schranken weisen.<br />
Noch sei es zu früh für ein solches Bündnis,<br />
sagt sie. Noch sei ein solches Bündnis<br />
nicht vorbereitet. Wenn es aber so weit<br />
ist, wird Petra Pau eine Rolle spielen. Es<br />
wird auf ihre Stimme ankommen.<br />
TIMO STEIN ist Redakteur bei <strong>Cicero</strong><br />
Online und befasst sich mit den linken<br />
Parteien <strong>der</strong> Berliner Republik<br />
41<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
BERLINER REPUBLIK<br />
Porträt<br />
UNTER KONTROLLE<br />
Erst wurde Alexan<strong>der</strong> Dobrindt Generalsekretär <strong>der</strong> CSU. Dann bezwang er seinen<br />
Körper und machte die Grünen nie<strong>der</strong>. Sein Befehlshaber ist Horst Seehofer<br />
Von GEORG LÖWISCH<br />
In <strong>der</strong> Nacht zum 9. Februar 2009 in<br />
Peißenberg Kreis Weilheim-Schongau<br />
beginnt ein Prozess, an dessen Ende<br />
die CSU triumphieren wird, die Grünen<br />
am Boden liegen und <strong>der</strong> Politiker<br />
Alexan<strong>der</strong> Dobrindt vom oberbayerischen<br />
Fettsack zum feinen Berliner Herrn<br />
mutiert ist. Auf Dobrindts Handy meldet<br />
sich <strong>der</strong> CSU-Chef und Ministerpräsident:<br />
Horst Seehofer. Er hat bis halb eins<br />
gebraucht. Wenn man den Bundeswirtschaftsminister<br />
Michael Glos wegmobben<br />
und den Generalsekretär Karl-Theodor<br />
zu Guttenberg auf dessen Posten setzen<br />
muss, kann es spät werden, bis man zur<br />
Generalsekretärsnachfolge kommt. Seehofer<br />
fragt den jungen Abgeordneten, <strong>der</strong><br />
in seiner Bundestagszeit auf demselben<br />
Stock sein Büro hatte. Dobrindt.<br />
Herbst 2013, Berlin. Nach einer Verhandlungsrunde<br />
um die Große Koalition<br />
verlässt Seehofer das Willy-Brandt-<br />
Haus. Er wirkt aufgekratzt, als wäre die<br />
SPD-Zentrale seine Stammwirtschaft.<br />
Neben dem 1,93-Meter-Trumm schwirrt<br />
ein Schwarm Leibwächter und Referenten.<br />
Sie konzentrieren sich auf den Chef.<br />
Aber neben ihm läuft ein Mann im taillierten<br />
Nadelstreifenanzug, <strong>der</strong> sich ein<br />
eigenes Lächeln leisten kann: Alexan<strong>der</strong><br />
Dobrindt, 43, er hat die Kampagne geleitet,<br />
die die CSU in einen Rausch führte.<br />
Jetzt organisiert er in einer Steuerungsgruppe<br />
die Verhandlungen von CDU,<br />
CSU und SPD. Er sagt: „Ich muss dafür<br />
sorgen, dass es kontrolliert abläuft.“<br />
Seehofer weist Dobrindt an, er solle<br />
auf eine Nachricht am nächsten Morgen<br />
warten. „Mach, was in <strong>der</strong> SMS steht.“<br />
In den vier Jahren als Generalsekretär<br />
hat sich Dobrindt verän<strong>der</strong>t. Er<br />
agierte zunehmend aggressiv. Im November<br />
2010 tobte Stuttgart 21, die<br />
Grünen reüssierten. Er nannte sie den<br />
„politischen Arm von Krawallmachern,<br />
Steinewerfern und Brandstiftern“. Politischer<br />
Arm, darin stecken viele Assoziationen.<br />
Nordirland, IRA, Terror.<br />
Das Amt des CSU-Generalsekretärs<br />
verlangt Attacken. So war es immer. <strong>Der</strong><br />
Ministerpräsident muss auch Staatsmann<br />
sein. <strong>Der</strong> Generalsekretär verkörpert<br />
CSU pur. „Er muss die an<strong>der</strong>en nie<strong>der</strong>machen,<br />
bis sie liegen“, sagt ein CSU-Politiker,<br />
<strong>der</strong> sich auskennt. Vielen Generalsekretären<br />
wurde die Rolle zur zweiten<br />
Natur. Dobrindt würde sie ausschalten<br />
können, sobald sie ihm nichts mehr nützt.<br />
„Ich habe eine Leidenschaft, Dinge<br />
an einem Reißbrett zu konstruieren“,<br />
sagt er. Strategisches Ziel, inhaltlicher<br />
Kern, assoziative Kraft. Für Mario<br />
Draghi, Chef <strong>der</strong> Europäischen Zentralbank,<br />
dachte er sich den Begriff „Falschmünzer“<br />
aus.<br />
Die SMS trifft um 5.30 Uhr ein.<br />
„Komm in die Landesleitung.“ Die Landesleitung<br />
ist die CSU-Zentrale in München.<br />
Seehofer schreibt nicht, wann Dobrindt<br />
da sein soll. Also fährt er lieber gleich los.<br />
Dobrindt hat Soziologie studiert. Demoskopische<br />
Daten analysiert er bis ins<br />
Detail. Früh hat er den Hauptgegner erkannt.<br />
Diagnose: „<strong>Der</strong> einzige Weg von<br />
den linken Parteien aus ins bürgerliche<br />
Lager einzudringen, waren die Grünen.“<br />
Ziel: Eine Brandmauer errichten. Therapie:<br />
Entfremdung. Er setzte die Grünen<br />
als Gegner des Ehegattensplittings<br />
in Szene, ihr Programm als Orgie <strong>der</strong><br />
Steuererhöhungen. Die Grünen prozessierten<br />
sogar dagegen. Das machte Dobrindts<br />
Kampagne richtig groß, dann verloren<br />
die Ökos auch noch vor Gericht.<br />
Er erkannte, dass die Pädophilen<br />
in <strong>der</strong> Grünen-Vergangenheit die ideale<br />
Story sind, um bürgerliche Wähler abzuschrecken.<br />
Den Politiker Volker Beck<br />
bezichtigte er ohne Faktengrundlage als<br />
„Vorsitzenden <strong>der</strong> Pädophilen-AG“. Beck<br />
gewann vor Gericht, es verbot Dobrindt<br />
die Äußerung – nach den Wahlen.<br />
Er kommt in die Landesleitung. Er<br />
wartet. Schließlich trifft Dorothee Bär<br />
ein, sie soll Vize-Generalsekretärin werden.<br />
Dann ist auch Guttenberg da.<br />
Dobrindt hat sich auch äußerlich<br />
verän<strong>der</strong>t. In <strong>der</strong> Anfangszeit kauerte er<br />
schwer in den Sesseln <strong>der</strong> Fernsehstudios,<br />
guckte aus Ritzen, die Wangen glänzten<br />
schwartig. 2011 beschloss er die Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
seines Körpers. Die Lust auf Süßes<br />
ersetzte er durch die Lust auf Disziplin.<br />
Minus 20 Kilo. Slim fit. Abenteureruhr mit<br />
Le<strong>der</strong>armband. Weihnachten 2011 kaufte<br />
er eine dunkel gerahmte Brille, die Marke<br />
hieß Krass. Er ist leicht kurzsichtig, die<br />
alte Brille brauchte er vor allem zum Sehen<br />
beim Autofahren. Die neue braucht<br />
er auch für das Aussehen. Die Augen wirken<br />
groß und freundlich und nachdenklich,<br />
wenn er zuhört. Ein eleganter Mann,<br />
<strong>der</strong> Drecksarbeit sauber verrichtet.<br />
Seehofer betritt den Raum. Er schenkt<br />
sich Kaffee ein.<br />
Erzählt Dobrindt von den Stunden,<br />
als ihn Seehofer zu seiner rechten Hand<br />
machte, spürt man seine Faszination für<br />
die Macht. Aber was will er? Was hat<br />
ihn in die Politik gebracht? Auf entsprechende<br />
Fragen nennt er Strauß und Kohl.<br />
Er leiht sich die Leidenschaft von ihnen,<br />
von zwei Politikern, die ausrasten konnten.<br />
Als Kohl einmal mit Eiern beworfen<br />
wurde, ging er auf die Angreifer los.<br />
Als Dobrindt Eier abkriegte, sagte er kalt,<br />
man solle das nicht überbewerten.<br />
Seehofer sagt: „Du wirst Wirtschaftsminister,<br />
du Generalsekretär, du stellvertretende<br />
Generalsekretärin.“<br />
Jetzt wartet Dobrindt auf den nächsten<br />
Befehl.<br />
GEORG LÖWISCH ist Textchef bei <strong>Cicero</strong>.<br />
Nachts schaltet er sein Handy stumm<br />
Foto: Archiv Klar/DJV Bildportal<br />
42<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
BERLINER REPUBLIK<br />
Kommentar<br />
DER<br />
WERT DES<br />
MENSCHEN<br />
Von<br />
FRANK A. MEYER<br />
Ökonomen und Manager<br />
ereifern sich über einen<br />
gesetzlichen Mindestlohn von acht<br />
Euro fünfzig pro Stunde. Warum?<br />
Weil sie Arbeiter als<br />
bloßes Objekt sehen<br />
Worum geht es bei <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung nach einem gesetzlichen<br />
Mindestlohn? Etwa um Ökonomie? Folgt<br />
man <strong>der</strong> alten marxistischen Ideologie, dann geht<br />
es immer um Ökonomie. Ebenso nach <strong>der</strong> aktuellen neoliberalen<br />
Ideologie.<br />
Die zwei entgegengesetzten säkularen Glaubenslehren erblicken<br />
in <strong>der</strong> Wirtschaft den Weg zur Erlösung: <strong>Der</strong> Kommunismus<br />
sieht sie in <strong>der</strong> Vergesellschaftung aller Produktionsmittel;<br />
<strong>der</strong> Marktradikalismus in <strong>der</strong>en Privatisierung – bis<br />
hin zu wesentlichen staatlichen Einrichtungen und Leistungen,<br />
seien es Schulen, Verwaltung, Straßenbau o<strong>der</strong> Sozialwerke.<br />
Was immer zur gesellschaftlichen Infrastruktur gehört, soll als<br />
Geschäft betrieben werden. Nicht einmal die Geldschöpfung<br />
durch staatliche Zentralbanken ist vom Furor <strong>der</strong> fanatischen<br />
Privatisierer ausgenommen.<br />
Zu den Produktionsmitteln <strong>der</strong> Marktgläubigen zählt auch<br />
<strong>der</strong> Mensch. Sie erfassen ihn in ihren Profitbilanzen als „Homo<br />
oeconomicus“, als „Humankapital“, als „Human resources“.<br />
Auf Deutsch: als „Rohstoff Mensch“.<br />
<strong>Der</strong> Rohstoffmensch bietet nach dieser Eschatologie seine<br />
Arbeit auf dem Markt als Ware an, die dann verrechnet wird<br />
mit <strong>der</strong> Nachfrage nach ebensolcher Ware, was schließlich den<br />
Lohn hervorbringt, respektive den Wert, den <strong>der</strong> Mensch auf<br />
dem Markt gerade zu erzielen vermag.<br />
Geht es also beim Mindestlohn ebenfalls um Ökonomie, da<br />
doch die Ökonomie <strong>der</strong> Angelpunkt aller Argumentation ist?<br />
Nein. Eben gerade nicht. Denn beim Mindestlohn geht es<br />
um den Menschen. Nur um ihn.<br />
Nur? Es geht um den Menschen als Höchstes.<br />
Es geht um seine Existenz. Die soll <strong>der</strong> Mindestlohn am<br />
unteren Rande <strong>der</strong> Gesellschaft garantieren: eine bescheidene,<br />
eine normale, eine gesunde Existenz, gesichert durch einen gerechten<br />
Lohn für des Menschen Arbeit.<br />
Illustration: Florian Bayer<br />
44<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Doch was ist ein gerechter Lohn, ein nicht vom Arbeitsmarkt<br />
– also vom Warenmarkt – hervorgebrachter Mindestlohn?<br />
Darüber können Ökonomen, die höheren Geistlichen <strong>der</strong><br />
Wirtschaftskirche, ganze Gebetsbücher vollfabulieren.<br />
Im vorliegenden Fall jedoch ist die Antwort einfach: Ein<br />
gerechter Lohn ist ein menschengerechter Lohn. Und ein menschengerechter<br />
Lohn ist ein Lohn, <strong>der</strong> dem arbeitenden Menschen<br />
gerecht wird, indem er ihm die Existenz ermöglicht.<br />
Und zwar eine Existenz ohne Heimarbeit, ohne Kellnern<br />
am Abend, ohne Verkaufsaushilfe in Randstunden, ohne Babysitting<br />
in <strong>der</strong> Nacht, auch ohne Flaschensammeln aus Abfalleimern<br />
– ohne zweiten o<strong>der</strong> gar dritten Job. Und ohne Sozialhilfe.<br />
Es geht also nicht etwa um mehr Lohn im Sinne von mehr<br />
Lohngerechtigkeit. Es geht um das Mindeste, das einem arbeitenden<br />
Menschen zusteht, einfach, weil er ein Mensch ist, in<br />
diese Zeit, in diese Gesellschaft geworfen, dem Leben ausgesetzt,<br />
das er zu leben hat, vor <strong>der</strong> Gesellschaft, vor seinen Angehörigen,<br />
vor Gott o<strong>der</strong> allein vor sich selbst.<br />
Es geht also um wenig, aber zugleich ums Ganze: Es geht<br />
um des Menschen Leben. <strong>Der</strong>zeit berechnet mit acht Euro fünfzig<br />
pro Stunde Arbeit – als Mindestlohn gesetzlich festzulegen.<br />
Dagegen laufen die Marktradikalen Sturm. In ihren Augen<br />
ist die staatliche Garantie dieses Lohnes Gotteslästerung:<br />
Weil ihr Gott <strong>der</strong> Markt ist und Gott gerecht, muss <strong>der</strong> von ihnen<br />
als unantastbar erklärte Marktlohn ebenso gerecht sein.<br />
Sogar die Deutsche Bank, Deutschlands Geldkirche, mit<br />
kriminellen und spekulativen Umtrieben <strong>der</strong> jüngeren Vergangenheit<br />
weiß Gott ausgelastet, fühlt sich zu warnen aufgerufen:<br />
Acht Euro fünfzig pro Stunde, diese Sünde wi<strong>der</strong> das ökonomische<br />
Gesetz, führe zum Verlust von 450 000 Arbeitsplätzen<br />
im besten Fall, einer Million im schlimmsten.<br />
Die hauseigenen Ökonomen-Pfäffchen belegen, was die<br />
höheren Würdenträger zu belegen ihnen befohlen haben. Die<br />
Bank, <strong>der</strong>en Boniritter Hun<strong>der</strong>te Millionen in die eigenen Taschen<br />
wirtschafteten, <strong>der</strong>en skandalbesudelte Führung nach<br />
wie vor Millionen in die eigenen Taschen wirtschaftet, fühlt<br />
sich zur Sorge um die Arbeitnehmer bemüßigt. Heuchelei gehört<br />
nun mal zum Kirchengeschäft.<br />
Kann ein Mensch im teuren Deutschland mit weniger als<br />
acht Euro fünfzig pro Stunde menschengerecht leben? Wer das<br />
behauptet, soll es probieren. Etwa Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer<br />
des Deutschen Industrie- und Handelskammertags.<br />
Er wirft den Politikern vor, dem Mindestlohn liege eine<br />
„Milchmädchenrechnung“ zugrunde. Selbst mit dem Mindestlohn<br />
von acht Euro fünfzig wäre Wansleben nicht in <strong>der</strong> Lage,<br />
auch nur ein Milchmädchenleben zu finanzieren.<br />
Was ist das für ein Gefühl: einen Monat lang ordentlich arbeiten,<br />
um dann einen Lohn zu erhalten, <strong>der</strong> ein ordentliches<br />
Leben nicht ermöglicht? Es ist ein Gefühl <strong>der</strong> Entwürdigung.<br />
Ein Gefühl? Es ist Entwürdigung!<br />
Menschen, denen man den minimal gerechten Lohn verweigert,<br />
nimmt man die Würde.<br />
Ja, <strong>der</strong> Markt erniedrigt den Menschen zur Ware, zum<br />
Objekt – vor allem jenen Menschen, <strong>der</strong> sich dagegen nicht<br />
zur Wehr setzen kann: den sozial Schwachen, den Armen,<br />
den Ohnmächtigen.<br />
Die Deutsche Bank,<br />
die Geldkirche<br />
des Landes, schickt ihre<br />
Pfäffchen los.<br />
Sie heucheln Sorge<br />
um Arbeitsplätze –<br />
wegen des<br />
Mindestlohns<br />
Hatte <strong>der</strong> Markt nicht einst auch große Nachfrage nach<br />
Kin<strong>der</strong>arbeit: in Bergwerken und Fabriken? Ließ sich nicht<br />
auch diese kapitalistische Perversion mit ökonomischer Rechnerei<br />
hieb- und stichfest begründen? Musste nicht auch diese<br />
Schande per Gesetz beendet werden, gegen die Marktradikalen<br />
des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts?<br />
Und wie sieht es heute im ganz konkreten Leben aus? <strong>Der</strong><br />
Mann schämt sich vor seiner Frau, dass er nicht genug Geld<br />
nach Hause bringt, dass er ihr nichts schenken kann, dass er<br />
sie bitten muss, jeden Cent zweimal umzudrehen, dass sie dazuverdienen<br />
muss, trotz Kin<strong>der</strong>n, dass es aber trotzdem kaum<br />
reicht, dass <strong>der</strong> Staat am Schalter <strong>der</strong> Arbeitsagentur um Geld<br />
angebettelt werden muss, dass dazu demütigende Fragen zu<br />
beantworten sind.<br />
Und die alleinerziehende Mutter versteckt ihre Armseligkeit<br />
vor dem Töchterchen, das ein Spielzeug möchte wie die<br />
Schulkameradinnen, das es dann doch ausnahmsweise erhält,<br />
weil die Mutter abends noch putzen geht.<br />
So existiert es sich im armen Deutschland.<br />
Im reichen Deutschland, wo man ökonomisch schaltet<br />
und waltet, ereifern sich die Marktanbeter mitsamt ihrem<br />
frommen, fürstlich ausgehaltenen Ökonomen-Klerus <strong>der</strong>weil<br />
über den Sündenfall eines gesetzlichen Mindestlohns von acht<br />
Euro fünfzig!<br />
Was für ein Menschenbild! Das Leben <strong>der</strong> armen an<strong>der</strong>en<br />
im armen an<strong>der</strong>en Deutschland ist keinen Lohn wert, <strong>der</strong> nicht<br />
den Segen des Marktes hat.<br />
Ja, für die Marktradikalen gibt es das – man wagt es<br />
kaum zu schreiben: unwertes Leben. Unwert, weil es sich<br />
nicht rechnet.<br />
FRANK A. MEYER ist Journalist und Gastgeber <strong>der</strong> politischen<br />
Sendung „Visàvis“ in 3sat<br />
45<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
BERLINER REPUBLIK<br />
Report<br />
Von hier aus wollte die SPD die Macht in Deutschland erobern.<br />
Wurde nichts. Schon wie<strong>der</strong> nicht. Das WillyBrandtHaus ist ein<br />
Kunstwerk, keine Kampfmaschine<br />
Foto: Michael Ruetz/Agentur Focus<br />
46<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
DAS<br />
GEISTERSCHIFF<br />
An Bord sind sie ins Scheitern verliebt.<br />
Das Berliner Willy-Brandt-Haus <strong>der</strong> SPD: Zentrale <strong>der</strong><br />
Lähmung und des Schreckens<br />
Von CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
Was für eine Kraft dieses Gebäude<br />
ausstrahlt. Wie ein<br />
Schiffsbug pflügt es die Wilhelmstraße<br />
zur einen und die Stresemannstraße<br />
zur an<strong>der</strong>en Seite. Die Kuppel<br />
oben auf <strong>der</strong> Nase des Bugs sieht aus<br />
wie eine Kommandobrücke, von <strong>der</strong> aus<br />
<strong>der</strong> Kapitän dieses Schiff durch die Straßenzüge<br />
Berlins steuert. Oben weht die<br />
rote Fahne <strong>der</strong> SPD im Herbstwind.<br />
Da liegt die Parteizentrale <strong>der</strong> Bundes-SPD:<br />
Das Willy-Brandt-Haus in Berlin,<br />
<strong>der</strong> Name soll Tradition und Kraft<br />
signalisieren. Aber wenn man einmal<br />
drum herum geht und in die Fenster<br />
schaut, dann hält das mächtige Gebäude<br />
vor allem Komik bereit. Im Bürgerbüro<br />
Kreuzberg-Friedrichshain sitzt ein grau<br />
melierter Mann im Ringelpulli an einem<br />
Bistrotischchen vor seinem aufgeklappten<br />
Laptop, einer Kaffeekanne und einer<br />
Bierflasche. Das Bistro „Willy’s“ hat<br />
schon geschlossen, aber die Leuchtreklame<br />
des Reisebüros daneben – ein<br />
SPD-Emblem auf einem weißen Koffer –<br />
leuchtet noch über einem Plakat <strong>der</strong> MS<br />
Azores, die „Reisen mit persönlicher<br />
Note“ verspricht. Links davon liegen auf<br />
einem Grabbeltisch des „Image-Shops“<br />
SPD-rote Wurstbrotdosen („Ganz mein<br />
Geschmack“) neben roten Badelatschen,<br />
die für 3,99 Euro zu haben sind – wie<br />
jemand mit einem roten Filzstift auf eine<br />
Ringbucheinlage geschrieben hat, die am<br />
Grabbeltisch pappt.<br />
Von hier aus wollte die SPD die<br />
Macht in Deutschland erringen. Von<br />
diesem Ort <strong>der</strong> pompösen Piesepampeligkeit<br />
wollte sie das Kanzleramt erobern.<br />
In Wahlkampfzeiten verwandeln<br />
sich Parteizentralen von einem Verwaltungsapparat<br />
in Kampfmaschinen. Jedenfalls,<br />
wenn alles richtig läuft. Bei <strong>der</strong><br />
SPD ist nicht alles richtig gelaufen, das<br />
kann man bei einem Wahlergebnis von<br />
25,7 Prozent ohne Risiko sagen. Manche<br />
sagen sogar, es ist <strong>der</strong> schlechteste Wahlkampf<br />
gewesen, den in <strong>der</strong> Bundesrepublik<br />
je eine Partei geführt hat.<br />
„WELCHER WAHLKAMPF?“, fragt einer,<br />
<strong>der</strong> hinter diesen Mauern arbeitet und<br />
durch die gläserne Drehtür geht. Es sei<br />
Zeit, fügt er hinzu, die Nie<strong>der</strong>lage ehrlich<br />
zu analysieren, statt bei den Fehlern<br />
des Kandidaten stehen zu bleiben. Denn<br />
es ist viel mehr schiefgelaufen. „Aber zu<br />
<strong>der</strong> Analyse wird es wie<strong>der</strong> nicht kommen“,<br />
sagt er. Dieser Jemand darf wie<br />
alle Gesprächspartner aus diesem Haus<br />
keinen Namen und kein Gesicht haben.<br />
Denn so ehrlich läuft die Aufarbeitung<br />
nicht, dass jemand, <strong>der</strong> die Dinge beim<br />
Namen nennt, nichts zu befürchten hätte.<br />
Eine Zentrale ist strukturell ein<br />
schwieriges Gebilde. „Bullshit Castle“<br />
hat <strong>der</strong> frühere Daimler-Boss Jürgen<br />
Schrempp einmal den Firmensitz seines<br />
Unternehmens genannt. Schrempp<br />
kannte nicht das Zuhause <strong>der</strong> ältesten<br />
Partei Deutschlands. Die Beschreibung<br />
trifft aber auch auf die Behausung <strong>der</strong><br />
SPD zu. Im Willy-Brandt-Haus spiegeln<br />
sich alle Probleme <strong>der</strong> Partei. Hier haben<br />
sich die Sedimente <strong>der</strong> zuletzt häufig<br />
wechselnden Parteivorsitzenden abgelagert<br />
und sind zu Gestein ausgehärtet.<br />
Knapp 200 Leute haben es sich in<br />
diesem Haus eingerichtet. In einer Parteizentrale<br />
sollten Ideen, Stimmungen<br />
und Wünsche aus den Glie<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Partei zusammentreffen, damit daraus<br />
Politik entsteht. Hier müsste die Politik<br />
zu einer schlagkräftigen Strategie<br />
werden. Den Landesverbänden und Unterbezirken<br />
würde die Zentrale helfen,<br />
zu planen, zu organisieren, sich auszurüsten,<br />
auf dass man gemeinsam in See<br />
sticht. Vorneweg das stolze Flaggschiff<br />
mit <strong>der</strong> stärksten Mannschaft, bei <strong>der</strong> je<strong>der</strong><br />
Handgriff sitzt und in <strong>der</strong> je<strong>der</strong> für<br />
den an<strong>der</strong>en einsteht.<br />
Aber so ist es nicht. Die Zentrale <strong>der</strong><br />
SPD gleitet wie ein Geisterschiff dahin,<br />
das keinen klaren Kurs hat, son<strong>der</strong>n einer<br />
seltsamen, jenseitigen Logik folgt.<br />
47<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
BERLINER REPUBLIK<br />
Report<br />
Im Wahlkampf gab es ein Lauerverhältnis.<br />
Stammbesatzung gegen SteinbrückCrew. Gabriel gegen Nahles.<br />
Wer hier aufräumt, hat viel vor sich<br />
Niemand will ihm zu nahe kommen. Alle<br />
Versuche, es mit Leben zu füllen, es neu<br />
zu bauen, scheitern seit Jahrzehnten.<br />
Selbst <strong>der</strong> Umzug nach Berlin 1999<br />
konnte daran nichts än<strong>der</strong>n. Dabei<br />
wurde fast die Hälfte des Personals ausgetauscht,<br />
aber irgendwie blieb die Parteizentrale<br />
immer die „Baracke“, die<br />
sie vor Jahrzehnten in Bonn buchstäblich<br />
war. Die Schlagzeilen aus <strong>der</strong> guten<br />
alten Zeit, als noch ausgeschnitten und<br />
auf Papier archiviert wurde, sind vergilbt,<br />
aber sie lesen sich wie frisch gedruckt.<br />
„Blühen<strong>der</strong> Frust“, „Engholms<br />
schwieriger Start in <strong>der</strong> SPD-Baracke“,<br />
„Die ausgezehrte Bonner SPD-Baracke“.<br />
Man könnte meinen, die fehlende Schlagkraft<br />
dieser Parteizentrale ist eine Erbkrankheit,<br />
die von Bonn mit nach Berlin<br />
genommen wurde.<br />
Einzig die Zeit, als Franz Müntefering<br />
die Zentrale führte, wird von vielen<br />
Insassen und vor allem von jenen, die<br />
dem Haus achselzuckend den Rücken gekehrt<br />
haben, als Phase wahrgenommen,<br />
in <strong>der</strong> sich die Kraft einigermaßen entfaltete.<br />
1996 hatte Müntefering als Bundesgeschäftsführer<br />
in Vorbereitung auf den<br />
Wahlkampf 1998 sogar den Klassenfeind<br />
ins Haus geholt. Eine Zürcher Unternehmensberatung<br />
nahm sich die Parteizentrale<br />
ein Jahr lang vor. Arbeitsauftrag:<br />
„Die Aufgaben einer mo<strong>der</strong>nen Parteizentrale<br />
zu definieren und Vorschläge<br />
zu entwickeln, wie diese Aufgaben möglichst<br />
optimal erfüllt werden können.“<br />
Gleichzeitig quartierten Müntefering<br />
und seine engsten Mitarbeiter, allen voran<br />
<strong>der</strong> heutige thüringische Wirtschaftsminister<br />
Matthias Machnig, die Wahlkampfzentrale<br />
vorsichtshalber aus <strong>der</strong> Bonner<br />
Baracke aus. 100 Meter weiter nahm die<br />
„Kampa“ ihre Arbeit auf, an <strong>der</strong> Fassade<br />
des Hauses zählte eine große Digitaluhr<br />
die Tage, die Helmut Kohl bis zur Abwahl<br />
blieben. Es folgten Jahre, in denen die<br />
SPD in <strong>der</strong> Lage war, Wahlen zu gewinnen.<br />
2002 war die Partei längst von Bonn<br />
nach Berlin gezogen, aber Münteferings<br />
Strategen schätzten die Kraft des Neuanfangs<br />
im neuen Haus so nüchtern ein,<br />
dass sie eine Kampa 02 für nötig hielten.<br />
Sie wurde an <strong>der</strong> Oranienburger Straße<br />
errichtet, im vibrierenden Berlin-Mitte,<br />
fern vom muffigem Parteigeruch. Dort<br />
sollten junge Leute Rot-Grün gegen Edmund<br />
Stoiber verteidigen.<br />
AUS DIESER ZEIT ist die Erkenntnis geblieben,<br />
dass Erfolge <strong>der</strong> Partei woan<strong>der</strong>s<br />
organisiert werden müssen, möglichst<br />
weit weg vom Willy-Brandt-Haus. Im<br />
Kanzleramt, in einer Staatskanzlei o<strong>der</strong><br />
eben in einer Kampa. Die Münte-Boys<br />
von damals hat es in alle Winde verstreut.<br />
Sie reden heute noch mit leuchtenden<br />
Augen von diesen Zeiten und bekommen<br />
matte Blicke, wenn sie über das Heute<br />
reden. „Die sind in <strong>der</strong> Birne nicht klar<br />
gewesen“, seufzt <strong>der</strong> eine und meint die<br />
Leute in <strong>der</strong> Parteizentrale. Es habe ein<br />
gebrochenes Verhältnis zu den elf Jahren<br />
Regierungszeit und zur Agenda 2010<br />
gegeben, konstatiert ein an<strong>der</strong>er. Außerdem<br />
habe sich das Haus seit jeher lieber<br />
als Denkfabrik verstanden – man könnte<br />
auch sagen: Bedenkenträgerfabrik. Das<br />
Adenauer-Haus <strong>der</strong> CDU dagegen funktioniere<br />
als Dienstleister: „Da steckste<br />
oben einen Befehl rein, dann rennen die!“<br />
Als Beleg wird eine Szene des Buchautors<br />
und FAZ-Journalisten Nils Minkmar<br />
angeführt, <strong>der</strong> Peer Steinbrück über<br />
ein Jahr begleitet hat. Einmal bekam er<br />
einen Anruf aus dem Büro des Kanzlerkandidaten<br />
im Willy-Brandt-Haus. Eine<br />
Dame fragte ihn nach seiner E-Mail-Adresse.<br />
Das ist allein schon ein son<strong>der</strong>bares<br />
Zeichen, weil solche Adressen bekannter<br />
„Kunden“ eigentlich in einem<br />
gut organisierten Haus für alle Wahlkämpfer<br />
zugänglich sein sollten. Dann<br />
aber bat die Dame Minkmar zu dessen<br />
Erstaunen auch noch um eine Handynummer<br />
– die Nummer jenes Handys,<br />
auf dem sie ihn gerade erreicht hatte.<br />
Foto: Thomas Meyer/Ostkreuz für <strong>Cicero</strong><br />
48<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
So etwas ist ein Indiz für große Versäumnisse.<br />
Dafür, dass hier je<strong>der</strong> vor sich<br />
hin arbeitete. Dazu kam etwas, das ein<br />
Kundiger einen „Bandsalat im Brandt-<br />
Haus“ nennt. Bandsalat, das meint die<br />
wechselseitige Lähmung <strong>der</strong> drei bis vier<br />
Kraftzentren im Haus.<br />
Da sei zum einen <strong>der</strong> Vorsitzende<br />
Sigmar Gabriel, dessen Sprunghaftigkeit<br />
und Lust am Alleingang dem ganzen<br />
Haus den letzten Nerv rauben. Gabriel<br />
habe permanent neue Arbeitsaufträge<br />
vergeben, die ihn kurz danach schon<br />
nicht mehr interessierten. Dazu das<br />
„Lauerverhältnis“ zur Generalsekretärin<br />
Andrea Nahles, die ihm so wenig über<br />
den Weg traut wie er ihr. Das Misstrauen<br />
führte dazu, dass sich die beiden nicht<br />
einmal auf einen Bundesgeschäftsführer<br />
einigen konnten. Diese Schlüsselposition<br />
ist seit Jahren unbesetzt. So zehrte Nahles<br />
ihre Kräfte erstens damit auf, dem<br />
Aktionismus des Vorsitzenden hinterherzuräumen,<br />
und zweitens, das Haus nach<br />
innen zu führen. Was eigentlich die Aufgabe<br />
des Bundesgeschäftsführers wäre.<br />
Das Durcheinan<strong>der</strong> verstärkte sich,<br />
weil Peer Steinbrück eigene Leute mit<br />
an Bord brachte. Sie wurden von <strong>der</strong><br />
Stammbesatzung teils wie Aussätzige behandelt,<br />
<strong>der</strong> Steinbrück-Berater Roman<br />
Maria Koidl war in Kürze erfolgreich vergrämt.<br />
In drei Lager zerfiel so das Haus.<br />
Als einzig wirkliche Macht im Wirrwarr<br />
erwies sich die Schatzmeisterin Barbara<br />
Hendricks. Sie habe in Wahrheit durch<br />
ihre Geldvergabe den Laden gesteuert,<br />
resümiert ein Zeuge die Ereignisse.<br />
Man müsse ins Gelingen verliebt<br />
sein, hat Gerhard Schrö<strong>der</strong> seiner Partei<br />
immer gesagt. Weil er ihr Wesen so genau<br />
kannte. Denn auf eine Art ist es mit<br />
<strong>der</strong> Zentrale <strong>der</strong> SPD wie mit ihrem ganzen<br />
Gestus: Sie leidet lieber, als dass sie<br />
sich ein Herz fasst, sich hinter dem Kanzlerkandidaten<br />
schart und ihn zum Wahlsieg<br />
trägt. Wenn die Generalsekretärin<br />
Andrea Nahles Ministerin wird, steht ihr<br />
Nachfolger vor einer Aufgabe in diesem<br />
Haus, so gewaltig wie <strong>der</strong> Bug, <strong>der</strong> durch<br />
die zwei Straßen von Berlin pflügt.<br />
CHRISTOPH SCHWENNICKE ist<br />
Chefredakteur von <strong>Cicero</strong>. Im Archiv hat<br />
er viele eigene Artikel über die chronische<br />
Misere <strong>der</strong> SPDZentrale gefunden<br />
FRAU FRIED FRAGT SICH …<br />
… ob wir in einer Wohlfühldiktatur leben<br />
Neulich habe ich meinen ersten Yoga-Kurs gemacht. Ich finde<br />
Yoga super. Man lernt neue Muskeln kennen und Stellungen,<br />
die „Herabschauen<strong>der</strong> Hund“ o<strong>der</strong> „Krieger 2“ heißen. Leute,<br />
die Yoga machen, achten auf sich. Sie sagen Sätze wie „das tut mir<br />
gut“ o<strong>der</strong> „achte mal drauf, was dir guttut“. Hört man diese Sätze<br />
gehäuft, fragt man sich, ob sie symptomatisch sind für unser Leben in<br />
<strong>der</strong> Wohlfühldiktatur. Denn: Uns gut zu fühlen, ist oberstes Gebot.<br />
Ständig scannen wir unsere körperliche und seelische Verfassung.<br />
Haben wir ausreichend geschlafen? Haben wir genügend Vitamine zu<br />
uns genommen? Sind wir in unserer Mitte?<br />
Unser Gottesdienst ist die Fernsehwerbung vor den 19-Uhr-Nachrichten:<br />
nur Produkte zur Steigerung des Wohlbefindens. Vitamin-B-Shots<br />
für bessere Konzentration, linksdrehen<strong>der</strong> Milchsäurejoghurt<br />
für die Verdauung, Diätdrinks fürs Traumgewicht. „Das tut<br />
mir gut“ ist das Mantra unserer Zeit, die Überzeugung, dass es <strong>der</strong><br />
Welt gut geht, wenn es mir gut geht. Lei<strong>der</strong> ist das Gegenteil <strong>der</strong> Fall.<br />
Unser Leben ist gut, weil das an<strong>der</strong>er schlecht ist. Und wenn von<br />
diesen an<strong>der</strong>en welche hierherkommen, um ein besseres Leben zu<br />
finden, schicken wir sie heim o<strong>der</strong> lassen sie ertrinken, um sicherzustellen,<br />
dass unser Leben gut bleibt. Die Fixierung aufs eigene<br />
Wohlbefinden geht mit dem Verlust von Empathie einher. Wer mit <strong>der</strong><br />
existenziellen Frage beschäftigt ist, ob er nach 18 Uhr noch Rohkost<br />
essen kann („ich glaube, das tut mir gar nicht gut“), kann sich nicht<br />
noch darum kümmern, ob an<strong>der</strong>swo Leute sterben, sorry jetzt mal!<br />
Ich muss an einen Freund aus meiner Jugend denken. <strong>Der</strong> schlief<br />
auf einer Isomatte, ernährte sich absichtlich schlecht und führte<br />
seinem Körper gerne zweifelhafte Substanzen zu. Seine Philosophie<br />
war, dass man einem Organismus, um ihn gesund zu halten, etwas<br />
zumuten müsse. Betrachten wir unsere Gesellschaft als Organismus.<br />
Ab auf die Isomatte! Muten wir uns etwas zu! Vergessen wir das<br />
Tut-mir-gut-Mantra und fragen wir uns, was an<strong>der</strong>en guttun könnte!<br />
Ich mache übrigens weiter Yoga. So viel Bewegung kann unmöglich<br />
gut für mich sein.<br />
AMELIE FRIED ist Fernsehmo<strong>der</strong>atorin und Bestsellerautorin.<br />
Für <strong>Cicero</strong> schreibt sie über Männer, Frauen und was das Leben<br />
sonst noch an Fragen aufwirft<br />
49<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
<strong>Cicero</strong> lesen<br />
o<strong>der</strong> verschenken.<br />
Bringen Sie sich Monat für Monat in angenehme Erinnerung und beschenken<br />
Sie Freunde o<strong>der</strong> sich selbst mit einem <strong>Cicero</strong>-Abonnement.<br />
Zum Dank erhalten Sie zusätzlich ein Geschenk Ihrer Wahl.<br />
Wählen Sie ein Dankeschön!<br />
1. Elegant durchs Jahr:<br />
<strong>Cicero</strong>-Kalen<strong>der</strong> 2014<br />
<strong>Der</strong> original <strong>Cicero</strong>-Kalen<strong>der</strong><br />
mit praktischer Wochenansicht<br />
auf einer Doppelseite und<br />
herausnehmbarem Adressbuch.<br />
Begleitet von Karikaturen, bietet<br />
<strong>der</strong> in Surbalin gebundene<br />
Kalen<strong>der</strong> viel Platz für Ihre<br />
Termine und Notizen.<br />
2. illy Art Collection: Kaffeebecher von Kiki Smith<br />
Die Fantasie <strong>der</strong> amerikanischen<br />
Künstlerin entfaltet sich<br />
auf <strong>der</strong> Oberfläche <strong>der</strong> illy<br />
Kaffeebecher nach Art <strong>der</strong><br />
dekorativen Künste, wobei sie<br />
die europäische Tradition <strong>der</strong><br />
Blumenmalerei auf Keramik<br />
neu interpretiert.<br />
3. Klassik-CD:<br />
Lang Lang/Simon Rattle<br />
Lang Lang, Sir Simon Rattle und<br />
die Berliner Philharmoniker<br />
spielen zwei Meilensteine <strong>der</strong><br />
Klavierliteratur des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts:<br />
Prokofievs explosives Klavierkonzert<br />
Nr. 3 sowie Bartóks<br />
Klavierkonzert Nr. 2. Limitierte<br />
Edition mit Bonus-DVD.<br />
4. Für Genießer:<br />
Das <strong>Cicero</strong>-Weinpaket<br />
Eine Kombination zweier<br />
außergewöhnlicher Weine:<br />
<strong>Der</strong> komplexe und edle<br />
Château de Lussan Cru<br />
Artisan AOC und <strong>der</strong> feine<br />
Grüne Veltliner von Winzer<br />
Stefan Bauer aus Wagram/<br />
Österreich.
<strong>Cicero</strong><br />
verschenken<br />
CICERO<br />
VERSCHENKEN<br />
& selbst beschenkt<br />
werden<br />
Entdecken Sie die Vorteile eines <strong>Cicero</strong>-Abonnements:<br />
<strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis: Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf.<br />
<strong>Cicero</strong> portofrei und bequem nach Hause geliefert.<br />
Wählen Sie zusätzlich ein Geschenk aus unserer <strong>Cicero</strong>-Kollektion.<br />
Weitere Geschenke finden Sie unter www.cicero.de/weihnachten<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
www.cicero.de/weihnachten<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 1097985 (für mich)<br />
Bestellnr.: 1097986 (als Geschenk)
BERLINER REPUBLIK<br />
Essay<br />
MACHT UND<br />
KAMERA<br />
Aus den Erfahrungen<br />
mit <strong>der</strong> Stasi können<br />
wir eine Menge über<br />
die neue Datenbrille<br />
Google Glass lernen<br />
Von ROLAND JAHN<br />
Als ich das Volkspolizeiamt verließ,<br />
drückte jemand auf den<br />
Auslöser. Klick, es war, glaube<br />
ich, das erste heimliche Foto von mir.<br />
Ich merkte nichts.<br />
Damals, 1981, war ich Ende zwanzig.<br />
Die Stasi hatte mich auf die Volkspolizei<br />
bestellen lassen, um ein Reiseverbot<br />
auszusprechen. Helmut Schmidt<br />
besuchte die DDR, und Erich Honecker<br />
wollte ihn im mecklenburgischen<br />
Güstrow über den Weihnachtsmarkt<br />
führen. Geheimpolizisten traten als<br />
brave Bürger auf: eine heile Welt im Advent,<br />
die frei von allem Unkontrollierbaren<br />
sein sollte. Leute wie ich durften<br />
ihre Stadt nicht verlassen.<br />
Es war das erste Bild von vielen, die<br />
ich ab 1992 in den Stasiakten über mich<br />
gefunden habe. Viele Bil<strong>der</strong> zeigten mich<br />
in Momenten, in denen ich mich unbeobachtet<br />
fühlte. Es gab Aufnahmen aus<br />
<strong>der</strong> DDR und Aufnahmen aus Westberlin,<br />
wo ich nach <strong>der</strong> gewaltsamen Ausbürgerung<br />
seit 1983 lebte. Man denkt,<br />
die Stasi ist hinter einem, aber sie ist neben<br />
einem. Fotos von meiner Wohnung in<br />
Kreuzberg, Fotos vom Briefkasten, Fotos<br />
vom Treppenhaus. Es sind auf den ersten<br />
Blick banale Details, aber sie werden nicht<br />
grundlos festgehalten. Fotos von <strong>der</strong> Wohnungstür<br />
und, ja, auch Fotos vom Schulweg<br />
meiner Tochter. Mich durchzuckte es,<br />
als ich die Bil<strong>der</strong> das erste Mal sah.<br />
52<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Illustration: Leif Heanzo<br />
Ein Überwachungsapparat liebt Fotos,<br />
denn er will alle Menschen erkennen<br />
können. Ihre Anonymität zerstört<br />
<strong>der</strong> Apparat – durch Fotos. Er sortiert<br />
die Bil<strong>der</strong>, ordnet sie zu, er passt die Abgebildeten<br />
in seine Organigramme ein. In<br />
Vernehmungen legten Stasioffiziere gern<br />
Fotos auf den Tisch: Kennen Sie den?<br />
Welche Rolle spielt er? Wie ist das Beziehungsgeflecht<br />
um ihn herum?<br />
Die Stasi benutzte Kameras, die in<br />
Aktenkoffern versteckt waren. Sie stahl<br />
Fotos aus Wohnungen. Sie ließ Inoffizielle<br />
Mitarbeiter Fotos von ihren Freunden<br />
machen. Sie nutzte die emotionale<br />
Kraft von Bil<strong>der</strong>n, um Menschen zu beeindrucken,<br />
zu kompromittieren, um –<br />
so hieß es – sie zu zersetzen. Bil<strong>der</strong> zu<br />
sammeln, war <strong>der</strong> Stasi so wichtig wie<br />
Gespräche abzuhören, sie wurde nicht<br />
umsonst Horch und Guck genannt. Die<br />
Stasi-Unterlagen-Behörde verwahrt 1,7<br />
Millionen Bil<strong>der</strong> <strong>der</strong> DDR-Geheimpolizei:<br />
Fotos, Negative, Dias im Archiv.<br />
Damit keine Missverständnisse entstehen:<br />
Eine Kamera ist nichts Schlechtes.<br />
Technik ist keine Bedrohung, nur ihr<br />
Missbrauch. Das gilt auch für die neuen<br />
Kameras, die in jedem Mobiltelefon stecken.<br />
Und bald auch in Google Glass, jener<br />
Brille, in <strong>der</strong> Kamera, Mikrofon und<br />
ein Minirechner enthalten sind, <strong>der</strong> online<br />
geht. Auf einem kleinen Display<br />
im Sichtfeld zeigt die Brille ihrem Träger<br />
Informationen an. Eine Tastatur ist<br />
gar nicht nötig, via Spracherkennung<br />
nimmt <strong>der</strong> Minirechner Befehle entgegen:<br />
„Brille: Mach ein Foto!“<br />
Das ist Technik, die begeistert. Ein<br />
Ingenieur kann seinem Kollegen, <strong>der</strong> in<br />
100 Kilometern Entfernung arbeitet, mühelos<br />
zeigen, was er gerade sieht, und ihn<br />
um Rat fragen. Man darf diese Technik<br />
nicht aufhalten.<br />
Natürlich hätte die Stasi so eine<br />
Brille sehr gut einsetzen können: Ein<br />
Führungsoffizier verfolgt die Protestaktion,<br />
an <strong>der</strong> sein IM teilnimmt. <strong>Der</strong> IM<br />
wird in Echtzeit geführt, <strong>der</strong> Offizier gibt<br />
Anweisungen über einen kleinen Kopfhörer,<br />
<strong>der</strong> an <strong>der</strong> Brille angeschlossen ist.<br />
Die gesammelten Informationen können<br />
umgehend analysiert und an an<strong>der</strong>e Stellen<br />
weitergegeben werden. Braucht <strong>der</strong><br />
IM ergänzende Informationen zu einem<br />
Menschen? Kein Problem. Ein hervorragendes<br />
Instrumentarium.<br />
Soll Google Glass deswegen schlecht<br />
sein? Die Frage ist, wer welche technischen<br />
Entwicklungen benutzen kann und<br />
zu welchem Zweck. Die Gefahren sind<br />
zahlreich. Man kann sich den kleinen<br />
Erpresser denken, <strong>der</strong> jemanden in einer<br />
unvorteilhaften Situation fotografiert<br />
und vom Opfer in einer schnellen Mail<br />
Geld verlangt. <strong>Der</strong> Gefilmte: identifiziert.<br />
<strong>Der</strong> Erpresser: anonymisiert.<br />
Man kann sich auch die Datensammler<br />
aus <strong>der</strong> Industrie vorstellen, die über<br />
die Brille das Konsumverhalten eines<br />
Menschen mitverfolgen und auswerten.<br />
O<strong>der</strong> den Staat, <strong>der</strong> seine Bürger vor Gefahren<br />
schützen möchte und sich <strong>der</strong> Träger<br />
von Datenbrillen bedient, als wären<br />
sie Masten mit Überwachungskameras.<br />
Die Gesellschaft braucht Regeln, damit<br />
die neue Technik die Rechte <strong>der</strong> Bürger<br />
nicht beschädigt. Technik auf niedrigem<br />
Niveau lässt sich vergleichsweise<br />
einfach regeln. Wir haben das Recht am<br />
eigenen Bild, durch das je<strong>der</strong> Mensch<br />
53<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
BERLINER REPUBLIK<br />
Essay<br />
DIE DATENBRILLE<br />
Das ist sie<br />
Google Glass ist ein winziger Computer, den man in einem<br />
Brillen gestell am Kopf trägt. Er enthält eine Digitalkamera, ein<br />
Mikrofon und ein kleines Display vor dem rechten Auge. Zunächst<br />
war ein KnochenleitungsLautsprecher vorgesehen, inzwischen<br />
wird auch eine Version mit einem Ohrstöpsel ausprobiert.<br />
Das kann sie<br />
Befehle geben die Nutzer über das Mikro mithilfe von Spracherkennung.<br />
O<strong>der</strong> sie wischen und tippen auf ein Berührfeld an <strong>der</strong><br />
rechten Schläfe. Mit <strong>der</strong> Brille kann man online gehen, freihändig<br />
Nachrichten austauschen, navigieren, Fotos und Videos aufnehmen<br />
o<strong>der</strong> Informationen abrufen. Brillengläser sollen integriert<br />
werden können.<br />
Das ist <strong>der</strong> Stand<br />
Google hat das Produkt 2012 vorgestellt. Bisher testen es<br />
10 000 ausgewählte Kunden, die zirka 1200 Euro zahlen mussten.<br />
Anfang November kündigte <strong>der</strong> Konzern an, das Testprogramm<br />
auszuweiten. Twitter und Facebook haben schon Apps entwickelt.<br />
Anfang 2014 soll die Datenbrille auf den Markt kommen, dann soll<br />
sie aber wesentlich weniger kosten als im Testprogramm.<br />
grundsätzlich selbst bestimmen kann,<br />
welche Aufnahmen von ihm veröffentlicht<br />
werden. Wir haben das Verbot unerlaubter<br />
Tonaufnahmen, das Persönlichkeitsrecht,<br />
den Datenschutz. Aber für die<br />
neue, verbundene und vernetzte Technik<br />
bedarf es neuer Regeln. Bil<strong>der</strong> und Töne,<br />
die aufgenommen werden, können schon<br />
jetzt sofort an an<strong>der</strong>e übertragen werden.<br />
Wir müssen darüber reden, welche Grenzen<br />
wir ziehen möchten.<br />
Die Frage ist dabei immer: Wie<br />
viel Freiheit darf eingeschränkt werden,<br />
um Freiheit zu schützen? Wie stark<br />
darf <strong>der</strong> Staat eingreifen in eine technische<br />
Entwicklung? Darf er den Bürgern<br />
verbieten, mit einer bestimmten Brille<br />
rumzulaufen?<br />
Die neue Dimension besteht darin,<br />
dass die Technik praktisch für jeden zugänglich<br />
sein wird. Schon jetzt nutzen<br />
Journalisten versteckte Kameras. Polizisten<br />
hören Verdächtige ab. <strong>Der</strong> Journalist<br />
mit <strong>der</strong> versteckten Kamera muss<br />
notfalls vor Gericht gute Gründe für sein<br />
Vorgehen haben, sonst wird es teuer. Auch<br />
für Abhöraktionen von Ermittlern gelten<br />
hohe Hürden. Das öffentliche Interesse<br />
wird gegen das Recht des Einzelnen abgewogen.<br />
Kann so eine Abwägung noch<br />
stattfinden, wenn Tausende o<strong>der</strong> Millionen<br />
Menschen eine Brillenkamera haben?<br />
Eine Option sind Freiräume. Schon<br />
jetzt steht am Eingang mancher Museen:<br />
„Bitte keine Foto- und Filmaufnahmen“.<br />
Das Urheberrecht an den Ausstellungsstücken<br />
soll gewahrt bleiben. Ist das Anliegen,<br />
für seine Umgebung ein Frem<strong>der</strong><br />
zu bleiben, nicht mindestens so wichtig?<br />
Wenn <strong>der</strong> Träger einer Datenbrille<br />
zur lebenden Überwachungskamera<br />
wird, wenn er sich irgendwann via Gesichtserkennung<br />
zu jedem Gesicht eine<br />
kleine Datensammlung aufs Display holt,<br />
wenn er seine ihm eigentlich fremde Umgebung<br />
einordnen, sortieren, durchleuchten<br />
kann – dann werden Schutzzonen nötig.<br />
Allerdings wünsche ich mir, dass die<br />
Schutzsuchenden in <strong>der</strong> Mehrzahl sind<br />
und nicht wie Raucher in den Raucherkabinen<br />
auf Flughäfen ausharren müssen.<br />
Fantasien? Wir müssen uns die Zukunft<br />
ausmalen, denn die Entwicklung<br />
verläuft rasant. Technisch ist mehr möglich,<br />
als wir uns vorstellen können. Dass<br />
die Mobiltelefone von Regierungschefs<br />
einfach abgehört werden, haben bis vor<br />
kurzem auch viele nicht geglaubt.<br />
Und die Stasi? Hätte sie den<br />
DDR-Bürgern Google Glass erlaubt? Nur<br />
wenn Datenbrillen etwas Normales gewesen<br />
wären, wäre <strong>der</strong> filmende IM nicht<br />
weiter aufgefallen. An<strong>der</strong>erseits: Die<br />
Macht des Geheimdiensts beruhte auch<br />
auf technischer Überlegenheit gegenüber<br />
<strong>der</strong> Bevölkerung. Dass ausgefeilte, neue<br />
Technik prinzipiell je<strong>der</strong> Bürger haben<br />
kann, ist eine demokratische Konstellation,<br />
die die Staatsmacht infrage stellt.<br />
Technik hat mir geholfen im Kampf<br />
gegen die Diktatur. Ich habe die Stasileute<br />
in Jena heimlich fotografiert, als<br />
sie eine Gedenkplastik abtransportierten.<br />
Sie erinnerte an einen Freund, <strong>der</strong><br />
in <strong>der</strong> U-Haft umgekommen war. Ich<br />
stand in einem Altersheim am Fenster<br />
und fotografierte. Die Bil<strong>der</strong> <strong>der</strong> Stasiaktion<br />
druckte <strong>der</strong> Spiegel.<br />
Später, von Westberlin aus, habe<br />
ich damals Kameras in die DDR eingeschmuggelt.<br />
Sie waren groß und schwer,<br />
VHS-Standard; Diplomaten und akkreditierte<br />
Journalisten brachten sie rüber.<br />
Freunde drehten Bil<strong>der</strong> von Protestaktionen.<br />
Am 9. Oktober 1989 demonstrierten<br />
Bürger in Leipzig gegen das Regime.<br />
Die Aufnahmen mit <strong>der</strong> eingeschmuggelten<br />
Kamera brachte ein Korrespondent<br />
in <strong>der</strong> Unterhose in den Westen. Mit einer<br />
Datenbrille hätten es meine Freunde<br />
leichter gehabt.<br />
ROLAND JAHN ist Bundesbeauftragter<br />
für die Unterlagen <strong>der</strong> Staatssicherheit <strong>der</strong><br />
DDR. Vor ihm leiteten erst Joachim Gauck<br />
und dann Marianne Birthler die Behörde<br />
Fotos: Google Glass<br />
54<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
WELTBÜHNE<br />
„ Ich glaube nicht,<br />
dass die<br />
diplomatischen Folgen,<br />
zumindest soweit<br />
bislang übersehbar,<br />
beson<strong>der</strong>s groß<br />
sein werden “<br />
Die Einschätzung von Barack Obamas Sicherheitsberaterin Susan Rice<br />
unmittelbar nach den ersten Enthüllungen von Edward Snowden, Seite 58<br />
55<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
KOKETT UND KNALLHART<br />
James Clapper, Chef <strong>der</strong> 16 amerikanischen Geheimdienste, hält das Ausspähen von<br />
Freunden für das Normalste <strong>der</strong> Welt und wun<strong>der</strong>t sich, dass die an<strong>der</strong>en sich wun<strong>der</strong>n<br />
Von WILLIAM DROZDIAK<br />
Foto: Tom Williams/CQ Roll Call/Getty Images<br />
<strong>Der</strong> Mann inmitten des Sturmes um<br />
die NSA-Affäre sieht nicht aus,<br />
wie man sich einen mysteriösen<br />
Geheimdienstchef vorstellen mag. James<br />
Clapper ist ein glatzköpfiger, 72 Jahre alter,<br />
pensionierter Luftwaffengeneral. Er<br />
selbst sagt über sich: „Ich bin zu alt für<br />
dieses Amt, verdammt“, und da kokettiert<br />
er natürlich. So direkt ist <strong>der</strong> hochdekorierte<br />
Ex-Militär allerdings selten.<br />
Meist spricht er so verdreht, dass seine<br />
Zuhörer Schwierigkeiten haben, irgendeinen<br />
Sinn darin zu erkennen. Für einen<br />
nationalen Geheimdienstdirektor, <strong>der</strong> für<br />
die 16 US-Dienste verantwortlich und<br />
Obamas wichtigster Geheimdienstberater<br />
ist, kann es durchaus sinnvoll sein,<br />
solche Verwirrung zu stiften.<br />
Als Clapper nun vor dem Geheimdienstausschuss<br />
des Repräsentantenhauses<br />
erscheinen musste, um den Abgeordneten<br />
zu erklären, warum die USA<br />
Telefongespräche <strong>der</strong> deutschen Kanzlerin<br />
und an<strong>der</strong>er Regierungschefs verbündeter<br />
Staaten abgehört hätten, zeigte<br />
er eine weitere Facette seines Wesens:<br />
Grantelnd ließ er die Abgeordneten wissen,<br />
dass er nicht verstehe, warum sich<br />
darüber überhaupt jemand aufrege. Es<br />
sei doch schließlich eine <strong>der</strong> Kernaufgaben<br />
von Geheimdiensten, „die Absichten<br />
ausländischer Regierungen zu<br />
ergründen“. Daran habe sich, seit er<br />
vor 50 Jahren seine Laufbahn begonnen<br />
habe, nichts geän<strong>der</strong>t. Die Aufregungen<br />
und Überraschungen ausländischer<br />
Regierungen haben ihn daher an<br />
eine Filmszene aus „Casa blanca“ erinnert:<br />
<strong>Der</strong> französische Polizeichef spielt<br />
den Schockierten, dass in Rick’s Cafe<br />
Glücksspiele stattfinden, obwohl er dafür<br />
Bestechungsgel<strong>der</strong> kassiert. Da war<br />
er wie<strong>der</strong>, <strong>der</strong> joviale Geheimdienstchef,<br />
<strong>der</strong> immer eine Metapher parat<br />
hat – und sei sie noch so schräg.<br />
<strong>Der</strong> hochdekorierte Vietnamveteran,<br />
<strong>der</strong> sich nicht fürchtet anzuecken, ist<br />
auch <strong>der</strong> Meinung, dass Spionage gegen<br />
befreundete Regierungschefs nicht<br />
weiter erwähnenswert sei. Daher habe<br />
er es auch nicht für nötig erachtet, den<br />
Kongress o<strong>der</strong> gar das Weiße Haus zu<br />
informieren. Es sei schließlich ein „wesentlicher<br />
Grundsatz“, so viele vertrauliche<br />
Informationen über ausländische<br />
Staats- und Regierungschefs wie möglich<br />
zu sammeln, um ihre Politik und<br />
ihre Absichten zu verstehen. Als er gefragt<br />
wurde, ob Verbündete in gleicher<br />
Weise Informationen über amerikanische<br />
Politiker sammeln würden, rief er mit Inbrunst:<br />
„Absolut!“<br />
DIE IRONIE DER GESCHICHTE liegt darin,<br />
dass James Clapper mehr Licht in<br />
die Aktivitäten amerikanischer Geheimdienste<br />
bringen wollte. Nachdem er drei<br />
Jahre unter zwei Präsidenten, die unterschiedlicher<br />
nicht sein könnten – George<br />
W. Bush und Barack Obama –, Chef<br />
<strong>der</strong> Aufklärung im Pentagon war, zögerte<br />
er, den Posten des Geheimdienstdirektors<br />
anzunehmen. <strong>Der</strong> Job galt als<br />
bürokratischer Albtraum. Die Behörde<br />
hatte in nur fünf Jahren drei Direktoren<br />
verschlissen. <strong>Der</strong> Posten war 2004<br />
von George W. Bush geschaffen worden,<br />
um die Grabenkämpfe innerhalb<br />
<strong>der</strong> amerikanischen Geheimdienste zu<br />
beenden. Es waren vor allem auch die<br />
Rivalitäten unter den einzelnen Geheimdiensten,<br />
die verhin<strong>der</strong>t hatten, dass die<br />
Attentate vom 11. September 2001 aufgedeckt<br />
wurden.<br />
Seit Clapper 2010 sein Amt angetreten<br />
hat, hat er den US-Geheimdiensten<br />
eine bessere Zusammenarbeit verordnet.<br />
Er hat Bürokratie abgebaut. Er hat die<br />
Geldverschwendung <strong>der</strong> militärischen<br />
Geheimdienste gestoppt. Und er hat die<br />
NSA zu größerer Transparenz verpflichtet.<br />
Letzteres wohl nur mit begrenztem<br />
Erfolg wie die Enthüllungen von Edward<br />
Snowden offenbaren.<br />
Nun hat Clapper angekündigt, einen<br />
Direktor für Bürgerrechte und Datenschutz<br />
einzustellen, <strong>der</strong> die Maßnahmen<br />
<strong>der</strong> Geheimdienste überwachen soll.<br />
Gleichzeitig warnte er den Kongress,<br />
überzureagieren und die Geheimdienste<br />
so einzuschränken, dass sie dabei behin<strong>der</strong>t<br />
würden, künftige Terroranschläge<br />
und an<strong>der</strong>e Bedrohungen für Amerikas<br />
Sicherheit zu verhin<strong>der</strong>n. Es sei „unrealistisch“<br />
zu glauben, <strong>der</strong> Kongress und<br />
das Weiße Haus könnten „bis ins letzte<br />
Detail darüber aufgeklärt werden, wie<br />
genau <strong>der</strong> Geheimdienst durch seinen<br />
,Sammelapparat‘ an eine bestimmte Information<br />
gelangt“ wäre.<br />
Es scheint, als müsste Clapper, <strong>der</strong><br />
seine Militärkarriere als einfacher Schütze<br />
im Marinecorp begann und als Generalleutnant<br />
<strong>der</strong> US Air Force beendete, nun<br />
die Tür zu Amerikas Geheimdienstwelt<br />
weiter öffnen, als ihm lieb ist. Präsident<br />
Barack Obama hat eine Überprüfung <strong>der</strong><br />
Arbeit <strong>der</strong> Geheimdienste im In- und Ausland<br />
angeordnet und wird weitreichende<br />
Reformen erwägen.<br />
Sogar konservative Kongressabgeordnete<br />
wie <strong>der</strong> Republikaner James<br />
Sensenbrenner, einer <strong>der</strong> Väter des Patriot<br />
Act, auf dessen Grundlage die Telefonate<br />
von Amerikanern abgehört werden,<br />
sagt, dass nun etwas geschehen müsse, um<br />
den Missbrauch des Gesetzes zu beenden.<br />
„Irgendwann ist die Balance zwischen Sicherheit<br />
und dem Schutz <strong>der</strong> Privatsphäre<br />
aus dem Gleichgewicht geraten.“<br />
WILLIAM DROZDIAK ist Präsident<br />
des American Council on Germany und<br />
war Chefkorrespondent <strong>der</strong> Washington<br />
Post in Europa<br />
57<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
EIN ZÄHER BROCKEN<br />
Susan Rice attestiert Politikern gerne mal, sie redeten Mist. Obamas Sicherheitsberaterin<br />
steht nach ihrer Einschätzung <strong>der</strong> NSA-Affäre allerdings selbst nicht beson<strong>der</strong>s gut da<br />
Von ANSGAR GRAW<br />
Zur Prophetin taugt Susan Rice<br />
kaum. „Ich glaube nicht“, sagte<br />
sie etwa Ende Juni, als sich Edward<br />
Snowden gerade nach Hongkong<br />
abgesetzt und die peinlichen Enthüllungen<br />
über Top-Secret-Programme des Geheimdiensts<br />
NSA begonnen hatte, „dass<br />
die diplomatischen Folgen, zumindest soweit<br />
bislang übersehbar, beson<strong>der</strong>s groß<br />
sein werden.“<br />
Inzwischen haben die Aktivitäten<br />
<strong>der</strong> National Security Agency zu heftigen<br />
Verwerfungen geführt zwischen<br />
Washington, Berlin und etlichen weiteren<br />
Hauptstädten in Europa wie Südamerika.<br />
O<strong>der</strong> diese Szene: „Sie werden uns<br />
nicht in Ihren beschissenen Krieg hineinziehen“,<br />
herrschte die damalige UN-Botschafterin<br />
<strong>der</strong> Vereinigten Staaten im<br />
März 2011 ihren französischen Amtskollegen<br />
Gérard Araud an, <strong>der</strong> für die Verhängung<br />
einer Flugverbotszone in Libyen<br />
warb. Nur zwei Tage später verfügte <strong>der</strong><br />
UN-Sicherheitsrat die Flugverbotszone,<br />
und die USA, Rice allen voran, waren<br />
die Wortführer dieser 180-Grad-Wende.<br />
Anfang Juni verkündete Barack<br />
Obama die Berufung von Rice zu seiner<br />
Nationalen Sicherheitsberaterin. Die<br />
Aufsicht über den Geheimdienst fällt<br />
zwar nicht in ihre Zuständigkeit. Aber<br />
als Botschafterin profitierte sie offenkundig<br />
von den fleißigen NSA-Agenten.<br />
<strong>Der</strong>en Lauschangriffe „halfen mir, die<br />
Wahrheit zu erfahren“, lobte Rice in einem<br />
internen Vermerk im August 2010,<br />
„über die Haltung an<strong>der</strong>er Län<strong>der</strong> zu<br />
Sanktionen (gegen den Iran) und verschafften<br />
uns in den Verhandlungen immer<br />
einen Schritt Vorsprung“.<br />
Als Sicherheitsberaterin bekam Rice<br />
die erste Woge des Berliner Unmuts über<br />
den Lauschangriff auf Angela Merkel ab.<br />
Ihr Pendant im Kanzleramt, Christoph<br />
Heusgen, beschwerte sich im Namen<br />
seiner Chefin bei Rice. Die bestätigte<br />
in dem Telefonat die Abhörmaßnahmen<br />
nicht, versicherte aber, wenn es sie gegeben<br />
habe, sei dies dem Präsidenten nicht<br />
bekannt gewesen. Das muss nicht logisch<br />
klingen, solange es den Spielregeln <strong>der</strong><br />
Diplomatie genügt.<br />
Rice, die am 17. November 49 Jahre<br />
alt wurde, ist eine erfahrene Regierungsmanagerin.<br />
Schon unter Bill Clinton arbeitete<br />
sie im Weißen Haus. Rice ist zudem<br />
ein „tough cookie“, wie die Amerikaner<br />
raue Typen nennen. Dem russischen<br />
UN-Botschafter Witali Tschurkin bescheinigte<br />
sie, er rede „Bullshit“, und dem inzwischen<br />
verstorbenen US-Spitzendiplomaten<br />
Richard Holbrooke zeigte sie den<br />
Mittelfinger. Vor allem aber gehört die<br />
Afro amerikanerin zu den unbeirrt loyalen<br />
„Obamans“, wie die intellektuelle Ritterkaste<br />
des Präsidenten genannt wird.<br />
DIE VERHEIRATETE MUTTER eines 16<br />
Jahre alten Jungen und eines zehnjährigen<br />
Mädchens bekleidet im Weißen Haus<br />
eine Schlüsselstellung mit viel persönlicher<br />
Macht – nicht im Sinne hierarchischer<br />
Durchgriffsrechte auf Pentagon,<br />
State Department o<strong>der</strong> Geheimdienste,<br />
son<strong>der</strong>n durch den regelmäßigen Kontakt<br />
mit dem Präsidenten.<br />
Dabei schien die Karriere <strong>der</strong> promovierten<br />
Historikerin und Politikwissenschaftlerin,<br />
die in Stanford und Oxford<br />
studierte, vor einem Jahr gescheitert.<br />
Vier Amerikaner, darunter Botschafter<br />
Christopher Stevens, waren im September<br />
2011 bei einem Angriff auf eine Außenstelle<br />
<strong>der</strong> US-Botschaft im libyschen<br />
Bengasi getötet worden. Obwohl <strong>der</strong> terroristische<br />
Hintergrund erkennbar war,<br />
hielt sich Rice in TV-Diskussionen an<br />
eine voreilige Sprachregelung des Weißen<br />
Hauses, es habe sich um „spontane<br />
Gewalt“ gehandelt.<br />
Die Republikaner schäumten, Rice<br />
habe unmittelbar vor <strong>der</strong> Präsidentenwahl<br />
die Tat zu bagatellisieren versucht.<br />
Sie kündigten die Blockade <strong>der</strong> Personalie<br />
an, als Obama Rice zur Nachfolgerin<br />
seiner ersten Außenministerin Hillary<br />
Clinton machen wollte. Die Attackierte<br />
zog ihre Bewerbung schließlich zurück.<br />
Als Sicherheitsberaterin schien Rice<br />
für Obama mitunter das zu werden, was<br />
die Neocons für George W. Bush waren,<br />
eine Anstifterin zu militärischen Abenteuern:<br />
Während jene Waffengänge for<strong>der</strong>ten,<br />
um die Demokratie zu verbreiten,<br />
werde sie humanitäre Interventionen verlangen,<br />
das war die Erwartung. Motiviert<br />
werde sie dabei durch die traumatische<br />
Erfahrung des Genozids in Ruanda 1994.<br />
Sie ist selbst davon überzeugt, dass sie damals<br />
als junge Beraterin Bill Clintons zu<br />
lange passiv blieb. In <strong>der</strong> Libyen-Frage<br />
schien Rice dieses Image zu bestätigen,<br />
bis sie – zusammen mit Hillary Clinton<br />
und <strong>der</strong> heutigen UN-Botschafterin Samantha<br />
Power – den zunächst interventionsunwilligen<br />
Präsidenten zum Eingreifen<br />
überredete.<br />
Doch <strong>der</strong> Bürgerkrieg in Syrien<br />
lässt Rice nicht laut Militäraktionen zum<br />
Schutz <strong>der</strong> Zivilbevölkerung for<strong>der</strong>n. Unlängst<br />
signalisierte sie gar, Washing ton<br />
wolle sein Engagement im Nahen Osten<br />
reduzieren: „Wir können uns nicht rund<br />
um die Uhr mit einer einzigen Region beschäftigen,<br />
so wichtig sie auch sein mag.“<br />
Ist das ihre Überzeugung o<strong>der</strong> die<br />
des Präsidenten? Einem Journalisten<br />
beschied Rice: „Kein Nationaler Sicherheitsberater,<br />
<strong>der</strong> sein Geld wert ist, hat<br />
eine persönliche Agenda.“<br />
ANSGAR GRAW, WeltKorrespondent in<br />
Washington, beneidet Rice nicht, die als<br />
Botschafterin noch NSALauschaktionen<br />
lobte, die sie jetzt erklären muss<br />
Foto: Mike McGregor/Contour by Getty Images<br />
58<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
DER COWBOY<br />
Für den Schutz Amerikas ist ihm jedes Mittel recht – selbst wenn es zu politischen<br />
Verwerfungen führt. Die Empörung kann NSA-Chef Keith Alexan<strong>der</strong> nicht verstehen<br />
Von SHANE HARRIS<br />
Am 1. August 2005 trat Keith<br />
Alexan<strong>der</strong> seinen Dienst als<br />
16. Direktor <strong>der</strong> National Security<br />
Agency an. Er war hochdekorierter<br />
Offizier des Militärgeheimdiensts mit<br />
einem West-Point-Abschluss in Systemtechnik<br />
und Physik, Leiter von Geheimdienstoperationen<br />
in Kampfeinsätzen<br />
und ehemaliger Direktor eines Militärgeheimdiensts.<br />
Ein Soldat, Spion – und<br />
totaler Computerfreak. Viele glaubten,<br />
Alexan<strong>der</strong> sei perfekt für seine Aufgabe.<br />
Nur einer nicht: sein Amtsvorgänger.<br />
General Michael Hayden hatte die<br />
NSA seit 1999 geleitet, also auch, als mit<br />
den Anschlägen vom 11. September eine<br />
neue Ära begann, in <strong>der</strong> die global arbeitende<br />
Agentur sich immer mehr auf<br />
Lausch angriffe auf Amerikaner konzentrierte.<br />
Hayden bewegte sich dabei auch<br />
in Bereichen, die kaum mehr vom Recht<br />
gedeckt waren o<strong>der</strong> die leitende Regierungsbeamte<br />
sogar als Verstoß gegen die<br />
Verfassung betrachteten. Aber ausgerechnet<br />
er machte sich Sorgen, dass Alexan<strong>der</strong><br />
keinen Sinn für die juristischen Komplexitäten<br />
seines Amtes haben würde.<br />
„Alexan<strong>der</strong> hatte etwas Cowboyhaftes<br />
– nach dem Motto: ‚Lasst uns nicht<br />
an das Gesetz denken, son<strong>der</strong>n einfach<br />
unseren Job machen‘“, sagt ein früherer<br />
Geheimdienstmitarbeiter. „Hayden fand<br />
das äußerst problematisch.“<br />
Wie problematisch, zeigte sich erstmals<br />
kurz nach 9/11. Alexan<strong>der</strong>, damals<br />
Chef des Militärischen Geheim- und Sicherheitsdiensts<br />
in Fort Belvoir, Virginia,<br />
bestand darauf, bislang unausgewertetes<br />
Rohmaterial über Terrorverdächtige von<br />
<strong>der</strong> NSA zu erhalten. Er hatte mo<strong>der</strong>nste<br />
Analyse-Software zur Datengewinnung<br />
entwickelt und wollte damit das NSA-Datenmaterial<br />
nach Terroristen durchforsten,<br />
die weitere Anschläge auf die USA<br />
planen könnten.<br />
Rechtlich gab es aber klare Vorgaben:<br />
Die NSA hatte abgefangene Gespräche,<br />
die auch US-Bürger betrafen,<br />
vor <strong>der</strong> Weitergabe an an<strong>der</strong>e Agenturen<br />
zunächst zu „reinigen“. Alexan<strong>der</strong><br />
aber wollte, sagt ein ehemaliger Beamter,<br />
dass man die „Rohrleitungen etwas<br />
in seine Richtung biegt“, sodass er den<br />
gesamten Fluss, sprich die Metadaten, digitale<br />
Aufzeichnungen von Telefonaten<br />
und E-Mail-Verkehr abschöpfen konnte.<br />
Dass die NSA auf dem Proze<strong>der</strong>e Auswertung<br />
vor Herausgabe bestand, passte<br />
ihm nicht. Er hatte das Gefühl, berichtet<br />
ein ehemaliger NSA-Mitarbeiter, dass<br />
die Daten oft erst zur Verfügung standen,<br />
wenn sie nichts mehr nützen.<br />
AN ALEXANDERS SAMMELWUT hat sich<br />
bis heute nichts geän<strong>der</strong>t. Um den nächsten<br />
Terroranschlag verhin<strong>der</strong>n zu können,<br />
glaubt er, ganze Kommunikationsnetzwerke<br />
überblicken zu müssen. Er<br />
will den ganzen Heuhaufen, um die eine<br />
Nadel zu finden. Diese Strategie ist für<br />
ihn aufgegangen. Er ist <strong>der</strong> am längsten<br />
amtierende Direktor in <strong>der</strong> Geschichte<br />
<strong>der</strong> NSA, und er steht heute an <strong>der</strong> Spitze<br />
eines Überwachungsimperiums. Neben<br />
<strong>der</strong> Leitung <strong>der</strong> NSA übernahm er 2010<br />
auch noch das neu geschaffene Cyber<br />
Command. Damit ist er auch verantwortlich<br />
für die Abwehr von Angriffen auf<br />
das militärische Computernetzwerk und<br />
den Einsatz neu ausgebildeter „Cyberkrieger“,<br />
die in die gegnerischen Netzwerke<br />
eindringen sollten.<br />
Die NSA war ein Datenkrake, schon<br />
bevor Alexan<strong>der</strong> ihr Direktor wurde.<br />
Aber unter seiner Führung nahmen <strong>der</strong>en<br />
Aktivitäten Ausmaße an, die jenseits dessen<br />
lagen, was seine Amtsvorgänger je<br />
in Betracht gezogen hätten. 2007 wurde<br />
das Prism-Programm zur Gewinnung<br />
von Informationen von Internet- und<br />
Technologieunternehmen gestartet. Die<br />
NSA erhält Zugang zu den Rohdaten von<br />
Unternehmen, inklusive E-Mails und<br />
Nachrichten aus den sozialen <strong>Medien</strong>.<br />
Analysten durchforsten sie nach Hinweisen<br />
auf Terrornetzwerke o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e geheimdienstlich<br />
relevante Themen. Einige<br />
<strong>der</strong> größten IT-Unternehmen wie Google,<br />
Microsoft, Facebook o<strong>der</strong> Apple versorgen<br />
die NSA mit Daten – aber an<strong>der</strong>s als<br />
unter Hayden haben sie keine rechtliche<br />
Handhabe mehr, sich dagegen zu wehren.<br />
Das Prism-Programm ist rechtlich<br />
abgesichert und erlaubt es <strong>der</strong> Behörde,<br />
Daten in großem Umfang von IT-Unternehmen<br />
einzufor<strong>der</strong>n.<br />
Nach Schätzungen <strong>der</strong> NSA werden<br />
1,6 Prozent aller Internetdaten über<br />
ihre Systeme umgeleitet – das ist eine um<br />
50 Prozent größere Datenmenge als jene,<br />
die Google in <strong>der</strong> gleichen Zeit verarbeitet.<br />
Während des Irakkriegs entwickelte<br />
Alexan<strong>der</strong> Instrumente für eine Echtzeitanalyse,<br />
die darauf abzielte, jedes<br />
Telefongespräch, jede Mail o<strong>der</strong> SMS im<br />
Land für die Suche nach Aufständischen<br />
zu nutzen. Manche Militär- und Geheimdienstmitarbeiter<br />
behaupten, dass<br />
sie dadurch wertvolle Einblicke gewinnen<br />
konnten, die dazu beitrugen, die Situation<br />
im Irak wesentlich zum Vorteil<br />
<strong>der</strong> Amerikaner zu wenden. Auch dieses<br />
Programm war in seinem Ausmaß und<br />
Umfang beispiellos. Als Chef des Cyber<br />
Command hat Alexan<strong>der</strong> dieses Konzept<br />
gewissermaßen vom Irak auf eine globale<br />
Ebene übertragen.<br />
Das Ergebnis ist: Nie zuvor war die<br />
NSA so mächtig und allgegenwärtig wie<br />
heute. Aber auch politisch gefährdet.<br />
Die gleiche Philosophie, die Alexan<strong>der</strong><br />
groß gemacht hat, nämlich so viele Daten<br />
von so vielen Quellen wie möglich zu<br />
erhalten, könnte ihn nun zu Fall bringen.<br />
Zum ersten Mal und für ihn ganz und<br />
Text: © 2013, Foreign Policy; Foto: Win McNamee/Getty Images<br />
60<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
WELTBÜHNE<br />
Porträt<br />
<strong>Der</strong> Chef des<br />
Geheimdiensts<br />
liebt Billard, Golf<br />
und „Bejeweled<br />
Blitz“, ein<br />
Puzzlespiel, bei<br />
dem er jedes<br />
Mal eine Million<br />
Punkte erreicht<br />
gar ungewöhnlich hat Alexan<strong>der</strong> seine<br />
einst geheimen Programme öffentlich zu<br />
rechtfertigen.<br />
Will er sein Reich bewahren, muss<br />
er zur größten Charmeoffensive seiner<br />
Karriere ansetzen. Zu seinem Glück hat<br />
Alexan<strong>der</strong> nicht nur ein technologisches<br />
Know-how, son<strong>der</strong>n auch in ein politisches<br />
Netzwerk investiert.<br />
Alexan<strong>der</strong>, 61, gilt als bescheiden<br />
und umgänglich. <strong>Der</strong> vierfache Vater<br />
schätzt eher abgestandene Witze, spielt<br />
gerne Billard, Golf und „Bejeweled Blitz“,<br />
ein Puzzlespiel mit Suchtpotenzial, bei<br />
dem er, so erzählt es Alexan<strong>der</strong> selbst,<br />
jedes Mal eine Million Punkte erreicht.<br />
IM WASHINGTONER POLITDICKICHT ist<br />
er einer <strong>der</strong> Ausgebufftesten. Um den Posten<br />
als NSA-Chef zu bekommen, machte<br />
er sich die höchste Pentagon-Ebene zum<br />
Verbündeten – inklusive des damaligen<br />
Verteidigungsministers Donald Rumsfeld,<br />
<strong>der</strong> wie<strong>der</strong>um Hayden misstrauisch unterstellte,<br />
er habe die NSA <strong>der</strong> Kontrolle<br />
durch das Pentagon zu entziehen versucht.<br />
Schon als Chef des Army’s Intelligence<br />
and Security Command hatte<br />
Alexan<strong>der</strong> viele seiner zukünftigen Alliierten<br />
in sein Hauptquartier eingeladen,<br />
das so genannte Information Dominance<br />
Center. Er hatte es nach dem Vorbild<br />
<strong>der</strong> Kommandobrücke von „Raumschiff<br />
Enterprise“ gestalten lassen, inklusive<br />
Chromverkleidung, einem riesigen<br />
Bildschirm gegenüber dem Le<strong>der</strong>sessel<br />
des Captains und Türen, die sich mit<br />
demselben zischenden Geräusch öffneten<br />
wie in <strong>der</strong> Serie. Seine Besucher liebten<br />
es, im Kommandosessel Platz zu nehmen,<br />
sich ein wenig wie Jean Luc Picard zu<br />
fühlen und sich die beeindruckende technische<br />
Ausrüstung vorführen zu lassen.<br />
Die NSA wurde geschaffen, um<br />
„klassische Aufgaben“ eines Geheimdiensts<br />
zu erfüllen. Sich zum Wächter<br />
<strong>der</strong> amerikanischen Wirtschaft aufzuschwingen,<br />
war nicht vorgesehen. Aber<br />
es ist nicht zu übersehen, dass es eine<br />
radikale Wende in diese Richtung gibt –<br />
und sie wäre typisch für Alexan<strong>der</strong>s<br />
Karriere. Unter seiner Führung hat <strong>der</strong><br />
Dienst seinen Einflussbereich in bisher<br />
ungekanntem Maß in die Privatwirtschaft<br />
ausgeweitet.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Defense-Industrial-Base-Initiative<br />
versorgt die NSA Unternehmen<br />
mit geheimdienstlichen Erkenntnissen<br />
über Cyberbedrohungen.<br />
Als Gegenleistung berichten die Unternehmen<br />
darüber, was sie in ihren Netzwerken<br />
beobachten. Pentagon-Beamten<br />
zufolge konnten durch dieses Programm<br />
tatsächlich einige Versuche von Cyberspionage<br />
gestoppt werden. Viele Unternehmer<br />
hingegen glauben, dass es<br />
Alexan<strong>der</strong> nicht darum ging, Informationen<br />
<strong>der</strong> NSA über Hacker weiterzugeben.<br />
Son<strong>der</strong>n darum, Informationen von<br />
den Unternehmen, seinen neuen digitalen<br />
Spähern, zu bekommen.<br />
Dieser Schritt war Alexan<strong>der</strong> jedoch<br />
nicht groß genug. Er wollte „eine<br />
Mauer um an<strong>der</strong>e sensible Einrichtungen<br />
in Amerika mithilfe einer Überwachung<br />
<strong>der</strong> Finanzinstitute und <strong>der</strong>en<br />
Netzwerke errichten“, so ein ehemaliger<br />
Beamter. Dieses Programm sollte<br />
in je<strong>der</strong> Bank an <strong>der</strong> Wall Street laufen.<br />
Aus rechtlichen Gründen wurde es allerdings<br />
nie vollständig umgesetzt. Denn<br />
hätte ein Unternehmen die Installation<br />
von Überwachungstechnologien erlaubt,<br />
hätte ein Gericht konstatieren können,<br />
dass es im Dienst <strong>der</strong> Regierung arbeitet.<br />
Wäre diese Überwachung ohne richterlichen<br />
Bescheid erfolgt, dann hätte dieses<br />
Unternehmen wegen <strong>der</strong> Verletzung<br />
des Vierten Verfassungszusatzes belangt<br />
werden können. „Überwachung ohne<br />
richterliche Anordnung kann eine Verletzung<br />
<strong>der</strong> Verfassung sein, gleich, ob<br />
dies durch die NSA, Google o<strong>der</strong> Goldman<br />
Sachs geschieht“, sagt <strong>der</strong> Beamte.<br />
„Hier gibt es ganz feine rechtliche Trennlinien,<br />
die die NSA aber oft nicht verstanden<br />
hat. Alexan<strong>der</strong> hat sich um die<br />
Frage einer möglichen Verletzung dieses<br />
Verfassungszusatzes nie geschert.“<br />
AUS DER VERBINDUNG seiner Behörde<br />
mit <strong>der</strong> Wirtschaft soll Alexan<strong>der</strong> immer<br />
mehr Kontrolle zuwachsen. Ohne<br />
Frage: Die NSA kann kaum das gesamte<br />
Internet selbst überwachen und braucht<br />
deshalb Informationen von Unternehmen.<br />
Doch sind Unternehmen, begann<br />
Alexan<strong>der</strong> sich zu fragen, wirklich in <strong>der</strong><br />
Lage, sich selbst zu verteidigen? „Wir beobachten<br />
immer mehr Aktivitäten in den<br />
Netzwerken“, sagte er jüngst während einer<br />
Sicherheitskonferenz in Kanada. „Ich<br />
fürchte, dass dies Ausmaße annimmt, die<br />
die Unternehmen nicht mehr allein bewältigen<br />
können und bei denen sie die<br />
Hilfe <strong>der</strong> Regierung benötigen.“<br />
Dass aber nun zum ersten Mal in<br />
Alexan<strong>der</strong>s Karriere Kongress und Öffentlichkeit<br />
Bedenken haben, Informationen<br />
mit <strong>der</strong> NSA zu teilen, irritiert ihn.<br />
Das tiefe Misstrauen, das <strong>der</strong> Behörde<br />
entgegengebracht wird, kann er nicht<br />
nachvollziehen. Geheimdienstler im Allgemeinen<br />
und Alexan<strong>der</strong> im Beson<strong>der</strong>en<br />
hätten oft ein Problem zu verstehen, wie<br />
wichtig es ist, dass ein Großteil <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
Vertrauen in sie hat, sagt ein<br />
ehemaliger Mitarbeiter Alexan<strong>der</strong>s. Er<br />
selbst sieht sich als ultimativen Verteidiger<br />
<strong>der</strong> Bürgerrechte; jemand, <strong>der</strong> einige<br />
ausspionieren muss, um alle zu schützen.<br />
Aber seine Glaubwürdigkeit ist schwer<br />
beschädigt. Selbst unter Alexan<strong>der</strong>s Kollegen<br />
schwindet das Vertrauen.<br />
„Man muss wohl nicht davon ausgehen,<br />
dass Keith sich während seines Mittagessens<br />
die aufgezeichneten Gespräche<br />
amerikanischer Bürger anhört“, sagt ein<br />
ehemaliger NSA-Mitarbeiter. „Aber in<br />
dieser Kontroverse zeigt er doch einige<br />
Naivität. Er denkt: ‚Was ist das Problem?<br />
Ich würde diese Macht niemals missbrauchen.<br />
Wir sind doch alle ehrenwerte<br />
Menschen.‘ Die NSA-Leute leben in ihrer<br />
eigenen Welt. Und Keith ist dafür ein<br />
perfektes Beispiel.“<br />
SHANE HARRIS recherchiert seit Jahren<br />
in den USGeheimdiensten. Nachzulesen in<br />
seinem Buch: „The Watchers: The Rise Of<br />
America’s Surveillance State“<br />
62<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Vorstandssprecher <strong>der</strong> Deutschen Bank<br />
Alfred Herrhausen, Frankfurt 1989<br />
Fotograf: Roland Holschnei<strong>der</strong><br />
Journalismus für<br />
eine neue Generation.<br />
Jetzt 4 Wochen kostenlos<br />
testen unter:<br />
handelsblatt.com/livetest<br />
Handelsblatt Live fürs iPad<br />
Die digitale Wirtschaftszeitung<br />
6:00 Die Morgenausgabe,<br />
produziert in New York<br />
12:00 Die Mittagsausgabe aus<br />
dem Newsroom in Düsseldorf<br />
20:00 Die Zeitung vom kommenden<br />
Tag – wie gedruckt, nur schneller<br />
Apple, the Apple Logo and iPad are Trademarks<br />
of Apple Inc., registered in the U.S. and other<br />
countries. App Store is a Service mark of Apple Inc.
WELTBÜHNE<br />
Spurensuche<br />
DER<br />
VERRÄTER<br />
Von THOMAS SCHULER<br />
Edward Snowden, Sohn einer braven Patriotenfamilie<br />
in Ellicott City an <strong>der</strong> US-Ostküste,<br />
<strong>der</strong> gegen die Geheimdienste einer Weltmacht antritt.<br />
Rekonstruktion eines Lebenswegs<br />
Illustration: Sebastian Haslauer<br />
64<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
© Foto Meyer: Antje Berghäuser; Schwennicke: Andrej Dallmann<br />
Am Ende die<br />
Revolution?<br />
Wie <strong>der</strong> Liberalismus<br />
überleben kann<br />
Das <strong>Cicero</strong>-Foyergespräch<br />
<strong>Cicero</strong>-Kolumnist Frank A. Meyer und<br />
<strong>Cicero</strong>-Chefredakteur Christoph<br />
Schwennicke im Gespräch mit Christian<br />
Lindner.<br />
Sonntag, 24. November 2013, 11 Uhr<br />
Berliner Ensemble<br />
Bertolt-Brecht-Platz 1, 10117 Berlin<br />
Tickets: Telefon 030 28408155<br />
www.berliner-ensemble.de<br />
BERLINER<br />
ENSEMBLE<br />
24. November<br />
CHRISTIAN<br />
LINDNER<br />
In Kooperation<br />
mit dem Berliner Ensemble<br />
Berliner<br />
Ensemble<br />
Anzeige<br />
WELTBÜHNE<br />
Spurensuche<br />
Wenn jemand im Jahr 2009 die<br />
NSA gefragt hätte, ob ein<br />
Mann namens Edward Snowden,<br />
geboren am 21. Juni 1983, ein Sicherheitsrisiko<br />
ist, hätte sie nach einem<br />
Blick in ihre Daten vermutlich gesagt:<br />
Bullshit, <strong>der</strong> Junge hat sogar für die CIA<br />
gearbeitet, kein Problem.<br />
Wenn jemand zur selben Zeit die<br />
CIA gefragt hätte: Sagt mal, ist Edward<br />
Snowden, geboren am 21. Juni 1983, ein<br />
Sicherheitsrisiko? Dann hätte sie vermutlich<br />
gesagt: Verdammt, ja, <strong>der</strong> Typ<br />
wollte bei uns in Geheimdateien eindringen.<br />
Wir haben ihn gefeuert.<br />
Je<strong>der</strong> Thriller verlangt nach einem<br />
dramatischen Moment, nach einem<br />
Punkt, von dem aus alles hätte an<strong>der</strong>s<br />
laufen können. <strong>Der</strong> Punkt, an dem <strong>der</strong><br />
Held hätte gestoppt werden können. Bei<br />
Edward Snowden war dieser Moment<br />
2009 gekommen. Seit Mitte 2006 arbeitete<br />
er als Computerspezialist <strong>der</strong> CIA in<br />
Genf. Er war aber nicht nur für Computer<br />
zuständig, son<strong>der</strong>n als eine Art Hausmeister,<br />
auch für das Funktionieren <strong>der</strong><br />
Heizung. Einer seiner Chefs schrieb damals<br />
warnende Worte in seine Personalakte:<br />
Snowdens Verhalten gebe ihm Anlass<br />
zur Sorge. Er verdächtigte ihn, in<br />
geheime Computerdateien eindringen<br />
zu wollen, für die er keine Zugangserlaubnis<br />
besitze. Die CIA habe ihn entlassen<br />
und nach Hause geschickt, berichtete<br />
die New York Times und berief sich auf<br />
Geheimdienstmitarbeiter.<br />
Damit hätte Snowdens Karriere als<br />
Agent beendet sein können, und die Welt<br />
hätte nie von ihm und den Abhörmaßnahmen<br />
des Geheimdiensts National Security<br />
Agency erfahren. Doch weil Snowden<br />
nicht nur Genf, son<strong>der</strong>n auch die CIA<br />
verließ, wurde eine Untersuchung abgebrochen<br />
und seine Akte geschlossen. Die<br />
CIA führt Personalakten offenbar vollautomatisch.<br />
Deshalb wird eine solche<br />
persönliche Bemerkung nur im Ausnahmefall<br />
weitergegeben. Die NSA, bei <strong>der</strong><br />
Snowden dann in Japan über den privaten<br />
Dienstleister Dell und später über<br />
Booz Allen Hamilton in Hawaii anheuerte,<br />
erfuhr nichts davon. Die CIA gibt<br />
offenbar nur Auskunft, wenn sie explizit<br />
darum gebeten wird. Die NSA fragte<br />
aber nicht. So wurde die Warnung erst<br />
vier Jahre später gefunden, aus Sicht <strong>der</strong><br />
Behörden war es da schon zu spät.<br />
Wie konnte es passieren, dass ausgerechnet<br />
jenen Leuten, die alle überwachen,<br />
die entscheidende Information<br />
fehlt? Ihre Erklärung klingt banal.<br />
Die Warnung sei einfach „durch das<br />
Netz geschlüpft“, zitierte die New<br />
York Times anonyme Ermittler und<br />
Geheimdienstmitarbeiter.<br />
Durchs Netz geschlüpft – passt diese<br />
Beschreibung nicht auch auf Snowden<br />
selbst, auf sein Leben als Spion und<br />
als Enthüller? Snowden schlüpft ständig<br />
durchs Netz – nicht nur <strong>der</strong> Geheimdienste,<br />
auch <strong>der</strong> <strong>Medien</strong> und <strong>der</strong> Öffentlichkeit.<br />
Glenn Greenwald, <strong>der</strong> Snowden<br />
in Hongkong traf und seine Akten für den<br />
Londoner Guardian auswertet, nennt ihn<br />
einen Computernerd, einen, <strong>der</strong> im Netz<br />
lebt. Er taucht auf – und wie<strong>der</strong> ab. In den<br />
<strong>Medien</strong> ist er „<strong>der</strong> meistgesuchte Mann<br />
<strong>der</strong> Welt“. Wer ist er wirklich?<br />
Richtig scheint zu sein, dass sich in<br />
Genf <strong>der</strong> Geheimdienst und sein Hausmeister<br />
zu misstrauen begannen. Snowden<br />
konnte seine Arbeit nicht mehr mit<br />
seinem Gewissen vereinbaren: Im Sommer<br />
2007 kam die Jurastudentin Mavanee<br />
An<strong>der</strong>son aus Nashville für vier<br />
Monate als Praktikantin in die amerikanische<br />
UN-Vertretung nach Genf und<br />
lernte Snowden kennen. Sie durfte ihr<br />
Land bei Abrüstungsverhandlungen vertreten.<br />
Ihr wurde eine hohe Sicherheitsstufe<br />
zugeteilt. Nach eigenen Angaben in<br />
ihrer Vita durfte sie sogar an Besprechungen<br />
<strong>der</strong> Geheimdienste teilnehmen.<br />
An<strong>der</strong>sons Top-Sicherheitsstufe habe<br />
es Snowden ermöglicht, offen mit ihr über<br />
das zu reden, was ihn bewegte. Die beiden<br />
wurden Freunde, wie sie einem Fernsehsen<strong>der</strong><br />
im Rückblick erzählte. Sie bekam<br />
mit, wie ihn seine Arbeit mehr und mehr<br />
frustrierte. Snowden sprach mit ihr darüber,<br />
warum er immer mehr an Sinn und<br />
Berechtigung <strong>der</strong> CIA zweifle. Details <strong>der</strong><br />
Unterhaltungen wollte sie nicht verraten,<br />
um ihm nicht zu schaden. Je<strong>der</strong>, <strong>der</strong> klug<br />
genug sei, um Zugang zu solchen Informationen<br />
zu erhalten, komme ins Grübeln,<br />
sagte sie. So verließ er die CIA.<br />
AM 1. JUNI 2013 trifft Snowden in Hongkong<br />
im Hotel Mira drei Journalisten, um<br />
ihnen Details über die Praktiken <strong>der</strong> NSA<br />
zu erzählen. Es hat Monate gedauert, den<br />
Kontakt aufzubauen, <strong>der</strong> nur verschlüsselt<br />
möglich war. Als Erkennungszeichen<br />
Illustration: Sebastian Haslauer<br />
66<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
„Ich möchte<br />
nicht in einer<br />
Welt leben,<br />
in <strong>der</strong> alles,<br />
was ich tue<br />
und sage,<br />
aufgezeichnet<br />
wird“<br />
Edward Snowden<br />
hält er einen Zauberwürfel in <strong>der</strong> Hand.<br />
Die Journalisten haben einen abgebrühten<br />
Aussteiger erwartet. Vor ihnen sitzt<br />
ein schmaler junger Mann mit einer<br />
Brille, die für sein Gesicht etwas zu groß<br />
ist. Er wirkt unbedarft. Aber das, was er<br />
erzählt, lässt keinen Zweifel zu, dass er<br />
weiß, worüber er berichtet. Er spricht ruhig<br />
und überlegt. Er sagt: „Sie haben ja<br />
keine Ahnung, was möglich ist. Das Ausmaß<br />
ist erschreckend. Wir können Software<br />
auf jeden Computer packen. Sobald<br />
jemand online geht, kann ich dessen<br />
Rechner identifizieren. Sie werden niemals<br />
sicher sein, egal, welchen Schutz Sie<br />
auch installieren.“<br />
Die Dokumentarfilmerin Laura<br />
Poitras packt unmittelbar nach dem ersten<br />
Aufeinan<strong>der</strong>treffen in Hongkong ihre<br />
Kamera aus und filmt Snowden tagelang.<br />
Für ihn war das zunächst eigenartig, wie<br />
er <strong>der</strong> New York Times in einem <strong>der</strong> wenigen<br />
Interviews, geführt über verschlüsselte<br />
E-Mails, sagte. „Normalerweise<br />
vermeiden Spione Kontakt mit Reportern.<br />
Als Quelle war ich eine Jungfrau.“<br />
An<strong>der</strong>erseits wollte er sich von Beginn<br />
an als Quelle <strong>der</strong> Enthüllungen outen,<br />
um glaubwürdig zu sein, und musste<br />
von den Journalisten zurückgehalten<br />
werden, wie Glenn Greenwald sagt. Sie<br />
baten ihn, mit dem Outing zu warten und<br />
erst über das System <strong>der</strong> Überwachung<br />
zu berichten, damit nicht von Beginn an<br />
Berichte über die Person Edward Snowden<br />
alle an<strong>der</strong>en Inhalte verdrängen.<br />
Anzeige<br />
Für alle, die es wissen wollen.<br />
Ist Krieg<br />
Fortschritt?<br />
ALS SNOWDEN AM 9. JUNI, einem Sonntagabend,<br />
schließlich an die Öffentlichkeit<br />
geht, sagt er dem Guardian zur Begründung:<br />
„Ich möchte nicht in einer<br />
Welt leben, in <strong>der</strong> alles, was ich tue und<br />
sage, aufgezeichnet wird.“ Im Video sagt<br />
er: „Als Systemadministrator bei den Geheimdiensten<br />
sieht man weit mehr als ein<br />
normaler Mitarbeiter. Irgendwann stellt<br />
man fest, dass man Rechtsbrüche gesehen<br />
hat, und will darüber reden. Aber<br />
je mehr man darüber redet, desto häufiger<br />
wird einem gesagt, dass es doch nicht<br />
so schlimm sei. Bis man an den Punkt<br />
kommt zu sagen, dass darüber die Öffentlichkeit<br />
zu entscheiden hat und nicht<br />
Angestellte <strong>der</strong> Regierung.“<br />
Seine Zweifel an <strong>der</strong> Rechtmäßigkeit<br />
und Berechtigung <strong>der</strong> Überwachung<br />
müssen sich allmählich entwickelt haben.<br />
»War! What is it good for? Absolutely<br />
nothing« – heißt es in einem legen dären<br />
Antikriegssong. Stimmt nicht, sagt Ian<br />
Morris. Seine umfassende Globalgeschichte<br />
enthüllt: Zu allen Zeiten hat<br />
Krieg Leben vernichtet – aber auch<br />
Innovationen gebracht, Gesellschaften<br />
erneuert, Frieden und Fortschritt vorangetrieben.<br />
Ist Krieg vielleicht sogar<br />
notwendig? Morris riskiert nicht nur<br />
eine provokante Frage, er kann sie auch<br />
beantworten.<br />
2013. 527 Seiten, gebunden. € 24,99<br />
Auch als E-Book erhältlich<br />
67<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Anzeige<br />
WELTBÜHNE<br />
Spurensuche<br />
Edition Nr. 9<br />
Strawalde<br />
Nebengekritzle<br />
2013<br />
Die Edition <strong>der</strong> Berliner Festspiele<br />
ist kostenlos im Festspielhaus<br />
und an 121 ausgewählten Orten<br />
in Berlin erhältlich.<br />
Aber es gab offenbar einen Schlüsselmoment:<br />
Zufällig sei er bei Reinigungsarbeiten<br />
im Computersystem auf einen<br />
geheimen Bericht über die illegale<br />
Überwachung während <strong>der</strong> Amtszeit von<br />
Präsident George W. Bush gestoßen. In<br />
dem Bericht beschrieb <strong>der</strong> für Kontrolle<br />
<strong>der</strong> Überwacher zuständige Staatsdiener,<br />
wie Gesetze umgangen werden, um<br />
im großen Stil illegales Abhören zu ermöglichen.<br />
Das löste bei Snowden Kritik<br />
aus: „Wenn die höchsten Staatsbeamten<br />
Gesetze brechen können, ohne Strafe<br />
fürchten zu müssen, dann sind geheime<br />
Mächte erheblich gefährlich.“<br />
Er wi<strong>der</strong>sprach aber dem Vorwurf,<br />
er habe sich in Genf unberechtigten Zugang<br />
zu Daten verschafft. Vielmehr sei<br />
die Bemerkung in seiner Personalakte<br />
eine Strafe dafür gewesen, dass er die<br />
CIA vor einer Sicherheitslücke im Computersystem<br />
warnte. Zudem wies er auf<br />
einen Streit mit einem Vorgesetzten hin,<br />
in dem es um eine Beför<strong>der</strong>ung und eine<br />
Gehaltserhöhung gegangen sei. <strong>Der</strong> Vorgesetzte<br />
habe einen angekündigten Test<br />
des Systems als unerlaubtes Eindringen<br />
beschrieben, um ihm zu schaden.<br />
Welche Version stimmt, ist aus <strong>der</strong><br />
Distanz schwer zu sagen. Snowden jedenfalls<br />
betont, <strong>der</strong> Vorfall habe ihm bewiesen,<br />
dass man nur verliere und bestraft<br />
werde, sobald man versuche, Fehler innerhalb<br />
des Systems zu korrigieren. Das<br />
habe er bei an<strong>der</strong>en Kollegen ähnlich erlebt.<br />
Die Erkenntnis: Um Dinge zu än<strong>der</strong>n,<br />
muss man sie öffentlich machen.<br />
Eines <strong>der</strong> Rätsel <strong>der</strong> Akte Edward<br />
Snowden lautet: Wie kam er rein? Wie<br />
hat er es ohne Studienabschluss 2005<br />
überhaupt in die CIA geschafft? Angeblich<br />
überzeugte er mit herausragenden<br />
Computerkenntnissen, die er sich selbst<br />
beigebracht hatte.<br />
Möglich ist auch, dass die Antwort<br />
in seiner Herkunft liegt. Jede gute Geschichte<br />
hat auch ein Element des Zufalls.<br />
Etwas, das den Helden fast zwangsläufig<br />
in die Geschichte führt. Eine Situation, in<br />
die er hineingeboren wird.<br />
Edward Snowden wird 1983 in Elizabeth<br />
City in North Carolina geboren.<br />
Als er neun Jahre alt ist, zieht die Familie<br />
nach Norden und 1999 weiter nach<br />
Ellicott City in die Gegend zwischen<br />
Washing ton und Baltimore. Seine Eltern<br />
arbeiten für den Staat. Vater Lonnie<br />
„Ed wollte seine<br />
Fähigkeiten<br />
einsetzen, um<br />
die Welt zu<br />
verbessern.<br />
Ich bewun<strong>der</strong>e<br />
seinen Mut“<br />
Mavanee An<strong>der</strong>son,<br />
ExKollegin von Edward Snowden<br />
68<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Anzeige<br />
bei <strong>der</strong> Küstenwache, Mutter Elizabeth,<br />
genannt Wendy, als Verwaltungsangestellte<br />
beim Bezirksgericht in Maryland.<br />
Die Eltern lassen sich 2001 scheiden –<br />
<strong>der</strong> Vater lebt in Pennsylvania in zweiter<br />
Ehe im Ruhestand, die Mutter weiterhin<br />
in Ellicott City. Eine ältere Schwester<br />
ist Juristin und arbeitet für eine Behörde<br />
in Washington.<br />
Ellicott City im US-Bundesstaat<br />
Maryland hat 65 000 Einwohner. Vor<br />
50 Jahren ist die Stadt einmal in die<br />
Schlagzeilen geraten, als über ihr ein<br />
Flugzeug in einen Schwarm Schwäne flog<br />
und abstürzte. <strong>Der</strong> Ort liegt zwischen<br />
Hügeln, er hat einen alten Stadtkern<br />
und ein Eisenbahnmuseum. Ein einst beliebter<br />
Vergnügungspark musste einem<br />
Shopping-Komplex weichen. Sonst wird<br />
nicht viel geboten. Aber es ist ein ruhiger<br />
Ort, <strong>der</strong> regelmäßig gute Plätze in den<br />
Ranglisten für Lebensqualität einnimmt.<br />
Die Bevölkerung gilt als wohlhabend.<br />
Zur NSA ist es nicht weit. Die Behörde<br />
arbeitet in Fort Meade, 20 Meilen<br />
südlich von Baltimore, und ist <strong>der</strong> größte<br />
Arbeitgeber in Maryland. Snowden verbringt<br />
Kindheit und Jugend im Schatten<br />
des Geheimdiensts, dessen Mitarbeiter<br />
über ihre Arbeit nicht sprechen dürfen,<br />
<strong>der</strong> aber zum Alltag gehört und dessen<br />
Existenzberechtigung naturgegeben zu<br />
sein scheint wie die Berge in Bayern.<br />
Zu <strong>der</strong> Zeit, als Snowden in Ellicott<br />
City die Arundel High School besuchte,<br />
schickte die NSA regelmäßig Mitarbeiter<br />
aus ihrer Zentrale in die Schule, um Kin<strong>der</strong>n<br />
in Mathematik zu helfen. Unklar ist,<br />
ob Snowden diese privilegierte Nachhilfe<br />
erhielt. Nach seinem Abgang von <strong>der</strong><br />
High School besuchte er das Anne Arundel<br />
Community College, eine Art Volkshochschule.<br />
Er belegte Computerkurse.<br />
In seiner Jugend baute er mit Freunden<br />
in einer Wohnung, die zum Komplex<br />
<strong>der</strong> NSA gehörte, eine Website für japanische<br />
Animationskunst. 2004 arbeitete<br />
er als Wachmann in einem Sprachenzentrum<br />
<strong>der</strong> NSA.<br />
Er verbrachte viel Zeit vor dem Computer.<br />
Nachbarn beschrieben ihn später<br />
als stets freundlich grüßend, wenngleich<br />
er dabei nie Augenkontakt gehalten habe.<br />
Manche wollten sich an einen jungen<br />
Mann erinnern, <strong>der</strong> hinter dem Fenster<br />
stundenlang nachts vor dem erleuchteten<br />
Bildschirm sitzt.<br />
Die Familie Snowden glaubte an den<br />
Staat und die Herrschaft des Rechts. Edward<br />
Snowden flog Ende Juni von Hongkong<br />
nach Moskau. Einige Wochen später<br />
bat ihn sein Vater in einem Fernsehinterview,<br />
er solle zurückkommen und dem<br />
Rechtsstaat vertrauen. Auf die Frage, ob<br />
er seinen Sohn lieber in Freiheit in Russland<br />
o<strong>der</strong> im Gefängnis in den USA sehen<br />
würde, sagte er: lieber im Gefängnis<br />
in den USA. Inzwischen war <strong>der</strong> Vater<br />
in Moskau, und es sind keine Interviews<br />
mehr bekannt, in denen er den Sohn<br />
drängte zurückzukehren.<br />
ÜBER EDWARD SNOWDENS Leben in<br />
Moskau weiß man wenig. Selbst die, die<br />
ihn dort besucht haben, sagen nichts Wesentliches.<br />
Seine Vertraute und Helferin<br />
Sarah Harrison, die ihn von Hongkong<br />
nach Moskau begleitete und jetzt in Berlin<br />
lebt, schweigt, um ihn, wie sie sagt,<br />
nicht zu gefährden. Reist er viel durchs<br />
Land, wie Gerüchte besagten? Ist er von<br />
<strong>der</strong> Welt abgeschnitten und stets kontrolliert<br />
und bewacht, wie es hieß? O<strong>der</strong> hat<br />
sich ein Minimum an Normalität eingestellt,<br />
wie Schnappschüsse vom Einkaufen<br />
und von einer Ausflugsfahrt auf einem<br />
Fluss nahelegen? Angeblich lernt er<br />
Russisch, hat einen Job bei einem Onlineportal,<br />
wie sein Anwalt verbreitet hat.<br />
Snowdens Mutter hält sich ganz raus.<br />
Als nach <strong>der</strong> Enthüllung ihres Sohnes Reporter<br />
vor ihrem Haus standen, lief sie<br />
mit tief ins Gesicht gezogener Regenkapuze<br />
an ihnen vorbei auf ihr Auto zu und<br />
dabei rief sie laut: „Please do not get into<br />
my life – thank you!“ Ihr Sohn hat seine<br />
Freiheit aufs Spiel gesetzt, damit an<strong>der</strong>e<br />
nicht einfach so in unser Leben eindringen.<br />
Man würde sie gerne fragen, was sie<br />
über ihn denkt. Aber sie lehnt den Kontakt<br />
zu Journalisten ab.<br />
Snowden hat seiner ehemaligen Kollegin<br />
und Freundin in Genf, Mavanee<br />
An<strong>der</strong>son, immer wie<strong>der</strong> davon erzählt,<br />
dass er die Schule abgebrochen hat, erinnerte<br />
sie sich. Als schäme er sich deswegen.<br />
Er schien aber zugleich stolz zu sein,<br />
dass er sich sein Computerwissen selbst<br />
beigebracht hat. Die Hochschulreife erlangte<br />
er auf dem zweiten Bildungsweg<br />
am Community College, ein Informatikstudium<br />
brach er jedoch ab. An<strong>der</strong>son<br />
nennt ihn „prone to brood“ – einen Grübler<br />
und Brüter. Jemand, <strong>der</strong> lange über<br />
Foto: David Ausserhofer<br />
ISBN 978-3-89684-152-0<br />
Auch als E-Book erhältlich.<br />
Asiem El Difraouis politischer<br />
Reisebericht zeigt die Menschen<br />
hinter den Nachrichten.<br />
www.edition-koerber-stiftung.de<br />
69<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Drei Monate<br />
<strong>Cicero</strong> Probe lesen<br />
<strong>Cicero</strong><br />
zur Probe<br />
Anzeige<br />
etwas nachdenkt, bevor er eine Entscheidung<br />
trifft. „Ed wollte seine Fähigkeiten<br />
einsetzen, um die Welt zu verbessern“,<br />
sagte sie. Deshalb habe er als Soldat in<br />
den Irak ziehen wollen. Deshalb habe er<br />
für die CIA gearbeitet. Ed sei nun ein<br />
Symbol für etwas, das größer als er selbst<br />
sei. „Ich bewun<strong>der</strong>e seinen Mut.“<br />
Ich möchte <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis von 18,– EUR* kennenlernen!<br />
Bitte senden Sie mir die nächsten drei <strong>Cicero</strong>-Ausgaben für 18,– EUR* frei Haus. Wenn mir <strong>Cicero</strong> gefällt, brauche ich nichts weiter<br />
zu tun. Ich erhalte <strong>Cicero</strong> dann monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit 7,75 EUR pro Ausgabe inkl. MwSt. (statt 8,50 EUR<br />
im Einzelverkauf). Falls ich <strong>Cicero</strong> nicht weiterlesen möchte, teile ich Ihnen dies innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt <strong>der</strong> dritten<br />
Ausgabe mit. Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein und können das Abonnement je<strong>der</strong>zeit kündigen. <strong>Cicero</strong> ist<br />
eine Publikation <strong>der</strong> Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Geschäftsführer Michael Voss. *Angebot und Preise<br />
gelten im Inland, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
Vorname<br />
Name<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Vorzugspreis<br />
Mit einem Abo<br />
sparen Sie gegenüber<br />
dem Einzelkauf.<br />
Telefon<br />
Datum<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/abo<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 943167<br />
Ohne Risiko<br />
Sie gehen kein Risiko ein<br />
und können Ihr Abonnement<br />
je<strong>der</strong>zeit kündigen.<br />
Ort<br />
E-Mail<br />
Geburtstag<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon o<strong>der</strong> E-Mail über interessante Angebote des Verlags<br />
informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch das Senden einer E-Mail an abo@cicero.de o<strong>der</strong> postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice,<br />
20080 Hamburg, je<strong>der</strong>zeit wi<strong>der</strong>rufen werden.<br />
Unterschrift<br />
JETZT<br />
TESTEN!<br />
3 x <strong>Cicero</strong> nur<br />
18,– EUR*<br />
Mehr Inhalt<br />
Demnächst monatlich mit<br />
Literaturen und zweimal<br />
im Jahr als Extra-Beilage.<br />
JEDER GUTE THRILLER braucht auch eine<br />
Liebesgeschichte. Irgendwo muss es eine<br />
Frau geben, die auf den Helden wartet.<br />
Die mit ihm leidet und daran, dass er eine<br />
höhere Aufgabe zu bewältigen hat. Die er<br />
verlassen musste, weil er die Welt retten<br />
wollte. Die ein Rätsel umgibt. Eine Frau<br />
wie Lindsay Mills.<br />
Die 28-Jährige war mehr als vier<br />
Jahre mit Snowden zusammen. Kennengelernt<br />
haben sie sich, als sie beide an<br />
<strong>der</strong> Ostküste in <strong>der</strong> Nähe <strong>der</strong> NSA lebten.<br />
In ihrem Blog „Adventures of a worldtraveling,<br />
pole-dancing superhero“, <strong>der</strong><br />
in Teilen noch im Internet zu finden<br />
ist, bot sie private Einblicke in das Leben<br />
mit Snowden. Demnach lebten sie<br />
seit 2009 gemeinsam in Baltimore, dann<br />
in Japan, wo er für die NSA arbeitete.<br />
Mitte 2012 zogen sie nach Hawaii, wo<br />
Snowden 122 000 Dollar im Jahr verdiente.<br />
Sie fuhren zum Camping, gingen<br />
schnorcheln, machten Urlaub in Hongkong.<br />
Zwischendrin finden sich Aufnahmen<br />
und Videos von Mills Auftritten mit<br />
<strong>der</strong> Waikiki Acrobatic Troupe.<br />
2012 schrieb sie: „Vergesst bitte nicht,<br />
dass ich nach Hawaii gezogen bin, um<br />
meine Beziehung zu E aufrechtzuerhalten.<br />
Seit ich aus dem Flugzeug stieg, erlebte<br />
ich das Auf und Ab einer gefühlsmäßigen<br />
Achterbahn.“ Nach einem Tag<br />
in ihrem Vorgarten notierte sie: „Ich sah<br />
E an und lächelte. Das war <strong>der</strong> am meisten<br />
erwachsene, langweilige Moment in<br />
meinem Leben. Ich fühle mich erwachsen,<br />
vorstädtisch und eigenartig zufrieden.“<br />
Zwischen den Zeilen wird deutlich,<br />
dass Snowden viel arbeitet und nur wenig<br />
Zeit hat für seine Freundin. Denn Monate<br />
später schrieb sie: „Freitag konnte ich<br />
nun endlich E meinen skeptischen Freunden<br />
vorstellen (sie waren sich nicht sicher,<br />
ob E existiert).“ Mitte Mai kündigt sie<br />
Besuch von Snowdens Familie an, allerdings<br />
bleibt offen, ob die tatsächlich gekommen<br />
ist. Drei Tage später verlässt ihr<br />
Freund Hawaii in Richtung Hongkong.
www.aufbau-verlag.de<br />
Illustration: Sebastian Haslauer<br />
„Ich lass<br />
von mir hören<br />
o<strong>der</strong> nicht.<br />
Superhelden<br />
brauchen eine<br />
rätselhafte Aura“<br />
Lindsay Mills,<br />
Edward Snowdens Freundin<br />
Mills hatte offenbar keine Ahnung,<br />
was er plante, aber sie klang besorgt, als<br />
sie am 7. Juni schrieb: „Krank, erschöpft,<br />
lastet die ganze Welt auf mir.“ Kurz davor<br />
begannen <strong>der</strong> Guardian und die<br />
Washington Post mit <strong>der</strong> Enthüllung <strong>der</strong><br />
NSA-Abhöraktion. Sie schrieb: „Ich lass<br />
von mir hören o<strong>der</strong> nicht. Superhelden<br />
brauchen eine rätselhafte Aura.“<br />
Am Tag, nachdem Snowden seine<br />
Identität als Urheber <strong>der</strong> Enthüllungen<br />
offenlegte, schrieb sie ihre letzte Nachricht:<br />
„Während ich das hier auf mein tränengetränktes<br />
Keyboard tippe, denke ich<br />
an all die Gesichter, die meinen Weg gekreuzt<br />
haben.“ Als versuche sie damit<br />
zurechtzukommen, notierte sie: „Manchmal<br />
kann sich das Leben keinen richtigen<br />
Abschied leisten.“ Danach löschte sie ihren<br />
Blog und verschwand.<br />
Mills’ Vater bestätigte Journalisten,<br />
dass seine Tochter mit Snowden eine Beziehung<br />
hatte. Er habe ihn als Mann mit<br />
Prinzipien kennengelernt. Snowden sei<br />
„sehr nett, schüchtern, zurückhaltend“,<br />
sagte Jonathan Mills. Snowden habe genaue<br />
Vorstellungen von Recht und Unrecht.<br />
Die Beziehung zu Mills erscheint<br />
heute dennoch so rätselhaft wie Snowden<br />
selbst. Warum hat er sie nicht mitgenommen<br />
nach Hongkong? Wusste sie<br />
wirklich nichts?<br />
Wer also ist Edward Joseph Snowden?<br />
Auffällig ist <strong>der</strong> Wi<strong>der</strong>spruch des<br />
einerseits fast naiv auftretenden Weltverbesserers<br />
– und des kühl und berechnend<br />
agierenden Computernerds. Aber<br />
vielleicht ist das nur wi<strong>der</strong>sprüchlich für<br />
Leute, die ihn nicht persönlich kennen.<br />
Am Ende bleiben Fragen: Snowden,<br />
<strong>der</strong> Brüter? Ist alles, was seit seinem<br />
Weggang von <strong>der</strong> CIA 2009 folgte, zielstrebig<br />
nach Plan abgelaufen? Hat Snowden<br />
seit dieser Zeit geheime NSA-Dokumente<br />
gesammelt, um eine Reform des<br />
Geheimdiensts zu erzwingen? Heute gibt<br />
es Berichte, wonach er bis zu 25 Kollegen<br />
in Hawai unter einem Vorwand ihre<br />
Passwörter abgeluchst haben soll. Aber<br />
wenn das zutrifft, wann fing er damit an?<br />
Und wie in jedem Thriller fragt man<br />
sich, was aus dem Helden werden soll.<br />
Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.<br />
THOMAS SCHULER ist Journalist in<br />
München. Er befasste sich während seiner<br />
Zeit als freier USAKorrespondent vor<br />
15 Jahren erstmals mit <strong>der</strong> NSA<br />
Anzeige<br />
<strong>Der</strong><br />
SPIEGEL-<br />
Bestseller<br />
jetzt als<br />
Son<strong>der</strong>ausgabe<br />
NUR<br />
22,- €<br />
Mark Twains Autobiographie,<br />
die auf Wunsch des Autors erst<br />
100 Jahre nach seinem Tod veröffentlicht<br />
wurde, erscheint jetzt als<br />
Geschenkausgabe in einem Band,<br />
ohne kommentierenden Anhang.<br />
»Ein Lesevergnügen!«<br />
die zeit<br />
MARK TWAIN<br />
Meine geheime Auto biographie<br />
Erfolgsausgabe. 736 Seiten<br />
Mit 45 Abb. Halbleinen<br />
Lesebändchen. € [D] 22,00<br />
ISBN 978-3-351-03552-5<br />
71<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
WELTBÜHNE<br />
Analyse<br />
TRAU. SCHAU,<br />
WEM<br />
Von WILLIAM J. DOBSON<br />
Eine Kette von Ereignissen lässt Län<strong>der</strong> von<br />
Europa bis Asien zweifeln, ob die USA<br />
überhaupt noch ihr zuverlässiger Partner sind<br />
ILLUSTRATION: SEBASTIAN HASLAUER<br />
Auf dem Höhepunkt des Kalten<br />
Krieges haben selbst<br />
zwei eingefleischte Feinde<br />
wie die USA und die Sowjetunion<br />
gewusst, dass sie zusammenarbeiten<br />
mussten. Um die Kluft<br />
zu überbrücken, haben sich die beiden<br />
Supermächte, ungeachtet ihrer ideologischen<br />
Unterschiede, <strong>der</strong> Anfeindungen<br />
und des globalen Wettrüstens, auf<br />
die Formel geeinigt: „Vertrauen ist gut,<br />
Kontrolle ist besser.“ Heute würden sich<br />
die Vereinigten Staaten glücklich schätzen,<br />
wenn ihre engsten Verbündeten ihnen<br />
überhaupt noch trauen würden.<br />
Das Misstrauen hat einen neuen Tiefpunkt<br />
erreicht, seit bekannt wurde, dass<br />
die National Security Agency (NSA) seit<br />
mindestens 2002 das Mobiltelefon von<br />
Bundeskanzlerin Angela Merkel abgehört<br />
hat. Natürlich ist das nur die Spitze<br />
des Eisbergs. Die Dokumente, die Edward<br />
Snowden veröffentlicht hat, offenbaren<br />
eine amerikanische Spionagebehörde<br />
mit einem unersättlichen Appetit<br />
auf Informationen. Sie bietet ein gigantisches<br />
Maß an technologischer Raffinesse<br />
auf, um Regierungen, Bürger und Organisationen<br />
auf <strong>der</strong> ganzen Welt zu überwachen,<br />
zu hacken und abzuhören – unabhängig<br />
davon, ob es sich um Freund<br />
o<strong>der</strong> Feind handelt. Einem Bericht des<br />
britischen Guardian zufolge scheint die<br />
NSA seit Oktober 2008 die Telefongespräche<br />
von 35 Staats- und Regierungschefs<br />
abgehört zu haben. US-Regierungsbeamte<br />
sind offensichtlich „ermuntert“<br />
worden, ihre Kontaktdaten <strong>der</strong> NSA anzuvertrauen,<br />
insbeson<strong>der</strong>e die Telefonnummern<br />
„ausländischer Politiker o<strong>der</strong><br />
führen<strong>der</strong> Militärs“. Über 200 Telefonnummern<br />
habe die NSA allein von einem<br />
Beamten <strong>der</strong> US-Regierung erhalten und<br />
sie schnell für ihre geheimdienstlichen<br />
Zwecke ausgeschlachtet.<br />
DIE REAKTION DEUTSCHLANDS, einem<br />
<strong>der</strong> unerschütterlichsten Verbündeten<br />
Amerikas, war schnell und unverblümt.<br />
Außenminister Guido Westerwelle bestellte<br />
Amerikas Botschafter ein, und<br />
Kanzlerin Angela Merkel betonte, dass<br />
die Beziehungen zwischen Deutschland<br />
und den USA „gravierend erschüttert“<br />
worden seien, dass „Vertrauen wie<strong>der</strong><br />
aufgebaut werden müsse“ und „Worte<br />
allein nicht ausreichen werden“.<br />
Ähnlich reagierte Frankreichs Präsident<br />
François Hollande, als er durch<br />
einen Bericht <strong>der</strong> französischen Tageszeitung<br />
Le Monde erfuhr, dass die NSA<br />
auch die Telefonate von Franzosen abgehört<br />
haben soll. Allein innerhalb eines<br />
Monats seien mehr als 70 Millionen<br />
Gespräche aufgezeichnet worden. Während<br />
<strong>der</strong> Überwachung wurden wohl Telefonate<br />
und Kurznachrichten gesammelt,<br />
wahrscheinlich auch von französischen<br />
Politikern und Wirtschaftsführern. An<strong>der</strong>e<br />
europäische Regierungschefs – die<br />
vermuten, dass auch sie Ziel <strong>der</strong> amerikanischen<br />
Geheimdienste waren – reagierten<br />
ähnlich wie Merkel und Hollande.<br />
Die Empörung ist aber nicht allein<br />
auf Europa beschränkt: Bereits im September<br />
sagte Brasiliens Präsidentin Dilma<br />
Rousseff wegen ähnlicher Anschuldigungen<br />
ihren Besuch in Washington ab.<br />
Die NSA-Enthüllungen haben Amerikas<br />
Glaubwürdigkeit zu einer Zeit beschädigt,<br />
in <strong>der</strong> das Vertrauen in Washington<br />
73<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Anzeige<br />
WELTBÜHNE<br />
Analyse<br />
816 S., 159 Abb. in Farbe u. 4 Ktn. Geb. € 25,–<br />
„Diese Geschichten sollten<br />
nie aufhören.“ Elisabeth von<br />
Thadden, DIE ZEIT<br />
„Dieses Buch ist so schön, so<br />
klug und so richtungweisend,<br />
dass es eigentlich in jede Bibliothek<br />
gehört.“ Tim Sommer,<br />
art – Das Kunstmagazin<br />
347 S., 125 Abb. in Farbe. Geb. € 29,95<br />
„Eine faszinierende Lektüre …<br />
und ein wun<strong>der</strong>schön ausgestattetes<br />
Buch, das man immer<br />
wie<strong>der</strong> gern in die Hand nehmen<br />
wird.“ Hubert Spiegel,<br />
Frankfurter Allgemeine Zeitung<br />
C.H.BECK<br />
www.chbeck.de<br />
nur noch eingeschränkt vorhanden ist. In<br />
den vergangenen zwölf Monaten hat es<br />
eine Reihe von Vorfällen gegeben, aufgrund<br />
<strong>der</strong>er die Weltgemeinschaft sich<br />
fragt, ob die USA überhaupt noch ein<br />
verlässlicher Partner sein können.<br />
Da wäre Präsident Obamas wankelmütige<br />
und unentschlossene Antwort<br />
auf Baschar al Assads Einsatz chemischer<br />
Waffen. In <strong>der</strong> Vergangenheit hatte<br />
Obama immer wie<strong>der</strong> betont, dass mit<br />
dem Gebrauch solcher Waffen eine „rote<br />
Linie“ überschritten sei. Und was tat <strong>der</strong><br />
US-Präsident, als diese Linie tatsächlich<br />
überschritten worden war? Erst bereitet<br />
er einen Raketenangriff auf Damaskus<br />
vor, dann gibt er den Plan eines Militärschlags<br />
unerwartet auf, um auf die russische<br />
Initiative zur Vernichtung <strong>der</strong> syrischen<br />
Chemiewaffen einzuschwenken.<br />
Was immer man von dieser Vereinbarung<br />
halten mag – die Tatsache, dass Obama<br />
seinen eigenen Versprechen keine Taten<br />
folgen ließ, hat Verbündete wie Südkorea,<br />
Japan, Israel und Taiwan verunsichert,<br />
die sich auf Amerikas Verteidigungszusagen<br />
verlassen.<br />
Fassungslos und besorgt ist man im<br />
Ausland auch über den Zustand des amerikanischen<br />
Regierungsapparats, <strong>der</strong> sich<br />
bei <strong>der</strong> jüngsten Haushaltssperre und <strong>der</strong><br />
Verletzung <strong>der</strong> Schuldengrenze in seinem<br />
ganzen Ausmaß offenbarte. Wegen <strong>der</strong><br />
Haushaltssperre sagte Obama eine wichtige<br />
Reise nach Asien ab, wo er am asiatisch-pazifischen<br />
Wirtschaftsgipfel APEC<br />
hätte teilnehmen soll. Das war die dritte<br />
Absage einer Reise in diese Region, und<br />
sie weckt Zweifel an <strong>der</strong> Ernsthaftigkeit<br />
<strong>der</strong> USA in ihren Beziehungen zum asiatisch-pazifischen<br />
Raum – zumal es <strong>der</strong><br />
Obama-Regierung nicht gelungen ist, irgendeinen<br />
bedeutenden Schritt zu unternehmen,<br />
<strong>der</strong> ihre „pivot“ nach Asien<br />
auch politisch untermauern würde. In<br />
<strong>der</strong> Region fragt man sich: Wie können<br />
die USA ihre Führung in Asien erneuern,<br />
wenn <strong>der</strong> Präsident nicht einmal in<br />
<strong>der</strong> Lage ist, sich in seine Air Force One<br />
zu setzen und die Region zu besuchen?<br />
Die asiatischen Staaten werden nicht auf<br />
die USA warten – schon gar nicht, wenn<br />
China parat steht.<br />
Die Vereinigten Staaten werden immer<br />
mehr als die unberechenbare Macht<br />
wahrgenommen, die unerwartet von einer<br />
Richtung in die an<strong>der</strong>e taumelt. Nach<br />
74<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013<br />
zwölf Jahren Krieg wirken die USA erschöpft,<br />
unsicher und gespalten. Angesichts<br />
einer Innenpolitik, die in Unordnung<br />
geraten ist, und einer Außenpolitik,<br />
die keine klare Linie erkennen lässt, werden<br />
Washingtons Verbündete immer wie<strong>der</strong><br />
überrascht: Man weiß einfach nicht,<br />
was als Nächstes zu erwarten ist.<br />
DIE NUN ENTHÜLLTEN DETAILS amerikanischer<br />
Spionagetätigkeit gegen enge<br />
Freunde und Verbündete kommen zu einem<br />
beson<strong>der</strong>s ungünstigen Zeitpunkt.<br />
Wie können diese ausländischen Mächte<br />
in enger Abstimmung mit den USA arbeiten,<br />
wenn Washington jede ihrer Bewegungen<br />
genau beobachtet? Warum sollten<br />
diese Verbündeten ihre Ressourcen<br />
o<strong>der</strong> gar das Leben ihrer Bürger und Soldaten<br />
aufs Spiel setzen – sei es im Irak,<br />
in Afghanistan, Libyen o<strong>der</strong> in einem<br />
<strong>der</strong> nächsten Krisengebiete in <strong>der</strong> Welt –,<br />
wenn sie ihrem wichtigsten Partner nicht<br />
vertrauen können? Wenn die USA sie in<br />
dieser Art und Weise ausspähten, sind sie<br />
dann überhaupt noch Verbündete?<br />
Natürlich haben die Obama-Regierung<br />
und ihre Verteidiger schnell darauf<br />
hingewiesen, dass es gute Gründe dafür<br />
gibt, warum die NSA so viele ausländische<br />
Daten sammelt. Am Anfang dieser<br />
Geheimdienstoperation stand die Terrorbekämpfung.<br />
Es ist eine Tatsache, dass –<br />
unter an<strong>der</strong>en – europäische Hauptstädte<br />
Brutstätten für islamistischen Terrorismus<br />
waren. Also sollte es niemanden<br />
überraschen, dass die USA ihr Äußerstes<br />
unternahmen, um sich diesen Bedrohungen<br />
so effektiv wie möglich zu stellen.<br />
Aber es gibt noch eine weitere Erklärung:<br />
Fast jede Regierung spioniert in irgendeiner<br />
Weise – auch bei ihren engsten<br />
Verbündeten. Viele <strong>der</strong> Staaten, die<br />
jetzt schockiert über die Aktivitäten <strong>der</strong><br />
NSA sind, spionieren ihrerseits in den<br />
USA und bei ihren europäischen Nachbarn.<br />
Zweifellos fürchten einige, dass<br />
Snowden schon bald Material über ihre<br />
eigenen geheimdienstlichen Unternehmungen<br />
offenbaren wird.<br />
Das Problem indessen sind das Ausmaß<br />
<strong>der</strong> globalen Überwachung durch<br />
Amerika und die Tatsache, dass kein an<strong>der</strong>es<br />
Land über eine Signalaufklärung<br />
verfügt, also eine ähnliche Fähigkeit wie<br />
die USA besitzt, Informationen zu sammeln,<br />
zu dekodieren und zu analysieren.
Anzeige<br />
Weil die<br />
Geheimdienste<br />
die Möglichkeit<br />
haben, Millionen<br />
ausländischer<br />
Telefongespräche<br />
abzuhören, tun<br />
sie es auch<br />
Viele <strong>der</strong> Snowden-Enthüllungen haben<br />
ein Ausmaß und Möglichkeiten <strong>der</strong> amerikanischen<br />
Geheimdienstmethoden offengelegt,<br />
die bislang unbekannt waren.<br />
Das allein schon schürt die Sorge <strong>der</strong><br />
Staats- und Regierungschefs, die fürchten,<br />
die NSA habe ihre Telefongespräche<br />
abgehört.<br />
Die USA und insbeson<strong>der</strong>e die Obama-Regierung<br />
sollten sich aber noch ganz<br />
an<strong>der</strong>e Sorgen machen: Ein internes Regierungspapier,<br />
das Snowden im vergangenen<br />
Monat dem Guardian zukommen<br />
ließ, hat auch gezeigt, dass <strong>der</strong> Lauschangriff<br />
auf ausländische Regierungschefs<br />
und Beamte „wenig Ergiebiges“ erbracht<br />
hat. Hier stellt sich die Frage: Warum riskiert<br />
man eine Beschädigung <strong>der</strong> Beziehungen<br />
wegen eines Programms, das fast<br />
keine nützlichen geheimdienstlichen Erkenntnisse<br />
bringt?<br />
LEIDER IST DIE ERKLÄRUNG dafür keine<br />
gute. Sie lautet: Weil sie es können. Nach<br />
dem ersten Schock, <strong>der</strong> auf die Anschläge<br />
vom 11. September 2001 folgte,<br />
haben die USA eine Maschinerie für eine<br />
kraftvolle Terrorbekämpfung errichtet,<br />
die reich ausgestattet war mit den Instrumenten<br />
und <strong>der</strong> Technologie, einen<br />
weiteren großen Angriff zu verhin<strong>der</strong>n.<br />
Dass sich die Balance zwischen Freiheit<br />
und Sicherheit nach einem Angriff wie<br />
dem vom 11. September in Richtung Sicherheit<br />
verschoben hat, ist nicht weiter<br />
verwun<strong>der</strong>lich – das war in den USA<br />
nicht an<strong>der</strong>s als in den meisten an<strong>der</strong>en<br />
Demokratien. <strong>Der</strong> Unterschied beim<br />
Kampf gegen den Terror besteht darin,<br />
dass Washing ton nie zu seiner früheren<br />
Balance zurückgefunden hat.<br />
Die technischen Möglichkeiten haben<br />
ihre eigene Logik entwickelt. Weil<br />
die amerikanischen Geheimdienste die<br />
Möglichkeit haben, Millionen ausländischer<br />
Telefongespräche abzuhören, tun<br />
sie es auch. Die Verlockung, die Technik<br />
zu nutzen, die sie entwickelt haben, ist zu<br />
groß, um ihr zu wi<strong>der</strong>stehen. Es ist völlig<br />
offensichtlich, dass die US-Regierung es<br />
auch mehr als zehn Jahre nach 9/11 nicht<br />
geschafft hat, die Geheimdienstapparate<br />
wie<strong>der</strong> einer klaren Kontrolle zu unterstellen.<br />
Das Ergebnis war eine politische<br />
und diplomatische Peinlichkeit. Immerhin<br />
hat das Weiße Haus zugegeben, dass<br />
das Pendel zu weit ausgeschlagen ist.<br />
Solche Versicherungen werden vielen<br />
Verbündeten Amerikas aber nicht<br />
ausreichen. Aus diesem Grund werden<br />
Deutschland und die USA ein Anti-Spionage-Abkommen<br />
abschließen. Die Alliierten<br />
<strong>der</strong> USA, nicht nur in Europa,<br />
werden klare Auskunft über den Vertrauensbruch<br />
Washingtons verlangen.<br />
Es ist entscheidend, wie die USA<br />
mit <strong>der</strong> Empörung über die NSA-Überwachung<br />
umgehen werden. Beziehungen<br />
mögen verletzt worden sein, aber dies<br />
könnte die Obama-Regierung zum Anlass<br />
nehmen, den Glauben <strong>der</strong> Menschen<br />
an die Supermacht wie<strong>der</strong>herzustellen.<br />
Barack Obama kann nicht garantieren,<br />
dass er in Zukunft Haushaltssperren verhin<strong>der</strong>n<br />
kann o<strong>der</strong> Konflikte mit Baschar<br />
al Assad. Aber er kann sich ehrlich bemühen<br />
zu zeigen, wie ernst er die Sorgen<br />
<strong>der</strong> Verbündeten nimmt. Versäumt er<br />
das, wird es nicht nur um verletzte Gefühle<br />
o<strong>der</strong> bittere Worte auf Seiten <strong>der</strong><br />
Verbündeten gehen. Es werden auch die<br />
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit <strong>der</strong><br />
USA mit ihren Partnern erheblich eingeschränkt.<br />
Bleiben die USA eine unberechenbare<br />
Macht, laufen sie Gefahr, allein<br />
dazustehen. Für Amerikas Verbündete<br />
gilt dann ebenfalls das Motto: Vertrauen<br />
ist gut, Kontrolle ist besser.<br />
WILLIAM J. DOBSON ist Außenpolitikchef<br />
des amerikanischen OnlineMagazins Slate<br />
und Autor des Buches „Diktatur 2.0“<br />
€ 26,99 [D]<br />
ISBN 978-3-424-35084-5<br />
Unsere Umweltprobleme haben<br />
ein Ausmaß angenommen, das<br />
jede Lösung unmöglich erscheinen<br />
lässt. Umso prekärer, dass<br />
alle Hoffnung auf die Vermeidung<br />
des Unheils gesetzt wird.<br />
Roger Scrutons Kritik dieser<br />
Strategie entblößt nachhaltige<br />
Politik und internationale<br />
Abkommen als vernachlässigbare<br />
Faktoren. Hingegen<br />
positioniert <strong>der</strong> Philosoph den<br />
Konservatismus als jenen einen<br />
Denkansatz mit <strong>der</strong> Potenz<br />
unsere Zukunft auf dem Planeten<br />
zu sichern.<br />
Überleben durch<br />
Resilienz und<br />
Erfindungsgeist<br />
75<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
WELTBÜHNE<br />
Fotoessay<br />
JESUS KAM<br />
BIS SIBIRIEN<br />
Fotos DAVIDE MONTELEONE<br />
Sergei Torop war Soldat, Polizist, einfacher Arbeiter.<br />
Dann erkannte er seine wahre Berufung. Seither suchen<br />
Tausende Menschen mitten in Sibirien ihr Heil<br />
bei dem selbst ernannten Jesus<br />
76<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
WELTBÜHNE<br />
Fotoessay<br />
„Um mich anzunehmen, müssen<br />
die Menschen alles aufgeben, was sie besitzen“<br />
Sergei Torop alias Wissarion<br />
In Petropawlowka, knapp<br />
4000 Kilometer östlich von<br />
Moskau, haben die Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
„Kirche des letzten Testaments“<br />
eine neue Heimat gefunden<br />
Eine Prozession in die<br />
umliegenden Berge von<br />
Petropawlowka gehört<br />
für die Gläubigen zum<br />
Sonntagsritual<br />
79<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Wenn es dunkel wird in<br />
Sibirien, treffen sich<br />
Wissarions Anhänger zur<br />
Abendliturgie
WELTBÜHNE<br />
Fotoessay<br />
„Die Menschheit ist auf direktem Weg auf den<br />
Abgrund zugegangen“<br />
Sergei Torop alias Wissarion<br />
Oleg und seine kleine<br />
Familie gehören zu den<br />
etwa 5000 Anhängern,<br />
die Wissarion nach<br />
Sibirien gefolgt sind<br />
Die Streifen <strong>der</strong> Gardine<br />
in einer <strong>der</strong> Holzhütten<br />
erinnert an eine Stola, das<br />
liturgische Gewandstück<br />
katholischer Geistlicher<br />
82<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
WELTBÜHNE<br />
Fotoessay<br />
Sergei Torops Leben hat eine furiose Wendung<br />
genommen. 1991 verkündete er:<br />
„Ja, ich bin Jesus.“ Seither versteht sich<br />
<strong>der</strong> einstige Verkehrspolizist als Religionsgrün<strong>der</strong><br />
mit universalem Anspruch.<br />
Seine wahre Berufung hatte <strong>der</strong> damals 29-Jährige<br />
im Mai 1990 durch ein „unglaubliches Aufleuchten<br />
<strong>der</strong> inneren geistigen Kraft“ erkannt. Seit dieser<br />
Zeit arbeitet er an seiner Unsterblichkeit.<br />
„Um mich anzunehmen, müssen die Menschen<br />
alles aufgeben, was sie besitzen“, sagt <strong>der</strong> neue<br />
Christus, <strong>der</strong> sich Wissarion nennt. Seine Jünger<br />
sind nur allzu gern bereit dazu. In Holzhütten<br />
ohne fließend Wasser leben die etwa 5000 Mitglie<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> „Kirche des letzten Testaments“ in<br />
35 Dörfern mit Petropawlowka als Zentrum, knapp<br />
4000 Kilometer östlich von Moskau. Im Winter fallen<br />
die Temperaturen auf minus 40 Grad, im Sommer<br />
wird es unerträglich heiß – ganz zu schweigen<br />
von den Scharen von Stechmücken.<br />
Seine erste Predigt hält Wissarion am 18. August<br />
1991. An diesem Tag beginnt <strong>der</strong> Putsch gegen<br />
Michail Gorbatschow. Es folgt eine chaotische Zeit.<br />
Ein neuer Jesus gibt manch einem Halt und Orientierung<br />
im neuen Russland. Keiner stört sich an<br />
<strong>der</strong> eher weltlichen Herkunft des neuen Heilsbringers.<br />
1961 in Krasnodar in Südrussland geboren,<br />
verlebt Torop eine typische sowjetische Kindheit.<br />
Den Militärdienst leistet er bei einem Bautrupp in<br />
<strong>der</strong> Mongolei ab, danach arbeitet er in einer Metallfabrik.<br />
Schließlich wird er Verkehrspolizist in<br />
Minusinsk. In seiner Freizeit malt er Heiligenbil<strong>der</strong>.<br />
Zum Heilsbringer ist es da nicht mehr weit.<br />
Für Wissarions Jünger, zu denen heute längst<br />
nicht mehr nur Russen zählen, ist er Gott. Jedes<br />
seiner Worte sei vom Licht <strong>der</strong> Wahrheit und <strong>der</strong><br />
Liebe durchdrungen. In seiner Nähe spüren seine<br />
Anhänger angeblich Schwingungen, Magnetfel<strong>der</strong><br />
o<strong>der</strong> kosmische Energie. Und Erlösung. „Die<br />
Menschheit ist auf direktem Weg auf den Abgrund<br />
zugegangen. Doch jetzt seid ihr an jener Stelle angekommen,<br />
wo von diesem verhängnisvollen Weg<br />
ein einziger Pfad abgeht, <strong>der</strong> zur wahren Vollkommenheit<br />
führt“, verspricht Wissarion.<br />
Diesen Weg weist selbstverständlich <strong>der</strong> selbst<br />
ernannte Heilsbringer. Wissarion verlangt von seinen<br />
Anhängern ein entsagungsvolles Leben. Kein<br />
Alkohol, kein Tabak, kein Fleisch. Das, was die<br />
Menschen in dieser Gemeinschaft essen, müssen<br />
sie dem kargen sibirischen Boden abtrotzen. Solch<br />
ein Leben muss man wollen.<br />
Mathilde Pal<br />
Bevor <strong>der</strong> Gottesdienst<br />
beginnt, recken Wissarions<br />
Jünger ihre Hände dem<br />
Konterfei des Vergötterten<br />
entgegen<br />
Fotos: Davide Monteleone/VII (Seiten 76 bis 84)<br />
84<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
KAPITAL<br />
„ Wenn Mario Monti<br />
ein Katholik ist, dann<br />
ist Mario Draghi im<br />
Vergleich dazu <strong>der</strong> Papst“<br />
<strong>Der</strong> Zitatgeber will lieber ungenannt bleiben, weil er sowohl mit dem<br />
ehemaligen italienischen Regierungschef Monti als auch mit dem Präsidenten<br />
<strong>der</strong> Europäischen Zentralbank Draghi befreundet ist. Seite 96<br />
85<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
KAPITAL<br />
Porträt<br />
GESCHICKT EINGEFÄDELT<br />
Christoph Rickerl flicht und färbt Schnüre in Wuppertal. Klingt banal, ist aber Hightech.<br />
Sein Betrieb hat sogar die aktuellen Nobelpreisträger mit einem Geflecht beliefert<br />
Von CAROLA SONNET<br />
Foto: Bettina Flitner für <strong>Cicero</strong><br />
Wäre Christoph Rickerl ein<br />
Schnürsenkel, dann jedenfalls<br />
kein herkömmlicher.<br />
Nicht die Standardversion in Schwarz,<br />
75 Zentimeter lang, auch wenn das immer<br />
noch <strong>der</strong> bestverkaufte Senkel von<br />
Barthels-Feldhoff ist, dem europäischen<br />
Marktführer aus Wuppertal.<br />
Rickerl, 44, wirkt jung, jedenfalls gemessen<br />
an dem altehrwürdigen Unternehmen,<br />
das er leitet. Die braunen Haare<br />
trägt er lang, Jeans statt Anzughose,<br />
keine Krawatte. Gäbe es eine Mischung<br />
aus dem handgewachsten Edelsenkel,<br />
den die Firma auf <strong>der</strong> Düsseldorfer Königsallee<br />
verkauft, und dem neonorangenen<br />
Hipster-Schuhband hinter ihm auf<br />
<strong>der</strong> Fensterbank, so würde ihn das beschreiben:<br />
ein Mann, <strong>der</strong> das Alte mit<br />
dem Neuen zu verflechten weiß.<br />
„Wir sehen uns auf dem Lernweg,<br />
<strong>der</strong> ständig im Begriff <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung<br />
ist“, sagt Rickerl. Innovation ist nötig.<br />
Denn zwar geht es Barthels-Feldhoff gut,<br />
<strong>der</strong> Branche dagegen nicht. Das Wuppertaler<br />
Unternehmen, gegründet vor<br />
184 Jahren, ist fast allein in Deutschland.<br />
Ein Großteil <strong>der</strong> Mitbewerber produziert<br />
in Asien o<strong>der</strong> hat dichtgemacht.<br />
Die Wuppertaler entschieden sich gegen<br />
China, stattdessen fertigen sie in Thüringen<br />
und Polen.<br />
Doch <strong>der</strong> Markt stagniert. Bei den<br />
Schustern hat Barthels-Feldhoff einen<br />
Marktanteil von 75 bis 80 Prozent. Ein<br />
Paar Schnürsenkel verkaufte <strong>der</strong> Schuster<br />
den Kunden früher immer noch mit<br />
dazu. „Früher sind die Leute mit kaputten<br />
Schuhen noch häufiger zum Schuster<br />
gegangen“, sagt Rickerl. Heute kostet<br />
ein neuer Schuh kaum mehr als eine<br />
neue Sohle.<br />
Aber man muss aus dem etwas machen,<br />
was man hat. So war die Firma<br />
Barthels-Feldhoff schon erfolgreich, als<br />
sie 1950 einen winzigen goldfarbenen<br />
Ring an die von ihm gefertigten Schnürsenkel<br />
steckte. Ein Alltagsgegenstand<br />
wurde veredelt – es war die Geburtsstunde<br />
<strong>der</strong> Marke Ringelspitz, mit <strong>der</strong><br />
die Firma groß wurde.<br />
Heute geht es wie<strong>der</strong> darum, die alten<br />
Kompetenzen möglichst klug einzusetzen.<br />
Aus Karbonfasergeflecht stellt<br />
Barthels-Feldhoff Schläuche für Prothesen,<br />
Kranarme, Eishockeyschläger<br />
und Skier her, für Produkte, bei denen<br />
es auf jedes Gramm Gewicht ankommt.<br />
<strong>Der</strong> Textilbetrieb fertigt Schnüre für Angeln,<br />
Fallschirme und Lenkdrachen aus<br />
Hightechmaterialien. Mit <strong>der</strong> Bergischen<br />
Universität Wuppertal hat die Firma ein<br />
Geflecht für das Kernforschungszentrum<br />
Cern in Genf entwickelt. Es verhin<strong>der</strong>t,<br />
dass sich die Wärme im Innern des Teilchenbeschleunigers<br />
zu stark ausdehnt.<br />
Auf diesen Kunden ist Rickerl stolz.<br />
Mithilfe des eigenen Produkts wurde in<br />
Genf 2012 die Existenz des Higgs-Teilchens<br />
bestätigt, für dessen theoretische<br />
Herleitung Peter Higgs und François Englert<br />
den Physiknobelpreis erhielten.<br />
Rickerl erhöht die Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
an die über 200 Mitarbeiter ständig. Ein<br />
eigenes Forschungszentrum entwickelt<br />
neue Produkte: „Heute kann es passieren,<br />
dass ein Strömungstechniker, ein<br />
Verfahrenstechniker und ein Textiler an<br />
einem Projekt arbeiten“, sagt er.<br />
In Deutschland mit einem Textilhersteller<br />
Erfolg zu haben, ist für Rickerl<br />
auch eine persönliche Sache. Sein<br />
Vater hatte einen Textilbetrieb, als Dreijähriger<br />
sah er den Näherinnen zu, wie<br />
sie Bän<strong>der</strong> und Kordeln herstellten. Sie<br />
schoben ihm Süßigkeiten zu. „Ich bin<br />
schwerst vorbelastet“, sagt er. Er wurde<br />
Textilingenieur. Als er von einer Stelle<br />
bei Barthels-Feldhoff hörte, fragte er<br />
seinen Vater. „Eine solide Firma, mit<br />
interessanten Menschen, die lebt ihre<br />
Werte“, sagte <strong>der</strong> und fügte hinzu: „Die<br />
ticken etwas an<strong>der</strong>s.“<br />
Gerade deshalb passte sie zu Rickerl.<br />
Er ist ein Chef, <strong>der</strong> sich Gedanken<br />
macht: über eine schrumpfende Mittelschicht,<br />
über die Arbeitswelt, in die<br />
er seine Azubis entlässt, in <strong>der</strong> ein hohes<br />
Gehalt, schneller Aufstieg, die große<br />
Karriere wichtig scheinen.<br />
Kunstunterricht ist Bestandteil für<br />
die Ausbildung <strong>der</strong> „Lernlinge“. So nennt<br />
auch Götz Werner seine Auszubildenden,<br />
<strong>der</strong> Milliardär von <strong>der</strong> Drogeriemarktkette<br />
DM. Rickerl kennt ihn persönlich.<br />
Werner ist Vorreiter einer anthroposophischen<br />
Geschäftsphilosophie, <strong>der</strong> sich<br />
auch Rickerl „tief verbunden“ fühlt.<br />
Jeden Morgen treffen sich alle Abteilungsleiter.<br />
Das soll verhin<strong>der</strong>n, dass<br />
je<strong>der</strong> nur für sich arbeitet. Es gibt einen<br />
kleinen Chor, einige haben miteinan<strong>der</strong><br />
Theater gespielt. Wissenschaftliche<br />
Mitarbeiter tauschen sich mit den<br />
Produktionsleuten aus <strong>der</strong> Färberei o<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Flechterei aus, um das alte mit dem<br />
Neuen zusammenzubringen.<br />
CAROLA SONNET schreibt gern über<br />
Wirtschaft und Bildung, über beide<br />
Themenfel<strong>der</strong> konnte sie mit dem<br />
Schnürsenkelhersteller sprechen<br />
MYTHOS<br />
MITTELSTAND<br />
Was hat Deutschland,<br />
was an<strong>der</strong>e nicht haben?<br />
Den Mittelstand!<br />
<strong>Cicero</strong> stellt in je<strong>der</strong> Ausgabe<br />
einen mittelständischen<br />
Unternehmer vor.<br />
Die bisherigen Porträts<br />
finden Sie unter:<br />
www.cicero.de/mittelstand<br />
87<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
KAPITAL<br />
Porträt<br />
DER PUNKROCK-STRATEGE<br />
Rausgehen, ausbuhen lassen, besser werden. Twitter-Grün<strong>der</strong> Jack Dorsey hat beim<br />
Börsengang des Jahres eine halbe Milliarde Dollar verdient, aber ums Geld ging es ihm nie<br />
Von CHRISTINE MATTAUCH<br />
Es war <strong>der</strong> 6. November 2011, als<br />
Barack Obama gut gelaunt eine<br />
kleine Bühne im Weißen Haus betrat<br />
und verkündete: „Ich werde jetzt Geschichte<br />
machen als erster Präsident, <strong>der</strong><br />
live tweetet.“ Über den Kurznachrichtendienst<br />
Twitter antwortete <strong>der</strong> Präsident<br />
direkt auf die Fragen <strong>der</strong> Nutzer.<br />
<strong>Der</strong> Mo<strong>der</strong>ator stand mit eingefrorenem<br />
Lächeln daneben: ein dünner junger<br />
Mann in einem hellgrauen Anzug mit<br />
schwarzer Krawatte, so verkrampft, dass<br />
er beim Hinsetzen fast den Stuhl verfehlte,<br />
nachdem er sich als „Jack Dorsey<br />
von Twitter“ vorgestellt hatte. Die Zuschauer<br />
wun<strong>der</strong>ten sich, wieso das Unternehmen<br />
so einen ungelenken Grünschnabel<br />
zum Präsidenten schickte.<br />
Inzwischen hat sich die Welt dramatisch<br />
verän<strong>der</strong>t. Twitter ist keine Neuheit<br />
mehr, son<strong>der</strong>n bekannt und etabliert – je<strong>der</strong><br />
fünfte amerikanische Internetnutzer<br />
ist inzwischen angemeldet. Beim Börsengang<br />
im November erlöste die Firma einen<br />
Milliardenbetrag. Und jener unsichere<br />
junge Mann, <strong>der</strong> im Weißen Haus<br />
vergaß, sich als Grün<strong>der</strong> von Twitter<br />
vorzustellen, ist heute ein Star <strong>der</strong> Tech-<br />
Szene und laut Forbes <strong>der</strong> sechstjüngste<br />
Milliardär <strong>der</strong> USA: Auf 1,3 Milliarden<br />
Dollar beziffert das Wirtschaftsmagazin<br />
das Vermögen des 37-Jährigen.<br />
Wer so erfolgreich ist, dem lässt die<br />
amerikanische Öffentlichkeit gern ein<br />
paar Beson<strong>der</strong>heiten durchgehen. Dass<br />
sich Dorsey als Punker einen Nasenring<br />
verpasste, drei Ausbildungen abbrach<br />
und kuriose Hobbys wie Botanisches<br />
Zeichnen pflegte, gilt aus heutiger Sicht<br />
nicht als asozial, son<strong>der</strong>n als Beleg seiner<br />
Genialität. Man muss aber auch etwas<br />
schräg ticken, um auf eine Idee wie<br />
Twitter zu kommen: Um sich vorstellen<br />
zu können, dass es Leute gibt, die sich<br />
mit 140 Anschlägen – die Obergrenze für<br />
eine Twitter-Kurznachricht – verständigen<br />
wollen. Die Spaß daran haben, sich<br />
im Telegrammstil zu äußern, mit kryptischen<br />
Abkürzungen, die man lernen<br />
muss wie einen Code.<br />
Ein geselliger Mensch hätte ein System<br />
wie Twitter wahrscheinlich nicht erfunden.<br />
Doch kommunikationsstark war<br />
Dorsey nie. <strong>Der</strong> Schauspieler Ashton<br />
Kutcher, <strong>der</strong> ihn gut kennt, sagt über<br />
Dorsey: „Wenn Jack spricht, zählt jede<br />
Silbe.“ Als Kind hatte er einen Sprachfehler<br />
und blieb am liebsten für sich.<br />
Auch als Heranwachsen<strong>der</strong> war er wortkarg<br />
und spröde, ein Eigenbrötler, <strong>der</strong><br />
unter dem Pseudonym JakDaemon düstere<br />
Gedichte und Manifeste ins Internet<br />
stellte.<br />
DORSEY WUCHS in St. Louis auf, einer<br />
Provinzhauptstadt in Missouri. Wie viele<br />
Jungs war er fasziniert von Fahrplänen<br />
und Landkarten, die er wie Poster an die<br />
Wände seines Kin<strong>der</strong>zimmers hängte.<br />
Dann kaufte sein Vater, ein Schiffsliebhaber,<br />
einen CB-Funkempfänger, um die<br />
Nachrichten <strong>der</strong> Mississippi-Kapitäne zu<br />
verfolgen. <strong>Der</strong> technikaffine Jack programmierte<br />
den Apparat so, dass er Polizeifunk<br />
und Krankenwagen abhören<br />
konnte. Die rituelle Struktur <strong>der</strong> Durchsagen<br />
faszinierte ihn: Die Teilnehmer<br />
meldeten Standort, Ziel und Mission:<br />
„Befinden uns in <strong>der</strong> Market Street Ecke<br />
Opernhaus, fahren zum Loretta-Park,<br />
kümmern uns um bewusstlose Person.“<br />
Es war ein System, das nach klaren Regeln<br />
funktionierte. Dorsey mochte das.<br />
Er mochte es so sehr, dass er versuchte<br />
eine Software zu bauen, die das, was er<br />
hörte, visualisierte.<br />
Bei den meisten Kin<strong>der</strong>n geht so eine<br />
Phase irgendwann vorbei. Bei Dorsey jedoch<br />
wurde die Suche nach <strong>der</strong> perfekten<br />
virtuellen Ordnung zur fixen Idee. In<br />
New York programmierte er ein digitales<br />
System, das Fahrradkuriere koordinierte;<br />
in San Francisco verbesserte er<br />
ein Programm für den Ticketverkauf <strong>der</strong><br />
Fähre nach Alcatraz. Als sei die Rationalität<br />
des Abstrakten die Konstante seines<br />
Lebens. Vielleicht war sie das ja auch.<br />
Alles an<strong>der</strong>e, was Dorsey anpackte, versandete<br />
irgendwie o<strong>der</strong> ging in die Brüche.<br />
Beziehungen zu Frauen. Hobbys<br />
wie Massage o<strong>der</strong> Botanikzeichnen, obwohl<br />
er auch die zeitweise so intensiv betrieb,<br />
dass er überlegte, damit sein Geld<br />
zu verdienen.<br />
Zwei Mal brach er ein Informatikund<br />
Mathematik-Studium ab, zunächst<br />
an <strong>der</strong> University of Missouri, dann an<br />
<strong>der</strong> New York University. Später verließ<br />
er vorzeitig eine Schule für Modedesign.<br />
2002 kehrte er in seine Heimatstadt<br />
St. Louis zurück wie einer, <strong>der</strong> es draußen<br />
nicht geschafft hat: „Ich fühlte mich<br />
wie ein Verlierer.“ Aber er gab nicht auf.<br />
Er machte es wie seine Idole, die Punkmusiker<br />
von Gruppen wie Operation Ivy<br />
and Rancid. Dorsey bewun<strong>der</strong>te sie, weil<br />
sie fast ohne jede Vorbildung mit den Instrumenten<br />
experimentierten und direkt<br />
live auftraten: „Sie wurden ausgebuht,<br />
ein ums an<strong>der</strong>e Mal. Aber sie gaben nicht<br />
auf, lernten und wurden besser. Ich fand<br />
diese Haltung einfach toll“, sagte er dieses<br />
Jahr bei einem Vortrag in New York.<br />
2005 ging er zurück nach San Francisco.<br />
Schlug sich mit kleinen Programmierjobs<br />
und Babysitten durch. Landete<br />
schließlich bei einem Start-up namens<br />
Odeo, das sich auf Podcasts spezialisiert<br />
hatte. „Die Podcasts interessierten mich<br />
nicht im Geringsten“, erinnert sich Dorsey,<br />
„aber ich mochte die Leute.“<br />
Als Odeo mangels funktionierenden<br />
Geschäftsmodells in die Krise geriet,<br />
baten die Chefs ihre Mitarbeiter<br />
um Einfälle. Dorsey holte seinen alten<br />
Foto: Kevin Abosch<br />
88<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
KAPITAL<br />
Porträt<br />
Jack Dorsey<br />
schrieb am<br />
21. März 2006 als<br />
@Jack den<br />
allerersten<br />
Tweet. Heute<br />
folgen ihm<br />
2,5 Millionen<br />
Menschen<br />
Traum wie<strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Schublade: eine<br />
Art Ortungsdienst, den Menschen zur<br />
Standortbestimmung nutzen sollten, so<br />
wie in seiner Jugend die Ordnungshüter<br />
den Polizeifunk. Als Beispiele für<br />
Kurznachrichten notierte er seinerzeit<br />
„bin im Park“ o<strong>der</strong> „liege im Bett“. Dass<br />
so ein Dienst auch dazu dienen könnte,<br />
dass sich Menschen miteinan<strong>der</strong> unterhalten,<br />
sich Neuigkeiten mitteilen o<strong>der</strong><br />
Gefühle, fiel dem Einzelgänger gar nicht<br />
ein. Es waren, viel später, die Anwen<strong>der</strong>,<br />
die Funktionen vorschlugen wie die, Meldungen<br />
gezielt an Personen zu adressieren,<br />
o<strong>der</strong> Diskussionen unter bestimmten<br />
Stichworten zu führen.<br />
Odeos Firmenleitung war einverstanden,<br />
und ein Team von vier Leuten<br />
machte sich an die Arbeit. Was in den darauffolgenden<br />
Jahren geschah, davon hat<br />
je<strong>der</strong> <strong>der</strong> Beteiligten seine eigene Version.<br />
So wie es oft passiert, wenn ein Team<br />
nach anfänglichem Erfolg auseinan<strong>der</strong>bricht.<br />
Sicher ist, dass es Dorsey war, <strong>der</strong><br />
die Software schrieb und am 21. März<br />
2006 unter <strong>der</strong> Adresse @Jack den ersten<br />
offiziellen Tweet absetzte, <strong>der</strong> heute<br />
für die Fans des Dienstes Kultstatus hat:<br />
„just setting up my twttr“.<br />
Sicher ist auch, dass <strong>der</strong> stille Dorsey<br />
eine Zeit lang als Vorstandsvorsitzen<strong>der</strong><br />
agierte, Fehler machte und abgelöst<br />
wurde; dass er enttäuscht war und half,<br />
gegen Evan Williams, seinen Nachfolger<br />
als Twitter-Chef, zu intrigieren, <strong>der</strong> ihn<br />
einst zu Odeo geholt hatte.<br />
Im Oktober, kurz vor dem Börsengang,<br />
erschienen in den USA fast<br />
zeitgleich zwei große Artikel über die<br />
Gründungsgeschichte von Twitter, einer<br />
in <strong>der</strong> New York Times und einer<br />
im New Yorker. In dem einen ist Dorsey<br />
ein Bösewicht, <strong>der</strong> absichtlich Kollegen<br />
aus dem Team drängt. <strong>Der</strong> an<strong>der</strong>e<br />
stellt ihn als verträumten Weltverbesserer<br />
dar, <strong>der</strong> selbst fast kaltgestellt worden<br />
wäre. Wenn Dorsey über sein Leben<br />
spricht, spart er dieses Kapitel am<br />
liebsten aus.<br />
Für ihn ist es heute wichtiger, dass<br />
er sein neues Unternehmen vorantreibt.<br />
Square heißt es, eine Software, die je<strong>der</strong><br />
nutzen kann, um an einem Tablet o<strong>der</strong><br />
Laptop Kreditkarten einzulesen. Den<br />
Kartenleser verteilt Square kostenlos,<br />
auch die App ist gratis. Umsatz macht<br />
das Jungunternehmen durch Provisionen<br />
auf den Zahlungsverkehr. Die Provisionen<br />
liegen etwas niedriger als die<br />
<strong>der</strong> großen Abrechnungskonzerne, und<br />
die Technik ist schlanker und schicker.<br />
Viele kleine Händler nutzen das Zahlungssystem<br />
inzwischen und auch einige<br />
große, darunter die Kaffeekette Starbucks.<br />
Und Dorsey baut weitere Funktionen<br />
wie Square Wallet o<strong>der</strong> Square<br />
Cash auf, die alle das Ziel haben, den<br />
Bezahlvorgang zu vereinfachen.<br />
VOR ZWEI MONATEN hatte <strong>der</strong> Milliardär<br />
mal wie<strong>der</strong> einen öffentlichen Auftritt,<br />
an <strong>der</strong> New Yorker Elitehochschule Columbia.<br />
Er, <strong>der</strong> Studienabbrecher, warb<br />
dort um Talente für seine Firma und<br />
wurde empfangen wie ein Guru – es war<br />
eine Großveranstaltung, mit mehreren<br />
Hun<strong>der</strong>t Zuhörern. Wer sich noch an<br />
den peinlichen Auftritt mit Obama erinnerte,<br />
erkannte den Jungunternehmer<br />
kaum wie<strong>der</strong>: Statt eines dürren Jünglings<br />
präsentierte sich ein Mann mit Ausstrahlung,<br />
<strong>der</strong> souverän mit dem Publikum<br />
spielte, selbstironisch Fotos von sich<br />
als Punk mit blauen Haaren zeigte und<br />
auch um spontane Kommentare nicht<br />
verlegen war.<br />
Endlich hat er seinen Platz im Leben<br />
gefunden. Er wird respektiert. Das<br />
Wall Street Journal kürte ihn im vergangenen<br />
Jahr zum „Technikinnovator des<br />
Jahres“. Auf Twitter folgen ihm 2,5 Millionen<br />
Menschen. Dorsey hat sich mit<br />
seiner Punkrockstrategie durchgesetzt:<br />
einfach Sachen öffentlich ausprobieren,<br />
vor aller Augen Fehler machen, besser<br />
werden. Er weiß jetzt, was geht und was<br />
nicht. Und wie das System Silicon Valley<br />
funktioniert.<br />
Bei Twitter ist er heute Chairman,<br />
ohne operative Aufgaben. Als Symbolfigur<br />
ist er wichtig für das Unternehmen:<br />
einer, auf den man hört, wenn er Verbesserungsvorschläge<br />
macht. Auch bei <strong>der</strong><br />
Vorbereitung des Börsengangs setzte das<br />
Unternehmen auf die Bekanntheit seines<br />
Grün<strong>der</strong>s – Amerika verehrt erfolgreiche<br />
Firmengrün<strong>der</strong>, nicht erst seit dem<br />
Kult um den verstorbenen Apple-Übervater<br />
Steve Jobs. In einem Video für<br />
Investoren ist Dorsey in Jeans und mit<br />
charmantem Drei-Tage-Bart aufgetreten,<br />
wie man sich einen coolen Tech-Unternehmer<br />
vorstellt: „Wir starteten Twitter,<br />
weil wir das wollten, weil wir es liebten<br />
und weil wir sehen wollten, wie an<strong>der</strong>e<br />
Leute es nutzen.“<br />
Für ihn ist <strong>der</strong> Rummel um den erfolgreichen<br />
Börsengang vor allem wichtig,<br />
um Werbung für sein neues Unternehmen<br />
zu machen. Natürlich ist da das<br />
Geld. Beim Börsengang von Twitter gehörten<br />
ihm 4,7 Prozent <strong>der</strong> Firma, mehr<br />
als 20 Millionen Aktien, die rund eine<br />
halbe Milliarde Dollar wert sein dürften.<br />
Dorsey, <strong>der</strong> früher spartanisch in einem<br />
Mini-Apartment lebte und nie ein Auto<br />
besaß, hat Gefallen am Luxus gefunden.<br />
Er trägt jetzt Hemden von Prada und<br />
Dior und fährt BMW. Kürzlich hat er in<br />
San Francisco für zehn Millionen Dollar<br />
eine Villa mit Blick auf die Golden Gate<br />
Bridge gekauft. Dort wohnt er mit seiner<br />
Freundin, die ebenfalls erfolgreich<br />
in <strong>der</strong> Internetbranche arbeitet. Die Annehmlichkeiten<br />
des Lebens schätzen zu<br />
können, gehört vielleicht auch zum Erwachsenwerden.<br />
<strong>Der</strong> ehemalige Veganer<br />
erlaubt sich heute auch Fisch und Fleisch.<br />
Beim Auftritt an <strong>der</strong> Columbia University<br />
hatte er einen kleinen Bauchansatz.<br />
Er stand ihm gut.<br />
CHRISTINE MATTAUCH arbeitet als<br />
Wirtschaftskorrespondentin seit 2007 in<br />
New York, twittert selbst aber eher selten<br />
90<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Ihr Sparpaket: Acer Tablet<br />
mit Tagesspiegel E-Paper<br />
für nur 24 ¤ im Monat. *<br />
Sichern Sie sich Ihr Sparpaket<br />
zum einmaligen Vorzugspreis:<br />
· Acer Iconia W-510, 64 GB, WiFi<br />
· Tagesspiegel E-Paper<br />
· Tagesspiegel-App für Windows 8<br />
· abnehmbare Tastatur im Wert von<br />
129,– ¤ gratis dazu – für alle Besteller<br />
bis zum 31. Dezember 2013!<br />
Für nur 24 ¤ im Monat! *<br />
Ihr<br />
Geschenk:<br />
die abnehmbare<br />
Tastatur – passend<br />
zu Ihrem<br />
Tablet!<br />
Gleich bestellen:<br />
Telefon (030) 290 21-500<br />
www.tagesspiegel.de/tablet-cicero<br />
* Einmalige Zuzahlung für das Tablet ACER Iconia W-510, 64 GB, Wi-Fi, 10,1" in silber: 99,– €. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Nach Ablauf <strong>der</strong> Mindestlaufzeit gilt <strong>der</strong> dann gültige Preis für<br />
das E-Paper (zzt. 17,20 € monatlich). Preise inkl. MwSt. Das Digitalpaket enthält den E-Paper-Preis von 17,20 € im Monat. <strong>Der</strong> Kauf des Tablet steht unter Eigentumsvorbehalt innerhalb <strong>der</strong> ersten 2 Jahre.<br />
Die Garantie für das Tablet beläuft sich auf ein Jahr. Mit vollständiger Zahlung des Bezugspreises für die Mindestvertragslaufzeit geht das Eigentum am Tablet an den Käufer über. Es gelten die unter<br />
tagesspiegel.de/bundle-agb veröffentlichten AGB. Die einmalige Zuzahlung wird bei Lieferung des Gerätes fällig. Zusätzlich zur Zahlung werden 2,– € Nachentgelt erhoben. Nur so lange <strong>der</strong> Vorrat reicht.
KAPITAL<br />
Interview<br />
„ ICH MÜSSTE DIE<br />
HÄLFTE ENTLASSEN “<br />
<strong>Der</strong> Mindestlohn im Praxistest: Ein Berliner Taxifahrer<br />
diskutiert mit seinem Chef, was passiert, wenn in Deutschland<br />
<strong>der</strong> flächendeckende Stundenlohn von 8,50 Euro kommt<br />
STEPHAN HAUBE<br />
ist 47 Jahre alt und arbeitet seit<br />
zehn Jahren als Taxifahrer. Sein<br />
monatliches Nettogehalt beziffert er<br />
auf rund 760 Euro, dazu kommen noch<br />
150 bis 200 Euro Trinkgeld im Monat.<br />
Er ist unterhaltspflichtig für seine<br />
14 Jahre alte Tochter<br />
ANDREAS DOMEK<br />
ist 56 Jahre alt und seit 32 Jahren<br />
als Taxi unternehmer in Berlin<br />
selbstständig. Sein Fuhr park umfasst<br />
25 Taxis, damit gehört Domeks Betrieb<br />
zu den größeren in <strong>der</strong> Stadt. Er legt<br />
Wert darauf, dass alle seine Fahrer<br />
regulär angestellt sind<br />
92<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Foto: Antje Berghäuser für <strong>Cicero</strong><br />
Herr Haube, Sie sind angestellter Taxifahrer<br />
in Berlin. Wie hoch ist Ihr durchschnittlicher<br />
Stundenlohn?<br />
Stephan Haube: Das ist von <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Schicht abhängig. An einem<br />
normalen Werktag komme ich auf ungefähr<br />
5,60 Euro die Stunde. An den Wochenendschichten<br />
kann es aber schon auf<br />
7,00 Euro hochgehen.<br />
Wie genau setzt sich das zusammen?<br />
Haube: Ich bekomme bis zu 45 Prozent<br />
vom Taxiumsatz, dazu kommen Zulagen<br />
für Nachtschichten, Sonn- und Feiertage<br />
und Essensgeld.<br />
Aber in jedem Fall liegen Sie unter dem<br />
anvisierten Mindestlohn von 8,50 Euro?<br />
Haube: Auf jeden Fall.<br />
Das heißt, Sie müssten ein Befürworter<br />
des Mindestlohns sein?<br />
Haube: Das bin ich auch. Obwohl<br />
ich die Verhältnisse in unserer Branche<br />
kenne.<br />
Und Sie, Herr Domek?<br />
Andreas Domek: Im Prinzip halte<br />
ich sehr viel von einem Mindestlohn. Es<br />
ist doch eine Sauerei, wenn zum Beispiel<br />
die Mitarbeiter einer Brotfabrik im Dreischichtbetrieb<br />
nur 3,62 Euro pro Stunde<br />
verdienen. Ich selbst würde ja auch gern<br />
einen Mindestlohn von 8,50 Euro zahlen –<br />
wenn ich denn die Möglichkeit dazu hätte.<br />
Was würden denn 8,50 Euro Mindestlohn<br />
für Sie als Taxiunternehmer konkret<br />
bedeuten?<br />
Domek: Die 8,50 Euro sind ja erst<br />
mal nur <strong>der</strong> Bruttolohn für den Arbeitnehmer.<br />
Als seriöser Betrieb, wie wir<br />
es sind, müssen da noch <strong>der</strong> Sozialversicherungsanteil<br />
von 20 Prozent draufgerechnet<br />
werden und ein Anteil von<br />
6 Prozent für die Berufsgenossenschaft.<br />
Außerdem muss <strong>der</strong> Urlaub bezahlt werden,<br />
und ich muss auch Krankheitsausfälle<br />
berücksichtigen. Das bedeutet unterm<br />
Strich eine Lohnkostenbelastung<br />
von 12,40 Euro pro Stunde für mich als<br />
Arbeitgeber.<br />
Wo ist das Problem?<br />
Domek: Das Problem ist, dass in Berlin<br />
<strong>der</strong> durchschnittliche Stundenumsatz<br />
eines Taxis bei knapp 13,70 Euro liegt –<br />
und zwar brutto, also ohne Betriebskosten<br />
für Benzin, für die Fahrzeuge und<br />
so weiter.<br />
Das heißt, bei 8,50 Euro Mindestlohn<br />
würden Sie Verluste machen?<br />
Domek: Ja. Trotzdem bin ich im<br />
Prinzip auch hier für einen Mindestlohn.<br />
Aber um 8,50 Euro die Stunde zahlen zu<br />
können, müssten meine Taxis einen Stundenumsatz<br />
von 21 Euro machen.<br />
Und diese Zahl ist nicht erreichbar?<br />
Domek: Nein, wie soll das gehen?<br />
Die Tarife fürs Taxifahren setzen ja<br />
nicht wir als Unternehmer fest, son<strong>der</strong>n<br />
die werden von <strong>der</strong> Senatsverwaltung<br />
für Wirtschaft vorgegeben. Und<br />
die hat die Taxitarife seit fünf Jahren<br />
nicht erhöht.<br />
Für einen Mindestlohn von 8,50 Euro<br />
müssten also die Taxitarife deutlich erhöht<br />
werden?<br />
Domek: Es müssten zuallererst einmal<br />
die Umsätze steigen. Wenn einfach<br />
nur die Preise fürs Taxifahren steigen,<br />
wird eben weniger Taxi gefahren, damit<br />
ist uns auch nicht gedient.<br />
Also?<br />
Domek: Am allerwichtigsten wäre<br />
es, die schwarzen Schafe in <strong>der</strong> Branche<br />
aus dem Markt zu nehmen. Dann hätten<br />
saubere Betriebe wie wir natürlich mehr<br />
Umsatz. Für Berlin gibt es ja sage und<br />
schreibe 7600 Taxikonzessionen.<br />
Was heißt „schwarze Schafe“?<br />
Domek: Da gibt es etliche Unternehmen,<br />
die dem Finanzamt nur einen<br />
Bruchteil ihrer Taxiumsätze melden; <strong>der</strong><br />
Rest wird schwarz erwirtschaftet. Auch<br />
Scheinselbstständigkeit ist weitverbreitet,<br />
indem den Fahrern ein Taxi pro forma<br />
verpachtet wird, um Sozialabgaben zu<br />
sparen. Sehr viele Taxibetriebe in Berlin<br />
arbeiten mit solchen Methoden. Viele seriöse<br />
Unternehmen haben wegen dieser<br />
Wettbewerbsverzerrung in den vergangenen<br />
Jahren aufgegeben.<br />
Gehen Sie davon aus, dass bei Einführung<br />
eines Mindestlohns die „schwarzen<br />
Schafe“ eher noch mehr werden<br />
würden?<br />
Domek: Natürlich.<br />
Herr Haube, waren Sie auch schon<br />
als scheinselbstständiger Taxifahrer<br />
unterwegs?<br />
Haube: Nein. Man muss auch klar<br />
sagen, dass solche Sachen vor allem in<br />
Taxiunternehmen mit arabischem, iranischem,<br />
russischem o<strong>der</strong> türkischem Hintergrund<br />
praktiziert werden. Das erzählen<br />
mir ja sogar <strong>der</strong>en Fahrer.<br />
Warum gehen denn die Behörden gegen<br />
solche Betriebe nicht vor?<br />
Domek: Weil sich die Berliner Verwaltung<br />
seit mindestens 20 Jahren im<br />
Tiefschlaf befindet.<br />
Haube: Die teilweise hanebüchenen<br />
Zustände im Taxigewerbe scheinen die<br />
Behörden hier einfach nicht zu interessieren.<br />
In an<strong>der</strong>en Städten wird da ganz<br />
an<strong>der</strong>s durchgegriffen.<br />
Inwiefern setzen denn Car-Sharing-Modelle<br />
o<strong>der</strong> Limousinen-Services Ihre<br />
Branche noch zusätzlich unter Druck?<br />
Domek: Car-Sharing ist für uns nicht<br />
schlecht, weil das viele Leute dazu bringt,<br />
ihr eigenes Auto abzuschaffen – die nutzen<br />
dann zur Not auch öfter mal ein Taxi.<br />
Die Limousinen-Services hingegen sind<br />
eine aggressive Konkurrenz für uns.<br />
Müssten Sie schließen, wenn <strong>der</strong> Mindestlohn<br />
von 8,50 Euro käme und ansonsten<br />
in <strong>der</strong> Branche alles gleich<br />
bliebe?<br />
Domek: Ich müsste mit Sicherheit die<br />
Hälfte aller Fahrer entlassen.<br />
Herr Haube, das Risiko einer Entlassung<br />
würden Sie zugunsten des Mindestlohns<br />
in Kauf nehmen?<br />
Haube: Schwierige Frage. Am Ende<br />
würde ich mir wahrscheinlich einen an<strong>der</strong>en<br />
Job suchen und mit dem Taxifahren<br />
aufhören.<br />
Das Gespräch führte<br />
ALEXANDER MARGUIER<br />
93<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
KAPITAL<br />
Kommentar<br />
EWIGER ETATSTREIT<br />
Von HENRIK ENDERLEIN<br />
Mit fragilen Haushaltskompromissen verhin<strong>der</strong>n die USA eine<br />
Apokalypse <strong>der</strong> Märkte, während sich die Politik radikalisiert<br />
Taugen die USA als Garant <strong>der</strong> Weltleitwährung, wenn die<br />
größte Volkswirtschaft in immer kürzeren Abständen auf<br />
einen Staatsbankrott zusteuert, während die Landesführung<br />
ein unwürdiges Polit-Wrestling veranstaltet?<br />
Zuletzt waren die USA im Oktober dabei, in die Zahlungsunfähigkeit<br />
zu schlittern. Präsident Barack Obama und Oppositionsführer<br />
John Boehner hatten nichts Besseres zu tun, als<br />
sich Begriffe wie „Armageddon“ o<strong>der</strong> „Apokalypse“ um die<br />
Ohren zu hauen und sich gegenseitig zu bezichtigen, das Land<br />
in den Abgrund jagen zu wollen.<br />
Wenige Stunden bevor die beim drohenden Staatsbankrott<br />
obligatorischen Countdown-Uhren <strong>der</strong> US-Nachrichtensen<strong>der</strong><br />
auf null standen, kam es dann doch noch zum erwarteten<br />
Happy End. Weltuntergang abgewendet. USA wie<strong>der</strong> zahlungsfähig.<br />
Zumindest für die nächsten drei Monate.<br />
In Deutschland wurde das Spektakel abfällig und unter<br />
Heranziehung <strong>der</strong> gängigen Antiamerikanismen kommentiert:<br />
Vergleiche mit Cowboys und Hollywood waren dabei noch die<br />
freundlicheren. Also alles nur ein Schmierentheater?<br />
Eine solch oberflächliche Betrachtung verkennt, worum es<br />
wirklich geht. <strong>Der</strong> US-Haushaltsstreit ist kein aufgebauschter<br />
Polit-Showdown kurz vor High Noon, son<strong>der</strong>n Ausdruck eines<br />
immer dysfunktionaleren politischen Systems. Die zunehmende<br />
Polarisierung <strong>der</strong> amerikanischen Parteien lähmt das<br />
politische System in Washington. Die schlechte Nachricht ist,<br />
dass sich daran kurzfristig nichts än<strong>der</strong>n wird. Die gute Nachricht<br />
ist, dass es dennoch nicht zu einem Staatsbankrott <strong>der</strong><br />
USA kommen wird.<br />
Das Problem ist, dass die Mitte in <strong>der</strong> US-Politik an Bedeutung<br />
verloren hat. Wahlen entscheiden sich an den Rän<strong>der</strong>n:<br />
Die meisten Parlamentssitze werden nicht mehr zwischen Republikanern<br />
und Demokraten ausgefochten, son<strong>der</strong>n innerhalb<br />
<strong>der</strong> Parteien.<br />
Wichtigster Grund ist das „Redistricting“, die geografische<br />
Neuordnung von Wahlkreisen. Wahlkreisgrenzen sind in<br />
den vergangenen Jahren so lange neu gezeichnet worden, bis<br />
fast nur noch „rein“ linke o<strong>der</strong> rechte Bevölkerungsgruppen<br />
einen Abgeordneten benennen. Konsequenz: 90 Prozent <strong>der</strong><br />
US-Wahlkreise für das Repräsentantenhaus gelten als eindeutig<br />
republikanisch o<strong>der</strong> demokratisch.<br />
Die Entscheidung über den Mandatsträger fällt nicht mehr<br />
bei <strong>der</strong> Wahl selbst, son<strong>der</strong>n bei den Primaries, den innerparteilichen<br />
Vorwahlen. Wer diese Art <strong>der</strong> Kandidatenkür in seiner<br />
eigenen Partei gewinnen will, rückt oft stärker nach rechts<br />
o<strong>der</strong> links, um möglichst viele Vorwähler anzusprechen.<br />
Die Wahlbeteiligung bei den Primaries liegt meist nur bei<br />
rund 10 Prozent <strong>der</strong> Wahlberechtigten je Partei. Wenn in einem<br />
republikanischen Wahlkreis 10 Prozent <strong>der</strong> Wahlberechtigten<br />
zwischen vier Kandidaten entscheiden, dann reicht theoretisch<br />
die Mobilisierung von 3 Prozent <strong>der</strong> Wahlberechtigten zum<br />
Illustration: Florian Bayer<br />
94<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Einzug ins Repräsentantenhaus. Die Realität kommt <strong>der</strong> Theorie<br />
sehr nahe: Je<strong>der</strong> US-Wahlkreis steht für rund 700 000 Wähler.<br />
In <strong>der</strong> Regel reichen aber 20 000 bis 30 000 Stimmen zum<br />
Gewinn <strong>der</strong> Vorwahlen aus – also weniger als 5 Prozent <strong>der</strong><br />
Gesamtwähler. Und weil Primaries vor allem polarisierte, oft<br />
radikalisierte Wählergruppen anziehen, polarisieren und radikalisieren<br />
sich auch die Kandidaten.<br />
Nur so konnte eine Bewegung wie die Tea Party bei den<br />
Republikanern entstehen. Gleiches gilt aber auch für die Demokraten.<br />
Dass die gesetzliche Gesundheitsversicherung nach<br />
Jahrzehnten <strong>der</strong> Debatte überhaupt eine Chance bekam, liegt<br />
am wachsenden Einfluss des linken Spektrums <strong>der</strong> Partei.<br />
Im Repräsentantenhaus prallen daher Gruppen von Abgeordneten<br />
aufeinan<strong>der</strong>, <strong>der</strong>en Partikularinteressen so ausgeprägt<br />
sind, dass sie sich Kompromissen mit dem politischen<br />
„Gegner“ im Grundsatz verweigern. Die gegenseitige Blockade<br />
wird zum Tagesgeschäft, verschärft durch den Umstand, dass<br />
die Republikaner das Repräsentantenhaus und die Demokraten<br />
den Senat kontrollieren.<br />
<strong>Der</strong> ewige Streit um den Haushalt ist nur vor diesem Hintergrund<br />
zu verstehen. Allein die Tatsache, dass die USA sich<br />
mit <strong>der</strong> „Fiskalklippe“ automatisch drohende Sparmaßnahmen<br />
nach <strong>der</strong> Rasenmäher-Methode verordnet haben, zeigt, dass die<br />
US-Politik starke Zweifel an <strong>der</strong> eigenen Handlungsfähigkeit<br />
hegt. Da sich <strong>der</strong> Kongress 2011 nicht einigen konnte, welche<br />
Steuersenkungen aus <strong>der</strong> Bush-Ära beibehalten werden sollten,<br />
wurde <strong>der</strong> 1. Januar 2013 als Frist gesetzt, nach <strong>der</strong>en Ablauf<br />
<strong>der</strong> Rasenmäher zum Einsatz kommt. Erst am 1. Januar 2013<br />
um 2 Uhr morgens verlängerte <strong>der</strong> US-Senat die Frist.<br />
Keine zehn Monate später brach <strong>der</strong> Streit erneut aus. Und<br />
viel spricht dafür, dass sich das Schauspiel bald wie<strong>der</strong>holt.<br />
Denn <strong>der</strong> Schuldenkompromiss vom 17. Oktober 2013 ist hastig<br />
zusammengezimmert und extrem zerbrechlich. Wie schon<br />
oft in den vergangenen Monaten und Jahren wurden die Kernprobleme<br />
auf die lange Bank geschoben. Immer noch ist unklar,<br />
wie <strong>der</strong> US-Schuldenberg zurückgehen soll, wenn weite Teile<br />
<strong>der</strong> Republikaner Steuererhöhungen strikt ablehnen, gleichzeitig<br />
weite Teile <strong>der</strong> Demokraten Ausgabenkürzungen aber<br />
für unmöglich halten.<br />
Und die nächsten Fristen stehen schon an: Ein Haushaltskompromiss<br />
soll bis Mitte Dezember stehen, dann greifen die<br />
nächsten Schuldengrenzen im Januar und Februar 2014. Die<br />
Saga geht also weiter.<br />
Trotzdem wird es auf keinen Fall zu einem US-Staatsbankrott<br />
kommen. Ein Zahlungsausfall <strong>der</strong> USA hätte so undenkbar<br />
große Auswirkungen, dass niemand in <strong>der</strong> US-Politik dafür<br />
die Verantwortung übernehmen wollte. An den Finanzmärkten<br />
gilt ein solches Horrorszenario ohnehin als ausgeschlossen,<br />
was wie<strong>der</strong>um dazu führt, dass <strong>der</strong> innerparteiliche Druck auf<br />
die Schlüsselfiguren des Haushaltsstreits in Washington nicht<br />
zu groß wird. Hinzu kommt, dass die US-Notenbank Fe<strong>der</strong>al<br />
Reserve immer noch rund vier Milliarden Dollar pro Arbeitstag<br />
in den US-Anleihemarkt pumpt. Von echter Preisbildung<br />
kann da schon lange keine Rede mehr sein. Und die Haushaltskrise<br />
im Oktober hat wahrscheinlich sogar dazu beigetragen,<br />
dass die Fe<strong>der</strong>al Reserve ihre Anleihekäufe noch länger fortsetzt<br />
als ursprünglich erwartet.<br />
Denn auch die Fe<strong>der</strong>al Reserve weiß, dass die Folgen eines<br />
US-Staatsbankrotts für die Weltfinanzmärkte apokalyptisch<br />
wären. Ein Großteil <strong>der</strong> weltweiten Finanzmarkttransaktionen<br />
ist indirekt durch US-Staatsanleihen abgesichert. Diese<br />
Papiere würden im Bankrottfall auf Ramschniveau heruntergestuft<br />
und würden ihren Sicherheitsstatus für immer verlieren.<br />
Die Weltmärkte würden kollabieren. Daran haben we<strong>der</strong><br />
Republikaner noch Demokraten ein Interesse. Und so einigen<br />
sie sich dann doch immer wie<strong>der</strong> in letzter Minute auf eine<br />
Fristverlängerung.<br />
Am Ende bleibt die Hoffnung, dass vor allem die Republikaner<br />
in <strong>der</strong> letzten Episode <strong>der</strong> Haushaltskrise gemerkt haben,<br />
dass sich <strong>der</strong> US-Präsident nicht in politische Geiselhaft<br />
nehmen lässt, weil <strong>der</strong> Staatsbankrott keine Option ist. An<strong>der</strong>erseits<br />
werden gerade die Abgeordneten <strong>der</strong> Tea Party ihre<br />
Nie<strong>der</strong>lage vom Oktober nicht einfach akzeptieren. <strong>Der</strong> politische<br />
Druck auf die Parteispitze <strong>der</strong> Republikaner könnte größer<br />
werden, beson<strong>der</strong>s im Hinblick auf die im kommenden Herbst<br />
anstehenden „Midterm Elections“, bei denen das gesamte Repräsentantenhaus<br />
und ein Drittel des Senats neu gewählt werden.<br />
Die ersten Primaries dafür beginnen im März 2014, kurz<br />
nachdem die nächste Frist im Haushaltsstreit abläuft.<br />
HENRIK ENDERLEIN ist Wirtschaftsprofessor an <strong>der</strong> Hertie<br />
School of Governance in Berlin und ist kürzlich von seiner<br />
Gastprofessur an <strong>der</strong> Kennedy School in Harvard zurückgekehrt<br />
Reclam Bibliothek – schöner lesen<br />
<strong>Der</strong> Beginn einer<br />
neuen Ausgabe<br />
Neuübersetzung auf <strong>der</strong><br />
Grundlage des endgültigen<br />
französischen Texts, mit<br />
Kommentar. Die weiteren<br />
Bände erscheinen halbjärlich.<br />
Marcel Proust:<br />
Auf <strong>der</strong> Suche nach <strong>der</strong><br />
verlorenen Zeit<br />
Band 1: Auf dem Weg zu Swann<br />
Übers. von Bernd-Jürgen Fischer<br />
694 S. · € 29,95<br />
978-3-15-010900-7<br />
»Ein gelungener Auftakt für<br />
ein großes Unternehmen«<br />
Deutschlandradio Kultur<br />
Anzeige<br />
www.reclam.de<br />
Reclam
KAPITAL<br />
Porträt<br />
MEISTER<br />
DES GELDES<br />
Wort, Tat, Tempo. Mario Draghi will den<br />
Euro retten. Um jeden Preis. <strong>Der</strong> Chef <strong>der</strong><br />
Europäischen Zentralbank ist <strong>der</strong> mächtigste<br />
Mann <strong>der</strong> EU. Wer sich ihm in den Weg stellt,<br />
den lässt er einfach stehen<br />
Von TIL KNIPPER und JULIUS MÜLLER-MEININGEN<br />
Um zu verstehen, wie Mario<br />
Draghi tickt, muss man<br />
kein Volkswirt sein, geschweige<br />
denn Bankbilanzen<br />
lesen können. Es reicht<br />
eine Rückblende ins Jahr 2005, jenes<br />
Jahr, in dem Draghi als Gouverneur an<br />
die Spitze <strong>der</strong> Banca d’Italia rückte. Im<br />
Palazzo Koch, dem Sitz <strong>der</strong> italienischen<br />
Notenbank in <strong>der</strong> Via Nazionale in Rom,<br />
stand die Zeit, wie in den unzähligen an<strong>der</strong>en<br />
Adelspalästen <strong>der</strong> Stadt, in denen<br />
sich seit Jahrhun<strong>der</strong>ten nichts verän<strong>der</strong>t.<br />
Mit Draghi zog die Mo<strong>der</strong>ne ein. <strong>Der</strong><br />
Pomp und die Historie des Hauses interessierten<br />
den gebürtigen Römer nie. Sein<br />
Vorgänger hatte einen Kofferträger beschäftigt,<br />
Draghi entband ihn von seinen<br />
Aufgaben und trug seine Aktentasche<br />
selbst. Für sein Büro wählte er<br />
ein schlichtes, mo<strong>der</strong>nes Design, ein<br />
Gemälde mit den Leiden des heiligen<br />
Andreas musste weichen. Gemessen an<br />
<strong>der</strong> Schwerfälligkeit des italienischen<br />
Bankenadels sind solche Maßnahmen<br />
nichts an<strong>der</strong>es als Exorzismus. Aber<br />
Draghi hatte da erst begonnen.<br />
Die größten Verän<strong>der</strong>ungen musste<br />
<strong>der</strong> träge Organismus <strong>der</strong> Notenbank verdauen.<br />
Leitende Mitarbeiter bekamen<br />
Blackberrys, alle Computer erhielten<br />
einen Internetzugang. Noch heute halten<br />
die Mitarbeiter <strong>der</strong> Bank diesen,<br />
schon damals lange überfälligen Schritt<br />
für eine Revolution. Als Draghi für sich<br />
selbst einen Laptop for<strong>der</strong>te, stellte sich<br />
die Technikabteilung quer. Ein tragbarer<br />
Computer, wozu das denn? <strong>Der</strong> Gouverneur<br />
verlor nicht etwa die Fassung. Er rief<br />
seinen Sohn Giacomo an und trug ihm<br />
auf, einen Laptop für Papà zu besorgen.<br />
Typisch Draghi: Er sucht selten die<br />
direkte Konfrontation, son<strong>der</strong>n umgeht<br />
Hin<strong>der</strong>nisse o<strong>der</strong> Kontrahenten,<br />
die sich ihm in den Weg stellen,<br />
lieber. Die an<strong>der</strong>en lässt er<br />
so einfach stehen. „Er ist ein<br />
Meister darin, Mehrheiten zu<br />
organisieren und gleichzeitig<br />
seine Gegner zu isolieren“,<br />
sagt ein Notenbanker, <strong>der</strong><br />
seinen Namen nicht in <strong>der</strong><br />
Zeitung lesen will.<br />
Vor zwei Jahren hat<br />
<strong>der</strong> 66 Jahre alte Draghi<br />
die Nachfolge des Franzosen<br />
Jean-Claude Trichet<br />
als Präsident <strong>der</strong><br />
Europäischen Zentralbank<br />
angetreten.<br />
In <strong>der</strong> Krise um den<br />
Euro ist Draghi zum<br />
96<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
97<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
KAPITAL<br />
Porträt<br />
Chronik<br />
DER WEG DES<br />
MARIO DRAGHI<br />
Istituto Massimo, Rom<br />
Schon als Schüler des elitären<br />
Jesuitengymnasiums<br />
in Rom trat Mario Draghi<br />
auf wie ein Notenbanker:<br />
„Tadellos gekleidet im blauen<br />
Anzug, immer wohlfrisiert“,<br />
erinnert sich sein ehemaliger<br />
Mitschüler, <strong>der</strong> heutige<br />
FerrariPräsident Luca di<br />
Montezemolo, <strong>der</strong> ihm aus<br />
<strong>der</strong> Hinterbank immer die<br />
Haare zerzauste. Draghi<br />
sei „zwar etwas ernst, aber<br />
nie langweilig“ gewesen<br />
und habe ihn immer abschreiben<br />
lassen<br />
„Wenn wir<br />
das Richtige<br />
machen,<br />
kommen wir<br />
raus aus <strong>der</strong><br />
Nummer“<br />
Ministero del Tesoro, Rom<br />
Von 1991 bis 2001 diente<br />
Mario Draghi als Generaldirektor<br />
im italienischen<br />
Finanzministerium neun<br />
Regierungen. Durch die<br />
von ihm vorangetriebene<br />
Privatisierung <strong>der</strong> Italien<br />
AG verhin<strong>der</strong>te er den<br />
Staatsbankrott. Bei den<br />
Verhandlungen des<br />
MaastrichtVertrags leitete<br />
Draghi die italie nische<br />
Delegation und brachte es<br />
fertig, Italien trotz <strong>der</strong><br />
schwachen Lira als<br />
Gründungsmitglied in die<br />
europäische Gemeinschaftswährung<br />
zu führen<br />
mächtigsten Mann Europas aufgestiegen,<br />
das Wirtschaftsmagazin Forbes hat ihn<br />
kürzlich auf Platz 9 <strong>der</strong> einflussreichsten<br />
Menschen <strong>der</strong> Welt gesetzt. Voraussichtlich<br />
ab Ende des kommenden Jahres<br />
übernimmt die EZB im Rahmen <strong>der</strong> Bankenunion<br />
auch noch die Aufsicht über<br />
Europas Großbanken. Draghis Stärke<br />
zeigt zugleich die Schwäche <strong>der</strong> europäischen<br />
Politiker.<br />
Auch bei <strong>der</strong> EZB in Frankfurt ist<br />
mit Draghi die Mo<strong>der</strong>ne eingezogen, in<br />
diesem Fall die geldpolitische. Durch<br />
entschlossenes Auftreten hat er in seiner<br />
noch relativ kurzen Amtszeit bereits<br />
zwei Mal verhin<strong>der</strong>t, dass die Eurozone<br />
auseinan<strong>der</strong>bricht.<br />
ES BEGANN MIT <strong>der</strong> „Dicken Bertha“. So<br />
hieß eigentlich die größte deutsche Kanone<br />
im Ersten Weltkrieg. Aber kurz<br />
nach Draghis Arbeitsbeginn im November<br />
2011 war damit eine Billion Euro<br />
gemeint, die die EZB den europäischen<br />
Banken zur Verfügung stellte, Laufzeit<br />
drei Jahre, Zinssatz 1 Prozent. Die Banken<br />
sollten mit diesem Geld Staatsanleihen<br />
kaufen. Für die Geldhäuser ein lohnendes<br />
Geschäft, da sie die Zinsdifferenz<br />
zwischen dem billigen EZB-Geld und den<br />
Anleihen von Län<strong>der</strong>n wie Spanien und<br />
Italien, die damals an den Märkten 4 bis<br />
5 Prozent Zinsen zahlen mussten, ohne<br />
großes Risiko für sich verbuchen konnten.<br />
Kurzfristig verhin<strong>der</strong>te Draghi damit,<br />
dass die Anleihezinsen dieser Län<strong>der</strong> weiter<br />
in die Höhe schossen und Spanien und<br />
Italien unter den ESM-Rettungsschirm<br />
hätten fliehen müssen, womit dieser Mechanismus<br />
angesichts <strong>der</strong> Größe <strong>der</strong> beiden<br />
Län<strong>der</strong> überfor<strong>der</strong>t gewesen wäre.<br />
Als sich die Zinsspanne zwischen<br />
den Staatsanleihen <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> <strong>der</strong> Eurozone<br />
erneut vergrößerte, unternahm<br />
Draghi im Sommer 2012 seinen bisher<br />
gewagtesten Schritt. Am 26. Juli, einen<br />
Tag vor <strong>der</strong> Eröffnung <strong>der</strong> Olympischen<br />
Spiele in London, brachte er bei<br />
einer Investorenkonferenz in <strong>der</strong> britischen<br />
Hauptstadt die Märkte mit den<br />
inzwischen legendären Worten „whatever<br />
it takes“ zur Räson: Koste es, was<br />
es wolle. Die Botschaft kam an: Wer an<br />
den Finanzmärkten gegen den Euro wettert,<br />
hat Super-Mario als Gegner, <strong>der</strong> als<br />
EZB-Chef über unbegrenzte Geldreserven<br />
verfügt.<br />
Unter dem Namen outright monetary<br />
transaction, o<strong>der</strong> OMT, hat die<br />
EZB Draghis Aussagen kurz darauf präzisiert.<br />
Die Zentralbank verspricht, in<br />
unbegrenzter Menge Staatsanleihen eines<br />
Landes zu kaufen mit einer Laufzeit<br />
von weniger als drei Jahren. Voraussetzung<br />
dafür ist, dass das Land sich an den<br />
ESM-Rettungsfonds wendet und sich dessen<br />
Bedingungen unterwirft: eine rigide<br />
Sparpolitik und harte Strukturreformen.<br />
In Anspruch genommen hat das<br />
OMT-Programm noch kein Staat. Die<br />
bloße Ankündigung Draghis hat die Spekulationen<br />
gegen den Euro beendet und<br />
die Refinanzierungskosten <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> an<br />
den Märkten gesenkt. Anfang November<br />
setzte Draghi geldpolitisch einen drauf,<br />
als er die Leitzinsen <strong>der</strong> Eurozone auf<br />
0,25 Prozent senken ließ, <strong>der</strong> tiefste Wert<br />
seit <strong>der</strong> Gründung <strong>der</strong> EZB 1998.<br />
Während Draghi in Italien bewun<strong>der</strong>t<br />
wird und auch international viel<br />
Lob erhält, steht er in Deutschland immer<br />
wie<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Kritik. Seine profiliertesten<br />
Gegner hierzulande sind <strong>der</strong><br />
Ökonom Hans-Werner Sinn, Chef des<br />
Ifo-Instituts in München, <strong>der</strong> ehemalige<br />
EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark und<br />
Bundesbankchef Jens Weidmann. Im Rat<br />
<strong>der</strong> Europäischen Zentralbank stimmte<br />
Weidmann gegen die Dicke Bertha, gegen<br />
das OMT-Programm und auch gegen<br />
die jüngste Zinssenkung. Seine Worte<br />
finden hierzulande viel Gehör.<br />
Sinn, Stark und Weidmann argumentieren<br />
eher juristisch als ökonomisch,<br />
wenn sie sich um die Unabhängigkeit<br />
<strong>der</strong> Zentralbank sorgen und<br />
Draghi Verstöße gegen die europäischen<br />
Verträge vorwerfen. Unabhängig ist in<br />
den Augen dieser Ökonomen aber ohnehin<br />
immer nur <strong>der</strong>jenige, <strong>der</strong> ihre Meinung<br />
teilt. Am Telefon holt Jürgen Stark<br />
tief Luft, um dann in einem Kurzreferat<br />
zu erklären, warum die Maßnahmen<br />
<strong>der</strong> EZB unter Draghi und Trichet gegen<br />
den Maastrichter Vertrag verstoßen<br />
und Draghi mit seinen außergewöhnlichen<br />
Maßnahmen das Mandat <strong>der</strong> Zentralbank<br />
bereits weit überdehnt hat. OMT<br />
steht bei Stark daher für „outside the<br />
mandate transactions“, weil sie gegen<br />
das Verbot <strong>der</strong> Vergemeinschaftung <strong>der</strong><br />
Haftung für Staatsschulden und gegen<br />
die direkte Staatsfinanzierung durch die<br />
Zentralbank verstießen.<br />
Fotos: Olaf Blecker (Seite 97), Antonio Scattolon/A3/Contrasto/laif<br />
98<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Verstehen, worüber an<strong>der</strong>e nur schreiben.<br />
Mit Deutschlands führendem Wirtschaftsmagazin.
KAPITAL<br />
Porträt<br />
Goldman Sachs, London<br />
2002 ging Draghi als<br />
Managing Director nach<br />
London ausge rechnet<br />
zu Goldman Sachs, <strong>der</strong><br />
USInvestmentbank,<br />
die Griechenland bei <strong>der</strong><br />
Verschleierung ihrer<br />
Staats schulden geholfen<br />
haben soll. Nach eigenen<br />
Angaben hat Draghi in<br />
seiner Zeit bei Goldman<br />
keinen „einzigen Deal<br />
mit Regierungen gemacht“<br />
und auch keine Kenntnis<br />
von den Transaktionen<br />
mit <strong>der</strong> Regie rung in<br />
Athen gehabt<br />
Sinn und Stark reden gerne darüber,<br />
was Draghi und die EZB alles nicht machen<br />
dürfen. Auf Nachfrage, wie ihre Lösungsvorschläge<br />
für die Krise aussehen,<br />
plädieren sie mehr o<strong>der</strong> weniger offen<br />
für den Austritt einiger Krisenstaaten<br />
aus <strong>der</strong> gemeinsamen Währung. Welche<br />
Konsequenzen sich daraus für das<br />
weltweite Finanzsystem ergäben, können<br />
sie auch nicht voraussagen. Hauptsache,<br />
die einmal aufgestellten Regeln<br />
werden in <strong>der</strong> engstmöglichen Auslegung<br />
eingehalten. Sinn scheint fast zu<br />
hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht,<br />
das sein Urteil zur EZB vermutlich<br />
Anfang 2014 treffen wird, Draghis Politik<br />
des billigen Geldes für verfassungswidrig<br />
erklären wird.<br />
Weidmann ist ein Befürworter <strong>der</strong><br />
Sparpolitik von Bundeskanzlerin Angela<br />
Merkel, <strong>der</strong>en wirtschaftspolitischer Berater<br />
er bis zu seinem Wechsel zur Bundesbank<br />
war. Dass diese Politik die Krisenlän<strong>der</strong><br />
wirtschaftlich noch mehr zu<br />
schwächen droht, scheint ihn nicht zu<br />
stören, solange sich die EZB auf die Einhaltung<br />
<strong>der</strong> Preisstabilität konzentriert.<br />
Weidmann lässt sich in Interviews gerne<br />
mit Aussagen wie dieser zitieren: „Ich<br />
möchte, dass in Europa öffentlich und<br />
konkret darüber diskutiert wird, zu welchem<br />
Maß an wirtschaftspolitischer Integration<br />
wir bereit sind.“<br />
Er möchte lieber diskutieren statt<br />
handeln. Das ist <strong>der</strong> größte Unterschied<br />
zwischen Draghi und Weidmann. Während<br />
<strong>der</strong> Deutsche noch zur Diskussion<br />
einlädt, hat <strong>der</strong> Italiener bereits eine<br />
Mehrheit für seinen Vorschlag organisiert.<br />
Draghis Credo lautet: „Das größte<br />
Risiko in Krisenzeiten ist nicht das Handeln,<br />
son<strong>der</strong>n das Nichthandeln.“<br />
Er hat diese Lektion auf die denkbar<br />
härteste Weise lernen müssen. Draghis<br />
Vater starb, als Mario 15 Jahre alt war,<br />
seine Mutter wenige Jahre später. So<br />
wurde er zum Familienvorstand für<br />
sich und seine Geschwister. Das Geld,<br />
„Ich weiß, was<br />
Inflation ist.<br />
Ich weiß, was<br />
sie anrichten<br />
kann“<br />
Banca d’Italia, Rom<br />
Die Zeit wirkt wie stehen<br />
geblieben im Palazzo Koch,<br />
dem Sitz <strong>der</strong> italienischen<br />
Zentralbank. Die aus weißem<br />
Travertin gemeißelte<br />
Ehrentreppe, ausgelegt mit<br />
rotem Teppich, signalisiert<br />
jedem Besucher: „Du bist<br />
klein, die Bank ist groß.“<br />
Als italienischer Zentralbankchef<br />
( 2005 bis 2011 )<br />
interessierte sich Mario<br />
Draghi nicht für den Pomp<br />
des alten Adelspalasts mit<br />
den antiken Scherben und<br />
den flämischen Wandteppichen.<br />
Er benutzte immer<br />
den schnellsten Weg in sein<br />
Büro vom Hof direkt in<br />
den Direktorentrakt<br />
Fotos: Jiri Rezac/VISUM, IMAGO<br />
100<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
das ihnen die Eltern hinterlassen hatten,<br />
legte ein Vormund in italienischen<br />
Staats papieren in Lira an. Die grassierende<br />
Inflation in Italien in den siebziger<br />
Jahren mit Teuerungsraten von 15 Prozent<br />
fraß fast das Erbe auf. Draghi, <strong>der</strong><br />
damals bereits Wirtschaftswissenschaften<br />
an <strong>der</strong> La Sapienza in Rom studierte,<br />
musste tatenlos zusehen, da <strong>der</strong> Vater<br />
verfügt hatte, dass sie das Geld erst mit<br />
<strong>der</strong> Volljährigkeit <strong>der</strong> jüngsten Schwester<br />
erhielten.<br />
Draghi weiß aus eigener Erfahrung,<br />
wie sich Inflation anfühlt. Als Meister<br />
<strong>der</strong> subtilen Kommunikation hat er<br />
diese Episode aus seinem Leben weiterverbreitet.<br />
Insofern ist es fast beleidigend,<br />
dass Draghi vorgeworfen wird, die EZB<br />
schüre mit <strong>der</strong> jüngsten Zinssenkung die<br />
Inflation in <strong>der</strong> Eurozone.<br />
Dabei ist das Gegenteil <strong>der</strong> Fall. Die<br />
Preissteigerung in <strong>der</strong> Eurozone ist so gering,<br />
dass Experten eher Angst vor einer<br />
Deflation haben. Wenn die Preise<br />
sinken, steigen die Sparguthaben im<br />
Wert, was zu einer Abwärtsspirale für<br />
die Konjunktur führen kann, weil keiner<br />
mehr Geld ausgeben will. Die Zinssenkung<br />
soll dem entgegenwirken, weil<br />
in einer Deflation auch die Schulden<br />
real ansteigen. Für Krisenlän<strong>der</strong> wird<br />
es noch schwieriger, ihre Schulden zu<br />
bedienen. Wenn aber durch niedrigere<br />
Zinsen mehr Euro auf den Markt kommen<br />
und <strong>der</strong> Kurs dadurch sinkt, ist das<br />
für die Zentralbank ein willkommener<br />
Nebeneffekt: Die Wettbewerbsfähigkeit<br />
<strong>der</strong> Schuldenlän<strong>der</strong> verbessert sich zumindest<br />
kurzfristig.<br />
BERLINER POLITIKER halten sich mit<br />
Aussagen über Draghi immer mit dem<br />
Hinweis auf die Unabhängigkeit <strong>der</strong><br />
Notenbank zurück. Zu den wenigen<br />
Ausnahmen gehört <strong>der</strong> haushaltspolitische<br />
Sprecher <strong>der</strong> Unionsfraktion Norbert<br />
Barthle, <strong>der</strong> seit Draghis Rede im<br />
Bundestag im Oktober 2012 ein Fan des<br />
EZB-Chefs ist. Er nennt ihn nur noch<br />
„den preußischsten aller Italiener“.<br />
Das wichtigste Argument von<br />
Draghis Kritikern ist <strong>der</strong> Reformdruck<br />
auf die schwächelnden Staaten: Wenn<br />
sie sicher sein können, dass die Notenbank<br />
eh einspringt, können sie es mit<br />
den Verän<strong>der</strong>ungen langsam angehen<br />
lassen. In die Debatte hat sich kürzlich<br />
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> finden Sie auch<br />
in diesen exklusiven Hotels<br />
© Christian Gahl<br />
The Mandala Hotel<br />
Potsdamer Straße 3, 10785 Berlin<br />
Tel.: +49(0)30 590 05 00 00,<br />
www.themandala.de<br />
»Wir wollen unsere Mitmenschen begeistern und faszinieren,<br />
Gäste wie Mitarbeiter. Eine Beherbergungskultur<br />
mit konsequenter Orientierung an den individuellen Gastbedürfnissen<br />
und jenseits <strong>der</strong> Massenkonfektion großer<br />
Hotelketten. Das ist das The Mandala Hotel.«<br />
CHRISTIAN ANDRESEN,<br />
GESCHÄFTSFÜHRER THE MANDALA HOTEL<br />
Diese ausgewählten Hotels bieten <strong>Cicero</strong> als beson<strong>der</strong>en Service:<br />
Möchten auch Sie zu diesem<br />
exklusiven Kreis gehören?<br />
Bitte sprechen Sie uns an:<br />
E-Mail: hotelservice@cicero.de<br />
<strong>Cicero</strong>-<br />
Hotel<br />
Bad Doberan – Heiligendamm: Grand Hotel Heiligendamm · Bad Pyrmont: Steigenberger Hotel<br />
Baden-Baden: Brenners Park-Hotel & Spa · Baiersbronn: Hotel Traube Tonbach · Bergisch Gladbach:<br />
Grandhotel Schloss Bensberg, Schlosshotel Lerbach · Berlin: Hotel Concorde, Brandenburger Hof,<br />
Grand Hotel Esplanade, InterContinental Berlin, Kempinski Hotel Bristol, Hotel Maritim, The Mandala<br />
Hotel, The Mandala Suites, Savoy Berlin, The Regent Berlin, The Ritz-Carlton Hotel · Binz/Rügen:<br />
Cerês Hotel · Dresden: Hotel Taschenbergpalais Kempinski · Celle: Fürstenhof Celle · Düsseldorf:<br />
InterContinental Düsseldorf, Hotel Nikko · Eisenach: Hotel auf <strong>der</strong> Wartburg · Ettlingen: Hotel-Restaurant<br />
Erbprinz · Frankfurt a. M.: Steigenberger Frankfurter Hof, Kempinski Hotel Gravenbruch · Hamburg:<br />
Crowne Plaza Hamburg, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hotel Atlantic Kempinski, Madison<br />
Hotel Hamburg, Panorama Harburg, Renaissance Hamburg Hotel, Strandhotel Blankenese · Hannover:<br />
Crowne Plaza Hannover · Hinterzarten: Parkhotel Adler · Keitum/Sylt: Hotel Benen-Diken-Hof Köln:<br />
Excelsior Hotel Ernst · Königstein im Taunus: Falkenstein Grand Kempinski, Villa Rothschild Kempinski<br />
· Königswinter: Steigenberger Grand Hotel Petersberg · Konstanz: Steigenberger Inselhotel<br />
Magdeburg: Herrenkrug Parkhotel, Hotel Ratswaage · Mainz: Atrium Hotel Mainz, Hyatt Regency<br />
Mainz · München: King’s Hotel First Class, Le Méridien, Hotel München Palace · Neuhardenberg: Hotel<br />
Schloss Neuhardenberg · Nürnberg: Le Méridien · Rottach-Egern: Park-Hotel Egerner Höfe, Hotel<br />
Bachmair am See, Seehotel Überfahrt · Stuttgart: Hotel am Schlossgarten, Le Méridien · Wiesbaden:<br />
Nassauer Hof · ITALIEN Tirol bei Meran: Hotel Castel · ÖSTERREICH Wien: Das Triest · SCHWEIZ<br />
Interlaken: Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa · Lugano: Splendide Royale · Luzern: Palace Luzern<br />
St. Moritz: Kulm Hotel, Suvretta House · Weggis: Post Hotel Weggis · Zermatt: Boutique Hotel Alex
KAPITAL<br />
Porträt<br />
Europäische Zentralbank,<br />
Frankfurt<br />
Seit zwei Jahren steht<br />
Mario Draghi jetzt an <strong>der</strong><br />
Spitze <strong>der</strong> EZB. In <strong>der</strong> Krise<br />
<strong>der</strong> Währungsunion ist<br />
<strong>der</strong> Italiener zum wichtigsten<br />
Wirtschaftspolitiker<br />
Europas aufgestiegen.<br />
Durch die Einrichtung <strong>der</strong><br />
gemeinsamen europäischen<br />
Bankenaufsicht bei<br />
<strong>der</strong> EZB in Frankfurt erhält<br />
Draghi in den kommenden<br />
Jahren noch mehr Verantwortung.<br />
Seine achtjährige<br />
Amtszeit endet 2019<br />
„Wenn du<br />
überzeugt bist,<br />
dass etwas<br />
getan werden<br />
muss, musst<br />
du es tun“<br />
Lancaster House, London<br />
<strong>Der</strong> 26. Juli 2012 könnte<br />
einmal als Wendepunkt <strong>der</strong><br />
Eurokrise in die Geschichte<br />
eingehen. Bei einer<br />
Investorenkonferenz im<br />
feudalen Lancaster House<br />
in London überraschte<br />
Mario Draghi seine Zuhörer<br />
mit <strong>der</strong> mutigsten Aussage<br />
seiner Karriere: „Innerhalb<br />
unseres Mandats ist die<br />
EZB bereit, alles Notwendige<br />
zu tun, um den Euro<br />
zu erhalten“, sagte er und<br />
fügte nach einer effektvollen<br />
Pause hinzu, „und<br />
glauben Sie mir, es wird<br />
genug sein“<br />
Draghis Doktorvater, <strong>der</strong> Wirtschaftsnobelpreisträger<br />
Robert Solow, eingemischt:<br />
„Natürlich braucht Europa Reformen.<br />
Das gilt für die Staaten des Südens,<br />
aber auch für Deutschland. Aber es kann<br />
doch nicht sein, dass die Notenbanker die<br />
Wirtschaft wissentlich in eine Depression<br />
stürzen, nur damit die Politik zum Handeln<br />
gezwungen wird“, sagte er in einem<br />
Interview mit <strong>der</strong> Zeit. Er wünsche sich,<br />
dass Draghi sich weiter so gegen den Abschwung<br />
stemmt. „Es ging uns nie um<br />
die reine Lehre, son<strong>der</strong>n immer auch um<br />
die praktische Anwendung“, sagt Solow.<br />
Draghi ist ein gelehriger Schüler.<br />
„Wenn du überzeugt bist, dass etwas getan<br />
werden muss, musst du es tun“, sagt<br />
er, nur dann sei er mit seinem Gewissen<br />
im Reinen.<br />
Auch mit drohenden Staatspleiten<br />
hat Draghi Erfahrungen gesammelt in<br />
seiner Zeit als Generaldirektor des italienischen<br />
Finanzministeriums in den<br />
Neunzigern. „Wir waren nur Millimeter<br />
vom Abgrund entfernt“, erinnert sich<br />
sein Freund Francesco Giavazzi, Professor<br />
für Ökonomie am MIT in Boston. Er<br />
arbeitete damals gemeinsam mit Draghi<br />
im Finanzministerium. „Mario bleibt<br />
extrem cool in Situationen, in denen<br />
normale Leute längst durchdrehen. Er<br />
sagt dann immer: ‚Wenn wir das Richtige<br />
machen, kommen wir raus aus <strong>der</strong><br />
Nummer.‘ Ich konnte in <strong>der</strong> Zeit nachts<br />
kein Auge zumachen, während Mario<br />
jeden Morgen bestens erholt ins Ministerium<br />
kam.“<br />
Draghi sagt selbst oft, dass die EZB<br />
alleine die Krise nicht beenden, son<strong>der</strong>n<br />
nur Zeit für Reformen kaufen kann. Er<br />
hat immer betont, dass er nur ein Diener<br />
des Staates sei. Im aufgedrehten Palazzo,<br />
wie das politisch-wirtschaftliche Machtsystem<br />
in Rom genannt wird, macht ihn<br />
dies zu einem Fremdkörper – aber zu einem<br />
mit hohem Ansehen. Seit seiner Zeit<br />
im Finanzministerium gibt es in <strong>der</strong> italienischen<br />
Politik kaum einen, <strong>der</strong> einen<br />
so tadellosen Ruf genießt: „Wenn Mario<br />
Monti ein Katholik ist, dann ist Mario<br />
Draghi im Vergleich dazu <strong>der</strong> Papst“, sagt<br />
einer, <strong>der</strong> mit beiden gut befreundet ist.<br />
Durch seine exponierte Stellung als<br />
EZB-Präsident während <strong>der</strong> schlimmsten<br />
Krise <strong>der</strong> Währungsunion wird Draghi<br />
inzwischen überall erkannt. Er erträgt es<br />
mit seinem stoischen Gesichtsausdruck,<br />
hinter dem er auch bei zähen Sitzungen<br />
allergrößte Langeweile verbergen kann.<br />
Er ist kein typischer Römer. Sein fast britisches<br />
Un<strong>der</strong>statement lädt selten zum<br />
in Rom beinahe obligatorischen Schwatz<br />
ein. Zu Hause im Parioli-Viertel im Norden<br />
<strong>der</strong> Stadt geht er am liebsten in die<br />
Trattoria „Ambasciata d’Abruzzo“. Meist<br />
isst er allein, setzt sich an einen abgelegenen<br />
Tisch. Er will kein Aufsehen. <strong>Der</strong><br />
Wirt Roberto Poggi serviert ihm ohne zu<br />
fragen abbacchio al forno, Lammbraten<br />
mit Kartoffeln, eine römische Spezialität<br />
und Draghis Leibgericht.<br />
IN DER NACHBARSCHAFT IN ROM kennt<br />
ihn je<strong>der</strong>. Niemand verliert ein schlechtes<br />
Wort über ihn. Die Einzelhändler gegenüber<br />
haben zwar leichte Umsatzeinbußen<br />
hinnehmen müssen, weil Carabinieri aus<br />
Sicherheitsgründen immer einige Parkplätze<br />
vor dem Haus <strong>der</strong> Draghis absperren<br />
müssen, sodass die Kunden <strong>der</strong> Bar,<br />
des Tabakladens und des Maßschnei<strong>der</strong>s<br />
nicht mehr anhalten können. „Aber er<br />
will dieses Chaos ja auch nicht“, sagt <strong>der</strong><br />
Schnei<strong>der</strong>. Draghi ist gar nicht mehr so<br />
häufig in Rom, da seine Tochter Fe<strong>der</strong>ica<br />
mit den zwei Enkeln in Mailand lebt, sodass<br />
er und seine Frau Serena zwischen<br />
Frankfurt, Rom und Mailand pendeln.<br />
In <strong>der</strong> Banca d’Italia weisen noch<br />
eine Plakette und ein Ölgemälde im vornehmen<br />
Rosa Salon auf sein Wirken hin.<br />
Auf dem Bild ist Draghi akkurat gescheitelt<br />
wie immer. Im Gesicht hat er viele<br />
Falten, als habe <strong>der</strong> Künstler geahnt,<br />
dass Draghis Aufgabe in Frankfurt noch<br />
anstrengen<strong>der</strong> wird. Wie immer trägt er<br />
einen dunklen Anzug, das Hemd ist weiß<br />
ohne Manschettenknöpfe. Seine Hand<br />
ruht auf einem Stapel Bücher, auf einem<br />
Tisch liegen drei Murmeln. Symbole für<br />
die Weisheit eines Mannes, <strong>der</strong> viel ins<br />
Rollen gebracht hat und an<strong>der</strong>s ist als die<br />
üblichen Krakeeler des öffentlichen Lebens<br />
in Italien? Wenn er in sechs Jahren<br />
zum Ende seiner Amtszeit so alt ist, wie<br />
er jetzt schon auf dem Bild aussieht, hat<br />
er immer noch Zeit, als Staatspräsident<br />
die italienische Politik zu reformieren.<br />
Bei den Recherchen von JULIUS MÜLLER-<br />
MEININGEN in Italien und TIL KNIPPER<br />
in Deutschland gab es eine gemeinsame<br />
Erkenntnis: Draghi mag nicht <strong>der</strong> größte<br />
Charismatiker sein, aber in seinem Umfeld<br />
kann er fast jeden für sich gewinnen<br />
Foto: Action Press<br />
102<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
STIL<br />
„ Oft habe ich mich<br />
gefragt, warum Weinläden<br />
ihr Angebot nicht nach<br />
Wirkung auffächern,<br />
son<strong>der</strong>n nach Rebsorten<br />
und Regionen. Warum<br />
berät einen niemand<br />
bezüglich <strong>der</strong> vielen<br />
grundverschiedenen Arten<br />
<strong>der</strong> Trunkenheit? “<br />
<strong>Cicero</strong>-Autorin Lena Bergmann über<br />
ihre persönliche Art des Weingenießens, Seite 106<br />
103<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
STIL<br />
Interview<br />
„ES MUSS JA NICHT ÖDE SEIN“<br />
Was können wir von Vampiren über das Leben lernen? Die Schauspielerin Tilda Swinton<br />
über ihre Rolle als kunstbeflissene Blutsaugerin in Jim Jarmuschs neuem Film<br />
Foto: VELTMAN/NYT/Redux/laif<br />
Frau Swinton, „Only Lovers Left Alive“<br />
ist ein Vampirfilm mit sehr schönen<br />
Bil<strong>der</strong>n, was auch daran liegt, dass<br />
das von Ihnen und Tom Hiddleston gespielte<br />
Vampirpaar einen seit Jahrhun<strong>der</strong>ten<br />
verfeinerten Lebensstil pflegt.<br />
Sie räkeln sich auf Samtsofas, komponieren<br />
Musik, sammeln alte Vinylplatten,<br />
schätzen gute Literatur. Sind die<br />
beiden gelangweilte Bohemiens?<br />
Tilda Swinton: Adam und Eve langweilen<br />
sich eben nicht. Sie füllen ihr Dasein<br />
mit Kunst und mit schönen Dingen.<br />
Das ist ihre Rettung, da die Kunst wie die<br />
beiden unsterblich ist. Doch trotz ihrer<br />
Kultiviertheit ernähren sie sich von Blut<br />
und vertragen nur die Dunkelheit. Allerdings<br />
töten sie nicht und trinken unverseuchte<br />
Blutreserven aus langstieligen<br />
Kristallgläsern. Die Vampire, die wir bislang<br />
kannten, wirkten doch immer so, als<br />
hätten sie nichts zu tun, waren völlig ihrem<br />
barbarischen Tötungsinstinkt unterworfen.<br />
Sie hatten keinerlei Interessen<br />
o<strong>der</strong> Talente, was für ein ödes Dasein!<br />
Was reizt Sie noch an Ihrer Filmfigur?<br />
<strong>Der</strong> Weitblick, den Eve hat. Sie hat<br />
die Inquisition, Cholera, Pest und alle<br />
Weltkriege überlebt. Sie kann damit umgehen,<br />
dass das Dasein aus Höhen und<br />
Tiefen besteht. Das hat sie auch ihrem Lebenspartner<br />
voraus, <strong>der</strong> viel später zum<br />
Vampir wurde. Adam will sich zu Beginn<br />
des Filmes mal wie<strong>der</strong> das Leben nehmen,<br />
weil er die Gegenwart nicht mehr<br />
ertragen kann. Eve ist seine Retterin, immer<br />
wie<strong>der</strong>. Sie ist sehr emanzipiert.<br />
Es geht auch um die romantische Vorstellung<br />
<strong>der</strong> ewigen Liebe. Adam und<br />
Eve sind schon seit Jahrhun<strong>der</strong>ten ein<br />
Liebespaar …<br />
… und wie im richtigen Leben ist<br />
es für die beiden ein ständiger Kampf –<br />
irgendwann fühlt es sich immer an<br />
wie eine Ewigkeit und man droht zu<br />
ersticken. Man muss eine tiefe Verbindung<br />
pflegen, um nicht depressiv auf<br />
dem Sofa zu enden. Beson<strong>der</strong>s als Vampir.<br />
Und je<strong>der</strong> muss sein Leben mit Inhalten<br />
füllen. Adam und Eve leben deswegen<br />
auch nicht immer am gleichen Ort,<br />
aber sie telefonieren miteinan<strong>der</strong>. Er mit<br />
einem Gerät aus den Siebzigern, sie mit<br />
dem neuesten iPhone.<br />
Adam hat sich in einer Villa im morbiden<br />
Detroit verschanzt, die ätherische Eve<br />
lebt in Tanger. Es gibt eine Szene, in <strong>der</strong><br />
sie nachts durch die Kasbah von Tanger<br />
läuft und trotzdem von allen angestarrt<br />
wird, weil sie so an<strong>der</strong>s aussieht.<br />
Das kennen Sie sicher auch.<br />
Nicht auf diese Art, nein. Ich bin<br />
ziemlich gut darin, unsichtbar zu sein.<br />
Wenn ich in meinem Dorf in Schottland<br />
unterwegs bin, sorgt das für null Aufsehen,<br />
weil wir uns alle seit Ewigkeiten<br />
kennen.<br />
Anfang des Jahres traten Sie zusammen<br />
mit David Bowie im Video zu seinem<br />
Song „The Stars (Are Out Tonight)“<br />
als alterndes Ehepaar auf, dem durch<br />
den Einzug junger Musiker in <strong>der</strong> Nachbarschaft<br />
das eigene Älterwerden<br />
schmerzlich vor Augen geführt wird.<br />
Schön, dass Sie die Verbindung sehen.<br />
Auch da geht es um die Unvergänglichkeit<br />
von Kunst. Er singt „stars are<br />
never sleeping, the dead ones and the<br />
living“.<br />
David Bowies Comeback in diesem Jahr<br />
kam überraschend. Wussten Sie davon?<br />
Nun, auch Stars hören ja nicht auf zu<br />
leben, nur weil man eine Weile nichts von<br />
ihnen hört. Ich kenne David seit Jahren,<br />
und ich wusste, dass er an einem neuen<br />
Album arbeitet. Aber ich bin eine große<br />
Verfechterin von Geheimnissen. Es ist ein<br />
großer Luxus, ein Kunstwerk so unerwartet<br />
auf die Welt kommen zu lassen.<br />
<strong>Der</strong> Film beginnt mit einer Einstellung,<br />
in <strong>der</strong> die Kamera Sie dabei beobachtet,<br />
wie Sie friedlich schlummern, ein<br />
fast außerirdisch wirkendes Wesen mit<br />
langen Haaren. Das erinnert an Ihre<br />
eigene Kunstperformance „The Maybe“<br />
im New Yorker Museum of Mo<strong>der</strong>n Arts,<br />
wo die Besucher Ihnen beim Schlaf in einer<br />
Glasvitrine zuschauen konnten.<br />
Im Film wird viel geschlafen. Und<br />
viel getanzt. Beides habe ich als Performances<br />
getan. Ich kann gar nicht sagen,<br />
woher diese Gleichzeitigkeit kommt.<br />
Aber natürlich kreist man als Künstler<br />
immer wie<strong>der</strong> um die gleichen Themen.<br />
Was hatte es mit dieser Schlaf-Installation<br />
auf sich?<br />
Ein Teil dieser Performance war,<br />
keine Erklärung o<strong>der</strong> Interpretation<br />
abzugeben. Ich habe sie erstmals vor<br />
18 Jahren in London aufgeführt, ein Jahr<br />
später in Rom. Das Moma hatte mich bereits<br />
vor einiger Zeit eingeladen, aber ich<br />
wusste nicht genau, wie ich das Stück<br />
adap tieren sollte. Bis mir klar wurde,<br />
dass es für genau diesen Zeitpunkt, diese<br />
Stadt und dieses Museum nur funktioniert,<br />
wenn ich ohne Ankündigung und<br />
ohne Statement auftauche, rein zufällig.<br />
Und genauso überraschend verschwand<br />
ich auch wie<strong>der</strong>.<br />
Sie sind in so vielen Bereichen tätig, bleibt<br />
man da als Künstlerin glaubwürdig?<br />
Wahrscheinlich liegt es daran, dass<br />
ich aus <strong>der</strong> Kunst komme, durch meine<br />
Arbeit mit dem Künstler und Filmemacher<br />
<strong>Der</strong>ek Jarman in den achtziger Jahren,<br />
das sind meine Wurzeln. Ich bin kein<br />
Filmstar, <strong>der</strong> mal was mit Kunst machen<br />
will. Wenn ich experimentiere, drehe ich<br />
einen Blockbusterfilm, das ist für mich<br />
die große Ausnahme.<br />
Das Gespräch führte<br />
THOMAS ABELTSHAUSER<br />
105<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
STIL<br />
Weinprobe<br />
WEISSE<br />
WEIHNACHT<br />
Von LENA BERGMANN<br />
Die kalte Jahreszeit verlangt Ohrensessel-Weine,<br />
gehaltvoll, komplex, ausdauernd – und rot.<br />
Unsere Autorin än<strong>der</strong>t ihre Strategie:<br />
Sie überwintert diesmal mit Weißwein<br />
106<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Illustration: Lisa Schweizer<br />
<strong>Der</strong> Rotwein gehört zum<br />
Winter wie <strong>der</strong> Rauschebart<br />
zum Weihnachtsmann,<br />
lehrt das deutsche Bildungsbürgerbrauchtum.<br />
In dieser<br />
Hinsicht war auch ich konservativ. Von<br />
<strong>der</strong> Ankunft <strong>der</strong> ersten Flocken bis zu<br />
jener <strong>der</strong> ersten Knospen sah man mich<br />
in vergangenen Jahren nach 17 Uhr nur<br />
selten ohne einen großen Kelch in <strong>der</strong><br />
Hand. Das Rot darin meist mit Tendenz<br />
zur Tinte – denn ich liebe meine Weine<br />
effektiv: Nach zwei Gläsern sollten sie<br />
mich mit <strong>der</strong> Welt versöhnt haben. Das<br />
heißt: Ich sollte einen Zustand erreicht<br />
haben, den ich „die angenehme Grunddichte“<br />
nenne. Und dann ab ins Bett.<br />
In diesem Jahr ist alles an<strong>der</strong>s. Es<br />
begann an einem nasskalten Oktobertag.<br />
Nach <strong>der</strong> Arbeit lenkte sich mein<br />
Auto wie automatisch zu einem guten<br />
Berliner Weinladen, wo ich mich vor<br />
dem Regal mit Cabernet Sauvignon aus<br />
Kalifornien wie<strong>der</strong>fand. Wahrscheinlich<br />
deshalb, da ich aus finanzieller Vernunft<br />
gerade eine Einladung meiner Schwägerin<br />
ins Napa Valley ausgeschlagen<br />
hatte. Die Arbeit getan, die Hauptstadt<br />
grau, <strong>der</strong> Mann verreist: Eiche, mindestens<br />
14,5 Prozent, dachte ich mir. Da entdeckte<br />
ich das Etikett auf einer Flasche<br />
Chardonnay von Lewis Cellars, rund, ein<br />
schwarzes „L“ mit festlichen Serifen auf<br />
goldenem Untergrund.<br />
Sofort war ich in Gedanken bei einem<br />
an<strong>der</strong>en regnerischen Abend. Mein<br />
Mann und ich, noch kin<strong>der</strong>los und frei.<br />
Ein Wolkenbruch hatte uns in einem Fischerdörfchen<br />
in Neuengland Zuflucht in<br />
<strong>der</strong> Bar eines kleinen Hotels suchen lassen.<br />
Zum Wetter empfahl uns <strong>der</strong> Kellner<br />
eben diesen Lewis, <strong>der</strong> uns schon nach<br />
wenigen Schlucken tief in die Sessel am<br />
Kamin massierte. Mit seiner öligen Textur<br />
unsere Kehlen streichelnd, verlangsamte<br />
<strong>der</strong> Wein unser Gespräch, was wir<br />
als sehr angenehm empfanden.<br />
Für mich war dieser Chardonnay ein<br />
Schlüsselerlebnis. So glücklich hatten mich<br />
bisher sehr beson<strong>der</strong>e Rotweine gemacht.<br />
Da war sie, meine angenehme Grunddichte,<br />
diesmal kam sie in tiefem Gold.<br />
Dazu diese spezifische Geschmacksnote,<br />
die ich heute als jene von im Eichenfass<br />
ausgebauten Chardonnays kenne. Kein<br />
an<strong>der</strong>er Weißwein schmeckt ähnlich.<br />
So verließ ich den Weinladen an<br />
diesem Tag nicht mit einem Cabernet,<br />
son<strong>der</strong>n mit einer Kiste Chardonnay<br />
von Lewis – für <strong>der</strong>en Preis ich mir allerdings<br />
auch fast ein Ticket nach Kalifornien<br />
hätte leisten können. In diesem<br />
Winter, so beschloss ich, würden mich<br />
nur die Weißen wärmen – zum Nikolaus,<br />
an den Adventssonntagen und unterm<br />
Weihnachtsbaum.<br />
Oft habe ich mich gefragt, warum<br />
Weinläden ihr Angebot nicht nach Wirkung<br />
auffächern, son<strong>der</strong>n nach Rebsorten<br />
und Regionen. Warum berät einen<br />
niemand bezüglich <strong>der</strong> vielen grundverschiedenen<br />
Arten <strong>der</strong> Trunkenheit, die<br />
sich durch den Konsum von Wein erzielen<br />
lassen? Warum regelt man das nicht<br />
wie in <strong>der</strong> nie<strong>der</strong>ländischen Cannabis-Industrie?<br />
Wer schon einmal in Amsterdam<br />
Marihuana gekauft hat, dem ist sicher angenehm<br />
aufgefallen, dass die Menükarten<br />
<strong>der</strong> Coffeeshops ihr Sortiment nach Effekt<br />
aufschlüsseln: „Sanftes, fröhlich stimulierendes<br />
High“. „Ebenso wunschlos<br />
wie reglos“. „Euphorisierendes, kommunikatives<br />
High“. Diesen Service wünsche<br />
ich mir auch vom deutschen Weinhandel.<br />
Es sollte Standard werden, dass man<br />
als Kunde sagen kann: Lieber Weinhändler,<br />
ich brauche mal einen Expertenrat.<br />
107<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
STIL<br />
Weinprobe<br />
Kommunizieren will ich heute nach Feierabend<br />
nicht mehr, dafür mein Buch zu<br />
Ende lesen, etwa 70 Seiten Richard Yates.<br />
Ich will mit meinem Mobiliar eins werden.<br />
Dabei soll <strong>der</strong> Wein geschmacklich<br />
nicht stehen bleiben. Ich darf morgen keinen<br />
Kater haben. Nach zwei großen Gläsern<br />
will ich in mein Bett. Mit <strong>der</strong> angenehmen<br />
Grunddichte. Verstehen Sie?<br />
Bei meinem Bekannten Guido Walter,<br />
Weinhändler in München, stößt mein<br />
Anliegen sofort auf Verständnis. Lei<strong>der</strong><br />
hat er seine Idee, ein Buch über unterschiedliche<br />
Wirkungsgrade von Alkohol<br />
zu schreiben, verworfen. Aber er berät<br />
mich am Telefon: „Du willst also keinen<br />
Sprinter.“ Ein Sprinter, erklärt er mir,<br />
ist ein typischer Vernissage-Wein. „Einer,<br />
<strong>der</strong> gleich da ist. Und dann kommt<br />
auch geschmacklich nicht mehr viel hinterher.“<br />
Also ein Wein, <strong>der</strong> frisch, fruchtig<br />
und vor<strong>der</strong>gründig ist. Dies sind die<br />
Eigenschaften, die man gemeinhin mit<br />
Weißwein assoziiert.<br />
Weine dieser Art befeuern Partys,<br />
Stehempfänge und Boutique-Eröffnungen,<br />
sind animierend und halten das<br />
Energielevel oben. Sie brauchen keine<br />
Essensbegleitung, sind sogenannte „Solo-Sipper“<br />
zum unkomplizierten Runterschütten<br />
und können durchaus schmecken.<br />
Aber sie sind nicht das, was ich<br />
suche. Sie sind nicht meditativ. Sie rufen<br />
keine Gelassenheit hervor. Ich suche<br />
im Wein die Entspannung. Gerade jetzt,<br />
im Winter.<br />
„Du suchst Ohrensessel-Weine“, sagt<br />
Guido. „Vielschichtige Weine, die deine<br />
Neugier halten. Gehaltvoll und konzentriert.<br />
Dies sind natürlich eher Rotwein-Attribute.“<br />
Er schickt mir drei<br />
seiner weißen Favoriten in dieser Kategorie,<br />
die ich in den folgenden Tagen auf<br />
ihre Wintertauglichkeit teste. Für meine<br />
70 Seiten Richard Yates zum Beispiel<br />
hat mir Guido einen Chardonnay „Tiglat“<br />
von Heinz Velich am Neusiedlersee<br />
empfohlen, den ich – wo sonst – in meinem<br />
Ohrensessel verkoste. Beim Lesen<br />
halte ich mich grundsätzlich an reinsortige<br />
Weine, denn aus Erfahrung weiß ich,<br />
dass sich bei einer Cuvée auch die Gedanken<br />
bald zu einer solchen mischen.<br />
Im Glas tiefes Goldgelb mit Bronzestich,<br />
ein Chardonnay, wie ich ihn liebe: Getoastete<br />
Eiche, Textur ölig. Aprikose, Vanille,<br />
Haselnuss, Rosenblüte. Ich muss<br />
nur alle vier Buchseiten einen Schluck<br />
nehmen, so lange dauert <strong>der</strong> Nachhall.<br />
Am nächsten Morgen katerfrei,<br />
abends dann einen Blanc de Noir, so<br />
nennt man einen Weißwein, <strong>der</strong> aus<br />
roten Trauben hergestellt wird. In <strong>der</strong><br />
Champagnerproduktion gang und gäbe,<br />
gilt dieses Verfahren bei stillen Weinen<br />
noch als Experiment. <strong>Der</strong> junge Winzer<br />
Benedikt Baltes gilt als experimentierfreudig,<br />
und mit dem „Blanc de Noir<br />
R“ des Weinguts Stadt Klingenberg hat<br />
er einen wahren Exoten auf die Flasche<br />
gezogen. Eleganter Rosé-Schimmer im<br />
„Du suchst<br />
vielschichtige<br />
Weißweine,<br />
die deine<br />
Neugier halten.<br />
Gehaltvoll und<br />
konzentriert“<br />
Guido Walter leitet die Münchner<br />
Weinhandlung „Walter und Sohn“<br />
und bildet Sommeliers aus<br />
Strohblond. Ein Schluck, und ich stehe<br />
im Wald: Duftende Nadelhölzer, Moos,<br />
gleichzeitig Frische. <strong>Der</strong>selbe Sinneseindruck,<br />
<strong>der</strong> mich beim Joggen im heimatlichen<br />
Taunus die Zivilisation vergessen<br />
lässt. Ein Wein wie ein deutsches Mittelgebirge.<br />
Und doch – höre ich da nicht ein<br />
Flattern? Nach längerer Zeit im Glas offenbart<br />
sich <strong>der</strong> Paradiesvogel, <strong>der</strong> im „R“<br />
steckt: Karamell, Zitrus, Tropenfrüchte.<br />
Sicher ein guter Begleiter zu thailändischem<br />
Essen – aber eben auch zum Rehrücken<br />
o<strong>der</strong> zum Hirschgulasch, beteuert<br />
Guido am Telefon.<br />
Am Mittwoch habe ich das Alleintrinken<br />
satt und lade mir eine bürogestresste,<br />
ausgehungerte Single-Freundin<br />
ein. Sie ist offen für alles. Für ein<br />
Käsefondue, zum Beispiel. Und noch<br />
eine dritte Frau ist an diesem Abend präsent:<br />
Die Winzerin Eva Fricke, die uns<br />
mit ihrem „Lorcher Schlossberg Riesling“<br />
einen geschmeidigen Gruß aus dem<br />
Rheingau nach Berlin schickt: die Reichhaltigkeit<br />
einer Auslese, auch etwas von<br />
<strong>der</strong>en Süße. Klar wie <strong>der</strong> Klang <strong>der</strong> Glocke<br />
des Kirchturms in Kiedrich. Aprikose,<br />
Kirsche und ein leichtes Mousseux,<br />
das dem Käse die Schwere nimmt. Ein<br />
Langstreckenläufer, <strong>der</strong> es spielerisch mit<br />
einem Pfund Gruyère aufnehmen kann,<br />
ohne seine Komplexität zu verleugnen.<br />
Ohne sich unterzuordnen. <strong>Der</strong> Lorcher<br />
Schlossberg ist ein emanzipierter Wein.<br />
Und sehr Ohrensessel-tauglich. Zum<br />
Glück habe ich <strong>der</strong>er zwei, in die meine<br />
Freundin und ich uns mit einem letzten<br />
Schluck zurückziehen.<br />
Am nächsten Morgen leichte Ausfallerscheinungen.<br />
Weckruf vom Postboten:<br />
Eine weitere Guido-Sendung, unangekündigt.<br />
Ihm sei da noch so ein Champagner<br />
eingefallen, „Cuvée Louis“ von<br />
Tarlant, halb Chardonnay, halb Pinot<br />
Noir, mit seinen Brioche-Noten perfekt<br />
zur Gans mit Semmelfüllung – was zu<br />
meinen Plänen für Weihnachten passt.<br />
LENA BERGMANN lebt in Berlin, leitet<br />
das StilRessort von <strong>Cicero</strong> und ist immer<br />
offen für Weinempfehlungen<br />
Illustration: Lisa Schweizer<br />
108<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
LATTE MACCHIATO VON DE’LONGHI<br />
STATE OF THE ART<br />
Das neue LatteCrema-Milchaufschäumsystem von De’Longhi:<br />
Für perfekten Milchschaum.<br />
Latte Macchiato, Cappuccino und Caffè Latte haben eines gemeinsam: ohne den richtigen Milchschaum<br />
geht es nicht. Daher hat De’Longhi sein patentiertes Milchaufschäumsystem noch weiterentwickelt.<br />
Das neue LatteCrema-System zaubert Ihnen mühelos cremigen, löffelfesten Milchschaum. Nur<br />
durch das ideale Zusammenspiel von Dampf und Luft entsteht ein Milchschaum wie beim Barista, um<br />
auch bei Ihnen Zuhause ein echt italienisches Kaffee-Erlebnis zu schaffen. Ganz einfach auf Tastendruck.<br />
www.delonghi.de
STIL<br />
Besuch<br />
DER HERR<br />
DER HÄUSER<br />
Von<br />
ULRICH CLEWING<br />
Es gibt Menschen, die sammeln Kunst,<br />
kostbare Erstausgaben o<strong>der</strong> seltene Briefmarken.<br />
Lars Sjöberg aus Odenslunda in <strong>der</strong> Nähe von<br />
Stockholm sammelt Häuser. Und leistet so seinen<br />
Beitrag zum Lauf <strong>der</strong> Geschichte<br />
Fotos: Ingalill Snitt<br />
111<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
STIL<br />
Besuch<br />
Lars Sjöberg wirkt nicht wie jemand,<br />
<strong>der</strong> beson<strong>der</strong>s erpicht<br />
ist auf Weihnachtsgeschenke.<br />
Aber einen Wunsch hätte er<br />
schon. Er denkt einen Moment<br />
nach: „Ein Sky-Lift wäre nicht schlecht.<br />
Wenn ich auf einem Baum stehe, um die<br />
Äste zurückzuschneiden“, erzählt <strong>der</strong><br />
72-Jährige, „dann hat inzwischen zumindest<br />
meine Frau Angst um mich.“ Demnach<br />
führen die beiden gerade ein eher<br />
aufregendes Leben, denn Lars Sjöberg<br />
besitzt viele, viele Bäume, verstreut auf<br />
Grundstücken in ganz Schweden. Und<br />
um alle muss er sich kümmern.<br />
Manche Menschen sammeln Kunst,<br />
kostbare Erstausgaben o<strong>der</strong> seltene Briefmarken.<br />
Lars Sjöberg aus Odenslunda in<br />
<strong>der</strong> Nähe von Stockholm sammelt Häuser.<br />
Neun hat er schon, dazu noch eine<br />
alte Kirche. Sein erstes kaufte er 1966,<br />
da war er 25 und suchte eine Bleibe für<br />
sich und seine Verlobte Ursula. Sieben<br />
Jahre später erwarb er das zweite, das<br />
in Odenslunda, in dem die beiden noch<br />
immer wohnen. Danach kam etwas ins<br />
Rollen, bei dem er nicht mehr genau weiß,<br />
was überwog, die Leidenschaft o<strong>der</strong> die<br />
Verzweiflung.<br />
ALTE HÄUSER HATTEN Lars Sjöberg schon<br />
als kleinen Jungen fasziniert. Er war ein<br />
schlechter Schüler, „wie Albert Einstein“:<br />
ein Legastheniker. Aber das hieß<br />
nicht, dass er nichts mit Büchern anfangen<br />
konnte. „Als ich zehn war, schenkte<br />
mir mein Onkel eine Ausgabe von ‚Suerica<br />
antiqua et hieronum‘. Darin habe<br />
ich jahrelang geschmökert“, sagt Sjöberg.<br />
Das erstmals um 1720 erschienene<br />
Kompendium war seinerzeit nicht nur<br />
das größte je in Nordeuropa gedruckte<br />
Buch. Es sprengte auch sonst alle Dimensionen.<br />
<strong>Der</strong> schwedische Feldherr und<br />
Architekt Erik Dahlbergh unternahm<br />
darin mit Dutzenden Helfern den Versuch,<br />
sämtliche gebauten und geplanten<br />
Herrenhäuser seiner Heimat in Wort und<br />
großen, in Kupfer gestochenen Schautafeln<br />
zu beschreiben.<br />
Das war <strong>der</strong> eine Teil <strong>der</strong> Prägung<br />
des Lars Sjöberg. <strong>Der</strong> an<strong>der</strong>e Teil bestand<br />
aus frühen Übungen in unmittelbarer<br />
Anschauung. Seine Mutter arbeitete<br />
als Lehrerin für Geschichte. „Sie<br />
liebte es, durchs Land zu fahren und<br />
Orte zu besichtigen. Dabei nahm sie mich<br />
Das Haus in Leufsta Bruk steht<br />
Besuchern nach Verabredung zur<br />
Besichtigung offen<br />
immer mit.“ Später studierte er Kunstgeschichte<br />
und wurde Kurator für Möbel<br />
und historische Stoffe am Nationalmuseum<br />
in Stockholm. Doch sein Interesse<br />
für alles Gebaute hatte nicht nachgelassen<br />
– und was er da sah, schockierte ihn.<br />
„In den sechziger und siebziger Jahren<br />
war Schweden ein Land, das viele als<br />
rückständig empfanden“, sagt Sjöberg.<br />
„Deshalb wollten sie es mit aller Macht<br />
verän<strong>der</strong>n.“<br />
Foto: Ingalill Snitt<br />
112<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Die Frage ist doch,<br />
ob man in <strong>der</strong><br />
kurzen Zeit, die<br />
einem in dem Lauf<br />
<strong>der</strong> Geschichte<br />
gegeben ist, etwas<br />
zerstören möchte.<br />
O<strong>der</strong> sie dazu nutzt,<br />
die Dinge zu<br />
erhalten<br />
Die Neuerer spalteten sich in zwei<br />
Fraktionen: Die einen waren Sozialisten,<br />
orientierten sich an Moskau und<br />
schwärmten für riesige Apartmentblocks,<br />
in denen je<strong>der</strong> eine mo<strong>der</strong>ne<br />
Wohnung finden sollte. Die an<strong>der</strong>en<br />
schielten Richtung USA und sahen<br />
überall nur noch Wolkenkratzer. Für<br />
Lars Sjöberg war das wie die Wahl zwischen<br />
Pest und Cholera. „Einmal reiste<br />
Le Corbusier nach Stockholm und legte<br />
Pläne vor, die gesamte Stadt einzuebnen<br />
– alle schwedischen Architekten<br />
klatschten Beifall. Damals wurden sehr<br />
viele alte Gebäude abgerissen, in den<br />
Städten, aber auch auf dem Land.“<br />
Also beschloss er, dagegen etwas zu<br />
unternehmen. Seine Frau verfügte über<br />
ein kleines Vermögen, das erleichterte<br />
einiges. Lars Sjöberg hat keinen Computer,<br />
kennt seine Postleitzahl nicht auswendig<br />
und ist auch nicht imstande, auf<br />
seinem mobilen Telefon SMS abzurufen.<br />
Aber abgesehen davon ist er als Akademiker<br />
doch recht praktisch veranlagt.<br />
Erst stellte er sich die Frage, „ob man in<br />
<strong>der</strong> kurzen Zeit, die einem in dem Lauf<br />
<strong>der</strong> Geschichte gegeben ist, etwas zerstören<br />
möchte. O<strong>der</strong> sie nicht lieber dazu<br />
nutzt, die Dinge zu erhalten.“ Dann begann<br />
er, gegen den Abrisswahn auf<br />
seine Art zu protestieren. Er gründete<br />
dazu keine Bürgerinitiative, ging nicht<br />
auf Demonstrationen. Er kaufte einfach<br />
Landsitze und Gutshöfe, einen nach dem<br />
an<strong>der</strong>en: Salaholm, Sörby, Regnaholm,<br />
Ekensberg, Bratteberg und noch vier<br />
weitere. Die ältesten aus dem späten 17.,<br />
die jüngsten aus <strong>der</strong> ersten Hälfte des<br />
19. Jahrhun<strong>der</strong>ts.<br />
Allzu prächtig darf man sie sich nicht<br />
vorstellen. Nach den gescheiterten Großmachtsansprüchen<br />
im Dreißigjährigen<br />
Krieg erlebte Schweden zwar eine lange<br />
Phase <strong>der</strong> Neutralität und des kontinuierlichen<br />
Aufschwungs. Doch <strong>der</strong> zunehmende<br />
Wohlstand kollidierte mit einer<br />
landestypischen Eigenschaft, mit <strong>der</strong> sich<br />
seine Bewohner später auf an<strong>der</strong>en Gebieten<br />
noch viele Freunde machen sollten.<br />
Diese spezielle Form von Bescheidenheit,<br />
die Lars Sjöberg so sehr mag – und <strong>der</strong><br />
man im ausgehenden 20. Jahrhun<strong>der</strong>t den<br />
Namen Reduziertheit gab.<br />
„Es ist erstaunlich, wie klein die Häuser<br />
waren, in denen die Adligen früher<br />
lebten“, sagt <strong>der</strong> Sammler. Das Haupthaus<br />
eines Herrensitzes wie Sörby aus<br />
<strong>der</strong> Zeit um 1680 maß im Grundriss nur<br />
etwa acht mal zehn Meter. Und das Innere<br />
sieht aus, als hätte Schweden während<br />
des Barock kurzerhand zwei Epochen<br />
übersprungen, und wäre direkt im<br />
Klassizismus gelandet. Die Wandgestaltung<br />
mit wenigen antikisierenden Girlanden<br />
ist zurückhaltend, die Möbel folgen<br />
dem geometrischen Gerüst <strong>der</strong> Säulen<br />
und Pilaster römischer Tempel, schnörkellos,<br />
unaufgeregt – und aus heutiger<br />
Sicht sehr mo<strong>der</strong>n.<br />
SEIT LANGEM IST SCHWEDEN – und Skandinavien<br />
allgemein – bekannt für die<br />
schlichte Eleganz seines Designs. Auf<br />
dem internationalen Kunstmarkt erzielen<br />
Vintage-Möbel des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
anhaltend hohe Preise. Seltene Stücke<br />
werden gar richtig teuer bezahlt. Modelabels<br />
wie Filippa K. o<strong>der</strong> Acne liefern<br />
die Pendants dazu, gradlinige, unprätentiöse<br />
Schnitte, die weltweit begeisterte<br />
Anhänger finden. Ausstellungen mit den<br />
in ihrer Einfachheit sehr verfeinert wirkenden<br />
Gemälden bürgerlicher Interieurs<br />
von Vilhelm Hammershøi sind – wie<br />
2008 in London o<strong>der</strong> letztes Jahr in München<br />
– zuverlässig Publikumsmagneten.<br />
Die Ursprünge all dessen, sie liegen hier,<br />
in Häusern wie Sörby.<br />
<strong>Der</strong> Kunstgeschichtler Sjöberg schlägt<br />
noch einen weiteren Bogen. „Wenn man<br />
es genau nimmt“, sagt er, „ist die schwedische<br />
Architektur nicht denkbar ohne<br />
Anzeige<br />
»Originell, brillant<br />
und spannend zugleich.«<br />
Regina Krieger, Handelsblatt<br />
Georg von Wallwitz<br />
Mr. SMith<br />
und daS ParadieS<br />
Die Erfindung des Wohlstands<br />
200 Seiten · Halbleinen · fadengeheftet<br />
ISBN 978-3-937834-63-4 · EUR 22<br />
BERENBERG<br />
www.berenberg-verlag.de<br />
Sinnliche<br />
Vielfalt<br />
BB_<strong>Cicero</strong>_Anzeige_05112013_de.indd 1 07.11.13 13:56<br />
THE CLASSICAL MUSIC BOX<br />
204 Seiten, Hardcover im Schuber,<br />
8 Musik-CDs, Format 28 × 28 cm<br />
59,95 € (D) / 61,70 € (D)<br />
ISBN 978-3-943573-07-0<br />
JAZZ INSTRUMENTS<br />
228 Seiten, Hardcover mit Surbalinbezug,<br />
8 Musik CDs, Format 28 × 28 cm<br />
49,95 € (D) / 51,40 € (D)<br />
ISBN 978-3-943573-06-0<br />
113<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013<br />
www.earbooks.net
STIL<br />
Besuch<br />
Palladio.“ Irgendwoher muss diese Vorliebe<br />
für harmonische Schlichtheit in <strong>der</strong><br />
Gestaltung herrühren – warum nicht von<br />
jenem Renaissance-Baumeister, dessen<br />
Lehre auch in Dänemark und vor allem<br />
in England so begeisterte Aufnahme gefunden<br />
hatte?<br />
Wenn man ihm eine Weile zuhört,<br />
könnte man denken, Lars Sjöberg lebte<br />
am liebsten in <strong>der</strong> Vergangenheit. Ein<br />
Nostalgiker, <strong>der</strong> mit gewissen Erscheinungen<br />
<strong>der</strong> Gegenwart nicht zurechtkommt.<br />
Nichts wäre falscher.<br />
MANCHMAL SPIELT ER einen Mann, <strong>der</strong><br />
sich selber bedauert ob <strong>der</strong> enormen Anstrengungen,<br />
die ihm seine Leidenschaft<br />
abverlangt, physisch wie finanziell. <strong>Der</strong><br />
dann Sätze sagt wie: „Lei<strong>der</strong> bin ich<br />
nicht so realistisch, wie ich sein sollte.“<br />
O<strong>der</strong>: „Das alles kostet weit mehr, als ein<br />
72-Jähriger zu ertragen bereit ist.“<br />
Doch im Grunde weiß er, dass er und<br />
seine Frau glückliche Menschen sind. Sie<br />
haben etwas in Gang gesetzt. Haben sich<br />
auf eine schwierige Mission eingelassen<br />
Schweden ist heute<br />
allgemein bekannt<br />
für die Schlichtheit<br />
seines Designs.<br />
Die Ursprünge all<br />
dessen liegen in<br />
diesen Häusern<br />
Die evangelische Kirche im<br />
Dörfchen Bolsta Bruk wurde<br />
1906 fertiggestellt und erinnert<br />
Sjöberg an Pippi Langstrumpfs<br />
schräge Villa Kunterbunt<br />
damals, und sind seitdem zwar nicht unbedingt<br />
reicher geworden, aber auf ihrem<br />
Weg ein gutes Stück vorangekommen.<br />
„Wir wollten die Menschen darauf<br />
aufmerksam machen, dass alte Dinge einen<br />
Wert haben, den man heute nicht so<br />
ohne Weiteres ersetzen kann“, sagt Sjöberg<br />
und fängt an, von <strong>der</strong> Akademie zu<br />
erzählen, an <strong>der</strong> er schon lange lehrt.<br />
Die Träakademien Mittuniversitetet<br />
befindet sich in dem Städtchen Kramfors<br />
in Mittelschweden, rund 500 Kilometer<br />
nördlich von Stockholm. Dort unterrichtet<br />
Sjöberg Studenten in den Fächern<br />
Holzbearbeitung und Polsterei. Möbel<br />
aus seiner eigenen Sammlung dienen als<br />
Anschauungsmaterial. „Das ist <strong>der</strong> einzige<br />
Grund, so viel Geld dafür auszugeben.<br />
Es ist etwas ganz an<strong>der</strong>es, ob man<br />
als Student vor Originalen lernt o<strong>der</strong> nur<br />
Fotos zur Verfügung hat.“ Sein Anliegen<br />
ist, historische Handwerkstechniken weiterzutragen,<br />
weil sie mo<strong>der</strong>nen Verarbeitungen<br />
um so viel überlegen sind. Und<br />
um sie nicht völlig in Vergessenheit geraten<br />
zu lassen. „Als ich einmal die Fenster<br />
Foto: Ingalill Snitt<br />
114<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Elegant durch das Jahr 2014<br />
<strong>Cicero</strong><br />
Kalen<strong>der</strong><br />
<strong>Der</strong> <strong>Cicero</strong>-Kalen<strong>der</strong><br />
<strong>Der</strong> Original-<strong>Cicero</strong>-Kalen<strong>der</strong><br />
Mit praktischer Wochenansicht auf einer Doppelseite und herausnehmbarem<br />
Adressbuch. Begleitet von Karikaturen, bietet <strong>der</strong><br />
Kalen<strong>der</strong> viel Platz für Ihre Termine und Notizen. Im handlichen<br />
Din-A5-Format, mit stabiler Fadenheftung und wahlweise in rotem<br />
Surbalin- o<strong>der</strong> schwarzem Le<strong>der</strong>einband erhältlich.<br />
❶ Echte Fadenheftung sorgt für dauerhafte Stabilität und erleichtert das Aufschlagen<br />
❷ Zwei verschiedenfarbige Lesebän<strong>der</strong> bieten schnelle Orientierung ❸ Jede Woche<br />
wird von einer Karikatur begleitet ❹ Wahlweise in karminrotem Surbalin mit Moiré-<br />
Schimmer o<strong>der</strong> schwarzem Rindsle<strong>der</strong>einband mit Prägung an Frontseite und Rücken<br />
Ja, ich möchte den <strong>Cicero</strong>-Kalen<strong>der</strong> 2014 bestellen!<br />
Ex. in rotem Surbalin je 25 EUR*/19,95 EUR für Abonnenten Bestellnr.: 1073946<br />
Ex. in schwarzem Le<strong>der</strong> je 69 EUR* Bestellnr.: 1073945<br />
Wi<strong>der</strong>rufsrecht: Sie können Ihre Bestellung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax o<strong>der</strong><br />
E-Mail) wi<strong>der</strong>rufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung <strong>der</strong> Frist genügt die rechtzeitige Absendung<br />
des Wi<strong>der</strong>rufs. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation <strong>der</strong> Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Geschäftsführer Michael<br />
Voss. *Preise zzgl. Versandkosten von 2,95 € im Inland, Angebot und Preise gelten im Inland, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
Vorname<br />
Straße<br />
Name<br />
Hausnummer<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: www.cicero.de/kalen<strong>der</strong><br />
PLZ<br />
Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Kontonummer BLZ Kreditinstitut<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon o<strong>der</strong> E-Mail über interessante Angebote des<br />
Verlags informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch das Senden einer E-Mail an abo@cicero.de o<strong>der</strong> postalisch an den <strong>Cicero</strong>-<br />
Leserservice, 20080 Hamburg, je<strong>der</strong>zeit wi<strong>der</strong>rufen werden.<br />
Datum<br />
Unterschrift
STIL<br />
Besuch<br />
geschrieben. Wun<strong>der</strong>bar aufgemachte,<br />
reich illustrierte Bände mit Titeln wie<br />
„The Swedish Room“ o<strong>der</strong> „Making Swedish<br />
Furniture“ o<strong>der</strong> „Klassische Schwedische<br />
Interieurs“. Und auf den Umschlägen<br />
Fotos, die tatsächlich ein bisschen<br />
aussehen wie von Vilhelm Hammershøi<br />
gemalt. Die Bücher handeln von den traditionellen<br />
Werten nordischer Gestaltung,<br />
von Funktionalität, Robustheit, Authentizität.<br />
Sie erzählen vom Altern, und<br />
warum es Dinge gibt, die dabei mehr als<br />
an<strong>der</strong>e ihre Würde bewahren.<br />
in unserem Haus in Odenslunda untersucht<br />
habe“, sagt Sjöberg, „merkte ich,<br />
dass es immer noch die ersten waren. Sie<br />
wurden aus Hartholz gefertigt und haben<br />
die letzten 200 Jahre Wind und Wetter<br />
schadlos überdauert. Erzählen Sie das<br />
mal einem Fabrikanten von heute. <strong>Der</strong><br />
bricht in Tränen aus.“<br />
Lars Sjöberg und seine Frau Ursula<br />
sind unter die Autoren gegangen. Zehn<br />
Bücher haben sie über ihre Passion bisher<br />
Sjöberg in Regnaholm, in dem<br />
Haus, das er mit seiner Frau<br />
bewohnt. Für das Esszimmer ließ<br />
er 26 typischgustavianische<br />
Stühle nachfertigen<br />
AUCH SONST HAT Lars Sjöberg, bei aller<br />
Bescheidenheit, Sinn für öffentlichkeitsrelevante<br />
Maßnahmen. Mitte <strong>der</strong> neuziger<br />
Jahre gelang ihm in <strong>der</strong> Hinsicht<br />
sogar ein Coup. Er luchste dem Möbelgiganten<br />
Ikea nicht nur Geld ab für die<br />
Instandhaltung gefährdeter Gebäude.<br />
Sie legten auch eine Kollektion auf, die<br />
Sjöberg gestaltete, mit Lampen, Stühlen,<br />
Sesseln und Sofas, die sich an schwedischen<br />
Entwürfen des 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
orientierten. Drei Jahre lief das, noch im<br />
aktuellen Katalog stößt man auf Überbleibsel,<br />
etwa bei <strong>der</strong> Alvine-Serie von<br />
Heimtextilien. Als Teil <strong>der</strong> Ikea-Aktion<br />
wurde seinerzeit ein altes schwedisches<br />
Herrenhaus gebaut, ganz aus Holz, nach<br />
Sjöbergs Plänen. „Wir haben es auf dem<br />
Vorplatz des Nationalmuseums aufgestellt,<br />
gut sichtbar vom königlichen Palast<br />
gegenüber“, sagt Sjöberg. „Am Ende<br />
des Sommers kaufte es ein Arzt, <strong>der</strong> es<br />
in die Nähe von Uppsala transportieren<br />
ließ.“<br />
Es scheint, als läge bei dem Gedanken<br />
ein Anflug von Bedauern in seiner<br />
Stimme. Doch vielleicht täuscht das auch.<br />
Manchmal wird Lars Sjöberg gefragt, ob<br />
er glaubt, dass Häuser so etwas wie eine<br />
Seele haben können. Dass sie etwas von<br />
ihren Bewohnern in sich aufnehmen und<br />
bewahren. Da muss <strong>der</strong> Wissenschaftler<br />
lachen. „Ich bin fest davon überzeugt,<br />
dass es für jeden eine Bereicherung darstellt,<br />
geschichtliche Zusammenhänge zu<br />
kennen und sich darauf zu besinnen, was<br />
einem an <strong>der</strong> Vergangenheit wertvoll erscheint.“<br />
Er macht eine Pause, dann sagt<br />
er noch: „Aber es tut mir leid: Ich glaube<br />
nicht an Geister.“<br />
ULRICH CLEWING schreibt regelmäßig<br />
über Kunst und beson<strong>der</strong>e Immobilien<br />
Foto: Ingalill Snitt<br />
116<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
STIL<br />
Klei<strong>der</strong>ordnung<br />
Foto: Thomas Kierok für <strong>Cicero</strong><br />
TIM RAUE<br />
Wenn ich meine Kochjacke anziehe,<br />
bin ich <strong>der</strong> Chef. Dann<br />
bin ich nicht mehr <strong>der</strong> private<br />
Tim, son<strong>der</strong>n Tim Raue, <strong>der</strong> Sternekoch.<br />
Ich trage dann eine Uniform, die einen<br />
Teil meiner Persönlichkeit för<strong>der</strong>t, die<br />
des Bestimmers. Meine Mimik, Gestik<br />
und Ausstrahlung sagen dann: Wenn ich<br />
das will, will ich das. Allerdings ohne<br />
Rumschreierei. Im Restaurant bin ich offensiv<br />
und präsent, während ich im Privaten<br />
eher zurückgezogen lebe.<br />
Traditionell besteht die Kluft <strong>der</strong><br />
Köche aus einer weißen Jacke und einer<br />
schwarzen Hose. Das habe ich durchbrochen.<br />
Zu meiner Zeit als Chefkoch<br />
des Hotel Adlon marschierte ich ganz<br />
in Schwarz ein – ziemlich Avantgarde.<br />
Als diese schwarze Periode zu Ende ging,<br />
war klar, dass ich etwas Neues brauchte.<br />
Ich wollte etwas, das mit <strong>der</strong> Region verbunden<br />
ist. Ich fühle mich nämlich nicht<br />
als Deutscher, son<strong>der</strong>n als Preuße, als<br />
Berliner. Das sind meine Wurzeln.<br />
Blau war schon immer meine liebste<br />
Farbe, also habe ich für diesen neuen Abschnitt<br />
ein eigenes Blau kreiert. Aus einem<br />
Pantone-Ton habe ich die Farbe definiert<br />
und selbst angemischt. Für den<br />
Stoff meiner Uniform habe ich eine imprägnierte<br />
Baumwolle gewählt, die leicht<br />
und atmungsaktiv ist. Denn bei einem<br />
Arbeitstag von durchschnittlich 16 bis<br />
18 Stunden muss ich mich wohlfühlen.<br />
Ich brauche Bewegungsfreiheit, ein gewisses<br />
Spiel. Deshalb sind meine Uniformen<br />
auch maßgeschnei<strong>der</strong>t. Und da ich<br />
in meiner Küche großen Wert auf regionale<br />
Produkte lege, werden auch meine<br />
Kochuniformen in Deutschland gefertigt.<br />
Ich bestehe auf gutem Handwerk. Sie<br />
werden mich nie mit industriell gefertigten<br />
Massenprodukten begeistern können.<br />
Tim Raue, 39 Jahre alt, arbeitete<br />
zunächst als Küchenchef des<br />
Berliner Swissôtels und wechselte<br />
dann zum Adlon. Prämiert mit zwei<br />
MichelinSternen und 19 Punkten<br />
im GaultMillau betreibt er heute<br />
die Restaurants „Tim Raue“ und<br />
„La Soupe Populaire“<br />
Außer bei Schuhen. Ich habe einen ausgeprägten<br />
Hang zu Nike. Ich besitze bestimmt<br />
100 Paare. Die sind aber bei mir<br />
auch nach drei Wochen durchgetreten.<br />
Ich trage sie natürlich auch beim Kochen.<br />
Außerhalb <strong>der</strong> Küche strebe ich nach<br />
einer Mischung aus englischer Handwerksarbeit<br />
und italienischem Lebensstil.<br />
Ich mag kräftige Farben, meine absolute<br />
Stilikone ist in dieser Hinsicht <strong>der</strong><br />
Fiat-Erbe und Lebemann Lapo Elkann,<br />
auch wenn ich selbst nie so schrill auf die<br />
Straße gehen würde. Das schürt zu viel<br />
Aufmerksamkeit. Ich will nicht leuchten.<br />
Wir Berliner lassen jeden so sein, wie<br />
er ist. Ganz gleich, ob Punk o<strong>der</strong> Prinzessin.<br />
Für meine Küche spielt das eine wichtige<br />
Rolle. Ich glaube, dass Geschmack<br />
keine Attitüde mehr braucht. Die Menschen<br />
wollen kein Schischi, son<strong>der</strong>n Genuss,<br />
ohne angestrengt darüber nachdenken<br />
zu müssen. Und so ist meine Küche:<br />
klar, reduziert, punktuell – wie ich auch.<br />
Hier gibt es keine harten Kontraste, dafür<br />
aber eine persönliche Note. Das bringe<br />
ich auch meinen Leuten bei: ihrer Arbeit<br />
einen eigenen Stil zu geben.<br />
Aufgezeichnet von<br />
SARAH-MARIA DECKERT<br />
118<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
SALON<br />
„ Für die Probleme<br />
dieser Welt gibt es<br />
genau zwei Lösungen:<br />
den Abzug und<br />
das Gaspedal “<br />
<strong>Der</strong> Kulturphilosoph Alexan<strong>der</strong> Pschera über die zynische Machowelt in<br />
Grand Theft Auto, dem erfolgreichsten Videospiel aller Zeiten, Seite 126<br />
119<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
SALON<br />
Porträt<br />
GRÖSSER ALS WIR SELBST<br />
Die Geigerin Carolin Widmann verbindet die Neue mit <strong>der</strong> Alten Musik. Wie ihr Bru<strong>der</strong>,<br />
<strong>der</strong> Komponist Jörg Widmann, setzt sie auf Leidenschaft und Selbstkritik statt Show<br />
Von VOLKER HAGEDORN<br />
Foto: Marco Borggreve<br />
Warum sie nun weggehe? „Ich<br />
muss Geige spielen.“ „Das<br />
kannst du doch auch daheim!“<br />
Carolin Widmann lacht sehr, als sie diesen<br />
Dialog mit ihrer Tochter erzählt. Die<br />
hat zwar schon ein paar Mal zugehört,<br />
wenn ihre Mutter auf dem Podium stand,<br />
aber dass genau das es ist, worauf es ankommt,<br />
leuchtet einer Vierjährigen nicht<br />
ein. <strong>Der</strong> 37-jährigen Solistin gefällt das<br />
„Warum?“ ihrer Tochter vielleicht auch<br />
deshalb, weil sie das eigene Tun weitaus<br />
tiefer befragt, als erfolgreiche Musiker es<br />
üblicherweise zu erkennen geben.<br />
Dass sie sich aussuchen kann, was<br />
sie spielt, dass die besten Komponisten<br />
für sie Konzerte schreiben, dass ihr beim<br />
jüngsten Berliner Musikfest ein ganzer<br />
Soloabend in <strong>der</strong> Philharmonie gehörte<br />
und auch die neue Aufnahme bei dem<br />
Label ECM auf <strong>der</strong> Bestenliste <strong>der</strong> deutschen<br />
Schallplattenkritik landete, hätte<br />
sie vor zehn Jahren nicht zu träumen gewagt:<br />
„Zu viele Einladungen, um aufzuhören,<br />
zu wenige zum Überleben.“ Doch<br />
<strong>der</strong> Krise folgte einer <strong>der</strong> erstaunlichsten<br />
Aufstiege im Felde <strong>der</strong> Kunstgeigerei. Erstaunlich,<br />
weil Widmann sämtliche Gebote<br />
<strong>der</strong> Branche ignoriert, zuvör<strong>der</strong>st jenes,<br />
dem Affen Zucker zu geben.<br />
<strong>Der</strong> letzte Affe, mit dem sie musikalisch<br />
zu tun hatte, war aus Plüsch und<br />
spielte – 30 Jahre ist das her – den Monostatos<br />
im Münchener Kin<strong>der</strong>zimmer.<br />
Carolin und ihr Bru<strong>der</strong> Jörg führten die<br />
„Zauberflöte“ mit Stofftieren auf, „vor<br />
null Zuschauern“. <strong>Der</strong> Junge spielte Klavier,<br />
das Mädchen sang sämtliche Rollen,<br />
ein Schaf im Divenkleid war die Königin<br />
<strong>der</strong> Nacht. Bald darauf begann Jörg Widmann<br />
zu komponieren und Carolin zu<br />
geigen. Beides tun sie bis heute, als berühmtestes<br />
deutsches Musikgeschwisterpaar<br />
seit den Mendelssohns. Jedoch steht<br />
Carolin nicht im Schatten des Bru<strong>der</strong>s.<br />
Vor ein paar Jahren musste sie sich,<br />
wenn sie Veranstaltern ein Stück Neue<br />
Musik vorschlug, Bemerkungen anhören<br />
wie: „Aber Sie ziehen sich noch was<br />
Schöneres an?“ Inzwischen wird sie geradezu<br />
gebeten, einen Boulez, Xenakis,<br />
Sciarrino, Haas mitzubringen. Es gibt<br />
ein wachsendes Publikum, das sich nach<br />
Geist sehnt, nicht nach Geigengirlies.<br />
BEI IHREM BERLINER RECITAL verband<br />
sie Bach und Bartók und neueste Musik.<br />
Georg Friedrich Haas, <strong>der</strong> stille Extremist<br />
aus Graz, arbeitet mit Vierteltönen<br />
und führt Hörer an Grenzen, von denen<br />
auch die meisten Musiker wenig wissen.<br />
„Ich habe nach zwei Sekunden gespürt,<br />
hier funktioniert es, die machen mit mir<br />
diese Reise. Es wurden zwei Stunden<br />
ohne einen Huster. Atemlose Andacht!“<br />
Solche Abende geben Kraft für die Professur<br />
in Leipzig, wohin sie nach elf Jahren<br />
in London gezogen ist. Und für die<br />
Familie. Zwei Berufstätige, <strong>der</strong> Mann ist<br />
Landschaftsarchitekt, zwei Kin<strong>der</strong>, das<br />
schlaucht: „Ich komme mir vor wie im<br />
Vorstand eines Kleinbetriebs.“<br />
Auffällig wurde sie 2005 mit einer<br />
Debüt-CD, die gemessen an den Marktgesetzen<br />
ein Suizidversuch war: mit den<br />
irrwitzigen „Capricci“ im Zentrum, die<br />
Salvatore Sciarrino 1976 jenseits aller<br />
„schönen Töne“ komponierte. Aber sie<br />
drang in seine Sprache so virtuos ein, wie<br />
sie es in ihren nächsten Aufnahmen auch<br />
bei Schubert und Schumann tat, <strong>der</strong>en<br />
Glut hier schon dem Eiswind des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
ausgesetzt ist, fragmentarisch,<br />
flackernd, verletzlich. Neue Musik ist ihr<br />
alles, auch wenn sie mit <strong>der</strong> Akademie<br />
für Alte Musik Berlin den Frühklassiker<br />
Franz Benda aus <strong>der</strong> Versenkung holt.<br />
Die ganz neue Musik beginnt bei ihr<br />
nicht im Elfenbeinturm, eher mit einer<br />
Jamsession wie jener, aus <strong>der</strong> Rebecca<br />
Saun<strong>der</strong>s ihr Konzert „Still“ entwickelte.<br />
Etwa 15 Violinkonzerte wurden für Carolin<br />
Widmann geschrieben, Wolfgang<br />
Rihm und Salvatore Sciarrino markieren<br />
die ästhetischen Extreme: „Wir haben<br />
eine ähnliche Zeit <strong>der</strong> Vielfalt wie vor<br />
1914“, meint sie, nicht sicher, ob diese<br />
Parallele so ein gutes Zeichen ist. Sicher<br />
ist aber gar nichts, außer „dass die Musik<br />
großartiger ist als wir“.<br />
Das ist keine Demutspose. „Man<br />
wird zwar selbstbewusster, wenn man<br />
Bestätigung bekommt, aber auch kritischer.<br />
Ich bezweifle jeden Tag alles. Das<br />
hört sich sehr tugendhaft an, und es<br />
ist einfach Mist“, sagt sie, lachend und<br />
ernst zugleich. Je mehr ein Musiker zeigt,<br />
desto verletzlicher macht er sich, fragiler.<br />
„Wenn ich rausgehe auf die Bühne, hilft<br />
es mir nicht zu wissen, dass ich die Chaconne<br />
schon 30 Mal gespielt habe. Es ist<br />
das erste Mal.“ Nach jedem Konzert analysiert<br />
sie, was nachhallt. Schriftlich, in<br />
einem Notizbuch. „Hier war etwas nicht<br />
gut, und da und da auch nicht. Darf ich<br />
trotzdem in den Himmel kommen?“<br />
Aber die Spannung zwischen Ethos<br />
und Erdung, Skepsis und Entschlossenheit<br />
ist es ja, die diese Künstlerin – Pardon!<br />
– attraktiv macht. Dass da eine<br />
schöne Frau auf <strong>der</strong> Bühne steht in <strong>der</strong><br />
Kölner Philharmonie, rothaarig im grünen<br />
Kleid, tut nach drei Tönen nichts zur<br />
Sache. Ins Konzert, das <strong>der</strong> Schweizer<br />
Dieter Ammann für sie geschrieben hat,<br />
stürzt sie sich, als wolle sie die funkelnde<br />
Partitur neu komponieren. Bohrende<br />
Fragen, rauchende Saiten, auch mal eine<br />
Quarte aufwärts, als käme gleich Tschaikowski.<br />
Lebensgier. „Was nur geigerisch<br />
ist“, hat sie gesagt, „das ist gar nichts.“<br />
VOLKER HAGEDORN, gelernter Bratscher,<br />
war von Carolin Widmanns Geigenkunst<br />
schon vor zwölf Jahren fasziniert<br />
121<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
SALON<br />
Porträt<br />
SITZEN, REDEN, SCHLAFEN AUCH<br />
Die Brü<strong>der</strong> Joel und Ethan Coen gelten als Inbegriff des lässigen Kinos. Ihr Film<br />
„Inside Llewyn Davis“ handelt von Bob Dylans unglücklichem und fast nur fiktivem Vetter<br />
Von DIETER OSSWALD<br />
Cool. Cooler. Coens – diese Formel<br />
gilt für die Kinobrü<strong>der</strong> Joel und<br />
Ethan seit Beginn ihrer Karriere,<br />
als sie 1984 mit dem bitterbösen Krimi<br />
„Blood Simple“ Robert Redfords renommiertes<br />
Festival von Sundance aufmischten.<br />
„Inside Llewyn Davis“, ihr 16. Werk,<br />
erzählt von einem höchst talentierten<br />
Musiker, <strong>der</strong> 1961 in <strong>der</strong> Folk szene von<br />
Greenwich Village sein Glück versucht.<br />
Und grandios scheitert.<br />
Dass <strong>der</strong> Titelheld den Pechvogel-Vetter<br />
von Bob Dylan abgeben<br />
könnte, die Donald-Duck-Variante sozusagen,<br />
ist kein Zufall. „Dylan steht<br />
als Schatten über dieser Geschichte“, erläutert<br />
Joel Coen, wobei er dieses unbekannte<br />
Kapitel <strong>der</strong> Folkgeschichte „viel<br />
faszinieren<strong>der</strong> und exotischer“ findet als<br />
bekannte Biografien. Als realer Pate für<br />
die fiktive Story dient <strong>der</strong> Musiker Dave<br />
Van Ronk, von dessen Memoiren die beiden<br />
Filmemacher begeistert waren.<br />
An einem sonnigen Herbsttag in London<br />
scheinen die Coen-Brü<strong>der</strong> beachtlich<br />
guter Laune, was keineswegs immer so<br />
ist. Mal sind die beiden witzig und charmant,<br />
mal lassen sie sich die Worte mühsam<br />
aus <strong>der</strong> Nase ziehen o<strong>der</strong> brechen<br />
mitten im Satz einfach ab.<br />
Die Rollen des Künstlerpärchens sind<br />
im Gespräch klar verteilt. Es ist die alte<br />
Geschichte von good cop und bad cop.<br />
<strong>Der</strong> 56-jährige Ethan gibt mit Kurzhaarfrisur<br />
und run<strong>der</strong> Nickelbrille den lieben<br />
Lächler, <strong>der</strong> Augenkontakt nicht ausweicht<br />
und als Verkäufer in einem Technikmarkt<br />
eine gute Figur abgäbe. Sein drei<br />
Jahre älterer Bru<strong>der</strong> Joel tritt vorzugsweise<br />
mit dunkler Sonnenbrille und stoischer<br />
Mimik auf. Auffallend gelangweilt.<br />
Lethargisch. Er könnte ebenso gut eingeschlafen<br />
sein. <strong>Der</strong> Gesprächs-Pokerspieler<br />
lauert freilich nur auf das ihm passende<br />
Stichwort. Als Gebrauchtwagenverkäufer<br />
hätte Joel wenig Erfolg. Bei den Filmen<br />
sieht die Bilanz brillant aus.<br />
Abgesehen vom Aufguss <strong>der</strong> „Ladykillers“<br />
findet sich kein Flop im Schaffen<br />
<strong>der</strong> Regisseure, die sich einst mit Rasenmähen<br />
das Geld für eine Super-8-Kamera<br />
zusammensparten und mit dem Nachbarskind<br />
Filme aus <strong>der</strong> Flimmerkiste<br />
nachdrehten. Das Sprungbrett für die<br />
Karriere bot Sam Raimi, <strong>der</strong> Joel 1981<br />
als Regieassistenten für den Horrorfilm<br />
„The Evil Dead“, „Tanz <strong>der</strong> Teufel“ engagierte.<br />
Mittlerweile sind die Coens in<br />
vielen Genres sattelfest.<br />
Für die Hollywood-Persiflage „Barton<br />
Fink“ bekamen sie Gold in Cannes.<br />
Für ihre Kidnapper-Geschichte „Fargo“<br />
kassierten sie den Drehbuch-Oscar. Mit<br />
<strong>der</strong> Gewalt-Groteske „No Country for<br />
Old Men“ räumten sie bei den Academy<br />
Awards dreifach ab. Ihr letztes Werk, <strong>der</strong><br />
Western „True Grit“, brachte es auf zehn<br />
Oscar-Nominierungen.<br />
DER NEUE STREICH handelt von ihrem<br />
Lieblingsthema: dem Versager, <strong>der</strong> als<br />
trotziges Stehaufmännchen gegen die<br />
Windmühlen des Schicksals ankämpft.<br />
Die Coens glauben an den verkannten<br />
Musikus und lassen ihn zum Auftakt<br />
ein komplettes Lied anstimmen. Ausgespielte<br />
Songs im Film entpuppen sich<br />
sonst als Gähneinlagen. Im Kino-Universum<br />
<strong>der</strong> lässigen Regie-Brü<strong>der</strong> gelten eigene<br />
Gesetze, holprige Titel inklusive.<br />
Zu diesen Regeln gehört das Scheitern<br />
<strong>der</strong> Helden, die sich nicht verbiegen<br />
lassen wollen. Das große Thema vom<br />
Ausverkauf <strong>der</strong> Ideale hängen die Coens<br />
aber niedrig auf. „In seiner übertriebenen<br />
Vorstellung erlebt Llewyn sich als<br />
sehr integrer Musiker, auf gewisse Weise<br />
mag er das sein. Gleichwohl ist er bereit,<br />
vor einem wichtigen Produzenten auf<br />
dem Boden zu kriechen“, erläutet Ethan.<br />
Seit über 20 Jahren bewahren sie<br />
ihre eigene Handschrift. „Die Welt hat<br />
uns mehr künstlerischen Freiraum gegeben<br />
als diesem Typen im Film. Insofern<br />
können wir uns glücklich schätzen“,<br />
meint Ethan. „Man darf den Faktor<br />
Glück niemals unterschätzen“, fügt sein<br />
älterer Bru<strong>der</strong> hinzu. Wo man diese<br />
Grenze zieht zwischen Ausverkauf und<br />
aufrechtem Gang? Ethan antwortet im<br />
Coen-Stil. „Man zieht seine rote Linie,<br />
wo man seine Linie eben zieht.“<br />
Die Brü<strong>der</strong> führen nicht nur gemeinsam<br />
Regie, sie machen den Schnitt, übernehmen<br />
die Produktion und schreiben<br />
die Drehbücher zusammen. „Eigentlich<br />
kann man nicht von einem Prozess sprechen“,<br />
sagt <strong>der</strong> eine. „Wir sitzen herum.<br />
Reden manchmal etwas. Und legen viele<br />
Schlafpausen ein“, ergänzt <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e.<br />
Von minimalistischen Aussagen berichten<br />
auch Schauspieler: „Mit Feedback<br />
sollte man nicht rechnen“, erinnert<br />
sich Hauptdarsteller Oscar Isaac. Ob die<br />
beiden beim Thema Tiere gesprächiger<br />
werden? Immerhin spielt eine Katze eine<br />
entscheidende Rolle im neuen Film und<br />
hört, wie George Clooney in „O Brother<br />
Where Art Thou“ auf den Namen „Ulysses“.<br />
„Katzen sind zum Kotzen, je<strong>der</strong><br />
Dreh mit einem Tier dauert ewig und ist<br />
frustrierend“, stöhnt Ethan. „Nie wie<strong>der</strong><br />
Katzen für die Coens!“, fügt Joel hinzu.<br />
Fast kann man sich denken, was<br />
beide von Prädikaten wie „Kult“ und<br />
„Cool“ halten. „Solche Etiketten waren<br />
immer schon ein Rätsel für mich“, meint<br />
Joel. Bru<strong>der</strong> Ethan ergänzt: „Über irgendwelchen<br />
Kultstatus machen wir uns<br />
keine Gedanken. Wer möchte sich schon<br />
in eine Schublade stecken lassen?“<br />
DIETER OSSWALD traf das kreative<br />
Duo gut ein halbes Dutzend Mal. So<br />
vergnüglich wie ihre Werke sind die<br />
Macher nicht – besser als umgekehrt<br />
Foto: Picture Press/Camera Press/Rob Greig/Time Out<br />
122<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
SALON<br />
Porträt<br />
DER GEISTERBESCHWÖRER<br />
Er schreibt und spielt, singt und swingt: Ulrich Tukur gibt <strong>der</strong> Liebe zum Morbiden<br />
denkbar viele, höchst vitale Formen. Und immer ist da diese Hoffnung, dass es an<strong>der</strong>s wäre<br />
Von BJÖRN EENBOOM<br />
Foto: interTOPICS/Photomovie/Max&Douglas<br />
Kaum ein Ort ist geeigneter für eine<br />
Begegnung mit Ulrich Tukur als<br />
das Frankfurter Literaturhaus. Das<br />
klassizistische Gebäude mit seinem imposanten<br />
Portikus beschwört den Geist<br />
des vielbegabten Gastes herauf. Tukur<br />
hat sich fernab aller digitalen Hochgeschwindigkeit<br />
dem entschleunigten Habitus<br />
des frühen 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts verschrieben.<br />
Gleich achtmal ließ er sich<br />
einen Anzug schnei<strong>der</strong>n in Form und<br />
Farbe eines Originals <strong>der</strong> dreißiger Jahre.<br />
Bei Lesungen trägt er ihn stets.<br />
In seinen Rollen verhandelt Tukur<br />
das Fragmentarische, Abseitige. Er spielt<br />
Charaktere mit dem berühmten Knacks,<br />
die im Mahlwerk des Lebens verloren<br />
gehen, dem Jenseits näherstehen als <strong>der</strong><br />
Erde. In „Das weiße Band“ war er ein<br />
herrschsüchtiger Baron, in „Rommel“<br />
<strong>der</strong> titelgebende NS-General und „Wüstenfuchs“,<br />
in „Das Leben <strong>der</strong> An<strong>der</strong>en“<br />
ein regimetreuer Oberstleutnant.<br />
„Mich rühren“, sagt er, „Menschen<br />
zutiefst, die einen aussichtslosen Kampf<br />
kämpfen. Die Aufgabe eines Schauspielers<br />
besteht auch darin, die Figuren zu verteidigen,<br />
die er spielt. Wie ein Strafverteidiger<br />
einen Verbrecher verteidigt.“ So<br />
hält er es im aktuellen Kinofilm „Houston“<br />
des Regisseurs und Autors Bastian<br />
Günther, <strong>der</strong> dafür bei den Hofer Filmtagen<br />
mit dem För<strong>der</strong>preis Neues Deutsches<br />
Kino prämiert worden ist.<br />
Tukur spielt den Headhunter Clemens<br />
Trunschka, <strong>der</strong> von einem deutschen<br />
Konzern beauftragt wird, den<br />
Spitzenmanager eines texanischen Ölunternehmens<br />
abzuwerben. Doch die<br />
Mechanismen <strong>der</strong> globalisierten Wirtschaftswelt<br />
haben Trunschka lädiert. Alkoholkrank<br />
ist er längst, das Band zur Familie<br />
wird dünn und dünner. Im fernen<br />
Texas soll er mit allen Mitteln Kontakt zu<br />
dem Topmanager aufnehmen. Bald irrt<br />
Trunschka in den Hotel- und Häuserwüsten<br />
Houstons ziellos umher: ein<br />
Wünschelrutengänger des Geldes, dem<br />
<strong>der</strong> Kompass entzweibrach. Aus dem<br />
Psychogramm eines Alkoholikers wird<br />
ein Roadmovie, ein Wirtschaftswestern.<br />
Dieser Trunschka sei „ein Mensch<br />
im turbokapitalistischen System, <strong>der</strong><br />
verzweifelt versucht, seine Fassade aufrechtzuerhalten“.<br />
Tukur sieht in <strong>der</strong><br />
Gegenwart eine „Zivilisation, die uns<br />
Menschen beschädigt. Wir haben etwas<br />
losgetreten, das uns überrennt. Die Geschwindigkeit,<br />
die wir angeschlagen haben,<br />
ist einfach viel zu schnell. Wir sind<br />
als Menschen ganz an<strong>der</strong>s disponiert.“<br />
ÄHNLICH DÜSTERE KLÄNGE stimmt <strong>der</strong><br />
zwischen den Künsten frei schwebende<br />
Ulrich Tukur in <strong>der</strong> Novelle „Die Spieluhr“<br />
an, die er soeben vorgelegt hat. Sie<br />
beruht auf dem französischen Kinofilm<br />
„Séraphine“, in dem Tukur den preußischen<br />
Kunstsammler Wilhelm Uhde verkörperte.<br />
Nun erzählt er eine spielerische<br />
Variante zu diesem Film. Die Figuren<br />
werden buchstäblich aufgesogen von den<br />
Gemälden eines verwunschenen Schlosses<br />
und kommen <strong>der</strong> Realität abhanden.<br />
Zwar fehle beim Schreiben <strong>der</strong> Sparringspartner.<br />
„Aber“ – bricht es aus Tukur<br />
hervor – „du lernst deine Ängste<br />
kennen. Eigentlich ist die Novelle die<br />
Geschichte meines Todes. Sie ist beseelt<br />
von dem Wunsch weiterzuleben, wenigstens<br />
in <strong>der</strong> Kunst, in Gemälden, <strong>der</strong> Musik.<br />
Aber auch vor dieser Welt habe ich<br />
Angst. Sie ist unheimlich.“<br />
So zeigt „Die Spieluhr“ auch, dass<br />
Tukurs große Leidenschaft <strong>der</strong> Musik<br />
gilt. „Musik ist die Königin <strong>der</strong> Künste“,<br />
schwärmt er, „sie zielt aus <strong>der</strong> Seele direkt<br />
in die Herzen.“ Vor 18 Jahren gründete<br />
er die Tanzkapelle „Rhythmus<br />
Boys“, die den Charme <strong>der</strong> „Roaring<br />
Twenties“ aufleben lässt. Mit dem Quartett<br />
hat er als singen<strong>der</strong> Frontmann bisher<br />
vier Alben veröffentlicht.<br />
Das Nachdenken über den Tod begann<br />
früh. Im Jugendzimmer in Wedemark<br />
bei Großburgwedel, wohin die<br />
Familie des gebürtigen Viernheimers<br />
umgezogen war, hatte er eine Wand mit<br />
ganzseitigen Todesanzeigen aus <strong>der</strong> FAZ<br />
dekoriert. Über dem Epitaphium thronte<br />
ein Gemälde seines Großvaters, eines<br />
Kunstmalers. Es zeigte: einen sterbenden<br />
Soldaten im Dreißigjährigen Krieg.<br />
<strong>Der</strong> Hang zum Morbiden bleibt die<br />
Konstante über alle Umbrüche hinweg.<br />
Tukur lebt in <strong>der</strong> vom Untergang bedrohten<br />
Lagunenstadt Venedig. Nein, düster<br />
sei er gar nicht, depressiv nicht, „ich bitte<br />
Sie!“, höchstens von einer „mediterranen<br />
Melancholie“ angesteckt, einer lebenszugewandten<br />
Traurigkeit. „Wenn man<br />
über das 50. Lebensjahr gesprungen ist<br />
und aus dem Paradies vertrieben wurde,<br />
ist man umstellt vom Tod. Gerade dann<br />
darf man sich den Schneid nicht abkaufen<br />
lassen. Du musst weitermarschieren,<br />
in Würde und Aufrichtigkeit. Da ist mir<br />
eine italienische Traurigkeit viel näher<br />
als eine robuste deutsche Depression.“<br />
In diesen fellinihaften Tönen ist <strong>der</strong><br />
für Mitte Dezember angekündigte neue<br />
„Tatort“ namens „Schwindelfrei“ mit Tukur<br />
als Ermittler Felix Murot gehalten.<br />
Spielort ist ein Zirkus. Murot schleust<br />
sich als Pianist in die Zirkusband ein,<br />
dargestellt von den „Rhythmus Boys“.<br />
<strong>Der</strong> darauffolgende „Tatort“, verspricht<br />
Tukur feixend, werde ein echter<br />
Paukenschlag: „47 Menschen kommen<br />
da ums Leben. Das hat noch nicht einmal<br />
ein österreichischer Krimi geschafft.“<br />
BJÖRN EENBOOM sympathisiert wie Ulrich<br />
Tukur mit den tragischen Charakteren im Film.<br />
BlockbusterHelden sind ihm ein Graus<br />
125<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
SALON<br />
Report<br />
KNARRE?<br />
GASPEDAL!<br />
Videospiele wie Grand Theft Auto<br />
bieten eine perfekte Flucht<br />
aus <strong>der</strong> Wirklichkeit.<br />
In ihrer zynischen Machowelt<br />
soll die Moral schweigen<br />
Von ALEXANDER PSCHERA<br />
126<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Anzeige<br />
Buchtipps: <strong>Der</strong><br />
Erste Weltkrieg<br />
Christopher Clark<br />
Die Schlafwandler<br />
(gelesen v. Frank Arnold)<br />
4 MP3-CDs, 29 Std. 17 Min.,<br />
29,99 € (D), auch<br />
im Download erhältlich<br />
ISBN 978-3-8371-2329-6<br />
Bahnbrechende Darstellung über<br />
den Ausbruch des Ersten Weltkriegs<br />
Trug Deutschland wegen seiner Großmachtträume<br />
wirklich die Hauptverantwortung am<br />
Ersten Weltkrieg? <strong>Der</strong> renommierte Historiker<br />
Christopher Clark kommt jetzt zu einer an<strong>der</strong>en<br />
Einschätzung. Das ungekürzte Hörbuch wird<br />
gelesen von Regisseur Frank Arnold.<br />
Hans Fenske<br />
<strong>Der</strong> Anfang vom Ende<br />
des alten Europa<br />
OLZOG 2013, 144 Seiten,<br />
Broschur, € 19,90,<br />
ISBN 978-3-7892-8348-2<br />
Wer wollte den Krieg, wer den Frieden?<br />
Viele Fragen, die »Urkatastrophe des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts«<br />
betreffend, sind noch nicht geklärt<br />
o<strong>der</strong> müssen neu gestellt werden. <strong>Der</strong> Freiburger<br />
Historiker Prof. Hans Fenske nimmt sich<br />
dieser Aufgabe an.<br />
Nicolas Wolz<br />
Und wir verrosten<br />
im Hafen<br />
dtv 2013, 352 Seiten,<br />
gebunden mit Schutzumschlag,<br />
21,90 € (D),<br />
ISBN 978-3-423-28025-9<br />
Das Fiasko <strong>der</strong> deutschen Flotte<br />
»Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser« verkündete<br />
Wilhelm II. Doch die Marine blieb<br />
gefangen im Wartezustand und zerstörerischer<br />
Kaisertreue bis sie sich 1919 selbst versenkte.<br />
Ein faszinieren<strong>der</strong> Einblick anhand von Tagebüchern,<br />
Briefen und Erinnerungen.<br />
Anzeige<br />
SALON<br />
Report<br />
Stellen Sie sich vor: Sie sitzen<br />
vor dem Fernseher und lauschen<br />
den Dialogen von John<br />
Travolta und Samuel L. Jackson<br />
in Quentin Tarantinos<br />
Film „Pulp Fiction“. Auf einmal bleibt<br />
das Bild stehen. Verärgert greifen Sie zur<br />
Fernbedienung – und plötzlich sind Sie<br />
mitten im Film, den Sie als Ihr eigener<br />
Regisseur mit einem Eingabegerät steuern.<br />
Sie werfen Jackson aus dem Auto,<br />
<strong>der</strong> Ihnen einen Fluch hinterherschickt.<br />
Sie steigen ein, lassen den Motor aufheulen,<br />
machen einen U-Turn und reißen<br />
dabei einen Hydranten aus <strong>der</strong> Verankerung.<br />
Wasser prasselt auf die Windschutzscheibe.<br />
Eine Polizeisirene heult<br />
auf. Die Stadt gleitet fotorealistisch an<br />
Ihnen vorüber. Auf nassem Asphalt<br />
spiegelt sich die Neonbeleuchtung eines<br />
Nachtclubs. Sie stellen den Wagen ab, erholen<br />
sich. Danach klauen Sie einen bulligen<br />
Ford und rasen stundenlang durch<br />
die Metropole, über <strong>der</strong> die Sonne versinkt.<br />
Die Welt gehört Ihnen. Tarantino<br />
kann in Rente gehen.<br />
So ähnlich fühlt sich das Videospiel<br />
Grand Theft Auto an. Wild, unberechenbar,<br />
grell. Hinter dem Kürzel<br />
GTA verbergen sich ein amerikanischer<br />
Straftatbestand, „schwerer Kraftfahrzeugdiebstahl“,<br />
und das erfolgreichste<br />
Videospiel aller Zeiten. Die Serie wurde<br />
1997 gestartet und ging soeben mit<br />
GTA V in die fünfte Runde. Dan und Sam<br />
Houser, die Grün<strong>der</strong> des produzierenden<br />
Rockstar-Studios, sind die Wun<strong>der</strong>kin<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Videospielindustrie.<br />
DIE GESAMTE BRANCHE hat im vergangenen<br />
Jahr mit einem Umsatzvolumen von<br />
weltweit 31 Milliarden Dollar die 28 Milliarden<br />
<strong>der</strong> Filmbranche hinter sich gelassen.<br />
Allein in Deutschland wurden<br />
gewaltige 73 Millionen Videospiele verkauft.<br />
Die meisten Spiele, so auch GTA,<br />
werden auf Konsolen gespielt, auf Sonys<br />
„Play Station“ und <strong>der</strong> „X-Box“ von<br />
Microsoft. Die grafischen Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> neuen Games sind handelsüblichen<br />
Computern längst über den Kopf gewachsen.<br />
Diese Konsolen, zwischen 400 und<br />
500 Euro teuer, werden direkt an den<br />
Fernseher angeschlossen und über sogenannte<br />
Controller, wuchtige Fernbedienungen<br />
mit vielen Knöpfen und Schaltern,<br />
gesteuert.<br />
Um die Figuren und Fahrzeuge durch<br />
die rasanten Szenerien zu bewegen, benötigt<br />
man viel Übung. Bestimmte Bewegungen<br />
und Manöver lassen sich nur<br />
ausführen, wenn mehrere Knöpfe gleichzeitig<br />
gedrückt werden. Selbst erfahrene<br />
Computerspieler haben oft Mühe, ein Fadenkreuz<br />
bei einem Konsolenspiel präzise<br />
zu justieren. Vor allem dann, wenn<br />
neben ihnen gerade ein Öltank explodiert<br />
und die Figur durch ein trümmerübersätes<br />
Schlachtfeld sprinten muss.<br />
Die grafische Perfektion <strong>der</strong> Spiele<br />
hat ihren Preis: GTA kostet <strong>der</strong>zeit im<br />
Handel rund 60 Euro. Die Produktionskosten<br />
liegen mit 265 Millionen Dollar<br />
deutlich über denen eines Hollywoodfilms.<br />
Auch <strong>der</strong> Umsatz <strong>der</strong> Spiele bewegt<br />
sich in an<strong>der</strong>en Regionen. GTA V<br />
spielte allein am ersten Verkaufswochenende<br />
weltweit annähernd eine Milliarde<br />
US-Dollar ein. Zum Vergleich: <strong>Der</strong> Erfolgsfilm<br />
„Gravity“ mit George Clooney<br />
und Sandra Bullock liegt nach mehreren<br />
Wochen Präsenz auf den Kinoleinwänden<br />
des Globus bei gerade einmal<br />
365 Millionen Dollar.<br />
Wo das Geld bei GTA V hinfloss,<br />
sieht man sofort: Das Spiel ist eine Orgie<br />
an visueller Präzision. Alles fühlt sich<br />
real an, hautnah, brutal sinnlich. Man<br />
kann sich in dieser Welt frei bewegen.<br />
„Open World“ heißt das Konzept in <strong>der</strong><br />
Sprache <strong>der</strong> Videospiele.<br />
In <strong>der</strong> fiktiven Stadt Los Santos, die<br />
unverkennbar Los Angeles nachempfunden<br />
ist, stimmt alles – das kleinste Architekturdetail,<br />
das Wetter, die urbane<br />
Geräuschkulisse. Gesprächsfetzen von<br />
Handytelefonaten schwirren vorbei, das<br />
Autoradio dudelt lokale Werbespots,<br />
nasse Joggingschuhe quietschen wie<br />
Plastikenten, im Ghetto wächst schmutziges<br />
Gras aus dem Asphalt. Fast meint<br />
man, das verbrannte Gummi <strong>der</strong> Autoreifen<br />
und den Urin <strong>der</strong> Hinterhöfe<br />
riechen zu können. Die Kulisse von<br />
„Pulp Fiction“ ist angesichts dieses Realitätssogs<br />
kaum mehr als ein barockes<br />
Guckkastentheater.<br />
<strong>Der</strong> Pixelirrsinn von GTA ist kein<br />
Selbstzweck. Er formuliert einen neuen<br />
Stil. Man könnte ihn „Hardcore-Realismus“<br />
nennen. Über die Bil<strong>der</strong>rampe<br />
gleitet man in ein Universum aus Gewalt,<br />
Drogen und Pornografie. Die offizielle<br />
Altersfreigabe „ab 18“ ist angemessen.<br />
Illustrationen: Rockstar Games [M] (Seiten 126 bis 129)<br />
Alle Bücher sind in<br />
Ihrer Buchhandlung erhältlich<br />
128<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Anzeige<br />
GTA V sorgt<br />
für antizivilisatorische<br />
Hypnose.<br />
Bereits das<br />
Autofahren<br />
wird dabei zur<br />
Therapie<br />
Das Spiel hat keinerlei pädagogischen<br />
Nutzen. Es erfüllt eine ganz an<strong>der</strong>e<br />
Funktion: Es befreit den Spieler aus <strong>der</strong><br />
Überregulierung einer nicht nur in politischer<br />
Hinsicht manisch korrekten Welt.<br />
Indem GTA nicht auf einem fernen<br />
Planeten o<strong>der</strong> einem Schlachtfeld in <strong>der</strong><br />
arabischen Wüste spielt, son<strong>der</strong>n in den<br />
Schluchten <strong>der</strong> Urbanität, macht es die<br />
Grenzüberschreitung, den Regelbruch erlebbar.<br />
Das ist <strong>der</strong> Kunstgriff, <strong>der</strong> GTA<br />
zum neuen medialen Paradigma formt:<br />
Dieses Universum ist real genug, um<br />
Identifikation zu ermöglichen, aber ausreichend<br />
fiktiv, um als Ausbruch aus dem<br />
engen Alltag großer Koalitionen mit minimalen<br />
Ideen empfunden zu werden.<br />
GTA V hat eine fundamental <strong>der</strong>egulierende<br />
Funktion. Es bietet ein Format<br />
für antizivilisatorische Hypnose, bei<br />
<strong>der</strong> schon das bloße Autofahren zur Therapie<br />
wird. Lohnsteuerkarten, Dispokredite<br />
und Krankenkassen wirken aus <strong>der</strong><br />
GTA-Optik wie Relikte eines früheren<br />
Lebens.<br />
Unsere oftmals moraldiktatorische<br />
Gesellschaft hat diese Form animalischer<br />
Befreiung offenbar nötig. An<strong>der</strong>s<br />
ist <strong>der</strong> Erfolg <strong>der</strong> GTA-Serie nicht zu erklären.<br />
Das Videospiel übernimmt dabei<br />
die Rolle des Kinos. Diesen Trend bestätigt<br />
Christian Schiffer, Spieleexperte und<br />
Grün<strong>der</strong> <strong>der</strong> ambitionierten deutschen<br />
Games-Zeitschrift WASD. Texte über<br />
Games: „Dass Hollywoodstars in Games<br />
auftauchen wie zuletzt Ellen Page und<br />
Willem Dafoe in ‚Beyond: Two Souls‘ für<br />
die ‚Play Station‘, wird bald schon völlig<br />
normal werden. Zugleich werden Spiele<br />
sich in ein Mittel verwandeln, durch das<br />
die Entwickler persönliche Statements<br />
zu gesellschaftlichen Problemen abgeben<br />
können. Autoren-Games werden<br />
eine ähnliche Funktion einnehmen wie<br />
heute noch die Autorenfilme.“<br />
FRÜHER WAR DAS KINO <strong>der</strong> Ort <strong>der</strong> Freiheit.<br />
Filme waren ein Medium <strong>der</strong> Entgrenzung<br />
und des Stressabbaus. Doch je<br />
stärker die Digitalisierung des Kinos voranschreitet<br />
und je ähnlicher die Oberflächen<br />
von Filmen und Spielen einan<strong>der</strong><br />
werden, desto anziehen<strong>der</strong> werden<br />
Games. Ein durchanimierter Film unterscheidet<br />
sich von einem Spiel nur noch<br />
dadurch, dass <strong>der</strong> Betrachter nicht in ihn<br />
einsteigen kann. Ein interaktives Game<br />
ist da für viele die bessere Alternative.<br />
Mit GTA sind Games zum gesellschaftlichen<br />
Leitmedium geworden, auch wenn<br />
sie <strong>der</strong> bildungsbürgerliche Kanon unter<br />
„Trash“ einreiht.<br />
Man könnte GTA ein „Super- o<strong>der</strong><br />
Metamedium“ nennen, sagt Christian<br />
Schiffer: In <strong>der</strong> Welt von GTA kann<br />
man ins Kino gehen, fernsehen, Zeitung<br />
lesen, Radio hören. In Zukunft könnte<br />
sich ein Großteil des <strong>Medien</strong>konsums in<br />
Welten wie Los Santos abspielen. „Ingame-Marketing“<br />
nennt sich das künftige<br />
Geschäftsmodell, bei dem virtuelle Werbeflächen<br />
in Spielestädten ebenso real<br />
vermarktet werden wie Downloadportale<br />
wie Spotify. So hermetisch, wie sie<br />
aussieht, ist die digitale Welt also nicht.<br />
Spiele definieren nicht nur die Art<br />
und Weise, wie zukünftig Geld verdient<br />
Wie reich und mächtig sind die<br />
Kirchen wirklich? Spielt Religion<br />
in einem säkularisierten<br />
Deutsch land noch eine Rolle?<br />
Matthias Drobinski zeigt, warum<br />
es gut ist, wenn Staat und<br />
Religionen zusammen arbeiten,<br />
und welche Voraussetzungen<br />
dafür nötig sind.<br />
256 S. / geb. mit Schutzumschlag<br />
€ 19,99 (D) / € 20,60 (A) / CHF* 28,50<br />
ISBN 978-3-579-06595-3<br />
*empf. Verkaufspr.<br />
GÜTERSLOHER<br />
VERLAGSHAUS<br />
www.gtvh.de<br />
GLAUBEN LEBEN...<br />
... o<strong>der</strong><br />
Politik machen?<br />
Was soll und was will die<br />
evangelische Kirche heute?<br />
Eine Streitschrift zum Themenjahr<br />
2014 „Religion und Politik“ in <strong>der</strong><br />
Lutherdekade.<br />
NEU<br />
„Die Führung des Staates muss nicht<br />
heilig sein, auch seine Regierung<br />
braucht keine christliche sein. Es genügt<br />
völlig, dass im Staat die Vernunft<br />
herrscht.“<br />
Martin Luther 1528 (WA 27, 418, 3-4)<br />
480 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag<br />
ISBN 978-3-7892-8351-2 · EUR 48,00<br />
129<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013<br />
www.olzog.de
Sa melbeilage von<br />
Sa melbeilage von<br />
Liebe, Gesundheit, Karriere: Immer weniger wollen<br />
wir dem Zufall überlassen. Doch wie weit reicht<br />
unsere Kontrolle?<br />
16-SEITIGES<br />
BOOKLET<br />
Sammelbeilage von<br />
Nr. 12<br />
Nr. 10<br />
Nr. 1<br />
„Die Welt als Wi le und Vorste lung"<br />
Buch IV, Paragraf 57<br />
„<strong>Der</strong> Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt” (1792/93)<br />
SOMMERAUSGABE<br />
NR. 05 / 2013<br />
0 4<br />
Deutschland 6,90 €<br />
Österreich: 7 €; Schweiz: 12,50 SF; Luxemburg: 7,40 €.<br />
Italien & Spanien: Auf Nachfrage.<br />
0 5<br />
192451 806907<br />
4 192451 806907 0 5<br />
4 192451 806907<br />
Die Welt<br />
mit<br />
philosophischen<br />
Augen<br />
betrachten<br />
Sammelbeilage von<br />
Woher kommt<br />
das<br />
Böse ?<br />
Es erschüttert unsere Welt, ist das radikal Fremde.<br />
Doch wenn an<strong>der</strong>e ihm verfallen, kann es dann<br />
auch mich erfassen?<br />
Ein Tag als perfekter Utilitarist<br />
Peter Singer unterzieht seine<br />
umstrittene Ethik dem Praxistest<br />
„Selbstverwirklichung<br />
ist zur Zumutung geworden“<br />
Gespräch mit Rahel Jaeggi<br />
Nr. 13<br />
René<br />
Descartes<br />
Das Experiment des Zweifelns<br />
„Meditationen über die Grundlagen <strong>der</strong> Philosophie“ (1641)<br />
Pussy Riot < > Slavoj Žižek<br />
Wie stabil<br />
ist das System ?<br />
Ein Briefwechsel aus dem Gefängnis<br />
Liegt das<br />
gute<br />
Leben<br />
auf dem<br />
Entscheidet<br />
<strong>der</strong><br />
Land?<br />
Zufall<br />
mein Leben ?<br />
Michael Sandel im Dialog<br />
mit Peer<br />
Steinbrück<br />
Wie viel Ungleichheit ist gerecht?<br />
Stéphane Hessels<br />
Vermächtnis<br />
Vermesse dich selbst!<br />
„Ich wurde im KZ zum Europäer“<br />
Gespräch mit Imre Kertész:<br />
Von den Amazonen zu den Femen<br />
Künstliche Befruchtung<br />
Eltern werden um jeden Preis?<br />
16-SEITIGES<br />
BOOKLET<br />
16-SEITIGES<br />
BOOKLET<br />
SCHOPEN<br />
HAUER<br />
Die Grünen und Heidegger<br />
Ist das Leben sinnlos?<br />
Goethe<br />
Die Erschließung <strong>der</strong> Natur<br />
Descartes<br />
Den Zweifel besiegen<br />
Wie werde ich<br />
(ein bisschen)<br />
freier ?<br />
Wir haben so viele Möglichkeiten wie noch nie,<br />
trotzdem fühlen wir uns ständig eingeengt.<br />
Welche Wege führen in ein selbstbestimmteres Leben?<br />
Eine wegweisende Wahlverwandtschaft<br />
„Es gibt keine wahre Religion“<br />
Gespräch mit dem Ägyptologen Jan Assmann<br />
Was macht Fußball schön ?<br />
Volker Finke im Dialog mit Gunter Gebauer<br />
SCHOPENHAUER<br />
ALBERT CAMUS<br />
Das Glück <strong>der</strong> Rebellion<br />
Die Macht des Willens<br />
Goethe<br />
JUNI/JULI<br />
NR. 04 / 2013<br />
Gestalte dein Werden !<br />
Deutschland 6,90 €<br />
Öste reich: 7 €; Schweiz: 12,50 SF; Luxemburg: 7,40 €.<br />
Italien & Spanien: Auf Nachfrage.<br />
4 1 9 2 4 5 1 8 0 6 9 0 7 0 4<br />
4 1 9 2 4 5 1 8 0 6 9 0 7<br />
OKTOBER/NOVEMBER<br />
NR. 06 / 2013<br />
WINTERAUSGABE<br />
NR. 01 / 2014<br />
Die neue Ausgabe,<br />
jetzt am Kiosk !<br />
Bestellen Sie<br />
Ihr Probeabo<br />
für nur<br />
15 €<br />
statt 20,70 €<br />
Abo-Service<br />
>>> +49 (0)40 / 41 448 463<br />
>>> www.philomag.de/abo<br />
>>> philomag@pressup.de<br />
Anzeige<br />
SALON<br />
Report<br />
wird, son<strong>der</strong>n auch, wie Geschichten erzählt<br />
und erlebt werden: crossmedial,<br />
interaktiv, offen. GTA V hat ein faszinierendes<br />
narratives Muster, das dieser<br />
Welt ohne Richtung Orientierung verleiht<br />
und sie damit von gescheiterten virtuellen<br />
Räumen in <strong>der</strong> Art von „Second<br />
Life“ unterscheidet. Es wirkt wie eine<br />
blutgetränkte Antwort auf Richard David<br />
Prechts so harmlose Frage nach dem<br />
Ich und den vielen. <strong>Der</strong> Spieler hat hier<br />
die Freiheit, ständig zwischen drei verschiedenen<br />
Figuren hin- und herzuwechseln,<br />
<strong>der</strong>en Wege sich kreuzen: Franklin<br />
ist ein kleiner Autodieb aus dem Ghetto,<br />
Michael ein pensionierter Gangster, den<br />
„Sopranos“ entsprungen, <strong>der</strong> sich in einer<br />
Villa über <strong>der</strong> Stadt verschanzt, und Trevor<br />
ein psychopathischer Drogendealer,<br />
<strong>der</strong> auch mit Waffen handelt.<br />
ZWISCHEN DIESEN FIGUREN entspinnt<br />
sich eine gut choreografierte Geschichte<br />
mit überraschenden Wendungen. Am<br />
Ende kann man sich entscheiden, einen<br />
<strong>der</strong> Protagonisten ins Jenseits zu beför<strong>der</strong>n,<br />
ehe nach mindestens 30 Stunden<br />
Spieldauer wie anno dazumal im<br />
Lichtspielhaus <strong>der</strong> Abspann über den<br />
Flatscreen läuft. <strong>Der</strong> Spieler kann zwischendurch<br />
aber auch das skurrile Universum<br />
<strong>der</strong> Nebenfiguren erkunden.<br />
Zum Beispiel lässt sich mit dem<br />
am Hals tätowierten und strohdummen<br />
Gangster Lamar und seinem fetten<br />
Rottweiler Chop das Ghetto aufmischen.<br />
Mehr darf über den Gang <strong>der</strong> Geschichte<br />
nicht verraten werden. Das gebietet ein<br />
ungeschriebenes Gesetz <strong>der</strong> Gamingwelt,<br />
die das „Spoilern“, das Verraten von<br />
zentralen Handlungselementen, unter<br />
Höchststrafe stellt. Das Schreiben über<br />
neue Spiele ist eine eigene journalistische<br />
Disziplin geworden, bei <strong>der</strong> es darum<br />
geht, viel zu sagen, ohne zum Spielver<strong>der</strong>ber<br />
zu werden.<br />
Man verrät allerdings kein Geheimnis,<br />
wenn man darauf hinweist, dass die<br />
Dialoge von GTA urkomisch und filmreif<br />
sind. Wenn sich Lamar und Franklin<br />
im <strong>der</strong>bsten Jargon darüber unterhalten,<br />
wessen Bild nun in den „Mitarbeiter<br />
des Monats“-Rahmen gehört, dann ist<br />
das eine würdige Replik auf das philosophische<br />
Gequassel in „Pulp Fiction“.<br />
Die Figuren selbst sind dagegen vollkommen<br />
ironielos. Sonst könnten sie<br />
Die distanzlos<br />
präsentierte<br />
Gewalt macht<br />
Videospiele<br />
für viele<br />
unerträglich,<br />
beson<strong>der</strong>s für<br />
Frauen. Das soll<br />
sich än<strong>der</strong>n<br />
nicht <strong>der</strong>egulierend funktionieren. Ein<br />
Gangster, <strong>der</strong> sich selbst bewitzelt, ist<br />
eine schlechte Projektionsfigur für Ausbruchsfantasien.<br />
Diese distanzlose Hermetik<br />
<strong>der</strong> Gewalt macht Videospiele für<br />
viele so unerträglich und ausweglos.<br />
GTA ist ein extremes Beispiel für<br />
diese Ausweglosigkeit. Will man die Geschichte<br />
Trevors zu Ende spielen, muss<br />
man einen vermeintlichen Terroristen<br />
mit Faustschlägen, Elektroschocks o<strong>der</strong><br />
heftigeren Methoden wie Waterboarding<br />
und Zähneziehen foltern, um an Informationen<br />
zu gelangen, die für das Weiterspielen<br />
notwendig sind. Versagt dabei<br />
das Herz des Opfers, wird es mit Adrenalin<br />
belebt. Für eine neue Folterrunde.<br />
Diese Szene hat dem Spiel viel Kritik<br />
eingebracht. In einigen Län<strong>der</strong>n, unter<br />
Illustration: Rockstar Games<br />
www.philomag.de<br />
130<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Anzeige<br />
Foto: Jürgen Bauer<br />
an<strong>der</strong>em in Japan, wurde sie geschnitten,<br />
in <strong>der</strong> deutschen Version ist sie spielbar.<br />
Die entscheidende Frage lautet: Ist die<br />
Sequenz ausreichend als Satire markiert?<br />
Während Human-Rights-Organisationen<br />
wie „Freedom from Torture“<br />
Menschenrechte für Spielefiguren einfor<strong>der</strong>n,<br />
beharren Spieleexperten wie<br />
Michael Graf, stellvertreten<strong>der</strong> Chefredakteur<br />
<strong>der</strong> deutschen Spielezeitschrift<br />
Gamestar, auf <strong>der</strong> Doppelbödigkeit <strong>der</strong><br />
Szene: „Die GTA-Serie war schon immer<br />
bissiger Spott, satirische Abrechnung mit<br />
den Schattenseiten des amerikanischen<br />
Traumes. In diesen Kontext passt auch<br />
die Folterszene von GTA V. Sie führt den<br />
Spielern brutal, aber auch brutal ehrlich<br />
die Abgründe des ‚Kampfes gegen den<br />
Terror‘ vor Augen: Man muss einen Mann<br />
misshandeln, um eine letztlich sinnlose<br />
Mission zu erfüllen.“<br />
Graf gesteht ein, dass <strong>der</strong> satirische<br />
Unterton nicht für jeden Spieler klar erkennbar<br />
ist. An<strong>der</strong>erseits seien die brutalen<br />
Szenen „ein mutiges Statement gegen<br />
Untaten, die tatsächlich begangen werden<br />
– und sogar, wie es heißt, zu unserem<br />
Schutz, in unserem Namen. GTA V<br />
hält uns den Spiegel vor, zwingt uns zur<br />
Konfrontation mit Tatsachen, mit denen<br />
wir uns lieber nicht beschäftigen wollen.<br />
Das Medium Spiel wird erwachsen.“<br />
Dennoch kann die bewusste Sequenz<br />
nicht ohne Weiteres als ethische<br />
Reflexion über die Legitimation von<br />
Folter gelesen werden wie vergleichbare<br />
Szenen in Kathryn Bigelows Film „Zero<br />
Dark Thirty“ o<strong>der</strong> jüngst in Denis Villeneuves<br />
„Prisoners“. Auch die Tatsache,<br />
dass im Spiel die Regierung persönlich<br />
den Folterbefehl erteilt, macht die<br />
Sequenz nicht umstandslos zur Satire.<br />
Will man GTA V zu Ende spielen, gibt<br />
es keine Alternative, als in die Rolle des<br />
Folterknechts zu schlüpfen.<br />
Damit positioniert sich das Spiel außerhalb<br />
des moralischen Diskurses. Moralisch<br />
relevant wäre das Spiel, wenn<br />
<strong>der</strong> Spieler die Freiheit zur Entscheidung<br />
hätte. Das würde bedeuten, mehrere<br />
Handlungsfäden anzubieten und<br />
dem Spieler die Wahl zu lassen, welchen<br />
Weg er gehen will. Ein solches Szenario<br />
könnte zu einem Instrument ethischer<br />
Reflexion werden, zu einer Simulation<br />
moralischen Handelns, die die Missstände<br />
<strong>der</strong> realen Welt kritisch spiegelt.<br />
Das Spiel greift zwar immer wie<strong>der</strong><br />
gesellschaftliche Probleme auf: Rassismus,<br />
Drogen, Frauenfeindlichkeit, den<br />
Diebstahl sozialer Daten. Facebook heißt<br />
im GTA-Slang Life Inva<strong>der</strong>. Aber daraus<br />
folgt nichts. Es gibt keine Botschaft.<br />
<strong>Der</strong> Hyperrealismus verdichtet sich nie<br />
zur Sozialkritik. Für die Probleme dieser<br />
Welt gibt es genau zwei Lösungen: den<br />
Abzug und das Gaspedal.<br />
WEIL JEDE KRITISCHE DISTANZ zum eigenen<br />
Ich fehlt, sind GTA und Konsorten<br />
für die an<strong>der</strong>e Hälfte <strong>der</strong> Weltbevölkerung<br />
uninteressant: für die Frauen.<br />
Stolze 85 Prozent <strong>der</strong> Gamer sind Männer.<br />
Los Santos ist eine maskuline Architektur,<br />
in <strong>der</strong> man auch ein Bordell<br />
aufstöbern kann. Entsprechend schaut<br />
das weibliche GTA-Personal aus: Es ist<br />
vollbusig, willig, extrem verdorben und<br />
gerne blond. Christian Schiffer von <strong>der</strong><br />
Zeitschrift WASD. Texte über Games<br />
sieht aber eine Umkehr voraus: „Die<br />
Zielgruppe für Spiele ist in den letzten<br />
Jahren größer, älter und vor allem<br />
weiblicher geworden. Dieser Trend wird<br />
sich fortsetzen. Die Zielgruppe wird anspruchsvoller,<br />
insbeson<strong>der</strong>e, was den Inhalt<br />
und die Handlung anbelangt.“<br />
Da stellt sich unweigerlich die Frage:<br />
Welche Form postindustrieller Meditation<br />
müssen Videogames bieten, um<br />
künftig auch von Frauen als Ventil für<br />
ihren Alltagsdruck erkannt zu werden?<br />
Braucht es Küchenzerstörungssequenzen?<br />
Kin<strong>der</strong>zimmerapokalypsen?<br />
Kastrationsfantasien?<br />
Vielleicht sieht die Zukunft <strong>der</strong> Games<br />
aber auch ganz an<strong>der</strong>s aus. <strong>Der</strong>zeit<br />
sind mehr als 88 Prozent <strong>der</strong> Spieleentwickler<br />
männlich. Doch immer mehr<br />
Frauen drängen in den Markt. Spiele, die<br />
von Frauen mitentwickelt werden, sind<br />
an<strong>der</strong>s. Bestes Beispiel ist die erfolgreiche<br />
Familiensimulation „Die Sims“. Vielleicht<br />
kann man ja demnächst in Grand<br />
Theft Auto VI einfach Brombeeren pflücken<br />
und mit Freunden ums Lagerfeuer<br />
sitzen, statt wehrlosen Menschen mit <strong>der</strong><br />
Kombizange Backenzähne aus dem Kiefer<br />
zu drehen.<br />
ALEXANDER PSCHERA ist ein gestresster<br />
Kulturphilosoph („Vom Schweben“), <strong>der</strong><br />
sich abends gerne bei Rotwein und GTA V<br />
von den Mühen des Alltags erholt<br />
131<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013<br />
Roman. Geb. 337 S. € 19,95 (D)<br />
Auch als eBook erhältlich<br />
»Marion Poschmanns<br />
Sonnenposition ist ein<br />
virtuos gearbeiteter<br />
Roman, <strong>der</strong> in einer<br />
dunkel funkelnden<br />
Sprache die Rän<strong>der</strong><br />
unserer Wirklichkeit<br />
ausleuchtet.«<br />
Sandra Kegel, FAZ<br />
Wilhelm-Raabe-<br />
Literaturpreis 2013<br />
Suhrkamp<br />
www.suhrkamp.de
SALON<br />
Hopes Welt<br />
DANKE, DU MICH AUCH!<br />
Wie ich in Frankreich einmal lernte, dass Musiker vor keinem<br />
Kraftwort zurückschrecken, um böse Geister zu bannen<br />
Von DANIEL HOPE<br />
Kommt alles Gute von oben, wie es in<br />
<strong>der</strong> Bibel heißt? Lässt es sich herbeiflehen,<br />
durch fromme Wünsche o<strong>der</strong> Beschwörungsformeln?<br />
Niemand weiß es. Trotzdem hat<br />
sich die Menschheit nie von dem Versuch<br />
abhalten lassen, dem Schicksal in die Karten<br />
zu sehen.<br />
Lang ist die Kette von vermeintlich sicheren<br />
Methoden, den Schleier des großen Geheimnisses<br />
zu lüften, angefangen beim Orakel in Delphi<br />
bis zum Horoskop in <strong>der</strong> Tageszeitung. Und immer<br />
wie<strong>der</strong> gab es Wahrsager und Wun<strong>der</strong>heiler,<br />
denen man übersinnliche Fähigkeiten zutraute,<br />
ob es die Vogelbeschauer im alten Rom waren<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> unheimliche Rasputin.<br />
Dass man Musikern und beson<strong>der</strong>s Komponisten<br />
eine beson<strong>der</strong>e Anfälligkeit für alles<br />
Über natürliche zuschreiben muss, will ich nicht<br />
behaupten. Aber Beispiele hat es zweifellos gegeben.<br />
Es bleibt schwer zu beurteilen, ob es sich<br />
dabei um Grenzfälle geistiger Verwirrung handelte.<br />
Bei Musikern ist es üblich, dass wir uns<br />
Sprüche überlegen, um den bösen Geistern aus<br />
dem Weg zu gehen. Neulich, kurz vor meinem<br />
Auftritt in Moskau, sagten mir meine russischen<br />
Freunde, dass man zum Schulterklopfen<br />
„geh zum Teufel!“ antworten müsse und sich<br />
niemals bedanken dürfe. Irgendwann in Frankreich<br />
hatte mir ein Mitstreiter auf dem Weg zur<br />
Bühne „Je vous dis merde“ zugeraunt. Ich glaubte,<br />
mich verhört zu haben. Er wünschte mir Scheiße?<br />
Nicht viel besser erging es mir in Italien.<br />
„In bocca al lupo!“, rief mir jemand vor einem<br />
Konzert zu. Als ich ihn völlig verständnislos<br />
ansah, sagte er nur, ich müsse mit „Crepi il lupo!“<br />
antworten. Hinterher habe ich im Wörterbuch<br />
nachgeschlagen und begriffen, dass er mir das<br />
„Maul des Wolfes“ an den Hals gewünscht<br />
hatte und ich daraufhin mit <strong>der</strong> Parole „Tod dem<br />
Wolf“ zu reagieren hatte. Angeblich geht <strong>der</strong><br />
Spruch auf die kapitolinische Wölfin zurück, von<br />
<strong>der</strong> Romulus und Remus gesäugt wurden.<br />
Verglichen mit Exkrementen, Raubtieren und<br />
Satan, kommt mir das im deutschen Sprachraum<br />
übliche „Hals- und Beinbruch“ sehr zivil vor.<br />
Am besten, so die abergläubische Theorie, führt<br />
man die Dämonen dadurch in die Irre, dass man<br />
das Gegenteil von dem sagt, was man meint.<br />
Das funktioniert deshalb leicht, weil die unliebsamen<br />
Gesellen nicht nur böse, son<strong>der</strong>n obendrein<br />
von sehr begrenzter Intelligenz sind.<br />
Wünscht man also einem Musiker vor dem Auftritt<br />
nicht Glück und Erfolg, son<strong>der</strong>n eben<br />
Hals- und Beinbruch, halten die Geister eigenes<br />
Eingreifen für überflüssig, weil ihnen Schlimmeres<br />
als eine Mehrfachfraktur für einen<br />
Geiger nicht einfällt.<br />
Wobei die Täuschung durch das Wort<br />
„Beinbruch“ zu Shakespeares Theaterzeiten eine<br />
Spur subtiler war: Üblicherweise warf das<br />
Publikum, wenn es mit <strong>der</strong> Vorstellung zufrieden<br />
war, Trinkgel<strong>der</strong> auf die Bühne. Wenn sich<br />
die Schauspieler danach bückten, brachen sie<br />
sich zwar nicht die Beine, verrenkten diese aber,<br />
um an das Kleingeld zu kommen. Je häufiger sie<br />
es tun konnten, desto höher waren ihre Einnahmen.<br />
Zum Glück ist diese Art <strong>der</strong> Abendgage passé.<br />
DANIEL HOPE ist Violinist von Weltrang. Sein<br />
Memoirenband „Familien stücke“ war ein Bestseller.<br />
Zuletzt erschienen sein Buch „Toi, toi, toi! – Pannen<br />
und Katastrophen in <strong>der</strong> Musik“ ( Rowohlt ) und<br />
die CD „The Romantic Violinist“. Er lebt in Wien<br />
Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
132<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Dahinter steckt<br />
immer ein kluger Kopf.<br />
www.faz.net<br />
Jens Weidmann, Bundesbankpräsident
SALON<br />
Gespräch<br />
„BEIM ISLAM<br />
IST ES HEIKLER“<br />
Rémi Brague ist Frankreichs Mann für Glaube und<br />
Diesseits. <strong>Der</strong> Religionsphilosoph lehrte an <strong>der</strong><br />
Sorbonne, schrieb über die „Weisheit <strong>der</strong> Welt“ und<br />
„Europa – seine Kultur, seine Barbarei“. Ein Pariser<br />
Gespräch mit dem Experten für arabische Philosophie<br />
über die Abgründe und Aufschwünge des Menschen<br />
134<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Was meinen wir eigentlich, wenn wir<br />
Religion sagen, Monsieur Brague?<br />
Rémi Brague: Sie haben damit die<br />
schwierigste Frage gleich zu Beginn gestellt.<br />
<strong>Der</strong> Begriff ist eine relativ späte<br />
Prägung aus christlichem Geist. Eigentlich<br />
können wir erst seit 1799 von Religion<br />
reden, seit Friedrich Schleiermachers<br />
Reden „Über die Religion“. Mit<br />
Schleiermacher beginnt die Geschichte<br />
des Religionsbegriffs im Westen. Er<br />
nannte die Religion ein Gefühl, später<br />
das „Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“<br />
von dem einen Gott, und grenzte es<br />
so vom Wissen einerseits, vom Tun an<strong>der</strong>erseits<br />
ab.<br />
Inwiefern drückt sich in einer solchen<br />
Definition christlicher Geist aus?<br />
Diese Vorfestlegung grenzt viele Bereiche<br />
aus, die in nichtwestlichen Kulturen<br />
essenziell zur Religion gehören. Im<br />
Buddhismus etwa gibt es die Vorstellung<br />
eines Gottes nur am Rande. Für Muslime<br />
wie<strong>der</strong>um ist das Recht das Zentrum ihrer<br />
Religion. Die Mystik ist im Islam erlaubt,<br />
die Ausübung <strong>der</strong> religiösen Pflichten<br />
hingegen ist erfor<strong>der</strong>lich. Auch <strong>der</strong><br />
Dschihad, den wir mit Krieg übersetzen<br />
müssen, zählt untrennbar zum Islam. Die<br />
älteste Biografie Mohammeds – von Ibn<br />
Ishaq aus dem 8. Jahrhun<strong>der</strong>t – zeigt, dass<br />
die militärische Dimension im Leben des<br />
Propheten überall präsent war. Zumindest<br />
nach <strong>der</strong> Hidschra, seiner Auswan<strong>der</strong>ung<br />
von Mekka nach Medina.<br />
damit ist auch <strong>der</strong> Anspruch gemeint,<br />
den die Wahrheit auf den Gläubigen erhebt.<br />
Augustinus trennt sehr schön eine<br />
veritas lucens, eine offenbarte Wahrheit<br />
also, die leuchtet und erleuchtet, und eine<br />
veritas redarguens. Darunter versteht er<br />
jene Wahrheit, die herausfor<strong>der</strong>t, die den<br />
Gläubigen angreift, ihn bloßstellt. Auch<br />
Levinas und Heidegger haben diese Unterscheidung<br />
aufgegriffen.<br />
Irrte Jan Assmann also?<br />
Ich bezweifle stark, dass die polytheistischen<br />
Religionen weniger gewalttätig<br />
waren. Denken Sie an die Menschenopfer<br />
im Namen <strong>der</strong> aztekischen Religion<br />
o<strong>der</strong> bei meinen Vorfahren, den Galliern.<br />
Außerdem müssen wir differenzieren, in<br />
welcher Form Gewalt in den sogenannten<br />
heiligen Büchern erscheint. Wird von ihr<br />
erzählt, o<strong>der</strong> wird zu ihr aufgerufen? Das<br />
Alte Testament schil<strong>der</strong>t etwa die grausame<br />
Eroberung Kanaans. Ganze Völker<br />
werden ausgerottet, man kann fast von<br />
einem Genozid sprechen. Es handelt sich<br />
um einen rückblickenden Albtraum in einer<br />
Zeit, da es die kanaanitischen Völker<br />
nicht mehr gibt. Hier liegt erzählte, aber<br />
nicht erwünschte Gewalt vor.<br />
Gibt es religiös erwünschte Gewalt?<br />
Gerne wird in diesem Zusammenhang<br />
auf den berühmten Psalm 137<br />
verwiesen. Dort lesen wir, die Säuglinge<br />
Babylons sollten gepackt und „am Felsen<br />
zerschmettert“ werden. Das ist eindeutig<br />
ein Wunschtraum, eine Rachefantasie aus<br />
<strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Unterdrückten. Es kommt<br />
oft vor, dass die Opfer mit ihren Henkern<br />
nicht eben höflich verfahren. Zudem ist<br />
es eine zeitgebundene Aussage. An<strong>der</strong>s<br />
stellt sich die Lage im Koran dar. Weil<br />
er das Werk eines ewigen und allwissenden<br />
Gottes ist, gelten die Gebote für<br />
jede Epoche, haben die Aufrufe zur Unterdrückung<br />
von Ungläubigen kein Ablaufdatum.<br />
Man könnte, einen berühmten<br />
Spruch abwandelnd, sagen: Jede Epoche<br />
ist unmittelbar zum Koran.<br />
Auch durch die Geschichte des Christentums<br />
zieht sich eine Blutspur. Die Kreuzzüge,<br />
die Inquisition, <strong>der</strong> Dreißigjährige<br />
Krieg sind Etappen. Verdanken sich<br />
diese Gewaltexplosionen alle einer falschen<br />
Lektüre des Neuen Testaments?<br />
Selbst wenn Ihnen diese Antwort<br />
vielleicht nicht schmecken wird: Im Fall<br />
des Christentums muss man sagen, dass<br />
die Gewalttäter ihrer eigenen Religion<br />
untreu geworden sind. Dadurch wird natürlich<br />
keine einzige Brutalität geringer.<br />
Beim Islam ist es abermals heikler, eben<br />
aufgrund dessen zeitloser Gültigkeit. In<br />
<strong>der</strong> Biografie des Propheten gibt es eine<br />
Szene, in <strong>der</strong> Mohammed anordnet, den<br />
Fotos: Patrick Gaillardin/Picturetank für <strong>Cicero</strong><br />
Gibt es eine generelle Geneigtheit zur<br />
Gewalt in den monotheistischen Religionen,<br />
weil diese einen Wahrheitsanspruch<br />
erheben? In diesem Sinne sind<br />
die Arbeiten Jan Assmanns verstanden<br />
worden. Auch Benedikt XVI. sprach<br />
beim letzten Treffen mit seinem Schülerkreis<br />
im Sommer 2012 davon: „<strong>Der</strong><br />
Gedanke von Wahrheit und <strong>der</strong> von Intoleranz“,<br />
so <strong>der</strong> damalige Papst, „haben<br />
sich fast völlig miteinan<strong>der</strong> verschmolzen,<br />
und so wagen wir gar nicht<br />
mehr, an Wahrheit zu glauben, von<br />
Wahrheit zu sprechen.“<br />
Das ist schon wie<strong>der</strong> eine sehr verzwickte<br />
Frage. <strong>Der</strong> Wahrheitsanspruch<br />
in den monotheistischen Religionen bindet<br />
in zwei Richtungen. Es handelt sich<br />
nicht nur um den Anspruch auf Wahrheit,<br />
den <strong>der</strong> Gläubige erhebt. Nein,<br />
135<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
SALON<br />
Gespräch<br />
Schatzmeister eines gerade besiegten<br />
Stammes zu foltern, um an dessen Geld<br />
zu kommen. Die Zentralfigur des heute<br />
in Saudi-Arabien herrschenden wahabitischen<br />
Islam, Ibn Taimiya (13. Jahrhun<strong>der</strong>t),<br />
zieht daraus die Schlussfolgerung,<br />
es sei erlaubt, einen Dieb zu foltern.<br />
So entsteht eine Rechtsquelle, über die<br />
zu diskutieren nicht gestattet ist, da sie<br />
auf einer Tat des Propheten beruht. Aus<br />
demselben Grund scheiterte vor einigen<br />
Jahren <strong>der</strong> Versuch des iranischen Parlaments,<br />
das Mindestalter für die Verheiratung<br />
von Mädchen auf zwölf Jahre<br />
zu erhöhen. Die Mullahs argumentierten,<br />
dass <strong>der</strong> Prophet bereits mit seiner<br />
neunjährigen Braut die Ehe vollzogen<br />
habe. Damit war die Gesetzesinitiative<br />
vom Tisch. Mohammed gilt Muslimen als<br />
„das schönste Vorbild“.<br />
<strong>Der</strong> Aufruf des heiligen Bernhard von<br />
Clairvaux zum zweiten Kreuzzug, „Deus<br />
lo vult“, „Gott will es“, ist auch kein<br />
menschenfreundliches Motto gewesen.<br />
Gewiss nicht. Und doch müssen wir<br />
uns vor dem Lupeneffekt hüten – davor<br />
also, mit <strong>der</strong> Lupe die Abgründe des<br />
Westens in den alleinigen Fokus zu rücken.<br />
Die Geschichte etwa Amerikas vor<br />
Kolumbus ist ebenso wenig makellos wie<br />
die Geschichte des Nahen Ostens, ehe <strong>der</strong><br />
Monotheismus entstand.<br />
Es gab also Gewalt ausdrücklich im Namen<br />
von polytheistischen Religionen?<br />
Das ist schon wie<strong>der</strong> nicht so einfach<br />
zu sagen. <strong>Der</strong> Unterschied zwischen Religion<br />
und Staat existierte damals kaum.<br />
Ob man im Namen des Volkes Gottes<br />
o<strong>der</strong> des Königs o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Nation Menschen<br />
schlachtete, war nicht zu entscheiden.<br />
In <strong>der</strong> vormonotheistischen Welt gab<br />
es Religion als eigenständiges Phänomen<br />
gar nicht. Krieg zwischen den Völkern<br />
war immer auch ein Krieg zwischen konkurrierenden<br />
Göttern. Mit dem Aufkommen<br />
des Monotheismus trat nicht die Gewalt<br />
in die Welt, wohl aber fand sie eine<br />
neue Form. Im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t haben<br />
dann bekanntlich zwei spätatheistische<br />
Regimes unter nationalsozialistischen<br />
beziehungsweise marxistisch-leninistischen<br />
Vorzeichen die Gewalttaten <strong>der</strong><br />
Religionen um ein Vielfaches übertroffen.<br />
Hitler verstand den Nationalsozialismus<br />
als eine „wissenschaftliche Lehre“,<br />
kühl und streng – so sagte er es zumindest<br />
1936. Wenn er vom Allmächtigen<br />
und <strong>der</strong> Vorsehung schwafelte, dachte<br />
er in darwinistischen Kategorien. Bisher<br />
gibt es keinen Grund zur Annahme,<br />
dass ein Atheismus, einmal zur Macht<br />
gelangt, lammfromm wäre.<br />
Das Problem ist demnach <strong>der</strong> Mensch,<br />
nicht seine Religion. Also liegt im<br />
Menschen eine Versuchung zu Gewalt<br />
und <strong>Blutrausch</strong>?<br />
Es gibt lei<strong>der</strong> einen grundlegenden<br />
Fanatismus, <strong>der</strong> sich innerhalb wie außerhalb<br />
einer Religion austoben kann.<br />
Auch wissenschaftlichen Fanatismus<br />
kann es geben. Ich schreibe gerade an<br />
einem Buch mit dem Titel „Die Herrschaft<br />
des Menschen“ und lese dazu, was<br />
<strong>der</strong> herausragende britische Chemiker<br />
John Desmond Bernal 1929 zu Papier<br />
brachte. Er for<strong>der</strong>te, den Menschen wissenschaftlich<br />
zu verbessern, und wurde<br />
so ein Ahnherr des Transhumanismus.<br />
Wenn es den wissenschaftlich verbesserten,<br />
den schöneren, klügeren, kräftigeren<br />
Menschen gäbe, dann – so Bernal –<br />
müsse dieser neue Mensch vermutlich<br />
die Zahl <strong>der</strong> übrigen, <strong>der</strong> nicht verbesserten<br />
Menschen verringern. Diese Ausmerzung<br />
<strong>der</strong> Missgeratenen erinnert<br />
doch sehr an die Vernichtung von Ungläubigen.<br />
Es ist eine sehr alte und eben<br />
auch ganz aktuelle Versuchung.<br />
Die Globalisierung macht vor den Religionen<br />
nicht halt. Sollten sie miteinan<strong>der</strong><br />
ins Gespräch kommen? Ist <strong>der</strong> interreligiöse<br />
Dialog, wie es oft heißt, ein Mittel<br />
zum Frieden?<br />
Religionen können nicht miteinan<strong>der</strong><br />
ins Gespräch kommen, son<strong>der</strong>n nur<br />
Menschen, die eine Religion haben. Im<br />
Bereich des Islam ist ein solches Gespräch<br />
beson<strong>der</strong>s schwierig, weil <strong>der</strong> Islam<br />
sich als eine Religion begreift, die<br />
Judentum und Christentum überflüssig<br />
gemacht hat. Ich rate generell eher zum<br />
interkulturellen als zum interreligiösen<br />
Gespräch. Lassen sie uns reden darüber,<br />
wie die verschiedenen Menschen ihren<br />
Glauben zum Ausdruck bringen. Reden<br />
wir über Gebetsmethoden, über das Fasten,<br />
über das Pilgern. Sobald man den Inhalt<br />
des Geglaubten berührt, wachsen die<br />
Schwierigkeiten exponentiell.<br />
Für ein solches Gespräch scheinen die<br />
Partner abhandenzukommen. Selbst in<br />
Frankreich, das einmal <strong>der</strong> Kirche erste<br />
Tochter hieß, glauben nur noch 16 Prozent<br />
an einen persönlichen Gott, wie ihn<br />
das Christentum voraussetzt. Macht<br />
die Säkularisierung des Westens Religionsgespräche<br />
obsolet?<br />
Europa beschreitet einen Son<strong>der</strong>weg.<br />
Und offenbar bekommt ihm die<br />
Foto: Patrick Gaillardin/Picturetank für <strong>Cicero</strong><br />
136<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
zunehmende Säkularisierung nicht beson<strong>der</strong>s,<br />
wenn ich mir die demografischen<br />
Fakten anschaue. Ist Europa vielleicht<br />
heute schon eine rosa geschminkte<br />
Leiche? <strong>Der</strong> Atheismus scheint nicht in<br />
<strong>der</strong> Lage zu sein, die grundlegende Frage<br />
zu beantworten, warum es unbedingt<br />
Menschen geben sollte.<br />
Sie schrieben davon in Ihrem Buch zur<br />
„Weisheit <strong>der</strong> Welt“: „Wir wissen nicht<br />
mehr, warum es moralisch gut ist, dass<br />
es Menschen in dieser Welt gibt.“<br />
Wirklich? Das ist ja erstaunlich. Mir<br />
war dieser Satz ganz entfallen, ich will<br />
ihn in „Herrschaft des Menschen“ ausführlich<br />
behandeln. Rousseau sagte einmal:<br />
<strong>Der</strong> Atheismus bringt keine Menschen<br />
um, aber er verhin<strong>der</strong>t, dass neue<br />
geboren werden. Wenn mit dem Tod alles<br />
aus ist, ist es ein extrem undemokratischer<br />
Akt, Menschen ins Leben zu rufen,<br />
ohne sie davor um ihre Erlaubnis<br />
zu fragen.<br />
„Bisher gibt es<br />
keinen Grund<br />
zur Annahme, dass<br />
ein Atheismus, zur<br />
Macht gelangt,<br />
lammfromm wäre“<br />
Rémi Brague, bis 2012 Inhaber des<br />
GuardiniLehrstuhls in München<br />
sich in religiöse wie in nichtreligiöse Formen<br />
kleiden, manche Religionen aber<br />
haben o<strong>der</strong> hatten ein durchaus ambivalentes<br />
Verhältnis zur Gewalt. Schließen<br />
möchte ich mit einem schönen Gedanken,<br />
den ich ebenfalls in „Weisheit<br />
<strong>der</strong> Welt“ gefunden habe. Sie schreiben,<br />
die Technik sei in <strong>der</strong> Neuzeit „eine Art<br />
PSH_1213_210x140_<strong>Cicero</strong>:Layout Ziehen wir ein Fazit: Die 1 Versuchung<br />
04.11.2013 14:44 Moral“ Uhr geworden, Seite „und 1 vielleicht sogar<br />
zur Gewalt ist unausrottbar, sie kann die wahre Moral“. Nimmt die Technik<br />
damit die Rolle einer Religion in postreligiöser<br />
Zeit ein?<br />
Die Welt erscheint heute in <strong>der</strong> Regel<br />
als schlecht, das ist die große gnostische<br />
Versuchung <strong>der</strong> Neuzeit. Darum<br />
soll sie verbessert werden mithilfe <strong>der</strong><br />
Technik. Religion und Moral dürfen wir<br />
aber nicht in eins setzen. Das Christentum<br />
zum Beispiel brachte gar keine neue<br />
Moral in die Welt, es geht in moralischer<br />
Hinsicht nicht über die Zehn Gebote hinaus.<br />
Es gibt überhaupt keine christliche<br />
Son<strong>der</strong>moral. Es gibt jetzt lediglich<br />
Gnade und Vergebung als neue Zutaten<br />
zur globalen Heilsökonomie – also eine<br />
neu gewährte Freiheit zum unmoralischen<br />
Tun und zur Umkehr. Das Christentum<br />
ist kein Knäuel aus Religion und<br />
Volk wie im Judentum, aus Religion und<br />
Recht wie im Islam, aus Religion und<br />
Weisheitslehre wie im Buddhismus. Das<br />
Christentum ist nur eine Religion. Eine<br />
Religion gewissermaßen mit Punkt und<br />
Absatz. Aus.<br />
Das Gespräch führte<br />
ALEXANDER KISSLER<br />
Anzeige<br />
„Wie hast du das gemeint?“<br />
Die Geschenkidee<br />
zu Weihnachten<br />
Liebe schützt nicht vor<br />
Missverständnissen.<br />
Gerade Paare reden häufig<br />
aneinan<strong>der</strong> vorbei. Doch<br />
mit klugen Techniken des<br />
Zuhörens und Miteinan<strong>der</strong>sprechens<br />
lassen sich<br />
Konflikte entschärfen.<br />
+ Wie man Geld richtig<br />
ausgibt<br />
+ Autisten im Job: Was<br />
sie besser können<br />
+ Wenn das eigene<br />
Kind „an<strong>der</strong>s“ ist<br />
PSYCHOLOGIE<br />
HEUTE<br />
Was uns bewegt.<br />
Jetzt auch<br />
als App<br />
Ein Jahr lang Psychologie Heute<br />
schenken – auf Wunsch auch schön<br />
verpackt.<br />
Geschenkabo unter:<br />
Telefon 0 62 01/60 07-330<br />
Fax 0 62 01/60 07-9331<br />
E-Mail:weihnachtsabo@beltz.de<br />
www.psychologie-heute.de
SALON<br />
Man sieht nur, was man sucht<br />
DIONYSOS am Machtpol,<br />
<strong>der</strong> WELTKRIEG als Kunstwart Von<br />
BEAT WYSS<br />
Rund 1400 Bil<strong>der</strong> umfasst die verschollen geglaubte Sammlung des<br />
Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt – auch „Pferde“ von Franz Marc<br />
Nein, es ist nicht <strong>der</strong> weiterhin<br />
verschollene „Turm<br />
<strong>der</strong> Blauen Pferde“, jenes<br />
legendäre Gemälde von<br />
Franz Marc, wovon zur<br />
Nachkriegszeit Poster in Zimmern von<br />
Mädchen hingen, die gern Tierärztin<br />
werden und reiten lernen wollten. Die<br />
schlichte Gouache auf Papier zeigt eine<br />
In Hitlers Auftrag erwarb<br />
Gurlitt Meisterwerke zu<br />
Schnäppchenpreisen. Sohn<br />
Cornelius hortete sie in einer<br />
Münchner Wohnung<br />
monochrom gehaltene Horde von Pferden,<br />
<strong>der</strong>en Rücken sich wie Wellen über<br />
ein Feld ergießen, um mit <strong>der</strong> Landschaft<br />
eins zu werden. Auf den ersten<br />
Blick ein unspektakuläres Blatt, verrät<br />
die kompakte, dynamische Komposition<br />
eine Formsprache, die Art Déco um<br />
mindestens ein Jahrfünft vorwegnimmt.<br />
Selten zeigt Marc so viel Ähnlichkeit<br />
Foto: Marc Müller/Picture Alliance/dpa<br />
138<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Foto: Artiamo<br />
mit Wassily Kandinsky, seinem Mitstreiter<br />
im Geist des „Blauen Reiters“,<br />
wie in dieser abstrakten Reduktion von<br />
Tierleibern, rhythmisch skandiert mit<br />
schwarzer Zeichnung.<br />
Mit dem Münchner Fund muss<br />
Marcs Bedeutung in <strong>der</strong> Kunstgeschichte<br />
nicht umgeschrieben werden.<br />
Dennoch wirkt das nun entdeckte Depot,<br />
das über 300 Werke <strong>der</strong> „entarteten<br />
Kunst“ enthalten soll, wie ein Blindgänger:<br />
Noch 70 Jahre nach dem Zusammenbruch<br />
vermag die Kulturpolitik <strong>der</strong><br />
Nationalsozialisten Schockwellen auf<br />
die Gegenwart auszusenden.<br />
Die Affäre erinnert an die immer<br />
wie<strong>der</strong> verdrängte Tatsache, dass viele<br />
Mitläufer des „Dritten Reiches“ als politische<br />
Opportunisten im Kunstbetrieb<br />
nach dem Krieg wichtige Stellungen einnahmen,<br />
zumal, wenn sie im Ruf standen,<br />
die verfolgte Avantgarde in schwieriger<br />
Zeit geför<strong>der</strong>t zu haben. Aber im<br />
Fall von Hildebrand Gurlitt, <strong>der</strong> bis<br />
1956 den Düsseldorfer Kunstverein leitete,<br />
muss kritische Häme im Hals stecken<br />
bleiben: Will man es dem Kunsthändler<br />
verübeln, dass es dem „jüdischen<br />
Mischling zweiten Grades“ gelang, sich<br />
und seine Familie unbeschadet durch die<br />
Zeit <strong>der</strong> Rassenverfolgungen zu bringen?<br />
Wer hier verurteilt, muss sich fragen, wie<br />
viel politischen Wi<strong>der</strong>stand die eigene<br />
Zivilcourage aushalten würde.<br />
Was bei <strong>der</strong> Debatte außer Acht<br />
bleibt, sind die politischen Haltungen<br />
<strong>der</strong> damals verfemten Künstler, die als<br />
Opfer des Nationalsozialismus in die<br />
Kunstgeschichte eingegangen sind. Dabei<br />
wird vergessen, dass etliche Expressionisten<br />
mit <strong>der</strong> Bewegung sympathisierten,<br />
allen voran Emil Nolde, Mitglied <strong>der</strong><br />
NSDAP Nordschleswig <strong>der</strong> ersten Stunde.<br />
Als <strong>der</strong> Maler erfuhr, sein Werk werde<br />
im Rahmen <strong>der</strong> Münchner Ausstellung<br />
„Entartete Kunst“ von 1937 gezeigt, beschwerte<br />
sich das Parteimitglied brieflich<br />
bei Propagandaminister Goebbels.<br />
Zu diesem Zeitpunkt war Franz Marc<br />
über 20 Jahre tot, gefallen im Ersten Weltkrieg.<br />
Wie wir seinen Aufzeichnungen<br />
entnehmen, teilte er die Kriegsbegeisterung<br />
mit Ernst Jünger und Hun<strong>der</strong>ttausenden<br />
junger Männer seiner Generation.<br />
Krieg war ihm Fortsetzung <strong>der</strong><br />
Kunst mit <strong>der</strong> Waffe. Er stehe „mit pochenden<br />
Herzen am Anfang <strong>der</strong> Dinge“,<br />
schrieb Marc an <strong>der</strong> Westfront im Frühjahr<br />
1915: „Unsere Herzen zittern in dieser<br />
Kriegsstunde, nicht vor <strong>der</strong> Gefährlichkeit<br />
<strong>der</strong> Krise, son<strong>der</strong>n vor Freude, die<br />
böse, dunkle Stunde Europa’s erlebt zu haben.<br />
Das Aussfallsthor <strong>der</strong> That.“<br />
Aus den Briefen des Künstlers spricht<br />
ein Mystiker in Uniform, <strong>der</strong> im Schützengraben<br />
den Weltgeist <strong>der</strong> Erneuerung<br />
donnern hört. Die Apokalypse,<br />
vom „Blauen Reiter“ 1912 im Feld <strong>der</strong><br />
Kunst verkündet, war jetzt im Schlachtfeld<br />
angekommen. Marc empfand keinen<br />
Wi<strong>der</strong>sinn, während <strong>der</strong> Gefechtspausen<br />
zu zeichnen. Er fand sein Symbol im frei<br />
schweifenden Tier. Seine Pferde, die Rehe<br />
und beson<strong>der</strong>s das Raubtier haben ihren<br />
Artverwandten in Nietzsches „blon<strong>der</strong><br />
Bestie“. Marc strebte eine animalische<br />
Kunst an, die sich einfühlt in den ungebändigten,<br />
dionysischen Lebenstrieb. Inmitten<br />
des Geschützlärms fühlte er sich<br />
eins mit dem schöpferischen Schwung<br />
des Chaos. Dass er selbst von einer Kugel<br />
getroffen wurde – am 4. März 1916 in<br />
Verdun –, nahm er als Schicksal hin. In<br />
<strong>der</strong> mystischen Verschmelzung mit dem<br />
Weltwillen gab es keinen Tod.<br />
Im Schützengraben vom „Geheimen<br />
Europa“ träumend, war Marc überzeugt,<br />
dass <strong>der</strong> Sieg den Deutschen gebühre.<br />
<strong>Der</strong> gewonnene Krieg würde eine befriedete<br />
Menschheit für die Botschaften <strong>der</strong><br />
Avantgarde reif gemacht haben: „Es ist<br />
das Geheimnis <strong>der</strong> Schaffenden (wie <strong>der</strong><br />
Natur, dem Symbol <strong>der</strong> Schaffenden), gerade<br />
den Wi<strong>der</strong>sinn, das Spröde und Böse<br />
zu ihrem Werke zu gebrauchen.“<br />
Das Amt Rosenberg erwies sich noch<br />
nicht reif für Franz Marc, als es dessen Bil<strong>der</strong><br />
konfiszierte, um sie in München als<br />
„Entartete Kunst“ anzuprangern. Bald<br />
protestierte <strong>der</strong> Deutsche Offiziersbund<br />
dagegen, dass hier das Werk eines tapferen<br />
Kriegshelden in den Schmutz gezogen<br />
werde. Auf Wunsch <strong>der</strong> Kriegsveteranen<br />
und in Würdigung eines für das<br />
Vaterland Gefallenen, wurden Marcs Gemälde<br />
vom Pranger genommen. Unter<br />
den sechs Gemälden war jener „Turm<br />
<strong>der</strong> Blauen Pferde“: Kein Geringerer als<br />
Hermann Göring erwarb das Gemälde für<br />
seine Sammlung.<br />
<strong>Der</strong> Reichsfeldmarschall hatte Sinn<br />
für jenen Anflug von spirituellem Faschismus<br />
in einem Werk, das den spießigen<br />
Propagandaideologen verschlossen<br />
bleiben musste. Göring sah die Sache mit<br />
<strong>der</strong> „Entarteten Kunst“ nicht so eng. Er<br />
besaß Werke von Cézanne, van Gogh,<br />
Munch, die aus dem offiziellen Kanon<br />
verbannt worden waren.<br />
Im April 2001 brachte die Zeitschrift<br />
Art die Vermutung in Umlauf, <strong>der</strong> „Turm<br />
<strong>der</strong> Blauen Pferde“ befinde sich möglicherweise<br />
in einem Zürcher Banksafe unter<br />
<strong>der</strong> Bahnhofstraße. Wer weiß, vielleicht<br />
gibt es dazu bald Neuigkeiten.<br />
Zum Autor<br />
BEAT WYSS<br />
ist einer <strong>der</strong> bekanntesten<br />
Kunsthistoriker des Landes.<br />
Er lehrt Kunstwissenschaft<br />
und <strong>Medien</strong>philosophie an<br />
<strong>der</strong> Staatlichen Hochschule<br />
für Gestaltung in Karlsruhe<br />
139<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
SALON<br />
Literaturen<br />
Neue Bücher, Texte, Themen<br />
Roman<br />
Außen Klasse, innen hohl<br />
Edith Whartons Roman „Dämmerschlaf“ stammt von 1927 – ein<br />
Gesellschaftsbild, das unserer Jetztzeit verwirrend ähnlich sieht<br />
Um 7.30 Uhr Mentales Verjüngungstraining,<br />
8.00 Psychoanalyse,<br />
8.30 Stilles Meditieren,<br />
8.45 Gesichtsmassage, 9.45 Eurhythmische<br />
Übungen“, dazwischen und danach<br />
Frühstück, Post, Friseur und noch einiges<br />
an<strong>der</strong>e, immer im Halbstundentakt;<br />
ein Besuch beim Osteopathen und ein<br />
das Daseinsgefühl neu justieren<strong>der</strong> Termin<br />
beim Heiler müssen natürlich auch<br />
noch ins Tagesprogramm. Werden die<br />
vorgesehenen Zeiten strikt eingehalten,<br />
bleibt sogar Raum fürs gesellschaftliche<br />
Engagement – lässt es sich mit einem<br />
Scheck erledigen, umso besser. Abends<br />
ist man zum Dinner mit Freunden verabredet<br />
und beschließt den Tag mit dem Besuch<br />
eines Clubs, in dem die gerade angesagte<br />
Band spielt: Sage keiner, das Leben<br />
<strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Frau sei nicht ausgefüllt!<br />
Zur Einhaltung eines <strong>der</strong>art minutiös<br />
durchgeplanten Tageslaufs freilich<br />
braucht es eiserne Disziplin, sie ist überhaupt<br />
die erste Tugend <strong>der</strong> Strateginnen<br />
auf dem Felde <strong>der</strong> Selbstoptimierung.<br />
Das eigentliche Lebenskunststück aber<br />
muss als Surplus täglich neu hervorgebracht<br />
werden: Auf den gleichbleibend<br />
entspannten Eindruck kommt hier<br />
schließlich alles an.<br />
Wer in dieser uhrwerkartig abschnurrenden<br />
Lebensführung mit esoterischen<br />
Einschlägen die besseren Kreise<br />
im Deutschland des 21. Jahrhun<strong>der</strong>ts erkennt,<br />
täuscht sich allerdings. Es war<br />
das Jahr 1927, als die amerikanische<br />
Foto: Hulton Archive/Getty Images<br />
140<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Schriftstellerin Edith Wharton den Angehörigen<br />
<strong>der</strong> New Yorker Upper Class<br />
mit ihrem Roman „Dämmerschlaf“ den<br />
satirisch amüsant verzerrten Spiegel vorhielt.<br />
Dass sich darin frappieren<strong>der</strong>weise<br />
auch unsere eigene Gegenwart zu zeigen<br />
scheint, hängt mit einer bis in die Details<br />
reichenden Gemeinsamkeit zusammen –<br />
es geht um die enorme Anstrengung des<br />
Einzelnen, den schönen Schein von Stil<br />
und Klasse zu kultivieren.<br />
Edith Wharton wusste besser als an<strong>der</strong>e,<br />
wovon sie da sprach. 1862 in eine<br />
Familie des New Yorker Hochadels hineingeboren,<br />
die ihre Wurzeln bis zu den<br />
ersten Siedlern zurückverfolgen konnte,<br />
war sie selbst unter einem gesellschaftlichen<br />
Diktat aufgewachsen, das gerade<br />
Frauen kaum Spielraum zur persönlichen<br />
Entfaltung ließ; <strong>der</strong> Erziehungsdrill galt<br />
<strong>der</strong> Perfektionierung höchster Standards<br />
in Auftreten und Erscheinung. Geld war<br />
genug vorhanden: Die Männer hatten es<br />
als Anwälte, Immobilienmakler und Banker<br />
zu mehren, die Frauen wendeten es<br />
zur Verschönerung ihrer repräsentativen<br />
Häuser und Gartenanlagen an; Spenden<br />
für wohltätige Zwecke galten ebenso wie<br />
Zahlungen an aus dem Ru<strong>der</strong> gelaufene<br />
Familienmitglie<strong>der</strong> letztlich ebenfalls <strong>der</strong><br />
Repräsentation.<br />
Auf dieses Frauendasein war Edith<br />
Wharton selbst getrimmt worden. In einer<br />
arrangierten Ehe heiratete sie 1885<br />
einen ebenfalls aus bester Familie stammenden<br />
Anwalt aus Philadelphia. Als er<br />
psychisch erkrankte, zog sich das Paar in<br />
das von Wharton selbst entworfene und<br />
ausgestattete Landhaus in Massachusetts<br />
zurück. Im Jahr 1913, 51 Jahre alt, ließ<br />
sie sich scheiden – da war sie bereits eine<br />
erfolgreiche Autorin, die sich ihre Millionen<br />
durch Schreiben selbst verdiente.<br />
Sie verließ die USA, in Paris und in ihrem<br />
Landhaus in <strong>der</strong> Provence entstand<br />
1920 <strong>der</strong> Roman, <strong>der</strong> sie zur Weltautorin<br />
machte: „Zeit <strong>der</strong> Unschuld“ (1993 verfilmt<br />
von Martin Scorsese). Nach Amerika<br />
kam sie zum letzten Mal 1923, um –<br />
als erste Frau – die Ehrendoktorwürde<br />
<strong>der</strong> Yale University entgegenzunehmen.<br />
Den Pulitzer-Preis hatte sie, ebenfalls als<br />
erste Frau, bereits 1921 erhalten, für den<br />
Nobelpreis war sie seit den späten zwanziger<br />
Jahren immer wie<strong>der</strong> im Gespräch.<br />
„Dämmerschlaf“ war Whartons 18.<br />
Roman, und er geriet endgültig zu einer<br />
Perfekt<br />
durchgestyled,<br />
mit eisern fit<br />
gehaltenem<br />
Körper, geht es<br />
nachmittags<br />
ab zum<br />
neuesten Heiler<br />
ironiegesättigten Abrechnung mit ihren<br />
eigenen Klassengenossen, insbeson<strong>der</strong>e<br />
aber mit <strong>der</strong>en weiblichen Leitfiguren.<br />
Hatte sie in früheren Büchern den Fokus<br />
vor allem auf die Domestizierung <strong>der</strong><br />
weiblichen Charaktere gelegt, so zeigte<br />
„Dämmerschlaf“ nun die innere Verheerung<br />
<strong>der</strong>er, die sich die gesellschaftlichen<br />
Regeln in nachgerade militärischer<br />
Manier zu eigen gemacht hatten. Perfekt<br />
gestyled, keine Mühe zur Jung erhaltung<br />
des alternden Körpers scheuend und<br />
für die bisweilen irritierte Seele von einem<br />
Wun<strong>der</strong>heiler zum nächsten eilend,<br />
hat die Protagonistin Pauline Manford<br />
sich selbst und ihre Umwelt eisern im<br />
Griff: „Mrs Manfords Tagesplan war unumstößlich.<br />
Selbst Krankheit und Tod<br />
verursachten darin kaum einen leisen<br />
Wellenschlag. Man hätte genauso gut<br />
versuchen können, eine Pyramide mit<br />
einem Sonnenschirm zum Einsturz zu<br />
bringen, wie den Gedanken wagen, das<br />
eng gefügte Mosaik von Mrs Manfords<br />
Terminkalen<strong>der</strong> durcheinan<strong>der</strong>zubringen.<br />
Nicht einmal Mrs Manford selbst<br />
hätte dies zuwege gebracht, beim besten<br />
Willen nicht, und wie Mrs Manfords Kin<strong>der</strong><br />
und das ganze Haus wussten, war<br />
ihr Wille <strong>der</strong> beste.“<br />
„Dämmerschlaf“ läutet literarisch<br />
das Ende des Jazz Age ein, das Edith<br />
Wharton zuvor mit grandiosem Witz<br />
zelebriert hatte. Nun wird die innere<br />
Brüchigkeit des Gesellschaftsgebäudes<br />
deutlich, das <strong>der</strong> „Schwarze Freitag“<br />
nur ein Jahr darauf in seinen materiellen<br />
Grundfesten erschüttern sollte. Die Familie<br />
Manford – die erwachsenen Kin<strong>der</strong><br />
Jim und Nona stammen aus Paulines<br />
erster und zweiter Ehe – bekommt es mit<br />
den <strong>Medien</strong> zu tun, als Skandalfotos erscheinen,<br />
auf denen Jims Ehefrau Lita unter<br />
an<strong>der</strong>en entblößten Damen bei einer<br />
geheimen Session des Gurus Mahatma<br />
klar zu erkennen ist. Lita allerdings, von<br />
Ehe und Kleinkind gelangweilt, stets in<br />
herrlichster Gar<strong>der</strong>obe und mit „goldfischfarbenem<br />
Haar“, tanzversessen und<br />
affärenselig, bereitet schon den nächsten,<br />
weit härteren Schlag gegen die Manfords<br />
vor: Sie will in Hollywood Karriere machen.<br />
Nichts aber könnte für die New<br />
Yorker Elite grausiger sein als die Vorstellung,<br />
eine <strong>der</strong> Ihren blicke, womöglich<br />
leicht bekleidet, von einem überlebensgroßen<br />
Filmplakat auf sie herab. Das<br />
also muss verhin<strong>der</strong>t werden. Außerdem<br />
gilt es, den zunehmend <strong>der</strong>angierten ersten<br />
Ehemann auf Linie zu halten, den aktuellen<br />
Ehemann trotz dessen ganz an<strong>der</strong>er<br />
Gelüste aufs Eheleben zu verpflichten<br />
und schließlich die 19-jährige Nona von<br />
<strong>der</strong> Liebe zu ihrem leichtlebigen verheirateten<br />
Vetter abzubringen. Genug zu<br />
tun und zusammenzuhalten also für die<br />
Dame des Hauses, die sich persönlich am<br />
meisten für Alarmanlagen und blitzende<br />
Armaturen interessiert.<br />
Außer <strong>der</strong> durchscheinend bleibenden<br />
Lita sind alle Figuren dieses Romans<br />
mit gleichmäßiger Sympathie gezeichnet.<br />
Wir sehen eine saturierte Gesellschaft<br />
am Abgrund tanzen, von dessen Existenz<br />
sie noch nichts ahnt, und können<br />
verfolgen, wie sich in jedem Einzelnen<br />
ein Schwarzes Loch aufzutun beginnt:<br />
Diese Menschen machen, bei ständig<br />
erhöhter Schlagzahl, einfach immer so<br />
weiter. Vollkommen vergessen haben sie<br />
die Grun<strong>der</strong>schütterung des Ersten Weltkriegs,<br />
<strong>der</strong> noch nicht einmal zehn Jahre<br />
zurückliegt – Geschichtsvergessenheit,<br />
so zeigt sich bei aller Lustigkeit in „Dämmerschlaf“,<br />
ist die Kehrseite <strong>der</strong> ehrgeizigen<br />
Fassadenverschönerung. Und wo die<br />
Vergangenheit gelöscht ist, bleibt auch für<br />
den Gedanken an Zukunft kein Raum<br />
mehr.<br />
Frauke Meyer-Gosau<br />
EDITH WHARTON<br />
„Dämmerschlaf“<br />
Aus dem Amerikanischen von<br />
Andrea Ott. Manesse, Zürich 2013.<br />
314 Seiten, 24,95 €<br />
141<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
SALON<br />
Literaturen<br />
Roman<br />
Ein Friedhofs<br />
Sommertags<br />
Traum<br />
Monika Maron stellt in<br />
einem heiteren kleinen Buch<br />
die ganz großen Fragen<br />
Irgendwann kommt in je<strong>der</strong> Biografie<br />
<strong>der</strong> Punkt, an dem <strong>der</strong> Blick nicht nur<br />
nach vorn, son<strong>der</strong>n auch zurückgeht,<br />
weil man schon so viel Leben hinter sich<br />
gelassen hat. Ruth, Ich-Erzählerin in Monika<br />
Marons neuem Roman „Zwischenspiel“,<br />
gerät ebenfalls in den Sog <strong>der</strong> Vergangenheit.<br />
Sie schaut zurück auf ihre<br />
früheren Ichs, die irgendwo geblieben<br />
sein müssen, denn schließlich verdankt<br />
sie ihnen die Person, die sie geworden<br />
ist, jetzt, heute. Ruth, die vor kurzem<br />
ihren 60. Geburtstag gefeiert hat, Museumsangestellte<br />
in Berlin, Mutter <strong>der</strong><br />
Tochter Fanny, von <strong>der</strong>en Vater, Bernhard,<br />
sie längst getrennt ist. Die Vergangenheit<br />
aber holt Ruth ein, denn an dem<br />
Tag, an dem <strong>der</strong> Roman spielt, soll Olga<br />
beerdigt werden – Olga, die Mutter von<br />
Bernhard, die Ruths Freundin geworden<br />
war, die ein hohes Maß an Einfühlung<br />
besaß, aber ihr eigenes Leben ein Stück<br />
weit verpasst hat.<br />
Das Schöne an Monika Marons<br />
neuem Buch ist, dass Ruth ihre verschiedenen<br />
früheren Ichs nicht einfach anhand<br />
von Erinnerungen aufblättert. Stattdessen<br />
arbeitet die Autorin mit einem surrealen<br />
Kunstgriff: Die Hauptfigur wird von<br />
einer seltsamen Sehstörung heimgesucht,<br />
die irritierend und reizvoll zugleich ist.<br />
Ihre Umgebung löst sich auf, die Konturen<br />
<strong>der</strong> Dinge verwischen, die Welt erscheint<br />
verpixelt. Und plötzlich tauchen<br />
Menschen aus Ruths Vergangenheit auf,<br />
die bereits gestorben sind, ein skurriler<br />
Totentanz, dem sich Ruth nicht entziehen<br />
kann. So sitzt ihr mit einem Mal Olga<br />
gegenüber, freundlich, offen, die beiden<br />
Frauen sprechen über Schuld – ein zentrales<br />
Motiv in Marons kurzem Roman.<br />
Ruth hatte damals Bernhard verlassen,<br />
<strong>der</strong> sich auch um seinen kranken Sohn<br />
kümmern musste, und Ruth fürchtete<br />
sich vor <strong>der</strong> Verantwortung. Später ist<br />
sie mit einem neuen Mann und Fanny<br />
in den Westen gegangen. Allerdings ist<br />
auch Bernhard kein Heiliger, auch er hat<br />
Schuld auf sich geladen.<br />
Im Verlauf <strong>der</strong> Handlung tauchen<br />
immer weitere Tote auf, mit denen sich<br />
Ruth unterhält, als sie ziellos durch einen<br />
Park läuft. Eigentlich hätte sie längst<br />
auf Olgas Beerdigung sein wollen, aber<br />
auf dem Weg dorthin hat sie sich verfahren,<br />
und <strong>der</strong> merkwürdige Tag entfaltet<br />
seine eigene, fantastische Logik.<br />
In <strong>der</strong> sogar auch ein Quäntchen Humor<br />
aufblitzt, wodurch <strong>der</strong> Tod einiges<br />
von seinem Schrecken verliert. Olga ist<br />
plötzlich wie<strong>der</strong> da, dieses Mal nicht im<br />
Totenhemd, son<strong>der</strong>n in Rock und Strickjacke.<br />
Sie hat die Beerdigung hinter sich<br />
gebracht, die Trauernden „trinken schon<br />
fröhlich und brauchen mich nicht mehr“,<br />
sagt sie und genießt die Schönheit des<br />
Parkes. Eine hübsche Pointe ergibt sich,<br />
als schließlich Margot und Erich vorbeikommen,<br />
ja, genau die, verbohrt und lächerlich.<br />
Ruth macht ihnen entschieden<br />
klar, dass keiner das Herrscherpärchen<br />
mehr haben will. Und verrät ihnen lieber<br />
nicht, dass <strong>der</strong> Kapitalismus gerade<br />
unter einer schweren Finanzkrise ächzt.<br />
Monika Maron ist ein eindrucksvolles<br />
Spiel mit den komplizierten Verästelungen<br />
<strong>der</strong> Vergangenheit gelungen. Erst<br />
die Auflösung des Vertrauten, Alltäglichen<br />
ermöglicht hier die Erinnerung. Darüber<br />
hinaus stellt <strong>der</strong> Roman fast beiläufig<br />
die großen Fragen des Lebens: Wie<br />
weit kann man sich dem Schicksal, das einem<br />
plötzlich gegen das Schienbein tritt,<br />
verweigern, sich einfach verdrücken? Ist<br />
es Mut o<strong>der</strong> Feigheit, sich aus <strong>der</strong> Verantwortung<br />
zu stehlen? Wo bleiben die<br />
Anteile des Bösen, das wir in uns tragen,<br />
und wie weit erlauben wir unserer Fantasie,<br />
diese in Szenarien von Mord und<br />
Totschlag zu verwandeln? Werden wir,<br />
solange wir leben, automatisch schuldig,<br />
so o<strong>der</strong> so? Natürlich ist Monika Maron<br />
viel zu klug, darauf Antworten zu geben.<br />
Die Fragen aber hallen nach <strong>der</strong> Lektüre<br />
lange nach. Franziska Wolffheim<br />
MONIKA MARON<br />
„Zwischenspiel“<br />
S. Fischer, Frankfurt am Main<br />
2013, 192 Seiten, 18,99 €<br />
Jugendbuch<br />
Enkel haben’s<br />
auch nicht leicht<br />
Die Geschichte einer<br />
komplexen Beziehung<br />
Einmal quer durch Kanada sind <strong>der</strong><br />
17-jährige Royce und seine Mutter<br />
gefahren: <strong>Der</strong> Großvater braucht<br />
Hilfe. Aber wie soll man einem Egomanen<br />
helfen, <strong>der</strong> jede Pflegekraft in kürzester<br />
Zeit vergrault? So trifft es Royce,<br />
<strong>der</strong> nach einer längeren Krankheit noch<br />
nicht wie<strong>der</strong> zur Schule gehen kann. Jeden<br />
Tag verbringt er lange Stunden mit<br />
seinem unausstehlichen Großvater, den<br />
er so nicht nennen darf, weil <strong>der</strong> sich<br />
dann alt fühlt: „Arthur“ also, einst gefeierter<br />
Cellist und Frauenheld, <strong>der</strong> die<br />
Tage schlafend o<strong>der</strong> MTV schauend verbringt.<br />
Von <strong>der</strong> Welt will er nichts mehr<br />
wissen, die Vorhänge vor den Panoramafenstern<br />
zum See bleiben zugezogen.<br />
<strong>Der</strong> Jugendroman „Arthur o<strong>der</strong> Wie<br />
ich lernte, den T-Bird zu fahren“ erzählt<br />
realistisch und mit herbem Humor die<br />
Geschichte einer allmählichen Annäherung<br />
zwischen den beiden so unterschiedlichen<br />
Familienmitglie<strong>der</strong>n. Royce<br />
lässt sich die Unverschämtheiten seines<br />
Großvaters nicht mehr gefallen, was ihm<br />
wie<strong>der</strong>um die knurrige Zuneigung Arthurs<br />
einbringt. Nach und nach entdeckt<br />
<strong>der</strong> Enkel zudem in alten Fotoalben und<br />
<strong>der</strong> verstaubten Schallplattensammlung<br />
die Geschichte des einstigen Stars, er<br />
darf ihn nun sogar mit dem prächtigen<br />
alten T-Bird in die Stadt fahren. Als <strong>der</strong><br />
alte Mann stirbt, ist Royce gereift und<br />
neu ins Leben hineingewachsen.<br />
Sarah N. Harvey gelingt ein wohltuend<br />
nüchterner Blick auf das so oft sentimental<br />
verklärte Großvater-Enkel-Verhältnis.<br />
An menschlicher Anteilnahme<br />
und einfühlsamer Personenzeichnung<br />
fehlt es dennoch nicht: Beeindruckend<br />
und sehr lesenswert. Britta Sebens<br />
SARAH N. HARVEY<br />
„Arthur o<strong>der</strong> Wie ich lernte,<br />
den TBird zu fahren“<br />
DTV, 235 Seiten, 13,95 €<br />
142<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
IMPRESSUM<br />
Krimi<br />
VERLEGER Michael Ringier<br />
CHEFREDAKTEUR Christoph Schwennicke<br />
STELLVERTRETER DES CHEFREDAKTEURS<br />
Alexan<strong>der</strong> Marguier<br />
REDAKTION<br />
TEXTCHEF Georg Löwisch<br />
CHEFIN VOM DIENST Kerstin Schröer<br />
RESSORTLEITER Lena Bergmann ( Stil ),<br />
Judith Hart ( Weltbühne ), Dr. Alexan<strong>der</strong> Kissler ( Salon ),<br />
Til Knipper ( Kapital ), Constantin Magnis<br />
( Reportagen ) , Frauke MeyerGossau ( Literaturen ),<br />
Christoph Seils ( <strong>Cicero</strong> Online )<br />
POLITISCHER CHEFKORRESPONDENT<br />
Hartmut Palmer<br />
ASSISTENTIN DES CHEFREDAKTEURS<br />
Monika de Roche<br />
REDAKTIONSASSISTENTIN Sonja Vinco<br />
PUBLIZISTISCHER BEIRAT Heiko Gebhardt,<br />
Klaus Harpprecht, Frank A. Meyer, Jacques Pilet,<br />
Prof. Dr. Christoph Stölzl<br />
ART DIRECTOR Viola Schmieskors<br />
BILDREDAKTION Antje Berghäuser, Tanja Raeck<br />
PRODUKTION Utz Zimmermann<br />
VERLAG<br />
GESCHÄFTSFÜHRUNG<br />
Michael Voss<br />
VERTRIEB UND UNTERNEHMENSENTWICKLUNG<br />
Thorsten Thierhoff<br />
REDAKTIONSMARKETING Janne Schumacher<br />
NATIONALVERTRIEB/LESERSERVICE<br />
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH<br />
Düsternstraße 1–3, 20355 Hamburg<br />
VERTRIEBSLOGISTIK Ingmar Sacher<br />
ANZEIGEN-DISPOSITION Erwin Böck<br />
HERSTELLUNG Roland Winkler<br />
VERLAGSGRAFIK Franziska Daxer<br />
DRUCK/LITHO Neef+Stumme,<br />
premium printing GmbH & Co.KG,<br />
Schillerstraße 2, 29378 Wittingen<br />
Holger Mahnke, Tel.: +49 (0)5831 23161<br />
cicero@neefstumme.de<br />
SERVICE<br />
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,<br />
haben Sie Fragen zum Abo o<strong>der</strong> Anregungen und Kritik zu<br />
einer <strong>Cicero</strong>Ausgabe? Ihr <strong>Cicero</strong>Leserservice hilft Ihnen<br />
gerne weiter. Sie erreichen uns werktags von 7:30 Uhr bis<br />
20:00 Uhr und samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.<br />
ABONNEMENT UND NACHBESTELLUNGEN<br />
<strong>Cicero</strong>Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
TELEFON 030 3 46 46 56 56<br />
TELEFAX 030 3 46 46 56 65<br />
E-MAIL abo@cicero.de<br />
ONLINE www.cicero.de/abo<br />
ANREGUNGEN UND LESERBRIEFE<br />
<strong>Cicero</strong>Leserbriefe<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
E-MAIL info@cicero.de<br />
Einsen<strong>der</strong> von Manuskripten, Briefen o. Ä. erklären sich mit <strong>der</strong> redaktionellen<br />
Bearbeitung einverstanden. *Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und<br />
Versand im Inland, Auslandspreise auf Anfrage. <strong>Der</strong> Export und Vertrieb<br />
von <strong>Cicero</strong> im Ausland sowie das Führen von <strong>Cicero</strong> in Lesezirkeln ist nur<br />
mit Genehmigung des Verlags statthaft.<br />
ANZEIGENLEITUNG<br />
( verantw. für den Inhalt <strong>der</strong> Anzeigen )<br />
Tina Krantz, Anne Sasse<br />
STELLVERTRETENDE ANZEIGENLEITUNG<br />
Sven Bär<br />
ANZEIGENVERKAUF<br />
Jörn SchmiedingDieck, Svenja Zölch,<br />
Jacqueline Ziob, Stefan Seliger ( online )<br />
ANZEIGENMARKETING Inga Müller<br />
ANZEIGENVERKAUF BUCHMARKT<br />
Thomas Laschinski<br />
VERKAUFTE AUFLAGE 82 970 ( IVW Q3/2013 )<br />
LAE 2013 122 000 Entschei<strong>der</strong><br />
REICHWEITE 380 000 Leser ( AWA 2013 )<br />
CICERO ERSCHEINT IN DER<br />
RINGIER PUBLISHING GMBH<br />
Friedrichstraße 140, 10117 Berlin<br />
info@cicero.de, www.cicero.de<br />
REDAKTION Tel.: + 49 (0)30 981 941200, Fax: 299<br />
VERLAG Tel.: + 49 (0)30 981 941100, Fax: 199<br />
ANZEIGEN Tel.: + 49 (0)30 981 941121, Fax: 199<br />
GRÜNDUNGSHERAUSGEBER<br />
Dr. Wolfram Weimer<br />
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in<br />
Onlinedienste und Internet und die Vervielfältigung<br />
auf Datenträgern wie CDROM, DVDROM etc. nur<br />
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags.<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bil<strong>der</strong><br />
übernimmt <strong>der</strong> Verlag keine Haftung.<br />
Copyright © 2013, Ringier Publishing GmbH<br />
V.i.S.d.P.: Christoph Schwennicke<br />
Printed in Germany<br />
EINE PUBLIKATION<br />
DER RINGIER GRUPPE<br />
EINZELPREIS<br />
D: 8,50 €, CH: 13,– CHF, A: 8,50 €<br />
JAHRESABONNEMENT ( ZWÖLF AUSGABEN )<br />
D: 93,– €, CH: 144,– CHF, A: 96,– €*<br />
Schüler, Studierende, Wehr und Zivildienstleistende<br />
gegen Vorlage einer entsprechenden<br />
Bescheinigung in D: 60,– €, CH: 108,– CHF, A: 72,– €*<br />
<strong>Cicero</strong> erhalten Sie im gut sortierten<br />
Presseeinzelhandel sowie in Pressegeschäften<br />
an Bahnhöfen und<br />
Flughäfen. Falls Sie <strong>Cicero</strong> bei Ihrem<br />
Pressehändler nicht erhalten sollten,<br />
bitten Sie ihn, <strong>Cicero</strong> bei seinem Großhändler<br />
nachzubestellen. <strong>Cicero</strong> ist dann in <strong>der</strong> Regel<br />
am Folgetag erhältlich.<br />
Verborgener<br />
Aufmarsch<br />
Friedrich Ani spürt die<br />
Neonazis im Alltag auf<br />
Wer sind sie eigentlich und wie<br />
sehen sie aus: die Neonazis?<br />
Auf Demonstrationen sieht<br />
man sie in Kampfklamotten, mit kahlem<br />
Schädel, eine gesellschaftliche Massenbewegung<br />
traut man ihnen kaum zu.<br />
Doch ist auch bekannt, dass sie sich netzwerkartig<br />
vorzugsweise auf dem flachen<br />
Land ausbreiten: durch soziale Unterstützung<br />
im Alltag, Musik, Feste. Diesen verborgenen<br />
Aufmarsch von rechts hat sich<br />
jetzt Friedrich Ani in seinem Krimi „M“<br />
vorgenommen. Die militanten Rechten<br />
sind hier in Münchens Fußballstadien<br />
und bürgerlichen Kneipen ebenso zu<br />
Hause wie in einem reputierlichen Hotel<br />
am Starnberger See.<br />
Privatdetektiv Tabor Süden wird dieser<br />
Zusammenhang erst allmählich klar.<br />
Lange kann er sich nicht vorstellen, dass<br />
Menschen in angesehenen Berufen zugleich<br />
treibende Kräfte eines Nazi-Netzwerks<br />
sind. Doch als er die Spur eines<br />
vermissten Taxifahrers aufnimmt und dabei<br />
<strong>der</strong> Kripo und dem Verfassungsschutz<br />
in die Quere kommt, zeichnen sich die<br />
Umrisse eines politischen Falles ab. Die<br />
kleine Detektei, für die er arbeitet, wird<br />
dabei selbst betroffen: Ein alter Kollege<br />
wird brutal zusammengeschlagen, die<br />
junge findige Detektivin fällt fast einem<br />
Mordanschlag zum Opfer, und Südens<br />
Chefin stößt auf Bezüge <strong>der</strong> gegenwärtigen<br />
Ereignisse zur zehn Jahre zurückliegenden<br />
Ermordung ihres kleinen Sohnes.<br />
Friedrich Ani vermeidet alles Plakative,<br />
und so setzt uns <strong>der</strong> Fall nicht nur<br />
unter Hochspannung, son<strong>der</strong>n zunehmend<br />
auch in Schrecken. <strong>Der</strong> aber entstammt<br />
nicht mehr dem Roman, son<strong>der</strong>n<br />
unserer alltäglichen Wirklichkeit. FMG<br />
FRIEDRICH ANI<br />
„M. EinTaborSüdenRoman“<br />
Droemer, München 2013,<br />
356 Seiten, 19,99 €<br />
144<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Anzeige<br />
Historische Biografie<br />
Unterwegs im<br />
Namen <strong>der</strong><br />
Eindeutigkeit<br />
Stefan Weinfurter verfolgt<br />
im Leben Karls des Großen<br />
ein Leitmotiv<br />
Kein Mangel herrscht an Biografien<br />
über Karl den Großen. Gerade<br />
drei Monate ist es her, dass<br />
<strong>der</strong> Nestor <strong>der</strong> Mittelalterforschung,<br />
Johannes Fried, „Karl <strong>der</strong> Große: Gewalt<br />
und Glaube“ vorlegte. Nun folgt<br />
mit dem deutlich kürzer ausgefallenen<br />
„Heiligen Barbar“ von Stefan Weinfurter<br />
<strong>der</strong> nächste Versuch, dem sattsam Ausgedeuteten<br />
neue Facetten abzugewinnen.<br />
Man sieht: Ein Karlsjahr steht vor <strong>der</strong> Tür.<br />
2014 wird sich <strong>der</strong> Tod des „Ahnherrn<br />
Europas“ zum 1200. Mal jähren.<br />
Die Quellenlage ist bekannt, die<br />
meisten Fragen wurden mehrfach erörtert;<br />
das Amüsement, als ein Zeitforscher<br />
einmal große Teile des Mittelalters<br />
für gefälscht erklären wollte, verpuffte<br />
schnell. Was also rechtfertigt den Versuch,<br />
noch einmal eine Summe zu ziehen?<br />
Stilistischer Ehrgeiz scheidet bei<br />
dem Heidelberger Ordinarius aus, formuliert<br />
er doch trockener, sprö<strong>der</strong> als sein<br />
Kollege Fried. Dessen panoramatische<br />
Gesamtschau ist ebenfalls Weinfurters<br />
Sache nicht. Er wartet mit dem Versuch<br />
auf, <strong>der</strong> gesamten Vita ein Leitmotiv abzulauschen,<br />
das den Imperator neu konturiert.<br />
Dieses erkenntnisstiftende Motiv<br />
ist die „Idee <strong>der</strong> Eindeutigkeit“.<br />
Daraus ergeben sich zwei gegenläufige<br />
Effekte. Das staunenswerte Handeln<br />
und Trachten des mächtigsten mittelalterlichen<br />
Herrschers gewinnt eine Stringenz,<br />
die ihn als Mensch greifbar macht<br />
und ihn insofern unserer Gegenwart näher<br />
rückt. An<strong>der</strong>erseits ist ihm die zeitgenössische<br />
Eingemeindung verwehrt,<br />
denn heute, so Weinfurter, sind wir Kin<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Vielheit, des Changierenden, des<br />
Polyvalenten – als wären die Postmo<strong>der</strong>nen<br />
frisch aus jener vorchristlichen „altorientalisch-assyrischen<br />
Welt“ gefallen,<br />
die ebenfalls in die Variabilität als Lebensform<br />
vernarrt war.<br />
Karls Idee findet sich unter an<strong>der</strong>em<br />
beim größten Gelehrten seines Hofes, Alkuin<br />
von York, und wirkte sich auf nahezu<br />
jedem politischen wie kulturellen<br />
Feld aus. „Die Eindeutigkeit <strong>der</strong> Wahrheit<br />
wurde zum alles bestimmenden Programm“,<br />
sie mündete in ein christlich<br />
hierarchisiertes Großreich nach augustinischem<br />
Muster, aber auch in die karolingische<br />
„Wissens- und Bildungsoffensive“.<br />
Denn genau benennen und trennscharf<br />
erklären muss können, wer die damals<br />
wie heute bunte Welt nach Prinzipien <strong>der</strong><br />
Eindeutigkeit ordnen will.<br />
Auf Alkuins Spuren sichtet also<br />
Weinfurter das Material. Bereits <strong>der</strong><br />
Krieg gegen die Langobarden und die<br />
Entmachtung des bayerischen Herzogs<br />
Tassilo III. hatten demnach das Ziel politischer<br />
Eindeutigkeit. Karl wollte die<br />
„alleinige Herrschaft über die Völker<br />
Galliens, Germaniens und Italiens zum<br />
Schutz und im Dienst <strong>der</strong> römischen Kirche“.<br />
<strong>Der</strong> brutale „Missionskrieg“ gegen<br />
die Sachsen war von <strong>der</strong>selben Grundkonzeption<br />
motiviert, <strong>der</strong> „Idee von<br />
Frieden, Vertrauen und Treue durch den<br />
gleichen Glauben (…) – so grausam und<br />
unmenschlich es sich für uns heute auch<br />
darstellt“. Konsequent, fast aus einem<br />
Guss erscheint die 43-jährige Regentschaft<br />
Karls. Forscher, die eher das Improvisierte<br />
und Zufällige betonen, sind<br />
Weinfurter nur eine Fußnote wert.<br />
Wird Karl so in unziemlicher Weise<br />
spiritualisiert? Nein. Weinfurter macht<br />
Ernst mit <strong>der</strong> an<strong>der</strong>norts nur beschworenen<br />
Prämisse, historische Gestalten<br />
vor dem Hintergrund ihrer eigenen Zeit<br />
zu bewerten. Er hält es für unredlich,<br />
dem „außerordentlichen Sendungsauftrag“<br />
Karls den Moralismus <strong>der</strong> Nachgeborenen<br />
entgegenzuhalten. Solchermaßen<br />
fokussiert, ist es letztlich <strong>der</strong> fromme<br />
Krieger, <strong>der</strong> Bildungs-, Glaubens- und<br />
Kalen<strong>der</strong>reformer, Kaiser und Reichsorganisator,<br />
<strong>der</strong> eine Frage an uns richtet:<br />
Sag an, lässt Weinfurter ihn reden, heutiger<br />
Leser, wie hältst denn du es mit <strong>der</strong><br />
Eindeutigkeit? Alexan<strong>der</strong> Kissler<br />
STEFAN WEINFURTER<br />
„Karl <strong>der</strong> Große. <strong>Der</strong> heilige Barbar“<br />
Piper, München 2013,<br />
352 Seiten, 22,99 €<br />
145<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013<br />
208 S., 115 Abb., 1 Karte. Halbln. € 19,95<br />
„Patrick Bahners legt ein<br />
Opus magnum zur Exegese<br />
Entenhausens vor.“<br />
Peter Iwaniewicz, Falter<br />
261 S., 174 Abb., 2 Ktn. Halbln. € 21,95<br />
Peter Peter erzählt in diesem<br />
Buch facettenreich die<br />
Geschichte <strong>der</strong> grandiosen<br />
Küche Österreichs, <strong>der</strong><br />
Köchinnen und Köche, ihrer<br />
Rezepte und Traditionen,<br />
ihrer Institutionen wie Kaffeehaus<br />
und Beisl.<br />
C.H.BECK<br />
www.chbeck.de
SALON<br />
Bibliotheksporträt<br />
ALLEIN MIT DEN BILDERN,<br />
DEN DINGEN<br />
<strong>Der</strong> New Yorker Architekt Richard Meier zeigt sich auch in seinen<br />
Büchern als Kind <strong>der</strong> europäischen Mo<strong>der</strong>ne<br />
Von SEBASTIAN MOLL<br />
Für die beengten New Yorker Verhältnisse ist die Wohnung von Richard<br />
Meier geradezu ein Palast. Das Loft reicht von einer Außenwand des Apartmenthauses<br />
an <strong>der</strong> 72. Straße bis zur an<strong>der</strong>en. Helles Sonnenlicht durchflutet<br />
aus beiden Richtungen das Wohn- und Arbeitszimmer, das die gesamte Fläche<br />
des Grundrisses einnimmt. Sogar für eine mannshohe Plastik von Frank<br />
Stella, einem engen Freund, ist Platz. Von <strong>der</strong> Raummitte aus schwingt sich<br />
eine breite Treppe elegant in das Obergeschoss des einzigen Domizils, das<br />
<strong>der</strong> Stararchitekt jemals für seinen eigenen Bedarf gestaltet hat.<br />
Dennoch ist die Wohnung zu klein für Meiers Büchersammlung. Seine<br />
wohlsortierte Bibliothek zur Architektur des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts zieht sich<br />
über zwei Wände des Raumes und kriecht wie Efeu um die Fenster. Mittendrin<br />
steht <strong>der</strong> Schreibtisch. Rundherum türmen sich Bücherstapel, von Ausstellungskatalogen<br />
bis zu Originalskizzen von Corbusier und Frank Lloyd<br />
Wright, Meiers großen Vorbil<strong>der</strong>n. „Im Obergeschoss“, verrät <strong>der</strong> weißhaarige<br />
Baumeister, „sind die Kunstbücher, da sieht’s noch schlimmer aus.“ Deshalb<br />
will er den Besucher lieber nicht die Treppe hinaufbitten.<br />
„Ich komme nicht nach mit dem Aussortieren und Verschenken“, sagt er<br />
mit seiner sanften, warmen Stimme. Auch die Bibliothek in seinem Büro an<br />
<strong>der</strong> 36. Straße platze schon aus allen Nähten, von seiner Sommerresidenz<br />
in East Hampton ganz zu schweigen. Unbesehen Bücher wegzuwerfen o<strong>der</strong><br />
weiterzugeben, ist nicht sein Stil. „Das brächte ich nicht fertig.“<br />
Schon seit Wochen liegt auf Meiers Schreibtisch <strong>der</strong> Katalog zur Corbusier-Ausstellung<br />
im Moma. Es ist ein Geschenk des Museums an den berühmten<br />
Schüler des visionären Schweizers, und es bringt Meiers Erinnerung<br />
in Schwung. <strong>Der</strong> Sommer 1957 ersteht vor seinem inneren Auge, als er<br />
mit seinem druckfrischen Diplom nach Paris flog, beseelt von dem Wunsch,<br />
bei dem großen Corbusier ein Praktikum zu absolvieren.<br />
Im Studio von Corbusier schlug man ihm aber die Tür vor <strong>der</strong> Nase zu.<br />
„Sobald sie meinen amerikanischen Akzent hörten, wollte keiner mehr mit<br />
mir reden.“ Den Grund erklärte ihm tags darauf <strong>der</strong> Meister, als Meier ihn<br />
bei <strong>der</strong> Eröffnung seiner Maison du Brésil ansprach. Corbusier war sauer,<br />
146<br />
<strong>Cicero</strong> – 12.2013
weil Amerika nichts hatte von ihm wissen wollen. Nicht einen einzigen Auftrag<br />
hatte Corbusier in den USA bekommen, vor allem nicht den, von dem<br />
er glaubte, er sei ihm auf den Leib geschrieben: die Vereinten Nationen in<br />
New York. Das musste Meier, ein glühen<strong>der</strong> Verehrer Corbusiers, büßen.<br />
Die Gedanken, die Corbusier in seinen „Fünf Punkten <strong>der</strong> Architektur“<br />
formulierte, fanden ihren Weg dennoch über den Ozean. Zu verdanken<br />
hatte er das vor allem Meier und dessen Kollegen von den „New York<br />
Five“ – <strong>der</strong> berühmten Gruppe damals junger Architekten, für die Corbusiers<br />
Vision des mo<strong>der</strong>nen Bauens eine Offenbarung war.<br />
1972 trafen sich die Five, zu denen neben Meier sein Cousin Peter Eisenman,<br />
Michael Graves, Charles Gwathmey und John Hejduk gehörten, in<br />
New York. <strong>Der</strong> Essayband „Five Architects“, <strong>der</strong> aus dem Treffen entstand,<br />
entfachte die erste ernsthafte Debatte über Architektur in <strong>der</strong> Neuen Welt.<br />
Den Fünf mit ihren hochtrabenden europäischen Ideen über die Befreiung<br />
des Innenraums von <strong>der</strong> Fassade und die Bedeutung des Lichtes in <strong>der</strong> Architektur<br />
wurde Gleichgültigkeit gegenüber dem architektonischen Kontext<br />
vorgeworfen. Doch die Kritik vermochte den Fünf wenig anzuhaben, je<strong>der</strong><br />
wurde ein Star. Meiers Magnum Opus, das Getty Center in Los Angeles, ist<br />
eine Hommage an Corbusier – ein in Weiß erstrahlen<strong>der</strong> Kunst-Campus.<br />
Ein Kind <strong>der</strong> europäischen Mo<strong>der</strong>ne ist Meier geblieben. Das spiegelt<br />
seine Bibliothek wi<strong>der</strong>. Ein komplettes Regal ist dem russischen Konstruktivismus<br />
gewidmet, ein an<strong>der</strong>es dem deutschen Expressionismus. Eine Wand<br />
gehört <strong>der</strong> holländischen Architektur des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts, eine weitere <strong>der</strong><br />
französischen, und natürlich gibt es ein vollständiges Regal Corbusier. Neben<br />
dem Schreibtisch steht ein Corbusier-Sessel. Dort sitzt Meier oft das gesamte<br />
Wochenende. Manchmal liest er, manchmal bastelt er an den Collagen,<br />
die er seit vielen Jahren in Din-A4-Hefte klebt – Karten, Einladungen, Magazin-Schnipsel.<br />
Dazu läuft klassische Musik von Brahms, Bartók, Mahler.<br />
Kein Roman ist in den Stapeln zu entdecken. Auf die Frage nach dem<br />
Lieblingsschriftsteller muss Meier grübeln. „Norman Mailer“ fällt ihm ein,<br />
ein guter Bekannter. „Die Nackten und die Toten“ sei ein wichtiges Buch<br />
für ihn gewesen. Ein Buch, das nichts mit Kunst o<strong>der</strong> Architektur zu tun<br />
hat, findet sich aber doch noch. Am Rand des Schreibtischs liegt ein kleines<br />
blaues Paperback, „Too Soon to Say Goodbye“. Es ist die Geschichte<br />
des Satirikers Art Buchwald, dem die Ärzte nach seiner Krebsdiagnose nur<br />
wenige Wochen zu leben gaben. Buchwald zog in ein Hospiz. Doch das Leben<br />
spielte ihm einen Streich – es ging einfach weiter, noch mehr als ein<br />
Jahr lang. Buchwald genoss jeden Tag mit Humor und schrieb darüber. Es ist<br />
eine Geschichte über Haltung und Mut im Angesicht des Unausweichlichen.<br />
„Das hat mich wirklich aufgemuntert“, sagt Meier. Er verabschiedet sich<br />
höflich, ja herzlich, aber letztlich wohl doch erleichtert, wie<strong>der</strong> allein zu sein.<br />
Allein mit den schönen Dingen, die er in seinem Palast an <strong>der</strong> 72. Straße angehäuft<br />
hat, allein mit seinem Universum.<br />
SEBASTIAN MOLL lernte als WahlNewYorker den Luxus des Raumes schätzen<br />
148<br />
<strong>Cicero</strong> – 12.2013<br />
Foto: Wolfgang Wesener für <strong>Cicero</strong> [M] (Seiten 146 bis 148)
WELT.DE/NEU<br />
ANZEIGE MIT WELT APP SCANNEN.<br />
REDAKTEUR ERLEBEN.<br />
Die Welt gehört denen,<br />
die lauter denken,<br />
als an<strong>der</strong>e schreien.<br />
ALAN POSENER,<br />
REDAKTEUR
SALON<br />
Serie<br />
1933 – ALS DEUTSCHLAND DIE DEMOKRATIE VERLOR, TEIL XI<br />
Nach einem<br />
knappen Jahr war <strong>der</strong> Einheitsstaat<br />
schon Realität.<br />
Verhaftet wurde, wer nicht<br />
mitmachte, etwa Kommunisten<br />
ALLE REIHEN FEST<br />
GESCHLOSSEN<br />
Von PHILIPP BLOM<br />
Das „Gesetz zur Sicherung <strong>der</strong> Einheit von Partei und Staat“<br />
setzte im Dezember 1933 den Schlusspunkt unter die<br />
nationalsozialistische Revolution. Die Demokratie war überwunden<br />
Foto: Eastblockworld.com, Peter Rigaud<br />
150<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Innerhalb von elf Monaten, vom<br />
31. Januar bis Ende November 1933,<br />
hatte die neue nationalsozialistische<br />
Regierung des Deutschen Reiches<br />
die Weimarer Verfassung ausgehebelt<br />
und Staat und Gesellschaft in fast allen<br />
Aspekten gleichgeschaltet. Das „demokratische<br />
Chaos“ war beendet. Was<br />
hier von Hitlers Regierung ruhig und<br />
ganz offiziell beschlossen wurde, war<br />
eine Revolution.<br />
Gewerkschaften und an<strong>der</strong>e Parteien<br />
waren verboten worden, das Parlament<br />
aufgelöst, die Beamtenschaft zur<br />
Linientreue verpflichtet und alle Regierungsentscheidungen<br />
dem Führerprinzip<br />
untergeordnet. Auch die Gesellschaft<br />
hatte sich enorm verän<strong>der</strong>t: Zuerst einmal<br />
gab es wie<strong>der</strong> Arbeit. 1932 waren<br />
sechs Millionen Deutsche arbeitslos, ein<br />
Viertel <strong>der</strong> werktätigen Bevölkerung.<br />
Im Herbst 1933 waren es dann nur noch<br />
3,7 Millionen.<br />
Dieser positive Wandel wurde <strong>der</strong><br />
neuen Regierung zugutegehalten, dabei<br />
hatte sich <strong>der</strong> Aufschwung bereits im<br />
Vorjahr abgezeichnet. Vor <strong>der</strong> Machtergreifung<br />
im Januar war die Arbeitslosenzahl<br />
bereits um eine halbe Million gefallen.<br />
Hitler investierte allerdings noch<br />
in diese Dynamik – mit einer defizitären<br />
Politik, die schon darauf hinauslief,<br />
dass die hohen Schulden nur durch einen<br />
siegreichen Krieg wie<strong>der</strong> zu begleichen<br />
wären.<br />
Auch das kulturelle und intellektuelle<br />
Leben des Landes hatte sich radikal<br />
verän<strong>der</strong>t. Sport und Freizeit lagen zum<br />
Teil in den Händen von „Kraft durch<br />
Freude“ und ihrer Teilorganisationen.<br />
Die Kirchen wurden geschickt marginalisiert,<br />
kompromittiert und gespalten,<br />
eine mögliche Einmischung aus dem Vatikan<br />
wurde durch das Konkordat praktisch<br />
neutralisiert. Jugendverbände wurden<br />
aufgelöst o<strong>der</strong> in die „Hitler-Jugend“<br />
überführt, Künstler, Filmschaffende und<br />
Schriftsteller in <strong>der</strong> Reichskulturkammer<br />
glattgebürstet.<br />
Einige Deutsche, hauptsächlich finanziell<br />
privilegierte, hatten das Land<br />
bereits verlassen. Juden und Oppositionellen<br />
wurde das Leben und oft das pure<br />
Überleben in Deutschland zunehmend<br />
schwer gemacht. Sie verloren ihre Lebensgrundlage,<br />
manche wurden in Konzentrationslager<br />
eingesperrt.<br />
Am 1. Dezember war die deutsche<br />
Premiere des Filmes „King Kong und die<br />
weiße Frau“. <strong>Der</strong> Führer liebte den Film<br />
aus den Vereinigten Staaten, obwohl <strong>der</strong><br />
Gedanke, dass hier eine blonde Frau<br />
von einem schwarzen Primaten zärtlich<br />
berührt wurde, einige Parteigenossen<br />
erschau<strong>der</strong>n ließ. Während <strong>der</strong> privaten<br />
Vorführung konnte Hitler sich in<br />
dem Bewusstsein zurücklehnen, an diesem<br />
1. Dezember sich endlich die absolute<br />
Macht gesichert zu haben. Als Krönung<br />
<strong>der</strong> beispiellos raschen Kampagne,<br />
mit <strong>der</strong> die Nationalsozialisten Deutschland<br />
in einen totalitären Staat verwandelt<br />
hatten, als letzte Bestätigung ihrer<br />
Allmacht, wurde an diesem Tag das Gesetz<br />
zur Sicherung <strong>der</strong> Einheit von Partei<br />
und Staat verabschiedet.<br />
IN DEM GESETZ wurde die NSDAP, die<br />
einzige im Parlament vertretene Partei,<br />
zur „Trägerin des deutschen Staatsgedankens“<br />
erklärt und zu einer Körperschaft<br />
des öffentlichen Rechtes gemacht.<br />
Damit waren hohe Parteifunktionäre<br />
automatisch auch Regierungsmitglie<strong>der</strong>.<br />
Partei und SA hatten allen Ämtern<br />
gegenüber ein Weisungsrecht. Die Partei<br />
war damit im Herzen des Staatsapparats<br />
angekommen. Wache Zeitgenossen<br />
wussten, was die Stunde geschlagen<br />
hatte. Allein zwischen Januar und Mai<br />
waren 1,7 Millionen Deutsche <strong>der</strong> Partei<br />
beigetreten und hatten <strong>der</strong>en Mitglie<strong>der</strong>zahl<br />
verdreifacht.<br />
Noch im November war Adolf Hitler<br />
mit überwältigen<strong>der</strong> Mehrheit wie<strong>der</strong>gewählt<br />
worden. 92,2 Prozent <strong>der</strong><br />
Deutschen hatten für ihn gestimmt. Das<br />
Regime hatte hart für seinen Sieg gearbeitet.<br />
„Die maßlose Propaganda für das<br />
‚Ja‘“ beschrieb Victor Klemperer in seinem<br />
Tagebuch: „Auf jedem Geschäftswagen,<br />
Postwagen, Fahrrad <strong>der</strong> Postboten,<br />
an jedem Haus und Schaufenster,<br />
auf breiten Spruchbän<strong>der</strong>n, die über die<br />
Straße gespannt sind – überall Sprüche<br />
von Hitler …“<br />
Dessen Liste war denn auch die einzige<br />
überhaupt auf dem Wahlzettel. Eine<br />
Proteststimme o<strong>der</strong> einen leeren Wahlzettel<br />
abzugeben, war angesichts des<br />
Drucks, den die SA häufig in den Wahllokalen<br />
ausübte, ein großes persönliches<br />
Risiko. Immerhin 7 Prozent <strong>der</strong> Deutschen<br />
waren dieses Risiko eingegangen.<br />
Zum Autor<br />
PHILIPP BLOM ist<br />
Historiker und Autor.<br />
Er stammt aus Hamburg<br />
und wurde in Oxford<br />
promoviert. Seine Bücher<br />
„<strong>Der</strong> taumelnde Kontinent“<br />
und „Böse Philosophen“<br />
sind mehrfach preisgekrönt<br />
Victor Klemperer war einer von ihnen.<br />
Er hatte mit Nein gestimmt, obwohl<br />
er mit Repressalien rechnete. Am 31. Dezember<br />
schrieb er: „Dies ist das charakteristischste<br />
Faktum des abgelaufenen<br />
Jahres, dass ich mich von zwei nahen<br />
Freunden trennen musste, von Thieme,<br />
weil Nationalsozialist, von Gusti Wiegandt,<br />
weil sie Kommunistin wurde.<br />
Beide sind damit nicht einer politischen<br />
Partei beigetreten, son<strong>der</strong>n ihrer Menschenwürde<br />
verlustig gegangen.“<br />
Am Ende des Eintrags folgt: „Das<br />
historische Erlebnis dieses Jahres ist unendlich<br />
viel bitterer und verzweiflungsvoller,<br />
als es <strong>der</strong> Krieg war. Man ist tiefer<br />
gesunken.“<br />
Hiermit endet unsere Serie über<br />
Deutschlands Weg in die nationalsozialistische<br />
Diktatur<br />
151<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
SALON<br />
152<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
Foto: Maurice Weiss/Ostkreuz für <strong>Cicero</strong><br />
Die letzten 24 Stunden<br />
Leben heißt,<br />
wach zu bleiben<br />
und den Tod zu<br />
erwarten<br />
WOELKI<br />
RAINER MARIA<br />
Rainer Maria Woelki<br />
<strong>Der</strong> gebürtige Kölner leitet<br />
seit 2011 das Erzbistum Berlin.<br />
Benedikt XVI. erhob ihn<br />
2012 in den Kardinalsrang.<br />
Sein Wahlspruch als Bischof<br />
lautet „Wir sind Zeugen“<br />
Wie nah Hoffnung und<br />
Todesangst beieinan<strong>der</strong>liegen<br />
und wie<br />
flüchtig die sicher geglaubte<br />
Rettung sein<br />
kann, hat meine Mutter schon als junges<br />
Mädchen erlebt. Ihre Familie hatte ihre<br />
letzte Hoffnung auf einen Platz in <strong>der</strong><br />
„Wilhelm Gustloff“ gesetzt, um <strong>der</strong> heranrückenden<br />
Front zu entkommen. Die<br />
Verzweiflung und Enttäuschung müssen<br />
groß gewesen sein, als das Schiff ohne<br />
sie abfuhr. Nur wenige Stunden später<br />
dann allerdings die schreckliche Nachricht:<br />
Die „Wilhelm Gustloff“, voll beladen<br />
mit Flüchtlingen, wurde versenkt,<br />
nur ein Teil <strong>der</strong> Passagiere konnte aus<br />
<strong>der</strong> eisigen Ostsee gerettet werden.<br />
Meine Mutter spricht nicht viel über<br />
dieses Erlebnis. Ich verbinde damit zwei<br />
für mich wichtige Einsichten: Wir wissen<br />
– Gott sei Dank! – nicht, wann unser<br />
Leben endet. Und ich habe mir vorgenommen,<br />
so zu leben, dass jede Stunde<br />
auch meine Todesstunde sein könnte,<br />
o<strong>der</strong> es zumindest zu versuchen.<br />
Ob ich voller Hoffnung bin o<strong>der</strong> ob<br />
mich Todesangst übermannt, ist nur ein<br />
schwaches Indiz. Das sicher geglaubte<br />
Ende vor Augen, kann es doch wie<strong>der</strong><br />
weitergehen, aber auch in <strong>der</strong> größten Lebensfreude<br />
kann uns <strong>der</strong> Herr zu sich rufen.<br />
Beson<strong>der</strong>s drastisch schil<strong>der</strong>t es Jesus<br />
in <strong>der</strong> Erzählung von dem reichen<br />
Mann, <strong>der</strong> sich Gedanken macht, wie<br />
er sich möglichst lang an seiner großen<br />
Ernte erfreuen kann: „Da sprach Gott<br />
zu ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht<br />
wird man dein Leben von dir zurückfor<strong>der</strong>n.“<br />
( Lukas 12,20 )<br />
Ich bin froh, dass die Stunde meines<br />
Todes für mich nicht verfügbar ist.<br />
Es wird kein Countdown starten, es wird<br />
keine Henkersmahlzeit, keinen letzten<br />
Wunsch geben, den man mir erfüllen<br />
wird. Wirklich realistisch ist das Gedankenspiel<br />
mit den letzten 24 Stunden nur<br />
für Menschen, die zum Tode verurteilt<br />
wurden, für die also ein Mensch den Todeszeitpunkt<br />
festgelegt hat. Meine letzte<br />
Stunde kennt nur Gott, und ich lebe aus<br />
dem Glauben, dass er auch dann bei mir<br />
ist und mich auf meinem letzten irdischen<br />
Weg begleitet.<br />
„Dann wird es mit dem Himmelreich<br />
sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre<br />
Lampen nahmen und dem Bräutigam<br />
entgegengingen. Fünf von ihnen waren<br />
töricht und fünf waren klug. Die törichten<br />
nahmen ihre Lampen mit, aber kein<br />
Öl, die klugen aber nahmen außer den<br />
Lampen noch Öl in Krügen mit“ (Matthäus<br />
25,1-4): So beschreibt Jesus die<br />
letzten 24 Stunden von zehn Frauen, die<br />
zu einer Hochzeit eingeladen sind.<br />
Heutzutage besteht die Versuchung<br />
darin, die Ankunft des Bräutigams zu<br />
beeinflussen, anstatt sich auf eine lange<br />
Wartezeit einzustellen. Ich verfolge die<br />
Diskussion um die Sterbehilfe mit großer<br />
Sorge. Auch mir selbst macht die Vorstellung<br />
Angst, einsam o<strong>der</strong> unter großen<br />
Schmerzen die Todesstunde erwarten<br />
zu müssen. Aber ich habe keine Wahl,<br />
wenn ich das Gleichnis Jesu weiterlese:<br />
„Seid also wachsam! Denn ihr wisst we<strong>der</strong><br />
den Tag noch die Stunde.“ So lautet<br />
seine Ermahnung.<br />
Wie in früheren Zeiten jedes Einschlafen<br />
ein „kleines Sterben“ war, so<br />
ist für mich jedes morgendliche Aufwachen<br />
ein Dankeschön für das mir geschenkte<br />
Leben und eine täglich neue<br />
Mahnung an mich selbst, wach zu bleiben<br />
und den Tod zu erwarten. Das hat<br />
mit Todessehnsucht überhaupt nichts zu<br />
tun. Ich kenne diesen Gedanken schon<br />
seit Jugendtagen.<br />
Das Gebet um einen guten Tod gehört<br />
zu meinem täglichen Beten, genauso<br />
wie die Fürbitte für die mir anvertrauten<br />
Menschen, Freunde und<br />
Verwandten. Und ich bin auch im Gebet<br />
mit denen verbunden, die mir auf<br />
diesem Weg vorausgegangen sind, auch<br />
mit denen, denen ich in ihrem Sterben<br />
zur Seite stehen durfte.<br />
153<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
POSTSCRIPTUM<br />
N°-12<br />
EIGHTIES<br />
Eigentlich ist Deutschland ein mo<strong>der</strong>nes<br />
Land. Aber weil man es mit nichts<br />
übertreiben soll, erst recht nicht mit <strong>der</strong><br />
Mo<strong>der</strong>nität, halten wir uns so gern an<br />
die achtziger Jahre des vergangenen Jahrhun<strong>der</strong>ts.<br />
Also an eine Zeit, die für viele<br />
mittelalte Erwachsene von heute noch<br />
nicht lange genug zurückliegt, um endgültig<br />
<strong>der</strong> nostalgischen Verklärung anheimzufallen.<br />
Es ist ein bisschen wie mit einem<br />
S-Klasse-Mercedes des Baujahrs 1982: <strong>Der</strong><br />
darf zwar schon mit dem steuerermäßigten<br />
Oldtimer-Kennzeichen als „kraftfahrzeugtechnisches<br />
Kulturgut“ herumfahren, wird<br />
aber dennoch als „Newtimer“ bezeichnet.<br />
Die meisten Angehörigen <strong>der</strong> Generation<br />
40 plus, mich eingeschlossen, können<br />
sich zwar nicht mehr allzu detailgetreu<br />
an die Achtziger erinnern. Doch das Gefühl,<br />
damals einen Epochenwandel miterlebt zu<br />
haben, ist noch einigermaßen frisch. Allein<br />
schon deshalb, weil plötzlich alles digital<br />
wurde: die Spiele, die Musik, die Textverarbeitung<br />
– bis hin zu Frisuren, die aussahen,<br />
als wären sie am Computer entstanden.<br />
Die erfolgreichste deutsche Band dieses<br />
Jahrzehnts trug den Mo<strong>der</strong>nitätsanspruch<br />
sogar im Namen, und es ist kein Zufall,<br />
dass <strong>der</strong> „Mo<strong>der</strong>n Talking“-Veteran Dieter<br />
Bohlen inzwischen zum alterslosen Inventar<br />
<strong>der</strong> Fernsehcastingunterhaltung geworden ist.<br />
Nena übrigens auch.<br />
Während unsere französischen Nachbarn<br />
die Musealisierung ihrer Nation mit aller<br />
Konsequenz vorantreiben, halten wir<br />
Deutsche immerhin an den Newtimern fest.<br />
Aber bekanntlich gibt es nicht nur Alte<br />
Nationalgalerien, son<strong>der</strong>n auch Pinakotheken<br />
<strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne. Und in Deutschland werden<br />
eben die Errungenschaften <strong>der</strong> achtziger<br />
Jahre unter beson<strong>der</strong>en konservatorischen<br />
Schutz gestellt. So gilt „Wetten, dass?“<br />
( Erstausstrahlung 1981 ) dem Staatssen<strong>der</strong><br />
ZDF immer noch als gelungenes Entertainmentformat<br />
„für die ganze Familie“, während<br />
sich bei <strong>der</strong> fö<strong>der</strong>alen ARD nach wie<br />
vor ein gewisser Horst Schimanski ( Erstauftritt<br />
ebenfalls 1981 ) durch Duisburger Industriebrachen<br />
ermittelt. Das kann man wohlwollend<br />
als „Kontinuität“ bezeichnen,<br />
obwohl „Einfallslosigkeit“ treffen<strong>der</strong> wäre.<br />
Auch die Großen Koalitionsverhandlungen<br />
anno 2013 atmen den Geist <strong>der</strong> achtziger<br />
Jahre. Da wird von allen Beteiligten ein<br />
mo<strong>der</strong>ner Gesellschaftsentwurf beschworen,<br />
wo es in Wahrheit darum geht, Klientelpolitik<br />
Kohl’scher Prägung zu betreiben:<br />
angefangen bei Rentengeschenken <strong>der</strong> CDU<br />
für die Zuschauerschaft von „Wetten, dass?“<br />
( Durchschnittsalter über 60 ) bis zur sozialdemokratischen<br />
Variante von „Zurück in<br />
die Zukunft“, <strong>der</strong> Rente mit 63. Nur Horst<br />
Schimanski muss tapfer weiterermitteln,<br />
obwohl er auf die 80 zugeht. Ein Zukunftsversprechen<br />
ist das trotzdem nicht.<br />
ALEXANDER MARGUIER<br />
ist stellvertreten<strong>der</strong> Chefredakteur<br />
von <strong>Cicero</strong><br />
DIE NÄCHSTE CICERO-AUSGABE ERSCHEINT AM 19. DEZEMBER<br />
Illustration: Anja Stiehler/Jutta Fricke Illustrators<br />
154<br />
<strong>Cicero</strong> – 12. 2013
LeagasDelaney.de<br />
Wir verraten Ihnen gern,<br />
wovon die Frau<br />
Ihrer Träume träumt.<br />
EINE UNVERGESSLICHE ZEIT IN PARIS, 16, RUE ROYALE<br />
IN LONDON, MADRID, WIEN, NEW YORK, PEKING, PARIS<br />
UND AN DEN BESTEN ADRESSEN DEUTSCHLANDS. WWW.WEMPE.DE<br />
Wempe Solitaire Ringe Krone und Colonna in 18k Weißgold.<br />
Ausdruck großer handwerklicher Perfektion und unserer Leidenschaft für Juwelen.