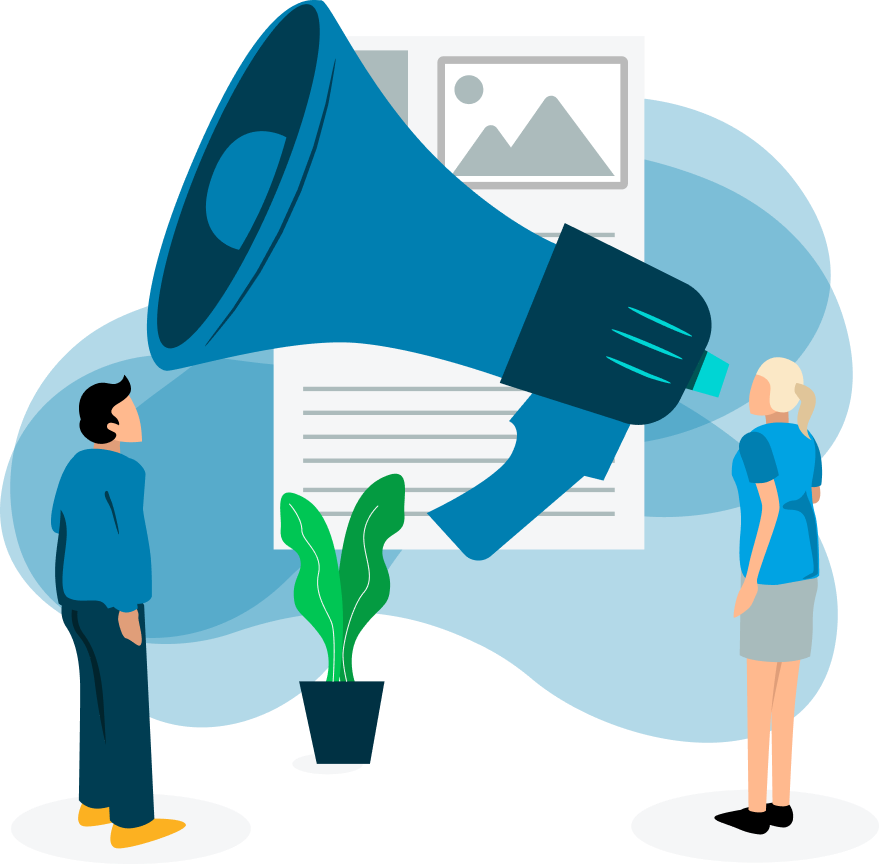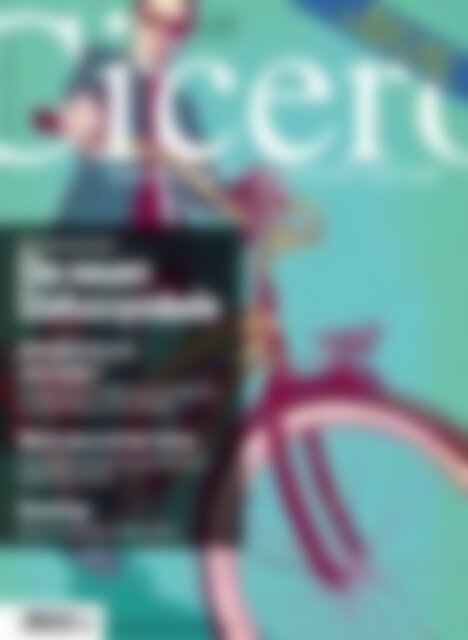Cicero Abschied vom Auto: Die neuen Statussymbole (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WWW.CICERO.DE<br />
Brust raus!<br />
Zu Besuch bei Femen<br />
Juli 2013<br />
8 EUR / 12,50 CHF<br />
www.cicero.de<br />
<strong>Abschied</strong> <strong>vom</strong> <strong>Auto</strong><br />
<strong>Die</strong> <strong>neuen</strong><br />
<strong>Statussymbole</strong><br />
„Natürlich bin ich<br />
eine Option“<br />
Ilse Aigner über ihren Machtanspruch in der CSU<br />
und die Nachfolge von Horst Seehofer<br />
Mein Leben mit der Fatwa<br />
Hamed Abdel-Samad über den Mordaufruf der<br />
ägyptischen Islamisten<br />
Babyblogs<br />
Darf man seine Kinder ins Netz stellen?<br />
Österreich: 8 EUR, Benelux: 9 EUR, Italien: 9 EUR<br />
Spanien: 9 EUR, Portugal (Cont.): 9 EUR, Finnland: 12 EUR
01<br />
4 1 98489 306907<br />
6,90 EUR / 9,90 CHF<br />
www.cicero.de<br />
Das Bilderpaar<br />
Sie verdichten, ohne zu karikieren. Sie<br />
machen Freude, ohne ins Unernste zu<br />
fallen. Illustrationen von Miriam Migliazzi<br />
und Mart Klein erinnern in ihrer Dynamik<br />
an hochklassige Comics. <strong>Die</strong> Kraft<br />
dieses Genres weiß das Illustratorenpaar<br />
zu nutzen, weil Mart Klein einst als<br />
Comiczeichner begann. Gemeinsam<br />
gründeten beide das Comic-Label „Unfug<br />
Verlag“. Heute bebildern sie politische und<br />
gesellschaftliche Themen für Magazine auf<br />
der ganzen Welt. Sie schließen Ereignisse<br />
und Entwicklungen für die Betrachter<br />
auf. So entstanden die Frau und der<br />
Mann mit dem Statusfahrrad für dieses<br />
Heft. So entstand auch das Doppelcover<br />
für die Sonderausgabe des <strong>Cicero</strong> zur<br />
Bundestagswahl.<br />
TITELBILD UND ILLUSTRATION:<br />
MIRIAM MIGLIAZZI & MART KLEIN<br />
WWW.CICERO.DE<br />
<strong>Die</strong><br />
Entscheidung<br />
Deutschland wählt – und ganz<br />
Europa fiebert mit<br />
Koalitionen, Konzepte,<br />
Kampfzonen – alles zur<br />
Bundestagswahl 2013<br />
spezial<br />
Steinbrück<br />
gegen Merkel<br />
Ihre Stärken,<br />
ihre Schwächen<br />
Wer kommt rein?<br />
Alle 299 Wahlkreise im <strong>Cicero</strong>-Check:<br />
<strong>Die</strong> Duelle, die Themen, die Favoriten<br />
„Der hatte was intus“<br />
Wie Gerhard Schröder in der Wahlnacht 2005<br />
Angela Merkel zur Kanzlerin machte<br />
Hochrechnungen<br />
<strong>Die</strong> 18-Uhr-Lüge<br />
spezial<br />
<strong>Die</strong><br />
Sonderausgabe<br />
des <strong>Cicero</strong> zur<br />
Bundestagswahl<br />
ist da. Ein Genuss<br />
für alle, die Lust<br />
auf Politik haben:<br />
Koalitionen,<br />
Konzepte,<br />
Kampfzonen
Brust raus!<br />
Zu Besuch bei Femen
EINZIGARTIG AUSSEN.<br />
EINDRUCKSVOLL INNEN.<br />
Erleben Sie Sportlichkeit und Eleganz, kombiniert mit einem außergewöhnlich großzügigen Innenraum.<br />
Mehr als nur ein neues <strong>Auto</strong>mobil: der neue BMW 3er Gran Turismo. Weitere Informationen bei Ihrem<br />
BMW Partner oder unter www.bmw.de/3erGranTurismo<br />
ERLEBEN SIE EINE NEUE GRÖSSE.<br />
DER NEUE BMW 3er GRAN TURISMO.<br />
Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 8,1–4,5. CO 2 -Emission in g/km (kombiniert): 189–119.<br />
Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
Der neue BMW<br />
3er Gran Turismo<br />
www.bmw.de/<br />
3erGranTurismo<br />
Freude am Fahren<br />
Jetzt scannen<br />
und eine neue<br />
Größe erleben.
cartier.de – 089 55984-221<br />
calibre de cartier<br />
CHRONOGRAPH 1904-CH MC<br />
DAS NEUE CHRONOGRAPHEN-UHRWERK MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 1904-CH MC WURDE IN GRÖSSTER<br />
UHRMACHER TRADITION VON DEN UHRMACHERN DER CARTIER MANUFAKTUR KREIERT, ENTWICKELT UND<br />
GEBAUT. UM PERFEKTE PRÄZISION ZU ERREICHEN, WURDE DAS UHRWERK MIT VIRTUOSER TECHNIK<br />
AUSGESTATTET: EIN SCHALTRAD, UM ALLE FUNKTIONEN DES CHRONOGRAPHEN ZU KOORDINIEREN,<br />
EIN VERTIKALER KUPPLUNGSTRIEB, UM DIE AKKURATESSE DES STARTENS UND STOPPENS DER TIMER<br />
FUNKTION ZU VERBESSERN, EINE LINEARE RESET FUNKTION UND EIN DOPPELTES FEDERHAUS, UM EIN<br />
UNVERGLEICHLICHES ABLESEN DER ZEIT ZU GEWÄHRLEISTEN.<br />
42MM GEHÄUSE AUS STAHL, MECHANISCHES MANUFAKTUR–CHRONOGRAPHENUHRWERK, AUTOMATIK-<br />
AUFZUG, KALIBER 1904-CH MC (35 STEINE, 28.800 HALBSCHWINGUNGEN PRO STUNDE, CA. 48 STUNDEN<br />
GANG RESERVE), KALENDERÖFFNUNG BEI 6 UHR, ACHTECKIGE KRONE AUS STAHL, SILBER OPALIERTES<br />
ZIFFERBLATT, PROFILRILLEN MIT SILBER FINISH, ARMBAND AUS STAHL.
C i c e r o | A t t i c u s<br />
Von: <strong>Cicero</strong><br />
An: Atticus<br />
Datum: 27. Juni 2013<br />
Thema: <strong>Statussymbole</strong>, Steuern, Grenzerfahrungen<br />
<strong>Die</strong> Grenzgänger<br />
Illustration: Christoph Abbrederis<br />
I<br />
ch sehe ihn noch vor mir auf dem Garagenvorplatz. Ein 230 E, in<br />
biederem Beige, die Sitze auch in einer undefinierbaren Nichtfarbe, und die<br />
ganze Familie stand ergriffen um den Mercedes herum. Wir Kinder spürten:<br />
Das hier war mehr als ein <strong>Auto</strong>. Das war ein <strong>Die</strong>nstwagen, der erste <strong>Die</strong>nstwagen<br />
unseres Vaters. Er hatte es geschafft. Jetzt hatte er es geschafft.<br />
Ich habe später Firmenautos, wenn sie möglich gewesen wären, immer abgelehnt.<br />
Ich mache mir nichts aus <strong>neuen</strong> <strong>Auto</strong>s. Mein Statussymbol ist kein motorisiertes<br />
Fahrzeug, dessen Brief auf meinen Arbeitgeber ausgestellt ist. Sondern ein flinkes,<br />
formschönes Fahrrad – oder die kleinen Klangwunder in Kirschholz in meinem<br />
Wohnzimmer.<br />
Das <strong>Auto</strong> hat Konkurrenz bekommen, als Fortbewegungsmittel, als Statussymbol.<br />
<strong>Die</strong> Absätze der deutschen <strong>Auto</strong>mobilindustrie im eigenen Land sinken rapide, auch<br />
weil der Stadtmensch immer weniger <strong>Auto</strong>s braucht – weder als Nutzfahrzeug noch als<br />
Statussymbol. Jan Kuhlbrodt (ab Seite 18), Buchautor und Fachmann für Statusfragen,<br />
hat sich auf die Suche nach jenen Dingen gemacht, mit denen man neuerdings zeigt,<br />
wer man ist. Til Knipper (ab Seite 30), Leiter des <strong>Cicero</strong>-Ressorts Kapital, ist der Frage<br />
nachgegangen, wie die <strong>Auto</strong>industrie der Entwicklung entgegentritt.<br />
Knipper hat außerdem den Drogerie-Milliardär Dirk RoSSmann befragt, warum<br />
er unbedingt mehr Steuern zahlen will (ab Seite 88). Ein Klartext-Interview, in dem<br />
Roßmann sogar behauptet, mit seiner Meinung nicht allein zu sein: „Ich kenne einige<br />
vermögende Menschen. Acht von zehn reichen Leuten haben kein Problem mit der<br />
Idee, höhere Einkommenssteuer zahlen zu müssen.“<br />
Ein Heft wie dieses ist viel Planung, aber immer auch etwas Zufall. Der Zufall<br />
will es nun, dass sowohl der (noch) amtierende Ministerpräsident von Hessen, Volker<br />
Bouffier, als auch die (noch) nicht amtierende Ministerpräsidentin von Bayern, Ilse<br />
Aigner, in dieser Ausgabe erstmals sehr offen über Grenzerfahrungen in ihrem Leben<br />
reden. Der CDU-Mann im Porträt von Hartmut Palmer ab Seite 34. <strong>Die</strong> amtierende<br />
Verbraucherministerin Aigner im Interview ab Seite 38. Wir haben uns gefragt: Ist das<br />
vielleicht gar kein Zufall, sondern ein Muster? Sind Menschen, die durch existenzielle<br />
Krisen gegangen sind, besser gewappnet für einen der härtesten Berufe der Welt:<br />
Spitzenpolitiker?<br />
Eine Grenzerfahrung macht derzeit auch unser <strong>Auto</strong>r hamed Abdel-Samad.<br />
Islamisten rufen dazu auf, ihn zu ermorden. Von einem geheimen Ort aus hat er<br />
für <strong>Cicero</strong> sein Leben mit der Fatwa beschrieben (ab Seite 78). Von der deutschen<br />
Regierung hört man zu diesem Fall erstaunlich wenig.<br />
Mit besten Grüßen<br />
In den „Epistulae ad Atticum“ hat<br />
der römische Politiker und Jurist<br />
Marcus Tullius <strong>Cicero</strong> seinem<br />
Freund Titus Pomponius Atticus<br />
das Herz ausgeschüttet<br />
Christoph Schwennicke, Chefredakteur<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 5
C i c e r o | I n h a l t<br />
Titelthema<br />
18<br />
Der Karl-May-Effekt<br />
Mit den Zeiten ändern sich die <strong>Statussymbole</strong>. An die Stelle von Luxuskarossen und Villen sind Fahrräder getreten und<br />
Freizeit, Bildung und Kinder. Eine Expedition zu den Stätten neuer Sehnsüchte und zeitloser Hoffnung<br />
von Jan Kuhlbrodt<br />
26<br />
Unsere <strong>Statussymbole</strong><br />
Stereo-Anlage, Rennrad, DVD-Sammlung.<br />
Oder Freundinnen. <strong>Cicero</strong>-<strong>Auto</strong>ren zeigen ihre<br />
<strong>Statussymbole</strong> und sagen, was sie ihnen bedeuten<br />
30<br />
Wir Teilen uns Tinka<br />
Carsharing ist nicht bloß nützlich, sondern drückt<br />
auch ein Lebensgefühl aus<br />
von Til Knipper<br />
Illustration: Miriam Migliazzi & Mart Klein<br />
6 <strong>Cicero</strong> 7.2013
I n h a l t | C i c e r o<br />
38 Bergsteigerin Aigner<br />
66 <strong>Auto</strong>krat Erdogan<br />
80<br />
Angreifer Schoeller<br />
BERLINER REPUBLIK WELTBÜHNE kapital<br />
32 | <strong>Die</strong> Bankerin der SPD<br />
Christiane Krajewski: Von der Finanzwelt<br />
in Steinbrücks Kompetenzteam<br />
Von Andreas Theyssen<br />
62 | Soldatin in Robe<br />
<strong>Die</strong> Staatsanwältin Ilda Boccassini will<br />
Silvio Berlusconi hinter Gitter bringen<br />
Von Petra Reski<br />
80 | Mit Uncle Sam nach oben<br />
Florian Schoeller attackiert die US-<br />
Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch<br />
Von Heinz-Roger Dohms<br />
34 | Zäher Bursche<br />
Ministerpräsident Volker Bouffier ging<br />
als junger Mann durch die Hölle<br />
Von Hartmut Palmer<br />
64 | Obamas Ausputzer<br />
US-Justizminister Eric Holder wirkt<br />
trotz der Anfeindungen gegen ihn sanft<br />
Von Christoph von Marschall<br />
82 | Auf gottlosem FuSSe<br />
David Bonneys atheistische Schuhe sind<br />
der Renner in den gottesfürchtigen USA<br />
Von Daniel schreiber<br />
Fotos: Dirk Bruniecki für <strong>Cicero</strong>, Tolga Adanali/DDP Images/Sipa/Depo Photos, Andreas Pein für <strong>Cicero</strong>; Illustration: Christoph Abbrederis<br />
36 | Frau Fried fragt sich …<br />
… warum Schule Folter sein muss<br />
Von Amelie Fried<br />
38 | „Natürlich bin ich eine Option“<br />
<strong>Die</strong> CSU-Hoffnung Ilse Aigner im<br />
Interview über existenzielle Erlebnisse,<br />
Raubfische und die Bayernwahl<br />
Von Georg Löwisch und<br />
Christoph SchwenNicke<br />
44 | Mein Wunschkabinett<br />
<strong>Cicero</strong>-Wahlserie: In dieser Regierung<br />
sitzen sogar Schavan und Wulff<br />
Von Katja Kraus<br />
46 | Der Apparat frisst<br />
seine Minister<br />
Das Euro-Hawk-Debakel zeigt die<br />
groteske Komplexität im Wehrressort<br />
Von Thomas Wiegold<br />
50 | Mein Schüler<br />
Wie sich Frank-Walter Steinmeiers Ruhe<br />
auf seine Schulklasse auswirkte<br />
Von Constantin Magnis<br />
52 | Mit Käfer und Kamera<br />
Wer auf der B 1 quer durchs Land fährt,<br />
begegnet Geschichten und Geschichte.<br />
Ein sommerlicher Roadmovie<br />
Von Philipp Jeske<br />
66 | Götterdämmerung in Istanbul<br />
Erdogan unterschätzt eine Generation.<br />
<strong>Die</strong> Geschichte der Protestbewegung<br />
Von Frank Nordhausen<br />
71 | Diktatur à la Turque<br />
Warum der türkische Premier das<br />
Musterbeispiel eines <strong>Auto</strong>kraten ist<br />
Von Will J. Dobson<br />
72 | Nackte Tatsachen<br />
<strong>Die</strong> Frauenorganisation Femen<br />
lässt sich durch nichts erschüttern<br />
und provoziert weiter barbusig<br />
Von Sabine Adler<br />
78 | „Wanted Dead“<br />
Unser <strong>Auto</strong>r wird mit dem Tod bedroht.<br />
Für <strong>Cicero</strong> schildert er, wie es dazu<br />
gekommen ist, und was er nun tut<br />
Von Hamed Abdel-samad<br />
84 | Kubas Ernst & Young<br />
Vom Castro-Regime gefeuert, ist Adolfo<br />
Ajero jetzt Kubas erster Steuerberater<br />
Von Claas Relotius<br />
88 | „Deutsche Unternehmer<br />
sind zu verklemmt“<br />
Der Drogeriegründer Dirk Roßmann<br />
fordert höhere Steuern für Reiche<br />
Von Til Knipper<br />
92 | <strong>Die</strong> Diktatur der Zukunft<br />
Flut in Deutschland, Hochzeit für<br />
Klimaforscher – ein Freiheitsplädoyer<br />
Von Hans-<strong>Die</strong>ter Radecke und<br />
Lorenz Teufel<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 7
C i c e r o | I n h a l t<br />
98 Fiona Leahy lehrt die Vermählung 112<br />
Rick Rubin balanciert Black Sabath aus<br />
Stil<br />
Salon<br />
96 | Sie werden es wollen<br />
Justin O’Shea, Chefeinkäufer von<br />
mytheresa.com, definiert Modetrends<br />
Von Anne Waak<br />
108 | lizenz zum Wehtun<br />
Martin Brinkmann gibt Deutschlands<br />
frechste Literaturzeitschrift heraus<br />
Von alexander Kissler<br />
126 | Der Tod trug viele Masken<br />
Das Geiseldrama von Gladbeck wirft<br />
auch nach 25 Jahren Fragen auf<br />
Von peter Henning<br />
98 | „Ich heule immer“<br />
<strong>Die</strong> britische Hochzeitsplanerin Fiona<br />
Leahy über die Gesetze des Feierns<br />
Von LENA BERGMANN<br />
110 | Offene Rechnungen<br />
Hat Ulla Berkéwicz das Ende<br />
von Suhrkamp eingeläutet?<br />
Von wiebke Porombka<br />
130 | Der Freiheit Falsche Freunde<br />
<strong>Die</strong> Ichlinge verdammen den Staat,<br />
weil er ihren Egoismus begrenzt<br />
Von Christoph Schwennicke<br />
100 | Warum ich trage, was ich trage<br />
Früher mussten die Klamotten die<br />
Härte des Lebens präsentieren<br />
Von SAMUEL FINZI<br />
112 | der Hexer<br />
Musikproduzent Rick Rubin hat „Black<br />
Sabbath“ zum Meisterwerk verholfen<br />
Von Thomas Winkler<br />
132 | BibliotheksportrÄt<br />
Hubert Burda liebt Petrarca und<br />
hofft auf eine neue Renaissance<br />
Von holger Fuss<br />
102 | DAs fremde Kind, das ich kenne<br />
Babyblogs: Eine Spielplatzbegegnung<br />
veranschaulicht ein<br />
unheimliches Phänomen<br />
Von Lena Bergmann<br />
106 | Küchenkabinett<br />
Essen im Stehen passt in unsere Zeit,<br />
auch außerhalb der Sommerfeste<br />
Von Julius Grützke und Thomas Platt<br />
114 | Mein paulus, mein Moses<br />
Was ich durch die beiden Urväter<br />
über den modernen Bürger lernte<br />
Von Feridun Zaimoglu<br />
118 | „<strong>Die</strong> reine Präsenz“<br />
Der Maler Tim Eitel wendet sich in<br />
<strong>neuen</strong> Bildern dem Prekariat zu<br />
Von Ralf Hanselle<br />
120 | man sieht nur, was man sucht<br />
Mit Grandma Moses kehrte die<br />
Idylle in die Malerei zurück<br />
Von Beat Wyss<br />
122 | Fromme Illusionen<br />
Das Konkordat mit dem Heiligen Stuhl<br />
wertete Hitlers Regime auf<br />
Von Philipp Blom<br />
125 | benotet<br />
Musik macht den Unterschied<br />
Von daniel Hope<br />
136 | die letzten 24 Stunden<br />
Vor dem eigenen Tod sollte man<br />
nicht davonschwimmen<br />
Von john von Düffel<br />
Standards<br />
Atticus —<br />
Von Christoph Schwennicke — seite 5<br />
Stadtgespräch — seite 10<br />
Forum — seite 14<br />
Impressum — seite 17<br />
Postscriptum —<br />
Von Alexander Marguier — seite 138<br />
<strong>Die</strong> nächste <strong>Cicero</strong>-Ausgabe<br />
erscheint am 25. Juli 2013<br />
Fotos: Courtesy of Curio magazine, Martin Schöller/August Images; Illustration: christoph Abbrederis<br />
8 <strong>Cicero</strong> 7.2013
C i c e r o | S t a d t g e s p r ä c h<br />
ein linker schwärmt für die Bundeskanzlerin, ein CSU-Mann hilft einem<br />
Linken beim Wahlkampf. Ein Pfarrer hält den Bundestagsrekord im Reden.<br />
Insider verraten, warum am <strong>neuen</strong> Flughafen BER ewig das Licht brannte<br />
ein gewisses Lächeln:<br />
Da schwärmt sogar gysi<br />
I<br />
n der Hamburgischen Landesvertretung<br />
moderiert Gregor Gysi ein<br />
Gespräch mit Uwe-Karsten Heye<br />
und Hugo Müller-Vogg. Beide tragen den<br />
Bindestrich in ihrem Namen, der eine<br />
auf der linken, der andere auf der rechten<br />
Seite. Der eine war Redenschreiber von<br />
Willy Brandt, der andere ist Redenschreiber<br />
in der Bild.<br />
Es ging um deren – nicht miteinander,<br />
sondern eher gegeneinander geschriebenes<br />
– Buch „Steinbrück oder Merkel?“<br />
Gegen Ende der Veranstaltung wird Gysi<br />
gebeten, doch nun auch seine persönlichen<br />
Eindrücke über die beiden Kandidaten<br />
mitzuteilen.<br />
Und da geschieht es: eine Liebeserklärung.<br />
Gysi an Merkel.<br />
Der Linke erzählt, wie vor fast genau<br />
drei Jahren in Island ein Vulkan ausbrach.<br />
<strong>Die</strong> Aschewolke über Europa ließ den Flugverkehr<br />
nahezu zusammenbrechen. Frau<br />
Merkel wollte nach einem Besuch – „von<br />
wo auch immer“ – nach Berlin zurückfliegen,<br />
landete aber in Lissabon.<br />
Als sie dort aus dem Flugzeug ausgestiegen<br />
sei, habe sie verschmitzt gelächelt und<br />
die Augen leicht nach oben verdreht. Er<br />
habe es selbst im Fernsehen gesehen. „Und<br />
ich sage Ihnen, das hatte was“, sagt Gregor<br />
Gysi. Auch er lächelt jetzt – offensichtlich<br />
immer noch beeindruckt von der ihn bezaubernden<br />
Merkel. gw<br />
Redenrekord im Plenum:<br />
Polit-Pastor holt gold<br />
P<br />
ascal Kober von der FDP ist<br />
ein ganz besonderer Parlamentarier.<br />
Der Reutlinger Abgeordnete<br />
hält uneinholbar den Redenrekord in der<br />
jetzt auslaufenden 17. Legislaturperiode.<br />
131 Mal hat er seit seinem Einzug in den<br />
Bundestag im Jahr 2009 bereits das Wort<br />
ergriffen. Er kann auch <strong>vom</strong> Zweitplatzierten<br />
Heinrich Kolb (110 Reden) und<br />
ebenfalls Freidemokrat nicht mehr eingeholt<br />
werden.<br />
Dass er so oft rede, habe nichts damit<br />
zu tun, dass er als evangelischer Pfarrer<br />
das Predigen gelernt habe. „Ich bin<br />
auch keine rhetorische Geheimwaffe der<br />
FDP“, versichert er. Er müsse deshalb<br />
so oft ans Mikrofon treten, weil er Mitglied<br />
im Hartz-IV-Ausschuss sei, dessen<br />
Probleme die Opposition besonders gern<br />
im Plenum des Bundestags zur Sprache<br />
bringe. Häufig müsse er auch als Vertreter<br />
im Ausschuss für Menschenrechte<br />
und humanitäre Hilfe den Standpunkt der<br />
FDP vertreten.<br />
Kober ist aber nicht nur ein fleißiger<br />
Rhetor, ihm ist es auch gelungen, im Hohen<br />
Haus von rechts bis links ein großes<br />
Gelächter auszulösen. Am Ende seiner<br />
100. Rede erlaubte er sich nämlich eine<br />
„persönliche Bemerkung“ an SPD-Kanzlerkandidat<br />
Peer Steinbrück. Der hatte<br />
im Unterschied zu Kober bis dahin nur<br />
fünfmal im Bundestag geredet und wegen<br />
seiner umfangreichen Vortragstätigkeit<br />
bekanntlich wenig Zeit fürs Plenum<br />
gefunden. An ihn gewandt stichelte Kober<br />
nun: „Ich freue mich, dass ausgerechnet Sie<br />
bei meiner 100. Rede anwesend sind.“ Das<br />
Protokoll vermerkt Heiterkeit auf allen Seiten<br />
des Hauses. Nur Steinbrücks Lippen<br />
wurden schmal.<br />
Anfangs hatte Kober gedacht, er<br />
komme als Parlamentsnovize so bald nicht<br />
zu Wort. Aber dann schaffte er es schon bei<br />
seinem ersten Auftritt im Plenarsaal, gleich<br />
zwei Reden zu halten. Einen Ordnungsruf<br />
hat der Polit-Pfarrer bislang noch nicht einstecken<br />
müssen. tz<br />
illustrationen: Cornelia von Seidlein<br />
10 <strong>Cicero</strong> 7.2013
illustrationen: Cornelia von Seidlein<br />
CSU-GRAF stützt linken:<br />
Historisches Bündnis<br />
E<br />
r sei, beteuert der Bundestagsabgeordnete<br />
Wolfgang Nešković unablässig,<br />
„kein Politiker, sondern<br />
ein Richter, der Politik macht“. Tatsächlich<br />
war der Bundesrichter a. D. zuerst Sozialdemokrat,<br />
bis die SPD das Asylrecht änderte.<br />
Dann war er bei den Grünen, bis die den<br />
Einsatz der Bundeswehr im Kosovo billigten.<br />
Dann holte ihn Gregor Gysi als parteilosen<br />
Kandidaten für den Wahlkreis 64<br />
(Cottbus-Spree-Neiße), den er tatsächlich<br />
direkt gewann. Leider kam er mit den dunkelroten<br />
Genossen in Brandenburg nicht<br />
klar. Er warf ihnen vor, in der Landtags-<br />
Koalition mit der SPD der Fortsetzung des<br />
Braunkohlebaus in der Lausitz zugestimmt<br />
und damit ein zentrales Wahlversprechen<br />
gebrochen zu haben.<br />
Jetzt will Nešković als Unabhängiger<br />
für den Bundestag kandidieren. Der Überzeugungstäter,<br />
der sich immer auf der linken<br />
Seite des politischen Spektrums verortete,<br />
hat dabei einen prominenten<br />
Konservativen gefunden, der ihm helfen<br />
will: Hermann Graf von Pückler, Urgroßneffe<br />
des berühmten Landschaftsgestalters<br />
und Weltenbummlers Fürst von Pückler-<br />
Muskau, der im 18. Jahrhundert rund um<br />
das Schloss Branitz den Schlosspark Cottbus-Branitz<br />
schuf – heute noch eine Sehenswürdigkeit<br />
des Landes.<br />
<strong>Die</strong> Pückler-Familie wurde 1945 vertrieben.<br />
Graf Hermann – 1939 auf Schloss<br />
Branitz geboren, wohin er nach dem Mauerfall<br />
zurückkehrte – wuchs in München<br />
auf und engagierte sich in der CSU. Früher<br />
war er Geschäftsführer und Partner einer<br />
Vertriebsgesellschaft für Industrieanlagen,<br />
heute betreibt er bei Cottbus die<br />
Pückler’sche Forstwirtschaft. Auch er ist<br />
ein erbitterter Gegner des Braunkohletagebaus,<br />
weil abzusehen ist, dass die durch<br />
den Bergbau verursachte Grundwasserabsenkung<br />
auch seine Wälder bedroht. In<br />
Nešković, auf den ihn übrigens der CSU-<br />
Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler<br />
aufmerksam gemacht hat, fand er nun<br />
einen engagierten Mitstreiter. „Über Wirtschaftspolitik<br />
haben wir sicher unterschiedliche<br />
Meinungen“, sagt Graf Pückler. Aber<br />
in der Lausitz sei Nešković „für mich der<br />
einzige Kandidat, der ganz klar kein Lobbyist<br />
von Vattenfall ist.“<br />
Der so gelobte linke Quertreiber rechnet<br />
sich Chancen aus, mit Hilfe des CSU-<br />
Mannes den Wahlkreis direkt zu holen. Zu<br />
seinen Unterstützern gehören auch viele<br />
Linke, die mit dem Partei-Establishment<br />
nicht einverstanden sind. Außerdem Piraten,<br />
Attac-Anhänger und viele Nichtwähler.<br />
Wenn außer ihm noch weitere Unabhängige<br />
im Parlament säßen, gäbe es eine Möglichkeit,<br />
das „Parteiendiktat“ (Nešković) im<br />
Bundestag zu brechen. Noch nie hat es allerdings<br />
ein Kandidat geschafft, als Unabhängiger<br />
einen Wahlkreis direkt zu holen.<br />
„<strong>Die</strong> Lausitz“, sagt Nešković, „kann Geschichte<br />
schreiben.“ hp<br />
Schilda in Schönefeld:<br />
Software vergessen<br />
I<br />
m Rathaus von Schilda war es bekanntlich<br />
immer duster, weil die<br />
Schildbürger vergessen hatten,<br />
Fenster einzuplanen. Im <strong>neuen</strong> Berliner<br />
Flughafen Schönefeld war es monatelang<br />
immer hell, weil niemand wußte, wie man<br />
das Licht ausschaltet. Es brannte Tag und<br />
Nacht, obwohl noch kein einziges Flugzeug<br />
je gestartet oder gelandet war. Wer nachfragte,<br />
warum das so sei, bekam zu hören,<br />
das Sicherheitspersonal und die Putzleute<br />
bräuchten die Beleuchtung – zum Bewachen<br />
und zum Putzen und zwar Tag und<br />
Nacht auf allen 300 000 Quadratmetern<br />
Geschossfläche.<br />
Das zu glauben, fiel schon schwer. Irgendwann<br />
lüftete Technik-Chef Horst<br />
Amann bei einem Treffen mit Kaufleuten<br />
und Industriellen einen kleinen Zipfel des<br />
Geheimnisses: Das ewig brennende Licht<br />
habe „damit zu tun, dass wir mit der Leittechnik<br />
nicht so weit sind, dass wir es steuern<br />
können.“ Warum sie noch nicht so weit<br />
sind, verriet er nicht.<br />
Insider kennen längst die Wahrheit:<br />
Das Licht brannte deshalb ununterbrochen,<br />
weil Planer des Flughafens vergessen<br />
hatten, eine bestimmte Software zu kaufen,<br />
die das Licht steuert. <strong>Die</strong>se Software,<br />
die natürlich auch ein paar Tausend Euro<br />
kostet, war einfach in der Ausschreibung<br />
nicht vorgesehen und wurde folglich auch<br />
nicht geliefert. <strong>Die</strong> Folge: Nachdem das<br />
Licht zu Testzwecken angeschaltet worden<br />
war, wusste niemand, wie man es wieder<br />
ausschaltet, weil die Software fehlte. Kein<br />
Witz – Schilda pur! hp<br />
Prinzip reissverschluss:<br />
pokern um die posten<br />
D<br />
ie Kabinettsbildung in einer Koalition<br />
funktioniert wie ein Reißverschluss:<br />
Ein Zahn aus der einen<br />
Reihe greift so lange in den Zahn der<br />
gegenüberliegenden Reihe, bis der Hosenlatz<br />
zu ist. Bei zwei Koalitionären fängt der<br />
größere mit dem Kanzleramt an. Dann hat<br />
der kleinere Partner Zugriff auf das zweitwichtigste<br />
Ressort, das Finanzministerium,<br />
danach der größere auf die Drei und so<br />
weiter, bis alle Posten verteilt sind.<br />
Eigentlich. Aber nicht, wenn es am<br />
22. September zu einer Großen Koalition<br />
kommen sollte, von vielen Beobachtern<br />
als der wahrscheinlichste Wahlausgang<br />
betrachtet.<br />
Denn da würde die SPD-Seite bei Zahn<br />
zwei des Reißverschlusses sagen: „Nein,<br />
danke!“ Weil Frank-Walter Steinmeier nicht<br />
Finanzminister werden möchte. Peer Steinbrück<br />
wäre dann nämlich als Wahlverlierer<br />
weg und der vormalige Kanzlerkandidat der<br />
SPD und jetzige Fraktionschef der erste Aspirant<br />
auf den ersten SPD-Ministerposten.<br />
Steinmeier würde aber: „Bitte, nach Ihnen!“<br />
zur Union sagen. Und lieber wieder Außenminister<br />
werden, ein Amt, das er schon<br />
mal mit großer Freude ausgeübt hat, in der<br />
letzten Großen Koalition. Sagen jedenfalls<br />
Leute in der Fraktion, die es wissen müssen.<br />
Und Wolfgang Schäuble könnte bleiben,<br />
was er eh gerne bleiben würde. swn<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 11
Vision erfüllt.<br />
<strong>Die</strong> neue S-Klasse.<br />
Mit der Erfindung des <strong>Auto</strong>mobils haben wir die Welt revolutioniert.<br />
Jetzt revolutionieren wir das <strong>Auto</strong>mobil. Erneut.<br />
www.mercedes-benz.de/s-klasse<br />
Eine Marke der Daimler AG<br />
Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 13,3–6,6/7,5–4,8/9,6–5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 225–147<br />
<strong>Die</strong> Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen<br />
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
g/km; Effizienzklasse: D–A.<br />
Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen.
C i c e r o | L e s e r b r i e f e<br />
Forum<br />
Es geht um Alterssex und Jugendlieben, ums „Wir“ oder „Ich“<br />
Zu den Kolumnen von<br />
Amelie Fried über<br />
Alterssex / Juni 2013, Frauen in<br />
Führungspositionen / Mai 2013,<br />
und Jugendlieben / Februar 2013<br />
Schlag ins<br />
Gesicht<br />
Runzlige Hautlappen – zahnlose Münder, die sich aneinanderpressen, sollten nicht<br />
gezeigt werden. Aber: Knackige Körper, die übereinander herfallen – Zungen, die<br />
in Mündern herumschlappen –, sollten auch nicht gezeigt werden. Sind die Alten<br />
für die ewig Jungen so ein Graus? Gefühle und Empfindungen ändern sich – sie<br />
schrumpeln nicht. Alter ist nicht gleich körperlicher Verfall. Wird Frau Fried nicht<br />
alt? Ich denke, nur Menschen, die keinen erfüllten Sex haben, können so etwas<br />
schreiben. Ein Schlag ins Gesicht.<br />
Elisabeth Hirche, Bad Bevensen<br />
Toller Beitrag<br />
Ich habe mit Freude den Artikel von<br />
Amelie Fried „… ob Frauen zu faul für<br />
Führungspositionen sind“ gelesen. Ein<br />
toller Beitrag, sprach mir direkt aus der<br />
Seele, sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür.<br />
Brigitte Friebe-August, Hamburg<br />
Keep up, Amelie!<br />
Gleicher Jahrgang, gleiche Sozialisierung:<br />
Ihr Artikel „Jugendliebe“ trifft<br />
meine Gefühle und Ansichten beziehungsweise<br />
der USA auf den Punkt! Als<br />
(amerikanisch geprägte) Berufsoptimisten<br />
können wir aber hoffen: Es gibt auch<br />
ein anderes, stilleres, reflektierendes,<br />
zivilgesellschaftlich denkendes und<br />
handelndes Amerika, nur hören wir von<br />
seinen Akteuren und diesem Teil Amerikas,<br />
der unser beider Jugendliebe viel<br />
näher kommt, in den deutschen Medien<br />
wenig, von Fox News natürlich gar nicht<br />
zu reden.<br />
Keep your column up, Amelie!<br />
O. J. Krueck, z. Zt. Kansas City, Missouri, USA<br />
zum Beitrag „Wo das Wir<br />
entscheidet“ von Alexander<br />
Kissler / Juni 2013<br />
Grandioser Fortschritt<br />
Nähert man sich naiv und ohne Hintergedanken<br />
dieser Problematik, dann ist<br />
und bleibt der Mensch ein Individuum<br />
und zugleich ein soziales Wesen, das<br />
kommuniziert und kooperiert. Somit<br />
wird er sich in der Regel fatalerweise<br />
verschiedenen Gruppen zugehörig<br />
fühlen. Wer sich nicht zugehörig fühlt,<br />
spricht von „ihr“ oder auch abwertend<br />
von „die“. In fernen Zeiten sprach man<br />
von einer dialektischen Beziehung von<br />
„ich“ und „wir“ – heute gibt es in diesem<br />
„Glaubenskrieg“ offenkundig nur noch<br />
ein „Entweder – Oder“. Was für ein<br />
grandioser Fortschritt!<br />
Es ist Herrn Brüderle insbesondere<br />
zu danken, dass er im Geiste bereits<br />
im FDP-Wahlkampfanzug und offensichtlich<br />
berauscht von der eigenen<br />
Bedeutung als politisch-philosophischer<br />
Aufklärer uns mit messerscharfer wie<br />
konfuser Argumentation auf die Abgründe<br />
des „wir“ aufmerksam machte.<br />
Denn das „wir“, so Brüderle, zerstöre<br />
das „ich“ und ist ein Kampfbegriff jener<br />
Parteien, die Deutschland in das Joch<br />
des Sozialismus zwingen wollen.<br />
Wenige Wochen zuvor hatte der<br />
gleiche Herr Brüderle getönt, dass „wir“<br />
(die FDP) die Regierung auf „Kurs“<br />
gehalten haben; wieder wenige Wochen<br />
zuvor hatte er mit dem Satz „das haben<br />
wir gemacht“ die wichtigsten Ergebnisse<br />
der Regierungsarbeit für die FDP<br />
vereinnahmt. War es die ausgeprägte<br />
Bescheidenheit Herrn Brüderles, dass er<br />
illustration: cornelia von seidlein<br />
14 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Manches teilt man gern online.<br />
/ /S I E SP RICHT MIT MA MA ÜBER ALLES_<br />
// AUSSER ÜBER IHREN ERSTEN FREUND_<br />
Anderes nicht.<br />
Manches teilt man gern online, anderes nicht. Microsoft versucht zu helfen. Wir machen uns für die Nutzung der „Do Not Track“-Funktion stark und<br />
bieten Tracking-Schutz für Internet Explorer an. Eine <strong>vom</strong> Fraunhofer-Institut SIT entwickelte und regelmäßig aktualisierte Tracking-Schutz Liste<br />
erlaubt Ihnen, sich vor unerwünschter Nachverfolgung gezielter zu schützen. <strong>Die</strong> Trennung zwischen dem, was öffentlich wird, und dem, was privat<br />
bleibt, wird vielleicht nie perfekt sein. Unabhängig davon steht der Schutz Ihrer Privatsphäre für uns an erster Stelle. microsoft.com/yourprivacy<br />
DER SCHUTZ IHRER PRI VATSPHÄRE<br />
S TEHT FÜR UNS AN ERS TER STELLE.<br />
© 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C i c e r o | L e s e r b r i e f e<br />
Debatte<br />
Wachsen oder Schrumpfen?<br />
Leser und Experten diskutieren über das Titelthema des Juni-Heftes<br />
Früh übt sich …<br />
… was später mal ein richtiger <strong>Cicero</strong>-<br />
Leser werden will. Zumindest das<br />
Titelbild mit dem Zwerg hat es dem<br />
kleinen Jonas, 3, aus Berlin angetan.<br />
Jonas wird in jedem Fall wachsen.<br />
Ob auch Deutschland wächst, wie<br />
die Titel-<strong>Auto</strong>ren behaupten, oder<br />
ob es schrumpft, wie andere meinen,<br />
darüber geht der Streit, den wir hier<br />
in Auszügen dokumentieren.<br />
<strong>Die</strong> Redaktion<br />
Dr. Reiner Klingholz, Direktor<br />
des Berlin-Instituts für<br />
Bevölkerung und entwicklung<br />
in einem Leserbrief (Auszüge):<br />
unwahrscheinlich<br />
In der neuesten Ausgabe von <strong>Cicero</strong><br />
wähnen Sie Deutschland auf dem<br />
Weg zum 100-Millionen-Volk.<br />
Nach sämtlichen heute verfügbaren<br />
Befunden ist diese Variante in etwa so<br />
wahrscheinlich wie ein Champions-<br />
League-Titel für Hoffenheim in der<br />
kommenden Saison.<br />
Zumal der Beitrag seine Argumentation<br />
ausgerechnet auf dem Bevölkerungswachstum<br />
in der sachsen-anhaltinischen<br />
Stadt Halle aufbaut. In der<br />
Tat hat sich dort die Bevölkerungszahl<br />
zwischen 2009 und 2011 geringfügig<br />
erhöht. Aber das ist kein Beleg<br />
für Wachstum, sondern eher für das<br />
Gegenteil: Überall in den <strong>neuen</strong> Bundesländern<br />
gehen die Einwohnerzahlen<br />
massiv zurück, und dieser Effekt treibt<br />
die Menschen in die Städte. Denn in<br />
den ländlichen Gebieten dünnt sich<br />
allerorts die öffentliche Infrastruktur<br />
aus – von Schulen, über Arztpraxen bis<br />
zu Einkaufsmöglichkeiten. <strong>Die</strong> Städte<br />
wachsen also lediglich, weil ihr eigenes<br />
Umland immer unattraktiver wird.<br />
Halle ist neben Magdeburg die einzige<br />
kleine Wachstumsinsel in einem<br />
Ozean des Schrumpfens.<br />
Prof. Dr. Norbert F. Schneider,<br />
Direktor des Bundesinstituts<br />
für Bevölkerungsforschung<br />
in einem Interview mit <strong>Cicero</strong><br />
Online (Auszüge):<br />
wir schrumpfen<br />
Herr Schneider, Sie wollen als Direktor<br />
des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung<br />
keine Prognose zur Bevölkerungsentwicklung<br />
in Deutschland<br />
abgeben. Warum?<br />
<strong>Die</strong> zurzeit bekannteste Prognose ist<br />
die zwölfte koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung<br />
des Statistischen<br />
Bundesamts. Sie reicht bis zum Jahr<br />
2060. <strong>Die</strong> Modellannahmen, die dort<br />
bezogen auf Geburtenhäufigkeit, Lebenserwartung<br />
und Wanderungsverhalten<br />
getroffen werden, sind in gewisser<br />
Weise beliebig und bewegen sich<br />
in breiten Korridoren. Je nach Variante<br />
kommt man auf eine Bevölkerungsgröße,<br />
die im Jahr 2060 bei circa<br />
70 Millionen und in einem anderen<br />
Fall bei etwa 64 Millionen liegt.<br />
Aber wie viele wir Mitte des Jahrhunderts<br />
auch sein werden – Fakt ist:<br />
Deutschland wird schrumpfen.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Auto</strong>ren des <strong>Cicero</strong>-Titels,<br />
Andreas Rinke und Christian<br />
schwägerl, bleiben bei ihrer<br />
these: deutschland wächst<br />
zensus besagt nichts<br />
Mit großer Überraschung sind<br />
soeben die Ergebnisse des Zensus<br />
wahrgenommen worden. 2011 hatte<br />
Deutschland danach rund 1,5 Millionen<br />
Einwohner weniger, als statistisch<br />
angenommen. Doch die Zensus-<br />
Ergebnisse besagen eben nicht, dass<br />
Deutschlands Bevölkerung schrumpft,<br />
wie viele Medien dies nun schreiben –<br />
sie bedeuten vielmehr, dass 2011 weniger<br />
Menschen in Deutschland gelebt<br />
haben, als die Behörden gedacht<br />
haben.<br />
Ein ratloser <strong>Cicero</strong>-Leser:<br />
phantom-debatte?<br />
Hat der böse Statistiker-Zensus 2011<br />
die optimistische 100-Millionen-<br />
Chance zunichtegemacht, müssen wir<br />
uns nunmehr doch wieder eher an der<br />
ernüchternden 80-Millionen-Grenze<br />
orientieren, und hat <strong>Cicero</strong> mit seinem<br />
triumphalen Aufmacher gründlich<br />
danebengelegen? Oder ist die von<br />
<strong>Cicero</strong> beschriebene Trendwende<br />
womöglich unbemerkt im Jahr 2012<br />
ins Land geschlichen? Es soll ja rund<br />
eine Million Menschen in der Republik<br />
geben, ohne Registrierung und Papiere.<br />
Oder sind auch diese Illegalen lediglich<br />
ein Phantom?<br />
Winfried Grund, Werl<br />
In eigener Sache:<br />
Der Art Directors Club Deutschland<br />
hat <strong>Cicero</strong> einen Nagel für die<br />
Covergestaltung des Septemberheftes<br />
2012 verliehen. Prämiert wurden<br />
nicht nur die Titel-Zeichnungen<br />
von Jan Rieckhoff, sondern<br />
auch die Idee, das TV‐Phänomen<br />
„Tatort“ mit den Konterfeis aller<br />
TV‐Kommissare zu präsentieren<br />
und entsprechend deren<br />
Einsatzgebieten in 20 verschiedenen<br />
Fassungen zu verbreiten<br />
– in Münster etwa<br />
mit den Porträts von Axel Prahl und<br />
Jan Josef Liefers oder in Hannover mit<br />
Maria Furtwängler auf dem Cover.<br />
Fotos: Privat; illustrationen: cornelia von seidlein<br />
16 <strong>Cicero</strong> 7.2013
I m p r e s s u m<br />
sich des „Kampfbegriffs“ der politischen<br />
Gegner bediente, um das Wort „ich“ zu<br />
umgehen?<br />
Wieland Becker, Berlin<br />
zum Postscriptum „Mitleid“ von<br />
Alexander Marguier/Mai 2013<br />
Klares Wort<br />
Auch wenn sich das Postscriptum der<br />
aktuellen Ausgabe eher wie eine Sonderveröffentlichung<br />
der Wahlkampfleitung<br />
des Kanzleramts liest, hat Herr Marguier<br />
in allen Punkten recht.<br />
Vielen Dank für dieses klare Wort!<br />
Thomas Goebel, München<br />
verleger Michael Ringier<br />
chefredakteur Christoph Schwennicke<br />
Stellvertreter des chefredakteurs<br />
Alexander Marguier<br />
Redaktion<br />
Textchef Georg Löwisch<br />
Ressortleiter Lena Bergmann (Stil), Judith Hart<br />
(Weltbühne), Dr. Alexander Kissler (Salon), Til Knipper (Kapital)<br />
Constantin Magnis (Reportagen), Christoph Seils (<strong>Cicero</strong> Online)<br />
politischer Chefkorrespondent Hartmut Palmer<br />
Assistentin des Chefredakteurs Monika de Roche<br />
Redaktionsassistentin Sonja Vinco<br />
Publizistischer Beirat Heiko Gebhardt,<br />
Klaus Harpprecht, Frank A. Meyer, Jacques Pilet,<br />
Prof. Dr. Christoph Stölzl<br />
Art director Kerstin Schröer<br />
Bildredaktion Antje Berghäuser, Tanja Raeck<br />
Produktion Utz Zimmermann<br />
Verlag<br />
geschäftsführung<br />
Rudolf Spindler<br />
Vertrieb und unternehmensentwicklung<br />
Thorsten Thierhoff<br />
Redaktionsmarketing Janne Schumacher<br />
Abomarketing Mark Siegmann<br />
nationalvertrieb/leserservice<br />
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH<br />
Düsternstraße 1–3, 20355 Hamburg<br />
Anzeigen-Disposition Erwin Böck<br />
herstellung Lutz Fricke<br />
grafik Franziska Daxer, Dominik Herrmann<br />
druck/litho Neef+Stumme, premium printing<br />
GmbH & Co.KG, Schillerstraße 2, 29378 Wittingen<br />
Holger Mahnke, Tel.: +49 (0)5831 23-161<br />
cicero@neef-stumme.de<br />
anzeigenleitung (verantw. für den Inhalt der Anzeigen)<br />
Tina Krantz, Anne Sasse<br />
Anzeigenverkauf Jörn Schmieding-<strong>Die</strong>ck<br />
anzeigenverkauf online Kerstin Börner<br />
anzeigenmarketing Inga Müller<br />
anzeigenverkauf buchmarkt<br />
Thomas Laschinski, PremiumContentMedia<br />
<strong>Die</strong>ffenbachstraße 15 (Remise), 10967 Berlin<br />
Tel.: +49 (0)30 609 859-30, Fax: -33<br />
verkaufte auflage 83 335 (IVW Q1/2013)<br />
LAE 2012 93 000 Entscheider<br />
reichweite 390 000 Leser<br />
<strong>Cicero</strong> erscheint in der<br />
ringier Publishing gmbh<br />
Friedrichstraße 140, 10117 Berlin<br />
info@cicero.de, www.cicero.de<br />
redaktion Tel.: +49 (0)30 981 941-200, Fax: -299<br />
verlag Tel.: +49 (0)30 981 941-100, Fax: -199<br />
Anzeigen Tel.: +49 (0)30 981 941-121, Fax: -199<br />
gründungsherausgeber Dr. Wolfram Weimer<br />
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in<br />
Onlinedienste und Internet und die Vervielfältigung auf<br />
Datenträgern wie CD-ROM, DVD-ROM etc. nur nach<br />
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags.<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder<br />
übernimmt der Verlag keine Haftung.<br />
Copyright © 2013, Ringier Publishing GmbH<br />
V.i.S.d.P.: Christoph Schwennicke<br />
Printed in Germany<br />
eine publikation der ringier gruppe<br />
zum beitrag „Da stehst du doch<br />
drauf“ von Daniel Haas/Mai 2013<br />
Traum von Kumpelei<br />
Schade, dass dem Spezialisten für populäre<br />
Medien Daniel Haas entgangen ist,<br />
dass sexuelle Belästigung von Frauen<br />
bei Klaas und Joko zum Traum von<br />
Kumpelei zu gehören scheint, zumindest<br />
so lange, bis dies von der Öffentlichkeit<br />
kritisiert wird. Oder hat er diesen<br />
Umstand ganz bewusst verschwiegen?<br />
Nur wenige Seiten weiter dagegen der<br />
Aufruf: „Zeig Flagge für Frauen!“ Oder<br />
gilt das erst, wenn das Niveau eindeutig<br />
auf die starke Verletzung von Menschenrechten<br />
sinkt? Vielleicht wurde dieser<br />
Artikel aber auch nur unter der Prämisse<br />
geschrieben, übertriebenen Tugendfuror<br />
um jeden Preis zu vermeiden?<br />
Bernadette Antoni, Kirchheim bei München<br />
Service<br />
Liebe Leserin, lieber leser,<br />
haben Sie Fragen zum Abo oder Anregungen und Kritik zu einer<br />
<strong>Cicero</strong>-Ausgabe? Ihr <strong>Cicero</strong>-Leserservice hilft Ihnen gerne weiter.<br />
Sie erreichen uns werktags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr und<br />
samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.<br />
abonnement und nachbestellungen<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/abo<br />
Anregungen und Leserbriefe<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserbriefe<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
E-Mail: info@cicero.de<br />
*Preise inkl. gesetzlicher MwSt. und Versand im Inland, Auslandspreise auf<br />
Anfrage. Der Export und Vertrieb von <strong>Cicero</strong> im Ausland sowie das Führen von<br />
<strong>Cicero</strong> in Lesezirkeln ist nur mit Genehmigung des Verlags statthaft.<br />
einzelpreis<br />
D: 8,– €, CH: 12,50 CHF, A: 8,– €<br />
jahresabonnement (zwölf ausgaben)<br />
D: 84,– €, CH: 132,– CHF, A: 90,– €*<br />
Schüler, Studierende, Wehr- und Zivildienstleistende<br />
gegen Vorlage einer entsprechenden<br />
Bescheinigung in D: 60,– €, CH: 108,– CHF, A: 72,– €*<br />
<strong>Cicero</strong> erhalten Sie im gut sortierten<br />
Presseeinzelhandel sowie in Pressegeschäften<br />
an Bahnhöfen und Flughäfen.<br />
Falls Sie <strong>Cicero</strong> bei Ihrem Pressehändler<br />
nicht erhalten sollten, bitten Sie ihn, <strong>Cicero</strong> bei<br />
seinem Großhändler nachzubestellen. <strong>Cicero</strong> ist<br />
dann in der Regel am Folgetag erhältlich.<br />
(<strong>Die</strong> Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.)<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 17
T i t e l<br />
18 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Der Karl-May-Effekt<br />
<strong>Die</strong> Zeiten ändern sich und mit ihnen die <strong>Statussymbole</strong>. Was<br />
früher die Luxuskarosse und die Villa waren, sind heute Fahrräder<br />
und Freizeit, Bildung und Kinder. Eine Expedition zu den<br />
Stätten neuer Sehnsüchte und zeitloser Hoffnung<br />
von jan Kuhlbrodt<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 19
T i t e l<br />
D<br />
ie Recherche zu diesem Artikel<br />
führte mich durch einige<br />
der schönsten Orte Deutschlands,<br />
durch Orte, die mit der<br />
deutschen Romantik in Verbindung<br />
stehen, sogar durch deren Herz, das<br />
Saaletal. Hier, wie in Radebeul bei Dresden,<br />
locken zum Fluss hin sanfte Hänge, mit<br />
Wein bepflanzt, inmitten der Frühlingssonne.<br />
Ich war froh, dass ich mit dem Zug<br />
unterwegs war und nicht mit <strong>Auto</strong> oder<br />
Flugzeug. Mir wäre das Grün an den Rainen<br />
sonst vollkommen entgangen. Wahrer<br />
Luxus wäre gewesen, die Strecke zu laufen,<br />
aber dazu fehlte mir die Zeit, das kostbarste<br />
Gut überhaupt.<br />
Vor einigen Jahren kauften Studenten<br />
unter Aufbringung all ihrer finanziellen<br />
Möglichkeiten ein <strong>Auto</strong>. Es war ein Ausweis<br />
von Freiheit. Auf dem Campus der<br />
Frankfurter Universität gab es eine studentische<br />
<strong>Auto</strong>vermietung, die mit einem Wochenendangebot<br />
warb, das „Kleine Fluchten“<br />
hieß, einen Opel Kadett enthielt und<br />
eine gewisse Anzahl Kilometer. Man hätte<br />
es damit knapp bis Italien geschafft, oder<br />
zur Oma in den Schwarzwald und wieder<br />
retour. Einige jener, die damals davon Gebrauch<br />
machten, bekleiden heute hohe<br />
Ämter. Einen Kommilitonen – er lehrt<br />
nun an einer Privathochschule für Juristen<br />
– sah ich kürzlich als Sachverständigen<br />
zur US‐Wahl in der Tagesschau.<br />
Damals, Ende der neunziger Jahre, saßen<br />
ein paar Freunde und ich während einer<br />
Party im Leipziger Westen gelangweilt<br />
um einen Küchentisch und überlegten, was<br />
wir mit uns und unserer Zeit anfangen sollten.<br />
Zum Glück hatte einer von uns ein<br />
<strong>Auto</strong> dabei, einen Renault mit Göttinger<br />
Kennzeichen. <strong>Die</strong>ses Fabrikat hatte ich oft<br />
an Tankstellen gesehen. Immer dieselben<br />
Kästen, immer Göttinger Kennzeichen<br />
und immer drei ältere Studenten mit Lederhosen,<br />
die in der Tankstelle eine mittelgroße<br />
„Toblerone“ kauften. Wir fuhren also<br />
zu dritt nach einem Zwischenstopp an der<br />
Tankstelle nach Rügen. Denn ich hatte damals<br />
zur Rettung des Abends einen Vater<br />
beizusteuern, der auf Rügen eine Pension<br />
betreibt und zu dem wir nun flohen.<br />
So hatten wir uns von den Eltern einen<br />
ordentlichen Status zusammengeliehen.<br />
Heute müsste ich, um meinen damaligen<br />
Vorstellungen zu genügen, eine<br />
statusgemäße Nickelbrille tragen und<br />
mit einem Füllfederhalter schreiben. Aber<br />
beides hatte ich mir schon in der späteren<br />
Jugend zu- und kurze Zeit darauf wieder<br />
abgelegt. <strong>Statussymbole</strong> verweisen eher auf<br />
einen Status, den man einnehmen will, als<br />
auf den, den man hat, und sie sind nicht<br />
immer praktisch. Man denke nur an die<br />
Halskrausen auf holländischen Barockgemälden.<br />
<strong>Die</strong> Ostsee ist heute immer noch<br />
Ziel vieler gelangweilter Berliner oder erholungssuchender<br />
Kreativer, aber kaum einer<br />
hat noch ein eigenes <strong>Auto</strong>. Auch deshalb<br />
sind die WG-Zimmer karger und individueller<br />
geworden, denn wie will man ohne<br />
<strong>Auto</strong> zu Ikea fahren?<br />
Mit der Abkehr <strong>vom</strong> Statussymbol<br />
<strong>Auto</strong> werden wir eines Tages gewaltige<br />
ökonomische Probleme bekommen. Das<br />
<strong>Auto</strong> ist eine Triebfeder der deutschen<br />
Wirtschaft. Und letztlich ist es für diese<br />
ein Glück, dass der jugendliche, kreative<br />
und autoskeptische Mittelstand derzeit nur<br />
den lautesten, buntesten und mithin sichtbarsten<br />
Teil der Gesellschaft ausmacht. <strong>Die</strong><br />
Zeitung meldete Ende April einen Gewinneinbruch<br />
bei Daimler mit einem Foto des<br />
bedrückt dreinblickenden Vorstandsvorsitzenden<br />
<strong>Die</strong>ter Zetsche.<br />
<strong>Die</strong> Ökonomen führen derartige Vorgänge<br />
auf Konjunkturschwankungen zurück.<br />
Aber warum schwankt die Konjunktur?<br />
Wo kommen die Veränderungen her?<br />
<strong>Statussymbole</strong><br />
sind<br />
geschmeidig.<br />
Sie passen<br />
sich den<br />
gesellschaftlichen<br />
Gegebenheiten<br />
an. Zielwerte<br />
werden rasch<br />
durch neue<br />
ersetzt<br />
Europa ist schon lange nicht mehr der boomende<br />
Wachstumsmarkt der Branche, asiatische<br />
Firmen beginnen, ihre eigenen Produktlinien<br />
zu entwickeln. Dacia hat das<br />
erkannt und wirbt mit Understatement.<br />
Der Dacia sei das Statussymbol für alle,<br />
heißt es, die kein Statussymbol brauchen.<br />
Im Werbetrailer packt Mehmet Scholl eine<br />
Gruppe von Jungen, die auf der Wiese Fußball<br />
gespielt haben, in einen Kombi der Billigmarke.<br />
Geschickt werden Kinderreichtum,<br />
Fußball und elterliche Fürsorge zu<br />
einem Paket verschnürt. Mehmet Scholl<br />
wird zur Symbolfigur des Mittelstands.<br />
Andererseits verzeichnet die Fahrradindustrie<br />
geradezu asiatische Zuwachsraten.<br />
Laut dem <strong>Auto</strong> Club Europa (ACE)<br />
nutzen mittlerweile 1,3 Millionen Deutsche<br />
Elektro-Fahrräder. <strong>Die</strong>se Zahl hat sich<br />
seit 2010 knapp verdreifacht. Der Umsatzanteil<br />
von E-Bikes am gesamten Fahrradmarkt<br />
stieg auf 10 und könnte bald 15 Prozent<br />
aller neu verkauften Räder betragen.<br />
Schon 2012 legte Daimler sein serientaugliches<br />
„smart ebike“ vor. Für dessen Entwicklung<br />
hatte der Konzern die Berliner E-Bike-<br />
Schmiede Grace mit an Bord geholt. Ein<br />
untrügliches Zeichen für den Wandel ist<br />
auch, dass heute sowohl Aldi-Süd als auch<br />
Aldi-Nord Elektrofahrräder vertreiben.<br />
In der Nähe von München, in Großhelfendorf<br />
bei Aying, besuche ich die Firma<br />
M1 Sporttechnik. Herr Schmid, ein jüngerer<br />
Mann, unglaublich freundlich und<br />
gut gelaunt, Marketingleiter bei M1, empfängt<br />
mich im Vestibül eines modernen Bürogebäudes.<br />
Er ist in Eile, denn die Firma<br />
beteiligt sich an zwei großen Messen, in<br />
Schanghai und in Halle/Westfalen, um<br />
ihre Carbonräder und E-Bikes vorzustellen.<br />
Es sind Produkte im höheren Preissegment,<br />
sie nähern sich finanziell dem Kleinwagen,<br />
und wenn man bedenkt, dass eine<br />
vierköpfige Familie vier Fahrräder braucht,<br />
sind wir schnell bei den Kosten für einen<br />
Mittelklasse-PKW.<br />
Das Wort E-Bike ließ mich bislang an<br />
wohlhabende Rentner denken. <strong>Die</strong> Produktlinie<br />
der Firma M1 belehrt mich eines<br />
Besseren. Auch die Elektroräder sind<br />
schnittige Fahrzeuge mit sportlicher Optik.<br />
Es gehe darum, erfahre ich, dem weniger<br />
Trainierten das Mithalten zu ermöglichen.<br />
Wenn Paare aus einem Sportler und<br />
einem Nichtsportler bestehen, soll Letzterer<br />
mit Ersterem auf gleicher Höhe fahren<br />
können.<br />
20 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Illustrationen: Miriam Migliazzi & Mart Klein (Seiten 18 bis 21)<br />
<strong>Die</strong> Firma hat sich für den Stammsitz<br />
die passende Gegend gewählt, ein Idyll, das<br />
von zahlungskräftigen Mittelständlern bewohnt<br />
wird. Schmids Augen leuchten, als<br />
ich ihn darauf hinweise. Wenn es nicht<br />
so neblig wäre, könne man die Gipfel der<br />
Alpen sehen. Dabei hat er in Maastricht<br />
studiert, in den Niederlanden, dem Fahrradland<br />
schlechthin. Dort kaufe man nur<br />
einmal im Leben ein Fahrrad, sagt er, und<br />
nachdem es gestohlen wurde, stiehlt man<br />
selbst. So könnte auch die Aufhebung des<br />
Eigentums durch Sozialisierung verlaufen.<br />
Davon aber sind wir weit entfernt. Allein<br />
ein Fahrradschloss kostete mich jüngst<br />
60 Euro.<br />
Herr Schmid betont die ökologische<br />
und verkehrspolitische Dimension des<br />
<strong>neuen</strong> Statussymbols Fahrrad. Ein Fahrrad<br />
ist in einer verstopften Innenstadt weniger<br />
Möglichkeit als vielmehr Bedingung eines<br />
zügigen Fortkommens. Zudem gewährleistet<br />
das Fahrrad im Gegensatz zum <strong>Auto</strong> die<br />
Sichtbarkeit seines Besitzers; er verschwindet<br />
nicht im Bauch, sondern schwingt sich<br />
beherzt als Herrscher auf den Sattel, ist eher<br />
stolzer Reiter denn Fahrer, kein Angestellter<br />
mehr, kein Chauffeur. Ein Fahrrad signalisiert<br />
Freiheit und Überlegenheit.<br />
<strong>Die</strong> Alleen der blühenden Apfelbäume<br />
sind bevölkert mit radelnden Mittvierzigern.<br />
Verwegenheit ist ihnen kein Wert<br />
mehr, sie tragen schicke Fahrradhelme<br />
und achten darauf, dass auch die Kinder<br />
sich wappnen. Eine solche Szene kann man<br />
in den Weinbergen um Meißen oder im<br />
Saaletal täglich beobachten.<br />
Weinanbau ist ein Statussymbol für eine<br />
privilegierte Gegend. Wo Wein angebaut<br />
wird, lebt es sich gut. Das führte zum Beispiel<br />
dazu, dass es eine Marke gibt, die von<br />
Reblingen stammt, die auf dem Südhang<br />
eines ehemaligen Tagebaus angepflanzt<br />
wurden. Auf ihrem Etikett prangen die<br />
gekreuzte Spitzhacke und der Hammer:<br />
„Blauer Steiger <strong>vom</strong> Geiseltalsee“. Benachbart<br />
sind die Saale-Unstrut-Gebiete. Aber<br />
auch Brandenburg winzert inzwischen,<br />
zum Beispiel im Weingut Welzow.<br />
Aus Weinanbaugebieten haben sich<br />
in den vergangenen 20 Jahren exklusive<br />
Wohngebiete entwickelt. Radebeul bei<br />
Dresden hat die höchste Millionärsdichte<br />
Deutschlands. In Radebeul zu wohnen, bedeutet<br />
enormen Statusgewinn. Vor dem<br />
Ersten Weltkrieg wusste das schon Karl<br />
May, der sich eben dort seine „Villa Bärenfett“<br />
errichten ließ. <strong>Die</strong> Einnahmen aus<br />
seinen Büchern ließen es zu, und sie ließen<br />
auch zu, dass er im Alter Reisen in einen<br />
Teil jener Gegenden unternehmen konnte,<br />
die er zuvor in seinen Büchern beschrieben<br />
hatte. Ein Zeichen des Niedergangs des <strong>Auto</strong>s<br />
als Statussymbol ist es wahrscheinlich<br />
auch, dass der Bahnhof von Radebeul gerade<br />
saniert wird, der über die Jahre vor<br />
sich hin verfiel.<br />
Mit Karl May wird jemand beschrieben,<br />
der zu seinen Lebzeiten den Kampf um Statusgewinne<br />
erfolgreich bestanden hat. Der<br />
sich herausarbeitete aus der Kleinstadt Hohenstein-Ernsttal<br />
und der Kleinkriminalität,<br />
der Gefängniserfahrungen machte, sich<br />
dem Leben als Genießender hingab und<br />
schließlich imstande war, seine Individualität<br />
auszukosten. Er verwuchs mit den<br />
Insignien guten Lebens, wurde selbst zum<br />
Symbol einer mitteleuropäischen Werteordnung.<br />
Und er machte jene Reisen, von<br />
denen er jahrelang geträumt hatte, wandelte<br />
auf den Spuren Kara ben Nemsis<br />
und fuhr mit dem Orientexpress. <strong>Die</strong> Beziehung<br />
von Karl May zu seinen Figuren<br />
ist ein Gleichnis zum Statussymbol: Der<br />
<strong>Auto</strong>r träumte sich in eine Rolle, die er literarisch<br />
ausführte und schuf sich gerade<br />
so die Mittel, diese Rolle im realen Leben<br />
einzunehmen.<br />
Wer es nicht schafft wie May, seine<br />
Träume als Bestseller zu verkaufen, oder in<br />
den angestrebten Status hineinzuwachsen,<br />
fällt zurück. Der französische Soziologe<br />
Pierre Bourdieu beschreibt diesen Vorgang<br />
in seinem Werk „<strong>Die</strong> feinen Unterschiede“<br />
als soziales Altern; es gibt demnach kein<br />
Stehenbleiben auf der Status-Treppe. Wer<br />
sich nicht nach oben fortwährend verjüngt,<br />
rutscht ab. „Soziales Altern“, so Bourdieu,<br />
„stellt nichts anderes dar als diese langwährende<br />
Trauerarbeit oder, wenn man mag,<br />
die gesellschaftlich unterstützte und ermutigte<br />
Verzichtsleistung, welche die Individuen<br />
dazu bringt, ihre Wünsche und Erwartungen<br />
den jeweils objektiven Chancen<br />
anzugleichen.“<br />
<strong>Die</strong> ironische Aufzählung der drei dominierenden<br />
<strong>Statussymbole</strong> Haus, Boot<br />
und <strong>Auto</strong> in einem Werbespot der neunziger<br />
Jahre gilt heute nur noch bedingt.<br />
Während in abgeschiedenen ländlichen<br />
Gebieten die Grundstücks- und Immobilienpreise<br />
verfielen oder zumindest stabil<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 21
T i t e l<br />
Bereich will das Statussymbol nicht nur<br />
Zeichen der Gruppenzugehörigkeit sein,<br />
sondern darüber hinaus die Individualität<br />
der Trägerin betonen. „In der <strong>neuen</strong> Maison<br />
in München“, so Klingenberg, „bieten<br />
wir erstmals in Deutschland den sogenannten<br />
‚Haute Maroquinerie‘-Service an, der es<br />
Kunden ermöglicht, eine Tasche von Louis<br />
Vuitton aus verschiedenen Formen, Lederarten<br />
und Größen nach eigenen Vorstellungen<br />
selbst zu kreieren.“<br />
Ein Fehler wäre es jedoch, Luxus und<br />
Statussymbol in eins zu setzen. Es gilt zu<br />
unterscheiden zwischen der Uhr, die man<br />
trägt als bloßen Schmuck, und jenem Instrument,<br />
welches die Zeit vorschreibt und<br />
den Rhythmus anzeigt. Als Luxusobjekt<br />
muss die Uhr gar nicht unbedingt präzise<br />
funktionieren, tut es aber meist, weil die<br />
Präzision, die sich aus der Bearbeitung erlesener<br />
Materialien ergibt, auch die Schönheit<br />
eines Gebrauchsgegenstands ausmacht.<br />
Und ihr Käufer hat einen Blick für die Besonderheiten<br />
der Mechanik, für die Restlaufzeitanzeige<br />
der „Lange 01“. Er kauft die<br />
Uhr aus Liebe zum Detail.<br />
geblieben sind, explodierten sie in den Ballungsräumen<br />
und Großstädten. München<br />
zum Beispiel, berichteten unlängst Makler,<br />
kennt „Fantasiepreise mit irrwitziger Dynamik<br />
selbst in schlechter Lage“. So wird<br />
neben dem Haus selbst die Mietwohnung<br />
zum Statussymbol. „Wir haben historische<br />
Höchstpreise“, wird Stephan Kippes, der<br />
Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts,<br />
in der Süddeutschen Zeitung zitiert. <strong>Die</strong><br />
Preise für neu gebaute Eigentumswohnungen<br />
haben erstmals die 5000-Euro-Grenze<br />
erreicht – pro Quadratmeter. Wer sich in<br />
München oder Hamburg etwas leisten<br />
kann, hat es im Grunde geschafft. Dort<br />
trennt sich die Spreu <strong>vom</strong> Weizen – und<br />
wer herausgehoben wohnt, will herausgehoben<br />
einkaufen.<br />
In München eröffnete deshalb im<br />
April 2013 die „Maison Louis Vuitton“.<br />
Eine Kultmarke der achtziger Jahre des<br />
vergangenen Jahrhunderts kehrt zurück<br />
und lädt im Herzen des Reichtums in ihren<br />
Tempel. Anonyme und gesichtslose Warenhäuser<br />
waren gestern, heute erlebt jene Einkaufskultur<br />
eine Renaissance, die Walter<br />
Benjamin in seinen „Pariser Passagen“ beschrieb:<br />
„Zu beiden Seiten dieser Gänge,<br />
die ihr Licht von oben erhalten, laufen die<br />
elegantesten Warenläden hin, sodass eine<br />
solche Passage eine Stadt, ja eine Welt im<br />
Kleinen ist.“<br />
Beate Klingenberg, Geschäftsführerin<br />
von Louis Vuitton Deutschland, ist die<br />
Herrin eines solchen Paralleluniversums. Sie<br />
sagt: „Der Luxusbereich hat sich schon immer<br />
durch ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis<br />
in entsprechender Umgebung ausgezeichnet<br />
und dies verbunden mit einem<br />
außergewöhnlichen Service – denken Sie<br />
nur an die Ateliers der großen Couturiers<br />
des 19. oder 20. Jahrhunderts.“ In diesem<br />
Luxus überschreitet die Grenzen des<br />
Gewöhnlichen und des Notwendigen<br />
gleichermaßen. Außerdem, weiß Bourdieu,<br />
ist da „kein materielles Erbe, das<br />
nicht zugleich auch kulturelles Erbe ist“.<br />
<strong>Die</strong> Funktion des Familienbesitzes beschränke<br />
sich keineswegs auf die „bloße<br />
sachliche Bestätigung der Anciennität<br />
und Kontinuität des Familiengeschlechts<br />
und … auf die … Anerkennung ihrer gesellschaftlichen<br />
Identität“. Jedes private<br />
Gut, heißt das, ist immer auch Produkt<br />
der Kultur, in der es entstand.<br />
In München, wohl der deutschen<br />
Hauptstadt des Luxus schlechthin, erscheint<br />
auch ein Magazin für die stillen<br />
Genießer. Man ist auf Diskretion bedacht<br />
und verzichtet auf Außendarstellung. Hier<br />
wird zum Beispiel über soziales Engagement<br />
berichtet, das es nicht nötig hat, an<br />
die große Glocke gehängt zu werden. Diskretion<br />
als Statussymbol scheint paradox,<br />
aber dennoch drückt es einen Stand aus,<br />
der sich jenseits der Bestandssicherung<br />
bewegt. Unauffällig wie eine Eule im alten<br />
Baumbestand des Nymphenburger<br />
Parks. Es geht dabei nicht nur um Genuss,<br />
sondern auch um sichere Reproduktion<br />
des eigenen Wohlstands. Und so können<br />
sich zum Beispiel auf den ersten Blick<br />
Illustration: Miriam Migliazzi & Mart Klein<br />
22 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Illustration: Miriam Migliazzi & Mart Klein<br />
waghalsige Anlagen in Afrika durchaus als<br />
sichere Zukunftsinvestitionen erweisen.<br />
Luxus wird in der Regel erst dann zum<br />
Statussymbol, wenn er ausgestellt wird. Im<br />
Gegensatz zum Luxus ist das Statussymbol<br />
ein Signal, das sich nach außen richtet. Vergleichbar<br />
einem Label, zeigt es die Zugehörigkeit<br />
zu einer Gruppe an, verkündet den<br />
Status des Trägers in der Gesellschaft, jenen,<br />
den er tatsächlich innehat, oder jenen,<br />
den er meint innezuhaben, oder jenen, den<br />
er anstrebt. Man muss nicht im Einzelnen<br />
mit der Gruppe identisch sein, man muss<br />
aber nach außen die Zugehörigkeit anzeigen,<br />
um zugerechnet zu werden.<br />
Wenn man als Bahnangehöriger verkleidet<br />
über einen Bahnhof ginge, würde<br />
man nach Rat gefragt, um Auskunft gebeten<br />
hinsichtlich Abfahrtszeiten, Wagenreihung,<br />
Gepäckmitnahme. So funktionieren<br />
<strong>Statussymbole</strong>: Sie bilden die Struktur<br />
einer Gesellschaft ab, zeigen Zugehörigkeiten<br />
an, schaffen aber nur bedingt Identitäten.<br />
Darüber hinaus unterliegen die<br />
<strong>Statussymbole</strong> wie die Gesellschaft selbst<br />
einem Wandel, sie sind dynamischer als<br />
bloße Luxusobjekte.<br />
Wenn es vor 20 Jahren noch außergewöhnlich<br />
war, einen Geschäftspartner beim<br />
Sushi zu treffen, so würde dieses Ansinnen<br />
heute ein müdes Lächeln entlocken, sind<br />
doch Sushilokale inzwischen so außergewöhnlich<br />
wie Bockwurststände. Deutsche<br />
Küche taugt hingegen wieder als verbindendes<br />
Statussymbol, wenn sie nur angemessen<br />
modern ist, das heißt entzuckert<br />
und entfettet und mit Produkten aus biologischem<br />
Anbau.<br />
<strong>Statussymbole</strong> sind geschmeidig. Sie<br />
passen sich den gesellschaftlichen Gegebenheiten<br />
an. Zielwerte werden rasch<br />
durch neue ersetzt. Das <strong>Auto</strong> kann nur<br />
dann Statussymbol sein, wenn Schnelligkeit,<br />
gepaart mit Individualität, das erstrebenswerte<br />
Ziel ausmacht. Individualität<br />
blieb attraktiv bis heute, aber Schnelligkeit<br />
wurde im 21. Jahrhundert durch Entschleunigung<br />
ersetzt und Individualität an<br />
Gesundheit gekoppelt, an einen enormen<br />
ökologischen Anspruch.<br />
Ein Informatikingenieur, den ich kenne,<br />
arbeitet für eine Softwarefirma und muss<br />
Deutschland, Europa, zuweilen auch Amerika<br />
durchqueren, um Computersysteme zu<br />
betreuen. Privat fährt er einen Kombi aus<br />
dem einzigen Grund, weil sein Rennrad<br />
in den Fond passt. Sonst wäre er, obwohl<br />
Das Fahrrad<br />
gewährleistet<br />
die Sichtbarkeit<br />
seines<br />
Besitzers; er<br />
verschwindet<br />
nicht im<br />
Bauch eines<br />
<strong>Auto</strong>s, sondern<br />
schwingt sich<br />
beherzt als<br />
Herrscher auf<br />
den Sattel<br />
Top-Verdiener, mit einem Kleinwagen unterwegs.<br />
Allerdings muss es ein veritables<br />
Rennrad sein, sonst könnte er auf eines der<br />
gemächlichen <strong>neuen</strong> Falträder zurückgreifen<br />
oder auf das M1 Secede, das E-Bike mit<br />
teilbarem Rahmen, das in den Kofferraum<br />
eines Kleinwagens passt. Das <strong>Auto</strong> ist lediglich<br />
das Gehäuse für das eigentliche Statussymbol,<br />
das teure Rennrad.<br />
Mein Freund, der Informatikingenieur,<br />
und ich sind heute fast 50 Jahre alt, fühlen<br />
uns fit wie 20, ernähren uns ökologisch mit<br />
Tendenz zum Veganismus und sind bekennende<br />
Europäer. Unsere Kinder besuchen<br />
nicht notwendig das Gymnasium, obwohl<br />
wir es uns wünschen, und unter unserem<br />
Kopfkissen liegt der Bestseller des Fernsehphilosophen<br />
Richard David Precht, in dem<br />
er uns die Misere des deutschen Bildungssystems<br />
erklärt. Der mündige Bürger liebt<br />
nichts so sehr, als über sich, seine Zukunft<br />
und die Zukunft seiner Kinder nachzudenken.<br />
Bildung wird immer ein Statussymbol<br />
bleiben. Das dreigliedrige Schulsystem hat<br />
die Tendenz, soziale Unterschiede zu manifestieren.<br />
<strong>Die</strong> Vorstellung Prechts, man<br />
könnte eine Einheitsschule zur bindenden<br />
Form machen, führt in die Irre.<br />
Prechts Modell, das er wie jeder Bildungsbürger<br />
mit Humboldt begründet,<br />
verfestigt letztlich die Verhältnisse. Klassische<br />
Bildung, wie er sie verlangt, führt<br />
geradewegs zu einer elitären Persönlichkeit,<br />
wie Precht selbst sie darstellt. <strong>Die</strong>se<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 23
T i t e l<br />
Bildung wird<br />
immer ein<br />
Statussymbol<br />
bleiben. <strong>Die</strong><br />
Vorstellung,<br />
man könnte<br />
eine Einheitsschule<br />
zur<br />
bindenden<br />
Form machen,<br />
führt in die Irre<br />
Form der Bildung ist autoreferenziell und<br />
somit Statussymbol, weil sie nur in jenen<br />
Schichten funktioniert, die ihr Wissen in<br />
Bücherwänden aufbewahrt, im Arbeitszimmer<br />
des Vaters. Precht tappt in die<br />
Statusfalle. Indem er sich selbst verabsolutiert,<br />
verabsolutiert er die Struktur, die<br />
ihn hervorgebracht hat.<br />
Zunächst scheint es merkwürdig, Kinder<br />
als Statussymbol zu betrachten, aber<br />
noch merkwürdiger ist, dass bei allgemein<br />
zurückgehender Geburtenrate sich<br />
bestimmte Stadtviertel durch ihren Kinderreichtum<br />
auszeichnen. Was in Berlin<br />
der hierfür berühmte Stadtteil Mitte, ist<br />
in Leipzig das Viertel Schleußig. Auf engem<br />
Raum gibt es Spezialgeschäfte für Umstandsmode,<br />
Kindermode und Spielwaren,<br />
eine Krimibuchhandlung, ein Geschäft für<br />
Naturseife, die International School und einen<br />
florierenden Bioladen. Selbst der Spätverkauf<br />
bietet Windeln und eine große<br />
Auswahl biologischer Lebensmittel an.<br />
Bezeichnend für die hiesige Population<br />
ist das Fachgeschäft für Kinderbekleidung<br />
„Grünschnabel“, ausdrücklich „für kleine<br />
und große Weltverbesserer“. Es wirbt mit<br />
„fair“ produzierten Kinderklamotten. Was<br />
bezweckt die Kundschaft mit dem Einkauf<br />
gerade in diesem Geschäft? „Ja, natürlich“,<br />
antwortet mir eine Frau, die ohne<br />
Kind, aber mit zwei Kindersitzen am Fahrrad<br />
zum Laden kommt, als ich sie frage,<br />
ob sie mit dem Einkauf hier wirklich die<br />
Welt verbessern könne. So etwas hat natürlich<br />
seinen Preis. Ein Geschäft, das<br />
T-Shirts in der Kindergröße 104 für mindestens<br />
30 Euro anbietet, wäre im sozial<br />
schwachen Leipziger Osten längst pleite.<br />
<strong>Die</strong>se regionale Aufteilung sorgt dafür, dass<br />
sich die Bewohner entsprechender Stadtteile<br />
auch im Urlaub an den Kleideretiketten<br />
erkennen können. So wird Durchmischung<br />
verhindert.<br />
Wer hier wohnt, muss lärmresistent<br />
sein, nicht nur wegen des Kinderlärms.<br />
Mütter und Väter, die ihre Kinder bei der<br />
Tagesmutter abgegeben haben, führen vor<br />
meinem Fenster gerne Gespräche von einer<br />
Länge, dass ich mich manchmal in ein<br />
proletarisches Viertel sehne, in dem am<br />
Tage Ruhe herrscht und in der Nacht natürlich<br />
auch. In einer Fußnote in seinem<br />
Hauptwerk „Das Kapital“ schreibt Marx,<br />
dass der gesellschaftliche Reichtum sich im<br />
Reichtum an Freizeit ausdrücke. Schon im<br />
19. Jahrhundert führte der wohlbestallte<br />
Pariser Flaneur seine Schildkröte spazieren,<br />
und auch heute wird öffentliche Freizeit<br />
mehr und mehr zum Statussymbol. <strong>Die</strong><br />
städtischen Parks sind wochentags gefüllt<br />
mit wohlangezogenen Bürgersleuten, Eltern<br />
stehen stundenlang vor meinem Fenster<br />
und reden.<br />
<strong>Die</strong>selben mitteilungsbedürftigen Eltern<br />
übrigens treffen sich am Sonntag vor<br />
der evangelischen Kirche. Ein Bau, der in<br />
den Dreißigern vielleicht Avantgarde war,<br />
heute eher an eine Festung gemahnt, platzt<br />
am Sonntag aus allen Nähten. Ein junger<br />
Pastor verabschiedet nach dem Gottesdienst<br />
die Gemeinde, die Mütter und Väter<br />
holen noch schnell den Nachwuchs aus<br />
dem Kindergottesdienst. Der Mittelstand<br />
orientiert sich an einer gewissen Biedermeierlichkeit,<br />
Kinder, Küche, Kirche erhalten<br />
eine ganz neue Bedeutung, taugen<br />
zum frei gewählten Statussymbol einer urbanen<br />
Elite. Man liest wieder Eichendorff,<br />
der schon der Eisenbahn misstraute, weil<br />
sie ihm zu laut und zu schnell war. Wer es<br />
sich leisten kann, flieht aus der Zeit. Solche<br />
kleinen Fluchten sind das begehrteste<br />
Statussymbol überhaupt.<br />
jan Kuhlbrodt<br />
schrieb das „Lexikon der <strong>Statussymbole</strong>“,<br />
aber auch „Stötzers<br />
Lied“ und jüngst den Essay „Das<br />
Elster-Experiment“<br />
Illustration: Miriam Migliazzi & Mart Klein; Foto: Marie-Luise Marchand<br />
24 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Mit <strong>Cicero</strong> durch das<br />
Wahljahr 2013<br />
Ihre Abovorteile:<br />
Vorzugspreis<br />
Mit einem Abo sparen<br />
Sie über 10 % gegenüber<br />
dem Einzelkauf.<br />
Mehr Inhalt<br />
Sie erhalten zusätzlich<br />
4 x im Jahr das Magazin<br />
Literaturen.<br />
Fit für die Wahl<br />
<strong>Cicero</strong> begleitet in einer<br />
Serie die Protagonisten des<br />
Wahlkampfs.<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
Unser Geschenk für Sie: <strong>Cicero</strong>-Spezial Wahl<br />
Wie führen Merkel und Steinbrück ihre<br />
Kampagnen? Welche Strategien, welche<br />
Kniffe wirken? <strong>Cicero</strong> präsentiert in einer<br />
Spezialausgabe zur Bundestagswahl 2013 die<br />
Akteure vor und hinter der Bühne, analysiert<br />
erstmals die Duelle in allen 299 Wahlkreisen<br />
und erklärt, vor welchen Maßnahmen sich<br />
keine Regierung in Zukunft drücken kann.<br />
Damit Sie im Wahlkampfsommer mitreden<br />
können und am 22. September die richtige<br />
Entscheidung treffen.<br />
Ich abonniere <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis.<br />
Bitte senden Sie mir <strong>Cicero</strong> monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit nur 7,– EUR / 5,– EUR<br />
(Studenten) pro Ausgabe inkl. MwSt. (statt 8,– EUR im Einzelkauf).* Mein Geschenk erhalte<br />
ich nach Zahlungseingang. Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein und<br />
können das Abonnement jederzeit kündigen.<br />
Meine Adresse<br />
*Preis im Inland inkl. MwSt. und Versand, Abrechnung als Jahresrechnung über zwölf Ausgaben,<br />
Auslandspreise auf Anfrage. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH,<br />
Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Geschäftsführer Rudolf Spindler.<br />
Bei Bezahlung per Bankeinzug erhalten Sie eine weitere Ausgabe gratis.<br />
Vorname<br />
Geburtstag<br />
Kontonummer<br />
Name<br />
BLZ<br />
Ich bezahle per Rechnung.<br />
Geldinstitut<br />
Ich bin Student.<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Ort<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail<br />
über interessante Angebote des Verlags informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch Senden<br />
einer E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg, jederzeit<br />
widerrufen werden.<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Jetzt <strong>Cicero</strong> abonnieren! Bestellnr.: 946129<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Shop: www.cicero.de/lesen
T i t e l<br />
UNSERE <strong>Statussymbole</strong><br />
Christoph Schwennicke, Chefredakteur<br />
„Meine (immer noch harmlose) High-End-Anlage habe ich über<br />
Jahrzehnte zusammengetragen. Das Umschleichen der einzelnen<br />
Komponenten bis hin zu den Kabeln war jedes Mal noch schöner<br />
als das Kaufen. Ich freue mich, wenn die Blicke von Gästen<br />
an der Anlage haften bleiben. Und noch mehr erfreue ich mich<br />
an den fassungslosen Gesichtern – wenn sich jemand die Zeit<br />
nimmt und der Fülle des Wohllauts zum ersten Mal hingibt.<br />
Bei sinnlichen Menschen ist es jedes Mal ein akustisches Erweckungserlebnis,<br />
ein Eintritt in eine neue Welt des Klanges. Das<br />
mitzuerleben macht mich froh – und stolz.“<br />
Lena Bergmann, Ressortleiterin Stil<br />
„Regelmäßig ertappe ich mich dabei, wie ich mit meinen Freundinnen<br />
angebe. Tatkräftige, talentierte und dabei noch trinkfeste<br />
Frauen, die es in der Hauptstadt zu etwas gebracht haben.<br />
Wir bestärken einander und empfehlen uns gegenseitig weiter.<br />
Und später besorgen wir unseren Kindern dann die Praktikumsplätze.<br />
Jede macht etwas völlig anderes, und wenn ich tatsächlich<br />
all die Frauen, auf die ich stolz bin, gemeinsam auf ein Bild<br />
zwängen würde, sähe das aus wie ein Klassenfoto. Zu Klassentreffen<br />
gehe ich allerdings nie. Obwohl ich gerne in meiner Heimat,<br />
dem Taunus, bin. Am Wochenende werden dort die <strong>Auto</strong>s<br />
geputzt und die Küchenausstattung diskutiert. Da halte ich<br />
mich raus.“<br />
Fotos: Peter Rigaud für <strong>Cicero</strong><br />
26 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Sind <strong>Statussymbole</strong> nicht kleinbürgerlich? Und ist es nicht unangenehm,<br />
darüber zu reden? Viel zu privat? Im Vorfeld zu dieser Ausgabe wurde in<br />
der Redaktion viel diskutiert. Das Ergebnis sind diese Statements<br />
Til Knipper, Ressortleiter Kapital<br />
„Als mein Vater so alt war wie ich heute, sprich: 36, schrieben<br />
wir das Jahr 1981. Seine <strong>Statussymbole</strong> damals: ein blauer Alfa<br />
Romeo Giulietta und eine Rolex. Meine <strong>Statussymbole</strong> damals:<br />
Oshkosh-Latzhose und mehr Haare als mein Vater. 32 Jahre<br />
später, seine <strong>Statussymbole</strong>: Mini Roadster und immer noch die<br />
Rolex. Meine <strong>Statussymbole</strong>: ein knallrotes Fausto-Coppi-Stahlrahmen-Rennrad<br />
und keine Uhr tragen. Zustand der Haarpracht<br />
2013: beide Glatze.“<br />
Alexander Marguier, Stellvertretender Chefredakteur<br />
„Ja, tatsächlich: <strong>Die</strong>se Armbanduhr habe ich mir Anfang der<br />
neunziger Jahre als Statussymbol zugelegt. Mein Distinktionsbewusstsein<br />
als junger Student war damals groß genug, um ungefähr<br />
1000 Mark für eine – wie ich finde – immer noch sehr<br />
elegante ‚Chronoswiss‘ mit <strong>Auto</strong>matikwerk auszugeben. Ein gut<br />
bezahlter Ferienjob hatte es möglich gemacht. Und es hat funktioniert,<br />
mein Selbstbewusstsein trug ich fortan auch am Handgelenk.<br />
Nach Jahren ließ die Zauberkraft allerdings nach, und<br />
die Uhr verschwand in irgendwelchen Schubladen. Bis ich sie<br />
dort unlängst wiederentdeckte, zur Reparatur brachte und jetzt<br />
wieder trage. Nicht mehr als Statussymbol, sondern nur noch<br />
aus Nostalgie.“<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 27
T i t e l<br />
Alexander Kissler, Ressortleiter Salon<br />
„Das Haus der Eltern und der Wagen des Vaters zeigten in meiner<br />
Kindheit, wer es zu etwas gebracht hatte. In meiner Familie<br />
war ich der Erste mit Abitur, mit Studium, mit Promotion<br />
und bin der Erste ohne Eigenheim, ohne repräsentativen Wagen;<br />
der meinige ist Baujahr 1994 und steht in der Garage. Regelmäßig<br />
aber werde ich mit meinem Konzertabonnement Teil<br />
der Statusgemeinde Opernhaus, besuche die Akademiekonzerte.<br />
Bruckner, Mahler, Strauß lösten am Statushimmel die Herren<br />
Benz, Daimler und Horch ab. Es ist ein Himmel, der jene schirmen<br />
soll, die zu ihm sich flüchten – und der sie nie ganz ungetröstet<br />
entlässt. Klänge können das besser als Dinge.“<br />
Constantin Magnis, Ressortleiter Reportagen<br />
„Ich fände es angemessen, wenn Leute meinem eklektischen<br />
Filmgeschmack mehr Bewunderung entgegenbrächten. Immer<br />
wenn wir Gäste in der Wohnung haben, wünschte ich, ihr wandernder<br />
Blick bliebe am DVD-Regal hängen. An den brillanten<br />
Gruselfilmen von Robert Wise zum Beispiel oder der wahnsinnig<br />
coolen Spike-Lee-Sammlung. Ich hoffe auf die anerkennend<br />
gehobene Augenbraue, die mich als respektablen Cineasten<br />
würdigt, als Person mit kulturellem Vorsprung. Stattdessen stehen<br />
die meisten enttäuscht davor und sagen: <strong>Die</strong> kenne ich alle<br />
nicht. Dann erkennen sie ‚Pulp Fiction‘ oder irgendeinen Scorsese-Film<br />
wieder, sagen: Der ist voll gut, und gucken dann woanders<br />
hin.“<br />
Fotos: Peter Rigaud für <strong>Cicero</strong><br />
28 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Christoph Seils, Ressortleiter <strong>Cicero</strong> Online<br />
„Früher ging die ganze Familie sonntags in die Kirche. Ich geh<br />
sonntags laufen. Der höchste Feiertag der Läufer fällt in Berlin<br />
auf den letzten Sonntag im September. Bei Kilometer 38 jedoch<br />
schuf der Marathon-Gott den Zweifel. Kurz vor dem Potsdamer<br />
Platz also kommt mir jedes Jahr der Gedanke: ‚Warum<br />
mache ich eigentlich diesen Scheiß?‘ <strong>Die</strong> Füße tun weh, die Akkus<br />
sind leer und wieder keine Glückshormone. Aber nur durch<br />
den Zweifel findet der Mensch zu seinem Ziel. Spätestens, wenn<br />
ich nach 42,195 Kilometern die Medaille in der Hand halte,<br />
schmiede ich schon Pläne für die nächste Laufsaison.“<br />
Petra Sorge, Online-Redakteurin<br />
„Wer in Berlin einen <strong>neuen</strong> Menschen kennenlernt, wird schnell<br />
gefragt: Wo kommst du her? In der Hauptstadt, die zu drei<br />
Vierteln aus Zugezogenen besteht, definiert Herkunft den Status.<br />
Der Stuttgarter gilt als knauserig, der Münchner als Snob.<br />
Ich komme aus Thüringen – aus Berliner Sicht ist das dermaßen<br />
hinterm Mond. Stört mich nicht. Meine Heimat gehört zu mir.<br />
Deshalb zeige ich die Provinz sogar mal vor wie ein Statussymbol.<br />
Sie hängt sozusagen in der Küche: Zwiebelzopf und Chilikranz<br />
stammen <strong>vom</strong> ‚Weimarer Zwiebelmarkt‘, dem größten<br />
Volksfest in Thüringen. Im Oktober war ich natürlich wieder<br />
dabei. Der Zopf ist allerdings schon etwas abgeknabbert, weil<br />
ich die Zwiebeln erst nach und nach verbrauche.“<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 29
T i t e l<br />
Wir teilen<br />
uns Tinka<br />
Das <strong>Auto</strong> verliert als Statussymbol an Bedeutung.<br />
Junge Stadtmenschen bevorzugen Carsharing.<br />
Eine Herausforderung für die ganze Branche<br />
von Til Knipper<br />
S<br />
ind <strong>Die</strong>ter Zetsche und Homer<br />
Simpson Brüder – zumindest<br />
im Geiste? Den Daimler-Vorstandsvorsitzenden<br />
gab es immerhin<br />
mal als Werbe-Trickfilmfigur<br />
Dr. Z, als er auf dem Chefsessel<br />
von Chrysler in Detroit saß. Das Familienoberhaupt<br />
aus der Zeichentrickserie wiederum<br />
verfügt über Führungserfahrung in<br />
der US-<strong>Auto</strong>industrie. In der zweiten Staffel<br />
muss Homer für seinen überraschend<br />
aufgetauchten Halbbruder Herb Powell ein<br />
<strong>Auto</strong> entwickeln, das dessen Unternehmen<br />
Powell Motors aus der Krise führen soll.<br />
<strong>Die</strong>ter Zetsche steht in Stuttgart ebenfalls<br />
unter Druck. Mit der <strong>neuen</strong> S-Klasse<br />
will Daimler zurück an die Spitze des Premiumsegments,<br />
von der BMW und Audi<br />
die Stuttgarter inzwischen verdrängt haben.<br />
Doch Zetsche läuft Gefahr, eine viel wichtigere<br />
Frage zu übersehen: Taugt ein <strong>Auto</strong><br />
heute überhaupt noch als Statussymbol?<br />
Besonders drängt sich die Frage bei<br />
BMW, Audi und Daimler auf, die sich<br />
mit 7er, A8 und der S-Klasse im teuren<br />
Premiumsegment bewegen. Im <strong>Auto</strong>land<br />
Deutschland verliert das <strong>Auto</strong> seinen Status<br />
als Liebhaberobjekt, für einen wachsenden<br />
Teil der Bevölkerung ist es inzwischen<br />
reines Transportmittel. <strong>Die</strong> Generation der<br />
unter 30-Jährigen will <strong>Auto</strong>s zwar noch benutzen,<br />
aber nicht besitzen und bevorzugt<br />
daher Carsharing-Angebote, geht aus einer<br />
Fraunhofer-Studie hervor.<br />
In den großen deutschen Städten zeichnet<br />
sich der Trend schon ab. <strong>Die</strong> Anzahl<br />
der PKW ist in Berlin zwischen 1995 und<br />
2012 um 6,8 Prozent gesunken, in Hamburg<br />
gab es ein Minus von 2,4 Prozent.<br />
<strong>Die</strong> Hauptstädter besitzen gleichzeitig mit<br />
328 PKW je 1000 Einwohner die wenigsten<br />
<strong>Auto</strong>s. 41 Prozent der Berliner Haushalte<br />
haben gar kein <strong>Auto</strong>, in Hamburg ist<br />
es gut ein Drittel.<br />
Gleichzeitig erleben Carsharing-Angebote<br />
einen bisher nie da gewesenen Boom.<br />
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich dabei<br />
die Angebote ohne feste Rückgabe-Station,<br />
wie Car2go, das Daimler zusammen mit<br />
dem <strong>Auto</strong>vermieter Europcar betreibt, und<br />
DriveNow, eine Kooperation von BMW<br />
und Sixt. <strong>Die</strong> Nutzer müssen sich nur einmal<br />
online registrieren. Mit einem Chip,<br />
der auf den Führerschein geklebt wird, und<br />
einer Pin-Nummer lassen sich die <strong>Auto</strong>s<br />
öffnen und starten. Freie Wagen werden<br />
per App auf dem Smartphone gefunden.<br />
Abgerechnet wird pro Minute, innerhalb<br />
des Einsatzgebiets kann der Wagen überall<br />
wieder abgestellt werden.<br />
Gab es in Deutschland 2012 noch<br />
42 000 registrierte Nutzer für diese sogenannten<br />
Freefloat-Angebote, sind es mittlerweile<br />
mehr als 260 000, die sich in<br />
Städten wie Berlin, Hamburg, München,<br />
Düsseldorf oder Köln die <strong>Auto</strong>s teilen.<br />
Nach einer aktuellen Umfrage des Bundesverbands<br />
Carsharing schafft mehr als die<br />
Hälfte der autobesitzenden Neukunden ihren<br />
Wagen nach einigen Monaten Carsharing-Mitgliedschaft<br />
ab. Der <strong>Auto</strong>besitz von<br />
Carsharing-Neukunden ist von 43,4 Prozent<br />
auf nur noch 19 Prozent gesunken.<br />
Kritiker bemängeln, dass die Ökonomie<br />
des <strong>Auto</strong>teilens nur in größeren Städten<br />
funktioniert. Mittelfristig ist das aber<br />
eher ein Argument für das Wachstumspotenzial<br />
des Carsharing. Schon heute wohnt<br />
mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in<br />
Städten. Nach Berechnungen der Vereinten<br />
Nationen werden es bis 2050 mehr als<br />
zwei Drittel sein.<br />
Das weiß Frank Ruff schon lange. Der<br />
Soziologe arbeitet in einem Großraumbüro<br />
am Potsdamer Platz in Berlin und untersucht<br />
mit einem interdisziplinären Team<br />
von 40 Forschern die Zukunft der Mobilität.<br />
Ruffs Arbeitgeber heißt Daimler, sein<br />
Titel lautet: Leiter der Forschungsgruppe<br />
für Gesellschaft und Technik. Ruff ist einer<br />
der Väter des Car2go, das als Pilotprojekt<br />
bereits 2008 in Ulm startete.<br />
War es schwer, dem Vorstand beizubringen,<br />
dass Daimler eine neue Form der<br />
<strong>Auto</strong>vermietung testen soll? „Veränderungen<br />
brauchen in unserer Gesellschaft generell<br />
sehr lange“, sagt Ruff diplomatisch.<br />
Inzwischen sind die Manager in Stuttgart<br />
stolz auf den Geschäftszweig. Der Mobilität<br />
der Zukunft räumen sie im Nachhaltigkeitsbericht<br />
des Konzerns viel Platz ein.<br />
Weniger auskunftsfreudig sind BMW<br />
und Daimler bei der Frage, ob ihre Carsharing-Programme<br />
schon Gewinne<br />
<strong>Auto</strong>s sind<br />
zu teuer,<br />
verstopfte<br />
Straßen und<br />
fehlende<br />
Parkplätze<br />
verleiden die<br />
Freude am<br />
Fahren<br />
30 <strong>Cicero</strong> 7.2013
www.rowohlt.de<br />
Anzeige<br />
Foto: rpivat<br />
erwirtschaften. Offizielle Zahlen gibt es<br />
nicht. „Es heißt immer, sie verdienten damit<br />
Geld, aber ich weiß nicht, wie da gerechnet<br />
wird“, sagt Ferdinand Dudenhöffer.<br />
Strategisch hält der <strong>Auto</strong>experte von der<br />
Universität Essen-Duisburg das Engagement<br />
der Premiumhersteller in diesem Bereich<br />
für richtig. „Ein Klasseprodukt, das<br />
die Kunden emotionalisiert“, lobt er. Das<br />
gilt vor allem für DriveNow, wo BMW den<br />
Carsharern mit Mini, Mini-Cabrio und<br />
BMW 1ern eben nicht nur ein Transportmittel<br />
zur Verfügung stellt, sondern auch<br />
Lebensgefühl verkauft. <strong>Die</strong> <strong>Auto</strong>s tragen sogar<br />
Namen. <strong>Die</strong> Nutzer sollen sich freuen,<br />
wenn sie mal wieder den 1er BMW Sandro<br />
buchen können oder Tinka, den Mini.<br />
„Das sind eigentlich bezahlte Probefahrten,<br />
bei denen eine Bindung zur<br />
Marke entsteht“, sagt Dudenhöffer. Davon<br />
könnte BMW profitieren, wenn sich<br />
der Nutzer doch für den Kauf eines eigenen<br />
<strong>Auto</strong>s entscheidet.<br />
Beim Fraunhofer-Institut denken die<br />
Forscher weiter. Nach der Studie „Visionen<br />
für nachhaltigen Verkehr in Deutschland“<br />
wird sich die Zahl der <strong>Auto</strong>s bis 2050<br />
deutschlandweit halbieren. „<strong>Die</strong> Städte sind<br />
grün, lebenswert, fußgänger- und radfahrerfreundlich,<br />
Carsharing-Parkplätze und Radstationen<br />
gibt es an allen größeren Haltepunkten“,<br />
schreiben die Verfasser.<br />
Schweizer Verkehrswissenschaftler haben<br />
kürzlich untersucht, warum sich Menschen<br />
heute <strong>vom</strong> eigenen <strong>Auto</strong> trennen. <strong>Die</strong><br />
häufigsten Gründe: Erstens können sie es<br />
sich nicht mehr leisten, und zweitens verleiden<br />
ihnen verstopfte Straßen und fehlende<br />
Parkplätze die Lust am Fahren. <strong>Auto</strong>hersteller,<br />
die sich <strong>neuen</strong> Geschäftsfeldern verschließen,<br />
werden den Anschluss verlieren.<br />
2013 wird ein schwieriges Jahr für die<br />
<strong>Auto</strong>industrie werden. Im ersten Quartal<br />
sind die Neuzulassungen nach Angaben<br />
des Kraftfahrzeugbundesamts um 13 Prozent<br />
eingebrochen. Bei Volkswagen waren<br />
es sogar 17 Prozent. <strong>Die</strong> Wolfsburger, bei<br />
denen das Thema Carsharing bisher keine<br />
echte Rolle spielt, müssen sogar den <strong>neuen</strong><br />
Golf mit hohen Rabatten in den Markt<br />
drücken. „Das wäre vor einigen Jahren<br />
undenkbar gewesen“, sagt Ferdinand Dudenhöffer.<br />
<strong>Die</strong> aktuelle Absatzkrise ist seines<br />
Erachtens aber eine Konsequenz der<br />
Eurokrise. Europa ist der wichtigste Absatzmarkt<br />
für die deutschen Hersteller. „Allerdings<br />
mehren sich auch die Hinweise<br />
auf strukturelle Defizite“, sagt Dudenhöffer.<br />
So hat eine Untersuchung seines Instituts<br />
ergeben, dass die Neuwagenkäufer<br />
in Deutschland älter werden. Seit 1995 ist<br />
das Durchschnittsalter von 46 Jahren auf<br />
inzwischen 52 Jahre gestiegen.<br />
Das Geld, das sie zu Hause nicht mehr<br />
verdienen kann, muss die <strong>Auto</strong>industrie<br />
daher woanders erwirtschaften. Denn<br />
das Wachstum beim Carsharing wird den<br />
Einbruch auf keinen Fall ersetzen können.<br />
In der <strong>Auto</strong>branche gilt die Faustregel:<br />
Großes <strong>Auto</strong>, große Marge, kleines<br />
<strong>Auto</strong>, kleine Marge. <strong>Die</strong> Premiumhersteller<br />
setzen auf China, wo Audi vergangenes<br />
Jahr um 30 Prozent wuchs und BMW um<br />
40 Prozent. Hier funktionieren Luxusautos<br />
noch als Statussymbol, weil der neue<br />
Geldadel in Peking und Schanghai seinen<br />
Reichtum gerne zur Schau stellt.<br />
Das könnte für <strong>Die</strong>ter Zetsche zum<br />
Problem werden, weil er mit seiner <strong>neuen</strong><br />
S-Klasse zwei Jahre zu spät kommt und<br />
die Wettbewerber sich große Anteile des<br />
Kuchens gesichert haben. VIPs und Fachpresse<br />
haben die Präsentation der <strong>neuen</strong> S-<br />
Klasse im Mai in Hamburg wohlwollend<br />
begleitet und die Rücksitze mit Hot-Stone-<br />
Massagefunktion, die Parfumspender und<br />
die 20 Assistenzsysteme, die den Fahrer fast<br />
überflüssig machen, ausgiebig bestaunt.<br />
Verkauft sich die neue S-Klasse trotzdem<br />
nicht, sind Zetsches Tage bei Daimler<br />
gezählt. Schon an Homer Simpson kann<br />
man sehen, dass ein <strong>Auto</strong> mit vielen liebevollen<br />
Extras nicht zwingend zum Erfolg<br />
führen muss. Dessen Kreation „The Homer“<br />
fiel trotz separater Kapsel für quengelnde<br />
Kinder und drei Hupen, die „La<br />
Cucaracha“ spielen, bei der Präsentation<br />
durch. Bruder Herb ging pleite und wollte<br />
von Homer nichts mehr wissen.<br />
Eine Staffel später kam es aber zur großen<br />
Versöhnung. Mit dem von Homer geliehenen<br />
Startkapital setzte Herb eine neue<br />
Geschäftsidee um, die ihn direkt wieder<br />
zum Millionär machte. Aus Dankbarkeit<br />
schenkte er Homer den von ihm heiß ersehnten<br />
Massagesessel namens Wirbelsäulenschmelzer,<br />
sozusagen den Urahn von<br />
<strong>Die</strong>ter Zetsches Hot-Stone-Rücksitz.<br />
Til Knipper<br />
leitet das Ressort<br />
Kapital bei <strong>Cicero</strong><br />
«<strong>Die</strong>se Geschichte<br />
habe ich erfunden,<br />
um zu erzählen,<br />
wie es war.»<br />
Der neue Roman von<br />
Eugen Ruge, 2011 ausgezeichnet<br />
mit dem Deutschen Buchpreis<br />
Auch als<br />
E-Book<br />
erhältlich<br />
208 Seiten. Gebunden<br />
€ 19,95 (D) / € 20,60 (A) / sFr. 28,50 (UVP)<br />
© Tobias Bohm<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 31
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
<strong>Die</strong> Bankerin der SPD<br />
In Christiane Krajewski hat Steinbrück ausgerechnet eine Frau aus der Finanzwelt im Kompetenzteam<br />
von Andreas Theyssen<br />
E<br />
s ist gar nicht so einfach, ein<br />
Fahrrad anzuschließen. Das Baustellenschild?<br />
Zu wackelig. Der<br />
Laternenpfahl? Schon belegt mit anderen<br />
Rädern. Der Baum? Zu dick für die Kette.<br />
Irgendwie haben die Stadtmöblierer ein<br />
Detail vergessen, als sie die Berliner Vorzeigestraße<br />
Unter den Linden ausstaffierten:<br />
Fahrradständer. So wird Christiane Krajewski<br />
einiges zugemutet, als sie zum Gespräch<br />
in einem Touristencafé nahe des Brandenburger<br />
Tores mit dem Fahrrad vorfährt.<br />
Ein Fahrrad? Das ist in ihrem Berufsstand<br />
recht unüblich. Christiane Krajewski,<br />
64, arbeitet als Investmentbankerin, da<br />
würden viele mindestens eine dunkle Limousine<br />
erwarten. Seit kurzem ist sie im<br />
Kompetenzteam des SPD-Kanzlerkandidaten<br />
Peer Steinbrück für Wirtschaft zuständig.<br />
Sozialdemokratie – das ist schon<br />
wieder etwas, das nicht jeder einer Investmentbankerin<br />
zutrauen würde.<br />
Seit Franz Müntefering 2004 seine<br />
Heuschrecken-Kampagne inszenierte, als<br />
daraufhin nicht nur in der SPD Hedgefonds,<br />
Finanzinvestoren und Broker in einen<br />
Topf geworfen wurden, sind Investmentbanker<br />
für viele Sozialdemokraten die<br />
Inkarnation des Turbokapitalismus. <strong>Die</strong> Finanzkrise<br />
hat ihren Ruf nicht verbessert.<br />
Christiane Krajewski versuchte damals,<br />
im Managerkreis der SPD gegenzusteuern.<br />
„Sicherlich gibt es negative Einzelfälle“,<br />
sagt sie. „Aber es gibt auch Untersuchungen,<br />
die besagen, dass Unternehmen im<br />
Besitz von Private Equity sich im Schnitt<br />
besser entwickeln und neue Arbeitsplätze<br />
aufbauen.“<br />
Es kommt noch schlimmer für das Sozialdemokratenherz.<br />
Denn Christiane Krajewski<br />
ist Senior Advisor bei der Frankfurter<br />
Investmentbank Leonardo & Co. „In<br />
Deutschland machen Immobilientransaktionen<br />
70 Prozent des Geschäfts aus“, verriet<br />
deren Chef Claudio Mori dem Handelsblatt.<br />
So berät Leonardo die Landesbank<br />
Baden-Württemberg, wenn sie ihre Wohnsiedlungen<br />
losschlagen will, oder die<br />
Wohnungsgesellschaft Gagfah. <strong>Die</strong> wird<br />
<strong>vom</strong> US-Finanzinvestor Fortress kontrolliert,<br />
hat in Dresden Tausende Wohnungen<br />
aufgekauft und durch ihren Umgang mit<br />
den Mietern die halbe Stadt in Harnisch<br />
gebracht. So klagte SPD-Stadtrat Thomas<br />
Blümel: „<strong>Die</strong> Gagfah erhöht Mieten, entlässt<br />
Mitarbeiter und verkauft Mieter, nur<br />
um die Profite trotz Finanzkrise zu retten.“<br />
Wo bleibt der Aufschrei in der SPD,<br />
dass Steinbrück eine Frau in sein Team holt,<br />
deren Firma mit solchen Kunden dealt?<br />
Halten die Sozialdemokraten still, um das<br />
letzte bisschen Chance auf den Wahlsieg<br />
nicht zu verspielen?<br />
<strong>Die</strong> Ruhe hat andere Gründe. Zum einen:<br />
Als Steinbrück die Nominierung der Investmentbankerin<br />
bekannt gab, erzählte<br />
er gleichzeitig, dass er seinen Pressesprecher<br />
feuert. <strong>Die</strong>se Nachricht dominierte<br />
in den Medien, Krajewski kam kaum vor.<br />
Zum anderen war sie saarländische Sozial-<br />
und Finanzministerin unter Oskar<br />
Lafontaine. Da gerät man unter Sozialdemokraten<br />
nicht so leicht in Verdacht,<br />
ein Büttel des Kapitals zu sein. Schließlich:<br />
<strong>Die</strong> Person Krajewski taugt nicht zur<br />
Verteufelung.<br />
Sie selbst tut sich schwer mit der Berufsbezeichnung<br />
Investmentbankerin.<br />
„Der Begriff ist mir zu breit für das, was<br />
ich mache“, sagt sie. Leonardo, die Investmentbank,<br />
für die sie arbeitet, finanziert<br />
keine Unternehmenskäufe, sondern berät<br />
dabei, ebenso wie bei Börsengängen und<br />
Umschuldungen. Krajewski selber befasst<br />
sich nur mit Unternehmenstransaktionen.<br />
„Da liegt mein Schwerpunkt.“ Sie schätzt<br />
an ihrem Job den Prozess eines Unternehmenskaufs<br />
oder -verkaufs: Erst die analytische<br />
Phase, dann die Verhandlungsphase,<br />
„und dann ist das Projekt vorbei, und es<br />
kommt wieder etwas Neues“.<br />
Auch sonst entspricht die Frau mit dem<br />
Fahrrad wenig dem Klischee einer Investmentbankerin.<br />
Nicht nur, weil sie sich daheim<br />
im Saarland in einer Kirchenstiftung<br />
engagiert. Sie ist überzeugte Marktwirtschaftlerin,<br />
sicherlich. Aber „ich wehre<br />
mich dagegen, wenn Marktwirtschaft<br />
keine Leitplanken hat“, sagt sie.<br />
Sie plädiert für eine Finanztransaktionssteuer.<br />
Sie scheut sich nicht einmal,<br />
die Worte Markt und Moral zu verknüpfen.<br />
„Ich halte es für legitim, Unternehmer auch<br />
an ihre Verpflichtungen zu erinnern“, sagt<br />
sie. „Auch wenn es nur Ausnahmen sind:<br />
Intransparentes unternehmerisches Handeln,<br />
tricky eingeleitete Konkurse, Unternehmen<br />
auszuhöhlen – all das ist grob unanständig.<br />
Eigentum verpflichtet. Das weiß<br />
die große Mehrheit der Unternehmer.“<br />
Reicht das, um im Wahlkampf für<br />
Steinbrück und die SPD Punkte zu holen?<br />
Krajewski sieht etliche wirtschaftspolitische<br />
Gründe, weshalb Angela Merkel<br />
abgelöst werden sollte. <strong>Die</strong> Finanztransaktionssteuer<br />
– „da passiert nichts durch die<br />
Bundesregierung“. Verkehrswegeausbau –<br />
„die Bundesregierung misst Infrastrukturmaßnahmen<br />
keine Bedeutung bei“. <strong>Die</strong><br />
Energiewende – „das ist derzeit reine Finger-in-den-Wind-Politik,<br />
die Wende muss<br />
man aber inhaltlich gestalten“.<br />
Der Kanzlerkandidat würde kaum anders<br />
formulieren. Genau dies kann zum<br />
Problem werden für Krajewski. Steinbrücks<br />
Kompetenz in Wirtschafts- und Finanzfragen<br />
ist unbestritten, sein Sendungsbewusstsein<br />
groß, sein Alphatier-Gehabe ebenso.<br />
Wo bleibt Platz für sie? „Ich helfe ihm“,<br />
sagt sie lächelnd. „Außerdem kann der sich<br />
ja nicht selbst durch den Kopierer jagen,<br />
also werde ich ihn bei passenden Terminen<br />
entlasten.“<br />
Analytische Phase, Verhandlungsphase,<br />
und dann, Ende September, ist das Projekt<br />
vorbei, und es kommt wieder etwas<br />
Neues.<br />
Andreas Theyssen<br />
traf als Ressortleiter der G+J-<br />
Wirtschaftsmedien etliche<br />
Banker. <strong>Die</strong>smal stieß er auf ein<br />
ungewöhnliches Exemplar<br />
Fotos: Jens Gyarmaty für <strong>Cicero</strong>, privat (<strong>Auto</strong>r)<br />
32 <strong>Cicero</strong> 7.2013
„Steinbrück<br />
kann sich ja<br />
nicht durch den<br />
Kopierer jagen“<br />
SPD‐Schattenministerin<br />
Christiane Krajewski<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 33
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
Zäher Bursche<br />
Volker Bouffier bangt um sein Ministerpräsidentenamt. Aber was ist das schon nach dem, was er erlebt hat?<br />
von Hartmut Palmer<br />
S<br />
O VIEL HAT GEFEHLT. Volker Bouffier<br />
hält Daumen und Zeigefinger<br />
so nah aneinander, dass nur noch<br />
ein Haar dazwischenpasst. Der Ministerpräsident<br />
von Hessen sitzt in seiner Berliner<br />
Landesvertretung und lacht sein heiseres<br />
Raucher-Lachen. „So viel hat gefehlt,<br />
und es wäre aus gewesen.“<br />
Es geht nicht um die knappen Wahlergebnisse,<br />
die ihn und Roland Koch in Hessen<br />
an die Regierung gebracht haben, nicht<br />
um die Umfragen, die meistens schlecht<br />
waren und auch jetzt, vor der Landtagswahl<br />
im September, für seine CDU wieder<br />
schlecht sind. Das Gespräch dreht<br />
sich auch nicht um die Skandale, die ihm<br />
nachgesagt und zum Teil auch nachgewiesen<br />
wurden, nicht um die Untersuchungsausschüsse,<br />
die er überstand.<br />
Es geht um etwas, das nicht in den Archiven<br />
steht und worüber er auch überhaupt<br />
nicht gerne spricht: Um jenen Märztag<br />
des Jahres 1973, als er sich mit seinem<br />
<strong>Auto</strong> überschlug und sein Leben wirklich<br />
zwischen Daumen und Zeigefinger<br />
passte. Basketballer war er damals, 22 Jahre<br />
jung, er spielte beim deutschen Meister<br />
MTV Gießen, hatte sich sogar mit dem<br />
Gedanken getragen, Profispieler zu werden.<br />
Und dann das.<br />
Auf dem Heimweg aus dem Skiurlaub<br />
ist es passiert, in Österreich. Seine Frau, die<br />
Großmutter und zwei Tanten saßen mit<br />
im Wagen, als er in der Nähe von Spittal<br />
einem <strong>Auto</strong> ausweichen musste, das ihm<br />
auf seiner Fahrspur entgegenkam. Er geriet<br />
auf den holprigen Randstreifen, nahm zwei<br />
oder drei kleine Bäume mit. Dann war da<br />
plötzlich eine Mauer. Mehr weiß er nicht.<br />
Als er im Krankenhaus aufwacht, liegt<br />
er wie ein gepanzerter Riesenkäfer auf dem<br />
Rücken. Er kann sich weder zur Seite drehen<br />
noch Arme oder Beine bewegen, weil<br />
er von oben bis unten eingegipst ist. Es<br />
geht ihm wie dem Handlungsreisenden<br />
Gregor Samsa, der, wie Franz Kafka schrieb,<br />
aufwachte und sich „in seinem Bett zu einem<br />
ungeheueren Ungeziefer verwandelt“<br />
fand. Der Befund der Ärzte ist deprimierend:<br />
Das linke Bein ist zerschmettert und<br />
wäre beinahe abgenommen worden. Es<br />
Tag und Nacht Schmerzen. Sie<br />
haben ihm kleine Löcher in den<br />
Kopf gebohrt. Aber er lebte<br />
schmerzt noch immer. Der Rückspiegel<br />
des <strong>Auto</strong>s hätte ihm fast den Kopf gespalten.<br />
Zwei Halswirbel sind angeknackst, der<br />
lebenswichtige Liquorkanal ist eingedrückt.<br />
Selbst Freunde und politische Weggefährten<br />
wissen nur, dass es einmal „diesen<br />
Unfall“ gab. Aber kaum einer kennt die<br />
Details, die er nur zögernd preisgibt, weil<br />
die Erinnerung ihn belastet. Wie er später,<br />
als er endlich nach Deutschland gebracht<br />
worden war, in den Keller einer neurologischen<br />
Klinik geschoben wurde, wo mehrere<br />
Leute lagen, einige mit Gewichten am<br />
Kopf, andere mit dem Kopf nach unten<br />
aufgehängt. „Dich drehen sie gleich auch<br />
durch die Mangel“, sagte einer zu ihm.<br />
So kam es. Schiere Folter. Rechts und<br />
links haben sie ihm kleine Löcher in den<br />
Kopf gebohrt, um ein 14 Kilogramm<br />
schweres Gewicht daran zu hängen, und<br />
dann musste er tagelang in der Schräglage<br />
bleiben, mit dem Gewicht am Kopf.<br />
Denn dieses Gewicht sollte seine gestauchten<br />
Wirbel auseinanderziehen.<br />
Tag und Nacht Schmerzen und immer<br />
die Angst, nie mehr im Leben auf eigenen<br />
Füßen stehen zu können. Später haben die<br />
Ärzte den sechsten und den siebten Halswirbel<br />
miteinander verschweißt, um den<br />
Hals zu stabilisieren. Zwischendurch war<br />
er halbseitig gelähmt.<br />
Zwei Jahre hat es gedauert, bis Volker<br />
Bouffier überhaupt wieder stehen und gehen<br />
konnte. Erst nur mit Krücken. Dann,<br />
nach vielen Monaten mühsamen, eisernen<br />
Trainings, endlich wieder ohne.<br />
<strong>Die</strong>ser Mann, 61 Jahre alt, hat manche<br />
politische Schlacht geschlagen. Eine gefühlte<br />
Ewigkeit lang war er seit 1999 im<br />
Kabinett seines Freundes Roland Koch als<br />
Innenminister die Nummer zwei in Hessen,<br />
bis er 2010 selbst Ministerpräsident<br />
wurde. Gleich zu Beginn seiner Zeit als Innenminister<br />
musste er sich des Vorwurfs erwehren,<br />
als Rechtsanwalt in einem Scheidungsverfahren<br />
Parteienverrat begangen zu<br />
haben – er hatte zuerst den befreundeten<br />
Ehemann beraten und war danach Anwalt<br />
von dessen Frau. Und er machte keine gute<br />
Figur, faselte sogar etwas von einer toten<br />
Katze mit Schleife, die ihm nach Art der<br />
Mafia vor die Tür gelegt worden sei – alles<br />
erfunden, wie sich später herausstellte.<br />
Dann soll er einer Staatsanwältin, deren<br />
Behörde den Fall untersuchte, einen lukrativen<br />
Posten angeboten haben – auch das<br />
kam heraus. So ging es weiter: Schlag auf<br />
Schlag. Der Mann, der mit dem Slogan<br />
angetreten war, als Hüter von „Law and<br />
Order“ durchzugreifen, geriet selbst immer<br />
wieder in Grauzonen. Er hat das alles überstanden.<br />
Weil Freunde zu ihm hielten, sagt<br />
er. Und weil er sich immer im Recht fühlte.<br />
Aber dies war es nicht allein. Volker Bouffier<br />
hat politisch überlebt, weil die Skandale<br />
ein Klacks waren im Vergleich zu dem,<br />
was er nach seinem Unfall durchgemacht<br />
hatte. Wer durch diese Hölle gegangen ist,<br />
den wirft nichts mehr um.<br />
„Wieder auf die Füße zu kommen“,<br />
sagt er rückblickend, „das war eigentlich<br />
die schwerste und größte Herausforderung<br />
in meinem Leben.“<br />
Foto: Christoph Michaelis für <strong>Cicero</strong><br />
34 <strong>Cicero</strong> 7.2013
„Volker war ein Kämpfer,<br />
robust, nicht filigran“ – der<br />
frühere Basketball-Trainer über<br />
Ministerpräsident Bouffier<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 35
F r a u F r i e d f r a g t s i c h …<br />
… warum Schule Folter<br />
sein muss<br />
W<br />
ährend ich das schreibe, muss<br />
ich bangen, dass meine Tochter<br />
durchs Abi fällt. Nicht, weil sie<br />
eine schlechte Schülerin wäre, sie hat einen<br />
glatten Zweier-Schnitt. Nein, weil sie trotz<br />
ordentlicher Vornoten in Mathe die nötigen<br />
Prüfungspunkte nicht schaffen und deshalb<br />
durchfallen könnte. Klar, ergibt ja auch Sinn,<br />
dass eine einzige Prüfung höher bewertet<br />
wird als zwölf oder 13 Jahre Unterricht.<br />
Auch, dass wir Eltern den Gegenwert<br />
eines Mittelklassewagens in Mathe-<br />
Nachhilfe investiert haben, weil wir<br />
seit der 5. Klasse den Stoff selbst nicht<br />
mehr verstehen, ist sicher sinnvoll.<br />
Zurzeit treffe ich täglich Abiturienten-Eltern,<br />
die mit Ringen unter<br />
den Augen unterwegs sind und Panik<br />
schieben. Eine Mitschülerin unserer Tochter<br />
musste mehrfach notfallmäßig zum Arzt gebracht und mit Spritzen gegen ihre<br />
Kopf- und Rückenschmerzen behandelt werden, eine andere kotzt aus Angst vor<br />
jeder Prüfung.<br />
In den vergangenen zwei Jahren hat unsere Tochter sich Unmengen von Lernstoff<br />
ins Hirn gepresst, bei Klausuren wieder ausgeschieden – und sofort vergessen.<br />
Was sollte sie anderes tun, wenn der Lehrplan keine sinnvollen Vernetzungen vorsieht,<br />
keine interdisziplinären Projekte, nicht den kleinsten Blick über den Tellerrand.<br />
Stattdessen: eine Überfülle zusammenhangloser Fakten fragwürdiger Relevanz.<br />
Warum muss jemand, der kein Verhältnis zu Zahlen hat und in seinem weiteren<br />
Leben nie mehr Mathe brauchen wird, Wahrscheinlichkeitsrechnung beherrschen?<br />
Und warum muss jemand, der Computer programmieren oder Maschinen<br />
bauen will, die höchsten Feinheiten lyrischer Reimformen kennen? Warum können<br />
Schüler sich nicht zu Beginn der Oberstufe auf das spezialisieren, was ihnen<br />
liegt, Spaß macht und später nützlich sein wird? Mit der verunglückten G-8-Reform<br />
wurde jedes individualisierte Lernen abgeschafft – zugunsten stumpfsinniger,<br />
standardisierter Paukerei. Gymnasiasten haben heute keine Zeit mehr für Sport,<br />
Musik oder Freunde, sie führen das Leben von Gefangenen, die sich einem absurden<br />
Zwangssystem unterwerfen, um irgendwann freizukommen.<br />
Das alles treibt mich zur Verzweiflung. Es ist ein Verbrechen an jungen Menschen,<br />
die zu unkritischen, angepassten Lernmaschinen erzogen werden, die später<br />
reibungslos ins globale Wirtschaftssystem eingepasst werden können. Dabei<br />
werden sie um eine der schönsten und wichtigsten Erkenntnisse der menschlichen<br />
Existenz betrogen: dass Lernen eine Lust sein kann.<br />
Alle, die an diesem Verbrechen beteiligt sind, sollten zur Strafe lebenslänglich<br />
in ein bayerisches Gymnasium gehen müssen. Und jedes Woche Abitur in ihrem<br />
Angstfach schreiben.<br />
Amelie Fried ist Fernsehmoderatorin und Bestsellerautorin. Kurz vor Redaktionsschluss<br />
kam die Nachricht, dass ihre Tochter das Abi bestanden hat<br />
Natürlich hat es ihm nach dem Unfall<br />
geholfen, dass sein Körper trainiert<br />
war. Er war in der Basketball A-Jugend des<br />
MTV Gießen zwar nicht der „Topscorer“,<br />
der immer die meisten Körbe wirft. Mit<br />
seinen 1,85 Meter, für einen Basketballer<br />
eher klein gewachsen, spielte er defensiv im<br />
Zentrum – und auf ihn war Verlass. „Der<br />
Volker“, sagt sein damaliger Mitspieler Roland<br />
Peters, „war ein zäher Bursche. Es war<br />
nicht einfach, an ihm vorbeizukommen.“<br />
Auch sein damaliger Trainer Bernd Röder<br />
schätzt seine Talente: „Er war ein Kämpfer:<br />
robust, nicht filigran, ein toller Teamplayer.<br />
Vor allem hat er gelernt, in einer<br />
Mannschaft Siege zu erringen und Niederlagen<br />
zu verkraften.“<br />
Robust, kämpferisch, mannschaftstauglich:<br />
Das sind die Eigenschaften, die<br />
ihm auch seine Parteifreunde in der CDU<br />
nachsagen. Als er wieder gehen konnte, hat<br />
Bouffier seine ganze Energie auf die Politik<br />
geworfen, so wie er vorher Sport getrieben<br />
hatte. Er war bereits eine große Nummer<br />
in der hessischen Jungen Union, als<br />
der sieben Jahre jüngere Roland Koch dazustieß.<br />
Bouffier war Landesvorsitzender,<br />
gehörte dem JU-Bundesvorstand an und<br />
war dabei, als 1979 während eines Fluges<br />
von Caracas nach Santiago de Chile hoch<br />
über den Wolken und mit viel Whiskey der<br />
legendäre „Andenpakt“ geschlossen wurde.<br />
Es war ein Männerbündnis, dessen Mitglieder<br />
einander schworen, sich gegenseitig<br />
beim Aufstieg nach oben nicht in die<br />
Quere zu kommen. Einige später berühmt<br />
gewordene CDU-Nachwuchspolitiker gehörten<br />
dazu: Matthias Wissmann, Günther<br />
Oettinger oder Friedbert Pflüger. Koch, der<br />
später einer ihrer Schwergewichte wurde,<br />
war erst durch Bouffier in den erlauchten<br />
Kreis aufgenommen worden.<br />
Schon sein Vater, Robert Bouffier, 1944<br />
in Stalingrad gefangen genommen und erst<br />
1950 aus Russland heimgekehrt, war ein<br />
bekannter CDU-Lokalpolitiker, sein Großvater<br />
hatte 1945 die CDU in Gießen gegründet.<br />
„Wir waren ein politisches Haus,<br />
und Hessen war damals ein absolut rotes<br />
Land. Wer da die Fahne der CDU hochgehalten<br />
hat und schon gar im öffentlichen<br />
<strong>Die</strong>nst, der wusste, das kann das Ende der<br />
Karriere gewesen sein.“<br />
Er lernte schon in jungen Jahren die<br />
Großen der CDU kennen: Konrad Adenauer<br />
durfte er im Wahlkampf 1957 als<br />
Illustration: Jan Rieckhoff; Foto: Andrej Dallmann<br />
36 <strong>Cicero</strong> 7.2013
i‐Dötzchen einen Blumenstrauß überreichen,<br />
später Ludwig Erhard und Rainer<br />
Barzel die Hand schütteln. Aber: „Wir waren<br />
immer in der Opposition. Da wird man<br />
nicht übermütig.“<br />
Wenn er mit seinen Mannschaftskameraden<br />
nach dem Training im Gasthaus<br />
„Zwibbel“ oder im Vereinshaus Bier trank,<br />
knobelte oder „Mäxchen“ spielte, ging es<br />
allerdings, wie sich Trainer Röder erinnert,<br />
„selten um Politik, sondern um Basketball“.<br />
Aber: „Man merkte schon, dass er sprachlich<br />
anders drauf war als wir“, sagt Mitspieler<br />
Peters. „Trotzdem hat er sich nie in den<br />
Vordergrund gespielt.“ Gelegentlich ging es<br />
wohl auch um die Mädels. Immerhin hat er<br />
seine Frau Ursel, die damals ebenfalls eine<br />
Basketballerin war, im Vereinshaus kennengelernt.<br />
Auch sie ist in der CDU und saß<br />
einige Jahre im Magistrat der Stadt. <strong>Die</strong><br />
Söhne, Volker und Frederic, sind in der<br />
Jungen Union aktiv.<br />
Als Volker Bouffier und seine Freunde<br />
von der Jungen Union anfingen, in Hessen<br />
CDU-Politik zu machen, fühlten sie<br />
sich von Gegnern umzingelt. „Wir hatten<br />
keine Referenten, keine Fahrer. Wir hatten<br />
nix. Wir wollten die Partei und die Welt<br />
verändern.“ Sie waren jung damals und<br />
ehrgeizig. Regelmäßig trafen sie sich in einem<br />
schmucklosen Hinterzimmer der <strong>Auto</strong>bahnraststätte<br />
„Wetterau“ nördlich von<br />
Frankfurt an der A 5. Eine Art hessischer<br />
„Andenpakt“ war das, kurz „Tankstelle“ genannt<br />
– Franz Josef Jung, Karlheinz Weimar,<br />
Karin Wolff und Roland Koch gehörten<br />
dazu. Bouffier war ihr Anführer. Mitte<br />
der neunziger Jahre aber rückte er plötzlich<br />
klaglos in die zweite Reihe und machte<br />
dem Aufsteiger Koch Platz. Dann war es<br />
fast wieder wie früher beim Basketball:<br />
Bouffier machte den Brecher und Stopper<br />
Großvater CDU, Vater CDU, Frau<br />
CDU. Und das im roten Gießen.<br />
<strong>Die</strong> Bouffiers waren umzingelt<br />
im Mittelfeld, an dem so leicht keiner vorbeikam,<br />
und Koch den Topscorer, der die<br />
Körbe warf. So eroberten sie die Macht: in<br />
der Partei, im Land.<br />
Seit Koch 2010 die Politik aufgegeben<br />
hat und an die Spitze des Bauunternehmens<br />
Bilfinger gewechselt ist, muss der<br />
Verteidiger Bouffier beweisen, dass auch<br />
er Körbe werfen kann. Am 22. September,<br />
zeitgleich mit der Bundestagswahl, entscheiden<br />
die Hessen bei der Landtagswahl<br />
über seine politische Zukunft. <strong>Die</strong> Umfragen<br />
verheißen nichts Gutes. Zwar hat sich<br />
die CDU nach den jüngsten Prognosen berappelt,<br />
während die SPD etwas absackte.<br />
Aber die Grünen wären stark genug, um<br />
eine rot-grüne Mehrheit zu sichern, zumal<br />
dann, wenn die FDP an der Fünf-Prozent-<br />
Hürde scheitert.<br />
Berlin, ein lauer JuniAbend. Beim Sommerfest<br />
im Garten der hessischen Landesvertretung<br />
sitzt Volker Bouffier, den sie<br />
„Bouffi“ nennen, mit der Bundeskanzlerin<br />
am Biertisch. Irgendwo unter den Gästen<br />
steht auch Thorsten Schäfer-Gümbel von<br />
der SPD herum, der seinen Job haben will.<br />
Aber „Bouffi“ ist der Hausherr. Er sitzt neben<br />
der Kanzlerin. Er sagt Angela zu ihr.<br />
Das Wetter ist herrlich. Bier und Wein<br />
fließen reichlich. Jetzt soll er etwas zu den<br />
schlechten Umfragen sagen. Der Mann mit<br />
dem immer noch vollen, aber inzwischen<br />
eisgrauen Haar tut so, als gäbe es die Zahlen<br />
nicht. Was für schlechte Umfragen?<br />
„<strong>Die</strong> CDU steigt, die SPD sinkt. Wir werden<br />
40 Prozent plus x bekommen“, sagt er<br />
mit seiner tiefen, rauchigen Stimme. „Und<br />
die FDP kommt rein. Das reicht zum Regieren.“<br />
Und wenn nicht? Wieder das etwas<br />
schiefe, typische Bouffier-Grinsen: „Damit<br />
beschäftige ich mich nicht.“<br />
Ärgern würde er sich bestimmt und<br />
zwar fürchterlich. Aber zerbrechen würde<br />
er daran nicht. Es gibt Wichtigeres in einem<br />
Leben, das schon mal zwischen Daumen<br />
und Zeigefinger gepasst hat.<br />
Hartmut Palmer<br />
ist politischer Chefkorrespondent<br />
von <strong>Cicero</strong><br />
Anzeige<br />
IM SOMMER versammeln<br />
wir die Weltstars der Klassik<br />
16. August – 15. September 2013<br />
Anne-Sophie Mutter | Berliner Philharmoniker |<br />
Christian Thielemann | Claudio Abbado | Daniel Barenboim |<br />
Lucerne Festival Orchestra | Martin Grubinger |<br />
Mariss Jansons | Mitsuko Uchida | Pierre Boulez |<br />
Royal Concertgebouw Orchestra | Simon Rattle |<br />
Thomas Hampson | West-Eastern Divan Orchestra |<br />
Wiener Philharmoniker und viele mehr<br />
Karten und Informationen: +41 (0)41 226 44 80 | www.lucernefestival.ch
| B e r l i n e r R e p u b l i k | A u f s t e i g e n u n d A b s t ü r z e n<br />
„NATÜRLICH BIN<br />
ICH EINE OPTION“<br />
38 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Sie könnte einmal Horst Seehofer<br />
nachfolgen. <strong>Die</strong> mächtigste Frau der<br />
CSU ist Ilse aigner schon jetzt. Wie<br />
funktionieren solche Aufstiege? Im<br />
<strong>Cicero</strong>-Gespräch erzählt die Ministerin<br />
von ihrer Prägung durch eine schwere<br />
Krankheit. Sie spricht über Angstberge,<br />
das gute Gefühl im Rampenlicht und<br />
ihre Begegnungen mit Raubfischen<br />
F<br />
rau Aigner, wir haben gehört,<br />
dass Sie gerne in den Bergen<br />
wandern gehen …<br />
Bei uns in Bayern sagt man Bergsteigen.<br />
Das können mal die kleineren Touren<br />
sein, nur mal kurz auf die Tregler-Alm<br />
hoch. Oder <strong>vom</strong> Brauneck rüber auf die<br />
Benediktenwand.<br />
Was ist der schwerste Gipfel, den Sie<br />
erklommen haben?<br />
Das dürfte der Guffert gewesen sein, mit<br />
2194 Metern. Am Schluss wird der Aufstieg<br />
richtig steil. Da muss man schwindelfrei<br />
sein.<br />
Und welchen politischen Achttausender<br />
peilen Sie an?<br />
<strong>Die</strong> CSU muss bei den Landtagswahlen<br />
im September besser abschneiden als vor<br />
fünf Jahren. <strong>Die</strong> 43 Prozent müssen wir<br />
unbedingt toppen.<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 39
| B e r l i n e r R e p u b l i k | A u f s t e i g e n u n d A b s t ü r z e n<br />
Wir meinten Sie persönlich.<br />
Ach so, persönlich. Eigentlich habe ich<br />
meine Karriere nie geplant. Dass ich<br />
Bundesministerin werde, hätte ich mir<br />
früher auch nie gedacht.<br />
Das heißt, Sie wollen gar nicht Ministerpräsidentin<br />
und Chefin der CSU werden?<br />
<strong>Die</strong> Frage stellt sich überhaupt nicht. Erst<br />
kommt die Landtagswahl, und danach<br />
heißt für die nächste Legislaturperiode<br />
der Ministerpräsident und Parteivorsitzende<br />
Horst Seehofer.<br />
Vielleicht beginnen wir mit Ihrem Aufstieg<br />
erst einmal ganz unten.<br />
Ganz unten?<br />
Im Mangfalltal, im Alpenvorland. Dort sind<br />
Sie geboren.<br />
Genau. Hügel, Wald. Meine Heimatgemeinde<br />
Feldkirchen-Westerham hatte damals<br />
weniger als 10 000 Einwohner, unser<br />
Dorf selbst etwa 1500. Fast alle haben<br />
sich gekannt.<br />
Wie war es dort bei den Aigners?<br />
Meine Eltern hatten einen Handwerksbetrieb.<br />
Jeder musste da mit anpacken, keiner<br />
hat sich aus der Verantwortung stehlen<br />
können. Aber dafür hatten wir viele<br />
Freiheiten – meine drei Schwestern und<br />
ich. <strong>Die</strong> Eltern haben gewusst, dass sie<br />
sich auf uns verlassen können. Wenn es<br />
schiefgegangen ist, hat es halt auch mal<br />
ein Donnerwetter gegeben.<br />
Was haben Ihre Eltern verkauft?<br />
Wir hatten ein Geschäft, wo man seine<br />
Waschmaschine kauft, die Spülmaschine,<br />
also die weiße Ware. Dann die Fernseher<br />
und Radiogeräte, das ist die braune<br />
Ware. Und da waren etwa 20 Handwerker<br />
in der Installation und im Service.<br />
Ich erinnere mich noch gut daran, dass<br />
meine Eltern in manchen Nächten nicht<br />
schlafen konnten, weil sie nicht genau<br />
gewusst haben, ob sie einen Auftrag bekommen<br />
und ob sie die Mitarbeiter weiter<br />
beschäftigen können. Ich hab als<br />
Kind gespürt, wenn es eng wurde.<br />
Warum wollten Sie den Betrieb des Vaters<br />
übernehmen?<br />
Ich wollte schon früh in den Betrieb einsteigen.<br />
Ich war erst auf dem Gymnasium,<br />
aber das war mir zu theoretisch.<br />
„Bei mir stand es fifty-fifty, ob<br />
ich nach der OP gelähmt bin.<br />
Alles, was danach kommt, setzt<br />
man in Relation zu so einem<br />
existenziellen Erlebnis“<br />
Ilse Aigner beim <strong>Cicero</strong>-Gespräch in München. In Bayern setzt sie im<br />
Herbst ihre Karriere fort. <strong>Die</strong> 48 Jahre alte CSU-Politikerin gibt ihr Amt<br />
als Verbraucherministerin in Berlin auf und wechselt in die Landespolitik.<br />
Fernziel: einmal Horst Seehofer nachzufolgen. Das wollen allerdings auch<br />
andere, zum Beispiel Markus Söder, bayerischer Finanzminister<br />
Fotos: Dirk Bruniecki für <strong>Cicero</strong> (Seiten 38 bis 40)<br />
40 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Deswegen bin ich auf die Realschule gewechselt.<br />
Da hat mich der Direktor zusammengestaucht<br />
auf dem Parkplatz, ob<br />
ich nicht ganz sauber bin. Dass ich angesichts<br />
solch guter Noten auf die Realschule<br />
wechsle. Aber das war mir egal.<br />
Allerdings habe ich festgestellt, dass das<br />
Kaufmännische nicht so meines ist. Ich<br />
wollte was Technisches und hab dann Radio-<br />
und Fernsehtechnikerin gelernt und<br />
mich später zur staatlich geprüften Elektrotechnikerin<br />
fortgebildet.<br />
Neben der Lehre haben Sie Leistungssport<br />
betrieben. Wie wichtig war das für Sie?<br />
Mit 13 habe ich angefangen. Wir waren<br />
viel unterwegs, zu Trainingslagern nach<br />
Italien, nach Cattolica, mein erster Urlaub<br />
ohne Eltern. Dann die Wettkämpfe<br />
am Wochenende, die sind meistens<br />
ganz früh losgegangen. Mein Angstberg<br />
war der Antholinger, der zieht sich<br />
elendslang.<br />
Radsportler müssen sich durch ein hartes<br />
Trainingsprogramm aufbauen.<br />
Jeden Tag aufs Rad und dann Kilometer<br />
machen. Selbst hinterm Schneepflug<br />
bin ich hergefahren. Das war auch noch<br />
in diesen kratzenden Wollhosen und<br />
Wolltrikots.<br />
Ist Ausdauer eine Eigenschaft von Ihnen<br />
geworden?<br />
Ja, auf alle Fälle. Ich bin keine Sprinterin,<br />
sondern eher eine Ausdauer-Sportlerin.<br />
Das gilt auch fürs Politische. Auch mal<br />
was aussitzen, hätte ich fast gesagt, aber<br />
es ist eher ein Abwarten. Ich warte den<br />
Moment ab, in dem es losgeht.<br />
Warum haben Sie den Radsport nicht<br />
weiterverfolgt?<br />
Ich hatte auf einmal fürchterliche<br />
Schmerzen, ohne zu wissen warum. <strong>Die</strong><br />
Untersuchungen gingen über ein ganzes<br />
Jahr. Dann habe ich Gelbsucht bekommen,<br />
deswegen bin ich abgemagert<br />
bis auf 49 Kilo. Bei meiner Größe ist das<br />
nicht gerade sonderlich viel. Dann hat<br />
sich nach einem weiteren Jahr rausgestellt,<br />
dass es ein Tumor im Rückenmark<br />
war. Der ist Gott sei Dank kurz vor meinem<br />
18. Geburtstag erfolgreich operiert<br />
worden. Aber ich hatte zwei Jahre lang<br />
mit unglaublichen Schmerzen zu tun. Da<br />
denken Sie nicht an Radrennen.<br />
Wie hat Sie die Krankheit geprägt?<br />
Man nimmt Dinge nicht mehr so wichtig,<br />
die einen sonst vielleicht aufregen<br />
würden. Ich musste in der Zeit die Prüfungen<br />
für die Mittlere Reife schreiben<br />
und habe nicht mehr schlafen können<br />
wegen der Schmerzen. Deswegen war<br />
mir alles andere egal, und das hat sich<br />
auch später ausgewirkt. So ein Einschnitt<br />
prägt. Bei mir stand es ja auch fifty-fifty,<br />
ob ich nach der Operation gelähmt bin<br />
oder nicht. Alles, was im Nachhinein<br />
kommt, setzt man in Relation zu so einem<br />
existenziellen Erlebnis.<br />
Wenig später, mit 19 Jahren gingen Sie in<br />
die Junge Union. Wie kamen Sie da hin?<br />
Das war keine Überzeugungstat. Ich war<br />
früher im Radsportverein gewesen und<br />
im Turnverein. Und meine Mutter hat<br />
sich immer eingebildet, ich müsste mich<br />
noch mehr engagieren. Dann hat es einen<br />
von der JU gegeben, der gesagt hat,<br />
jetzt könntest du eigentlich zu uns kommen.<br />
<strong>Die</strong> beiden haben mich so lange<br />
genervt, bis ich eingetreten bin. Ich hab<br />
ja nicht gewusst, dass es von da an recht<br />
schnell ging.<br />
Kreistagsmitglied 1990, JU-Landesvorstand,<br />
stellvertretende JU-Landesvorsitzende<br />
1993, mit 29 dann im Landtag.<br />
Wieso ging es so zügig nach oben?<br />
Offenbar hatte ich schon immer so ein<br />
Einmisch-Gen. Ich war von der ersten bis<br />
zur letzten Klasse Klassensprecherin und<br />
dann auch Schülersprecherin.<br />
Aber Sie haben einmal behauptet, Sie<br />
seien kein Alphatier.<br />
Man kann Dinge auch in die Hand nehmen,<br />
ohne sich aufzuplustern. Ich bin<br />
halt kein Breitmaul. Ich habe mich aber<br />
immer für andere eingesetzt, die sich vielleicht<br />
nicht so recht trauten.<br />
Gehen wir weiter Ihre Karriere hoch.<br />
Bundestag, Parteipräsidium, Bundesministerin<br />
– wie kommt Ilse Aigner von einer<br />
Etappe zur nächsten?<br />
Vielleicht weil ich nicht auf der Stirn stehen<br />
habe: „Ich will mehr werden.“ Ich<br />
mache da, wo ich stehe, meine Arbeit<br />
ordentlich.<br />
Im Ernst? Ihr Aufstieg sieht eher nach<br />
einer systematischen Kaderkarriere aus.<br />
Wer mich nicht kennt, mag das so sehen.<br />
Aber vielleicht müssten Sie in meine Geschichte<br />
zurückblicken: Mir war nach der<br />
Operation wichtiger als alles andere, dass<br />
ich gesund bin und dass ich gute Freunde<br />
habe, mit denen ich mich verstehe, und<br />
dass die Familie intakt ist. Deswegen<br />
habe ich nur in ganz wenigen Momenten<br />
gesagt: Das will ich jetzt wirklich machen,<br />
zum Beispiel als ich für die CSU als Bürgermeisterin<br />
antreten wollte.<br />
Mit wie vielen Jahren war das?<br />
Da war ich 27, gerade mal drei Jahre im<br />
Gemeinderat. Wir haben zu viert den<br />
Ortsverband aufgemischt. Vor der entscheidenden<br />
Veranstaltung hab ich die<br />
Stereoanlage eingeschaltet und mir „Auf<br />
in den Kampf, Torero“ aufgelegt. Es gab<br />
drei Kandidaten, der Fraktionschef ist im<br />
ersten Wahlgang rausgefallen, und ich<br />
bin gegen den zweiten Bürgermeister in<br />
die Stichwahl gegangen. Da stand’s 75:72<br />
gegen mich.<br />
Dafür zogen Sie kurz danach in den Landtag<br />
ein. Wie sind Sie da rangegangen?<br />
Das war eine ganz schlechte Zeit für die<br />
CSU, nach dem Übergang von Strauß<br />
zu Streibl 1993, als die Partei in Umfragen<br />
bei 38 Prozent stand. Ich habe mir<br />
in fünf Stimmkreisen die Unterstützung<br />
gesichert, auch gegen Konkurrenten, die<br />
nicht begeistert waren, dass da so ein junges<br />
Mädel daherkommt. Aber so ist mir<br />
das geglückt, vor allem, weil Edmund<br />
Stoiber die CSU wieder über die 50-Prozent-Marke<br />
brachte.<br />
Stimmkreis für Stimmkreis. In der CSU<br />
gelten Sie als eine methodische Netzwerkerin,<br />
richtig?<br />
Ich telefoniere keine Listen ab. Aber ich<br />
greif schnell mal zum Telefon und frage,<br />
was Sache ist. Ich will direkt wissen, was<br />
los ist.<br />
Wie viele CSU-Telefonnummern haben Sie<br />
denn in Ihrem Handy? 300?<br />
Das wird nicht reichen. Das werden<br />
schon mehr als 1000 sein, die ich im Telefon<br />
gespeichert hab.<br />
Helmut Kohls berühmtes Notizbuch der<br />
Macht – nur in der Digitalversion.<br />
Es gibt ja allein schon im Wahlkreis<br />
fast 50 Ortsverbände der CSU und<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 41
| B e r l i n e r R e p u b l i k | A u f s t e i g e n u n d A b s t ü r z e n<br />
22 Kreisverbände in Oberbayern. Dazu<br />
kommen die JU, die Frauenunion, die<br />
Mittelstandsunion, die Mandatsträger,<br />
das läppert sich.<br />
Zum unglamourösen Landwirtschaftsministerium<br />
mit all den Subventionen<br />
und Fischereiquoten haben Sie sich<br />
nebenbei noch ein zweites aufgebaut: das<br />
Aigner-Aufbauministerium.<br />
Aigner-Aufbauministerium?<br />
Zuständigkeit: Fototermine mit Kofi Annan<br />
und Bill Gates. Kämpfe gegen facebook.<br />
Kampagne gegen das Wegwerfen von<br />
Essen.<br />
Das Ministerium ist wirklich sehr breit<br />
aufgestellt. <strong>Die</strong> Frage ist, ob man so etwas<br />
auch sichtbar macht. Zugegeben: Da<br />
sind auch Facetten drin, die ich mir erst<br />
erschlossen habe.<br />
Mit Bill Gates auf dem Foto: Das wollten<br />
Sie einfach als gute Show.<br />
Lesen Sie’s nach: Da ist es um den Kampf<br />
gegen Hunger und Armut in Afrika<br />
gegangen.<br />
Was unterscheidet Sie in Ihrer Art, als<br />
Ministerin zu agieren, von einem Gipfelstürmer<br />
wie Guttenberg?<br />
Ich bin bodenständig aufgewachsen, in<br />
recht einfachen Verhältnissen. Wir waren<br />
halt in einer kleinen Gemeinde. Gut, der<br />
Karl-Theodor kommt auch aus einer kleinen<br />
Gemeinde, aber er hatte eine ganz<br />
andere Perspektive.<br />
Weil er <strong>vom</strong> Schloss kam?<br />
Das darf ihm nicht zum Vorwurf gemacht<br />
werden. Man wird in seine Welt reingeboren.<br />
Das Zweite ist: Ich bin im Auftritt<br />
anders. Ich könnte gar nicht mit so viel<br />
Glanz unterwegs sein. Deswegen muss der<br />
Absturz für ihn umso schlimmer gewesen<br />
sein. Weil er natürlich sehr schnell hochgeschossen<br />
worden ist von den Medien,<br />
sich vielleicht auch hat hochschießen lassen.<br />
Mir persönlich tut das sehr leid. Ich<br />
habe einen völlig anderen Hintergrund.<br />
Ich könnte zum Beispiel auch nicht wie<br />
Kretschmann große Philosophie-Sentenzen<br />
zitieren. Das ist nicht meine Welt.<br />
Was ist Ihre Welt?<br />
Ich bin Technikerin, zack, zack, zack,<br />
eins, zwei, drei – Ergebnis.<br />
Wenn wir in unserem Bergsteigerbild<br />
bleiben, ist Guttenberg hochgestürmt, und<br />
Sie arbeiten sich von Hütte zu Hütte vor.<br />
Ich mach auch mal eine Rast, und ich<br />
schaue mir die Dinge an. <strong>Die</strong>se Ruhe<br />
und Weite in den Höhen, die man oben<br />
genießen kann mit der mitgebrachten<br />
Brotzeit. Andersrum gehe ich auch<br />
ins Wasser – zum Fischen und zum<br />
Tauchen.<br />
In Bayern?<br />
Auch in Bayern. Den Tauchschein hab<br />
ich im Pullinger Weiher bei München<br />
gemacht, an dem Tag hat es gerade geschneit.<br />
Ich war auch bei uns in einem<br />
Baggerweiher tauchen, das weiß ich noch,<br />
„Dass Karl-Theodor<br />
zu Guttenberg<br />
das Rampenlicht<br />
genossen<br />
hat, kann ich<br />
verstehen. Wer<br />
tut das nicht? Da<br />
muss man ehrlich<br />
sein. Natürlich ist<br />
das schön“<br />
weil ich auf einmal einem Hecht gegenüber<br />
gewesen bin, Auge in Auge, und der<br />
hat dann rückwärts eingeparkt, ab ins<br />
Gebüsch.<br />
Gehen wir zu einer wichtigen Etappe Ihrer<br />
Karriere: 2011 wurden Sie Vorsitzende<br />
der CSU Oberbayern, des mit Abstand<br />
größten Parteibezirks. <strong>Die</strong> Machtposition<br />
fand auch Georg Fahrenschon attraktiv,<br />
der damalige bayerische Finanzminister.<br />
Ja, das war eine schwierige Zeit für mich<br />
und auch für ihn. Der Georg und ich<br />
sind 25 Jahre praktisch parallel gelaufen –<br />
Richtung Gipfel, wenn man so will. Aber<br />
dann hatten wir auf einmal dasselbe Ziel,<br />
und es war auf einmal nur ein Platz auf<br />
dem Gipfel.<br />
Wie haben Sie Ihren Freund<br />
ausgeschaltet?<br />
Davon kann keine Rede sein. Wir haben<br />
offen und ehrlich miteinander geredet,<br />
auch Freunde einbezogen, die uns beraten<br />
haben, und er hat schlussendlich gesagt:<br />
Okay, dann machst das du.<br />
Der Hecht hat rückwärts eingeparkt.<br />
Ich habe offen gesagt, was ich will, und<br />
wie wir das Problem lösen können.<br />
Liebenswürdige Schale, harter Kern?<br />
Das würde ich durchaus unterschreiben.<br />
Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt<br />
habe, dann verfolge ich das sehr<br />
zielstrebig, auch über Etappen, es muss<br />
nicht sofort gehen. Und ich habe ein<br />
Elefantengedächtnis.<br />
Sie sind nachtragend?<br />
Ich kann verzeihen, aber nicht vergessen,<br />
das ist der Unterschied.<br />
Stimmt es, dass an der Vorsitzenden des<br />
CSU-Bezirks Oberbayern auch der Ministerpräsident<br />
nicht vorbeikommt?<br />
Ein Vetorecht habe ich nicht, falls Sie<br />
das meinen. Aber Horst Seehofer und<br />
ich arbeiten eng zusammen. Wenn eine<br />
wichtige Entscheidung Oberbayern betrifft<br />
oder auch die Partei, dann stimmt<br />
er das gern mit mir ab. Ich melde mich<br />
auch, wenn ich was zu sagen habe, wenn<br />
auch nicht unbedingt öffentlich.<br />
Gehört es zu Ihrem Rezept, dass Sie den<br />
Chefs Entwarnungssignale geben? Sie<br />
machen Ihre Aufgabe, Sie knien sich rein,<br />
aber Sie drängeln nicht nach oben?<br />
Zumindest müssen die nicht Angst haben,<br />
dass ich ihnen von hinten das Messer<br />
in den Rücken ramme.<br />
Noch einen Unterschied zum<br />
Karl-Theodor.<br />
Da tun Sie ihm sicher Unrecht. Das ist<br />
eine von vielen Unterstellungen. Dass er<br />
das Rampenlicht genossen hat, kann ich<br />
verstehen. Wer tut das nicht? Da muss<br />
man ehrlich sein.<br />
Sie genießen das Rampenlicht?<br />
Ja, natürlich ist das schön. Wenn die<br />
Leute auf einen zugehen, wenn sie sich<br />
freuen, ein Foto mit mir machen zu<br />
können. Klar, dann freue auch ich mich.<br />
42 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Man muss aber immer im Kopf behalten,<br />
dass das auch am Amt hängt. Wenn du<br />
oben bist, brauchst du immer Menschen,<br />
die auch mal sagen: Ilse, das war jetzt<br />
nicht ganz optimal.<br />
Haben Sie Angst davor, Ihre Macht zu<br />
verlieren?<br />
Nee. Ich definiere mich nicht über Macht<br />
und Ämter. <strong>Die</strong> Politik vergibt sie nur<br />
auf Zeit. Das wird einem als Landwirtschafts-<br />
und Verbraucherschutzministerin<br />
schnell klar, das ist ein echter Schleudersitz.<br />
Lebensmittel sind ein sensibler Bereich,<br />
da hätte es mich jedes Jahr wegwischen<br />
können.<br />
Warum gehen Sie aus Berlin in die Landespolitik?<br />
Das ist doch wie ein Abstieg.<br />
Landtag ist kein Abstieg. Wir haben<br />
schwierige Wahlen vor uns, da kann ich,<br />
da will ich zum Erfolg beitragen. Und da<br />
ist es schon auch entscheidend, dass ich<br />
mir nicht zu schade bin, die Karriere in<br />
Berlin aufzugeben.<br />
Es gibt auch eine andere Version: Man<br />
sitzt zusammen im engeren CSU-Kreis<br />
und sagt sich: Unwahrscheinlich, dass<br />
die schwarz-gelbe Bundesregierung in<br />
Berlin bestätigt wird. Aber in einer großen<br />
Koalition gibt es keine drei CSU-Ministerien<br />
mehr, also müssen wir das vorher<br />
bereinigen.<br />
Quatsch. Das wäre Kaffeesatzleserei. Ich<br />
glaube auch nicht, dass an mir so einfach<br />
jemand vorbeikommt.<br />
Haben Sie mit Horst Seehofer abgesprochen,<br />
was Sie nach der Wahl werden?<br />
Nein.<br />
Eines Tages lesen wir dann in Ihrem<br />
Lebenslauf: Ministerpräsidentin in Bayern,<br />
und Sie sagen uns wieder wie vorhin: „Ach,<br />
eigentlich habe ich meine Karriere nie<br />
geplant.“<br />
Es sind viele Möglichkeiten denkbar für<br />
das Jahr 2018 und die folgenden. <strong>Die</strong><br />
Grundlagen dazu müssen aber erst gelegt<br />
werden. Was mich schon freut, ist, dass<br />
die Leute positiv darauf reagieren, dass<br />
ich mich ab Herbst auf Bayern konzentriere.<br />
Ich habe fast ein Aufatmen gespürt.<br />
Und natürlich bin ich für manche auch<br />
eine Option.<br />
Das Maximilianeum, der Münchner Landtag,<br />
ist das Basislager, in dem Sie nun<br />
biwakieren, bevor es hoch zum Gipfel geht.<br />
Basislager ist auf alle Fälle gut. Wenn<br />
Sie mal bei den richtigen Bergsteigern<br />
schauen: <strong>Die</strong> sind ganz schön lang in den<br />
Basislagern.<br />
Aber man ist nah dran, am …<br />
… genau.<br />
Und Proviant haben Sie?<br />
Ohne Ende. Ich habe eine lange<br />
Kondition, tiefen Puls und tiefen<br />
Blutdruck. Deshalb werde ich bestimmt<br />
nicht unruhig.<br />
Das Gespräch führten Georg Löwisch und<br />
Christoph Schwennicke<br />
Anzeige
| B e r l i n e r R e p u b l i k<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
4<br />
8 9<br />
5 6 7<br />
10 11 12<br />
13 14 15 16<br />
Wen hätten Sie gern an der Macht? Bis zur Bundestagswahl lädt <strong>Cicero</strong><br />
Persönlichkeiten ein, sich die perfekte Regierung zu wünschen. <strong>Die</strong>smal hat die<br />
<strong>Auto</strong>rin und frühere HSV-Managerin Katja Kraus ein Kabinett berufen. Darin hat<br />
Schavan ihr Amt wieder, und Wulff bekommt eine zweite Chance. <strong>Die</strong> Posten für die<br />
Augustausgabe des <strong>Cicero</strong> wird die Schauspielerin Christiane Paul besetzen<br />
Illustration: Jan Rieckhoff; Fotos: Picture Alliance/ DPA (12), Deutscher Medienpreis, Action Press, Julia Baier/Laif, Christian Langbehn/DDP Images<br />
44 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Foto: Erwin Elsner/Picture Alliance/DPA<br />
(1) Bundeskanzler<br />
Roger Willemsen. Gesellschaftsgestaltung<br />
sollte auf humanistischer Bildung basieren.<br />
Und weil Charme, Herzlichkeit und<br />
Humor wünschenswerte Eigenschaften für<br />
höchste Repräsentanten des Landes sind.<br />
(2) Chef des Bundeskanzleramts<br />
Petra Pau. Eine kluge und beharrliche<br />
Verfechterin der Bürgerrechte, dabei<br />
hochrespektiert im Parlament und auf<br />
ihre ruhige Weise so durchsetzungsfähig<br />
wie sachkundig. Von ihrem guten Geist<br />
kann das Kanzleramt nur profitieren.<br />
(3) Auswärtiges<br />
Egon Bahr. Friedensstifter und charmanter<br />
Geschichtenerzähler. Weil ein Mann, der<br />
Zeitgeschichte geprägt hat und noch immer<br />
einen ungestümen Gestaltungswillen<br />
ausstrahlt, ein idealer Repräsentant ist.<br />
Gesellschaftsbild, für Offenheit gegenüber<br />
anderen Kulturen und Traditionen.<br />
(10) Gesundheit<br />
Ulla Schmidt. Hat auch hartnäckigen<br />
Lobbyisten Paroli geboten. Sollte dort<br />
weitermachen, wo sie aufgehört hat. Und<br />
in Brandenburg Urlaub machen.<br />
(11) Wirtschaft<br />
Gesine Schwan. Vereint rasante Intellektualität<br />
mit Wärme und Menschlichkeit.<br />
(12) Bildung<br />
Annette Schavan. Weil es nicht gerecht ist,<br />
aufgrund einer inquisitorischen Debatte,<br />
ohne jegliche Verhältnismäßigkeit und<br />
inhaltliche Argumentation, das Amt<br />
zu verlieren. Und weil diese Form der<br />
moralischen Verurteilung und Häme<br />
ein erschütterndes Menschenbild zeigt.<br />
Anzeige<br />
Was ist<br />
eine gute<br />
Regierung?<br />
(4) Innen<br />
Andreas Voßkuhle. Ein Mann mit<br />
Klarheit und Haltung ohne Neigung<br />
zum Populismus. Kann Nein sagen.<br />
Und wirkt komplett unbestechlich.<br />
(13) Umwelt<br />
Nikolaus Gelpke. Hat profunde Kenntnisse<br />
ökologischer Sachverhalte und das nicht nur<br />
über das Meer, das er liebt. Er ist obendrein<br />
ein guter Kommunikator, wenn auch der<br />
leisen Töne. Könnte stilbildend wirken.<br />
(5) Justiz<br />
Michael Nesselhauf. Begleitet die deutsche<br />
Rechtsgeschichte seit Jahrzehnten mit<br />
großer Dezenz. Ein Enthusiast.<br />
(6) Finanzen<br />
Sahra Wagenknecht: Ob sie mit der<br />
gleichen Verve Politik macht, wie sie<br />
ihre Positionen in Talkshows vertritt?<br />
Ich finde, es ist einen Versuch wert.<br />
(7) Arbeit und Soziales<br />
Jana Schiedek. Eine Frau, die mit<br />
Frauenpolitik ernst macht. Souverän,<br />
eloquent und unaufhaltsam auf<br />
dem Weg zu Bedeutung.<br />
(8) Ernährung und Verbraucherschutz<br />
Sarah Wiener. Ihre Lieblingsworte<br />
sind „Aggroindustrie“, gegen deren<br />
Methoden sie engagiert kämpft, und<br />
„Achtsamkeit“, nicht nur im Umgang mit<br />
unserer Umwelt und den Ressourcen.<br />
(9) Familie<br />
Marieluise Beck. Sie repräsentiert<br />
die Entwicklung der Grünen in den<br />
vergangenen 30 Jahren auf sympathische<br />
Weise. Glaubwürdig. Steht für ein modernes<br />
(14) Entwicklung<br />
Peter Eigen. Engagiert im Kampf<br />
gegen Korruption, Machtmissbrauch<br />
und Entwicklungsgefälle. Wäre<br />
auch ein fantastischer Bundespräsidentinnenehemann<br />
geworden.<br />
(15) Kultur<br />
Joseph Vogl. Besitzt einen intelligenten,<br />
zeitgemäßen und unkonventionellen<br />
Kulturbegriff, und er wird dem Land<br />
Ideen schenken, gute Gedanken und<br />
Debatten, die die Wichtigkeit der Kultur<br />
neuerlich bestimmen. Das ist nötig.<br />
(16) Integration<br />
Christian Wulff. Der Islam gehört<br />
zu Deutschland. Und auch das<br />
Recht auf eine zweite Chance.<br />
Katja Kraus, 42, war<br />
Fußballnationalspielerin.<br />
Danach wurde sie<br />
Managerin, bis 2011<br />
im Vorstand des<br />
Hamburger SV. Im<br />
Frühjahr gab sie ihr Debüt als <strong>Auto</strong>rin mit<br />
„Macht – Geschichten von Erfolg und Scheitern“<br />
Mit 4 Abbildungen | 256 Seiten<br />
Gebunden mit Schutzumschlag<br />
€ 19,99 / SFr 28.90 / € [A] 20,60<br />
ISBN 978-3-451-30753-9<br />
Gehard Schröder<br />
aus dem Vorwort:<br />
»<strong>Die</strong> unkonventionellen Vorschläge<br />
von Nicolas Berggruen<br />
und Nathan Gardels regen dazu<br />
an, über die Zukunft eines guten<br />
Regierens im 21. Jahrhundert<br />
zu diskutieren, frei und ohne<br />
Scheuklappen.«<br />
Neu in allen Buchhandlungen<br />
oder unter www.herder.de<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 45
| B e r l i n e r R e p u b l i k | M i l i t ä r<br />
Der Apparat<br />
frisst seine<br />
Minister<br />
Schon der Kauf von Strickmützen für die Soldaten ist ein<br />
schwieriger Akt. De Maizières Euro-Hawk-Debakel zeigt<br />
das komplexe System aus Militär, Ministerialbürokratie<br />
und Rüstungsindustrie. Lässt es sich überhaupt steuern?<br />
von Thomas Wiegold<br />
I<br />
n der Welt der Militärs gerät schon<br />
ein kleiner Einkauf zum Großprojekt.<br />
Vier Seiten widmete die Wehrbürokratie<br />
vor zwei Jahren einer<br />
wichtigen Neuerung: Im „System<br />
Ausstattung Soldat, Subsystem Ausstattung<br />
Soldat allgemein in der Fähigkeitskategorie<br />
Unterstützung und Durchhaltefähigkeit“<br />
erteilten die Beamten die Nutzungsgenehmigung<br />
– für eine neue Strickmütze.<br />
Natürlich nach Eignungsprüfung und<br />
Sichtung der Marktverfügbarkeit. <strong>Die</strong> „Anforderung<br />
zur Änderung“ der bisherigen<br />
Strickmütze lag da schon eine Weile zurück:<br />
knappe drei Jahre.<br />
Ob Kleinteil wie Strickmütze oder<br />
Großgerät wie ein neues Kriegsschiff oder<br />
etwas noch nicht Erprobtes wie eine Riesendrohne:<br />
<strong>Die</strong> Rüstung, quasi der Investitionshaushalt<br />
des Verteidigungsressorts, ist<br />
seit Jahrzehnten die Zeitbombe für jeden<br />
Ressortchef. Wie Thomas de Maizière im<br />
Fall der Drohne Euro Hawk übernimmt<br />
jeder neue Minister Altlasten seiner Vorgänger.<br />
Mit gut sieben Milliarden Euro machen<br />
die Anschaffungen <strong>vom</strong> Kampfjet bis<br />
zum Handschuh zwar noch nicht mal ein<br />
Viertel des jährlichen Verteidigungsbudgets<br />
aus. Doch die komplexe Beschaffung, die<br />
sich gerade bei Flugzeugen, Schiffen oder<br />
gepanzerten Fahrzeugen auch schon mal<br />
über Jahrzehnte hinzieht, kann keiner der<br />
meist nur wenige Jahre amtierenden Minister<br />
überblicken.<br />
Dennoch ist bislang noch kein Verteidigungsminister<br />
der Bundesrepublik über<br />
einen Rüstungsskandal in seiner Amtszeit<br />
gestolpert. Zwar mussten von den bislang<br />
16 Ressortchefs sieben zurücktreten oder<br />
wurden entlassen, die Gründe für den früheren<br />
Abgang hatten jedoch mit ihrem Verhalten<br />
zu tun – zum Teil auch dem privaten.<br />
Allerdings: Dass sie ihren Laden immer<br />
im Griff gehabt hätten, kann man selbst<br />
von den Ministern kaum sagen, die ihre<br />
normale Amtszeit hinter sich brachten.<br />
Und fast jeder versuchte sich an einer Reform,<br />
die stets die umfassendste und einstweilen<br />
letzte sein sollte – wie Rudolf Scharpings<br />
„Reform der Bundeswehr von Grund<br />
auf“ im Jahr 2000 oder Thomas de Maizières<br />
„Neuausrichtung“ elf Jahre später.<br />
Immer sollte es in den vergangenen<br />
zwei Jahrzehnten darum gehen, nach Ende<br />
des Kalten Krieges die Bundeswehr alter<br />
Prägung umzubauen zu der Armee, die in<br />
heutigen Zeiten benötigt wird – mit dem<br />
Material, das eine solche Truppe braucht.<br />
Der häufige Wechsel an der Spitze<br />
des Wehrressorts – allein in den vergangenen<br />
20 Jahren die sechs Minister Volker<br />
Rühe, Rudolf Scharping, Peter Struck,<br />
Franz Josef Jung, Karl-Theodor zu Guttenberg<br />
und Thomas de Maizière – führte allerdings<br />
dazu, dass kaum eine Reform zu<br />
Ende war, wenn die neue begonnen wurde.<br />
Als de Maizière im vergangenen Jahr die<br />
Liste der Standorte vorlegte, die mit der<br />
Verkleinerung der Bundeswehr geschlossen<br />
Illustration: Jens Bonnke<br />
46 <strong>Cicero</strong> 7.2013
werden, standen auch ein paar Restposten<br />
dabei: <strong>Die</strong> Schließung dieser Standorte<br />
hatte noch sein Vor-Vor-Vorgänger Struck<br />
beschlossen.<br />
Das versetzt nicht nur die Truppe in<br />
den permanenten Ausnahmezustand. Auch<br />
die Minister selbst und die Spitze des Ministeriums<br />
konnten und können kaum<br />
noch über alle Verästelungen im Geflecht<br />
von Reformen und Rüstungsprojekten auf<br />
dem Laufenden sein. <strong>Die</strong> Komplexität von<br />
Beschaffung und Betrieb wurde durch immer<br />
mehr Komplexität ersetzt. <strong>Die</strong> Verantwortlichkeiten<br />
gerade beim Kauf <strong>neuen</strong><br />
Geräts verschwammen so sehr, dass eine<br />
Kommission unter Vorsitz des Chefs der<br />
Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen<br />
Weise, von „organisierter Verantwortungslosigkeit“<br />
sprach.<br />
Am Ende vermittelten die meisten<br />
Amtsinhaber in den neunziger Jahren den<br />
Eindruck, dass sie ihren Laden nicht im<br />
Griff hätten. Ausgerechnet zwei Minister,<br />
die gegensätzlicher kaum sein könnten, waren<br />
unter den sechs Ressortchefs der vergangenen<br />
zwei Jahrzehnte eine Ausnahme:<br />
der CDU-Minister Volker Rühe, wegen<br />
seines ruppigen Umgangs auch als „Volker<br />
Rüpel“ geschmäht. Und der im vergangenen<br />
Jahr verstorbene SPD-Minister<br />
Peter Struck, der als „Soldatenkumpel“ in<br />
Erinnerung blieb.<br />
Was diesen beiden so unterschiedlichen<br />
Politikern an der Spitze des Verteidigungsministeriums<br />
gemeinsam war: Sie<br />
achteten darauf, dass sie <strong>vom</strong> Apparat nicht<br />
dumm gehalten wurden. Rühe mit harter<br />
Hand, Struck mit einer kollegial geführten<br />
Leitung aus Staatssekretären und Generalinspekteur,<br />
die auf ihn eingeschworen<br />
war. Vor allem aber pflegten beide Minister<br />
Frühwarnsysteme in den Verästelungen des<br />
Ministeriums. Dafür nutzten sie den sogenannten<br />
Planungsstab, der direkt dem<br />
Minister zugeordnet war. Unter Rühe verdiente<br />
sich sein Planungsstabschef Ulrich<br />
Weisser den teils respektvollen, teils spöttisch<br />
gemeinten Titel „Großadmiral“, unter<br />
Struck sorgten erst der spätere Generalinspekteur<br />
Wolfgang Schneiderhan und dann<br />
Franz Borkenhagen als Leiter dieses Stabes<br />
dafür, dass der Minister auf dem Laufenden<br />
blieb – wenn es sein musste, auch am<br />
<strong>Die</strong>nstweg vorbei.<br />
Ausgerechnet der bürokratische de<br />
Maizière strich den Planungsstab als Minister-Eingreiftruppe<br />
bei der vorerst letzten<br />
Reform ersatzlos. „Wer stellt jetzt die Hofnarren-Fragen?“,<br />
kritisiert ein enger Mitarbeiter<br />
eines früheren Verteidigungsministers.<br />
Wer hat den Überblick, um den Chef<br />
vor Fußangeln und Tretminen zu warnen?<br />
Da nützt es dem Ressortchef auch wenig,<br />
auf die formale Zuständigkeit seiner<br />
Staatssekretäre zu pochen und, wie de Maizière,<br />
das eigene Handeln am ebenso formalen<br />
Weg der Ministervorlagen auszurichten.<br />
Am Ende fragt die Öffentlichkeit<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 47
| B e r l i n e r R e p u b l i k | M i l i t ä r<br />
nicht nach Formalitäten, sondern nach<br />
dem, was passiert ist. Der Minister selbst<br />
trägt die politische Verantwortung – ganz<br />
egal, ob er über den <strong>Die</strong>nstweg informiert<br />
wird oder auf dem Flur von einem Vorgang<br />
hört.<br />
Im Wehrressort, klagt ein langjähriger<br />
interner Beobachter der Entscheidungsabläufe,<br />
fehle es seit Jahren vor allem an<br />
einem: an der Grundeinstellung, dass die<br />
Spitze gleich denkt und gemeinsam handelt.<br />
Ministeriumsspitze und Apparat zogen<br />
zunehmend an einem Strang, aber<br />
in verschiedene Richtungen. Obendrein<br />
nahm die Komplexität zu.<br />
Denn mit normalem Einkauf in einer<br />
Marktwirtschaft haben Rüstungsprojekte<br />
wenig bis gar nichts gemeinsam. Schon wer<br />
der Kunde im klassischen Sinne ist, steht<br />
gar nicht so genau fest: Wer das neue Gerät<br />
beschafft, ist nicht zwingend der, der entscheidet.<br />
Wer die Anforderungen an die<br />
Neuinvestition aufstellt, steht nicht zwingend<br />
in Kontakt mit jenen, die das Gerät<br />
eines Tages nutzen sollen.<br />
Lange Beschaffungsdauer, komplizierte<br />
Managementverfahren mit verteilten Verantwortlichkeiten<br />
und ein Spannungsfeld<br />
zwischen der zivilen Beschaffungsbürokratie<br />
und den uniformierten Nutzern sind<br />
noch nicht das ganze Problem. Kaum ein<br />
Produkt wird von der Stange beschafft, wie<br />
es die Industrie anbietet; fast immer will<br />
der Kunde – sprich: sowohl die Ministerialbürokratie<br />
als auch das Militär – etwas<br />
Neues, das erst neu oder umentwickelt werden<br />
muss. <strong>Die</strong> Industrie hat ein Interesse<br />
daran, ihre neuesten, vielleicht auch noch<br />
nicht ausgereiften Lösungen möglichst<br />
früh zu verkaufen, denn zwischen Entscheidung<br />
und Lieferung vergehen nicht<br />
selten Jahre oder sogar Jahrzehnte.<br />
Kauft die Bundeswehr einmal ein Produkt,<br />
das es schon gibt, muss es wenigstens<br />
angepasst werden. Das führte – und führt –<br />
bisweilen ins Absurde. Legendär sind die<br />
handelsüblichen AA-Batterien, massenhaft<br />
im Gebrauch von der Taschenlampe bis zur<br />
Nachtsichtbrille. Jahrzehntelang gab die<br />
Bundeswehr diese Verbrauchsgüter in militarisierter<br />
Form aus, im militärtypischen<br />
Dunkelgrün mit chromgelber Versorgungsnummer<br />
als Sonderanfertigung. Einmal in<br />
großer Menge gekauft, lagen sie jahrelang<br />
im Depot und landeten am Ende teuer<br />
und teilentladen bei der Truppe. Kleinere<br />
Panzer,<br />
Flugzeuge,<br />
Hubschrauber: Es<br />
kann passieren,<br />
dass die Beamten<br />
etwas anderes<br />
wollen als die<br />
Soldaten<br />
Posten Batterien aus dem Großhandel hätten<br />
es auch getan: Im Batteriefach des Geräts<br />
ist die Farbe nicht einmal zu erkennen.<br />
Das Hauptproblem ist allerdings der<br />
langwierige Prozess für die wirklich großen<br />
Dinge – <strong>vom</strong> ersten Konzept für ein<br />
Kampfflugzeug, einen Hubschrauber oder<br />
ein Panzerfahrzeug bis zum ersten echten<br />
Einsatz. <strong>Die</strong> Industrie verspricht nur zu<br />
gerne ein Produkt am „vorderen Ende der<br />
technologischen Entwicklung“, die sie sich<br />
<strong>vom</strong> Kunden, also dem Verteidigungsministerium,<br />
gut bezahlen lässt. Der Kunde<br />
tritt keineswegs einheitlich auf – was die<br />
Militärs als Anforderung ins Lastenheft<br />
schreiben, wird von den (zivilen) Beschaffern<br />
vielleicht ganz anders bestellt. Selbst<br />
unter den Uniformträgern nennen Heer,<br />
Luftwaffe und Marine bisweilen verschiedene<br />
Anforderungen. Doch aus den Problemen<br />
lernen die wenigsten, denn vor allem<br />
aufseiten der Soldaten wechseln die<br />
Zuständigen alle paar Jahre auf eine andere<br />
Stelle, oder, wie es militärisch heißt, in eine<br />
andere Verwendung.<br />
Wann, wo und von wem bei einem<br />
solchen Projekt ein Fehler gemacht wurde,<br />
ist ein Jahrzehnt später kaum noch nachvollziehbar.<br />
Schon zu Beginn in der Analyse-<br />
oder der Definitionsphase, als die ersten<br />
Ideen entwickelt wurden? Im Verlauf<br />
der Entwicklung, als neue Anforderungen<br />
hinzukamen, alte verworfen wurden? Bei<br />
der Planung für einen Vertrag, im Vertrag<br />
selbst – oder erst, als das ganze Vorhaben<br />
schon umgesetzt schien?<br />
Der „Boxer“, das neueste gepanzerte<br />
Transportfahrzeug der Bundeswehr, hat<br />
ein Gewicht von mehr als 30 Tonnen. Begonnen<br />
wurde die Idee, erzählte einst der<br />
frühere Heeresinspekteur Gert Gudera, mit<br />
den Planungen für ein 20-Tonnen-Fahrzeug,<br />
um den schnelleren Lufttransport in<br />
den Einsatz zu ermöglichen: „Dann macht<br />
jeder noch eine Öse dran, und schon sind<br />
wir bei 30 Tonnen.“<br />
Natürlich hat es unzählige Versuche<br />
gegeben, das zu ändern. „Auf dem Markt<br />
vorhandenes Material soll vorrangig nach<br />
marktüblichen Regeln beschafft, die Eigenverantwortung<br />
der ausführenden Unternehmen<br />
soll gestärkt werden“, verkündete<br />
im Januar 2002 Detlev Petry, der damalige<br />
Chef des für Beschaffungen zuständigen<br />
Amtes.<br />
Es blieb ein Wunsch. So ist die Beschaffung<br />
weiter ein sich selbst blockierendes<br />
System. De Maizières Debakel mit dem<br />
Euro Hawk ist noch nicht mal das teuerste<br />
Beispiel: Mit einem laut verkündeten<br />
„kommerziellen Ansatz“ hatten sieben<br />
Länder beim Hersteller Airbus Military aus<br />
dem Eads-Konzern das neue Transportflugzeug<br />
A400M geordert. Auf den vereinbarten<br />
„Festpreis“ von 20 Milliarden Euro für<br />
das Projekt legten die Bestellerländer 2010<br />
noch 3,5 Milliarden Euro drauf, weil der<br />
Hersteller Airbus Military aus dem Eads-<br />
Konzern auf politischer Ebene drohte, das<br />
Projekt abzubrechen. Bei der Bundeswehr<br />
sind die Maschinen, die ursprünglich 2011<br />
geliefert werden sollten, bis heute nicht angekommen.<br />
Thomas Wiegold<br />
zählt im Journalismus zu<br />
den besten Kennern der<br />
Bundeswehr. Er bloggt unter<br />
www.augengeradeaus.net<br />
Illustration: Jens Bonnke; Foto: Andrea Bienert<br />
48 <strong>Cicero</strong> 7.2013
anmelden und bewerben!<br />
www.querdenker.de<br />
JETZT<br />
Kongress & Award<br />
am 21./22.11.2013 in München<br />
vernetzt.nachhaltig.anders.<br />
Innovative Denkfabriken, intelligente Netzwerke und<br />
mobile Technologien neu denken.<br />
Ulrik Nehammer<br />
Vorsitzender des Vorstandes<br />
der Coca Cola AG<br />
Prof. Dr. Fredmund Malik<br />
Vorsitzender der Malik Management<br />
Zentrum St. Gallen AG<br />
Jürgen Hase<br />
Vice President M2M Competence Center<br />
der Deutschen Telekom AG<br />
Monika Rühl<br />
Leiterin Change Management & Diversity<br />
der Deutschen Lufthansa AG<br />
<strong>Die</strong> Ehrenpreise 2013 werden von<br />
Günther Jauch und Peter Maffay<br />
im Doppelkegel der BMW Welt<br />
persönlich entgegen genommen.<br />
Auch Sie können sich in sechs<br />
verschiedenen Kategorien für den<br />
QUERDENKER-Award bewerben!<br />
www.querdenker.de<br />
PREMIUM-Partner
| B e r l i n e r R e p u b l i k | M e i n S c h ü l e r<br />
„Nicht der sprudelnde Typ“<br />
Der Lehrer Helmut Kuhlmann musste Frank-Walter Steinmeiers<br />
Mutter erst überreden, den Sohn auf das Gymnasium zu schicken<br />
<strong>Die</strong> Schule, in der ich Frank-Walter Steinmeier unterrichtet habe,<br />
war eine richtige Dorfschule. Das war in Brakelsiek, 1963 bis<br />
1966, ich war sein Grundschullehrer von der zweiten bis zur vierten<br />
Klasse, Deutsch, Sachkunde, Mathe, Religion.<br />
Frank hat sich in seiner Art kaum geändert. Er ist heute nicht<br />
so der sprudelnde Typ, und das war er auch damals nicht. Ein<br />
zurückhaltendes Kind, ich würde sagen: bescheiden.<br />
Wenn gezankt wurde, war er eher nicht involviert.<br />
Stattdessen hat er Ruhe ausgestrahlt, und<br />
das hat der Klasse gutgetan. Er war auch intelligent,<br />
und man sah an seinen Bemerkungen, dass<br />
er was auf dem Kasten hat, aber er hat das nicht<br />
so ausgespielt. Wir hatten hin und wieder Treffen<br />
mit Lehrern von anderen Schulen. Für die gab es<br />
eine Vorführstunde mit meiner Klasse, und nach<br />
einer dieser Stunden sagte ein auswärtiger Kollege zu mir: „Also,<br />
dieser Frank, der ist wirklich etwas Besonderes.“ Einmal hat er<br />
einen kleinen Aufsatz geschrieben, es könnte das Thema „Glück<br />
gehabt, Pech gehabt“ gewesen sein. Dazu sollten die Kinder aufschreiben,<br />
was ihnen einfällt. Franks Text war ganz kurz, aber<br />
besonders pfiffig, an den genauen Inhalt erinnere ich mich leider<br />
nicht mehr.<br />
Meine Frau hat damals jeden Sonntag Kindergottesdienst in<br />
der Gemeinde gehalten, da kam der Frank auch. Sie hat ihn so<br />
erlebt wie ich: Auch wenn die Kinder überall herumwuselten und<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
nicht aufpassten, der Frank war konzentriert und hat bei den Bibeldiskussionen<br />
vernünftige Beiträge gebracht.<br />
Mit Frau Steinmeier, Franks Mutter, habe ich irgendwann ein<br />
Gespräch geführt, weil ich es zu schade fand, Frank einfach auf die<br />
Oberschule, also später die Hauptschule zu schicken. Der gehörte<br />
aufs Gymnasium. Seine Mutter sagte: „Können wir das denn machen,<br />
den Frank aufs Gymnasium nach Blomberg<br />
schicken? Ich kann ihm ja in den Fremdsprachen<br />
gar nicht helfen.“ Ich sagte: „Da habe ich keine Bedenken,<br />
der Frank schafft das auch alleine.“ Ein paar<br />
Tage später kam sie wieder und sagte: „Wir möchten<br />
das eigentlich nicht, das Risiko ist uns zu groß,<br />
und vielleicht ist er da dann der Einzige aus dem<br />
Dorf.“ Dann habe ich schweres Geschütz aufgefahren:<br />
„Frau Steinmeier, ich will Ihnen mal was sagen,<br />
wenn das mein Sohn wäre, ich würd das machen.“ Schließlich hat<br />
sie ihren Frank tatsächlich aufs Gymnasium geschickt.<br />
Vor einigen Jahren hat er in Detmold in der Stadthalle einen<br />
Vortrag gehalten. Danach haben wir uns unterhalten, und nach<br />
einem Viertelstündchen sagte er: „Ich muss jetzt noch ein bisschen<br />
weiter.“ Das fand ich auch in Ordnung, dass er nach einem<br />
so netten Gespräch seine Zeit ein wenig einteilt.<br />
In der <strong>Cicero</strong>-Serie „Mein Schüler“ zur Bundestagswahl spürt<br />
Constantin Magnis Lehrer unserer Spitzenpolitiker auf<br />
Der heutige SPD-<br />
Fraktionschef Frank-<br />
Walter Steinmeier in<br />
seiner westfälischen<br />
Heimat als etwa<br />
Zehnjähriger mit<br />
der Mannschaft <strong>vom</strong><br />
TuS Brakelsiek<br />
Foto: Tus/Schriegel/Picture Alliance/DPA; Grafik: <strong>Cicero</strong><br />
50 <strong>Cicero</strong> 7.2013
DIE ENTSCHEIDUNG DES JAHRES – BUNDESTAGSWAHL AM 22. SEPTEMBER<br />
Wer soll<br />
unser Land<br />
regieren?<br />
Auch als<br />
iPAD-APP<br />
und ePAPER<br />
erhältlich<br />
ALLE DUELLE, ALLE WAHLKREISE,<br />
ALLE ARGUMENTE<br />
Wie führen Merkel und Steinbrück ihre Kampagnen?<br />
Welche Strategien, welche Kniffe wirken? <strong>Cicero</strong> präsentiert<br />
die Akteure vor und hinter der Bühne, analysiert erstmals<br />
die Duelle in allen 299 Wahlkreisen und erklärt, vor welchen<br />
Maßnahmen sich keine Regierung in Zukunft drücken kann.<br />
Damit Sie im Wahlkampfsommer mitreden können und am<br />
22. September die richtige Entscheidung treffen.<br />
Das <strong>Cicero</strong>-Spezial zur Bundestagswahl 2013<br />
jetzt im Handel oder gleich hier bestellen –<br />
für Abonnenten versandkostenfrei!<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: www.cicero.de/spezial<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 988907
| B e r l i n e r R e p u b l i k | D i e D e u t s c h l a n d s t r a s s e<br />
Mit Käfer<br />
und Kamera<br />
<strong>Die</strong> B 1 durchschneidet Deutschland, von West<br />
nach Ost, <strong>vom</strong> Aachener Ortsteil Vaalserquartier<br />
bis zum Grenzübergang nach Polen bei Küstrin an<br />
der Oder. Sie erzählt Geschichten und Geschichte.<br />
Der Fotograf Philipp Jeske ist in<br />
seinem VW Käfer losgefahren. Ein Roadmovie<br />
Hameln.<br />
Drei Lebensgefühle<br />
in Deutschland:<br />
Heckspoiler,<br />
Cabrio, Käfer<br />
52 <strong>Cicero</strong> 7.2013
7.2013 <strong>Cicero</strong> 53
| B e r l i n e r R e p u b l i k | D i e D e u t s c h l a n d s t r a s s e<br />
1<br />
4<br />
7<br />
Essen<br />
Ein Schrei in Schnörkeln – und Gleichschritt in gedeckten Farben<br />
54 <strong>Cicero</strong> 7.2013
2 3<br />
5 6<br />
8 9<br />
1 Aachen; 2 Aachen; 3 Aachen; 4 Garzweiler; 5 Garzweiler; 6 Buderich; 7 Düsseldorf; 8 Essen; 9 Essen<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 55
| B e r l i n e r R e p u b l i k | D i e D e u t s c h l a n d s t r a s s e<br />
10<br />
11<br />
13<br />
14<br />
16<br />
17<br />
10 Essen; 11 Nahe Essen; 12 Dortmund; 13 Blomberg; 14 Soester Börde; 15 Hameln; 16 Hameln; 17 Nahe Hameln; 18 Nahe Braunschweig<br />
56 <strong>Cicero</strong> 7.2013
12<br />
15<br />
18<br />
Soester Börde<br />
Mein Zelt im Feld. Station neben der B 1 auf einem der fruchtbarsten Böden Deutschlands<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 57
| B e r l i n e r R e p u b l i k | D i e D e u t s c h l a n d s t r a s s e<br />
19<br />
22<br />
25<br />
Berlin<br />
Abfahrbereit auf dem Pariser Platz: Zwei Pferdestärken und ein Mops<br />
58 <strong>Cicero</strong> 7.2013
20 21<br />
23 24<br />
26 27<br />
19 Helmstedt; 20 Plaue; 21 Brandenburg an der Havel; 22 Nahe Brandenburg an der Havel;<br />
23 Potsdam; 24 Potsdam; 25 Berlin; 26 Berlin; 27 Berlin<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 59
| B e r l i n e r R e p u b l i k | D i e D e u t s c h l a n d s t r a s s e<br />
28<br />
29<br />
31<br />
32<br />
E<br />
ine Linie zieht sich durchs<br />
ganze Land. Blickt man auf<br />
eine Karte, auf der die Bundesstraße<br />
1 verzeichnet ist, fällt einem<br />
der Schnitt auf. Als ließe<br />
sich die Spitze Deutschlands wie der Kopf<br />
eines Frühstückseis einfach abnehmen,<br />
sodass man hineinschauen kann in dieses<br />
Land und seine historisch gewachsenen<br />
Befindlichkeiten.<br />
<strong>Die</strong> B 1 ist mehr als eine Straße, sie<br />
ist gelebte Geschichte. Sie führt nicht nur<br />
von West nach Ost, sondern quer durch die<br />
deutsche Historie. Sie reicht nämlich von<br />
Aachen bis nach Königsberg (dem heutigen<br />
Kaliningrad), von der Krönungsstadt<br />
Karls des Großen, bis zur Krönungsstadt<br />
Friedrichs des Großen.<br />
In Deutschland beginnt ihr Verlauf<br />
im Westen an der Grenze zu den Niederlanden<br />
– von Aachen bis zur polnischen<br />
Grenze an der Oder streckt sie sich. Eine<br />
Verbindung quer durchs Land ähnlich der<br />
viel besungenen Route 66 in den USA, die<br />
von Santa Monica an der Küste Kaliforniens<br />
über fast 4000 Kilometer bis nach<br />
Chicago führt.<br />
<strong>Die</strong> B 1 ist Teil der alten Straße, die<br />
Adolf Hitler im Zuge der Neuordnung<br />
des Reichsstraßenwesens zur Reichsstraße<br />
Nr. 1 machte. Sie war Deutschlands längste<br />
Straße: über 1392 Kilometer lang. <strong>Die</strong><br />
Bundesstraße und einstige Reichsstraße<br />
folgt in ihrem Verlauf einer alten Handelsroute<br />
der Römer. Vorläufer ist die „Via Regia“,<br />
eine ottonische Königsstraße, die von<br />
Aachen nach Magdeburg verlief und die<br />
im rheinisch-westfälischen Bereich auf den<br />
noch älteren „Hellweg“ zurückgeht.<br />
Um das Jahr 150 findet der Verlauf<br />
der heutigen B 1 in der „Geographike Hyphegesis“<br />
des griechischen Mathematikers<br />
und Astronomen Ptolemäus erstmals<br />
als eine alte Heer- und Handelsstraße Erwähnung.<br />
Bei eben jenem Ptolemäus, der<br />
die Erde in die Mitte seines geozentrischen<br />
Weltbilds schob. 1400 Jahre nach Ptolemäus<br />
entwarf Kopernikus sein heliozentrisches<br />
Weltbild, stellte die Erde als Scheibe<br />
und Mittelpunkt der Welt infrage und beschrieb<br />
eine Welt, die sich um die eigene<br />
Achse und die Sonne bewegte. Seine Statue<br />
befindet sich an der B 1 in Frombork<br />
in Polen, dem früheren Frauenburg. Dort<br />
wirkte Kopernikus als ermländischer Domherr.<br />
Im Rücken der Statue steht in seinem<br />
Schatten eine weitere Figur: Anna Schilling.<br />
Sie war die Haushälterin und Muse des großen<br />
Weltveränderers. Beide trennt die B 1.<br />
So ist die B 1 eine Straße voller Geschichte<br />
und Geschichten. Grund genug, ihr<br />
zu folgen. Von West nach Ost: Starten wir<br />
in Aachen, durchqueren die Jülicher Börde,<br />
fahren weiter entlang des Teutoburger<br />
Waldes und beschleunigen auf dem Ruhrschnellweg.<br />
Wir stoppen vielleicht beim<br />
Rattenfänger von Hameln oder bestaunen<br />
in Braunschweig Europas größte Quadriga,<br />
erfahren deutsch-deutsche Geschichte am<br />
60 <strong>Cicero</strong> 7.2013
28 Berlin<br />
29 Dahlwitz<br />
30 Seelow<br />
31 Plaue<br />
32 Polnische Grenze<br />
33 Endstation<br />
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> finden Sie auch in<br />
diesen exklusiven Hotels<br />
30<br />
Brenners Park-Hotel & Spa<br />
Schillerstraße 4 / 6, 76530 Baden-Baden<br />
Tel.: +49 (0)7221 900 0, www.brenners.com<br />
»Ein Grandhotel und Kultur sind unmittelbar miteinander<br />
verbunden. Deshalb freue ich mich, mit<br />
<strong>Cicero</strong>, dem Magazin für politische Kultur, unseren<br />
Gästen eine besonders hochwertige Publikation<br />
anbieten zu können.«<br />
FRANK MARRENBACH, GESCHÄFTSFÜHRENDER DIREKTOR<br />
33<br />
ehemaligen Grenzübergang Helmstedt-Marienborn<br />
oder schütteln den Kopf über die<br />
Hundertwasserhäuser in Magdeburg. Wir<br />
denken vielleicht an alte Agentenstreifen,<br />
während wir von Potsdam über die Glienicker<br />
Brücke fahren und sich plötzlich das<br />
urbane Berlin am Horizont auftürmt.<br />
Mitten durch Berlin geht es dann weiter.<br />
Auf der einstigen Stalinallee halten wir kurz<br />
im Café Sibylle, wo wir das linke Ohr und<br />
die rechte Schnauzbartspitze des gestürzten<br />
Stalindenkmals bewundern dürfen. Über<br />
die Oder, vorbei am Straßenstrich, geht es<br />
bis nach Küstrin, wo Friedrich der Große<br />
der Hinrichtung seines besten Freundes<br />
beiwohnte. <strong>Die</strong> Deutsche B 1 ist da längst<br />
zur polnischen DK 22 geworden. <strong>Die</strong><br />
Weichsel wird überquert, Marienburg, einst<br />
Hauptsitz des deutschen Ordens, passieren<br />
wir zur Linken, bevor im alten Königsberg<br />
die Reise endet und die B 1 hinter uns liegt,<br />
eine Achse europäischer Geschichte.<br />
Timo Stein<br />
<strong>Die</strong>se ausgewählten Hotels bieten <strong>Cicero</strong> als besonderen Service:<br />
Aachen: Pullman Aachen Quellenhof · Bad Doberan – Heiligendamm: Grand Hotel Heiligendamm · Bad Pyrmont:<br />
Steigenberger Hotel · Baden-Baden: Brenners Park-Hotel & Spa · Bad Schandau: Elbresidenz Bad Schandau Viva<br />
Vital & Medical SPA · Baiersbronn: Hotel Traube Tonbach · Bergisch Gladbach: Grandhotel Schloss Bensberg,<br />
Schlosshotel Lerbach · Berlin: Hotel Concorde, Brandenburger Hof, Grand Hotel Esplanade, InterContinental Berlin,<br />
Kempinski Hotel Bristol, Hotel Maritim, The Mandala Hotel, Savoy Berlin, The Regent Berlin, The Ritz-Carlton Hotel<br />
Binz/Rügen: Cerês Hotel · Dresden: Hotel Taschenbergpalais Kempinski · Celle: Fürstenhof Celle · Düsseldorf:<br />
InterContinental Düsseldorf, Hotel Nikko · Eisenach: Hotel auf der Wartburg · Essen: Schlosshotel Hugenpoet<br />
Ettlingen: Hotel-Restaurant Erbprinz · Frankfurt a. M.: Steigenberger Frankfurter Hof, Kempinski Hotel Gravenbruch<br />
Hamburg: Crowne Plaza Hamburg, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hotel Atlantic Kempinski, InterContinental<br />
Hamburg, Madison Hotel Hamburg, Panorama Harburg, Renaissance Hamburg Hotel, Strandhotel Blankenese<br />
Hannover: Crowne Plaza Hannover · Hinterzarten: Parkhotel Adler · Jena: Steigenberger Esplanade · Keitum/Sylt:<br />
Hotel Benen-Diken-Hof · Köln: Excelsior Hotel Ernst · Königstein im Taunus: Falkenstein Grand Kempinski, Villa<br />
Rothschild Kempinski · Königswinter: Steigenberger Grand Hotel Petersberg · Konstanz: Steigenberger Inselhotel<br />
Magdeburg: Herrenkrug Parkhotel, Hotel Ratswaage · Mainz: Atrium Hotel Mainz, Hyatt Regency Mainz<br />
München: King’s Hotel First Class, Le Méridien, Hotel München Palace · Neuhardenberg: Hotel Schloss Neuhardenberg<br />
· Nürnberg: Le Méridien · Potsdam: Hotel am Jägertor · Rottach-Egern: Park-Hotel Egerner Höfe, Hotel<br />
Bachmair am See, Seehotel Überfahrt · Stuttgart: Hotel am Schlossgarten, Le Méridien · Wiesbaden: Nassauer Hof<br />
ITALIEN Tirol bei Meran: Hotel Castel · ÖSTERREICH Lienz: Grandhotel Lienz · Wien: Das Triest · PORTUGAL<br />
Albufeira: Vila Joya · SCHWEIZ Interlaken: Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa · Lugano: Splendide Royale<br />
Luzern: Palace Luzern · St. Moritz: Kulm Hotel, Suvretta House · Weggis: Park Hotel Weggis, Post Hotel Weggis<br />
Möchten auch Sie zu diesem<br />
exklusiven Kreis gehören?<br />
Bitte sprechen Sie uns an:<br />
E-Mail: hotelservice@cicero.de
| W e l t b ü h n e<br />
Soldatin in Robe<br />
<strong>Die</strong> Staatsanwältin Ilda Boccassini lässt sich durch niemanden einschüchtern – auch nicht von Silvio Berlusconi<br />
von Petra REski<br />
S<br />
ie hat feuerrote Haare, liebt<br />
Schmetterlingsbrillen, kräftige<br />
Farben und Ohrgehänge, groß<br />
wie Kaffeetassen. Sie gibt keine Interviews,<br />
nimmt an keiner Talksshow teil und<br />
schreibt keine Bücher. Ihre Feinde nennen<br />
sie „Nutte“, wünschen ihr, an Krebs<br />
zu sterben und bedachten sie am diesjährigen<br />
Todestag ihres Freundes und Kollegen<br />
Giovanni Falcone mit einem anonymen<br />
Brief, darin zwei Projektile.<br />
Ilda Boccassini steht ganz oben auf<br />
der Hass-Skala gegen italienische Staatsanwälte<br />
– vulgo auch als „rote Roben“,<br />
„Terroristen“ oder „Jakobiner“ verteufelt,<br />
wenn nicht gar als „anthropologisch anders“<br />
(O- Ton Silvio Berlusconi). Seit mehr<br />
als 30 Jahren legt sich die Mailänder Staatsanwältin<br />
mit Mafiosi, korrupten Unternehmern,<br />
schmutzigen Politikern und käuflichen<br />
Richtern an. Zuletzt forderte sie im<br />
Mai dieses Jahres, Berlusconi sechs Jahre<br />
ins Gefängnis zu stecken und lebenslang<br />
von öffentlichen Ämtern auszuschließen.<br />
Seitdem regnet es wieder Hass auf „die rote<br />
Ilda“ – die den Lustgreis und Ex-Ministerpräsidenten<br />
im „Ruby-Prozess“ der Prostitution<br />
Minderjähriger und des Amtsmissbrauchs<br />
beschuldigt.<br />
Unter den Höflingen Berlusconis gehören<br />
Boccassini-Hasstiraden seit Jahrzehnten<br />
zum guten Ton: Kaum hatte die Staatsanwältin<br />
ihre Anklage verlesen, setzte sich<br />
Giuliano Ferrara, adipöser Chefredakteur<br />
der Berlusconi-Hauspostille Il Foglio, eine<br />
rote Perücke und eine Schmetterlingsbrille<br />
auf und sang zur Musik von Verdis Rigoletto<br />
von der „infamen Anklage der roten<br />
Ilda“ gegen seinen Herrn. Vittorio Sgarbi,<br />
Kunstkritiker, Berlusconi-Freund und<br />
Hysteriker von hohen Gnaden, wünschte<br />
gar, dass Ilda Boccassini mit „Arschtritten“<br />
aus der Staatsanwaltschaft ausgeschlossen<br />
werde, weil sie einen „kriminellen und<br />
grundlosen Prozess“ führe, dessen alleiniges<br />
Ziel darin bestehe, Berlusconi zu vernichten.<br />
Weil sich die italienischen Linken<br />
in einer Harmonieregierung mit Berlusconis<br />
PDL befinden, wollten auch sie nicht<br />
zurückstehen. Furchtlos bezichtigten sie<br />
Boccassini des Rassismus, weil sie in ihrer<br />
Anklage das Wort „orientalische Hinterlist“<br />
benutzt hatte, als es um die Lügen<br />
der marokkanischen Karima El Marough<br />
ging, die unter dem Namen „Ruby“ in<br />
Berlusconis Harem einen hoch dotierten<br />
Rang einnahm: Laut Abhörprotokoll soll<br />
dem Ex-Ministerpräsidenten das Schweigen<br />
der Marokkanerin mehr als vier Millionen<br />
Euro wert gewesen sein.<br />
Silvio Berlusconi, im Mai bereits in<br />
zweiter Instanz wegen Steuerbetrugs zu vier<br />
Jahren Haft und fünf Jahren Ausschluss von<br />
öffentlichen Ämtern verurteilt – in der Urteilsbegründung<br />
wird er als „Gewohnheitsverbrecher“<br />
bezeichnet –, gehört seit Jahrzehnten<br />
zu Ilda Boccassinis Stammkunden.<br />
Schon in den neunziger Jahren beschäftigte<br />
sich die Staatsanwältin mit ihm. Damals<br />
gehörte sie zum berühmten Mailänder Ermittlerpool,<br />
der den Korruptionsskandal<br />
„Mani pulite“ aufklärte, dessen Auswirkungen<br />
sämtliche etablierten Parteien Italiens<br />
in den Abgrund zog.<br />
Weil in Italien das Gattopardo-Prinzip<br />
(„Alles muss sich ändern, damit alles gleich<br />
bleibt“) herrscht – weshalb sich zwar die<br />
Namen der Parteien, nicht aber die Protagonisten<br />
der italienischen Politik ändern –,<br />
blieb der begabte Verbrecher Berlusconi der<br />
furchtlosen Ilda bis heute erhalten: Sie war<br />
es, die im Jahr 2003 Berlusconis Richterbestechung<br />
aufklärte. Sie war es auch, die<br />
ihn rettete, als sie vier Jahre später 15 Linksterroristen<br />
festnehmen ließ, die planten,<br />
Berlusconi umzubringen und sein publizistisches<br />
Hauptquartier in Mailand, die Redaktion<br />
seiner Tageszeitung Libero, in die<br />
Luft zu sprengen.<br />
Im Laufe ihrer Karriere hat die gebürtige<br />
Neapolitanerin, die sich selbst als Soldatin<br />
bezeichnet, keine Gelegenheit ausgelassen,<br />
sich Feinde zu schaffen, und das<br />
nicht nur unter Mafiosi und Mächtigen,<br />
sondern auch unter ihren Kollegen: Der<br />
Mailänder Generalstaatsanwalt warf ihr exzessiven<br />
Individualismus vor, der sie unfähig<br />
zur Teamarbeit mache, und schloss<br />
sie 1991 aus dem Ermittlerpool aus, der<br />
sich mit organisierter Kriminalität in Mailand<br />
beschäftigte. Da hatte Ilda Boccassini<br />
bereits das mafiose Beziehungsgeflecht in<br />
Norditalien aufgedeckt, die „Duomo Connection“,<br />
die über Freimaurer bis zur Familie<br />
des Sozialistenchefs Bettino Craxi<br />
reichte – im Alleingang, weil Ilda Boccassini<br />
einigen Kollegen nicht traute. Und daran<br />
auch keinen Zweifel ließ.<br />
Einer der wenigen, den die 63-Jährige<br />
schätzt, war der Antimafia-Staatsanwalt<br />
Giovanni Falcone aus Palermo, mit dem<br />
sie die „Duomo Connection“ aufklärte.<br />
Als er 1992 von der Mafia ermordet wurde,<br />
wachte sie an seinem Sarg. Und erinnerte<br />
bei seiner Gedenkfeier die ostentativ trauernden<br />
Kollegen daran, Falcone zu Lebzeiten<br />
im Stich gelassen zu haben.<br />
Kurz darauf ließ sie sich nach Sizilien<br />
versetzen, um die Ermittler in Caltanissetta<br />
bei der Aufklärung der Morde an Giovanni<br />
Falcone und seinem Kollegen Paolo Borsellino<br />
zu unterstützen. Auch hier wurde<br />
sie ihrem Ruf gerecht. Kurz bevor sie sich<br />
wieder nach Mailand zurückversetzen ließ,<br />
äußerte sie in einem Brief Zweifel an der<br />
korrekten Handhabe der pentiti, der mafiosen<br />
Kronzeugen: <strong>Die</strong> Verhöre müssten<br />
ausschließlich nach den „Normen des<br />
Strafgesetzbuchs“ geführt werden. Jahrzehnte<br />
später wurden ihre Zweifel bestätigt:<br />
Der Borsellino-Prozess musste neu<br />
aufgerollt werden, weil sich herausgestellt<br />
hatte, dass ein Kronzeuge von der Polizei<br />
unter Folter dazu gebracht wurde, eine Tat<br />
zu gestehen, die er nicht begangen hatte.<br />
Petra Reski, Journalistin<br />
und Schriftstellerin, lebt seit 1991<br />
in Venedig. Zuletzt erschien ihr<br />
Buch „Von Kamen nach Corleone<br />
– <strong>Die</strong> Mafia in Deutschland“<br />
Fotos: Getty Images, Paul Schirnhofer (<strong>Auto</strong>rin)<br />
62 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Ihre Feinde wünschen ihr<br />
den Krebs und senden ihr<br />
Projektile per Post. <strong>Die</strong><br />
Staatsanwältin Ilda Boccassini<br />
legt sich mit Mafiosi und<br />
schmutzigen Politikern an<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 63
| W e l t b ü h n e<br />
Obamas Ausputzer<br />
US-Justizminister Eric Holder steht in der Kritik. Ein Rücktritt kommt für ihn nicht infrage. Noch nicht<br />
von Christoph von Marschall<br />
V<br />
erkehrte Welt: Eric Holder steht<br />
plötzlich als Schurke da. Ausgerechnet<br />
die Republikaner werfen<br />
ihm Geheimnistuerei und staatliche Gängelung<br />
der Medien vor. Dabei galt der erste<br />
schwarze Justizminister der USA bisher<br />
eher als zu liberal. Er war der Musterschüler<br />
des progressiven Amerika und wurde<br />
gerne als Verkörperung erfolgreicher Minderheitenförderung<br />
präsentiert. Wenn so<br />
einer Gefahr läuft, über eine politische Affäre<br />
zu stolpern, dann wohl über einen zu<br />
laxen Umgang mit Staatsinteressen, sollte<br />
man denken.<br />
Nun ist es anders gekommen. Holder<br />
und sein Chef Barack Obama sehen sich<br />
mit dem Vorwurf konfrontiert, sie stünden<br />
für einen zu starken Staat. Obama hatte bei<br />
seinem Amtsantritt angenommen, die Republikaner<br />
würden ihn als Weichling attackieren,<br />
dem die nötige Härte fehle, um<br />
US-Bürger mit allen Mitteln vor Anschlägen<br />
zu schützen. So gab er sich „hart“ und<br />
ordnete an, das „Leaken“ geheimer Informationen<br />
auf Grundlage der „Maßnahmen<br />
zur Terrorabwehr“ gnadenlos zu verfolgen.<br />
Keinesfalls wollte er sich dem Vorwurf aussetzen,<br />
nachsichtiger als sein Amtsvorgänger<br />
George W. Bush zu sein.<br />
Gegen die erwartbaren Attacken hatte<br />
sich Obama gewappnet, nicht aber gegen<br />
die Vorwürfe, die jetzt gegen ihn erhoben<br />
werden. <strong>Die</strong> Republikaner halten ihm vor,<br />
er habe ein „imperiales“ Verständnis der<br />
Präsidentschaft und nehme – wie sein Justizminister<br />
– die Rechtfertigungspflicht gegenüber<br />
Kongress, Bürgern und Medien<br />
nicht ernst. <strong>Die</strong> Konservativen wollen die<br />
AP-Affäre nutzen, um Eric Holder zu stürzen<br />
und so den Machtwechsel im Weißen<br />
Haus vorzubereiten.<br />
<strong>Die</strong> Nachrichtenagentur AP hatte<br />
2012 über einen im Jemen geplanten und<br />
schließlich vereitelten Bombenanschlag auf<br />
ein US-Flugzeug berichtet – mit Details,<br />
die als vertraulich galten. Daraufhin leitete<br />
das Justizministerium eine Untersuchung<br />
wegen Verdachts des Geheimnisverrats ein<br />
und beschaffte sich Telefonverbindungsdaten<br />
von 20 AP-Reportern, ohne die Nachrichtenagentur<br />
darüber zu informieren.<br />
Verantwortlicher Minister: Eric Holder.<br />
In den USA ist dieses Vorgehen nicht<br />
zwingend illegal. <strong>Die</strong> gesetzlichen Vorgaben<br />
sind vage, veraltet und sagen nichts<br />
über den Umgang mit E-Mails und Mobiltelefonen.<br />
Dennoch könnte Holder stürzen<br />
– nicht über die Affäre selbst, sondern<br />
Eric Holder war der Muster schüler<br />
des progressiven Amerika<br />
über seine widersprüchlichen Angaben zu<br />
ihrer Aufklärung, die die Republikaner als<br />
„Lügen“ und „Vertuschungsversuche“ bezeichnen.<br />
Anfangs hatte der 62-Jährige erklärt,<br />
er sei nie persönlich mit Leak-Untersuchungen<br />
gegen Journalisten befasst<br />
gewesen. Später musste er zugeben, dass ein<br />
Dokument zur Überprüfung eines weiteren<br />
Reporters seine Unterschrift trägt. Glaubwürdigkeit<br />
sieht anders aus.<br />
<strong>Die</strong>ser Widerspruch reiht sich in eine<br />
immer länger werdende Folge von Skandalen<br />
und Affären ein, mit denen die Obama-<br />
Regierung zu kämpfen hat. Dazu gehört<br />
auch die verschärfte Überprüfung konservativer<br />
Gruppen durch die Steueraufsicht<br />
IRS. <strong>Die</strong> hatte beispielsweise Anträge<br />
auf Steuerbefreiung als gemeinnützige Organisation<br />
bis zu drei Jahre ohne Bescheid<br />
liegen gelassen. Stets im Fadenkreuz der<br />
Kritik: Eric Holder, der zugleich als Obamas<br />
Ausputzer die Krise managen soll.<br />
Der Jurist wirkt auch nach den jüngsten<br />
Anfeindungen sanft. Lässt sich aber<br />
nicht beirren und beharrt auf seinen Überzeugungen,<br />
die in den USA als links gelten:<br />
Terroristen will Holder vor zivile Strafgerichte<br />
stellen und nicht vor Militärkommissionen;<br />
er ist für die Homo-Ehe, gegen<br />
die Todesstrafe und schreitet früh ein,<br />
wenn er die Rechte von Minderheiten bedroht<br />
sieht.<br />
Holders Vater und seine Großeltern<br />
mütterlicherseits kamen aus Barbados<br />
in die USA. Dank Begabtenförderung<br />
konnte Holder, der im New Yorker Stadtteil<br />
Queens aufwuchs, eine herausragende<br />
High School in Manhattan besuchen und<br />
an der Columbia University Jura studieren.<br />
Nach zwölf Jahren im Justizministerium,<br />
wo er sich der Korruptionsbekämpfung<br />
widmete, beförderte ihn der republikanische<br />
Präsident Ronald Reagan 1988 zum<br />
Richter am Obergericht des Hauptstadtbezirks<br />
DC. Bill Clinton ernannte ihn 1993<br />
zum ersten schwarzen Staatsanwalt in Washington<br />
und 1997 zum Vize-Justizminister.<br />
Schon damals musste er seinen Kopf für<br />
den Chef hinhalten. Clinton ließ Holder<br />
die Begnadigung des Wahlkampfspenders<br />
und wegen Steuerhinterziehung angeklagten<br />
Marc Rich arrangieren. Später nannte<br />
Holder seine Rolle einen Missgriff.<br />
Auch in der AP-Affäre versucht der<br />
Top-Jurist die Gemüter zu beruhigen, indem<br />
er Fehler eingesteht. Sein Ministerium<br />
sei „zu weit gegangen“, sagt er und verspricht<br />
ein Gesetz, das Medien besser gegen<br />
Leak-Untersuchungen schützt.<br />
Ein Rücktritt kommt für ihn zu diesem<br />
Zeitpunkt nicht infrage, das sähe wie eine<br />
Niederlage aus. Holder ist für Obama wertvoller,<br />
wenn er die Affäre durch offensives<br />
Krisenmanagement übersteht. Erst danach<br />
darf der Justizminister gehen.<br />
Christoph von Marschall<br />
ist seit 2005 USA-Korrespondent.<br />
Von ihm erschien zuletzt: „Der<br />
neue Obama. Was von der zweiten<br />
Amtszeit zu erwarten ist“<br />
Fotos: Mike McGregor/Contour by Getty Images, Privat (<strong>Auto</strong>r)<br />
64 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Eric Holder galt als liberaler<br />
Saubermann. Jetzt hat<br />
sein Image die ersten<br />
Schrammen bekommen<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 65
| W e l t b ü h n e | T ü r k e i<br />
Götterdämmerung<br />
in Istanbul<br />
66 <strong>Cicero</strong> 7.2013
<strong>Die</strong> Bürger fordern ihren Regierungschef<br />
heraus. Sie sind Erdogans Selbstherrlichkeit<br />
und Bevormundung leid. Eine ganze Generation<br />
begehrt gegen den islamischen Paternalismus<br />
in der Türkei auf. Eine Zwischenbilanz<br />
von Frank Nordhausen<br />
<strong>Die</strong>ses Bild sah die ganze Welt: Ceyda<br />
Sungur, die „Frau in Rot“, protestierte,<br />
als ein Polizist ihr aus nächster Nähe<br />
Tränengas ins Gesicht spritzte. Heute<br />
hängen Plakate von ihr in ganz Istanbul<br />
Foto: Reuters<br />
D<br />
er Protest kam aus einer unerwarteten<br />
Richtung. Schon<br />
zweieinhalb Jahre kämpfte eine<br />
bunte Truppe von Stadtplanern,<br />
Architekten und Ökologen im<br />
Istanbuler Szene-Stadtteil Beyoglu gegen<br />
die Umwandlung ihres Kiezes in ein gesichtsloses<br />
Touristen- und Shoppingzentrum.<br />
<strong>Die</strong> Aktivisten des Netzwerks Taksim-<br />
Solidarität trafen sich einmal im Monat zu<br />
einer Demo, bei der es über den Taksim-<br />
Platz und durch die Fußgängerzone Istiklal<br />
Caddesi ging. Selten nahmen mehr als<br />
100 Unterstützer daran teil. Bis Ende Mai<br />
hatte Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan<br />
höchstwahrscheinlich noch nie von<br />
ihnen gehört.<br />
Als der Regierungschef Ende vergangenen<br />
Jahres persönlich ankündigte, in dem<br />
an den Taksim-Platz angrenzenden Gezi-<br />
Park ein Einkaufszentrum im Stil einer osmanischen<br />
Kaserne zu errichten, regte das<br />
die Bürger auf. „Es ist für sich genommen<br />
schon ein Unding, dass der Premier sich in<br />
die Stadtplanung einmischt. Vor allem aber<br />
ist dieser Park für Beyoglu lebenswichtig“,<br />
sagt Cem Hüzün. Der 46 Jahre alte Architekt<br />
ist einer der Gründer des Taksim-<br />
Netzwerks. „Der Park ist einer der letzten<br />
grünen Plätze im Stadtzentrum der europäischen<br />
Seite.“<br />
Am 28. Mai, einem <strong>Die</strong>nstag, erfuhr<br />
die Bürgerinitiative, dass Bagger anrückten,<br />
um im Gezi-Park Bäume zu fällen,<br />
obwohl Bebauungspläne dies nicht vorsahen<br />
und ein Gerichtsurteil es verbot. <strong>Die</strong><br />
Parkschützer alarmierten ihre Freunde und<br />
Bekannten über Telefonketten, Facebook<br />
und Twitter, und die Bauarbeiter sahen<br />
sich von nun an rund 150 Umweltschützern,<br />
Politikern, Architekten gegenüber,<br />
die sich vor ihre Bagger setzten, an die<br />
Bäume ketteten und Sit-ins veranstalteten.<br />
Um „unser Grün zu beschützen“, wie Architekt<br />
Hüzün sagt. Am frühen Morgen<br />
des 30. Mai schickte der Istanbuler Gouverneur<br />
erstmals die Polizei, um die lästigen<br />
Baumschützer zu vertreiben. Doch sie<br />
kamen wieder. In der folgenden Nacht saßen<br />
bereits mehr als 1000 Menschen im<br />
Park und riefen: „Gezi ist unser! Taksim<br />
ist unser! Istanbul ist unser!“<br />
Als die Polizei im Morgengrauen erneut<br />
und mit „exzessiver Gewalt“, wie es die<br />
amerikanische Regierung später formulieren<br />
sollte, gegen das Zeltcamp der Parkschützer<br />
vorging, als Wasserwerfer sprühten,<br />
Tränen- und Pfeffergasschwaden auf<br />
die Aktivisten niedergingen – da war dies<br />
der berühmte Tropfen, der das Fass überlaufen<br />
ließ. Bilder der Räumung verbreiteten<br />
sich rasch in den sozialen Netzwerken,<br />
und binnen weniger Stunden strömten<br />
Zehntausende meist junge Leute zum Taksim-Platz.<br />
Beißendes Tränengas hüllte sie<br />
ein, Hunderte wurden verhaftet – doch<br />
die Bürger hielten stand. Statt das Feuer<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 67
| W e l t b ü h n e | T ü r k e i<br />
zu löschen, fachte der Staat es an. In Windeseile<br />
verbreiteten sich die Proteste in der<br />
gesamten Türkei.<br />
Es war Sonnabend, der 1. Juni gegen<br />
16 Uhr, als die Polizei auf dem Taksim-<br />
Platz kapitulierte und einfach wegging. Zu<br />
diesem Zeitpunkt riefen die Demonstranten<br />
bereits: „Tayyip verschwinde!“ Sie protestierten<br />
nicht mehr nur für Bäume, sondern<br />
für die Freiheit, so zu leben, wie sie<br />
es wünschten. „Ich will nicht, dass mir der<br />
Regierungschef vorschreibt, wie ich mich<br />
anziehen, was ich essen und was ich nicht<br />
trinken soll, wie viele Kinder ich aufziehen<br />
und wie oft ich in die Moschee gehen<br />
muss“, sagt eine 28-jährige Anwältin<br />
auf dem Taksim-Platz. „Tayyip hat jeden<br />
Maßstab verloren.“<br />
Vor allem seit seinem dritten, überwältigenden<br />
Wahlsieg von 2011 trifft Erdogan<br />
politische Entscheidungen immer häufiger<br />
im Alleingang und richtet sie religiös aus.<br />
Er schränkte die Möglichkeiten zu Abtreibung<br />
und Kaiserschnitt ein, ließ ein rigoroses<br />
Anti-Alkohol-Gesetz verabschieden<br />
und integrierte das Koransystem in Schulen<br />
– ein Affront gegen die Grundfesten<br />
der laizistischen Republik. Kürzlich legte<br />
er den Grundstein für einen überdimensionalen<br />
Nachbau der berühmten Blauen<br />
Moschee auf dem Istanbuler Camlica-Hügel,<br />
um die größte säkulare Stadt der Türkei<br />
optisch zu beherrschen.<br />
sich später wieder erholen, aber spätestens<br />
zu diesem Zeitpunkt musste Premier Erdogan<br />
eigentlich gewarnt sein. Doch er verrannte<br />
sich in eine Krise, wie er sie in seiner<br />
zehnjährigen Regierungszeit noch nie<br />
erlebt hatte. Vier Tote, 17 Menschen, die<br />
ein Auge durch Gummigeschosse verloren,<br />
mehr als 5000 teils schwer Verletzte waren<br />
die unheilvolle Bilanz der ersten zwei Wochen<br />
des Aufstands.<br />
Im Staatsfernsehen und den großen<br />
Privatsendern wurden von nun an täglich<br />
Hunderttausende Demonstranten auf ein<br />
paar Hundert kleingerechnet. „Wir waren<br />
schockiert“, sagte Nihal Dag, eine 30-jährige<br />
Jurastudentin, die im Gezi-Park zeltete.<br />
„Unsere Medien haben die Wahrheit<br />
Atatürk. Hier fanden die großen politischen<br />
Versammlungen statt, hier schossen<br />
am 1. Mai 1977 Unbekannte von den<br />
Dächern auf eine Gewerkschaftskundgebung<br />
und töteten 34 Menschen. Hier<br />
fuhren drei Mal die Panzer der Putschgeneräle<br />
auf. Das liberale Istanbuler Bürgertum<br />
fühlt sich mit dem Taksim emotional<br />
stark verbunden.<br />
Recep Tayyip Erdogan wollte dem Platz<br />
daher schon immer seinen Stempel aufdrücken,<br />
wollte das Atatürk-Zentrum durch<br />
eine repräsentative Moschee ersetzen – der<br />
ultimative Triumph über die Säkularen.<br />
Das Vorhaben scheiterte letztlich daran,<br />
dass der forsche Ministerpräsident im letzten<br />
Moment stets davor zurückschreckte,<br />
Auf dem Taksim-Platz bekam es der megalomane<br />
Osmanen-Nostalgiker nun aber<br />
mit postmodern angehauchten Demonstranten<br />
zu tun, deren ironischem Witz er<br />
nicht ansatzweise gewachsen war. Jede Frau<br />
solle drei Kinder bekommen, hatte Erdogan<br />
gefordert. „Willst du wirklich drei von<br />
meiner Sorte?“, fragte eine Demonstrantin<br />
zurück. Erdogan beschimpfte die Protestierenden<br />
als „Marodeure“ – sie nahmen<br />
das Wort „Capulcular“ als stolze Selbstbezeichnung<br />
an und stellten auf dem besetzten<br />
Taksim-Platz „Capulcular-Bars“ auf, in<br />
denen sie Bier und Tequila ausschenkten.<br />
Von da an konnte Erdogan sagen, was<br />
er wollte – in unzähligen Karikaturen<br />
wurde er zur Spottfigur und verlor den<br />
Nimbus des Unverwundbaren. <strong>Die</strong> ausländischen<br />
Medien wurden hellhörig und verglichen<br />
den Taksim- mit dem Kairoer Tahrir-Platz,<br />
dem Symbol des Aufstands gegen<br />
den ägyptischen Diktator Hosni Mubarak.<br />
<strong>Die</strong> Istanbuler Börse brach ein. Sie sollte<br />
Recep Tayyip Erdogan konnte zwar Hunderttausende seiner Anhänger mobilisieren,<br />
aber auch dadurch will sich die neue Protestbewegung nicht einschüchtern lassen<br />
verschwiegen und Pinguinsendungen gezeigt,<br />
als sie über Tränengasangriffe hätten<br />
berichten müssen.“ Jetzt fragten sich die<br />
jungen Leute auf Facebook: „Haben uns<br />
die Medien über den Kurdenkonflikt jemals<br />
die Wahrheit gesagt?“ Auf dem Taksim-Platz<br />
standen fortan Kemalisten neben<br />
Kurden, Nationalisten neben Anarchisten<br />
in der Opposition gegen Erdogan – früher<br />
wäre das undenkbar gewesen.<br />
Es war ein Fehler des 59 Jahre alten<br />
Regierungschefs, die symbolische Bedeutung<br />
des Taksim-Platzes zu unterschätzen.<br />
<strong>Die</strong> gewaltige Freifläche ist das Herz der<br />
16-Millionen-Megacity und mit dem Republik-Denkmal<br />
sowie dem Atatürk-Kulturhaus<br />
eine in Beton gegossene Huldigung<br />
an den Vater der säkularen, westlich<br />
ausgerichteten Republik, Mustafa Kemal<br />
seinen Gegnern offen den Krieg zu erklären.<br />
Doch die Zeit der Zurückhaltung endete<br />
spätestens mit der jüngsten Wahl. „Ich<br />
bestimme die Tagesordnung der Türkei“,<br />
lautet seither Erdogans Diktum. Er möchte<br />
das Land zur Präsidialdemokratie machen,<br />
das Amt mit erweiterten Vollmachten versehen<br />
und sich 2014 zum Staatspräsidenten<br />
wählen lassen.<br />
Um besser zu verstehen, was den Erfolg<br />
dieses Mannes prägt, lohnt ein Besuch<br />
im konservativen Kleineleuteviertel<br />
Kasimpasa am Goldenen Horn. Hier ist<br />
er aufgewachsen, hier begann sein Aufstieg<br />
aus einfachsten Verhältnissen. Der<br />
Spross einer frommen Migrantenfamilie<br />
<strong>vom</strong> Schwarzen Meer, Absolvent einer islamischen<br />
„Imam-Hatip-Schule“, war erfolgreicher<br />
Fußballspieler, Student der<br />
Foto: Tolga Adanali/DDP Images/Sipa/Depo Photos<br />
68 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Wirtschaftswissenschaften, Geschäftsmann,<br />
Politiker, Häftling, Millionär, Premierminister.<br />
In Kasimpasa, nur eine halbe Stunde<br />
zu Fuß <strong>vom</strong> Taksim entfernt, protestiert<br />
niemand gegen die Regierung. „Tayyip ist<br />
ein guter Mensch, er ist gläubig. Wo wären<br />
wir ohne ihn?“, sagt ein 50-jähriger Elektromonteur<br />
vor der Hauptmoschee.<br />
Erdogan ermöglichte den einfachen<br />
Bürgern einen Lebensstandard, von dem<br />
sie früher nur träumen konnten. Neue<br />
Wohnung, <strong>Auto</strong>, Kühlschrank, Fernseher.<br />
Schöne Straßen, Wasser- und Stromleitungen,<br />
funktionierende Müllabfuhr.<br />
In Kasimpasa nimmt es dem Premier niemand<br />
übel, dass seine Familie inzwischen<br />
Milliarden Dollar besitzen soll, die laut<br />
„Der Premier<br />
hört auf<br />
niemanden<br />
mehr. <strong>Die</strong><br />
Macht hat ihn<br />
vergiftet“<br />
Mehmet Altan, Wirtschaftswissenschaftler<br />
und einst Unterstützer Erdogans<br />
Wiki leaks-Protokollen der US-Botschaft<br />
in Ankara auf Schweizer Konten gebunkert<br />
sind.<br />
Tatsächlich sitzt Erdogan so lange fest<br />
im Sattel, wie er seiner Stammklientel – Arbeiter,<br />
kleine Leute, das anatolische Bürgertum<br />
– eine stabile Wirtschaftsentwicklung<br />
und innere Sicherheit garantiert. Der Vater<br />
des türkischen Wirtschaftswunders will<br />
das Land bis zum 100. Republikgeburtstag<br />
2023 unter die zehn führenden Wirtschaftsnationen<br />
der Welt führen. Erste Meinungsumfragen<br />
zwei Wochen nach Beginn<br />
der Massenproteste zeigten, dass die völlig<br />
auf ihn zugeschnittene AKP landesweit stabil<br />
bei 50 Prozent der Stimmen steht.<br />
Seit mehr als zehn Jahren regiert Tayyip<br />
Erdogan jetzt die Türkei mit ihren 75 Millionen<br />
Einwohnern. Seine Partei gewann<br />
Ende 2002 mitten in einer tiefen Wirtschaftskrise<br />
und nach Jahren der Instabilität<br />
unter den etablierten Parteien die<br />
Parlamentswahlen. Doch konnte Erdogan<br />
erst am 12. März 2003 zum Ministerpräsidenten<br />
gewählt werden, nachdem per<br />
Verfassungsänderung ein Politikbann gegen<br />
ihn aufgehoben wurde. Der charismatische<br />
Redner, der seine ersten politischen<br />
Meriten in der Wohlfahrtspartei des islamistischen<br />
Ministerpräsidenten Necmettin<br />
Erbakan erwarb, machte sich als Oberbürgermeister<br />
von Istanbul einen Namen,<br />
als er die marode Infrastruktur der Stadt<br />
gründlich modernisierte. Aus jener Zeit<br />
stammt auch ein Gedichtzitat, das ihm<br />
1998 das Politikverbot eintrug und schon<br />
ahnen ließ, wes Geistes Kind er ist: „<strong>Die</strong><br />
Demokratie ist nur ein Zug, auf den wir<br />
aufspringen, bis wir am Ziel sind. <strong>Die</strong> Moscheen<br />
sind unsere Kasernen, die Minarette<br />
unsere Bajonette, die Kuppeln unsere<br />
Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.“<br />
Der begnadete Populist zerstreute<br />
Ängste vor einer „Gottesstaats-Agenda“<br />
aber zunächst mit einer pragmatisch orientierten<br />
Reformpolitik nach dem Motto:<br />
„leben und leben lassen“, die das Land<br />
gleichwohl tiefgreifend veränderte. Er<br />
schaffte die Todesstrafe ab, ließ Polizisten<br />
psychologisch schulen und wies das putschfreudige<br />
Militär in seine Schranken. Kurden<br />
wurde Sprachunterricht, Christen der<br />
Kirchenbau, Studentinnen das Tragen des<br />
Kopftuchs erlaubt. Als Lohn für die Demokratisierungsfortschritte<br />
eröffnete die<br />
EU Ende 2005 die Beitrittsverhandlungen.<br />
„Für uns hat Erdogans Politik einen ungeahnten<br />
wirtschaftlichen Aufschwung gebracht“,<br />
sagt Safak Civici, die zusammen<br />
mit ihrem Mann Ibrahim eine Möbelfirma<br />
in Kayseri in Mittelanatolien betreibt. Kayseri<br />
gehört zu jenen „anatolischen Tigerstädten“,<br />
die den wirtschaftlichen Aufschwung<br />
tragen, dem Tayyip Erdogan vor<br />
allem seine Popularität verdankt. <strong>Die</strong> AKP<br />
habe damals einen Überraschungssieg gelandet,<br />
„weil die Leute der alten Parteien<br />
überdrüssig waren“, sagt Civici. <strong>Die</strong> Inflation<br />
betrug 44 Prozent, der Staatsbankrott<br />
drohte. „<strong>Die</strong> Leute wollten frischen Wind.“<br />
Erdogan habe vor allem ökonomisch gepunktet.<br />
„Er hat die Krise erstickt und uns<br />
Märkte geöffnet. Unsere Leute gewannen<br />
Selbstbewusstsein“, sagt Safak Civici. „Und<br />
sie trauten sich zu zeigen, dass sie konservativ<br />
und religiös sind.“<br />
Erdogans Emotionalität, seine Sturheit,<br />
seine Einmischung in den Alltag kommen<br />
bei seinen wichtigen Zielgruppen ganz anders<br />
an als im aufgeklärten Istanbul. Ein<br />
Ereignis ist symbolhaft für das neue türkische<br />
Selbstbewusstsein: als Erdogan 2009<br />
beim Weltwirtschaftsforum in Davos<br />
nach einem heftigen Disput mit dem israelischen<br />
Staatspräsidenten Schimon Peres<br />
wütend das Podium verließ. „Unsere früheren<br />
Politiker waren Waschlappen. Aber Erdogan<br />
hat keine Angst vor niemand“, sagt<br />
Yunus Mert, Koch in einem Fischrestaurant<br />
in Kayseri.<br />
Erdogan ist ein großer Reformer, dem<br />
es anfangs auch gelang, viele Liberale für<br />
sich zu gewinnen wie den Istanbuler Wirtschaftswissenschaftler<br />
Mehmet Altan, einen<br />
bekannten Zeitungskolumnisten. „Erdogan<br />
machte die Türkei freier“, sagt Altan.<br />
„Er eröffnete den Menschen, die Atatürk<br />
links liegen gelassen hatte, neue Perspektiven<br />
– den Religiösen, den Minderheiten,<br />
dem anatolischen Bürgertum.“ Während<br />
es anfangs schien, als wolle er Atatürks säkulares<br />
Erbe der <strong>neuen</strong> Zeit anpassen, fand<br />
der Premier immer mehr Gefallen am autoritären<br />
Vermächtnis des „Türkenvaters“.<br />
Den türkischen Zentralismus hat Erdogan<br />
nicht angetastet und auch das Parteiengesetz<br />
nicht, das ihm erlaubt, innerhalb seiner<br />
Partei jeden Bewerber um ein Bürgermeisteramt<br />
oder ein Parlamentsmandat<br />
persönlich auszuwählen. Altan hat sich zuletzt<br />
enttäuscht von Erdogan abgewendet.<br />
„Der Premier hört auf niemanden mehr“,<br />
sagt er. „<strong>Die</strong> Macht hat ihn vergiftet.“<br />
„Es ist traurig, dass es in der Türkei<br />
keine Meinungsfreiheit mehr gibt“, sagt<br />
ein Istanbuler Bauunternehmer, der aus<br />
Angst vor der AKP seinen Namen nicht<br />
gedruckt sehen will. „Es könnte sein, dass<br />
ich dann keine Aufträge mehr bekomme“,<br />
sagt er und spricht von „rücksichtsloser<br />
Bereicherung Erdogans und seiner Clique“.<br />
Wer kein AKP-Mitglied sei, erhalte<br />
keine staatlichen Aufträge. Wer welche bekomme,<br />
der müsse zahlen. Für ihre Wahlkämpfe<br />
hat die Partei ungleich mehr Geld<br />
zur Verfügung als die Gegner. Dem Bauunternehmer<br />
macht das Angst. „Plötzlich<br />
sind überall Kopftuchfrauen. <strong>Die</strong> Kinder<br />
in den öffentlichen Schulen werden religiös<br />
indoktriniert. Und die Armee, die früher<br />
eingegriffen hat, ist völlig paralysiert“,<br />
sagt er. Spätestens seit Erdogans jüngstem<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 69
| W e l t b ü h n e | T ü r k e i<br />
„Macht, was ihr wollt,<br />
die Kaserne wird gebaut“<br />
Recep Tayyip Erdogan, türkischer Regierungschef<br />
Wahlsieg müsse das Land den Preis für die<br />
Alleinherrschaft der „Emporkömmlinge<br />
aus Anatolien“ zahlen.<br />
Doch im Regierungslager und in der<br />
AKP wagt niemand offenen Widerspruch<br />
gegen den „Sultan“. Erdogan muss vor allem<br />
darauf achten, die mächtige Bauindustrie<br />
des Landes und ausländische Investoren<br />
nicht durch innere Unruhen zu verschrecken.<br />
Ihnen verspricht der Premier nun,<br />
die geplanten Großprojekte weiter abzuwickeln,<br />
schließlich sei er demokratisch legitimiert.<br />
Das bezweifeln auch die meisten<br />
Demonstranten nicht, aber sie wünschen<br />
sich, dass ihre Stimme gehört wird.<br />
Der 27-jährige Dokumentarfilmer Can<br />
Tanyeli und die 28-jährige Jurastudentin<br />
Elif Aksayan haben sich seit Beginn<br />
an den Protesten gegen Erdogan beteiligt.<br />
„Wer in den Gezi-Park kommt, kann<br />
sehen, dass wir keine Chaoten sind. Wir<br />
räumen sogar den Müll sofort weg“, sagt<br />
Tanyeli. „Erdogan greift unsere Demokratie<br />
an, er benimmt sich wie ein Diktator.“<br />
Beide wohnen wie die meisten jungen Türken<br />
noch bei ihren Eltern und diskutieren<br />
derzeit viel mit ihnen. Ihre Eltern sind Liberale,<br />
die sich noch an die blutigen Straßenkämpfe<br />
erinnern können, denen der<br />
Militärputsch von 1980 folgte. „Sie haben<br />
Angst, dass es wieder so wird. Aber sie stehen<br />
voll hinter uns“, sagt Aksayan.<br />
Ein Riss geht durch die Türkei, er verläuft<br />
nicht zwischen Alt und Jung, sondern zwischen<br />
dem konservativen, anatolischen Osten<br />
und dem liberalen, nach Europa blickenden<br />
Westen. Im Gezi-Park artikuliert<br />
sich der Aufbruch einer gut ausgebildeten<br />
Babyboomer-Generation, die Mitsprache<br />
verlangt, individuelle Freiheit, die Rettung<br />
der gefährdeten Umwelt und lebenswerte<br />
Städte – ähnlich wie in der Bundesrepublik<br />
der siebziger und achtziger Jahre. Eine<br />
Massenbewegung zur Verteidigung der Demokratie<br />
ist entstanden, wie sie die Türkei<br />
noch nie gesehen hat.<br />
„Bäume retten ist wichtiger als Jeans<br />
kaufen“, sagen die Demonstranten, auf<br />
deren Idealismus und Engagement die Türkei<br />
stolz sein könnte. <strong>Die</strong> Masse der Protestler<br />
will keine Revolution, sondern verlangt<br />
vor allem Mitsprache, Rücksichtnahme auf<br />
die Umwelt und ein Ende der Polizeigewalt.<br />
Wie bei den Protesten gegen die Startbahn<br />
West in Deutschland reagiert die etablierte<br />
Politik mit Unverständnis, Ignoranz und<br />
mit Härte. Anders als vor 30 Jahren in der<br />
Bundesrepublik aber werden die türkischen<br />
Protestler von einem großen Teil ihrer Eltern<br />
unterstützt.<br />
Statt auf die jungen Leute zuzugehen<br />
und das Land zu versöhnen, ließ Erdogan<br />
die Polizei tagelang Tränengas auf Teenager<br />
schießen. „Macht, was ihr wollt, die Kaserne<br />
wird gebaut“, rief er den Demonstranten<br />
zu. Doch sein Versuch, den Taksim-Platz<br />
mit der Hilfe von Polizei und<br />
Provokateuren zu „säubern“, scheiterte am<br />
11. Juni an der überwältigenden Solidarität<br />
der Demonstranten. Es ist ein historisches<br />
Paradox, dass ausgerechnet Erdogan<br />
auf dem besten Weg ist, die „marginalen<br />
Gruppen“ der türkischen Linken, Liberalen<br />
und Minderheiten politisch zu vereinen.<br />
Berühmt geworden ist ein Foto <strong>vom</strong><br />
Taksim-Platz, das zeigt, wie ein PKK-Anhänger<br />
eine junge Frau mit Atatürk-Fahne<br />
aus dem Strahl eines Wasserwerfers rettet,<br />
während im Hintergrund ein weiterer Demonstrant<br />
den Wolfsgruß der rechtsnationalistischen<br />
MHP zeigt.<br />
In der Not flüchtete sich der Ministerpräsident<br />
in haltlose Diffamierungen<br />
und die abgegriffenste Verschwörungstheorie<br />
überhaupt. Mehrfach erklärte er,<br />
hinter den Protesten stecke die „internationale<br />
Zinslobby“, die an einer abstürzenden<br />
türkischen Wirtschaft verdienen wolle.<br />
<strong>Die</strong> antisemitische Vorlage wurde von Erdogans<br />
Anhängern verstanden und millionenfach<br />
weitergetragen. Doch wer sehen<br />
wollte, sah einen Mann, der täglich mehr<br />
sein Gesicht verlor. Der Premier, der sein<br />
Land so erfolgreich reformiert hat, zeigte<br />
sich seiner Aufgabe nicht mehr gewachsen.<br />
Am 14. Tag des Aufruhrs, einem Freitag<br />
um zwei Uhr morgens, hielten die Protestler<br />
auf dem Taksim-Platz, in Ankara und Antalya<br />
den Atem an. Es war der Moment, als<br />
Erdogans „letzte Warnung“ an die Demonstranten<br />
ablief, nach Hause zu gehen oder<br />
sie „mit voller Härte“ abzuräumen. Doch<br />
dann geschah – nichts. <strong>Die</strong> Polizisten setzten<br />
ihre Helme ab, viele gingen schlafen.<br />
Erdogan hatte überraschend eingelenkt. Er<br />
hatte sich sogar persönlich mit einer Abordnung<br />
des Taksim-Netzwerks getroffen<br />
und beschlossen, die endgültige Entscheidung<br />
über den Gezi-Park den Gerichten zu<br />
überlassen; falls das Berufungsgericht gegen<br />
die Osmanenkaserne entscheide, werde<br />
sie eben nicht gebaut. Plötzlich wurden die<br />
vormaligen „Marodeure“ als „besorgte Umweltschützer“<br />
bezeichnet.<br />
Inzwischen haben „die Marodeure“ aber<br />
doch noch die Härte und Häme des Regierungschefs<br />
zu spüren bekommen. Am<br />
15. Juni wurde der Taksim-Platz schließlich<br />
brutal geräumt. Erdogan verhöhnte<br />
die Demonstranten bei einer Kundgebung<br />
vor Hunderttausenden seiner Anhänger in<br />
Istanbul.<br />
In der Krise wirkt der mächtige Erdogan<br />
trotz aller Machtdemonstration wie ein<br />
Kaiser ohne Kleider. Wie ein Mann, der<br />
bislang so stark aussah, weil er noch nie mit<br />
einer ernst zu nehmenden Opposition konfrontiert<br />
war; die kemalistische Oppositionspartei<br />
CHP ist zerstritten und schwach.<br />
Deshalb ist nun die spannendste Frage, ob<br />
sich aus der Taksim-Gezi-Bewegung eine<br />
politische Opposition formt wie damals in<br />
Deutschland die Grünen.<br />
Ironischerweise hat Erdogan die heillos<br />
zerstrittenen „marginalen Gruppen“<br />
zusammengeführt und mit seiner Attacke<br />
auf den modernen Lebensstil eine ganze<br />
Generation auf die Straße gebracht.<br />
Wird diese Zivilgesellschaft es nun<br />
schaffen, aus dem Straßenprotest eine alternative<br />
Politik mit nichtkontaminierten<br />
Repräsentanten zu entwickeln? Nach<br />
zwei Wochen Aufruhr fehlte den Aktivisten<br />
noch der Wille dazu, vielleicht auch<br />
die Vorstellungskraft und eine charismatische<br />
Führungsfigur. Aber das Spiel hatte<br />
ja auch gerade erst begonnen.<br />
Frank Nordhausen<br />
lebt seit mehreren Jahren in<br />
Istanbul. Seither versucht er, das<br />
System Recep Tayyip Erdogan zu<br />
ergründen<br />
Foto: privat<br />
70 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Diktatur à la turque<br />
Warum Recep Tayyip Erdogan das Musterbeispiel für einen modernen <strong>Auto</strong>kraten ist<br />
von William J. Dobson<br />
Illustration: jan rieckhoff; Foto: Travis Daub<br />
W<br />
ährend der vergangenen<br />
zehn Jahre war Recep<br />
Tayyip Erdogan das leuchtende<br />
Vorbild moderner <strong>Auto</strong>kraten.<br />
Um seinen Herrschaftsanspruch<br />
zu untermauern, hat er<br />
mehr Journalisten verhaften lassen als die<br />
chinesische KP; seine politischen Verbündeten<br />
haben einen Großteil der türkischen<br />
Medien unter ihrer Kontrolle; er greift auf<br />
drakonische Gesetze wegen Beleidigungstatbeständen<br />
zurück, um seine Gegner<br />
einzuschüchtern. Mehr als 700 Oppositionelle<br />
– darunter Politiker, Generäle, Aktivisten<br />
und Gelehrte – sitzen im Gefängnis.<br />
Außerdem reagiert er auf öffentliche<br />
Proteste mit Tränengas und Wasserwerfern,<br />
wie die Weltöffentlichkeit in den vergangenen<br />
Wochen erleben durfte.<br />
Aber Diktatoren brauchen keine Nachhilfe,<br />
wenn es darum geht, wie man für<br />
Ruhe auf den Straßen sorgt oder Feinde<br />
wegsperrt. Was die autoritären Herrscher<br />
des 21. Jahrhunderts dagegen am türkischen<br />
Premierminister bewundern, ist<br />
dessen Fähigkeit, seinen Machtanspruch<br />
in ein demokratisches Gewand zu kleiden.<br />
Unabhängig davon, wie unerbittlich sein<br />
Regime auftritt, ist Erdogan ein populärer,<br />
demokratisch und mit großen Mehrheiten<br />
gewählter Anführer. Dafür gibt es<br />
gute Gründe: <strong>Die</strong> Bosporusregion boomt,<br />
das Pro-Kopf-Einkommen in der Türkei<br />
hat sich in der zurückliegenden Dekade<br />
verdreifacht, Exporte florieren, und die<br />
Staatsfinanzen haben sich deutlich verbessert.<br />
Istanbul wurde zum Standort multinationaler<br />
Unternehmen wie Microsoft<br />
oder McKinsey. Außerdem plant Erdogan<br />
den Bau eines zehn Milliarden Dollar teuren<br />
Megaflughafens, dem größten der Welt.<br />
Kurzum, Erdogan ist das leuchtende<br />
Beispiel für einen bemerkenswerten Trend<br />
in der internationalen Politik: der Aufstieg<br />
der <strong>neuen</strong> <strong>Auto</strong>kraten. Anstatt ihre Länder<br />
in Polizeistaaten zu verwandeln, machen<br />
sich moderne Diktatoren Steuerbehörden,<br />
Gesundheitsämter oder Rechtsanwälte zunutze,<br />
um Dissidenten kleinzukriegen. Sie<br />
berufen sich in ihren Reden auf die Demokratie,<br />
verwenden das Recht aber wie eine<br />
Waffe gegen ihre Gegner. Aus der Entfernung<br />
wirken sie beinahe wie Demokraten.<br />
Aber je näher man ihnen kommt, desto<br />
deutlicher wird, dass sie die brutalen Formen<br />
der Unterdrückung lediglich gegen<br />
weniger harsch erscheinende Zwangsmechanismen<br />
eingetauscht haben.<br />
Erdogans Wahlerfolge sind unbestreitbar.<br />
Doch er hat seine Mehrheiten dazu benutzt,<br />
um sämtliche Institutionen auszuhebeln,<br />
die seinem Machtanspruch gefährlich<br />
werden könnten. Der türkische Premierminister<br />
schüchtert alle ein, die die Regierung<br />
zur Rechenschaft ziehen wollen. Deshalb<br />
hat er so viele Journalisten verhaften<br />
lassen, deshalb tritt er die Zivilgesellschaft<br />
und Nichtregierungsorganisationen mit<br />
Füßen, deshalb besetzt er das Justizwesen<br />
mit Gefolgsleuten. Erdogan erinnert stark<br />
an den verstorbenen Hugo Chávez, auch<br />
so ein demokratisch legitimierter <strong>Auto</strong>krat.<br />
Beide wurden regulär gewählt, um dann im<br />
Amt die Demokratie ihres Kernes zu berauben.<br />
Im Unterschied zu Chávez ist Erdogan<br />
aber eher ein Technokrat mit einer<br />
deutlich erfolgreicheren Wirtschaftspolitik.<br />
Doch Erdogans Bild eines gemäßigten<br />
<strong>Auto</strong>kraten gerät nun ins Wanken. Das<br />
brutale Vorgehen seines Regimes gegen<br />
die Demonstranten im Gezi-Park und auf<br />
dem Taksim-Platz stellen seine Herrschaft<br />
vor die größte Bewährungsprobe seit zehn<br />
Jahren. Anstatt mäßigend auf die Protestbewegung<br />
einzuwirken, hat er das Feuer noch<br />
zusätzlich angefacht, indem er am 15. Juni<br />
die Polizeikräfte brutal mit Tränengas,<br />
Gummigeschossen und mit Chemikalien<br />
versetzten Wasserstrahlen gegen die letzten<br />
Demonstranten im Gezi-Park hat vorgehen<br />
lassen. Tags darauf hielt er eine anfeuernde<br />
und unversöhnliche Rede vor Tausenden<br />
seiner Anhänger, in der er die aufbegehrenden<br />
Bürger erneut als „Plünderer“, „Kriminelle“<br />
und „Extremisten“ bezeichnete, die<br />
von Terroristen gesteuert seien.<br />
Erdogan wird seine polarisierende Rhetorik<br />
vielleicht noch bereuen. Andere moderne<br />
<strong>Auto</strong>kraten – Wladimir Putin etwa<br />
oder der malaysische Premierminister Najib<br />
Razak – hätten ihm womöglich geraten,<br />
weniger inkonziliante Formulierungen<br />
zu wählen. Erdogans konfrontative<br />
Taktik hat aus der Türkei ein gespaltenes<br />
Land gemacht, in dem sich beide Seiten<br />
mit gärendem Groll gegenüberstehen. Das<br />
könnte die Grundlage sein für weitere Proteste,<br />
Zusammenstöße und vielleicht noch<br />
weit Schlimmeres.<br />
Aber Erdogan beruft sich auf seine<br />
Popularität bei der eigenen Anhängerschaft.<br />
Würde er sich heute zur Wahl stellen,<br />
könnte er sich eines Sieges sicher sein.<br />
Dennoch sollte der moderne türkische <strong>Auto</strong>krat<br />
auf der Hut sein. Noch vor kurzer<br />
Zeit wäre es kaum vorstellbar gewesen, dass<br />
Hunderttausende Türken auf die Straßen<br />
gehen, um ihre Stimmen gegen seine Herrschaft<br />
zu erheben. Seine Alleinherrschaft<br />
mag bestehen bleiben – aber sie wird nie<br />
wieder dieselbe sein wie zuvor.<br />
William J. Dobson<br />
ist Außenpolitik-Chef des<br />
Online-Magazins Slate und<br />
<strong>Auto</strong>r des Buches „The Dictator’s<br />
Learning Curve“<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 71
| W e l t b ü h n e | P h ä n o m e n F e m e n<br />
Nackte Tatsachen<br />
Femen-Frauen scheuen keine Konfrontation. Auch nicht, wenn sie in einem tunesischen<br />
Gefängnis landen, wie jüngst die Deutsche Josephine Witt. Für ihre Überzeugungen<br />
kämpfen die Aktivistinnen mit blankem Körpereinsatz. Ungeachtet wachsender Kritik<br />
von Sabine Adler<br />
72 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Kampfbereit: Im<br />
„Lavoir Moderne<br />
Parisien“ in<br />
Paris trainieren<br />
die Femen für<br />
ihren Einsatz<br />
Foto: Leo Novel/Corbis<br />
W<br />
enn Inna Schewtschenko<br />
an der U-Bahn-Station<br />
Barbès-Rochechouart aussteigt,<br />
folgen ihr sämtliche<br />
Blicke. Munter hüpft<br />
sie die Treppen herunter, aber ihr Gesicht<br />
ist ernst, fast finster. In der Öffentlichkeit,<br />
erst recht auf Fotos ist für Femen Lachen<br />
streng verboten! Oben rauschen die Metrozüge<br />
auf der Hochbahn weiter, unten am<br />
Ausgang der Station teilt sich die Gruppe<br />
Schwarzafrikaner für die junge Frau mit<br />
der blonden Mähne. Sie starren ihr nach,<br />
auch wegen der makellosen langen Beine<br />
in den roten Shorts. Sie tut, als nehme sie<br />
niemanden zur Kenntnis. Den Blick aufs<br />
Pflaster geheftet, rennt sie den Boulevard<br />
Barbès hinauf, biegt in die Rue Myrha. Als<br />
sie vor wenigen Monaten nach Paris kam,<br />
glaubte sie, in eine andere Welt zu kommen.<br />
Aber auch hier pfeifen ihr die Kerle<br />
hinterher, machen sie an, versuchen, sie<br />
zu begrapschen.<br />
„In der Ukraine behandelt man Frauen,<br />
zumal junge, so und noch viel schlimmer“,<br />
sagt Schewtschenko. „Ukrainische Mädchen<br />
sind arm, ungebildet und sehr schön.<br />
Für Menschenhändler, Zuhälter gelten sie<br />
als extrem billige Arbeitskräfte, mit denen<br />
sich eine Menge Geld verdienen lässt. Jede<br />
Minute verschwindet ein Mädchen.“ Deswegen<br />
kämpften die Femen in der Ukraine<br />
anfangs gegen Sextourismus, Prostitution<br />
und Mädchenhandel.<br />
Doch Schewtschenkos Biografie<br />
scheint allem, was sie ihrer Heimat vorwirft,<br />
zu widersprechen. Sie stammt aus<br />
Hirsson, einem kleinen Ort im Süden<br />
der Ukraine, nahe der Krim. Sie hat ein<br />
Universitätsstudium (Journalistik) absolviert,<br />
bekam danach sofort eine Stelle. In<br />
Frankreich, im Westen, wo sie glaubte, alles<br />
sei ganz anders, erlebt sie keinen Tag,<br />
an dem sie nicht genauso wie in Kiew belästigt<br />
wird. So lautet die Schlussfolgerung<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 73
| W e l t b ü h n e | P h ä n o m e n F e m e n<br />
der 22-Jährigen: Frauen sind nirgendwo<br />
frei, sie werden von drei Feinden bedroht –<br />
Diktaturen, der Religion und der Sexindustrie.<br />
Eine Revolution müsse her, erstmals<br />
eine von Frauen angezettelte.<br />
Schewtschenkos Arbeitsweg führt sie<br />
durch Paris’ afrikanisch-arabische Viertel.<br />
Friseur- und Kosmetikläden für die<br />
schwarze Kundin, der Goldhändler, die<br />
Reisebüros, die Schlachter, die Lamm- und<br />
Hammelfleisch feilbieten, Gemüseläden mit<br />
Süßkartoffeln, vor allem aber die Erdnussverkäufer,<br />
die auf dem engen Bürgersteig<br />
in Blechtonnen Nüsse rösten. Der Kontrast<br />
könnte kaum größer sein: <strong>Die</strong> blonde<br />
Schönheit eilt im Sturmschritt vorbei an gemütlich<br />
schwatzenden Afrikanern vor den<br />
Teestuben. Endstation Rue Léon.<br />
Vor einem Szenetheater wartet eine<br />
Gruppe Frauen. Erstmals hellt sich Innas<br />
Gesicht auf. Sie schließt die Stahltür auf,<br />
drinnen umarmen sich die Frauen, Küsschen<br />
rechts, links, Lachen. Sie stürmen die<br />
Holztreppe zum ersten Stock hinauf. Hier<br />
ist ihr Reich! Ein 20 Meter langer Raum<br />
mit niedriger Decke. Trainingssaal und<br />
Versammlungsraum. Innas Arbeitsplatz.<br />
„Femen – New Feminism“, „Femen is the<br />
ideology of sextremism“, „No sharia“ steht<br />
an den Wänden. Dazu lebensgroße Zeichnungen<br />
von barbusigen Frauen mit Blumenkränzen<br />
auf den Köpfen und bemalten<br />
Oberkörpern: „No religion“, „No dictatorship“.<br />
Eindeutig Porträts der Frauen, die<br />
hier gleich schwitzen werden. Eine Mittdreißigerin,<br />
höchstens 1,55 Meter groß,<br />
<strong>vom</strong> Handrücken bis zu den Schulterblättern<br />
tätowiert, kurzer Bürstenhaarschnitt,<br />
harte Züge. Ganz anders die sanfte Sarah<br />
mit den pinkfarbenen Lippen im runden<br />
Schneewittchengesicht, der ihr langes<br />
dunkles Haar glatt über die Schultern fällt.<br />
Ihr hat die Zeichnerin ein Schild in die<br />
Hände gemalt, auf dem „Not A Sex Toy“<br />
steht. Sarahs ebenmäßige Schönheit gäbe<br />
eine gute Vorlage für eine Barbie-Puppe ab,<br />
eben jenes Spielzeug, das ihre deutschen<br />
Kampfgenossinnen aus den Kinderzimmern<br />
verbannt wissen möchten.<br />
<strong>Die</strong> 20 Frauen traben im Laufschritt.<br />
Zehn Runden. Alle hören auf Inna: „Liegestütze!<br />
Erst mal zehn, 100 heute insgesamt!<br />
Sit-ups! One, two, three … Ab zehn zählen<br />
sie französisch weiter, kichern: onze, douze,<br />
treize. 100 Mal – sofort – die Fäuste auf<br />
und zu. Ende des Warm-ups. Aufstellung<br />
in Doppelreihe. Jede nimmt ihre Gegenüber<br />
Huckepack, macht 20 breitbeinige<br />
Kniebeugen. Wechsel. Schweres Schnaufen.<br />
Dann treten sie einzeln vor die Gruppe,<br />
mit Plakat über dem Kopf. „Fuck your morals“,<br />
ruft die erste. „Free Amina“, fallen die<br />
anderen ein. <strong>Die</strong> Übung: Doppel-Slogans.<br />
„Go undressed and win – Pop no more.“<br />
Schreien strengt die Stimmbänder an, alle<br />
husten. Weiter: 20 Mal „Pop no more –<br />
basta Berlusconi“, dann: „Pop no more –<br />
in gay we trust.“ Geübt wird, bis der Chor<br />
klappt, wirklich alle mit einer Stimme rufen,<br />
keine nachklappt, sonst kommt die<br />
Botschaft stümperhaft rüber. Sie haben<br />
nur Sekunden. Wenn überhaupt. Den Petersdom<br />
im Vatikan durften sie nicht einmal<br />
betreten. Der Sicherheitsdienst griff sie<br />
draußen auf dem Platz ab. Da hatte noch<br />
keine ein Plakat gezückt oder die Jacke<br />
abgeworfen. Schewtschenko ist überzeugt,<br />
dass ihre Fotos auf informellen Fahndungslisten<br />
europäischer Sicherheitsdienste kursieren.<br />
Deswegen wird jede geplante Aktion<br />
in größter Konspiration vorbereitet.<br />
Enge Kontakte zu Fotografen sind unabdingbar,<br />
aber auch sie werden erst unmittelbar<br />
vor der Aktion informiert. Denn immer<br />
noch sind mehr Vorhaben zu Ende,<br />
bevor sie überhaupt losgingen. Jede Femen-Aktion<br />
verstehen die Frauen deswegen<br />
auch als einen Demokratietest.<br />
Nächste Aufgabe: Attacke in Kleinstbesetzung.<br />
Vier Frauen bilden eine Gruppe,<br />
stürmen die „Öffentlichkeit“. Sie sprechen<br />
„Frauen hört<br />
man nicht<br />
zu, Frauen<br />
will man nur<br />
anschauen.<br />
Wenn das so<br />
ist: bitte!“<br />
Inna Schewtschenko<br />
sich kurz ab, aber wer fängt an? Auch das<br />
will gekonnt sein: Gemeinsam loslegen,<br />
gemeinsam enden. „Nudity is freedom –<br />
topless Dschihad“, „Dschihad“, klappert<br />
eine hinterher. Es klingt dünn und dämlich,<br />
so einzeln. Sie schlägt die Hand vor<br />
den Mund. Schewtschenko muss nichts<br />
erklären. Noch mal. „Nudity is freedom<br />
– topless Dschihad“, jetzt sitzt der<br />
Chor, doch die Übung ist noch nicht geschafft.<br />
Alle anderen gehen auf die vier<br />
los, stoppen sie mit Gewalt, bis die nicht<br />
mehr schreien und sich nicht mehr rühren.<br />
Eine Aktivistin läuft davon. „Ganz falsch!<br />
Wenn du rennst, wirst du abgedrängt, bist<br />
getrennt von den anderen, erledigt. Wirf<br />
dich zu Boden und jetzt zappeln, was das<br />
Zeug hält, damit sie dich nicht zu fassen<br />
kriegen. Und schreien. Nie aufhören mit<br />
Schreien“, mahnt Schewtschenko. Mehrere<br />
Femen stürzen sich auf jeweils eine<br />
Aktivistin, versuchen sie in die Zange zu<br />
nehmen, zur Ruhe zu bringen. Wenn das<br />
trotz ihrer Überzahl erst nach einiger Zeit<br />
gelingt, lobt Inna: „Well done!“<br />
<strong>Die</strong> Trainings-Femen sind bekleidet. Mit<br />
ihren „Firmen-Shirts“, ärmellosen Tops<br />
mit dem „Femen“-Aufdruck in Bauchnabelhöhe.<br />
<strong>Die</strong> Frauen haben keinerlei Berührungsängste.<br />
<strong>Die</strong> in der Regel männlichen<br />
Sicherheitsleute ihrer „targets“, wie<br />
sie die attackierten Politiker nennen, dagegen<br />
haben deutliche Hemmungen, die<br />
Aktivistinnen zu packen, wenn die halbnackt<br />
sind, passen auf, nicht versehentlich<br />
die Brüste zu berühren. Femen-Vorteil.<br />
Bis die Bodyguards ihre Jackets ausgezogen<br />
und über die Frauen geworfen haben,<br />
vergehen weitere wertvolle Sekunden,<br />
ziehen die Aktivistinnen noch mehr Aufmerksamkeit<br />
auf sich. Vor diesen Handgreiflichkeiten<br />
haben die Frauen allerdings<br />
Angst, denn häufig werden sie brutal geschlagen,<br />
sobald die Kameras nicht mehr<br />
klicken. Schewtschenko hat bei einer Aktion<br />
einen Zahn eingebüßt (der längst<br />
ersetzt ist). „In dem Moment spürst du<br />
nichts, denn dein Körper ist überflutet mit<br />
Adrenalin. Aber am nächsten Tag, wenn<br />
du deine blauen Flecken zählst, kapierst<br />
du, wie hart sie zugegriffen haben.“<br />
Keine wird verdonnert zu einer Aktion,<br />
jede macht nur mit, wenn sie es selbst<br />
will. Einzige Voraussetzung: Vier Wochen<br />
Vorbereitung, denn die Frauen sollen<br />
sicher sein, dass sie der Konfrontation<br />
74 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Foto: Leo Novel/Corbis<br />
Als 17-jährige Studentin gründete Inna Schewtschenko mit drei Freundinnen<br />
in der Ukraine Femen. Inzwischen finden ihre Aktionen überall statt<br />
standhalten. Eine der wichtigsten und deshalb<br />
längsten Übungseinheiten ist diese:<br />
Alle positionieren sich in Doppelreihe einander<br />
gegenüber, weniger als eine Armlänge<br />
entfernt. Brüllen sich an, in voller<br />
Lautstärke, solange sie können. Erst die<br />
eine Reihe, dann die andere Reihe, dann<br />
alle zusammen, dann die Paare einzeln.<br />
Schon das Zuschauen kostet Nerven. „Kill<br />
Kirill, kill Kirill, kill Kirill.“ Natürlich wollen<br />
sie den Patriarchen der russisch‐orthodoxen<br />
Kirche nicht töten, aber der Spruch<br />
ist gut für Übungszwecke, seine Aussage<br />
jedoch auch unter den Aktivistinnen umstritten.<br />
So wie der Slogan „Arbeit macht<br />
frei“, den ausgerechnet die deutschen<br />
Mitstreiterinnen auf der Hamburger Reeperbahn<br />
ausgewählt hatten, um gegen Prostitution<br />
zu protestieren. „Klar wollen wir<br />
provozieren, aber vor allem experimentieren<br />
wir immer noch. Wir behaupten auch<br />
nicht, dass jede Aktion eine gelungene<br />
ist“, räumt Inna Schewtschenko ein. Zerknirscht<br />
wirkt sie darüber nicht. Denn bei<br />
aller Kritik war die öffentliche Wahrnehmung<br />
beachtlich. Auch dass sie den Betrieb<br />
auf dem „Porno-Forum“ in Paris, wo jeder<br />
für 15 Euro Eintritt Live-Akten beiwohnen<br />
kann, für eine Stunde lahmgelegt haben,<br />
verbuchen die Frauen als Erfolg.<br />
„Porn is not real life“, hat Georgina,<br />
die italienische Politikstudentin, auf ein<br />
schwarzes Tuch gepinselt. Textilplakate haben<br />
sich als praktisch erwiesen, denn Pappschilder<br />
fallen zu früh auf, nur oben ohne<br />
ist manchmal zu wenig. Den Stoff ziehen<br />
sie Sekunden vor der Aktion aus dem Hosenbund,<br />
die Überraschung gelingt fast immer.<br />
Auch in Mailand, wo Femen bei der<br />
italienischen Parlamentswahl gegen Silvio<br />
Berlusconi zu Felde zog.<br />
Es ist vor allem der Kontrast – blanker<br />
Busen vor Präsidenten, Premierministern,<br />
Promis –, der selbst im sexaufgeladenen<br />
Westen zieht. Andrej Portnow, Politologe<br />
und Landsmann von Inna Schewtschenko,<br />
hält den Protest lediglich für Show. <strong>Die</strong> den<br />
Femen freilich unerhört große Aufmerksamkeit<br />
beschert und in der Ukraine das<br />
Thema Gleichberechtigung erstmals in der<br />
Öffentlichkeit aufwarf. Ihn stört allerdings,<br />
dass die Aktivistinnen dafür das simpelste<br />
aller Mittel nutzen, denn sich auszuziehen,<br />
verschaffe absolut jedem ein Publikum.<br />
40 Frauen umfasst Femen France. Nur<br />
vier Femen, die ukrainischen Gründerinnen,<br />
arbeiten hauptamtlich bei der Happening-Organisation,<br />
finanzieren sich<br />
angeblich aus dem Internetverkauf von<br />
Femen-Tops und -Tassen. Aus der Ukraine<br />
haben sich die Femen vorübergehend<br />
zurückgezogen. So wie sich dort ihre Themen<br />
immer wahlloser ausweiteten, wird die<br />
Organisation jetzt immer internationaler.<br />
„Wir agitieren, rekrutieren niemanden“,<br />
sagt die Femen-Gründerin. „<strong>Die</strong> Frauen<br />
finden uns.“ Schewtschenko mit den katzengrünen<br />
Augen bestreitet auch, dass Bewerberinnen<br />
einen Optiktest bestehen<br />
müssen, weder komme es auf Schönheit<br />
noch auf Gewicht oder Jugend an. <strong>Die</strong> Älteste<br />
der französischen Gruppe sei 49 Jahre,<br />
es kämen Große und Kleine, Schlanke und<br />
Fülligere, mit vollen oder flachen Brüsten.<br />
<strong>Die</strong> ganze Bandbreite. Wenn die Frauen<br />
mit den Femen Kontakt aufnehmen, hätten<br />
sie für sich entschieden, so radikal aufzutreten.<br />
Allerdings würde sich jede zweite<br />
wieder zurückziehen, weil sie der Körpereinsatz,<br />
wenn es ernst wird, ängstigt. Vielen<br />
ist die Konfrontation dann doch zu direkt,<br />
zu massiv. Dazu könne und wolle sie<br />
niemanden überreden. Dass ausgerechnet<br />
die Medien den Vorwurf erheben, als Feme<br />
müsse man ein Casting durchlaufen, sei<br />
ein Witz. Inna Schewtschenko, die spielend<br />
ihr Geld als Mannequin verdienen<br />
könnte, gibt den Schwarzen Peter zurück.<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 75
| W e l t b ü h n e | P h ä n o m e n F e m e n<br />
Schließlich würden die Bildmedien, wenn<br />
sie von den Femen berichten, vor allem Fotos<br />
– und zwar nur von den schönsten – abdrucken.<br />
Berichte von Femen-Aktionen als<br />
reine Wortmeldung? Fehlanzeige!<br />
<strong>Die</strong> meisten, die jetzt bei der nächsten<br />
Runde Sit-ups, seitlichen Armstützen<br />
und den nächsten Liegestützen stöhnen,<br />
sind Studentinnen oder freiberuflich tätig.<br />
„Wenn ich mal wieder drei Tage von<br />
der Polizei festgehalten werde, kann ich<br />
schließlich schlecht meinen Chef anrufen<br />
und um Freistellung bitten“, erklärt Sarah<br />
Konstantine. Sie ist 27 Jahre alt und freie<br />
Musikkritikerin.<br />
<strong>Die</strong> Femen sagen der Männerwelt keineswegs<br />
als Ganzes den Kampf an. Immer<br />
mehr Freunde oder Ehemänner unterstützen<br />
die Frauen tatkräftig. Der Ukrainer<br />
Wiktor Swjatski sei der eigentliche, der kreative<br />
Kopf, schreibt Jaroslawa Koba, eine<br />
ukrainische Journalistin, und dass die Femen<br />
ihn gern verschweigen. Sarah Konstantine<br />
kommt von sich aus auf die Männer<br />
an ihrer Seite zu sprechen. Ihr Freund<br />
helfe der Organisation bei der Pflege ihrer<br />
Internetseite. Andere, Anwälte, leisteten<br />
rechtlichen Beistand, immer schön im<br />
Hintergrund.<br />
Femen sind nicht erklärtermaßen lesbisch,<br />
haben aber Lesben in ihren Reihen.<br />
Sie treten uneingeschränkt für die Gleichstellung<br />
von homosexuellen Partnerschaften<br />
ein, weswegen sie bei den Massendemonstrationen<br />
der vergangenen Wochen in<br />
Paris mehrmals schwere Prügel einstecken<br />
mussten. Sarah Konstantine hat diese brutale<br />
Intoleranz schockiert. In ihrer unmittelbaren<br />
Umgebung, in der Musikredaktion<br />
weiß jeder, dass sie seit einem halben Jahr<br />
zu den Femen gehört, niemand nimmt daran<br />
Anstoß. Manche Freunde oder Kollegen<br />
bewunderten sie sogar dafür, dass sie „etwas<br />
tut und nicht nur im Café diskutiert“. Ihr<br />
gefällt der Aktionismus: schnell und stets<br />
aufsehenerregend auf aktuelle politische Ereignisse<br />
zu reagieren. Das sei ihre Stärke. So<br />
wie andere packende Pamphlete verfassen<br />
oder gute politische Arbeit leisteten. Doch<br />
das sei eben nicht ihre Sache. „Selbst wenn<br />
wir nur zwei Minuten für unsere Botschaft<br />
bekommen: Sobald danach starke Videos<br />
oder Fotos um die Welt gehen, hat es sich<br />
gelohnt.“ Als Sarah Konstantine die französischen<br />
Femen als Zimmermädchen verkleidet<br />
vor dem Haus von Ex-IWF-Chef<br />
Sarah Konstantine hat sich vor einem halben Jahr Femen angeschlossen, weil ihr<br />
der Aktionismus gefällt, schnell und aufsehenerregend auf Politik zu reagieren<br />
Dominique Strauss-Kahn sah, stand ihr<br />
Entschluss fest: Sie wollte mitmachen. Ihre<br />
größte Genugtuung sei, dass „der Feminismus<br />
zurückgekehrt ist“.<br />
Inna Schewtschenko würdigt die ideologische<br />
Vorarbeit der Feministinnen der<br />
ersten Stunde. Allerdings sei es ihnen<br />
nicht gelungen, das Thema in der gesellschaftlichen<br />
Diskussion zu halten. <strong>Die</strong><br />
Feministinnen seien die Theoretikerinnen<br />
gewesen, die Femen nun die Praktikerinnen.<br />
Allerdings mit einem <strong>neuen</strong><br />
Verständnis von Nacktheit: statt Kalaschnikows<br />
Brüste im Kampf gegen die Rolle<br />
der Frau als Sexobjekt. Gleiches mit Gleichem<br />
bekämpfen?<br />
Sorgen, dass ihr politischer Körpereinsatz<br />
eines Tages ein Hindernis im Job<br />
werden könnte, treiben Sarah, die französische<br />
Femen-Aktivistin, nicht um. Eher<br />
würde sie auf ihre Karriere verzichten als<br />
auf ihre Freiheit, sich wo wie sie will politisch<br />
zu äußern. Schewtschenko hat das<br />
berufliche Aus wegen ihrer Femen-Aktivität<br />
bereits hinter sich. Sie flog sofort aus<br />
der Pressestelle der Stadt Kiew raus, als bekannt<br />
wurde, dass sie zu den Femen gehört.<br />
In ihrer ukrainischen Heimat herrschen<br />
nichts als Vorbehalte gegen Feministinnen.<br />
<strong>Die</strong> sind verschrien als unzufrieden<br />
mit sich und ihrem Äußeren, bärtig, lesbisch<br />
sowieso und voller Hass auf Männer.<br />
Fotos: Leo Novel/Corbis, Bettina Straub (<strong>Auto</strong>rin)<br />
76 <strong>Cicero</strong> 7.2013
In Frankreich dagegen erführen die Femen<br />
Solidarität, vor allem von denen, die sich<br />
über die Wiederbelebung der alten Debatten<br />
freuen. Wie der Besitzer des Theaters<br />
„Lavoir Moderne Parisien“, in dessen Räumen<br />
sie kostenlos trainieren dürfen. Für<br />
einen Feminismus, der sich kaum weiblicher,<br />
kaum aggressiver Gehör verschaffen<br />
könnte. <strong>Die</strong> Ukrainerin war sich durchaus<br />
nicht sicher, ob sich Frauen in Frankreich<br />
für den „Femen-ismus“ mobilisieren lassen<br />
würden. Oder in Italien, Belgien, Deutschland,<br />
Kanada, Brasilien, wo es inzwischen<br />
Femen-Ableger gibt. Und vielleicht bald<br />
in den USA – Interessentinnen hätten sich<br />
bereits gemeldet.<br />
Überall, das hat sie inzwischen verstanden,<br />
würden Frauen benachteiligt, als Sexobjekte<br />
betrachtet, in ihren Rechten und<br />
Freiheiten eingeschränkt. In der Ukraine<br />
<strong>vom</strong> Staat und, wie in vielen anderen Ländern<br />
auch, von der Kirche. „Dort, wo die<br />
Religion beginnt, enden die Rechte der<br />
Frauen. Religion und Glaube sollen sich<br />
auf Kirchen und Wohnungen beschränken<br />
und fernhalten von der Politik und der<br />
Straße.“ <strong>Die</strong> Religion betrachtet Schewtschenko<br />
daher als Gegner. Dessen Symbole<br />
sie auch schon mal beseitigt. In Kiew<br />
sägte sie als Zeichen der Solidarität mit den<br />
inhaftierten russischen Pussy-Riot-Frauen<br />
ein acht Meter großes Kreuz ab, das Demonstranten<br />
während der orangenen Revolution<br />
im Stadtzentrum aufgestellt hatten.<br />
Seither lässt Präsident Wiktor Janukowitsch<br />
sie wegen Blasphemie mit Haftbefehl<br />
suchen.<br />
Deswegen floh Schewtschenko nach<br />
Frankreich, bat um politisches Asyl und<br />
gründete die französischen Femen. Worüber<br />
Sarah, der die Busenaktionen der<br />
Ukrainerinnen schon lange gefallen haben,<br />
hocherfreut war. <strong>Die</strong> Französin versteht<br />
ihre „beschrifteten“ Brüste als eine<br />
Art Uniform, wie bei Soldaten. Drei Missstände<br />
haben sie zu einer unversöhnlichen<br />
Kämpferin gemacht: ungleiche Löhne für<br />
Männer und Frauen, die Pornoindustrie<br />
und kleine muslimische Mädchen, die<br />
Schleier tragen. „Das bricht mir das Herz.“<br />
Ihr sei egal, ob sich die islamischen Frauen<br />
freiwillig verhüllten, Konstantine nimmt<br />
für sich in Anspruch, diese Frauen als unfrei<br />
zu empfinden.<br />
Daher plädiert sie immer wieder für<br />
Aktionen zur Freilassung von Amina. Der<br />
Tunesierin, die nach dem Vorbild der<br />
ukrainischen Femen-Gründerinnen Slogans<br />
auf ihren nackten Oberkörper schrieb,<br />
die Fotos davon ins Internet stellte und<br />
seither im Gefängnis sitzt. Als der tunesische<br />
Präsident Moncef Marzouki Mitte<br />
April in Paris sein Buch „Eine Einladung<br />
zur Demokratie – Das tunesische Experiment“<br />
präsentieren wollte, stürmten Sarah<br />
Konstantine und zwei weitere französische<br />
„Sextremistinnen“ seine Pressekonferenz im<br />
„Selbst wenn<br />
wir nur zwei<br />
Minuten<br />
für unsere<br />
Botschaft<br />
bekommen:<br />
Sobald danach<br />
starke Videos<br />
oder Fotos um<br />
die Welt gehen,<br />
hat es sich<br />
gelohnt“<br />
Sarah Konstantine<br />
Pariser „Institut der arabischen Welt“. Auf<br />
Sarahs Brüsten prangte die Frage: „Where<br />
is Amina?“ Auch die Parole „Topless Dschihad“<br />
erlebte den Praxistest und „Women’s<br />
spring is coming“ nach dem für die Femen<br />
so enttäuschenden arabischen Frühling.<br />
Der tunesischen Regierung werfen<br />
sie vor, das Land islamisieren zu wollen.<br />
Der Kampf für Amina hat inzwischen einen<br />
vorläufigen Höhepunkt erreicht. Zwei<br />
Französinnen und die Deutsche Josephine<br />
Witt wurden wegen ihrer Aktion Ende Mai<br />
vor dem Justizpalast in Tunis zu einer Haftstrafe<br />
von vier Monaten verurteilt.<br />
Vor allem auch dieser Protest ist auf<br />
heftige Kritik gestoßen. Insbesondere<br />
tunesische Frauenrechtlerinnen sind besorgt.<br />
Sie sehen ihre über viele Jahre hart<br />
erkämpften Freiheiten durch Femen in Gefahr.<br />
Fast schon flehentlich fordern sie die<br />
Aktivistinnen auf, ihre Aktionen in Tunesien<br />
zu beenden. Schewtschenko aber lässt<br />
sich auch dadurch nicht beirren.<br />
Bevor ein Nachdenken auch nur beginnen<br />
kann, folgt schon die nächste Aktion,<br />
Schlag auf Schlag, an immer anderen<br />
Orten mit immer <strong>neuen</strong>, vor allem anderen<br />
Themen. So bleiben sie zwar in aller<br />
Munde, doch von einer Revolution sind<br />
sie weit entfernt, die findet noch nicht<br />
einmal virtuell statt. Deswegen hagelte es<br />
Kritik von Gegnern wie von potenziellen<br />
Verbündeten. „Jeden Morgen, wenn ich<br />
von den SMS auf meinem Handy aufwache,<br />
lese ich: ,Stirb! Schmor in der Hölle!<br />
Verbrennen sollte man dich!‘ Damit ich<br />
dann wenigstens einmal was Nettes höre,<br />
sage ich zu mir selbst: Guten Morgen,<br />
liebe Inna.“<br />
<strong>Die</strong> ukrainischen Femen gibt es seit fünf<br />
Jahren. Als 17-jährige Studentin gründete<br />
Inna Schewtschenko mit drei Freundinnen<br />
die Organisation. Bereits als kleines Mädchen<br />
fand sie es ungerecht, dass ihre Mutter,<br />
obwohl sie sich zwölf Stunden am Tag<br />
abrackerte und wie ihr Vater eine Hochschulbildung<br />
hat, nicht mehr als 100 Euro<br />
im Monat verdiente. „Mein Vater arbeitete<br />
nur sechs Stunden und bekam viel mehr.“<br />
<strong>Die</strong> Aussicht auf solch ein Frauenleben<br />
machte sie rebellisch. <strong>Die</strong> Wut schweißte<br />
die Frauen zusammen. Sie gingen auf die<br />
Straße, protestierten – für die politischen<br />
Beobachter waren sie Luft. Bis zu jenem<br />
7. Februar 2010, als sie in dem Wahllokal,<br />
in dem Janukowitsch seine Stimme abgab,<br />
vor ihm warnten: ein künftiger Diktator,<br />
mit dem die Freiheiten der orangenen Revolution<br />
der Vergangenheit angehören<br />
würden. Erstmals agierten sie „topless“.<br />
Auf einmal existierten sie. <strong>Die</strong> Femen.<br />
Alle Welt druckte ihre Fotos. Sie begriffen:<br />
„Frauen hört man nicht zu, Frauen<br />
will man nur anschauen. Wenn das so ist:<br />
bitte!“ Dank ihrer Brüste hatten sie nun<br />
eine Stimme.<br />
SAbine Adler<br />
ist Korrespondentin des Deutschlandfunks<br />
in Warschau. Sie<br />
findet, Femen-Aktionen müssen<br />
für zu Vieles herhalten<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 77
| W e l t b ü h n e | M o r d a u f r u f<br />
„Wanted Dead“<br />
Hamed Abdel-Samad hat vor einem Islamofaschismus gewarnt. Weil radikalen,<br />
ägyptischen Gelehrten das nicht passt, haben sie zur Ermordung des <strong>Cicero</strong>‐<strong>Auto</strong>rs<br />
aufgerufen. Doch der will sich davon nicht einschüchtern lassen<br />
von Hamed Abdel-Samad<br />
V<br />
or einigen Monaten sah ich auf<br />
Facebook ein mit Photoshop gefaktes<br />
Bild. Ein böse blickender,<br />
bärtiger Mann hielt ein Plakat,<br />
darauf stand: „Enthauptet diejenigen,<br />
die behaupten, der Islam sei die Religion<br />
der Gewalt.“ Ich habe herzlich gelacht<br />
und sah in dem gefälschten Foto eine<br />
elegante Beschreibung der bitteren Realität.<br />
An dieses Bild musste ich denken, als<br />
ich plötzlich mein eigenes Porträt mit dem<br />
Aufruf „Wanted Dead“ auf Facebook entdeckte.<br />
Das soziale Netzwerk, das wir 2011<br />
genutzt hatten, um den ägyptischen Diktator<br />
zu stürzen, wird heute von Islamisten<br />
missbraucht, um einen Mordaufruf gegen<br />
mich zu verbreiten.<br />
Alles begann am 4. Juni. Ich hielt in<br />
Kairo einen Vortrag über den „religiösen Faschismus<br />
in Ägypten“ und vertrat die These,<br />
dass das faschistoide Denken im Islam nicht<br />
erst mit dem Aufstieg der Muslimbrüder begonnen<br />
habe, sondern in der Urgeschichte<br />
des Islam begründet sei. Ich argumentierte:<br />
Der Islam habe die religiöse Vielfalt auf der<br />
arabischen Halbinsel beendet, verlange von<br />
seinen Angehörigen unbedingten Gehorsam,<br />
dulde keine abweichenden Meinungen<br />
und strebe seit seiner Gründung nach<br />
der Weltherrschaft. Bis heute ist diese Geisteshaltung<br />
im Islam dominanter als andere<br />
Aspekte dieser Religion. Daher kann man<br />
von Islamofaschismus sprechen.<br />
Mir war bewusst, dass man moderne<br />
Begriffe wie Faschismus, die aus einem bestimmten<br />
historischen und politischen Kontext<br />
und aus einer europäischen Erfahrung<br />
stammen, nicht auf Arabien im 7. Jahrhundert<br />
übertragen kann. Meine Botschaft war<br />
daher: Wenn die religiösen Muslime es ablehnen,<br />
dass der Prophet und der Koran<br />
mit Maßstäben des 21. Jahrhunderts beurteilt<br />
werden, müssen sie aus den gleichen<br />
Gründen akzeptieren, dass säkulare Muslime<br />
es ablehnen, dass ihr Alltag, die Politik<br />
und die Justiz im 21. Jahrhundert durch die<br />
Regeln des Korans bestimmt werden, die<br />
für eine andere Zeit entstanden sind und<br />
eine andere Erfahrung beschreiben.<br />
Kurz darauf versammelte sich eine<br />
Gruppe islamischer Gelehrter und wollte<br />
meine Argumente live im Fernsehen entkräften.<br />
Nachdem sie zahlreiche Beispiele<br />
aus der Biografie des Propheten und aus<br />
dem Koran zitiert hatten, die beweisen sollten,<br />
dass der Islam Vielfalt und andere Meinungen<br />
akzeptiere, diskutierten sie, wie ich<br />
für die Verunglimpfung des Islam bestraft<br />
werden sollte. Das Urteil fiel<br />
schnell und einstimmig: Ich<br />
soll getötet werden!<br />
Allein wie ich getötet werden<br />
solle, und wer die Macht<br />
habe, über meine Tötung zu<br />
verfügen, wurde weiter debattiert.<br />
Ein Fernsehprediger<br />
sagte, ich solle zur Reue und<br />
Rückkehr zum Islam eingeladen<br />
werden; sollte ich das ablehnen, müsse<br />
der Herrscher Ägyptens mich töten. Ein<br />
Professor aus der renommierten Al-Azhar-<br />
Universität und der Anführer der Terrorbewegung<br />
Dschamaa Islamiya forderten meinen<br />
sofortigen Tod ohne Reue, denn ich soll<br />
auch den Propheten beleidigt haben, und da<br />
helfe keine Reue. Einer von ihnen sah keine<br />
Notwendigkeit, den Herrscher Ägyptens vor<br />
meiner Tötung um Erlaubnis zu bitten.<br />
<strong>Die</strong>se Gelehrten leben in einem geschlossenen<br />
ideologischen Kreis, weshalb sie überhaupt<br />
nicht merken, dass ihr Urteil meine<br />
Argumente eher bekräftigt. Es ist die Ironie<br />
des Schicksals, dass diese Religionswächter<br />
im Frühjahr 2011 die Massendemonstrationen<br />
gegen Hosni Mubarak verurteilt haben<br />
und sie für unislamisch hielten, während ich<br />
Meine Gedanken<br />
können<br />
diese Fanatiker<br />
nicht<br />
erdrosseln<br />
mit Tausenden von Ägyptern auf dem Tahrir-Platz<br />
für den Sturz des Diktators demonstriert<br />
habe. Uns haben sie als Agenten des<br />
Westens bezeichnet, die durch die Demonstrationen<br />
Ägypten destabilisieren wollen.<br />
Ich hätte mir damals nie gedacht, dass<br />
mein Land nach dem Sturz Mubaraks<br />
noch unfreier sein würde. Aber ich bereue<br />
es trotzdem nicht. Mubarak war es gewesen,<br />
der durch seine Politik den Muslimbrüdern<br />
die richtige Atmosphäre bot, um<br />
zu wachsen und ihre Ideologie zu verbreiten.<br />
Durch seine Alleinherrschaft konnten sich<br />
die Islamisten als Opfer darstellen und damit<br />
die Sympathie vieler Ägypter gewinnen.<br />
In Ägypten gab es eine Diktaturzwiebel,<br />
die aus mehreren<br />
Schichten bestand: die<br />
Schicht des Mubarak-Clans,<br />
die Militärdiktatur und die<br />
religiöse Diktatur. Man muss<br />
eine Schicht nach der anderen<br />
abschälen, um zu einem<br />
demokratischen Kern zu gelangen.<br />
Freiheit ist eben teuer!<br />
Nun werden die Muslimbrüder demaskiert<br />
und verlieren allmählich die Sympathie<br />
der Ägypter. Den <strong>neuen</strong> Präsidenten<br />
Mohammed Mursi nennen einfache Ägypter<br />
„Mubarak mit Bart“. Das Land geht<br />
durch eine schwere wirtschaftliche Krise,<br />
die die neue Regierung nicht meistern<br />
kann. Überall fehlt es an Brot und Benzin.<br />
So waren meine islamkritischen Aussagen<br />
ein willkommener Anlass für den<br />
Sender der Muslimbrüder und der Salafisten,<br />
um von diesen Krisen abzulenken und<br />
stattdessen über die angeblich gefährdete<br />
religiöse Identität Ägyptens zu diskutieren.<br />
Normalerweise müssten selbst nach<br />
ägyptischem Recht die beiden Männer, die<br />
den Mordaufruf gemacht haben, sofort verhaftet<br />
werden. Aber gerade diese Männer<br />
78 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> Probe lesen<br />
Foto: Antje Berghäuser<br />
braucht Präsident Mursi, weil er von der<br />
Opposition unter Druck gesetzt wird. Eine<br />
Unterschriftenaktion, die seine Amtsenthebung<br />
fordert, konnte binnen eines Monats<br />
mehrere Millionen Unterschriften sammeln.<br />
Für den 30. Juni ist eine Massendemonstration<br />
vor dem Präsidentenpalast geplant.<br />
<strong>Die</strong> Muslimbrüder versuchen nun, meine<br />
islamkritischen Ansichten als Meinung der<br />
gesamten Opposition darzustellen, um sie<br />
als Islamhasser zu diffamieren und dadurch<br />
mehr Unterstützung zu bekommen.<br />
<strong>Die</strong> Muslimbrüder haben bislang in allen<br />
Bereichen versagt. Nur in einem waren<br />
sie erfolgreich. Sie haben es geschafft,<br />
Ägypten in zwei Völker zu spalten: Gläubige<br />
und Ungläubige. <strong>Die</strong> Ressentiments<br />
in beiden Lagern wachsen und drohen, das<br />
Land ins politische Chaos zu stürzen. In<br />
Ägypten hat der innere Kampf der Kulturen<br />
begonnen. Es ist ein existenzieller, aber<br />
unvermeidbarer Kampf, den die Mubarak-<br />
Diktatur künstlich verzögert hatte.<br />
In diesem Kampf bin ich nur eine Person,<br />
die ihre Meinung sagt. Ich habe keine<br />
Angst, mache mir nur Sorgen um meine<br />
ägyptische Familie, die nun in Mitleidenschaft<br />
gezogen wurde und Ziel von Beschimpfungen<br />
und Drohungen ist. Wenn<br />
ich wieder in Deutschland bin, erwarte ich<br />
allerdings angemessene Schutzmaßnahmen<br />
durch den Staat. Überhaupt sollte die Bundesregierung<br />
in Ägypten anders auftreten<br />
als bislang. Zurückhaltung ist nicht mehr<br />
angebracht.<br />
Es ist zwar bedauerlich, dass ich mich<br />
verstecken muss, während die, die mich töten<br />
wollen, frei herumlaufen können. Aber<br />
meine Gedanken können diese Fanatiker<br />
nicht erdrosseln. Im Gegenteil. <strong>Die</strong>se Hetzkampagne<br />
gegen mich hat meinen Leserkreis<br />
in Ägypten vergrößert. Ich erfahre viel<br />
Zustimmung und Solidarität von Kreisen,<br />
die mir bislang verschlossen waren. Unter<br />
den vielen Nachrichten, die mich über Facebook<br />
erreicht haben, habe ich mich über<br />
eine besonders gefreut. Ein junger Ägypter<br />
schrieb mir: Ich danke den Terroristen<br />
dafür, dass sie mich mit Ihnen und Ihren<br />
Gedanken bekannt gemacht haben. Bitte<br />
machen Sie weiter!“<br />
hAMED ABDEL-sAMAD<br />
war während des Aufstands<br />
im Frühjahr 2011 in Kairo.<br />
Seither kämpft er für die<br />
Demokratisierung Ägyptens<br />
Ihre Abo-Vorteile:<br />
Frei Haus: <strong>Cicero</strong> wird ohne<br />
Aufpreis zu Ihnen nach Hause<br />
geliefert .<br />
Vorteilspreis: Drei Ausgaben für<br />
nur 16,50 EUR* statt 24,– EUR.<br />
Ich möchte <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis von 16,50 EUR* kennenlernen!<br />
Bitte senden Sie mir die nächsten drei <strong>Cicero</strong>-Ausgaben für 16,50 EUR* frei Haus. Wenn mir <strong>Cicero</strong> gefällt, brauche ich nichts weiter<br />
zu tun. Ich erhalte <strong>Cicero</strong> dann monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit 7,– EUR pro Ausgabe inkl. MwSt. (statt 8,– EUR im<br />
Einzelverkauf) und spare so über 10 %. Falls ich <strong>Cicero</strong> nicht weiterlesen möchte, teile ich Ihnen dies innerhalb von zwei Wochen nach<br />
Erhalt der dritten Ausgabe mit. Verlagsgarantie: Sie gehen keine langfristige Verpflichtung ein und können das Abonnement jederzeit<br />
kündigen. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Geschäftsführer Rudolf Spindler.<br />
*Angebot und Preise gelten im Inland, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
Vorname<br />
Name<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Telefon<br />
Datum<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
Telefax: 030 3 46 46 56 65<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/abo<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 943167<br />
Ort<br />
E-Mail<br />
Geburtstag<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail über interessante Angebote des Verlags<br />
informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch das Senden einer E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den <strong>Cicero</strong>-Leserservice,<br />
20080 Hamburg, jederzeit widerrufen werden.<br />
Unterschrift<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
JETZT<br />
TESTEN!<br />
3 x <strong>Cicero</strong> nur<br />
16,50 EUR*<br />
Bundestagswahl 2013<br />
<strong>Cicero</strong> begleitet in einer<br />
Serie die Protagonisten des<br />
Wahlkampfs.
| K a p i t a l<br />
Mit Uncle Sam nach oben<br />
Größenwahn oder Coup? Florian Schoeller greift die Ratingagenturen an. Den richtigen Mann dafür hat er an Bord<br />
von Heinz-Roger Dohms<br />
D<br />
as Hamilton House ist ein denkmalgeschützter<br />
Zwanziger-Jahre-<br />
Bau im Londoner Norden. Im<br />
zweiten Stock wartet ein drahtiger Mann<br />
in Jeans und Pulli. Im Gespräch weist er<br />
immer wieder auf einen Punkt hin: Für das,<br />
was Florian Schoeller, Chef der Ratingagentur<br />
Scope in Berlin, und er hier vorhätten,<br />
brauche man „deep pockets“, tiefe<br />
Taschen also, viel Geld. Später sieht er sich<br />
noch mal in seinem Büro um, deutet auf<br />
den alten Teppich und die schmierige Tapete,<br />
lacht und sagt: „Na ja, ganz so tief müssen<br />
die Taschen vielleicht gar nicht sein.“<br />
Der Mann in Jeans und Pulli heißt<br />
Sam Theodore. Der 61-Jährige gilt als Koryphäe,<br />
jedenfalls in der Welt der Ratingagenturen,<br />
jener Firmen, die mit ihren Bonitätsnoten<br />
über die Kreditwürdigkeit von<br />
Unternehmen, Banken und Staaten entscheiden.<br />
Bis 2005 war Theodore Chefanalyst<br />
für Bankenratings bei Moody’s, die seit<br />
einer gefühlten Ewigkeit mit Standard &<br />
Poor’s und Fitch die Ratingwelt beherrschen;<br />
gemeinsamer Marktanteil: 95 Prozent.<br />
Ein früherer Kollege sagt über ihn:<br />
„Sam steht für die gute, alte Zeit in unserer<br />
Branche.“<br />
Und nun heuert dieser Theodore bei<br />
der Ratingfirma Scope an. Es ist, als würde<br />
Pep Guardiola nicht zum FC Bayern, sondern<br />
zum VfL Bochum wechseln.<br />
Florian Schoeller ist der Mann mit den<br />
tiefen Taschen. Er hat Theodore zu Scope<br />
geholt. Entspannt sitzt er in der Bar eines<br />
Hamburger Hotels. Eben gerade hat der<br />
39-Jährige einen Vortrag bei einer Immobilientagung<br />
gehalten. „Gute Rede“, sagt<br />
der Kommunikationsmanager, den er sich<br />
seit neuestem leistet, doch Schoeller, Gründer<br />
und Chef von Scope, scheint eher gelangweilt<br />
von der Immobilienbranche. Er<br />
hat jetzt ein neues Thema, viel größer, viel<br />
spannender, eine andere Dimension: „In<br />
drei bis fünf Jahren soll Scope, was die Ratingkompetenz<br />
betrifft, auf Augenhöhe mit<br />
S&P, Moody’s und Fitch sein.“<br />
Schoeller ist nicht nur viel jünger, sondern<br />
auch stämmiger als Theodore. Unter<br />
seinem Hemd verbirgt sich ein kleiner Unternehmerbauch,<br />
was in Kombination mit<br />
dem jungenhaften Gesicht, gegelten Haaren<br />
und seiner hemdsärmlig-wurstigen Art<br />
eine interessante Melange ergibt: ein bisschen<br />
Barock. Ein bisschen Schelm. Ein<br />
bisschen BWL-Student.<br />
Dabei hat Schoeller nie studiert. Stattdessen<br />
machte er nach Abitur und Bundeswehr<br />
erst Praktika und dann Karriere. Mit<br />
23 Jahren zog er sein erstes größeres Immobilienprojekt<br />
an Land, den Verkauf eines<br />
Lofts in Berlin-Mitte, an die Adresse erinnert<br />
er sich noch, „Melchiorstraße 26“. Es<br />
folgten weitere Objekte, doch schnell interessiert<br />
Schoeller sich stärker für die Bewertung<br />
von Immobilien als für deren Verkauf.<br />
So gründete er 2002, mit 26 Jahren,<br />
Scope, eine Ratingagentur zur Bewertung<br />
von Immobilienfonds. <strong>Die</strong> ersten Jahre verliefen,<br />
gelinde gesagt, turbulent. Mal war<br />
Scope so gut wie pleite, mal hagelte es Kritik<br />
wegen vermeintlicher Interessenkonflikte,<br />
mal zog eine eifrige Analystin den Zorn der<br />
halben Fondsbranche auf sich. Man sei „unerfahren<br />
gewesen“ und habe „nicht immer<br />
gut kommuniziert“, sagt Schoeller heute. Er<br />
biss sich durch, erschloss weitere Nischen,<br />
beschäftigt heute 80 Mitarbeiter und erwirtschaftet<br />
einen Millionenumsatz. Profitabel?<br />
„Seit Jahren.“<br />
Jetzt will er raus aus der Nische. Hinein<br />
in die richtige Ratingwelt, den Wettbewerb<br />
mit den „Big Three“ aufnehmen. Nicht wenige<br />
in der Branche halten den Versuch<br />
für Größenwahn. Roland Bergers „Europäische<br />
Ratinginitiative“ ist gerade erst krachend<br />
gescheitert: <strong>Die</strong> Unternehmensberater<br />
hatten den Doppelpass mit der Politik<br />
gesucht, die Finanzelite aber nicht überzeugt.<br />
Schoeller will sich dagegen ganz auf<br />
die Emittenten von Wertpapieren und die<br />
Investoren konzentrieren: „<strong>Die</strong> Qualität<br />
der Ratings ist entscheidend. Aus Brüssel<br />
kommt nicht ein Cent Geschäft.“<br />
Um Sam Theodore hat Schoeller gebuhlt<br />
wie ein verliebter Teenager. Bis der nachgab,<br />
weil es ihn „reizt, noch einmal etwas völlig<br />
Neues aufzubauen“, mit einem kleinen<br />
Team von sieben Analysten im engen, mäßig<br />
repräsentativen Londoner Büro.<br />
Scope will zunächst nur Banken bewerten,<br />
Industriekonzerne sollen später folgen.<br />
Theodore entwickelt gerade eine neue Ratingmethodik,<br />
die sich von den zahlengetriebenen<br />
Modellen der „Big Three“<br />
abheben soll. Faktoren, die schwer quantifizierbar<br />
sind, räumt er größeres Gewicht<br />
ein: Überzeugt die Strategie der Bank? Passt<br />
das Geschäftsmodell des Geldhauses? Wie<br />
kompetent ist der Vorstand?<br />
Gelingt Scope damit die Rückkehr in<br />
die „gute, alte Zeit“? Der Zeitpunkt des Angriffs<br />
ist gut gewählt. Das Image der drei<br />
großen Konkurrenten aus den USA hat<br />
durch die Finanzkrise extrem gelitten. <strong>Die</strong><br />
US-Finanzaufsicht wirft ihnen vor, mit viel<br />
zu positiven Bewertungen hypothekenbesicherter<br />
Anleihen Anleger wissentlich getäuscht<br />
zu haben. Theodore kommt dagegen<br />
mit vergleichsweise weißer Weste zu<br />
Scope, während der Krise arbeitete er für<br />
Finanz- und Bankenaufsichtsbehörden.<br />
Im kommenden Jahr werden mit seinem<br />
Ratingmodell 40 bis 50 große europäische<br />
Banken ein Rating von Scope erhalten<br />
– unentgeltlich. In zwei, drei oder<br />
vielleicht auch erst in fünf Jahren sollen die<br />
Scope-Noten so etabliert sein, dass die Emittenten<br />
bereit sind, für sie zu zahlen. Gut eine<br />
Million Euro dürfte dieses Experiment bis<br />
dahin pro Jahr verschlingen. Sind Schoellers<br />
Taschen tief genug? An Selbstbewusstsein<br />
mangelt es ihm zumindest nicht: „Bislang<br />
bin ich in jedem Markt, in den ich reingegangen<br />
bin, auch dringeblieben.“<br />
Heinz-Roger Dohms<br />
ist in der Ratingwelt zu<br />
Hause, über die er lange als<br />
Korrespondent für FTD und<br />
Capital berichtet hat<br />
Fotos: Andreas Pein für <strong>Cicero</strong>, privat (<strong>Auto</strong>r)<br />
80 <strong>Cicero</strong> 7.2013
„Bislang bin ich in<br />
jedem Markt, in den<br />
ich reingegangen bin,<br />
auch dringeblieben“<br />
Florian Schoeller, Gründer und Chef der Ratingagentur Scope<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 81
| K a p i t a l<br />
Auf gottlosem FuSSe<br />
David Bonneys atheistische Schuhe im Bauhausstil verkaufen sich am besten in den gottesfürchtigen USA<br />
von Daniel Schreiber<br />
D<br />
avid Bonney weiSS, wie er die Aufmerksamkeit<br />
des Publikums auf<br />
sich zieht. Dafür stand er lange<br />
genug als Sänger und Kabarettist auf<br />
Berliner Kleinkunstbühnen. Sein komisches<br />
Talent stellt er mittlerweile aber lieber<br />
auf der Website seines Schuhe-Labels<br />
„Atheistberlin.com“ unter Beweis: Dort hält<br />
ein Model auf Richard Dawkins’ Wälzer<br />
„The God Illusion“ Mittagsschlaf, Charles<br />
Darwins Ururenkel lacht in die Kamera,<br />
und Michelangelos sixtinischer Kapellen-<br />
Adam drückt seinem Schöpfer ein Paar von<br />
Bonneys heidnischen Schuhen in die Hand.<br />
Darauf angesprochen, grinst der Wahlberliner.<br />
Um es gleich klarzustellen: Der<br />
34-jährige Designer hat nichts gegen Christen<br />
und Anhänger anderer Religionen. Obwohl<br />
er in Dublin aufgewachsen ist, einer<br />
der katholischen Bastionen Europas, zogen<br />
ihn seine Mutter, eine irische Hausfrau,<br />
und sein Vater, ein englischer Klempner,<br />
einfach nicht religiös auf. In den Kirchenchor<br />
kam er trotzdem, weil er gut sang.<br />
Abgefärbt hat auch das nicht: Auf der<br />
Sohle jedes Schuhes seiner Firma steht in<br />
großen, roten Buchstaben: „Ich bin Atheist.“<br />
Von der Form-folgt-Funktion-Idee der<br />
Bauhaus-Ära inspiriert, sehen die Schuhe<br />
wie unglaublich bequeme Vorkriegs-Sneaker<br />
aus. Per Hand werden sie in einer portugiesischen<br />
Schuhfabrik aus drei Stücken<br />
unbehandelten Nubukleders genäht und<br />
passen sich der Fußform schon beim ersten<br />
Tragen an. „Mein Leben lang habe ich<br />
nach Schuhen gesucht, die ich wirklich haben<br />
wollte“, sagt Bonney. „Irgendwann war<br />
es an der Zeit, sie selber herzustellen.“<br />
<strong>Die</strong> Schuhe sind noch nicht einmal<br />
teuer. <strong>Die</strong> Firma, zu der sechs Mitarbeiter<br />
gehören, die sich um Logistik und um Finanzen<br />
kümmern, vertreibt sie seit einem<br />
Jahr übers Internet und seit kurzem auch<br />
im eigenen Shop in Berlin-Kreuzberg. Sie<br />
kosten 150 Euro, inklusive Versandkosten<br />
und Mehrwertsteuer.<br />
<strong>Die</strong> meisten Bestellungen kommen aus<br />
den USA, wo „Atheismus“ noch ein regelrechtes<br />
Reizwort ist. „Mit unseren Schuhen<br />
versuchen wir auch, unsere entspannte,<br />
europäische Attitüde zu verbreiten. Atheismus<br />
ist doch nichts weiter als eine intelligente,<br />
leicht hedonistische Weltsicht“,<br />
sagt Bonney. Er wedelt nicht<br />
mit Flaggen oder Manifesten,<br />
aber 10 Prozent des Gewinns<br />
spendet die Firma an atheistische<br />
Organisationen wie<br />
Ärzte ohne Grenzen.<br />
<strong>Die</strong> Idee für die Schuhe<br />
entwickelte Bonney lange,<br />
bevor er ihr Design entwarf.<br />
Nach seinem Psychologie-<br />
Studium arbeitete er in einer<br />
Londoner Werbeagentur<br />
und schrieb nebenbei<br />
seine MBA-Arbeit, Thema:<br />
<strong>Die</strong> Zukunft der Werbewirtschaft.<br />
<strong>Die</strong> vor sich hin<br />
siechende Branche müsse<br />
sich dringend neu erfinden,<br />
konstatierte er damals, und<br />
Marken kreieren, welche die<br />
ethischen Glaubenssätze ihrer<br />
Käufer widerspiegeln.<br />
Um die Chancen von<br />
Atheist Shoes zu testen,<br />
stellte er den Prototyp des Schuhes in der<br />
Online-Community Reddit vor. Das Interesse<br />
daran war riesig. Über die Crowdfunding-Plattform<br />
Kickstarter sammelte er<br />
dann innerhalb von nur vier Wochen fast<br />
60 000 Dollar ein. <strong>Die</strong> Geldgeber konnten<br />
über Kickstarter entweder die Produktion<br />
der eigenen Schuhe vorfinanzieren<br />
oder durch kleinere Spenden die Umsetzung<br />
der Idee unterstützen. „Unsere Kunden<br />
haben dabei mitgeholfen, die Marke<br />
von Anfang an mitzugestalten – das ist unbezahlbar.<br />
Crowdfunding ist perfekt für<br />
Unternehmensgründer. Wir mussten zwar<br />
lange von Reis und Pasta leben, aber mit<br />
MYTHOS<br />
MITTELSTAND<br />
„Was hat Deutschland,<br />
was andere nicht<br />
haben? Den<br />
Mittelstand!“, sagt jetzt<br />
auch der Deutsche-<br />
Bank-Chef Anshu<br />
Jain. <strong>Cicero</strong> weiß das<br />
schon länger und stellt<br />
den Mittelstand in<br />
einer Serie vor. <strong>Die</strong><br />
bisherigen Porträts aus<br />
der Serie unter:<br />
www.cicero.de/mittelstand<br />
dem eingesammelten Geld konnten wir direkt<br />
loslegen“, sagt Bonney.<br />
Kulturwissenschaftler sprechen im Zusammenhang<br />
mit dieser Art der Finanzierung<br />
gerne von einer „Moralisierung der<br />
Märkte“, weil Kunde und Unternehmen<br />
emotional von Anfang an eng verbunden<br />
sind. Für Bonney gehen<br />
damit auch neue Anforderungen<br />
fürs Marketing einher.<br />
Als er bemerkte, dass<br />
es in den USA Zustellungsprobleme<br />
gab, verschickte<br />
er eine Reihe von Paketen<br />
ohne die Aufschrift Atheist<br />
Shoes. <strong>Die</strong> Pakete ohne<br />
Logo kamen im Schnitt<br />
drei Tage früher an. <strong>Die</strong> mit<br />
Logo waren nicht nur langsamer,<br />
sondern gingen in<br />
den gottesfürchtigen USA<br />
auch zehnmal so oft verloren.<br />
Der Zusteller bezog<br />
dazu keine Stellung, aber<br />
die US-Medien nahmen die<br />
von Bonney geschickt lancierte<br />
Story gerne auf.<br />
Bei der Expansion seines<br />
Unternehmens geht Bonney<br />
sehr behutsam vor. Das Angebot<br />
des amerikanischen<br />
Kaufhausriesen Target, seine Schuhe zu vertreiben,<br />
lehnte er ab. Für sein kleines, alternatives<br />
Label setzt er lieber auf temporäre<br />
Shops in London und New York. Dort gibt<br />
es ab Herbst auch die Atheist-Baby-Shoes zu<br />
kaufen, mit Teddybärfell gefüttert. Auf ihren<br />
Sohlen steht „I believe in Mummy“ und „I<br />
believe in Daddy“. Eigentlich das perfekte<br />
Taufgeschenk.<br />
Daniel Schreiber<br />
schreibt über Kunst und Kultur<br />
und ist <strong>Auto</strong>r des Buches<br />
„Susan Sontag. Geist und<br />
Glamour“ (Aufbau-Verlag)<br />
Fotos: Götz Schleser für <strong>Cicero</strong>, Andrej DAllmann (<strong>Auto</strong>r)<br />
82 <strong>Cicero</strong> 7.2013
„Mein Leben lang<br />
habe ich bequeme<br />
Schuhe gesucht. Jetzt<br />
habe ich sie einfach<br />
selbst hergestellt“,<br />
sagt David Bonney<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 83
| K a p i t a l<br />
Kubas Ernst & Young<br />
Adolfo Ajero ist Kubas erster selbstständiger Steuerberater – Folge der „stillen Revolution des Kapitals“<br />
von Claas Relotius<br />
H<br />
in und wieder wandelt sich ein<br />
Land oder System so leise und<br />
schleichend, schrieb Fidel Castro<br />
einst, dass selbst die Gewinner des Wandels<br />
ihre Chancen nicht auf Anhieb begriffen.<br />
So ging es auch Adolfo Ajero, als er vor<br />
etwas mehr als einem Jahr den an ihn adressierten<br />
Brief der Regierung öffnete, um<br />
darin seine rot-weiß-blaue Entlassungsurkunde<br />
zu finden. Bis zu diesem Tag hatte<br />
Ajero 29 Jahre lang als Fahrlehrer in Havanna<br />
gearbeitet, wie fast alle Kubaner<br />
<strong>vom</strong> Staat beschäftigt. Um der sozialistischen<br />
Idee zu dienen, wie es in Kubas Verfassung<br />
heißt.<br />
In dem Schreiben aber teilte man ihm<br />
mit, er sei einer jener 400 000 Staatsbediensteten,<br />
der jetzt eigenen Geschäften<br />
nachgehen könne. Zunächst war er verzweifelt:<br />
Wie sollte man, dachte der 51-Jährige,<br />
als privater Geschäftsmann ein Auskommen<br />
finden in einem System, in dem<br />
mehr als 50 Jahre lang jede Form von Privatwirtschaft<br />
verboten war?<br />
Seine Frau Ana brach vor den beiden<br />
Töchtern in Tränen aus. Er selbst schimpfte<br />
auf den Staat, rief „Nieder mit den Castros!“,<br />
grübelte Abend für Abend vor sich<br />
hin, wie sich Geld verdienen ließe, und<br />
ging schließlich doch in die nächste Bodega,<br />
um die Angst vor der Zukunft wegzutrinken.<br />
Dann, nach drei Wochen, hatte<br />
er plötzlich eine Idee, die aus einem Fahrlehrer,<br />
der wegen seiner Entlassung zu verzweifeln<br />
drohte, einen der gefragtesten Unternehmer<br />
Havannas gemacht hat.<br />
Eine simple Idee machte aus<br />
dem Ex-Fahrlehrer Havannas<br />
gefragtesten Unternehmer<br />
Ajero ist der erste kubanische Steuerberater,<br />
den die Insel in 60 Jahren gesehen<br />
hat. Vielleicht erkannte er am schnellsten,<br />
dass mit der <strong>neuen</strong> Selbstständigkeit auf<br />
Kuba nicht nur lang ersehnte Freiheiten,<br />
sondern auch ungewohnte Pflichten einhergehen.<br />
Wer eine Unternehmerlizenz<br />
besitzt, der darf Angestellte beschäftigen<br />
und weit mehr verdienen als den bisherigen<br />
Einheitslohn. Er muss aber auch Einkommensteuer<br />
zahlen und Beiträge zur Sozialversicherung<br />
leisten. Für die meisten Kubaner<br />
ein völlig neues System. Und für Ajero<br />
eine Marktlücke, die es zu füllen gilt.<br />
Ajeros Aufstieg hat viel mit der „stillen<br />
Revolution des Kapitals“ zu tun, von<br />
der sich die Menschen in den Gassen der<br />
Hauptstadt hinter vorgehaltener Hand erzählen.<br />
Drei schwere Hurrikans, die Weltwirtschaftskrise,<br />
vor allem aber Jahrzehnte<br />
kommunistischer Planwirtschaft hatten das<br />
Land ökonomisch an den Rand des Ruins<br />
gebracht, als sich Kubas Präsident Raúl<br />
Castro im Frühjahr 2011 für einen radikalen<br />
Kurswechsel entschied: Das Handelsverbot<br />
für Privatgüter wurde aufgehoben,<br />
Land und Immobilien privatisiert, der Anund<br />
Verkauf von <strong>Auto</strong>s, jahrzehntelang<br />
<strong>vom</strong> Staat untersagt, erlaubt.<br />
Das weitreichendste Eingeständnis des<br />
Scheiterns besteht aber darin, dass das Castro-Regime<br />
bis 2014 mehr als eine Million<br />
Angestellte aus dem Staatsdienst entlässt.<br />
Zimmermänner, Elektriker, Mechaniker,<br />
Friseure, Programmierer, die Liste der Berufe<br />
ist lang, insgesamt 178 Tätigkeiten<br />
sind betroffen. Als Ausgleich erhalten die<br />
Entlassenen Lizenzen, die ihnen erlauben,<br />
was anderen Kubanern weiterhin verwehrt<br />
bleibt – sie dürfen, und sie müssen, Geschäften<br />
auf eigene Rechnung nachgehen.<br />
Aber taugen die Kubaner nach all den Jahren<br />
noch zum Kapitalismus?<br />
An einem <strong>Die</strong>nstagvormittag, der so<br />
heiß ist, dass die streunenden Hunde in den<br />
Straßen wie tot auf den Bordsteinen liegen,<br />
stehen 70 Frauen und Männer Schlange<br />
vor einem zweistöckigen Gebäude, das Eisschrank<br />
heißt. Seinen Namen verdankt das<br />
Haus der angeblich besten Klima anlage der<br />
Stadt. Adolfo Ajero hat erst vor ein paar<br />
Wochen dem Staat zwei Etagen abgekauft<br />
und neue Büroräume einrichten lassen.<br />
Hinter breiten Stahlschreibtischen beschäftigt<br />
er ein Dutzend Angestellte, die meisten<br />
Klienten in der Schlange wollen aber nach<br />
wie vor zum Chef.<br />
Ajero, untersetzte Gestalt, Baseball-<br />
Kappe, gilt als Fachmann. Dabei sagt er<br />
selbst: Seine Arbeit, den Menschen mit ihren<br />
Problemen zu helfen, das könne eigentlich<br />
jeder: „Nur die Geschäftsidee, die habe<br />
eben ich allein gehabt.“<br />
„Wenn bald eine Million Menschen, die<br />
bisher <strong>vom</strong> Staat versorgt wurden, plötzlich<br />
selbst den Staat versorgen sollen“, sagt<br />
er, „dann braucht es jemanden, der ihnen<br />
zeigt, wie man das macht.“ Um die kubanische<br />
Version von Ernst & Young zu<br />
werden, besorgte sich Ajero zunächst die<br />
Gesetzestexte, studierte jeden Absatz und<br />
lud die Nachbarn des Viertels ein, um ihnen<br />
am eigenen Küchentisch Steuertipps<br />
zu erklären. Den Handwerkern zeigte er,<br />
wie sie ihre Werkstätten absetzen können,<br />
und den Einzelhändlern, wie sich bei der<br />
Verkaufssteuer ein paar Pesos sparen lassen.<br />
Das kubanische Steuerrecht, bereits Mitte<br />
der neunziger Jahre mithilfe des ehemaligen<br />
Hamburger SPD-Finanzsenators Klaus<br />
Foto: Claas relotius für <strong>Cicero</strong><br />
84 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Adolfo Ajero arbeitet im<br />
„Eisschrank“. In dem Gebäude mit<br />
der besten Klimaanlage Havannas<br />
gehören seiner Beratungsgesellschaft<br />
schon zwei Etagen<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 85
| K a p i t a l<br />
Gobrecht entwickelt, umfasst gerade mal<br />
70 Artikel. Anwendung finden die Regelungen<br />
erst jetzt, weil durch die „stille Revolution<br />
des Kapitals“ eine kubanische Privatwirtschaft<br />
entsteht.<br />
So wächst mit der Zahl der Selbstständigen<br />
auch die Nachfrage nach Beratung,<br />
und der Name Ajero spricht sich herum.<br />
Hostalbesitzer, Schreinermeister oder einfache<br />
Schuhputzer aus ganz Havanna kommen<br />
nun zu ihm, und aus dem Büro am<br />
Küchentisch entstand ein boomendes kubanisches<br />
Beratungsunternehmen. Im<br />
letzten halben Jahr warf Ajeros Firma fast<br />
20 000 Dollar ab – mehr als er zuvor in<br />
seinem ganzen Leben als Fahrlehrer verdiente.<br />
Er kann einen in Verzweiflung stürzen<br />
und manchmal doch so süß schmecken,<br />
der Kapitalismus.<br />
Als die ersten Entlassungen verkündet<br />
wurden, hielt Präsident Raúl Castro gemeinsam<br />
mit seinem Bruder und Amtsvorgänger<br />
Fidel eine Fernsehansprache.<br />
Wenn sich jeder mit Kraft und Schweiß<br />
für das Land zerreiße, beschworen die Castros,<br />
dann werde das neue Kuba keine gänzlich<br />
andere Welt sein – nur „más bonito“,<br />
noch schöner. Rund um die Uhr zeigten<br />
alle Sender tagelang das neue Evangelium<br />
der Castros.<br />
Für Ajero hat sich die frohe Botschaft<br />
erfüllt. Und auf der ganzen Insel ist eine<br />
Art Goldgräberstimmung spürbar. An der<br />
Universität von Havanna lernen bereits<br />
heute 400 Studenten, wie man Geschäftspläne<br />
erstellt, Güter auf den Markt bringt<br />
und Profit maximiert. Aktivitäten, die<br />
noch vor kurzem als konterrevolutionäre<br />
Straftaten galten, für die man auf direktem<br />
Weg ins Gefängnis wanderte. Kubas<br />
Machthaber bezeichnen die Bankrotterklärung<br />
der eigenen Politik als bloße „Aktualisierung“<br />
des Sozialismus. Was sie dabei<br />
verschweigen: Richtig attraktiv ist der freie<br />
Markt bisher vor allem für ausländische Investoren,<br />
die mit Privatflugzeugen und Aktenkoffern<br />
voll Dollarscheinen aus Miami<br />
kommen, um zu Schnäppchenpreisen Bauflächen<br />
und Immobilien zu kaufen.<br />
Kubas Machthaber bezeichnen<br />
den Bankrott ihrer Politik als<br />
„Aktualisierung“ des Sozialismus<br />
Für die Mehrheit der Einheimischen<br />
ist der Alltag dagegen mehr denn je zum<br />
Überlebenskampf geworden. Am Ende der<br />
Avenida Salvador Allende, einer der pulsierenden<br />
Hauptverkehrsadern Havannas, haben<br />
Hunderte junge und alte Kubaner, die<br />
noch vor gut einem Jahr als Handwerker,<br />
Taxifahrer oder Elektriker auf der staatlichen<br />
Gehaltsliste standen, ihre Stände aufgebaut.<br />
Haushaltsgeräte, Kleider, Hüte,<br />
Bücher, Schallplatten, Handys, Unterwäsche,<br />
Klobrillen, Kondome, an den Ständen<br />
auf der Plaza Conquistador liegt alles<br />
aus, was ein paar Pesos verspricht. Dazwischen<br />
ziehen schwitzende Gemüsehändler<br />
mit ihren Holzschubkarren durch die<br />
Straßen.<br />
Der lauteste unter den durcheinanderschreienden<br />
Händlern ist Joel, 36, weit<br />
aufgeknöpftes Hemd, ein Gesicht wie der<br />
junge Charles Bronson. „Ofertas, Ofertas!“<br />
<strong>Die</strong> Stimme krächzt, doch Joel jagt weiter<br />
wie ein Irrwisch vor seinen Stellwänden mit<br />
CDs auf und ab. Wo er die Sachen herbekommt,<br />
die er verkauft? „Von Roberto“,<br />
sagt Joel. Kubas gängigster Vorname ist unter<br />
Havannas Kleinunternehmern zum Synonym<br />
für einen Händler geworden, den<br />
es gar nicht gibt. „Von Roberto“ heißt so<br />
viel wie illegal – so beschaffen sich hier die<br />
meisten ihr schmales Angebot, um irgendwie<br />
zu überleben.<br />
„Als Selbstständiger musst du ein Chamäleon<br />
sein“, sagt Joel, und doch: „Sogar<br />
das beste Chamäleon braucht etwas, um<br />
den Motor zum Laufen zu bringen.“ Es<br />
ist diese Erkenntnis, welche die Leute hier<br />
eint: Der Kapitalismus funktioniert nur,<br />
wenn man auch Kapital hat. Den meisten<br />
Kleinfabriken, Werkstätten oder Handwerksbetrieben<br />
mangelt es an Maschinen<br />
und Material.<br />
„Es ist wie eine Schlinge um deinen<br />
Hals“, sagt Joel. „Wenn du nichts besitzt,<br />
lässt dich das neue System ins Leere fallen<br />
und bricht dir das Genick.“<br />
Der Erfolg von Ajero, dem Steuerberater,<br />
und die gleichzeitige Misere Joels –<br />
Welten scheinen dazwischen zu liegen und<br />
doch sind beides unmittelbare Folgen der<br />
Reformen. Ist das gerecht? Was bedeutet<br />
Gleichheit? Was Freiheit? Und: Wiegt Freiheit<br />
mehr als Sicherheit?<br />
In der Bar La Floridita, in welcher der<br />
Legende nach Hemingway den Daiquiri<br />
für sich entdeckte, sitzt der Ökonom Oscar<br />
Espinosa Alvarez, 46, an der holzvertäfelten<br />
Bar. Er stochert in seinem ersten Drink seit<br />
14 Monaten. So lange saß er im Gefängnis,<br />
weil er auf dem Höhepunkt der Krise im<br />
kubanischen Fernsehen gefragt hatte, wie<br />
es sein könne, dass eine Bananenrepublik<br />
nicht in der Lage sei, der darbenden Bevölkerung<br />
wenigstens ausreichend Bananen<br />
zur Verfügung zu stellen?<br />
Er leugnet nicht, dass die Reformen<br />
genau hier ansetzen und bereits erste Erfolge<br />
erkennbar sind. Seit kubanische Bauern<br />
ihr eigenes Land bewirtschaften dürfen,<br />
steigt die Produktivität, die Versorgungssituation<br />
entspannt sich. Und doch bebt<br />
Wut in Espinosas Stimme, wenn er über<br />
den Einzug des Kapitalismus in seiner Heimat<br />
spricht.<br />
„Das Land steht am Scheideweg, und<br />
die Frage ist, was wir Kubaner in Zukunft<br />
wollen“, sagt er. „Den zügellosen Individualismus<br />
der Amerikaner, bei denen die<br />
Armen weder Bildung noch Medikamente<br />
bekommen? Das rastlose Wachstum der<br />
Chinesen, die gleichzeitig ihre Umwelt ruinieren?<br />
Oder die Bankendiktatur Europas,<br />
die euer ganzes System kollabieren<br />
lässt?“<br />
Über solche Fragen zerbricht sich<br />
Adolfo Ajero nicht den Kopf. Er will expandieren.<br />
Erst kürzlich verabschiedete<br />
die Regierung ein Lohnsteuergesetz, das<br />
ab sofort alle Kubaner zur Kasse bitten<br />
wird. „Eine Riesenchance für mich“, sagt<br />
Ajero, doch er weiß auch: <strong>Die</strong> Konkurrenz<br />
schläft nicht. Weil das Geschäft mit den<br />
Steuern so lukrativ ist, werden Beratungsfirmen<br />
in Havanna schon bald wie Pilze aus<br />
dem Boden schießen. Dann gehe es darum,<br />
effizienter zu arbeiten und leistungsstärker<br />
zu sein als die anderen. „Wer das beste Angebot<br />
hat, entscheidet nicht mehr die Regierung“,<br />
sagt Ajero. Es entscheidet allein<br />
der Markt.<br />
Claas Relotius<br />
berichtet als freier<br />
Auslandsreporter regelmäßig<br />
aus Lateinamerika<br />
Foto: Philipp Wieland<br />
86 <strong>Cicero</strong> 7.2013
DAS GANZE SEHEN –<br />
MIT DER NEUEN CAPITAL<br />
Bio, Bauern und Bonanza – die Energiewende ist ein großes Projekt.<br />
Und eine große Geldmaschine. Alle zahlen, einige wenige werden reich.<br />
<strong>Die</strong> ganze Geschichte erzählt die neue Capital.
| K a p i t a l | M i l l i a r d ä r e<br />
„Deutsche UnternehmeR<br />
sind zu verklemmt“<br />
Drogerieketten-Inhaber Dirk Rossmann fordert einen höheren Spitzensteuersatz, hält<br />
die neue Rundfunkgebühr für unsinnig und findet Uli Hoeneß‘ Verhalten gefährlich<br />
„Wenn man das<br />
Glück hat, sehr viel<br />
Geld zu verdienen,<br />
dann erwächst<br />
daraus eine Pflicht,<br />
sich gesellschaftlich<br />
einzubringen“<br />
Foto: Silke Kirchhoff für <strong>Cicero</strong><br />
88 <strong>Cicero</strong> 7.2013
H<br />
err Roßmann, warum werden<br />
Eigentümer von Drogerieketten<br />
so häufig verhaltensauffällig?<br />
Wie kommen Sie denn darauf?<br />
Götz Werner propagiert seit Jahren die<br />
Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens,<br />
Anton Schlecker geht als<br />
Marktführer wortlos pleite, und Sie fordern<br />
mitten im Bundestagswahlkampf höhere<br />
Steuern für Reiche?<br />
Sie haben insofern recht, dass Götz Werner<br />
und ich uns häufiger in gesellschaftliche<br />
Debatten einmischen. Ich bin zwar<br />
in keiner Partei Mitglied, aber ich war<br />
schon immer ein politischer Mensch,<br />
der mitdenken und mitgestalten wollte.<br />
Wenn man das große Glück hat, erfolgreich<br />
zu sein und sehr viel Geld im Leben<br />
zu verdienen, dann erwächst daraus<br />
für mich auch eine Pflicht, sich gesellschaftlich<br />
einzubringen und sein Gesicht<br />
zu zeigen.<br />
Also handelt es sich nicht um eine geschickte<br />
Marketingmaßnahme oder das<br />
Ausleben eines Rampensau-Gens?<br />
Quatsch, glauben Sie ernsthaft, dass das<br />
Unternehmen Rossmann davon profitiert<br />
hat, als ich mich für den damaligen Bundespräsidenten<br />
Christian Wulff eingesetzt<br />
habe? Von den 1000 Zuschriften, die ich<br />
bekam, waren 800 vernichtend und nur<br />
200 positiv.<br />
Warum haben Sie es dann getan?<br />
Ich habe mich einfach über die Art der<br />
Berichterstattung aufgeregt. Das war für<br />
mich ein Schockerlebnis, diese Hetzjagd,<br />
die die Medien veranstaltet haben.<br />
Es ging mir dabei gar nicht so sehr um<br />
Wulff, der mit Sicherheit auch Fehler gemacht<br />
hat. Aber Sie müssen das doch<br />
nur mal mit dem Fall Hoeneß jetzt vergleichen,<br />
der Steuern in Millionenhöhe<br />
hinterzogen hat. Ich kann nicht erkennen,<br />
dass dazwischen irgendwie differenziert<br />
wird, obwohl es bei Wulff um wesentlich<br />
kleinere Beträge ging. <strong>Die</strong> Frage,<br />
die mich aber noch viel mehr beschäftigt:<br />
Warum mischen sich so wenige Unternehmer<br />
in Deutschland öffentlich ein?<br />
Haben Sie eine Theorie?<br />
Ja, ich glaube, viele Unternehmer in<br />
diesem Land sind zu schüchtern und<br />
vielleicht ein bisschen zu verklemmt.<br />
Meinen Sie das ernst?<br />
Ja, Politiker und Schauspieler müssen<br />
sich zwangsläufig ins Scheinwerferlicht<br />
der Öffentlichkeit begeben, um ihre Berufe<br />
ausüben zu können. Ich kenne aber<br />
viele Unternehmer, die als Person kein<br />
besonders ausgeprägtes Selbstbewusstsein<br />
haben. <strong>Die</strong> definieren sich nur über<br />
ihr Unternehmen, ihren Maschinenpark,<br />
ihr Vermögen, über das, was sie geschaffen<br />
haben. In diesem abgegrenzten Bereich<br />
gegenüber ihren Mitarbeitern oder<br />
am Verhandlungstisch treten sie auch<br />
sehr selbstsicher auf. In der Öffentlichkeit<br />
aber sind viele von ihnen unsicher,<br />
weil sie mit direkter Kritik nicht umgehen<br />
können. Das sind sie von ihren Mitarbeitern<br />
nicht gewohnt. Ich habe damit<br />
auch zu spät angefangen und musste den<br />
Umgang mit der Öffentlichkeit und den<br />
Medien erst mühsam erlernen.<br />
Haben die Reichen in Deutschland nicht<br />
viel mehr Angst vor Neid als ein Problem<br />
mit ihrem Selbstbewusstsein?<br />
Mag sein, dass auch Neid eine Rolle<br />
spielt. Wenn ich im Ausland bin, stelle<br />
ich aber ohnehin immer wieder fest, dass<br />
wir eine völlig verzerrte Selbstwahrnehmung<br />
haben. Nach einer aktuellen BBC-<br />
Umfrage ist Deutschland das beliebteste<br />
Land der Welt. Wir genießen also großes<br />
Ansehen in der ganzen Welt, aber<br />
das spiegelt sich in der Grundstimmung<br />
in Deutschland nicht wider. Es geht mir<br />
auch nicht um eine Nivellierung. Ich bin<br />
dafür, dass es Unterschiede gibt, und bin<br />
dagegen, dass alle das gleiche Gehalt bekommen<br />
und alle in identischen Häusern<br />
Dirk RoSSmann gründete 1972 den ersten<br />
Drogeriemarkt mit Selbstbedienung<br />
in Deutschland. Im vergangenen Jahr erzielte<br />
das Unternehmen des 66-Jährigen<br />
einen Rekordumsatz von 5,9 Milliarden<br />
Euro, eine Steigerung von 16,1 Prozent.<br />
Nach der Pleite des Marktführers Schlecker<br />
2012 ist Roßmann die Nummer zwei<br />
auf dem deutschen Drogeriemarkt hinter<br />
dm. Er beschäftigt 36 000 Mitarbeiter<br />
in 2776 Filialen, 1754 davon in Deutschland.<br />
Sein Vermögen wird auf 1,5 Milliarden<br />
Euro geschätzt.<br />
til<br />
wohnen. Wenn die Schere zwischen den<br />
Reichen und den Armen aber immer<br />
weiter auseinanderklafft, ist das gefährlich.<br />
Wenn die Reichen sich dann auch<br />
nicht mehr an Gesetze halten, wie es der<br />
Fall Uli Hoeneß zeigt, der eigentlich ein<br />
Sympathieträger ist, macht das eine Gesellschaft<br />
fragil. Ich bleibe dabei: Wer<br />
mehr hat, der trägt auch eine höhere Verantwortung<br />
für den Zusammenhalt der<br />
Gesellschaft.<br />
Womit wir bei Ihren Steuervorschlägen<br />
wären. Sie setzen sich für eine Erhöhung<br />
des Spitzensteuersatzes von 42 Prozent<br />
auf 49 Prozent ein. Warum wollen Sie<br />
mehr Steuern zahlen?<br />
Ich kenne einige vermögende Menschen.<br />
Acht von zehn reichen Leuten haben kein<br />
Problem mit der Idee, höhere Einkommenssteuer<br />
zahlen zu müssen. <strong>Die</strong> sehen<br />
das locker und liegen wegen der Reichensteuer<br />
schon jetzt bei einem Steuersatz<br />
von 45 Prozent.<br />
<strong>Die</strong> Grünen haben einen ähnlich lautenden<br />
Vorschlag in ihrem Wahlprogramm: Ab<br />
60 000 Euro soll man 45 Prozent zahlen,<br />
ab 80 000 Euro dann 49 Prozent. Sind<br />
diese Grenzen sinnvoll?<br />
Ich halte sie für etwas niedrig, aber ich<br />
werde mich jetzt nicht von Ihnen auf einen<br />
bestimmten Betrag festnageln lassen.<br />
<strong>Die</strong> Grenzen muss die Politik selbst<br />
festlegen.<br />
Haben Sie noch weitere Vorschläge?<br />
<strong>Die</strong> Steuer auf Zinserträge sollte von<br />
25 Prozent auf 30 Prozent erhöht werden.<br />
Bei den Krankenkassen sollte man überlegen,<br />
ob nicht alle verpflichtet werden,<br />
in die gesetzliche Krankenkasse einzuzahlen.<br />
Es hindert mich doch keiner, darüber<br />
hinaus auch noch private Zusatzversicherungen<br />
abzuschließen. Wenn jeder einzahlen<br />
muss, ließe sich der Beitragssatz<br />
von 14 Prozent auf 10 Prozent senken.<br />
Also Bürgerversicherung und höhere<br />
Zinsertragssteuer, das stammt jetzt aus<br />
dem SPD-Wahlprogramm. Wollen Sie<br />
auch einen Mindestlohn von 8,50 Euro<br />
netto, wie Sozialdemokraten und Grüne<br />
ihn fordern?<br />
Ich bin nicht gegen Mindestlöhne, solange<br />
dadurch keine Arbeitsplätze gefährdet<br />
werden. Bei uns verdient eine<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 89
| K a p i t a l | M i l l i a r d ä r e<br />
Verkäuferin im Monat etwa 2100 Euro<br />
brutto je nach Betriebszugehörigkeit. Das<br />
macht bei 150 Stunden im Monat einen<br />
Bruttolohn von 14 Euro. Damit liegt sie<br />
netto auch noch über den 8,50 Euro.<br />
Eben haben Sie noch Christian Wulff verteidigt,<br />
jetzt klingt es so, als wünschten<br />
Sie sich eine Neuauflage der rot-grünen<br />
Koalition?<br />
Unsinn, ich vertrete vor allem bei den<br />
Themen Vermögens- und Erbschaftssteuer<br />
ganz andere Ansichten als die SPD<br />
und die Grünen.<br />
Eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer<br />
lehnen Sie demnach ab?<br />
Davon halte ich überhaupt nichts, auch<br />
wenn selbst deren Befürworter das Betriebsvermögen<br />
davon ausnehmen wollen.<br />
Das linke Spektrum stellt sich das<br />
aber immer zu leicht vor. <strong>Die</strong> Abgrenzung<br />
von Privat- und Betriebsvermögen<br />
ist wahnsinnig kompliziert. Experten gehen<br />
davon aus, dass allein der Verwaltungsaufwand<br />
für die Erhebung einer<br />
Vermögenssteuer so hoch wäre, dass am<br />
Ende kaum etwas von den zusätzlichen<br />
Steuereinnahmen übrig bleiben würde.<br />
Das haben früher auch SPD und Grüne<br />
gewusst und unter Bundeskanzler Gerhard<br />
Schröder von einer Wiedereinführung<br />
abgesehen.<br />
Und für die Erbschaftssteuer gilt das<br />
ebenfalls?<br />
Wir haben ein sehr vernünftiges Erbschaftssteuerrecht<br />
in Deutschland mit einem<br />
Regelsteuersatz von 30 Prozent. Es<br />
gibt seit der Steuerreform 2008 die Möglichkeit,<br />
beim Übertragen eines Unternehmens<br />
auf die nächste Generation die<br />
Zahlung der Steuer zu vermeiden, wenn<br />
die Erben den Betrieb mindestens zehn<br />
Jahre weiterführen. Wer das ändern will,<br />
macht einen Fehler, weil dann die Substanz<br />
der Unternehmen besteuert wird.<br />
Daran kann keiner ein Interesse haben,<br />
weil dadurch viele Arbeitsplätze gefährdet<br />
werden.<br />
Also wünschen Sie sich eine neue Große<br />
Koalition?<br />
Es kommt nicht darauf an, was ich mir<br />
wünsche. Ich kann nur sagen, dass die<br />
Regierung Schröder und die Große Koalition<br />
unter Bundeskanzlerin Angela<br />
„Wie wichtig die<br />
Steuerreform für<br />
Unternehmen<br />
war, hat die Krise<br />
gezeigt. Mit dem<br />
alten Steuerrecht<br />
wären die Firmen<br />
reihenweise<br />
kollabiert“<br />
Merkel kluge und weitsichtige Unternehmenssteuerreformen<br />
durchgeführt haben.<br />
Davor war es gerade für Familienunternehmen<br />
schwierig, Eigenkapital<br />
für die Firma zu bilden. Als Exportland<br />
brauchen wir aber dringend finanziell gesunde<br />
Firmen, die investieren können,<br />
um international wettbewerbsfähig zu<br />
bleiben. Wie wichtig die Reformen waren,<br />
hat die Wirtschaftskrise gezeigt. Nur<br />
weil die Firmen vorher etwas Speck ansetzen<br />
konnten, sind wenige in die Insolvenz<br />
gegangen, als plötzlich die Aufträge<br />
wegbrachen. Mit dem alten Steuerrecht<br />
wären die Unternehmen in der Krise reihenweise<br />
kollabiert. So schnell hätten Sie<br />
gar nicht berichten können.<br />
Sie engagieren sich seit mehr als 20 Jahren<br />
mit Ihrer Stiftung Weltbevölkerung als<br />
Entwicklungshelfer in Ostafrika. Warum<br />
stecken Sie nicht mehr Geld in diesen<br />
Bereich, statt eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes<br />
zu fordern?<br />
Für mein soziales Engagement suche ich<br />
mir Bereiche, wo ich mit relativ geringem<br />
finanziellen Aufwand viel erreichen<br />
kann. Viele Menschen haben keinen<br />
Zugang zu Verhütungsmitteln, dabei<br />
kostet es nur 13 Euro, ein Paar pro Jahr<br />
damit zu versorgen. Das ist ein Anliegen<br />
der Stiftung Weltbevölkerung, weil wir<br />
dadurch helfen können, unkontrolliertes<br />
Bevölkerungswachstum, Aids, ungewollte<br />
Schwangerschaften und die daraus<br />
resultierenden Probleme zu vermeiden.<br />
In Ordnung, aber warum braucht der<br />
Staat noch mehr Geld? 2013 rechnet<br />
der Staat mit 615 Milliarden Euro an<br />
Steuereinnahmen – das ist Rekord.<br />
Ihr Argument ist bekannt und auch<br />
nicht falsch. Wir sollten immer auch<br />
die Kosten seite im Auge haben. Für<br />
mich ist es auch unfassbar, wie viel Geld<br />
bei Großprojekten wie dem Bau des<br />
Berliner Flughafens oder bei Stuttgart 21<br />
verschwendet wird. Wenn der Bau<br />
unseres <strong>neuen</strong> Zentrallagers plötzlich<br />
das Doppelte kosten würde, könnte ich<br />
mir das nicht leisten. Sie dürfen auf der<br />
anderen Seite aber auch nicht vergessen,<br />
dass die Aufgaben des Staates sehr<br />
vielfältig und breit angelegt sind.<br />
Gilt dasselbe nicht auch für die Aufgaben<br />
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in<br />
Deutschland. Warum wehren Sie sich mit<br />
Händen und Füßen gegen die Zahlung der<br />
<strong>neuen</strong> Rundfunkgebühr?<br />
Ich erzähle Ihnen jetzt mal, wie das war:<br />
Ich war für ein Wochenende in einem<br />
Wellnesshotel im Spreewald. Abends<br />
guckte ich die „Tagesschau“ und erfuhr<br />
dort, dass die Firma Rossmann gegen die<br />
<strong>neuen</strong> GEZ-Gebühren klagt: „Das ist ja<br />
interessant“, dachte ich.<br />
Sie wussten das gar nicht?<br />
Nein, wir sind hier 20 Personen in der<br />
Geschäftsleitung mit klar abgegrenzten<br />
Kompetenzen. Der zuständige Geschäftsführer<br />
und unsere Anwälte hatten<br />
die Klage eingereicht. Es ist hier nicht<br />
so, dass alle erst loslegen, wenn der Boss<br />
eine Ansage macht. Nach meiner Rückkehr<br />
habe ich mir das erklären lassen und<br />
stehe voll hinter der Entscheidung.<br />
Es soll um Mehrausgaben von etwa<br />
200 000 Euro gehen. Ist das für die Firma<br />
Rossmann nicht mehr tragbar?<br />
Es geht hier überhaupt nicht ums Geld,<br />
sondern, auch wenn das etwas pathetisch<br />
klingen mag, um Gerechtigkeit. Wir<br />
klagen gegen eine unsinnig Regelung,<br />
weil es nicht in Ordnung ist, dass ich<br />
plötzlich für jeden einzelnen Standort<br />
Rundfunkgebühren zahlen soll, obwohl wir<br />
in unseren Filialen weder Radio, Fernsehen<br />
noch Internet haben. Ich werde zu Unrecht<br />
häufig als streitlustig bezeichnet. Ich bin<br />
friedfertig, aber gegen Ungerechtigkeit<br />
habe ich mich schon immer gewehrt.<br />
Das Gespräch führte Til Knipper<br />
90 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Jetzt<br />
im<br />
Handel.<br />
BISMARCK Der preußische Strippenzieher<br />
PAZIFISTEN Begeisterung für den Traum <strong>vom</strong> Frieden<br />
ZEPPELIN <strong>Die</strong> Erfindung der Luftfahrt<br />
www.spiegel-geschichte.de
| K a p i t a l | E s s a y<br />
<strong>Die</strong> Diktatur<br />
der Zukunft<br />
Hochwasser in Deutschland. Hochzeit für<br />
Klimaapokalyptiker. Im Namen unserer Urenkel<br />
verlangen sie, unsere Freiheitsrechte zu opfern.<br />
Ein Plädoyer für den Fortschrittsglauben<br />
von Hans-<strong>Die</strong>ter Radecke und Lorenz Teufel<br />
N<br />
och bis in die 1840er Jahre entführten<br />
Skidi-Pawnee-Indianer<br />
junge Mädchen von Nachbarstämmen<br />
und schlachteten sie<br />
auf einem kunstvoll errichteten<br />
Schafott. <strong>Die</strong>ses Opfer war notwendig, um<br />
die Fruchtbarkeit der Felder für die Zukunft<br />
zu sichern.<br />
Der Glaube, man könne die Zukunft<br />
durch ein Opfer in der Gegenwart günstig<br />
beeinflussen, war (und ist) in vielen Kulturen<br />
verbreitet. <strong>Die</strong> Verbindung zur Zukunft<br />
wird dabei von angesehenen Spezialisten<br />
hergestellt. Sie nennen sich Seher,<br />
Schamanen, Astrologen, Priester – oder<br />
Wissenschaftler.<br />
Im Zuge der Aufklärung übernahm die<br />
Wissenschaft immer häufiger das Geschäft<br />
der Zukunftsprognose. Basierend auf ihren<br />
Vorhersagen definierten die einflussreichsten<br />
Personen der Gesellschaft die Opfer,<br />
Illustration: Rüdiger Trebels c/o Claudia Schönhals<br />
92 <strong>Cicero</strong> 7.2013
die für das Glück der zukünftigen Generationen<br />
erbracht werden mussten. Und<br />
die waren nötig, denn Ende des 19. Jahrhunderts<br />
stand nach übereinstimmender<br />
Meinung der maßgeblichen Experten der<br />
Niedergang der Menschheit oder doch zumindest<br />
bestimmter Teile davon unmittelbar<br />
bevor.<br />
<strong>Die</strong>se Gewissheit basierte auf einem<br />
alternativlosen Wissenskonsens, Darwins<br />
Evolutionstheorie: <strong>Die</strong> Natur war durch<br />
verantwortungsloses menschliches Handeln<br />
aus dem Gleichgewicht geraten. Eine<br />
wachstumsorientierte Sozialpolitik, die der<br />
natürlichen Auslese, Darwins „survival of<br />
the fittest“ entgegenwirkte und auch die<br />
weniger „Fitten“ begünstigte, behinderte<br />
die nachhaltige Entwicklung der Menschheit<br />
und gefährdete den ohnehin brüchigen<br />
Weltfrieden. <strong>Die</strong> Diagnose war eindeutig,<br />
schmerzliche therapeutische Mittel waren<br />
also unumgänglich. „Es muss der menschliche<br />
Artprozess durch die Ausbildung einer<br />
Theorie und Praxis der Eugenik so weit<br />
rationell beeinflusst werden, dass die Fortpflanzung<br />
von konstitutionell Minderwertigen<br />
zuverlässig verhindert wird“, sagte der<br />
gesundheitspolitische Sprecher der SPD<br />
und Reichstagsabgeordnete Professor Alfred<br />
Grotjahn in den zwanziger Jahren.<br />
Ziel einer zukunftsorientierten Politik<br />
konnte es demnach nur sein, die Freisetzung<br />
„schädlichen“ Erbmaterials so weit als<br />
möglich zu verhindern. Der Ausstoß „giftiger“<br />
Erbfaktoren durch den hemmungslosen<br />
Wachstumswahn der weniger „Fitten“<br />
musste zwangsläufig zum Erbgutwandel<br />
und damit zur Verunreinigung der natürlichen<br />
Genosphäre führen.<br />
Viele Staaten suchten ihr Heil im alternativlosen<br />
Wissenschaftskonsens und<br />
setzten auf Genschutzprogramme. Das<br />
vermeintlich hehre Ziel, den Gen-Wandel<br />
aufzuhalten, rechtfertigte auch unorthodoxe,<br />
autoritäre staatliche Eingriffe.<br />
Zwangssterilisierungen, Heiratsverbote für<br />
Epileptiker, Zwangskastrationen für Geistesschwache<br />
waren die Mittel, mit denen<br />
der Genpool transformiert werden sollte.<br />
1933 forderte der Literaturnobelpreisträger<br />
und Sozialist George Bernhard Shaw,<br />
dass eine Zivilisation diejenigen ausrotten<br />
müsse, die den Ansprüchen nicht genügen.<br />
Um den Eugenikgott milde zu stimmen,<br />
war dem Menschheitsfreund kein Opfer<br />
zu groß.<br />
Heute liefert die Klimawissenschaft einen<br />
ähnlich alternativlosen Wissenskonsens:<br />
<strong>Die</strong> globale Durchschnittstemperatur<br />
steigt, und das <strong>vom</strong> Menschen gemachte<br />
CO 2 ist schuld. Wieder werden zum Wohl<br />
zukünftiger Generationen drastische<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 93
| K a p i t a l | E s s a y<br />
Eingriffe in die Freiheit des Einzelnen vorgenommen.<br />
<strong>Die</strong> Opferung enormer finanzieller<br />
Ressourcen und rücksichtslose Naturzerstörung<br />
durch Flächenverbrauch für<br />
ökonomisch und teilweise auch ökologisch<br />
fragwürdige erneuerbare Energieträger sind<br />
leider nur die Spitze des Eisbergs.<br />
Der Potsdamer Klimaforscher Hans Joachim<br />
Schellnhuber ist gar bereit, die Demokratie<br />
aufzugeben. Er will die Macht<br />
der demokratischen Mehrheit auf „ein paar<br />
wenige Leute, die eine ethische Elite darstellen“,<br />
übertragen. Zusammen mit seinem<br />
Kollegen Stefan Rahmstorf fordert<br />
er eine große Transformation der Gesellschafts-<br />
und Wirtschaftsordnungen. Ziel ist<br />
ein Planwirtschaftssystem, in dem „sämtliche<br />
Planungsmaßnahmen zu Raumordnung,<br />
Stadtentwicklung, Küstenschutz<br />
und Landschaftspflege unter einen obligatorischen<br />
Klimavorbehalt gestellt werden“.<br />
Der amerikanische Klimaforscher<br />
James E. Hansen ruft die chinesischen Despoten<br />
auf, die Menschheit vor dem Klimatod<br />
zu retten. Das kommunistische China<br />
sei die „letzte Hoffnung der Welt“. Weather-Channel-Klimaexpertin<br />
Heidi Cullen<br />
will allen Meteorologen, die die Rolle<br />
des Menschen bei der globalen Erwärmung<br />
leugnen, die berufliche Zulassung<br />
entziehen.<br />
<strong>Die</strong> Beamten im deutschen Umweltbundesamt<br />
bezichtigen Journalisten und<br />
Wissenschaftler, die den „Kenntnisstand<br />
der Klimawissenschaft“ kritisch hinterfragen,<br />
gar der Unfähigkeit und Käuflichkeit.<br />
Elitenherrschaft, Totalitarismus, Berufsverbot<br />
und Pranger, was noch? Um<br />
den Klimagott nachhaltig zu besänftigen,<br />
fehlt eigentlich nur noch das Menschenopfer.<br />
Der Grazer Professor Richard Parncutt<br />
hat diese Lücke geschlossen: Er forderte die<br />
„Todesstrafe für einflussreiche Leugner der<br />
globalen Erderwärmung“. Eine Erklärung,<br />
woher ausgerechnet Parncutt als Musikwissenschaftler<br />
seine Expertise herleitet, blieb<br />
er den Lesern seines Pamphlets schuldig.<br />
Nach heftigen Protesten hat er sich inzwischen<br />
für seine Äußerungen entschuldigt.<br />
Ganz offensichtlich sind viele Menschen<br />
bereit, fast alles zu tun, wenn ihnen<br />
jemand sagt, das Wohl zukünftiger<br />
Generationen hänge davon ab. Sie opfern<br />
Geld, Freiheit und das Leben anderer.<br />
Aus der Geschichte lässt sich dieses<br />
Vertrauen in die Prognosefähigkeit der<br />
Um die<br />
Klimagötter<br />
gnädig zu<br />
stimmen,<br />
fehlt nur noch<br />
der Ruf nach<br />
Menschenopfern<br />
Zukunftsspezialisten nicht ableiten. <strong>Die</strong><br />
Liste falscher Vorhersagen ist lang.<br />
Als Mitte des 19. Jahrhunderts Experten<br />
errechneten, die Straßen New Yorks<br />
würden spätestens 1910 unter Pferdemist<br />
ersticken, da klang diese Prognose durchaus<br />
glaubwürdig. <strong>Die</strong> exzessive Nutzung<br />
des „Rohstoffs“ Pferd musste zwangsläufig<br />
zu Problemen mit den dabei anfallenden<br />
Abfallstoffen führen. <strong>Die</strong> New Yorker<br />
widerstanden der Versuchung, die Innenstadt<br />
zur Umweltzone zu erklären und<br />
nur noch Ponys vor Kutschen zu erlauben.<br />
Auch Mist-Emissionszertifikate blieben ihnen<br />
erspart. Unsere Vorfahren taten etwas,<br />
was in den Modellrechnungen nicht vorkam:<br />
Sie erfanden das <strong>Auto</strong>.<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts erklärte<br />
der Physiker Lord Kelvin in einer „Science<br />
is settled“-Rede die Physik für abgeschlossen:<br />
„Jetzt gibt es nichts Neues mehr in<br />
der Physik zu entdecken. Wir müssen jetzt<br />
nur noch zunehmend genauere Messungen<br />
durchführen.“ Kurz darauf revolutionierten<br />
Quanten- und Relativitätstheorie die<br />
Physik grundlegend und gaben Kelvin der<br />
Lächerlichkeit preis.<br />
<strong>Die</strong> These, wir könnten die Entwicklung<br />
der Wissenschaft oder Menschheit zuverlässig<br />
vorhersagen, ist empirisch nicht<br />
zu begründen und logisch nicht zu beweisen.<br />
Und wie der Philosoph <strong>Die</strong>ter Birnbacher<br />
treffend feststellt, ist „der Glaube an<br />
ein zukünftiges Glück, das durch die Opfer<br />
der Gegenwart ermöglicht wird, durch<br />
nichts belegt. Das Glück der Zukünftigen,<br />
für das der Terror der Gegenwart das unerlässliche<br />
Mittel sein soll, ist kein Ergebnis<br />
wissenschaftlicher Prognostik, sondern<br />
einer den Anspruch der Wissenschaftlichkeit<br />
usurpierenden Prophetie.“<br />
Auch wenn das zweite Jahrhunderthochwasser<br />
innerhalb von elf Jahren und<br />
andere Wetterkatastrophen die Klimaforscher<br />
zu bestätigen scheinen, ist die Treffsicherheit<br />
der bestehenden Modelle zur<br />
Vorhersage des Klimas aus wissenschaftlicher<br />
Sicht von der des reinen Ratens kaum<br />
zu unterscheiden. Denn beim Klima haben<br />
wir es mit einem perfekt chaotischen<br />
physikalischen System zu tun, dessen mittel-<br />
und langfristige Entwicklung prinzipiell<br />
nicht vorhersagbar ist. Dennoch gibt<br />
es nun angeblich einen Klimakonsens, der<br />
mit breiter gesellschaftlicher Zustimmung<br />
als Prognosegrundlage für eine düstere Zukunft<br />
der Menschheit instrumentalisiert<br />
wird und in dessen Namen massive Eingriffe<br />
in die individuelle Freiheit gerechtfertigt<br />
werden.<br />
Für die überwältigende Akzeptanz dieses<br />
herbeigeredeten Menschheitsnotstands<br />
scheinen mehrere nur teilweise bewusste<br />
Prozesse verantwortlich zu sein: <strong>Die</strong> uralte<br />
menschliche Angst vor dem Weltuntergang<br />
erzeugt in Tateinheit mit einer fehlgeleiteten<br />
Wissenschaftsgläubigkeit und<br />
an animistische Vergötterung erinnernde<br />
Naturverklärung ein zivilisationsfeindliches<br />
Gemenge, das die Menschen zu Geißeln<br />
einer virtuellen Zukunft macht, die<br />
nicht weniger von uns verlangt, als dass<br />
wir ihr unsere Art zu leben zum Opfer<br />
bringen.<br />
Bezeichnend ist, dass fast sämtliche geforderten<br />
Maßnahmen zur Vermeidung der<br />
sogenannten Klimakatastrophe auf weniger<br />
Konsum, weniger Wachstum, weniger<br />
Illustration: Rüdiger Trebels c/o Claudia Schönhals<br />
94 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Fotos: Privat (<strong>Auto</strong>ren)<br />
Wohlstand, weniger Markt, weniger individuelle<br />
Freiheit abzielen. Kontrolle und<br />
Beschränkung sind das Ziel. Fast nie ist<br />
die Rede von Kreativität, ergebnisoffener<br />
Forschung oder <strong>neuen</strong> markttauglichen<br />
Technologien. Der eigentliche Feind der<br />
Klimaretter ist nicht das CO 2 . Der Feind<br />
sind Fortschritt und Freiheit. <strong>Die</strong> zukünftigen<br />
Generationen werden missbraucht,<br />
um die eigene Ideologie in der Gegenwart<br />
durchzusetzen. Kritik an dieser Strategie<br />
wird durch eine Erweiterung des Moralbegriffs<br />
auf Menschen, die als Bürger einer<br />
fernen Zukunft dem ihnen zugesprochenen<br />
Rechtsgut noch gar nicht zustimmen<br />
können, regelrecht geächtet.<br />
<strong>Die</strong> Berufung auf das Wohl künftiger Generationen<br />
leidet aber an einer unerträglichen<br />
Selbstherrlichkeit. <strong>Die</strong> ständig erhobenen<br />
Forderungen nach „Gleichgewicht“<br />
und „Nachhaltigkeit“ sind nichts anderes<br />
als der Ausdruck eines stockkonservativen<br />
Denkens, das in letzter Konsequenz<br />
dazu führen würde, unseren Nachfahren<br />
eine ganz bestimmte Lebens- und Denkweise<br />
aufzuzwingen. Woher wissen wir<br />
denn, dass unsere Urenkel dem zustimmen,<br />
was „Ökophilosophen“ als „nachhaltiges<br />
Leben im Gleichgewicht mit der<br />
Natur“ bezeichnen? Wird das, was Nachhaltigkeitsapostel<br />
heute als alternativlose<br />
Handlungsweise verkaufen, jenen Generationen<br />
überhaupt von Nutzen sein? Wer<br />
könnte heute ernst bleiben, wenn unsere<br />
Vorfahren unter großen finanziellen Opfern<br />
sämtliche Planungsmaßnahmen zu<br />
Raumordnung, Stadtentwicklung, Küstenschutz<br />
und Landschaftspflege unter einen<br />
obligatorischen Pferdemistvorbehalt<br />
gestellt hätten?<br />
Freiheit ist die unabdingbare Grundvoraussetzung<br />
für Fortschritt jedweder<br />
Art, insbesondere aber für den wissenschaftlich-technischen.<br />
Nur dort, wo das<br />
Infragestellen von Prämissen, das Bezweifeln<br />
von Folgerungen und das Entwickeln<br />
von Alternativen nicht nur geduldet, sondern<br />
gefördert werden, sind bisher die großen<br />
Wissensdurchbrüche gelungen. Doch<br />
statt nach Fortschritt streben die Propheten<br />
des Untergangs nach Gleichgewicht, statt<br />
Kreativität fordern sie Konsens – ein bestürzendes<br />
Drehbuch für die Rückkehr zur<br />
mittelalterlichen Fortschrittsfeindlichkeit.<br />
Konsens, Kontrolle, Einschränkung<br />
der individuellen Freiheit, Vorsorge durch<br />
Selbstbeschränkung – diese Rezepte für<br />
den Schutz späterer Generationen sind genau<br />
das Gegenteil dessen, was der Menschheit<br />
zu ihrem heutigen Maß an Wohlstand,<br />
Gesundheit, Lebenserwartung und individueller<br />
Selbstentfaltung verholfen hat.<br />
Doch statt dies zu würdigen, wettern die<br />
Prediger der Nachhaltigkeit gegen „übermäßigen<br />
Wohlstand“ und „sinnlosen Luxus“.<br />
Vor menschlichem Wohlergehen wird<br />
gewarnt, zu Risiken und Nebenwirkungen<br />
fragen sie Ihren Nachhaltigkeitsschamanen<br />
oder Klimaseher.<br />
Heute festlegen zu wollen, wie die Bedürfnisse<br />
der Menschen in hundert Jahren<br />
aussehen werden, ist an Überheblichkeit<br />
nicht zu überbieten, es sei denn, wir<br />
setzen das auf Konsensdenken basierende<br />
Stillstandsprogramm unserer Umweltpriester<br />
tatsächlich um.<br />
Aber was gestern noch Abfall war, kann<br />
heute ein wertvoller Rohstoff sein und umgekehrt.<br />
Derzeit zeichnet sich beispielsweise<br />
ab, dass die Transmutations-Technologie<br />
es künftig erlaubt, strahlenden<br />
Reaktorabfall zumindest teilweise in harmlose<br />
Stoffe umzuwandeln und dabei noch<br />
Energie zu gewinnen. Und Unternehmen<br />
wie Planetary Resources planen bereits<br />
die ersten Erkundungsmissionen zu Asteroiden,<br />
deren Metalle und Mineralien die<br />
<strong>vom</strong> Club of Rome 1972 prognostizierten<br />
„Grenzen des Wachstums“ ins Kosmische<br />
erweitern werden. Solche oft als naiver<br />
Fortschrittsglaube geschmähten Projekte<br />
sind in Wahrheit Ausdruck eines liberalen<br />
Humanismus, der den Menschen heute genauso<br />
dient wie künftigen Generationen,<br />
weil er auf ihre Kreativität vertraut.<br />
Unsere Nachkommen werden uns aber<br />
nicht danach beurteilen, wie viel CO 2 wir<br />
eingespart haben, sondern danach, welchen<br />
Spielraum für Freiheit und Entfaltung wir<br />
ihnen gesichert haben. Damit bereiten wir<br />
der Zukunft einen fruchtbaren Boden, nicht<br />
mit kleinkarierten Opfergaben wie CO 2 -<br />
Ablass , Dosenpfand und Biosprit.<br />
Hans-<strong>Die</strong>ter radecke<br />
und Lorenz Teufel<br />
sind studierte Physiker und<br />
Fachjournalisten. Gemeinsam<br />
veröffentlichten sie zuletzt bei<br />
Droemer das Buch „Was zu<br />
bezweifeln war. <strong>Die</strong> Lüge von<br />
der objektiven Wissenschaft“<br />
Anzeige<br />
© Foto Peter Sloterdijk: Axel Heiter; Martin Walser: Philippe MATSAS/Opale<br />
Mehr als schön<br />
ist nichts<br />
Zwei Meinungen über den<br />
Zustand der Welt.<br />
Das <strong>Cicero</strong>-Foyergespräch<br />
<strong>Cicero</strong>-Kolumnist Frank A. Meyer<br />
im Gespräch mit Peter Sloterdijk und<br />
Martin Walser.<br />
Sonntag, 29. September 2013, 11 Uhr<br />
Berliner Ensemble<br />
Bertolt-Brecht-Platz 1, 10117 Berlin<br />
Tickets: Telefon 030 28408155<br />
www.berliner-ensemble.de<br />
BERLINER<br />
ENSEMBLE<br />
29. 9. 2013:<br />
Peter Sloterdijk<br />
& Martin Walser<br />
im Gespräch mit<br />
Frank A. Meyer<br />
In Kooperation<br />
mit dem Berliner Ensemble<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 95
| S t i l<br />
SIE WERDEN ES WOLLEN<br />
Justin O’Shea sitzt als Chefeinkäufer eines Online-Modehändlers an der Schaltstelle eines globalen Geschäfts<br />
von anne Waak<br />
V<br />
OLLBART, bis unters Kinn tätowiert,<br />
das offene Hemd bietet einen<br />
Blick auf das Brusthaar: Justin<br />
O’Shea sieht aus, als spiele er Gitarre in<br />
einer Rockband der wüsteren Sorte. Sein<br />
Job jedoch ist zu wissen, welche Kleider<br />
die sehr modeinteressierten Frauen dieser<br />
Welt kaufen wollen – und zwar bevor die<br />
es selbst auch nur ahnen.<br />
O’Shea ist Buying Director bei dem<br />
Münchner Unternehmen mytheresa.com,<br />
also Chefeinkäufer bei einem der weltgrößten<br />
Online-Versandhändler für Luxusmode.<br />
Als solcher reist der 34-Jährige<br />
eigentlich andauernd von London über Paris,<br />
Mailand und New York, nach Stockholm,<br />
Florenz, Rom und wieder zurück.<br />
Neun Monate des Jahres ist er damit beschäftigt,<br />
neben Moderedakteurinnen und<br />
einschlägigen Promis in den ersten Reihen<br />
der Fashion Weeks zu sitzen und in den<br />
Showrooms der Designer die Stücke der<br />
aktuellen Kollektionen anzuschauen, sie zu<br />
befühlen, auf ihr Verkaufspotenzial hin zu<br />
untersuchen und sie schließlich in großen<br />
Stückzahlen zu bestellen. Wer sich seinen<br />
Beruf anschaut, versteht ein bisschen besser,<br />
wie das globale Geschäft mit der Mode<br />
heutzutage funktioniert.<br />
Denn es sind die Einkäufer der Online-Shops,<br />
die dafür sorgen, dass die <strong>neuen</strong><br />
Kollektionen erhältlich sind, lange bevor<br />
sie in den Modemagazinen gezeigt werden<br />
oder in den Geschäften hängen. <strong>Die</strong><br />
Chefeinkäufer von mytheresa.com, Net-aporter<br />
und Luisaviaroma setzen die Trends.<br />
O’Sheas Kundinnen sitzen in 110 Ländern,<br />
in Argentinien, Australien, Abu<br />
Dhabi – sogar in mehr als ein Dutzend<br />
afrikanischer Länder liefert der Shop. Er<br />
sagt, durch die ständigen Reisen habe er<br />
ein Verständnis dafür entwickelt, wie sich<br />
Frauen in den unterschiedlichen Regionen<br />
der Welt kleiden. Speziell im Nahen Osten<br />
sei es wichtig, den örtlichen Lifestyle einzubeziehen.<br />
„Wenn ich Lanvin kaufe, entscheide<br />
ich mich für lange Kleider oder<br />
größere Größen – weil ich weiß, dass das<br />
Label im streng religiösen Saudi-Arabien<br />
gerade sehr angesagt ist.“<br />
Anders als die Modekritiker ist O’Shea<br />
begeistert von den Kollektionen des Designers<br />
Hedi Slimane für das Pariser Traditionshaus<br />
Saint Laurent. Während die<br />
Süddeutsche Zeitung stänkerte, für die<br />
Frühjahrskollektion hätte Slimane „den alten<br />
Yves mitsamt seinem Le Smoking unter<br />
harte Aufputschmittel gesetzt und ins<br />
Nachtleben von L. A. gezerrt“, sagt der Einkäufer:<br />
„Mir gefällt die Richtung, die die<br />
Marke nimmt.“ Anders als unter Slimanes<br />
Vorgänger Stefano Pilati sei Saint Laurent<br />
nun wiedererkennbar und verständlich.<br />
Der Erfolg gibt ihm recht: <strong>Die</strong> Käuferinnen<br />
lieben die bodenlangen Seidenkleider<br />
und die Schlapphüte aus Filz.<br />
Doch auch der Profi tätigt mal Fehlkäufe.<br />
Erst vor kurzem orderte er eine ordentliche<br />
Anzahl Sneakers eines bekannten<br />
Labels, weil er davon überzeugt war,<br />
dass der Schuh richtig erfolgreich werden<br />
würde. „Aber er hat sich einfach nicht verkauft.<br />
So ist das eben manchmal.“ Vielleicht<br />
sahen die Schuhe auf dem Foto<br />
auch einfach nicht gut genug aus. Beim<br />
Versandhandel entscheidet der erste Blick.<br />
Was nicht sofort gefällt, bestellt die Kundin<br />
nicht. Egal, wo auf der Welt sie vor dem<br />
Bildschirm sitzt.<br />
O’Sheas abenteuerliche Erwerbsbiografie<br />
ist so global wie sein Job. Aufgewachsen<br />
in einem kleinen australischen Dorf, begann<br />
er seine Karriere als Stylist der britischen<br />
Alternative-Rock-Band Snow Patrol.<br />
Mit der befand er sich gerade auf Tour, als<br />
seine Eltern sich scheiden ließen. „Mein<br />
Vater ist ein eher traditioneller Mann, der<br />
keine Ahnung hat, wie man kocht oder<br />
Wäsche wäscht. Ich ging also nach Hause<br />
zurück, um mich eine Zeit lang um ihn zu<br />
kümmern“, sagt O’Shea in einem Englisch,<br />
in dem sich die australische Angewohnheit,<br />
die Melodie am Satz ende fragend anzuheben,<br />
mit der nordamerikanischen Marotte<br />
mischt, möglichst viele Lückenfüller-likes<br />
einzubauen. Vater und Sohn jedenfalls<br />
kauften ein Haus, richteten es ein und<br />
O’Shea brachte seinem Vater bei, wie man<br />
sich eine anständige Mahlzeit zubereitet.<br />
Um, wie er sagt, „die Midlifecrisis meines<br />
Vaters auszuleben“, besorgten sie sich dann<br />
zwei Harley Davidsons. Weil O’Shea senior<br />
in einer Mine arbeitet, verdiente auch<br />
Justin in jenem Jahr sein Geld mit dem<br />
Kupferabbau unter Tage. <strong>Die</strong> Erzählungen<br />
eines Kollegen von Tahitis schwarzen Perlen<br />
führten ihn anschließend in den Südpazifik.<br />
Er stieg in den Perlenhandel ein.<br />
Just als er nach London gegangen war, um<br />
eine eigene Schmuckkollektion aufzuziehen,<br />
kam er zu seinem ersten Job als Einkäufer<br />
für ein Modegeschäft. Nach London<br />
folgten Amsterdam und Kuwait, bis<br />
er vor drei Jahren schließlich bei seinem<br />
jetzigen Arbeitgeber in München landete.<br />
<strong>Die</strong> Stadt, in der er lediglich drei Monate<br />
im Jahr verbringt, sagte ihm lange<br />
nicht zu. Bis er sich in seine Kollegin Veronika<br />
Heilbrunner verliebte. <strong>Die</strong> beiden<br />
sind so etwas wie das coole Powercouple<br />
der Mode. Meistens prägen sein<br />
Gesicht zwei steile Falten zwischen den<br />
Augenbrauen, aber wenn O’Shea von<br />
seiner Freundin spricht, hellt sich seine<br />
Miene auf.<br />
Er selbst trägt im Grunde seit Jahren das<br />
gleiche Outfit: maßgeschneiderte Dreiteiler<br />
des schwedischen Labels Acne und Prada-<br />
Schuhe. Dazu eigens für ihn angefertigte<br />
Sonnenbrillen, hinter denen er seine jetlagmüden<br />
Augen versteckt. Wie das ruhige<br />
Auge des Orkans, der zweimal jährlich die<br />
Laufstege, Magazine und Shops umwälzt,<br />
setzt der Mann, der die Trends steuert, modisch<br />
vor allem auf: Beständigkeit.<br />
Anne Waak<br />
ist freie <strong>Auto</strong>rin, schreibt am<br />
liebsten über Mode und Pop und<br />
lebt in Berlin<br />
Fotos: Gerhardt Kellermann, Joachim Bessing (<strong>Auto</strong>rin)<br />
96 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Stücke, die<br />
Justin O’Shea für<br />
mytheresa.com<br />
einkauft, haben<br />
eine realistische<br />
Chance, Trend<br />
zu werden<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 97
| S t i l<br />
„ICH heule immer“<br />
Fiona Leahy, die gefragteste Hochzeitsplanerin der Briten, erzählt, worauf es am großen Tag ankommt<br />
F<br />
rau Leahy, kann man Hochzeiten<br />
überhaupt bis zum letzten Detail<br />
durchplanen? Am Ende ruiniert<br />
ein betrunkener Onkel mit einer spontanen<br />
Rede die Stimmung.<br />
Natürlich nicht. Ich würde dem betrunkenen<br />
Onkel übrigens nie verbieten zu<br />
reden. Hochzeiten brauchen auch diese<br />
peinlichen Momente. Trotzdem blockiert<br />
der Gedanke an unkalkulierbare Familienmitglieder<br />
viele Paare schon bei der<br />
Planung. Ich versuche, das aufzulockern.<br />
Also einfach ohne die Familie abhauen?<br />
<strong>Die</strong> romantischste Hochzeit, die ich je<br />
geplant habe, war die Flucht eines Londoner<br />
Paares, das komplett ohne Gäste<br />
sein wollte. Sie fand im New Yorker<br />
Gramercy Park statt, einem Privatpark.<br />
Nur Priester und Trauzeuge waren anwesend,<br />
nicht mal ich durfte dabei sein.<br />
Für welche Hochzeit haben Sie bisher den<br />
meisten Aufwand betrieben?<br />
Das war für die königliche Familie von<br />
Katar, mitten in der Wüste. Traditionell<br />
feiern Frauen und Männer dort die<br />
meiste Zeit getrennt. Ich habe die Party<br />
für die 1000 Frauen organisiert. „Marie<br />
Antoinette“ war das Thema für die Dekoration.<br />
Das war kurz nach dem Film<br />
von Sofia Coppola, übrigens eine Idee<br />
der Braut.<br />
Veranstalten Sie nur Hochzeiten für Berühmtheiten<br />
und Majestäten?<br />
Überhaupt nicht. <strong>Die</strong> Stimmung ist sowieso<br />
viel besser, wenn unter hundert<br />
Leute anwesend sind. Und wenn das Paar<br />
nicht versucht, seine Gäste zu beeindrucken,<br />
sondern sich auf seine Gefühle füreinander<br />
konzentriert.<br />
Weinen Sie auf Hochzeiten Ihrer Klienten?<br />
Immer. Ich lerne ja die Paare und andere<br />
Familienmitglieder oft gut kennen. Der<br />
Moment, wenn die Braut zum Altar läuft<br />
und der Bräutigam sie zum ersten Mal<br />
sieht, ist immer magisch. 80 Prozent meiner<br />
Kunden heiraten übrigens kirchlich.<br />
Amerikanische Filme zum Thema Hochzeiten<br />
haben im Kino Hochkonjunktur.<br />
Was ist das Faszinierende an Junggesellenabschieden,<br />
Polterabenden und einem<br />
Vorbereitungsmarathon?<br />
Es spitzt sich alles auf einen Tag zu. Der<br />
Spannungsbogen steigt, ständig kann etwas<br />
schiefgehen. <strong>Die</strong> Amerikaner beweisen<br />
in ihren Filmen viel Selbstironie. Dabei<br />
ist die dortige Hochzeitsindustrie<br />
sehr dogmatisch, alles ist ritualisiert. <strong>Die</strong><br />
meisten Bräuche, von den gleichen Outfits<br />
für die Brautjungfern über reportageartig<br />
gestaltete Hochzeitsfotografie und<br />
personalisierte Gastgeschenke, sind längst<br />
in Europa angekommen.<br />
Das dürfte Sie als Planerin ja nicht nerven.<br />
Es nervt dann, wenn kein Raum für Zufälle<br />
bleibt. Da sind britische Hochzeiten<br />
oft wesentlich entspannter. Natürlich<br />
hilft der britische Humor dabei. Spontanreden<br />
und ein hysterisch lachendes<br />
Publikum kann man nicht planen.<br />
Es sei denn, man bucht Hugh Grant als<br />
Trauzeugen.<br />
Ich kenne einen Mann, der auf mehreren<br />
britischen Hochzeiten, die ich organisiert<br />
habe, sensationell komische Reden<br />
gehalten hat. Er war von verdächtig vielen<br />
Männern zum Trauzeugen gemacht<br />
worden, obwohl nicht jedes Mal eine<br />
tiefe, langjährige Freundschaft der Auslöser<br />
gewesen sein kann. Selbst ich hätte<br />
ihn gerne als Trauzeugen, wenn ich so darüber<br />
nachdenke.<br />
Eine Praktikantin Ihres Teams hat im<br />
Internet beklagt, sie hätte bei Ihnen zwei<br />
Wochen lang nur gebastelt.<br />
Das war wahrscheinlich für die Hochzeit<br />
in Aserbaidschan. Wir haben Wände<br />
und Decken mit Papierblumen verkleidet.<br />
30 Leute haben in meinem Londoner<br />
Studio tagelang gebastelt. Später haben<br />
wir die Blumen nach Aserbaidschan geschickt.<br />
Ich mag visuelle Dekadenz, sie<br />
darf nur nicht vulgär wirken.<br />
Gibt es auch simple Tipps, die man ohne<br />
Hochzeitsplaner umsetzen kann?<br />
Eine gute Sitzordnung verrät einen sensiblen<br />
Gastgeber. Ich trenne Paare gerne,<br />
setze sie aber immer an den gleichen<br />
Tisch. Man sollte nicht krampfhaft Gäste<br />
mischen, die sich nicht kennen. Smalltalk<br />
kann so anstrengend sein. Und bitte: Singles<br />
sollte man immer ermutigen, einen<br />
Freund oder eine Freundin mitzubringen.<br />
Ein Fest der Liebe alleine zu überstehen,<br />
kann deprimierend sein. Redebeiträge<br />
würde ich vorher zeitlich begrenzen, auch<br />
wenn es hart klingt.<br />
Man ist den Gästen ja auch etwas schuldig.<br />
Immerhin reisen sie an, buchen ein<br />
Hotel und kaufen noch ein Geschenk.<br />
Im Idealfall reisen die Gäste mit einem<br />
guten Gefühl wieder ab. Sowohl die<br />
Braut als auch der Bräutigam sollten ein<br />
paar ausgewählte Worte an sie richten,<br />
kein spontanes Dahingeplänkel. Neulich<br />
war ich auf einer Landhochzeit. Es<br />
gab Schaukeln, auch für die Erwachsenen,<br />
mehrere Lagerfeuer und Ruderboote<br />
am See. Alle fühlten sich wie Kinder. Das<br />
schafft Intimität.Wenn sich fremde Menschen<br />
gemeinsam amüsieren und ein<br />
Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht,<br />
dann ist das ein Zeichen für ein gelungenes<br />
Fest. Selbst wenn sie sich danach nie<br />
mehr wiedersehen.<br />
Für welches Brautpaar würden Sie gerne<br />
eine Hochzeit veranstalten?<br />
Für Arthur Miller und Marilyn Monroe.<br />
Auch wenn es dann geknallt hat. Ob die<br />
Ehe hält oder nicht, sehe ich am großen<br />
Tag leider immer noch keinem Paar an.<br />
Das Gespräch führte Lena Bergmann<br />
Foto: Courtesy Curio Magazine<br />
98 <strong>Cicero</strong> 7.2013
„Hochzeiten brauchen auch<br />
Peinlichkeiten“ – Fiona<br />
Leahys Buch „Just Married“<br />
erscheint diesen August<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 99
| S t i l | K l e i d e r o r d n u n g<br />
Warum ich trage, was ich trage<br />
SAMUEL FINZI, SCHAUSPIELER<br />
F<br />
ASSEN SIE MAL AN. Fast so weich<br />
wie Samt, man nennt es Babycord.<br />
Von weitem sieht man nicht einmal,<br />
dass es Cord ist. Groben Cord ordnet<br />
man schnell einer bestimmten Art<br />
von Menschen zu. Er ist normalerweise<br />
schlabbrig und spießig. <strong>Die</strong>ser Baldessarini-Anzug<br />
ist eng und elegant geschnitten.<br />
Trotzdem ist er bequem, mein Körper<br />
fühlt sich wohl. Es ist mir wichtig, dass sich<br />
das Kleidungsstück sofort dem Körper anpasst.<br />
Dass es organisch wirkt.<br />
Ich mag Widersprüchliches, das schafft<br />
Lebendigkeit. Ich habe mich nie einem bestimmten<br />
Stil zugeordnet. Heute trage ich<br />
zum Beispiel diese genähten Lederschuhe<br />
von Riccardo Cartillone aus Berlin. Dabei<br />
würde man zum dunkelblauen Anzug<br />
eher dunkle Schuhe erwarten. <strong>Die</strong> Farbe<br />
des Anzugs begeistert mich. Ein Blau, das<br />
fast schwarz ist. Ich glaube, Blau steht mir.<br />
Kann auch sein, dass ich mir das einbilde.<br />
Das begann schon als Kind, ich verbinde<br />
es mit dem Meer, mit der Weite. Dort habe<br />
ich viel Zeit verbracht. Ich könnte meinen<br />
ganzen Schrank mit hellblauen Hemden<br />
und dunkelblauen T-Shirts füllen. Früher<br />
habe ich Wert auf Vielfalt gelegt. Jetzt weiß<br />
ich, was gut ist, was ich tragen kann. Durch<br />
die Reduktion komme ich zur Essenz.<br />
Ich zog 1989 von Bulgarien nach Westberlin.<br />
Das war ein besonderer Ort, man<br />
trug Klamotten anders, präsentierte die<br />
Härte des Lebens, musste draufhauen, exzentrisch<br />
sein. Ich habe mir gleich eine<br />
schwarze Lederjacke angeschafft. Und<br />
heute trage ich Babycord. Ich kann mir<br />
vorstellen, dass man sich damit gern umarmen<br />
lässt. Ich kann Menschen gut in den<br />
Arm nehmen. Hierzulande streichelt oder<br />
klopft man sich oft den Rücken bei der<br />
Begrüßung. Ich kann das nicht leiden, das<br />
zeugt alles von Angst, Angst vor Berührung.<br />
Mein silbernes Armband trage ich seit<br />
25 Jahren. Wenn ich es verlieren sollte,<br />
wüsste ich nicht weiter. Schon in der Schule<br />
hatte ich einen Hang zu Armbändern.<br />
Mein erstes habe ich mir mit neun Jahren<br />
gekauft, bei einer dieser kitschigen Buden<br />
im Ferienlager. Es war aus goldenem<br />
Blech. Ich gab mein ganzes Taschengeld dafür<br />
aus und war sehr stolz. Eingraviert auf<br />
der kleinen Plakette stand: I love you. Ich<br />
glaube, ich wusste nicht einmal, was das<br />
bedeutete.<br />
Aufgezeichnet von Marie Amrhein<br />
1989 zog der Schauspieler Samuel Finzi<br />
aus seiner Heimat Bulgarien nach Berlin.<br />
Damals war er 23 Jahre alt. Heute erlebt<br />
man Finzi unter anderem an der Volksbühne,<br />
am Deutschen Theater, dem Maxim-Gorki-<br />
Theater, dem Schauspielhaus Leipzig – und<br />
in Til Schweigers Komödie „Kokowääh 2“<br />
Foto: Thomas Rusch für <strong>Cicero</strong><br />
100 <strong>Cicero</strong> 7.2013
02.–07. JULI 2013
| S t i l | M u t t e r - K i n d - B l o g s<br />
Das Fremde Kind,<br />
das ich kenne<br />
Vom ersten Ultraschallbild an beobachtet unsere <strong>Auto</strong>rin das<br />
Leben eines Jungen, das seine Mutter im Netz dokumentiert.<br />
Bis sie ihm auf einem New Yorker Spielplatz gegenübersteht.<br />
Geschichte eines unheimlichen Phänomens<br />
von LENA BERGMANN<br />
N<br />
eW YORK, im September 2012.<br />
Meine Tochter schaukelt. Noch.<br />
Lange wird sie nicht mehr durch<br />
die Luft wirbeln können, denn<br />
auf dem Spielplatz im West Village<br />
ist viel los. <strong>Die</strong> Kleinkinder stehen mit<br />
ihren Müttern und Nannies Schlange. Wir<br />
werden erwartungsvoll angeschaut.<br />
Ein Junge scheint sich nicht für die<br />
Schaukeln zu interessieren. Auch nicht für<br />
das Klettergerüst. Abseits und selbstvergessen<br />
steht er da, mit dem Rücken zu mir, ich<br />
sehe einen dichten dunklen Haarschopf, einen<br />
Kapuzenpulli und ein grinsendes Affengesicht<br />
auf seinem Rucksack. Als er sich<br />
zur Seite dreht, erkenne ich den Jungen.<br />
Unfassbar. Aber er ist es. Toby.<br />
Erschrocken mustere ich die großen<br />
braunen Augen und die vollen Lippen im<br />
runden Gesicht, aus dem ich schon von<br />
Geburt an beide Eltern herauslesen konnte.<br />
Mir fällt ein, dass seine Babysitterin Naudia<br />
ihm den Affenrucksack geschenkt hat,<br />
für den ersten Tag in der Spielgruppe, das<br />
muss im Juli gewesen sein. Am liebsten<br />
würde ich das voll beladene Ding jetzt von<br />
den kleinen Schultern ziehen. Ich kann<br />
doch nicht zulassen, dass er so schwer trägt.<br />
Toby schiebt sich etwas aus einer durchsichtigen<br />
Tüte in den Mund, wahrscheinlich<br />
„Honey Nut Loops“ von Kellogg’s, die<br />
mag er besonders. Seine Mutter versucht<br />
manchmal vergeblich, ihm die Variante<br />
ohne Zucker unterzujubeln. Aber Kinder<br />
merken so etwas sofort. Toby wirkt reifer<br />
als meine Tochter. Doch ich weiß ja, dass er<br />
elf Tage jünger ist. Am 25. Mai hat er Geburtstag.<br />
Seine Geburt vor zweieinhalb Jahren<br />
verlief ohne Komplikationen, obwohl<br />
seine Mutter die Wehen erst ignorierte und<br />
dann fürchten musste, ihr Sohn würde im<br />
Taxi zur Welt kommen.<br />
Ich weiß das alles. Jedes Detail. Obwohl<br />
ich weder ihn noch seine Mutter je<br />
gesprochen habe. Obwohl die beiden nicht<br />
wissen können, wer ich bin. Sie wissen ja<br />
nicht mal, dass es mich gibt.<br />
Da hinten, auf der Bank, das könnte<br />
Naudia sein, die Babysitterin. Sie betreut<br />
ihn montags und dienstags, bis nachmittags<br />
um vier. Andererseits ist vier Uhr lange<br />
vorbei, insofern müsste seine Mutter hier<br />
irgendwo sein. Mir fällt ein, dass sie die<br />
späten Nachmittage oft mit Toby auf dem<br />
„Bleecker Playground“ verbringt, sie genießt<br />
diese Stunden mit dem Sohn.<br />
Ich suche also eine zierliche Frau mit<br />
langem, dunklem Pferdeschwanz, Brille<br />
und Lippenstift. Oder ist Toby mit seinem<br />
Vater hier? Mir ist mittlerweile klar:<br />
Meine Tochter und ich müssen auf unserem<br />
Spaziergang durch das West Village<br />
Illustration: Henrik Abrahams<br />
102 <strong>Cicero</strong> 7.2013
7.2013 <strong>Cicero</strong> 103
| S t i l | M u t t e r - K i n d - B l o g s<br />
auf Tobys Stammspielplatz gelandet sein.<br />
Er wohnt ja auch um die Ecke. Ich glaube,<br />
in der West 11th Street. Ob ich das Haus<br />
mit der Feuerleiter von der Straße aus erkennen<br />
würde? Immerhin weiß ich, wie es<br />
von innen aussieht. Wenig Platz. Das Gästebett,<br />
in dem manchmal die Oma mütterlicherseits<br />
übernachtet, steht deswegen auch<br />
im Kinderzimmer. Es sieht recht gemütlich<br />
aus, seit es renoviert wurde. Wann war das<br />
noch mal? Auf jeden Fall erst nach Tobys<br />
Geburt. Am Anfang hat er noch bei seinen<br />
Eltern im Bett geschlafen. Inzwischen<br />
hängt über seinem weißen Gitterbett ein<br />
antikes Mobile mit Schiffchen. So etwas<br />
wollte ich auch für unser Kinderzimmer,<br />
habe aber in Berlin nichts Vergleichbares<br />
gefunden. Toby schläft durch, derzeit bis<br />
sechs Uhr morgens, meist ohne Decke, das<br />
Hinterteil in die Luft gestreckt.<br />
Von Berlin aus habe ich das Leben<br />
dieses Jungen und seiner Familie beobachtet.<br />
Es fühlt sich an, als hätte ich daran<br />
teilgenommen. Seine Mutter hat<br />
ihr Leben und das ihres Kindes unter<br />
joannagoddard . blogspot . com ins Netz<br />
gestellt; Lieblingstier, Lieblingsbuch, Lieblingsschlaflied.<br />
Erster Schritt, erster Zahn,<br />
erster Toilettenbesuch.<br />
Selbst über die Kinder guter Freunde<br />
weiß ich nicht annähernd so viel. Noch<br />
nie habe ich von einem Kind so viele Bilder<br />
gesehen, Toby beim Baden, beim Schlafen,<br />
beim Weinen und mit frischer Naht<br />
am Knie, nachdem er zu wild getobt hatte.<br />
Würde ich alle Bilder, die ich im Laufe der<br />
Jahre von Toby gesehen habe, in Fotoalben<br />
kleben, wären das vermutlich mehr als<br />
die von zwei Generationen meiner eigenen<br />
Familie.<br />
Trotz all dieser Einblicke ist Toby für<br />
mich aber immer eine Internetfigur geblieben.<br />
Ein Protagonist auf meinem Bildschirm.<br />
Jetzt steht er vor mir auf dem Spielplatz.<br />
Ein Fremder, den ich kenne.<br />
Vor fünf Jahren fing ich an, in meinem<br />
Berliner Büro regelmäßig den Blog seiner<br />
Mutter zu lesen. Damals war ich Redakteurin<br />
bei einem Wohnmagazin und schrieb<br />
über Einrichtungsstile. Recherchen im Internet<br />
gehörten zu meiner Arbeit. Irgendwann<br />
landete ich zufällig auf „A Cup of Jo“.<br />
Dort schrieb Joanna Goddard über Dates,<br />
Klamotten und Lippenstiftfarben. Aber<br />
auch über Bücher, Fernsehserien und perfekte<br />
Wochenenden in Upstate New York.<br />
Durch sie erfuhr ich, wann es im Winter<br />
in New York zum ersten Mal schneite, in<br />
welchem Café man am besten in Ruhe am<br />
Laptop arbeiten konnte und wen Don Draper<br />
in „Mad Men“ am Vorabend rauchend<br />
flachgelegt hatte. Joanna postete auch Entdeckungen<br />
aus anderen Blogs. Ein wenig<br />
wie das deutsche Kultur-Portal „Perlentaucher“,<br />
nur eben für Lifestyle- und Frauenthemen.<br />
Besser als die redaktionellen Inhalte<br />
der deutschen Frauenmagazine waren<br />
die Einträge und Tipps auf ihrem Blog allemal.<br />
Es half, dass man beim Lesen in ein<br />
angenehmes Layout mit guten Bildern<br />
eintauchte.<br />
Wie ich selbst, war Joanna Goddard<br />
früher Redakteurin, zunächst festangestellt<br />
bei einem Magazin, dann freiberuflich.<br />
Sie wurstelte sich durch die Branche,<br />
entwickelte Magazine, schrieb Kolumnen,<br />
beriet Firmen in Marketingfragen. Parallel<br />
zu dieser eher zufälligen Mischung aus Tätigkeiten,<br />
die alle inzwischen auch meine<br />
Mir wurde<br />
klar: Ich weiß<br />
alles über ein<br />
Kind, das ich<br />
persönlich<br />
nicht kenne<br />
berufliche Laufbahn prägten, startete sie<br />
2007 ihren Blog „A Cup of Jo“. Ihr erster<br />
Eintrag zum Jahresbeginn: Ihr Geständnis,<br />
sie habe Silvester in New York alleine verbracht.<br />
<strong>Die</strong> Offenheit war mir sympathisch.<br />
Nachdem ich den Blog entdeckt hatte,<br />
wurde Joanna Goddard zu einer Art New<br />
Yorker Freundin, bei der ich täglich vorbeischaute.<br />
Im Englischen gibt es den Begriff<br />
„guilty pleasure“ – ein Vergnügen, das<br />
von Schuldgefühlen begleitet wird. Joanna<br />
Goddards Blog war ein tägliches Vergnügen,<br />
für das ich mich aber schämte – wie<br />
wenn man beim Zahnarzt in der Gala blättert<br />
und dabei nicht ertappt werden will.<br />
Vor allem stillte der Blog meine permanente<br />
New-York-Sehnsucht mit Beiträgen<br />
über Orte, die ich kannte. Ich merkte:<br />
Nicht nur unsere Jobs in der Magazinbranche<br />
hatten Joanna und ich gemeinsam,<br />
denn mittlerweile ist Joanna an Silvester<br />
nicht mehr alleine – sie hat sich<br />
verliebt, verlobt und verheiratet. Auch ich<br />
habe mich verliebt, verlobt und verheiratet.<br />
Unsere Männer haben sogar denselben Vornamen.<br />
Und den gleichen Beruf. Den gleichen<br />
Bart auch. Im Wallsé im West Village,<br />
unserem romantischen Lieblingsrestaurant,<br />
waren Joanna und ihr Mann am Abend ihrer<br />
Verlobung. All das habe ich von meinem<br />
Berliner Bürostuhl aus verfolgt.<br />
Dann, im September 2009, wurde ich<br />
zum ersten Mal schwanger. Direkt danach<br />
verkündete auch Joanna Goddard per Blog<br />
ihre Schwangerschaft. Mir ging es am Anfang<br />
ziemlich mies. Einmal habe ich mich<br />
im Büro heimlich zum Schlafen unter den<br />
Schreibtisch gelegt. Joanna ging es blendend.<br />
Ich hatte keine Lust auf Fachliteratur,<br />
sie las alles. Ich selbst hatte keine Mutter<br />
mehr, die ich hätte fragen können, Joanna<br />
befragte die ihre und teilte deren Weisheiten<br />
mit ihren Leserinnen. Am 9. Januar<br />
2010 postete sie das erste Ultraschallbild<br />
ihres Sohnes. Elf Tage nach meiner Tochter<br />
kam Toby zur Welt.<br />
Joanna empfahl auf ihrem Blog biologische<br />
Babyprodukte. Nun war sie eine<br />
Art Streberfreundin, deren Präsenz mich<br />
irgendwie beruhigte.<br />
Längst sind auch andere Frauen fasziniert<br />
<strong>vom</strong> Alltag Joanna Goddards. Über<br />
fünf Millionen monatliche Klicks erhält ihr<br />
Blog. Das Magazin Forbes nannte „A Cup<br />
of Jo“ eine der „Top 10 Lifestyle Websites<br />
for Women“. Lucky, ein erfolgreiches<br />
Foto: Joanna Goddard<br />
104 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Fotos: Joanna Goddard, Jens Bösenberg (<strong>Auto</strong>rin)<br />
Eine neue<br />
Generation von<br />
Bloggerinnen<br />
präsentiert<br />
ihre Kinder im<br />
Internet<br />
amerikanisches Frauenmagazin, schrieb:<br />
„Der Blog, den die komplette Mode- und<br />
Schönheitsindustrie liest“. Selbst Martha<br />
Stewart, Königin der Häuslichkeit, lobte:<br />
„Wir alle lieben Joanna für ihre Sag-es-wiees-ist-Einträge<br />
über die Mutterschaft.“<br />
Joanna Goddard gehört zu den erfolgreichsten<br />
Vertreterinnen einer <strong>neuen</strong><br />
Bloggergeneration, die das tägliche Erleben<br />
der Mutterschaft im Internet miteinander<br />
teilt. Längst haben Mütter in europäischen<br />
Großstädten nachgezogen: <strong>Die</strong><br />
eine schreibt von Amsterdam aus über Babymassagen<br />
für Neugeborene, die andere<br />
postet aus London eine Bastelanleitung für<br />
Girlanden, Hunderte von Leserinnen loben<br />
und verbreiten diese weiter. Wenn eine<br />
ehemalige Führungskraft des US State Department<br />
im Intellektuellen-Heft The Atlantic<br />
erklärt, warum sie den Kindern zuliebe<br />
den Traumjob augegeben hat, folgen<br />
die Blogkommentare wie der Donner auf<br />
den Blitz. Viele der Bloggerinnen sind<br />
Hausfrauen und zelebrieren die selbst gewählte<br />
Häuslichkeit – inzwischen kursiert<br />
in der Szene der Begriff „Feminist Housewife“.<br />
Zur Darstellung dieser <strong>neuen</strong> Häuslichkeit<br />
werden Tausende von Bildern gemacht,<br />
die eigenen Kinder dokumentieren<br />
darauf das heimisch-familiäre Glück. Dafür<br />
interessieren sich wiederum die Marketingabteilungen<br />
von Babynahrungsherstellern,<br />
Spielzeugmanufakturen, Kinderkleidungsund<br />
Möbelproduzenten.<br />
Aber auch Pädophile nutzen die Seiten.<br />
Nach der Begegnung auf dem Spielplatz<br />
habe ich ein wenig recherchiert. <strong>Die</strong><br />
Diplom-Psychologin Laura F. Kuhle <strong>vom</strong><br />
Zentrum für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin<br />
der Berliner Charité weiß aus der<br />
klinischen Arbeit mit pädophilen Männern,<br />
dass nicht nur explizite Missbrauchsabbildungen<br />
zur Erregung genutzt werden. In<br />
geschlossenen Netzwerken, die zum Tausch<br />
von Kinderpornografie, aber auch zum<br />
Tausch von nichtexpliziten Abbildungen<br />
genutzt werden, gibt es Kategorisierungen<br />
wie „Windelkinder“, „FKK“ oder „schlafende<br />
Kinder“. Als Quellen für solche Aufnahmen<br />
begegnen Kuhle in diesem Zusammenhang<br />
regelmäßig Mütterblogs.<br />
Beate Krafft-Schöning, die im Jahr<br />
2000 die Initiative „NetKids“ gründete,<br />
weist darauf hin, dass per Bildmontage<br />
regelmäßig die Köpfe „noch unbekannter“<br />
Kinder auf explizite Missbrauchsszenen<br />
gesetzt werden, die unter Usern schon<br />
die Runde gemacht haben. Sie warnt davor,<br />
jegliches Bildmaterial von Kindern im Internet<br />
zu verbreiten, und sieht darin sogar<br />
eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte<br />
der Kinder durch die eigenen Eltern.<br />
„Immerhin“, sagt Krafft-Schöning,<br />
„gibt es inzwischen Richtlinien für Eltern,<br />
die einen bewussten Umgang mit dem<br />
Internet bewirken und das Navigationsverhalten<br />
regulieren. Etwa, wie viel Zeit<br />
Kinder entsprechend ihrer Altersgruppe<br />
überhaupt im Internet verbringen sollten.<br />
Darüber hinaus gibt es Methoden, das Internet<br />
durch Sicherungen ‚kinderfreundlich‘<br />
zu machen, indem nur einige ausgewählte<br />
Seiten freigeschaltet werden. Das<br />
war vor zehn Jahren noch anders.“ Allerdings<br />
gebe es ausgerechnet bei Eltern von<br />
Kleinkindern oft kein Problembewusstsein.<br />
Erst wenn die Kinder sozialen Netzwerken<br />
beitreten wollen, fangen viele Eltern mit<br />
dem Nachdenken darüber an, inwieweit<br />
sich ihre Kinder im Internet exponieren<br />
sollten. Zu spät, denn: „Was einmal im<br />
Netz gelandet ist, kann nicht mehr entfernt<br />
werden“, sagt Krafft-Schöning.<br />
Toby, der dreijährige Sohn von Joanna<br />
Goddard, wird also immer im Netz bleiben,<br />
mit allen Bildern, allen Details. Es<br />
werden mehr werden. Ohne seine Mitwirkung<br />
würde der Blog seiner Mutter bei<br />
den Besucherzahlen einen Einbruch erleben.<br />
All das wird mir klar, als ich Toby in<br />
New York begegne. Jetzt, wo ich den Jungen<br />
aus der Nähe gesehen habe, entsteht<br />
eine Distanz. Der Blog, die Bilder, das Produkt<br />
ist mir unheimlich, weil Toby gar kein<br />
Produkt ist. Sondern echt.<br />
Auf ihrem Blog textet Joanna Goddard<br />
in Marketingsprache: „Meine Leserinnen<br />
sind enthusiastische, stilsichere Frauen, die<br />
Online-Shopping lieben und gerne Neues<br />
entdecken.“ Es geht hier nicht mehr um<br />
die sympathische Single-Frau, die ihre<br />
New-York-Beobachtungen teilt. Es werden<br />
unentwegt Produkte empfohlen, aus<br />
der Perspektive einer scheinbar perfekten<br />
Familie, mit Sätzen wie: „Es hat sich gut auf<br />
Tobys Haut angefühlt.“ So gewinnt man<br />
Anzeigenkunden.<br />
Joanna sucht nun schon seit einiger<br />
Zeit nach einer größeren Wohnung für<br />
ihre Familie.<br />
<strong>Die</strong>ses Detail erzählt sie mir auf dem<br />
Spielplatz bei den Schaukeln höchstpersönlich.<br />
Nicht mal ansprechen muss ich sie. Sie<br />
mag den Hut, den ich trage, und macht mir<br />
ein Kompliment. Als ich erwähne, dass ich<br />
in Berlin lebe, erzählt sie, dass sie vor der<br />
Geburt ihres Sohnes auch mal da war. Dass<br />
sie mit ihrem Mann im Tiergarten Fahrrad<br />
gefahren ist und Döner gegessen hat. Das<br />
weiß ich natürlich alles schon. Aber ich lasse<br />
mir nichts anmerken. Ich erzähle ihr nicht,<br />
dass ich ihren Blog lese.<br />
Für diesen Artikel hingegen habe ich<br />
angefragt, ob sie Zeit für ein telefonisches<br />
Interview habe. Leider nicht, schrieb sie zurück.<br />
Sie bereite gerade ihre Mutterschaftspause<br />
vor und sei quasi schon auf dem Weg<br />
ins Krankenhaus. Toby bekommt die Tage<br />
ein Geschwisterchen. Das erste Ultraschallbild<br />
steht schon im Netz.<br />
LENA BERGMANN<br />
leitet das Stil-Ressort von <strong>Cicero</strong>.<br />
Sie hat nur einmal voller Stolz<br />
ein Bild ihrer Tochter auf Facebook<br />
veröffentlicht<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 105
| S t i l | K ü c h e n k a b i n e t t<br />
Tischlein,<br />
versteck dich<br />
Der Imbiss ist längst nicht mehr Notbehelf<br />
für das Proletariat, sondern steht für kreative<br />
Großstadtküche und flexible Konsumenten<br />
Von Julius Grützke und Thomas Platt<br />
D<br />
ER sommer ist die saison der Gartenfeste. Nicht nur<br />
Privatleute nutzen die hohen Außentemperaturen, um<br />
Freunde einzuladen, ohne die Innenräume beanspruchen<br />
zu müssen, sondern auch öffentliche Institutionen veranstalten<br />
große Freiluftpartys, bei denen sie sich präsentieren können, ohne<br />
dabei die Büros neugierigen Blicken preiszugeben. So bleibt der<br />
Muff in der Amtsstube erhalten, während draußen auf dem Rasen<br />
ein frisches und modernes Image zelebriert wird.<br />
Zu dem <strong>neuen</strong> und schmeichelhaften Bild, das auf solchen<br />
Partys gezeichnet wird, gehören auch Speisen, die schon längst<br />
nicht mehr nur aus der Gulaschkanone geschöpft oder <strong>vom</strong><br />
Grill genommen werden. Stattdessen ist das ganze Spektrum der<br />
Gourmetküche vertreten, <strong>vom</strong> Marshmallow aus Rote-Bete-Saft<br />
bis zur braisierten Jakobsmuschel. <strong>Die</strong> Cateringfirmen, die solche<br />
Veranstaltungen beliefern, haben mit Sterneköchen und voll<br />
ausgestatteten mobilen Küchen so aufgerüstet, dass es inzwischen<br />
keine Schwierigkeiten mehr bereitet, Tausende von Gästen auf<br />
höchstem Niveau zu verköstigen.<br />
Damit folgen sie einem Trend, der auch außerhalb der Sommerfeste<br />
zu beobachten ist. Der Imbiss und das Essen im Stehen<br />
erfahren seit Jahren eine kontinuierliche Aufwertung. Was früher<br />
ein Notbehelf zur Nahrungsaufnahme für Proletarier auf Montage<br />
war, die dafür den Weg zur Arbeit nicht lange unterbrechen<br />
mussten, hat sich zu einem zentralen Element der Esskultur entwickelt,<br />
das in allen Qualitätsstufen am Straßenrand angeboten<br />
wird – und nicht nur dort.<br />
<strong>Die</strong> Auflösung des starren Arbeitszeitregimes, die zunehmende<br />
Mobilität und der Verlust des Mittagessens im familiären<br />
Rahmen haben den Bedarf an Mahlzeiten für zwischendurch<br />
gesteigert – auch von Leuten, die mit einer Currywurst nichts<br />
anzufangen wissen. Auf sie zielten Innovationen des bestecklosen<br />
Essens wie Hamburger, Döner Kebab, Falafel, Sushi und<br />
Wraps, die dann anderen althergebrachten Fastfood-Konzepten<br />
wie Erbsensuppe und Schaschlik den Garaus machten. <strong>Die</strong> neue<br />
Vielfalt ermöglichte schließlich auch eine Differenzierung des<br />
Angebots durch Verfeinerung und gewann dadurch noch mehr<br />
Zuspruch. Inzwischen werden manche <strong>neuen</strong> Nahrungstrends an<br />
der Bordsteinkante gesetzt, das vietnamesisch gefüllte Baguette<br />
Banh-Mi zum Beispiel oder Onigiri, Dreiecke aus gewürztem<br />
und gepresstem Reis. Zu wünschen ist auch, dass ein mächtiger<br />
Trend aus Amerika sich bei uns durchsetzt. Der Food-Truck<br />
als mobiles Imbissrestaurant ist eine voll ausgestattete, fahrbare<br />
Küche, wie man sie von Filmdreharbeiten her kennt. Dort werden<br />
meist ethnisch grundierte Spezialitäten an per Facebook und<br />
twitter avisierten Orten zubereitet und dann einem Flashmob<br />
aus Gourmets verkauft.<br />
Gemeinsam ist all diesen Richtungen, dass sie sich <strong>vom</strong> Zeremoniell<br />
des Essens verabschiedet haben. Besteck ist meistens<br />
nicht mehr nötig, selbst der Teller wird nicht gebraucht. <strong>Die</strong> gedeckte<br />
Tafel hat ausgedient. Sie weicht einem kontinuierlichen<br />
Picknick auf dem Asphalt mit wechselnden Personen und Portionen.<br />
<strong>Die</strong> Speisenfolge ordnet sich keinem Menü unter und<br />
entbehrt dessen Stringenz. Das Gleiche gilt auch für Begegnungen<br />
und Tischgespräche. Was einstmals noch eine Grundform<br />
des politischen Diskurses war, löst sich in informellen Gelegenheitsgesprächen<br />
auf, deren Gehalt weniger substanziell erscheint.<br />
So sehr man aber darüber wehklagen könnte, dass die<br />
oft zitierte Gesprächskultur mit den Tischsitten verschwindet,<br />
stellt es doch auch einen Fortschritt dar, wenn die gesetzten Essen<br />
in geschlossenen Zirkeln an Einfluss verlieren gegenüber einer<br />
offenen Tischgesellschaft, zu der praktisch jeder geladen ist.<br />
<strong>Die</strong> Ergebnisse dieser Entwicklung sind schon heute zu sehen:<br />
Nicht nur dank des Internets ist die Politik durchlässiger geworden<br />
und gibt mehr Bürgern Gelegenheit zur Beteiligung. Nur<br />
zur Sommerparty des Bundespräsidenten braucht man weiterhin<br />
eine persönliche Einladung.<br />
Julius Grützke und Thomas Platt<br />
sind <strong>Auto</strong>ren und Gastronomiekritiker.<br />
Beide leben in Berlin<br />
illustration: Thomas Kuhlenbeck/Jutta Fricke Illustrators; Foto: Antje Berghäuser<br />
106 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Das geht besser!<br />
Zum Beispiel mit einem personalisierten Roman!<br />
Ob für den Partner, die Freundin, die Eltern oder die Großeltern:<br />
Auf Geschenkidee.de finden Sie zu jedem Anlass garantiert das passende<br />
Geschenk. Vom Erlebnisgutschein bis zum eigenen Roman.<br />
www.geschenkidee.de
| S a l o n<br />
Lizenz zum Wehtun<br />
Seit 20 Jahren gibt Martin Brinkmann die „Krachkultur“ heraus, Deutschlands frechste Literaturzeitschrift<br />
von Alexander Kissler<br />
D<br />
rei Personen, mindestens, wohnen<br />
in Martin Brinkmann: Herausgeber<br />
der Zeitschrift Krachkultur<br />
ist er seit 20 Jahren, Schriftsteller<br />
wurde er, und nun ging er auch unter die<br />
Literaturagenten, in München, unweit jener<br />
pittoresken Straßenzüge, wo einst der<br />
Pumuckl seine Späße trieb, Meister Eder<br />
tischlerte und mit putzigem Lokalkolorit<br />
ein Kinderbuchklassiker verfilmt wurde.<br />
Hier ist München die glatte Antithese zu<br />
allem, was das Leben und Schreiben des<br />
Martin Brinkmann bestimmt.<br />
„Wie“, fragt Brinkmann, der mit seinen<br />
36 Jahren einen zornigen jungen Mann abgibt,<br />
„wie“, fragt er in seinem Büro in einer<br />
Mansarde unweit des Wiener Platzes, „wie<br />
kommt es denn, dass immer mehr Menschen<br />
psychologische Betreuung brauchen,<br />
obwohl sie tagein, tagaus Ratgeber lesen,<br />
die ihnen das schöne Leben beibringen sollen?“<br />
<strong>Die</strong> Antwort hat der schlaksige Mann<br />
mit den dünnen Haaren und dem norddeutsch<br />
trommelnden Zungenschlag parat:<br />
Weil die Menschen abgespeist werden<br />
mit Künstlichkeit. Weil ihnen der „Kontakt<br />
mit der Weltliteratur“ fehlt. Weil die<br />
Bücher, die sie lesen, „nicht wehtun, keine<br />
Erkenntnisse eintreiben, sondern nur den<br />
Kopf streicheln und die Sinne ablenken“.<br />
Nach solchen Sätzen, die auch nach<br />
freundlichst dargebotenem Erdbeerkuchen<br />
eine klirrende Weile in der Luft stehen bleiben,<br />
klingt es wie eine Gegenwartsbeschreibung,<br />
wenn Brinkmann sich und Ko-Herausgeber<br />
Fabian Reimann rückblickend als<br />
„general-oppositionell gesinnt“ bezeichnet.<br />
Auf dem Gymnasium von Bad Bederkesa<br />
saßen die beiden Schüler, lasen Horrorbücher<br />
und wollten ihrer Sehnsucht nach der<br />
„<strong>neuen</strong> Sicht auf die Dinge“ ein Gefäß geben.<br />
<strong>Die</strong> Krachkultur war geboren. Es gibt<br />
sie noch, im Gegensatz zu den meisten Literaturzeitschriften<br />
der neunziger Jahre.<br />
<strong>Die</strong> Jubiläumsausgabe, Nummer 15, ist ein<br />
kraftstrotzender Lebensbeweis der <strong>neuen</strong><br />
Sicht, Literatur ohne Schminke.<br />
Geändert hat sich gleichwohl viel. Dem<br />
Faible für das Horrorgenre schwor Brinkmann<br />
ab. Auch ist keine „Avantgarde um<br />
jeden Preis“ das Ziel, wohl aber ein „unkonventioneller,<br />
ein noch nicht etablierter<br />
oder schon wieder nicht mehr etablierter<br />
Zugriff auf die wesentlichen Themen“.<br />
<strong>Die</strong>sem Anspruch kann ebenso der verstorbene<br />
Ostberliner Underground-Poet Matthias<br />
Baader Holst genügen („ich bin am<br />
ende doch das hat nichts zu heißen / wer<br />
zu lang lebt verliert sich schnell“) als auch<br />
Ernst Jünger, wie er auf dem Titelbild von<br />
Ausgabe 8 traulich seinen Sittich anblickt.<br />
Spätere Branchengrößen wie Karen Duve,<br />
Tanja Dückers, Saša Stanišić hatten in der<br />
Krachkultur frühe Auftritte. Büchner-Preisträgerin<br />
Sibylle Lewitscharoff steuerte eine<br />
Betrachtung über „Hoffnung“ bei.<br />
Soll also ein neuer Kanon entstehen,<br />
ein Gegengift gegen das „Wellness-Paradies<br />
deutscher Buchmarkt“? Brinkmann<br />
lächelt: Ja, über die Jahre sei man tatsächlich<br />
zu Bewahrern geworden. <strong>Die</strong> Krachkultur<br />
will auch Gedächtnis sein. Darum gelang<br />
es Brinkmann bereits 2004, Richard<br />
Yates dem Publikum näherzubringen – ehe<br />
2008 die Verfilmung von „Zeiten des Aufruhrs“<br />
mit Leonardo DiCaprio und Kate<br />
Winslet für eine globale Renaissance sorgte.<br />
Heimito von Doderer dürfte es schwerer<br />
haben. Brinkmann holt aus dem Nebenzimmer<br />
seine Dissertation. Sie ist 700 Seiten<br />
stark, kostete ihn fünf Lebensjahre und<br />
handelt von Musik und Melancholie. <strong>Die</strong><br />
Recherchen im Nachlass sorgten für eine<br />
komplett ausverkaufte Ausgabe der Krachkultur.<br />
Brinkmann konnte die Erzählung<br />
„Chronique scandaleuse oder René und die<br />
dicken Damen“ erstveröffentlichen. War<br />
Doderer nicht Formenbewahrer, während<br />
Krachkultur eine Lust am Formenzertrümmern<br />
hat? Da täuscht sich der Gast: „Eigentlich“,<br />
sagt Brinkmann, „war Doderer<br />
ein Postmodernist. Er schrieb das beste<br />
Deutsch des 20. Jahrhunderts. Was er der<br />
Literatur abverlangte, gilt noch heute.“ Das<br />
sprechende Zitat folgt: Literatur, so Doderer,<br />
müsse „eine gewisse Krudität des Griffes<br />
ins innere Geweid“ wagen. Also das Wesentliche<br />
ganz unlieblich sagen.<br />
Für Brinkmanns eigene Dichtung steht<br />
die Probe aus. Er schaut auf das Buch auf<br />
dem Küchentisch, den Roman von 2001,<br />
„Heute gehen alle spazieren“, fixiert die<br />
Kirchturmspitze von St. Johannes, draußen,<br />
oberhalb des Wiener Platzes, blickt in die<br />
Stube: „Ich dachte damals, ich hätte es geschafft.<br />
Dann aber ruhte ich mich auf den<br />
Lorbeeren aus.“ Erzählungen schreibt er<br />
regelmäßig, jüngst für Lettre International.<br />
Der Roman war die für ein Debut „typische<br />
autoanalytische Bearbeitung der eigenen<br />
Biografie“. Zwischen Zivildienst und<br />
Studium bemitleidet sich ein junger Mann<br />
in Norddeutschland: „Was soll nur aus mir<br />
werden?“ Witz und Selbstironie machen<br />
das schmale Buch zur feinen Sommerlektüre.<br />
Auch der Tod von Brinkmanns Vater,<br />
der zur See fuhr, verfängt sich dort im Gitter<br />
der Lakonie: „<strong>Die</strong> Frau, die meinen Vater<br />
anscheinend gekannt hat, wünscht mir<br />
nicht mal herzliches Beileid.“<br />
In der <strong>neuen</strong> Krachkultur gehen Schriftstellerinnen<br />
der Frage nach, was die „Pornografisierung<br />
der Männergehirne“ mit<br />
den Frauen macht. Nicht die teils grellen<br />
Stimmen aber aus den USA sind die wahre<br />
Entdeckung, sondern die Skizze „Glatt“ des<br />
deutschen <strong>Auto</strong>rs Torsten Wohlleben ist es.<br />
<strong>Die</strong>ser schildert in einer musikalisch präzisen<br />
Sprache, die Doderer gefallen hätte, die<br />
unheilige Schönheitsbehandlung der reichen,<br />
schönen Viktoria. Grundiert wird<br />
„Glatt“ von jener lässigen Melancholie, die<br />
getrost die vierte Person genannt werden<br />
kann, die in Martin Brinkmann fröhlich<br />
Quartier genommen hat.<br />
Alexander Kissler<br />
leitet bei <strong>Cicero</strong> den Salon.<br />
Von ihm erschien zuletzt „Papst<br />
im Widerspruch. Benedikt XVI.<br />
und seine Kirche 2005 – 2013“<br />
Fotos: Dirk Bruniecki für <strong>Cicero</strong>, Andrej Dallmann (<strong>Auto</strong>r)<br />
108 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Martin Brinkmann,<br />
Zeitschriftenmacher<br />
und Schriftsteller,<br />
wünscht sich eine<br />
Literatur, die verstört<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 109
| S a l o n<br />
Offene Rechnungen<br />
<strong>Die</strong> Suhrkamp-Verlegerin Ulla Berkéwicz gibt Rätsel auf. Ist sie die Totengräberin eines großen Erbes?<br />
von Wiebke Porombka<br />
W<br />
er die Nachfolge erfolgreicher<br />
Männer antritt, wird argwöhnisch<br />
beobachtet. Pep Guardiola<br />
steht das noch bevor. Auf Markus Lanz ist<br />
die Häme bereits niedergeprasselt. <strong>Die</strong> heftigste<br />
Nachfolgediskussion aber spielt sich<br />
nicht im Unterhaltungsgenre ab, sondern<br />
dort, wo sich die Hochkultur zu Hause<br />
wähnt: bei Suhrkamp, dem Verlag, der<br />
das intellektuelle Selbstverständnis der alten<br />
Bundesrepublik wie kein anderer verkörpert.<br />
Nun, da diese Geschichte mit der<br />
Schutzinsolvenz am vorläufigen Ende angelangt<br />
ist, scheint eine Frage noch ungeklärt:<br />
Ist Ulla Berkéwicz, die 2003 auf den charismatischen<br />
Siegfried Unseld folgte, die<br />
Lady Macbeth des Literaturbetriebs? Oder<br />
ist die Suhrkamp-Verlegerin die von geldhungrigen<br />
Teilhabern geschröpfte Verteidigerin<br />
der schönen Literatur?<br />
Ulla Berkéwicz, geboren als Ulla<br />
Schmidt, ist eine Frau mit schillerndem<br />
Vorleben. <strong>Die</strong> gelernte Schauspielerin, die<br />
sich ihren wohlklingenden Künstlernamen<br />
in Abwandlung des Nachnamens ihrer<br />
Großmutter zugelegt hat, war seit 1990<br />
mit Siegfried Unseld verheiratet. So viel<br />
ist sicher. Nicht verbürgt hingegen ist, ob<br />
1948 oder 1951 ihr korrektes Geburtsjahr<br />
ist oder aber, wie die Welt jüngst mitteilte,<br />
1949. Als sie 55 wurde, habe sie sich, nach<br />
alter Schauspielerinnen-Manier, um drei<br />
Jahre jünger gemacht, ließ die Verlegerin<br />
einst verlauten. Allerdings findet sich die<br />
Verjüngung bereits im Klappentext zu ihrer<br />
ersten Erzählung „Josef stirbt“ aus dem<br />
Jahr 1982. Sei es drum.<br />
Zu dieser Zeit hat Berkéwicz, um sich<br />
vollends dem Schreiben zu widmen, ihre<br />
Theaterlaufbahn bereits beendet. Geblieben<br />
ist von den neun Jahren auf der Bühne<br />
eine ganze Reihe beeindruckender Namen:<br />
Stationen am Staatstheater Stuttgart, den<br />
Städtischen Bühnen Köln, an den Münchner<br />
Kammerspielen, am Residenztheater,<br />
am Hamburger und Bochumer Schauspielhaus,<br />
dazu Regisseure wie Peymann und<br />
Zadek und eine erste Ehe mit dem Regisseur<br />
und Bühnenbildner Wilfried Minks.<br />
Konnte es wirklich angehen, dass Unseld<br />
eine branchenfremde Frau, die als bekennende<br />
Esoterikerin gilt und die noch<br />
dazu Bücher schreibt, deren immerzu um<br />
expressives Pathos ringender Ton – je nach<br />
Tagesform – schaudern oder schmunzeln<br />
macht, zu seiner Nachfolgerin bestimmt<br />
hat? Anstelle beispielsweise seines Sohnes<br />
Joachim Unseld?<br />
Immerhin hat Siegfried Unseld diese<br />
Bücher in seinem Verlag herausgebracht –<br />
wo sie bis heute erscheinen. Eins muss man<br />
Berkéwicz lassen: Sie schert sich erstaunlich<br />
wenig darum, ob man das als Pikanterie<br />
wahrnehmen könnte. Ihr nächstes Buch,<br />
für dieses Frühjahr angekündigt, ist allerdings<br />
auf den späten Herbst verschoben.<br />
Genauso wenig schert Berkéwicz der Beigeschmack,<br />
den andere ihrer durchaus unkonventionellen<br />
Methoden hervorrufen.<br />
Zum Mythos geworden ist die abendliche<br />
Inszenierung, zu der Berkéwicz die<br />
Suhrkamp-Mitarbeiter nach dem Tod ihres<br />
Mannes bat. Zwei Gäste sollen in Ohnmacht<br />
gefallen sein, als die Stimme des verstorbenen<br />
Verlegers ertönte und das Team<br />
auf seine Gattin als Nachfolgerin einschwor.<br />
Am Totenbett soll die Aufnahme<br />
entstanden sein. Episoden wie diese kann<br />
man problemlos zu einer Geschichte zusammenstricken,<br />
der es an übler Nachrede<br />
und süffisanter Missgunst nicht mangelt.<br />
Aufschlussreicher erscheint ein Blick<br />
auf das, was in der Struktur des Verlags<br />
nach Unselds Tod vor sich gegangen ist.<br />
Namhafte <strong>Auto</strong>ren wie Martin Walser oder<br />
Daniel Kehlmann haben Suhrkamp den<br />
Rücken gekehrt. Auch die Leitungsebene<br />
wurde fast komplett ausgetauscht – ging<br />
oder wurde gegangen: Von Günter Berg<br />
über Rainer Weiss bis zu Lektor Thorsten<br />
Ahrend oder Vertriebschef Georg Rieppel.<br />
Enttäuschte Kronprinzen? Zweifelsohne<br />
zeigt es: Man unterschätzt Ulla Unseld-Berkéwicz,<br />
wie sie mit vollem Namen<br />
heißt, wenn man sie als verirrte Esoterikerin<br />
abzustempeln versucht. Sie ist eine Verlegerin,<br />
die ihre Macht, jedenfalls intern,<br />
professionell auszubauen verstanden hat.<br />
Selbst Neider müssen anerkennen, dass<br />
Suhrkamp unter ihr und aller Unkenrufe<br />
zum Trotz Saison für Saison ein ebenso anspruchsvolles<br />
wie erfolgreiches, wenn auch<br />
wirtschaftlich riskantes Programm vorlegt.<br />
Der Umzug des Verlags von Frankfurt<br />
nach Berlin war also wohl eher Souveränitätsbeweis<br />
denn der frevelhafte Bruch mit<br />
der Suhrkamp-Tradition. Vielleicht ist es<br />
umgekehrt: Vielleicht hat Berkéwicz nicht<br />
mit Tradition gebrochen, sondern zu kompromisslos<br />
an einer althergebrachten auratischen<br />
und autokratischen Verlegerposition<br />
festgehalten. Man kann die legitimen<br />
finanziellen Forderungen des Medienunternehmers<br />
Hans Barlach an den Verlag für<br />
verwerflich halten. Fakt ist, dass die Lage<br />
brenzlig geworden ist, weil Berkéwicz es<br />
nicht gelang, sich mit dem Minderheitsgesellschafter<br />
zu einigen. Weil sie nicht abließ<br />
von einem Alleinherrscheranspruch,<br />
der moralisch legitim sein mag, faktisch<br />
aber nicht bestand.<br />
Symptomatisch ist die viel diskutierte<br />
Villa in Berlin-Nikolassee, Gegenstand in<br />
einem der unzähligen Prozesse zwischen<br />
Suhrkamp-Geschäftsführung und Barlach.<br />
Das Haus ist Privatbesitz der Verlegerin<br />
und wird gleichzeitig für Veranstaltungen<br />
des Verlags genutzt – gegen Mietzahlungen<br />
an Berkéwicz. Zum juristischen Stolperstein<br />
wurde, dass die Miete den per Gesellschaftervertrag<br />
gestatteten Betrag geringfügig<br />
überschreitet. Nimmt man die Villa als<br />
Indiz für das Ganze, dann liegt der Schluss<br />
nah: Hier ist eine Rechnung ganz grundsätzlich<br />
nicht aufgegangen.<br />
Wiebke Porombka<br />
arbeitete ebenfalls einige Jahre<br />
am Theater, bevor sie zur<br />
Literaturkritik wechselte<br />
Fotos. Markus Tedeskino, Synnove Duran (<strong>Auto</strong>rin)<br />
110 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Ulla Unseld-Berkéwicz,<br />
einst Schauspielerin,<br />
nun Schriftstellerin und<br />
Verlegerin, könnte das<br />
Ende von Suhrkamp<br />
eingeläutet haben<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 111
| S a l o n<br />
Der Hexer<br />
Musikproduzent Rick Rubin hat Black Sabbath zu einem späten Meisterwerk verholfen – durch Reduktion<br />
von thomas Winkler<br />
D<br />
ie überraschende nachricht<br />
ist nicht, dass eine legendäre<br />
Band nach mehr als drei Jahrzehnten<br />
der Trennung zusammengefunden<br />
hat. Auch nicht, dass es drei Mittsechzigern<br />
gelungen ist, ein neues Album einzuspielen.<br />
<strong>Die</strong> Nachricht ist es ebenfalls nicht, dass<br />
Starproduzent Rick Rubin die Rentnercombo<br />
zu ihrem faszinierend vitalen Auftritt<br />
angeleitet hat. <strong>Die</strong> Überraschung ist,<br />
dass sich alle Welt auf Black Sabbath einigen<br />
kann. Tatsächlich hat „13“, das erste<br />
in Originalbesetzung aufgenommene Album<br />
seit 35 Jahren, sich zur Konsensplatte<br />
des Jahres entwickelt. Sie stürmt weltweit<br />
die Verkaufscharts – trotz sperriger, schwer<br />
dräuender, abweisender Songs.<br />
Black Sabbath, die 1968 in der Stahlstadt<br />
Birmingham gegründete Rockband,<br />
gelten als Erfinder des Heavy Metal. Sie<br />
waren stilprägend, von der Einführung<br />
des als Teufelsakkord bekannten Tritonus<br />
in die Rockmusik über die Endzeitsymbolik<br />
bis zu den abgebissenen Tauben- und<br />
Fledermausköpfen, mit denen sich Sänger<br />
Ozzy Osbourne nicht nur bei Tierschützern<br />
unbeliebt machte. Seitdem hat Osbourne<br />
eine Reality-TV-Show und unzählige<br />
Entziehungskuren überlebt, während<br />
Gitarrist Tony Iommi erst während der<br />
Aufnahmen zu „13“ eine Chemotherapie<br />
gegen Lymphdrüsenkrebs hinter sich<br />
brachte. Bassist Geezer Butler, seit Jahrzehnten<br />
als weitgehend skandalfreier Veganer<br />
der ruhende Pol der Band, schrieb<br />
wieder die Texte, in denen religiöse Zweifel,<br />
Konsumwahn und Weltfrieden, vor allem<br />
aber Tod und Teufel verhandelt werden.<br />
Das große Thema der Band ist die Vergänglichkeit.<br />
Damit prägte sie den Heavy<br />
Metal bis in seine letzten Verästelungen.<br />
Metal ist sich immer bewusst, dass etwas<br />
nur lebt, um zu sterben: die Liebe, der<br />
Mensch, das System, die Welt, wie wir<br />
sie kennen. Seit der Kapitalismus in einer<br />
Dauerkrise festsitzt, ist das Genre noch am<br />
ehesten von der Krise des Popgeschäfts<br />
verschont geblieben. Metal-Fans sind treu,<br />
und die Musik setzt dem Vergehen des Lebens<br />
die schwergewichtige Wertigkeit eines<br />
traditionellen Handwerks entgegen.<br />
Um sich auf diese Qualitäten zu besinnen,<br />
engagierten Black Sabbath den richtigen<br />
Produzenten: Rick Rubin hat sich<br />
im Laufe der vergangenen Jahrzehnte etabliert<br />
als der große Restaurator und Wertbewahrer<br />
der Popmusik. Der mittlerweile<br />
50 Jahre alte New Yorker hat auch die Red<br />
Hot Chili Peppers, Glenn Danzig oder die<br />
Beastie Boys zu Branchengrößen geformt.<br />
Seinen legendären Ruf als Soundgestalter<br />
aber verdiente er sich, indem er scheinbar<br />
hoffnungslos versackte Karrieren von<br />
ausgemusterten Altstars wie Johnny Cash,<br />
Neil Diamond, ZZ Top wieder in Gang<br />
brachte. Dazu wendet Rubin stets dieselbe<br />
Methode an: Er reduziert das Werk seiner<br />
Schützlinge auf deren unverzichtbare Essentials,<br />
auf das schlichtweg Wesentliche.<br />
Das Ergebnis, sagt Rubin nun, sei „Black<br />
Sabbath being Black Sabbath“.<br />
Rubin sieht mit seinem Weihnachtsmannbart<br />
nicht nur aus wie ein Guru, er<br />
arbeitet auch so. Seinen Jugendjahren verpflichtet,<br />
die er in Punkbands verbrachte,<br />
beherrscht er bis heute kein einziges Instrument.<br />
Rubin kann keine Noten lesen<br />
und dürfte der einzige erfolgreiche Musikproduzent<br />
der Welt sein, der nicht einmal<br />
rudimentär ein Mischpult bedienen kann.<br />
Büroräume meidet Rubin aus Prinzip,<br />
hat aber lange Jahre erfolgreich Plattenlabel<br />
geleitet, darunter die legendäre<br />
Firma Def Jam, die er noch im Studentenwohnheim<br />
gründete. Als er <strong>vom</strong> Entertainment-Konzern<br />
Sony eingekauft wurde,<br />
um das berühmte Label Columbia zu retten,<br />
schaffte er nicht nur Hierarchien ab<br />
und führte neue, mitunter esoterische Geschäftsprinzipien<br />
ein, sondern ließ sich angeblich<br />
auch vertraglich garantieren, dass<br />
er niemals einen Anzug tragen muss und<br />
dass niemals eine Telefondurchwahl für ihn<br />
eingerichtet wird. Einem schwerkranken<br />
Johnny Cash verschaffte er neben einer unerwarteten<br />
Spätkarriere auch einen Kinesiologen,<br />
der den Country-Helden mit Alternativmedizin<br />
verjüngte.<br />
Vor allem aber erzählen Musiker, die<br />
mit ihm gearbeitet haben, von einem<br />
Fleischbündel, das auf einer Couch ruht,<br />
mit geschlossenen Augen im Takt der<br />
<strong>neuen</strong> Aufnahmen hin und her wogt, bevor<br />
Rubin seltsam orakelhafte, aber erstaunlich<br />
hilfreiche Ratschläge aussendet.<br />
Er versuche zu vermeiden, seinen Auftraggebern<br />
konkrete Verbesserungsvorschläge<br />
zu machen, erzählt Rubin, „in neun von<br />
zehn Fällen kommen die von selbst auf eine<br />
Lösung, die besser ist als alles, was ich mir<br />
ausdenken könnte“.<br />
Auch Osbourne, Iommi und Butler irritierte<br />
der erklärte Black-Sabbath-Fan Rubin,<br />
indem er sie ausführlich mit der Musik<br />
konfrontierte, der sie ihren Legendenstatus<br />
verdanken. Black Sabbath mussten sich<br />
immer wieder das eigene Frühwerk anhören,<br />
um zu erkennen, was Black Sabbath<br />
eigentlich ausmacht. Wer das herausgefunden<br />
hat, der kann den ganzen überflüssigen<br />
Ballast eliminieren.<br />
Folgerichtig klingt „13“ nun grundsätzlich,<br />
ja zeitlos. Osbournes Stimme quengelt<br />
sich durch Nahtoderfahrungen und existenzielle<br />
Fragestellungen wie „Is god really<br />
dead?“, Butlers Bass grummelt bösartig<br />
und Iommis Gitarre sägt tiefer gelegte<br />
Riffs, die, wenn sie nicht die Abgründe<br />
menschlicher Ängste durchschreiten, das<br />
Bauchfell gewaltig zum Flattern bringen.<br />
Und dass es drei Rentner sind, die unsere<br />
Zeit so quicklebendig und passgenau zum<br />
Klingen bringen, ist angesichts des demografischen<br />
Wandels vermutlich nur eine<br />
kleine Überraschung.<br />
thomas Winkler<br />
durchlebte eine<br />
schwermetallgeschwängerte<br />
Jugend in der Provinz und<br />
schreibt über Pop, Film, Sport<br />
Fotos: Martin Schöller/August Images, privat (<strong>Auto</strong>r)<br />
112 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Lehrmeister der Reduktion, mit<br />
sich im Reinen: Rick Rubin hat<br />
sein Gleichgewicht gefunden<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 113
| S a l o n | P a u l u s u n d M o s e s<br />
Moses, der Seelenentzweite,<br />
sah nie das Gelobte Land<br />
Mein Paulus,<br />
Mein Moses<br />
Gott hasst die Erschlaffung. Und die alte Zeit ist<br />
nicht vergangen: Was ich über die modernen Bürger<br />
lernte, als ich hinabstieg in die Schriften der beiden<br />
Urväter des Judentums und des Christentums<br />
von Feridun ZaimogLu<br />
I<br />
m Jahre 2012 nahm ich zwei Auftragsarbeiten<br />
an: ein Hörspiel für den<br />
Hessischen Rundfunk über Paulus<br />
und ein Theaterstück über Moses. Es<br />
wird Anfang Juli beim Passionstheater<br />
Oberammergau in der Regie Christian<br />
Stückls uraufgeführt werden. Der Apostel<br />
stritt für das Himmelreich mit der Wortgewalt<br />
eines Philosophen. Der Prophet galt<br />
als zungenlahmer Israelit. Es ist überliefert,<br />
dass beide Gottesmänner die Götzen ihrer<br />
Zeit zermalmten. Sie wollten Schande und<br />
Schandtat nicht länger dulden.<br />
Moses wurde von Bithiah, der Schwester<br />
des Pharao, höfisch erzogen. Paulus<br />
war ein gebildeter schriftkundiger Jude, er<br />
sprach die Sprache des damaligen Imperiums.<br />
Pharaos Ziehsohn schlug einen ägyptischen<br />
Aufseher tot und floh. Der Apostel<br />
hingegen zog sich den Unmut der Urgemeinde<br />
zu, weil er den Menschensohn Joschua<br />
vergöttlichte. Er verließ die Getreuen<br />
des Heilands. In der Bibel hatte ich oft geblättert,<br />
ich schrieb das über Jahrzehnte angelagerte<br />
Wissen auf. Wie konnte es mir gelingen,<br />
diese Krieger im <strong>Die</strong>nste des Herrn<br />
zu zeichnen? Reichte das bloße Quellenstudium<br />
aus? Sah ich in ihnen Figuren der Heiligen<br />
Fabel, mit der man die Völker narkotisiert?<br />
Waren sie derart anfechtbar, dass ich<br />
den Stoff zu Ungunsten des Jüngers und des<br />
Gesandten aktualisieren musste?<br />
<strong>Die</strong> Lieblingsfloskel des kulturschaffenden<br />
Bürgers heißt „die heutige Sicht“. Ein<br />
Gott wird bestenfalls vermutet. Der Bürger<br />
stellt ihn sich vor als einen konservierten<br />
Leichnam, der jenseits des Alls in der<br />
Schwärze treibt. Ein Stückeschreiber unserer<br />
Zeit findet es vergnüglich, Gott zu lästern.<br />
Allein sein Zugriff und sein Verständnis<br />
zählen und also psychologisiert er: Er<br />
fühlt sich ein. In Gott, in das fleischgewordene<br />
Wort, in das Insekt und das erlegte<br />
Wild, in den Urschlamm und in die<br />
Pflanze. Einen von Gottes Licht beglänzten<br />
Mann kann er nur verlächerlichen. Schließlich<br />
arbeitet er mit den Mitteln der Verstörung.<br />
Man hat sich daran zu halten, dass er<br />
die heiligen Männer durchschaut; es sind<br />
allesamt gemütserregte Kerle.<br />
Was also tut der heutige Schreiber, da er<br />
die schönen Legenden bearbeitet? Er verschleiert<br />
die Grandiosität und unterdrückt<br />
das Ungestüm. Aus Moses wird ein schwätzender<br />
Krüppel, eine Monologmaschine,<br />
ein Verkündigungsgerät. Ein fluchsprotzender<br />
Greis, der den Infusionsschlauch<br />
Foto: Contrasto/Laif<br />
114 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Foto: Hermann Buresch/BPK<br />
benagt. Paulus dichtet er eine manifeste<br />
Geistesverwirrung an: Der Apostel, seiner<br />
Heiligkeit beraubt, nackt bis auf das Lendentuch,<br />
übergießt sich mit dem Blut des<br />
Gekreuzigten. Er liest seitenlange Briefe vor,<br />
die er nie abgeschickt hat. Den Holzsplitter<br />
<strong>vom</strong> Kreuz des Heilands zeigt er dem Publikum<br />
vor und stochert damit zwischen den<br />
Zähnen. <strong>Die</strong>se Entwürfe, der Phantasie des<br />
Provokateurs entsprungen, begeistern bestimmt<br />
den einen oder anderen Großkritiker.<br />
<strong>Die</strong> Wahnverstrickung großer Frauen<br />
und Männer gilt als wesenhaft.<br />
Übertreibe ich? Zeigt man nicht tatsächlich<br />
die abgehackten Köpfe von Heilsbringern<br />
auf der Bühne? Zeichnet man nicht<br />
Frösche und Säue, die ans Kreuz genagelt<br />
sind? Beschimpft man nicht einen Gottesgesandten<br />
als Kinderschänder und Sodomisten?<br />
Gott selbst aber will der Aufklärer<br />
am Erschöpfungsinfarkt gestorben wissen.<br />
Er habe die Welt erschaffen und sich dabei<br />
übernommen.<br />
Ich scherte mich wenig um die Leugner<br />
und ihre Deutung. <strong>Die</strong> in Zerrbildern<br />
zum Fratzen-Ich verzeichnete Seele:<br />
Sie taugt höchstens als Porträt eines Irren.<br />
In eherner Zeit fielen auf die Häupter<br />
der Gläubigen und der Heiden herab die<br />
Trümmer des alten Himmels. <strong>Die</strong> Herren<br />
in den Palästen, sie ahnten den Zerfall der<br />
Reiche; und doch hoffte ein jeder Tyrann,<br />
er werde das Weltende überleben. Kein<br />
Reich gedieh ohne verknechtete Männer<br />
und Frauen, Ägypten war ein Sklavenstaat<br />
von vielen. Ausgerechnet Moses, den Sohn<br />
einer Sklavin, ernannte der Pharao zu seinem<br />
Nachfolger.<br />
Der Thronanwärter niederer Herkunft<br />
wurde also nicht seinem Volk zugeschlagen.<br />
<strong>Die</strong> Hebräer brannten Lehmziegel für die<br />
Häuser der Ägypter. Der Glaube ihrer Vorväter<br />
hielt sie am Leben. Was sahen sie in<br />
des Königs Günstling Moses, wenn er sich<br />
zu ihrem Zeltlager stahl? Einen Verräter, einen<br />
mit allen Salben geschmierten Lumpen?<br />
Wer Stamm und Sippe verließ, konnte<br />
nur irregehen – musste man nicht den Abtrünnigen<br />
nach Ahnengesetz steinigen?<br />
In der jüdischen Legendensammlung<br />
suchte ich vergebens nach Auskünften über<br />
Moses als jungen Höfling. <strong>Die</strong> fünf Bücher<br />
Mose geben einen Abriss über Taten und<br />
Wunder des Propheten. Sie wurden Aberhunderte<br />
Jahre nach seinem Tod von Priestern<br />
niedergeschrieben. <strong>Die</strong> Geschichten<br />
über den Gesandten wurden zu einer<br />
heiligen Schrift verkittet. Allein den Bibeltreuen<br />
geht es um die Originaltreue; ich<br />
aber wollte <strong>vom</strong> vorgefundenen Stoff ausgehen:<br />
Moses hängt dem Einen Heiligsten<br />
an. Thron, Sippe, Stamm – vor dem Auge<br />
des Herrn werden sie nicht bestehen. Über<br />
ein Reich hätte er herrschen können, jeder<br />
Untertan wäre vor ihm, dem fleischgewordenen<br />
Götzen, zu Boden gegangen.<br />
Er aber entschied: Huld gebührt nur<br />
dem einen Gott. Was nützen Standbilder<br />
in den Tempeln, vor denen man Räucherwerk<br />
verbrennt? Er entschied: Ich will nicht<br />
beflecken meine Seele, da ich heiligte Stein<br />
und bröckeligen Lehm. Um des Ruhmes<br />
der Macht, die uns überragt, floh er die<br />
Selbstüberhöhung. Sein Ziehvater im Palast,<br />
seine Mutter eine Leibeigene – die Hagiographen<br />
bemühten eine seelenentzweite<br />
Figur, um den Mann Moses dem Dunkel<br />
zu entreißen. Er war ein Prophet, der Brot<br />
aß, und der Herr ließ ihn nicht sinken.<br />
Der Aufseher, den er mordete, hatte die<br />
Frau eines Knechtes geschändet, und also<br />
musste er sterben. Der Pharao erkannte<br />
darin kein Aufbegehren wider seine Herrschaft,<br />
er hätte es bei einer harten Mahnung<br />
belassen. Moses waren Ruhm und<br />
Rüge einerlei, und noch hatte Gott den Seinen<br />
nicht gerufen. Er verließ aber das Land,<br />
bot einem anderen König seine <strong>Die</strong>nste an,<br />
nahm eine schwarze Kuschitin zur Frau.<br />
Erst Jahrzehnte später kehrte er zurück, er<br />
war zum Kriegerpropheten gereift.<br />
Ich verstand: Aller Glaube ist wüstenländisch,<br />
und die Wüste ist Ursprung.<br />
Hartgesichtig sind die Gläubigen. Der<br />
Gott ihrer Anbetung hasst die Erschlaffung,<br />
das milde Wort, die Abart, den fremden<br />
Einfluss und die Vermischung. Ich erschrak:<br />
<strong>Die</strong> Israeliten, die sich mit Frauen<br />
fremder Stämme vermählen und verpaaren,<br />
werden ausgemerzt. Moses’ Schwester Miriam<br />
zankt den Gesandten deshalb aus; der<br />
Herr straft die Todsünder und belohnt aber<br />
Mit dem großen<br />
Offenbarungskünstler Paulus<br />
begann das Christentum<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 115
| S a l o n | P a u l u s u n d M o s e s<br />
Moses, der mit einer Kuschitin das Zelt<br />
teilte. Miriam erbleicht augenblicklich, ihr<br />
Gesicht wird schneeweiß, sie muss als Aussätzige<br />
außerhalb des Lagers leben. Ist das<br />
gerecht? Hat sich das wirklich zugetragen,<br />
oder haben die späteren Verfasser absichtsvoll<br />
gedichtet?<br />
In der Stunde des großen Kampfes<br />
muss der Zweifler gebrochen werden.<br />
Gott versetzt ein Volk von mehreren Tausend<br />
Männern und Frauen. <strong>Die</strong>se Schar der<br />
Knechte soll das verheißene Land erobern;<br />
und also wird der gemeine Sklave durch<br />
Zucht und Drill, durch Tod und Verdammung<br />
diszipliniert. Am Ende werden die<br />
Israeliten in geordneten Schlachtreihen gegen<br />
die feindlichen Krieger ziehen. In der<br />
kinderfreundlichen Fassung begegnen wir<br />
einem rauschebärtigen Moses, der mit den<br />
Gesetzestafeln den Berg Sinai herabsteigt.<br />
Was aber steht tatsächlich geschrieben?<br />
Nach dem ersten Abstieg zerbrach er<br />
voller Zorn die Steintafeln – die Knechte<br />
hatten, verdrossen ob Jahwes Regelwerk,<br />
ein Abbild in Gold gegossen. Der Gesandte<br />
ordnete den massenhaften Mord an, die<br />
Getreuen metzelten die Frevler nieder. Moses<br />
stieg ein zweites Mal auf den Berg, und<br />
als er nach 40 Tagen zurückkehrte, wichen<br />
die Israeliten vor ihm zurück. Moses’ Gesicht<br />
war entstellt. Gott hatte ihn berührt<br />
und verbrannt. Für den Rest seines Lebens<br />
musste er sein Antlitz verhüllen. Manchmal<br />
legte er den Gesichtsschleier ab, wenn<br />
er mit seinem Bruder Aaron sprach.<br />
Aaron wurde <strong>vom</strong> Herrn zum Hohepriester<br />
erhöht: Er widersprach Gott nicht, als<br />
Er zwei seiner Söhne im Feuer umkommen<br />
ließ. Sie hatten Jahwe zur ungelegenen Zeit<br />
Räucherwerk geopfert. Aaron schwieg, da<br />
Gott Miriam des Lagers verwies. Das Volk<br />
liebte ihn, den guten Redner und Rechtsprecher.<br />
Moses stammelte; er war der härteste<br />
Krieger des Herrn. Man büßte mit<br />
dem Leben, wenn man seinen Ratschluss<br />
anzweifelte. Moses sprach Gottes Gesetz.<br />
Laut der Schrift und den Legenden sind<br />
dies die wahren Geschichten. Ich verstand:<br />
<strong>Die</strong> alte Zeit ist nicht vergangen.<br />
Ich schrieb in mächtigen Worten, ohne<br />
Zagen und Glaubensschwäche. Ich verbot<br />
mir Gewäsch und Gerede, das postprophetische<br />
Übelschwätzen. Kein Klamauk,<br />
keine heutige Prosa, keine Blasphemie. <strong>Die</strong><br />
Frömmelei ist eine Erfindung der niederträchtigen<br />
Kreatur: Sie zimmert im Geiste<br />
jedem, der nicht ihres Sinnes ist, ein Galgengerüst.<br />
Also verbot sich mir auch die<br />
Verkitschung und Verknirpsung eines großen<br />
Mannes.<br />
In unserer Zeit glaubt jeder Bürger, er<br />
könne mitreden, weil er Streitgespräche im<br />
Fernsehen verfolgt hat. Welch ein Irrtum,<br />
welch eine Verblendung. Im Glauben gibt<br />
es kein Expertentum. <strong>Die</strong> Pharisäer und<br />
Jeder Bürger glaubt, er könne<br />
mitreden, weil er Streitgespräche<br />
im Fernsehen verfolgt hat<br />
Philister, die Höker und Theologen: Sie<br />
deuten, sie zerren den unfassbaren Gott in<br />
die Nähe. Für mich, der ich für die Bühne<br />
schrieb, war Deutung nicht statthaft. Moses,<br />
der Anführer eines verknechteten Volkes.<br />
Moses, von Gott geliebt und geschützt.<br />
<strong>Die</strong>ser Moses blieb zurück: Der Herr verwehrte<br />
ihm den Einzug ins Gelobte Land.<br />
Joschua Meschiach, Sohn des Zimmermanns,<br />
Gottes Liebling, der gesalbte Heiland:<br />
Wer ihn sah, mit unvertrübten Augen,<br />
wurde verwandelt. Wer seinen Worten <strong>vom</strong><br />
nahenden Himmelreich glaubte, wurde berührt.<br />
Ihn schickte der Herr, dass er erfülle<br />
das Gesetz und erneuere den Bund. Es<br />
scharten sich um ihn die einfachen Männer<br />
und Frauen. <strong>Die</strong> Gebildeten und Gelehrten<br />
beschauten ihn aus der Ferne wie ein<br />
wildes Tier. Der Mann brach mit der Überlieferung,<br />
er heiligte nicht den Feiertag, er<br />
bespuckte die Geldwechsler im Tempelhof.<br />
Es gab im Lande viele glühende Männer,<br />
die das Weltende weissagten: Stein wird<br />
bersten, Holz wird splittern, und die Erde<br />
spuckt alles Gebein heraus.<br />
Menschensohn Joschua: Über ihn hielt<br />
der Vater im Himmel seine Hand. Saulus<br />
begriff: Weisheit zähmt den Geist; die<br />
Offenbarung peitscht die Seele. Joschua<br />
brachte das Schwert, mit dem Eisen<br />
schied er die Schläfer von den Erwachten.<br />
Saulus lernte ihn zu hassen. <strong>Die</strong> Männer,<br />
die dem jungen Prediger nachliefen,<br />
nannte er Gesindel. <strong>Die</strong> Frauen, die Joschuas<br />
Füße salbten und mit ihrem Haar<br />
trockneten, hieß er hurenhaft. Bei Tage<br />
durfte man kein Licht aufstecken – dieser<br />
wirre Jüngling aber war beglänzt. Saulus<br />
stand in <strong>Die</strong>nsten des Hohen Rates zu<br />
Jerusalem, er wurde als Ketzerrichter bestallt.<br />
Es steht geschrieben: Auf dem Weg<br />
nach Damaskus hörte er die Stimme des<br />
Meisters. Traumbild, Erleuchtung, Bekehrung.<br />
Er änderte seinen Namen nicht. Im<br />
Griechischen sprach man Saulus als Paulus<br />
aus.<br />
Der Name des Predigers bedeutet:<br />
Gott ist Rettung. Also sah Saulus den <strong>vom</strong><br />
Herrn geschickten Erlöser. Einen Mann aus<br />
Fleisch und Blut. Den an den Schandpfahl<br />
genagelten Menschensohn – hat Saulus ihn<br />
auch sehen können? Von seiner Gottesnatur<br />
konnte der im strengen Eingottglauben<br />
aufgewachsene Joschua nicht gesprochen<br />
haben. Ich entdeckte: Saulus’ Trauer<br />
über den Tod des Rabbi war unermesslich.<br />
Er vergöttlichte ihn. Ich las die Evangelien,<br />
überflog die Briefe an die Gemeinden.<br />
<strong>Die</strong> Bücher von Bibelexegeten und<br />
Theologen hatte ich in den letzten 30 Jahren<br />
verschlungen, und also musste ich nicht<br />
nachschlagen.<br />
Ich betrachtete Schwarz-Weiß-Fotografien<br />
von jungen Philippinos in San Fernando.<br />
Am Karfreitag lassen sie sich ans<br />
Kreuz nageln. Über die Schmerzensnachahmung<br />
kommen sie dem Liebling Gottes<br />
nah und näher. <strong>Die</strong> Menschen des einfachen<br />
Volkes, sie kümmert nicht die orthodoxe<br />
Lehre. Auch damals, zu Saulus’ Lebzeiten,<br />
gab es viele Männer und Frauen,<br />
denen man die Geistesgaben der Prophetie<br />
und Zungenrede zuschrieb. Der gebildete<br />
Apostel floh ihre Gesellschaft, verließ<br />
das Heilige Land. Nur die Ekstase auf dem<br />
Papier empfand er als reizvoll.<br />
Der tote Gesandte, das ausbleibende<br />
Weltende, die Anfeindungen der Altgläubigen,<br />
die Macht des Imperiums: Saulus ersann<br />
einen Gegenschlag, er schrieb die Geschichte<br />
um. Gottes und Volkes Liebling<br />
Jesus wurde zum Weltenlenker, zu Christus<br />
mit dem Strahlenkranz. Er baute an<br />
einer <strong>neuen</strong> Kirche, um der alten Kirche<br />
zu trotzen. Es durfte der Feind nicht gesiegt<br />
haben, Feindes Triumphgesang würde<br />
verklingen. <strong>Die</strong> Frauen und Männer der<br />
116 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Foto: Bettina Fürst-Fastré<br />
ersten Stunde gingen den Apostel hart an.<br />
Das Heidentum sickerte in den Glauben,<br />
ihr Heiland wurde verklärt – sie stemmten<br />
sich dagegen und unterlagen.<br />
Ich bin auf der Seite der Propheten. Priester<br />
und Theologen lehne ich ab. Der Handel<br />
mit Gottes Gnade widert mich an. Kein<br />
Stellvertreter des Herrn ist unfehlbar. <strong>Die</strong><br />
unerbittlichsten Feinde der gottgeliebten<br />
Gesandten waren immer die Priester des alten<br />
Glaubens. <strong>Die</strong> Abtrünnigen und Spalter:<br />
Sie erfanden neue Dogmen, und sie<br />
erfanden neue Ketzer. Ihr törichtes Geschwätz,<br />
ihre Richtersprüche, ihre Arrangements<br />
mit den Herrschern der Zeit; ihre<br />
Massenmorde, ihre Preisungen und Anrufungen,<br />
ihre Vergötzung der Heilsbringer –<br />
sie beriefen sich dabei immer auf Gott.<br />
Doch sollen die Aufklärer bei diesen<br />
Worten nicht frohlocken. Ihre Heilsgestalten<br />
waren und sind Fortschrittsmaschinen.<br />
Ihre rassenreinen und klassenlosen Gesellschaften<br />
glichen Höllenreichen. Es braucht<br />
eines Satans nicht, um das abscheulich<br />
Böse zu wirken. Ich erkannte: Moses und<br />
Joschua, geheiligte Männer, <strong>vom</strong> Herrn in<br />
diese Welt gesetzt, auf dass sie den Götzendienst<br />
mit aller Macht bekämpfen. Und<br />
Paulus? Der geläuterte Inquisitor warnte<br />
und mahnte die Getreuen des Heilands;<br />
die alten Gesetze waren erloschen, das neue<br />
Gesetz hieß Christus.<br />
Saulus hat um des Überlebens willen<br />
Joschua Meschiach geopfert. Wie kann<br />
ich mich dem Apostel anverwandeln, auf<br />
dem Papier, das dieser Mann so liebte?<br />
Viele Tage denke ich nach, verwerfe viele<br />
Ideen. Der Offenbarungskünstler sprach in<br />
Gleichnissen. Saulus legte in Worten das<br />
Glaubensbekenntnis fest. Ich verstand: Er<br />
hat überlebt, und also wird er ein harmonisches<br />
Bild zeichnen. Ich verstand: Er ist<br />
umstellt, und also wird er nicht mit sich<br />
verhandeln lassen. Er weiß, dass seine Tage<br />
gezählt sind. Er schreibt an die Jünger und<br />
Führer der Gemeinden … und sie schreiben<br />
zurück: Das ist der rettende Einfall.<br />
Was kann ich sagen, nach Tagen und<br />
Wochen der harten Arbeit? Moses und Paulus<br />
– ich bezeuge: Sie haben gelebt.<br />
Anzeige<br />
Unser Wein des Monats<br />
Cabernet Rosé Vin de Pays de la Cité de Carcassonne, 2012<br />
Weißwein je Flasche für 5,90 EUR*<br />
Zu 100 % aus Cabernet Sauvignon vinifiziert, präsentiert sich dieser<br />
feine Rosé fruchtig und saftig, gleichzeitig aber erfrischend. Sein<br />
perfektes Frucht-Säureverhältnis mit Anklängen von Brombeerund<br />
Erdbeeraromen schafft einen charaktervollen Wein, der nicht<br />
nur, aber besonders im Sommer Spaß macht.<br />
*Zzgl. Versandkostenpauschale von 7,95 EUR; Bestellnr.: 1002106 (Einzelfl.), 1002105 (Paket)<br />
Tipp: Beim Kauf von 11 Flaschen erhalten Sie eine weitere gratis.<br />
Feridun Zaimoglu<br />
ist Schriftsteller. Von ihm<br />
stammen u. a. „Der Mietmaler“,<br />
„Hinterland“, „Liebesbrand“ und<br />
„German Amok“<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Telefon: 030 3 46 46 56 56<br />
E-Mail: shop@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/wein
| S a l o n | T i m e i t e l i m G e s p r ä c h<br />
„<strong>Die</strong> reine Präsenz“<br />
Tim Eitel, einst Shootingstar der Leipziger Schule, fürchtet den Verlust der Ernsthaftigkeit<br />
in der Kunst. In <strong>neuen</strong> Bildern wendet er sich dem Prekariat zu<br />
Gut zehn Jahre ist es her, dass der Begriff<br />
„Neue Leipziger Schule“ zum Synonym<br />
wurde für eine unverbrauchte Strömung<br />
in der deutschen Gegenwartskunst.<br />
Früh als Shootingstar der Szene rund um<br />
die Leipziger Hochschule für Grafik und<br />
Buchkunst wurde der 1971 in Leonberg<br />
geborene Tim Eitel gehandelt. Anlässlich<br />
einer Ausstellung in der Sammlung Essl<br />
bei Wien mit <strong>neuen</strong> Bildern erklärt Eitel,<br />
warum er seine Werke als lebensbejahend<br />
empfindet und was ihn am Prekariat<br />
interessiert.<br />
H<br />
err Eitel, es schien in den vergangenen<br />
Jahren ruhiger um Sie<br />
geworden zu sein. Ihre letzte<br />
Einzelausstellung in Deutschland liegt<br />
fünf Jahre zurück. Sie selbst leben mittlerweile<br />
in Paris. Brauchten Sie Abstand?<br />
Ich bin nicht komplett umgezogen, ich<br />
habe noch immer meinen Wohnsitz<br />
und ein Atelier in Berlin. Für mich ist es<br />
aber gut, eine Dualität im Leben zu haben.<br />
Ich mag es, die Dinge einmal aus einer<br />
anderen Perspektive zu sehen. Vorher<br />
habe ich eine Zeit lang in New York<br />
gelebt und bin dann wieder nach Berlin<br />
gezogen. Jetzt lebe ich zwischen Berlin<br />
und Paris. Ich finde diese Ortswechsel<br />
produktiv. Dadurch relativiert sich alles<br />
ein wenig. Was in einem Land ungeheuer<br />
wichtig erscheint, wird im anderen fern<br />
und unbedeutend.<br />
In der Sammlung Essl in Klosterneuburg<br />
bei Wien werden nun neben bereits<br />
bekannten Arbeiten auch fünf neue Bilder<br />
von Ihnen zu sehen sein. Hat sich die<br />
räumliche Veränderung in Ihrer Arbeit<br />
niedergeschlagen?<br />
Meine Arbeit hängt immer stark davon<br />
ab, was um mich herum passiert.<br />
Ich male auf Grundlage von eigenen<br />
Fotografien. Das heißt, dass alle Bilder<br />
aus Situationen stammen, die ich selbst<br />
erlebt habe. Dadurch hat der Ort, an<br />
dem eine Arbeit beginnt, selbstverständlich<br />
großen Einfluss. Es braucht allerdings<br />
immer etwas Zeit, bis ich wirklich<br />
anfange, mit dem Material einer Stadt<br />
zu arbeiten. Gerade am Anfang habe ich<br />
noch eine touristische Perspektive. Das<br />
Besondere verstellt mir den Blick. Mich<br />
interessieren in meiner Malerei aber viel<br />
mehr die darunter liegenden Schichten,<br />
Dinge, die dann wieder viel universeller<br />
sind.<br />
Das Besondere einer Stadt scheint auf<br />
Ihren Bildern gar nicht aufzutauchen. Es<br />
gibt keine Exotik und keine fest verortbaren<br />
Architekturen.<br />
Ich vermeide das Exotische. Exotik ist etwas<br />
für Postkarten. Ich denke, man sollte<br />
in der Kunst die Dinge verhandeln, die<br />
man kennt, Dinge, über die man auch etwas<br />
zu sagen hat.<br />
Bei vielen Ihrer jüngeren Arbeiten erscheinen<br />
soziale Texturen – Motive, die auf<br />
Obdachlosigkeit verweisen oder Armut.<br />
Solche Wirklichkeiten haben nicht unmittelbar<br />
etwas mit der Lebenssituation eines<br />
Künstlers zu tun, dessen Werke Preise im<br />
sechsstelligen Bereich erzielen.<br />
Als ich erstmals nach Berlin kam, hatte<br />
ich ein Atelier im Künstlerhaus Bethanien.<br />
Morgens, auf dem Weg zur Dusche,<br />
kam ich immer an einer Glastür<br />
vorbei. Auf der einen Seite der Tür waren<br />
die Künstlerateliers, auf der anderen<br />
Seite befand sich das Sozialamt. Doch<br />
die Tür war nur in einer Richtung hin offen:<br />
von hier nach da. <strong>Die</strong>ses Bild ist mir<br />
immer im Kopf geblieben. In meiner Arbeit<br />
steckt allerdings kein direktes politisches<br />
Statement oder gar eine Anklage.<br />
Ich transponiere das Vorgefundene in<br />
eine andere Realität. Das ist vielleicht<br />
ein bisschen wie im Theater: Personen<br />
oder Dinge, die aus der Realität gegriffen<br />
sind, werden auf meinen Bildern zu<br />
Symbolen. Es ist ja Malerei und keine<br />
Dokumentation.<br />
Sie haben sich in <strong>neuen</strong> Bildern mit der Lebensweise<br />
der Roma auseinandergesetzt.<br />
Das Prekariat ist eben eine Realität. Eine<br />
Realität, die heute allgegenwärtig ist. In<br />
diesen Situationen findet eine starke<br />
Konzentration auf das wirklich Wesentliche<br />
statt. Das Wesentlichste der Existenz<br />
ist es doch vermutlich, am Leben zu bleiben.<br />
<strong>Die</strong>se Konzentration würde ich auf<br />
meinen Bildern gerne in eine Analogie<br />
überführen. Und was die Roma angeht:<br />
In Frankreich ist das ein viel diskutiertes<br />
Thema. Regelmäßig werden hier Lager<br />
platt gewalzt. Gegenüber von meinem<br />
Atelier in Saint-Denis ist im vergangenen<br />
Jahr ein Camp entstanden. Das war gebaut<br />
aus Materialien, die die Bewohner<br />
ausschließlich auf der Straße gefunden<br />
haben. <strong>Die</strong> Improvisation hatte einen eigenen<br />
Stilwillen und eine eigene Ästhetik<br />
– fast schon wie bei einer abstrakten<br />
Skulptur.<br />
Auf Ihren Gemälden hat man oft den<br />
Eindruck, dass Mitgefühl nicht gewollt ist.<br />
Viele Figuren drehen dem Betrachter den<br />
Rücken zu. Kann da Empathie entstehen?<br />
Ich glaube, dass der Akt der Identifikation<br />
über eine Rückenfigur viel leichter<br />
geschehen kann als über ein Gesicht.<br />
Man kann gemeinsam mit der Figur ins<br />
Bild schauen. Auch wenn dieser Bildraum<br />
bei mir meistens sehr wenig Tiefe<br />
besitzt und ein bisschen wie ein Kasten<br />
funktioniert. Schaut man indes direkt<br />
auf ein Gesicht, dann hat man ein<br />
Foto: Uwe Walter, Berlin; Tim Eitel, selbstporträt, 2005. courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin und The Pace Gallery, © VG Bild-kunst, Bonn 2013<br />
118 <strong>Cicero</strong> 7.2013
„Eigentlich finde ich<br />
meine Bilder eher<br />
lebensbejahend. Sie<br />
sind viel positiver, als<br />
ich selbst es bin“<br />
Tim Eitel, hier auf einem Selbstporträt von 2005<br />
Gegenüber. Je nachdem, wie nah dieses<br />
an einem dran ist, kann man sich<br />
mit dem identifizieren – oder eben auch<br />
nicht.<br />
Einige Denker attestieren unserer Gesellschaft<br />
einen Mangel an Kontakt mit dem<br />
„anderen“. <strong>Die</strong>ses Defizit führe, so etwa<br />
Byung-Chul Han, zu Müdigkeit. Melancholie<br />
und Ermattung sind auch jene Begriffe,<br />
die viele Beobachter mit Ihren Bildern in<br />
Verbindung bringen.<br />
Ich frage mich oft, ob diese Melancholie<br />
und auch das Romantische, das manche<br />
sehen, in meinen Bildern wirklich drin<br />
ist. Das liegt vielleicht an der Dunkelheit.<br />
Eigentlich finde ich meine Bilder aber<br />
eher lebensbejahend. Sie sind für mich<br />
viel positiver, als ich es selbst bin.<br />
Ihre Bildräume wirken wie leer geräumte<br />
Plateaus, die auf ein Ereignis warten, das<br />
dann nicht eintrifft. Warum sind Ihre<br />
Bilder immer so handlungsarm?<br />
Ich will die ganze Konzentration auf die<br />
Figuren selbst legen. Es soll da kein Vorher<br />
und kein Nachher geben. Bei Figurationen<br />
fangen die Betrachter meistens<br />
automatisch an, narrativ zu denken. Sie<br />
sehen eine Figur und fragen sich, wo die<br />
herkommt und wo die hingeht. Mir geht<br />
es nur um die reine Präsenz einer Figur –<br />
und somit natürlich auch um die Präsenz<br />
des Bildes selbst.<br />
<strong>Die</strong> Romantik hat die Figur des freien<br />
Künstlers etabliert. Was als Gegenentwurf<br />
zur bürgerlichen Gesellschaft verstanden<br />
wurde, scheint heute fast ein Prototyp des<br />
urbanen Menschen zu sein. Fühlen Sie als<br />
Künstler noch eine Form von Exklusivität?<br />
Das ist schwer zu sagen. Wir sind heute<br />
ja tatsächlich in einer merkwürdigen Situation.<br />
Jeder ist irgendwie kreativ, und<br />
es gibt keine Subkultur mehr. Alles ist assimiliert.<br />
Nicht zuletzt durch das Internet<br />
ist heutzutage jeder Gegenentwurf<br />
binnen kürzester Zeit Mainstream. Da<br />
ist es schon schwer, sich als Künstler eine<br />
Form von Eigenständigkeit zu bewahren.<br />
Hinzu kommt noch diese immens<br />
gestiegene Akzeptanz für die Kunst. Das<br />
ist einerseits natürlich schön; andererseits<br />
verliert das Ganze dadurch ein Stück<br />
Ernsthaftigkeit.<br />
Das Gespräch führte Ralf Hanselle<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 119
| S a l o n | M a n s i e h t n u r , w a s m a n s u c h t<br />
Bunte Fluchten<br />
Pop-Art vor der Pop-Art: Eine patriotische<br />
Bäuerin lieferte den USA das Pflaster<br />
für die Wunden des Kalten Krieges.<br />
Wie Grandma Moses die Idylle wieder<br />
salonfähig machte<br />
Von Beat Wyss<br />
M<br />
enschen strömen aus dem<br />
Bürgerhaus eines Dorfes, beflaggt<br />
mit den Fahnen der Vereinigten<br />
Staaten. Es ist Nationalfeiertag.<br />
Der Zug bewegt sich entlang des Fuhrwegs<br />
zum Garten eines Bauernhauses, wo<br />
einige Frauen, umschwärmt von Kindern,<br />
Tische für das Festmahl gedeckt haben.<br />
Auf der Wiese spielen Burschen Baseball.<br />
Der Himmel ist bedeckt, vielleicht entlädt<br />
sich da noch ein Sommergewitter.<br />
Am Rand dieser ländlichen Idylle stehen<br />
zwei Soldaten, einer mit Gewehr, der<br />
andere lädt die Kanone, beide bereit für<br />
die obligaten 13 Salutschüsse zum Fest.<br />
Sie erinnern daran, dass die Unabhängigkeitserklärung<br />
der 13 britischen Kolonien<br />
an der Ostküste Nordamerikas am 4. Juli<br />
1776 von einem achtjährigen Krieg begleitet<br />
war.<br />
<strong>Die</strong> Malerin der Szene, Anna Mary<br />
Robertson, weltberühmt geworden als<br />
Grandma Moses, war eine große Patriotin.<br />
Schon längst Witwe und Mitte siebzig,<br />
entdeckte die zehnfache Mutter das<br />
Malen als Hobby neben ihrer vielfältigen<br />
Tätigkeit als Hausfrau, Bäuerin und<br />
Großmutter. Das Heimatmuseum von<br />
Bennington in Vermont, etwa 25 Kilometer<br />
entfernt <strong>vom</strong> Gehöft der Künstlerin<br />
in Eagle Bridge, New York, besitzt<br />
die größte öffentliche Grandma-Moses-<br />
Sammlung samt Memorabilien, darunter<br />
den reich bemalten Küchentisch, an dem<br />
die Greisin zu malen pflegte.<br />
<strong>Die</strong> naiven Bilder aus dem Landleben<br />
passen gut in ein Museum, das zugleich<br />
lokale Gedenkstätte des amerikanischen<br />
Revolutionskriegs ist. In der Schlacht von<br />
Bennington am 16. August 1777 erlitten<br />
die britischen Truppen, darunter auch<br />
verbündete Indianer und 200 Braunschweiger<br />
Dragoner, eine erste empfindliche<br />
Niederlage gegen die rebellierenden<br />
Amerikaner. Grandma Moses war stolz<br />
auf ihren Ururgroßvater Archibald Alexander,<br />
der damals in einem Kampfverband<br />
aus Albany mitmarschiert war. Sie<br />
widmete ihr Gemälde „July Fourth“ dem<br />
amerikanischen Präsidenten Harry Truman.<br />
Das Werk gelangte 1952 <strong>vom</strong> Bauernhof<br />
direkt ins Weiße Haus in Washington.<br />
Der Kalte Krieg nach außen<br />
fördert die Idylle im Innern.<br />
Der kometenhafte Aufstieg von<br />
Grandma Moses begleitete das amerikanische<br />
Selbstbewusstsein nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg, als die Armeen der<br />
USA das seit Jahrhunderten verzankte<br />
und in Totalitarismen zerfallene Europa<br />
unter der Pax Americana zivilisiert haben.<br />
Und Westeuropa schloss sich willig<br />
dem Grandma-Moses-Triumph an: Bereits<br />
im Sommer 1950 zog eine Wanderausstellung<br />
von Wien über München,<br />
Salzburg, Bern, Den Haag nach<br />
Paris. Ich erinnere mich, als Kind von<br />
Grandma Moses gehört zu haben. Von<br />
den großen Namen des abstrakten Expressionismus,<br />
Jackson Pollock oder<br />
Mark Rothko, erfuhr ich erst als Student.<br />
Grandma Moses war die Schwalbe,<br />
die den Frühling amerikanischer Vorherrschaft<br />
im Kunstsystem der Nachkriegszeit<br />
„July Fourth“<br />
widmete<br />
Grandma<br />
Moses 1952<br />
US-Präsident<br />
Harry Truman<br />
eröffnete. Es wäre zu kurz gegriffen, sie<br />
als naive Bauernmalerin abzutun. Zehn<br />
Jahre vor Andy Warhol hat die Bäuerin<br />
aus Eagle Bridge gegenständliche<br />
Kunst, damals verpönt in intellektuellen<br />
Kreisen, wieder salonfähig gemacht.<br />
Ihr Werk ist Pop-Art avant la lettre.<br />
Seit den frühen fünfziger Jahren überschwemmten<br />
Grandma-Moses-Motive<br />
Tapeten, Sofakissen, Gardinenstoffe<br />
und Zuckerdosen, ganz zu schweigen<br />
von den Postkarten mit Bauernszenen<br />
Fotos: Grandma Moses: July Fourth. Copyright © 1951<br />
(renewed 1979), Grandma Moses Properties Co., New<br />
York/Courtesy of The White House Art Collection<br />
120 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Foto: artiamo (<strong>Auto</strong>r)<br />
und Winterlandschaften: Bei ihrem Tod<br />
1961, so wurde geschätzt, waren deren<br />
100 Millionen in Umlauf gesetzt.<br />
Eine 6-Cent-Briefmarke nach dem Gemälde<br />
„July Fourth“ wurde im Mai 1969<br />
ausgegeben.<br />
Anekdoten säumen ihren späteren<br />
Weg zur Malerei: Gestickt und gehäkelt<br />
hatte sie ja seit ihrer Zeit als Hausmädchen,<br />
doch zu malen habe sie begonnen,<br />
als Arthritis in den Fingern es ihr zunehmend<br />
schwerer machte, die dünne Nadel<br />
zu halten als den Pinsel. Zudem war Malerei<br />
haltbarer als ihre von Familie und<br />
Freundeskreis so geschätzten Stickereien,<br />
von denen einige durch Mottenfraß beschädigt<br />
wurden. Solch hausfrauliche Sinnesart<br />
machte es dem Feminismus der<br />
ersten Stunde nicht leicht, die spät berufene<br />
Malerin als Kampfgenossin anzuerkennen;<br />
die emanzipierte Frau sah im<br />
malenden Mütterchen mit der gestärkten<br />
Küchenschürze ein Opfer weiblichen<br />
Rollenzwangs.<br />
Der Laufbahn in den Olymp schadete<br />
das kaum. Im Alter von 92 Jahren wurde<br />
Grandma Moses für ihre Verdienste um<br />
ihr Vaterland in die Frauenvereinigung<br />
„Töchter der Amerikanischen Revolution“<br />
aufgenommen.<br />
B e at W y s s<br />
ist einer der bekanntesten<br />
Kunsthistoriker des Landes.<br />
Er lehrt in Karlsruhe<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 121
| S a l o n | 1 9 3 3 – u n t e r w e g s i n d i e D i k t a t u r<br />
Fromme Illusionen<br />
Das Konkordat mit dem Heiligen Stuhl war Hitlers erster völkerrechtlicher Vertrag und<br />
sorgte für einen Ansehensgewinn. Er brach ihn dennoch. Sechste Folge einer Serie<br />
von Philipp Blom<br />
E<br />
in halbes Jahr, nachdem er<br />
Reichskanzler geworden war,<br />
sah sich Hitler mit der Tatsache<br />
konfrontiert, dass das Ausland<br />
das neue deutsche Regime noch<br />
immer mit Skepsis beobachtete. Natürlich:<br />
Deutschland war nicht die einzige europäische<br />
Diktatur, aber als großer Verlierer<br />
des Ersten Weltkriegs und als strategisch<br />
unumgänglicher Partner für jede Neuordnung<br />
Europas wurde es besonders intensiv<br />
beobachtet. Der Führer brauchte einen außenpolitischen<br />
Erfolg, der die Kritiker beruhigen<br />
konnte.<br />
Nichts war dafür besser geeignet als ein<br />
Konkordat mit dem Heiligen Stuhl, der<br />
seine eigenen Gründe hatte, außenpolitische<br />
Erfolge zu suchen. Als Staat von Mussolinis<br />
Gnaden musste er seine völkerrechtliche<br />
Stellung absichern und gleichzeitig<br />
die Interessen der Kirche fördern. Ein Konkordat<br />
mit dem Deutschen Reich würde<br />
ihn stärken. Eine Garantie der Nichteinmischung<br />
der jungen Diktatur in kirchliche<br />
Belange konnte darüber hinaus sicherstellen,<br />
dass die Kirche auch weiterhin Konfessionsschulen,<br />
Priesterseminare und karitative<br />
Einrichtungen führen und so ihre<br />
Stellung im Land behaupten konnte.<br />
Hitler hatte zudem ein innenpolitisches<br />
Interesse. <strong>Die</strong> katholisch dominierte Zentrumspartei,<br />
geleitet von Prälat Ludwig<br />
Kaas und anderen einflussreichen Priestern,<br />
war ihm ein ständiges Hindernis im<br />
Parlament. Immerhin waren ein Drittel<br />
der Deutschen Katholiken. Wenn die Regierung<br />
im Gegenzug für ihre Neutralität<br />
in kirchlichen Belangen eine Garantie bekam,<br />
dass sich kirchliche Amtsträger nicht<br />
mehr politisch engagieren würden, wäre<br />
das Zentrum praktisch ausgeschaltet.<br />
<strong>Die</strong> Verhandlungen über ein Konkordat<br />
fanden in Rom statt. Auf kirchlicher<br />
Seite verhandelte Kardinalstaatssekretär<br />
Eugenio Pacelli, der spätere<br />
Papst Pius XII. Noch wenige Monate<br />
zuvor hatten die deutschen<br />
Bischöfe gemeinsam die Position<br />
vertreten, man könne<br />
nicht gleichzeitig Katholik<br />
und Nazi sein. Jetzt aber,<br />
als der Staat immer stärker<br />
schien, änderte sich ihre Meinung.<br />
Schon im März ließen<br />
sie verlauten, sie vertrauten Hitler:<br />
„Ohne die in unseren früheren Maßnahmen<br />
liegende Verurteilung bestimmter<br />
religiös-sittlicher Irrtümer aufzugeben,<br />
glaubt daher der Episkopat das Vertrauen<br />
hegen zu können, dass die vorbezeichneten<br />
allgemeinen Verbote und Warnungen<br />
nicht mehr als notwendig betrachtet werden<br />
brauchen.“<br />
Lange haben Historiker angenommen,<br />
Kardinal Pacelli habe von Rom aus im<br />
Hintergrund die Strippen gezogen und<br />
die deutsche katholische Kirche verraten,<br />
aber tatsächlich war er irritiert über die<br />
nationale Linie der meisten deutschen Bischöfe.<br />
Der katholische Journalist Walter<br />
Dirks erinnerte sich: „Als diese bösen Nazis<br />
mit einem Mal legal, wie es schien, an<br />
die Macht gekommen waren, entdeckte<br />
man plötzlich eine Menge von Übereinstimmungen,<br />
ein hierarchisches Denken<br />
von oben nach unten, den Antibolschewismus,<br />
den Antiliberalismus, der ja bei<br />
1933<br />
Anno<br />
Als Deutschland die<br />
Demokratie verlor<br />
den konservativen Katholiken immer eine<br />
große Rolle gespielt hat.“<br />
Das „nationale Erwachen“ Deutschlands<br />
begrüßten die Bischöfe und stellten<br />
fest: „Ein abwartendes Beiseitestehen<br />
oder gar eine Feindseligkeit der Kirche<br />
dem Staat gegenüber müsste Kirche<br />
und Staat verhängnisvoll<br />
treffen.“ Nicht alle Kirchenfürsten<br />
waren aber glücklich<br />
über diesen <strong>neuen</strong>, anschmiegsamen<br />
Kurs der<br />
Kirche. Der Kölner Kardinal<br />
Joseph Schulte meinte, mit „einer<br />
Diktatur kann man kein Konkordat<br />
schließen“, auch Kardinal von<br />
Galen in Münster war kritisch, aber ihre<br />
Stimmen wurden <strong>vom</strong> Chor der national<br />
eingestellten Kollegen übertönt.<br />
Pacelli, der lange als päpstlicher Nuntius<br />
in Berlin gewesen war, stellte die Staatsräson<br />
des Vatikans über die Botschaft der<br />
Kirche. Als Papst Pius XI. ihn am 1. April<br />
1933 angesichts des Judenboykotts beauftragte,<br />
über Maßnahmen der Kirche nachzudenken,<br />
notierte er, „es könnten Tage<br />
kommen, in denen man sagen können<br />
muss, dass in dieser Sache etwas gemacht<br />
worden ist“. Er tat aber nichts.<br />
Im April war das „Gesetz zur Wiederherstellung<br />
des Berufsbeamtentums“ verabschiedet<br />
worden, das es der Berliner Regierung<br />
erlaubte, jüdische und politisch<br />
missliebige Beamte loszuwerden. Pacelli<br />
wies seinen Nuntius an, der Vatikan könne<br />
sich nicht in die inneren Angelegenheiten<br />
eines anderen Staates einmischen. Stellungnahmen<br />
zur „Judenfrage“ seien allein<br />
Sache der deutschen Bischöfe. Seine<br />
122 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Am 20. Juli 1933 wurde in Rom das Reichskonkordat zwischen dem Deutschen Reich und dem Heiligen Stuhl unterzeichnet.<br />
Vizekanzler Franz von Papen und der päpstliche Nuntius in Berlin, Eugenio Pacelli, später Pius XII., führten die Griffel<br />
Fotos: BPK Images, Peter Rigaud (<strong>Auto</strong>r); Grafik: <strong>Cicero</strong><br />
eigene Haltung in diesen Fragen, nachdem<br />
er 1939 selbst zum Papst gewählt wurde, ist<br />
bis heute umstritten.<br />
Das Reichskonkordat wurde am<br />
20. Juli 1933 in Rom feierlich unterzeichnet.<br />
<strong>Die</strong> Glocken des Petersdoms läuteten.<br />
Beide Seiten waren hochzufrieden und sahen<br />
sich als Gewinner der Verhandlungen.<br />
Besonders Hitler kostete seinen Triumph<br />
voll aus. Seine Regierung hatte ihren ersten<br />
völkerrechtlichen Vertrag abgeschlossen<br />
und konnte sich mit dem moralischen Status<br />
der Kirche schmücken, die ihm den gewünschten<br />
politischen Sieg beschert hatte.<br />
Gleichzeitig hatte sich die Zentrumspartei<br />
bereits während der Verhandlungen aufgelöst.<br />
Jede politische Einmischung vonseiten<br />
der deutschen Katholiken war jetzt effektiv<br />
unmöglich geworden. Hitler zählte<br />
darauf, dass sie sich „von jetzt an rückhaltlos<br />
in den <strong>Die</strong>nst des nationalsozialistischen<br />
Staates stellen werden“.<br />
<strong>Die</strong> katholische Hierarchie bestärkte<br />
ihn darin. Der Münchner Kardinal Michael<br />
von Faulhaber schrieb dem Führer:<br />
„Was die alten Parlamente und Parteien<br />
in 60 Jahren nicht fertigbrachten, hat Ihr<br />
staatsmännischer Weitblick in sechs Monaten<br />
weltgeschichtlich verwirklicht.“<br />
Selbstverständlich hielten sich die Nationalsozialisten<br />
nicht an ihren Teil des<br />
faulen Handels. <strong>Die</strong> Kirche wurde zusehends<br />
gleichgeschaltet. Aller kirchlicher<br />
Widerstand und alle Hilfe für Verfolgte<br />
waren zur lebensgefährlichen Sache einiger<br />
mutiger Priester und Ordensleute geworden,<br />
etwa des Berliner Dompropsts<br />
Bernhard Lichtenberg. 1942 rang sich Pius<br />
dazu durch, in der Weihnachtsansprache<br />
das Schicksal von „Hunderttausenden, die,<br />
persönlich schuldlos, bisweilen nur um ihrer<br />
Volkszugehörigkeit oder Abstammung<br />
willen dem Tode geweiht (…) sind,“ zu bedauern.<br />
Weiter ging er nicht.<br />
Konkordate, die der Heilige Stuhl mit<br />
faschistischen Diktatoren abschloss, sind<br />
bis heute gültig. Das gilt für Mussolinis<br />
Konkordat von 1929 ebenso wie für die<br />
1933 ratifizierten Konkordate mit dem<br />
Dollfuß-Regime in Österreich und mit<br />
Hitler-Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht<br />
hat diese Regelung 1957<br />
bestätigt.<br />
Wir werden den Weg in die Diktatur von<br />
1933 weiterhin nachzeichnen. In der nächsten<br />
Ausgabe wenden wir uns der Einführung<br />
des Volksempfängers zu.<br />
Philipp Blom ist Historiker<br />
und <strong>Auto</strong>r. Seine Bücher „Der<br />
taumelnde Kontinent“ und<br />
„Böse Philosophen“ wurden<br />
mehrfach ausgezeichnet<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 123
Jetzt im Handel! Oder für 3,70 € zzgl. Versandkosten bequem per Telefon<br />
unter 040/5555 78 00 bzw. online unter neon.de/heft bestellen.
B e n o t e t | S a l o n |<br />
illustration: anja stiehler/jutta fricke illustrators<br />
Musik macht den<br />
Unterschied<br />
Weil Phantasie ein bedrohter Rohstoff ist, darf<br />
an der Kunsterziehung nicht gespart werden<br />
Von Daniel Hope<br />
N<br />
e ulich sprach ich bei dem Branchenforum Classical<br />
Next. Über 800 internationale Fachbesucher waren nach<br />
Wien gekommen, Konzerthausmanager, Musiker, Künstleragenten,<br />
Vertreter von Labels und Vertrieben sowie Journalisten<br />
aus 40 Ländern. Zufällig fiel dieses Datum exakt auf den 100. Jahrestag<br />
der skandalösen Pariser Première von Igor Strawinskis „Le<br />
Sacre du Printemps“. Es gibt nicht viele Werke, die in den vergangenen<br />
100 Jahren einen solchen Aufruhr ausgelöst haben.<br />
<strong>Die</strong> Musikwelt hat sich seitdem radikal verändert. Wenn wir<br />
den Kassandrarufen glauben würden, wären wir klassischen Musiker<br />
schon am Ende. Schreckensbilder tauchen auf von Künstlern,<br />
die wie Mozart von Gläubigern verfolgt werden oder wie<br />
Schubert den Winter in ungeheizten Dachkammern verbringen<br />
und mit klammen Fingern ihr verstimmtes Fortepiano bedienen.<br />
Und was ist aus den Sponsoren-Millionen geworden, mit denen<br />
„Lehman Brothers“ und die anderen Pleite-Banken Musik und<br />
Theater unterstützen wollten? Darf man noch hoffen, dass die<br />
Schecks ausgehändigt werden? Wird es auch überhaupt Leute geben,<br />
die das Geld für eine Konzertkarte, eine CD, zumindest einen<br />
Download erübrigen?<br />
Wer Musik liebt oder wer sie nur verkauft, beschäftigt sich mit<br />
solchen Fragen nicht erst seit der Finanzkrise. <strong>Die</strong> Musik hatte immer<br />
schon heilende Kräfte, und sei es nur, dass sie die Nerven beruhigt<br />
– so wie anno 1873, als Johann Strauss gleich nach dem großen<br />
Börsenkrach in Wien in seiner „Fledermaus“ schrieb: „Glücklich<br />
ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.“<br />
Man sollte aber nicht vergessen, dass Krisen den Anstoß zu<br />
<strong>neuen</strong> Überlegungen geben, dass sie, wie es Max Frisch formuliert<br />
hat, in einen „produktiven Zustand“ übergehen können, sofern<br />
man ihnen „den Beigeschmack der Katastrophe nimmt“. Das<br />
Problem ist nur: Vor allem die jungen Menschen haben immer<br />
seltener Gelegenheit, klassische Musik zu entdecken. Der Ursachenkatalog<br />
wurde oft genug aufgezählt: Hausmusik ist zur Ausnahme<br />
geworden, der Musikunterricht in den Schulen unzureichend;<br />
klassische, angeblich antiquierte Konzerte schrecken ab;<br />
die Oper ist häufig elitär; die Eintrittspreise sind gesalzen, manche<br />
Zeitungskritiken abgehoben; gewisse Radioprogramme verbreiten<br />
nur belangloses Gedudel.<br />
Es gibt aber keine Krise der klassischen Musik. Sie ist vital wie eh<br />
und je. <strong>Die</strong> Krise liegt in der Geringschätzung, die der Musik entgegengebracht<br />
wird. Was kann man dagegen tun? In Deutschland<br />
gibt es Künstler und Institutionen, die unermüdlich kämpfen, um<br />
die Musik an die Jugend zu bringen: Von Lars Vogts „Rhapsody in<br />
School“ bis zum „Netzwerk Junge Ohren“, von „Live Music Now“<br />
bis zu „Jedem Kind ein Instrument“. <strong>Die</strong>se großartigen Organisationen<br />
machen Deutschland zum Vorreiter. Aber sie brauchen unsere<br />
Unterstützung, von Künstlerseite wie auch von der Musikbranche.<br />
Ich bin ein großer Befürworter der musischen Erziehung. Der<br />
Zweck der Kunsterziehung ist es aber nicht, Künstler zu produzieren.<br />
Ihr Zweck ist es, unserer Jugend eine humanistische Ausbildung zu<br />
ermöglichen, damit sie ein erfülltes und produktives Leben in einer<br />
freien Gesellschaft verwirklichen kann.<br />
Wenn wir uns in einem globalen Markt wirtschaftlich behaupten<br />
wollen, brauchen wir Kreativität, Einfallsreichtum und Innovation.<br />
Aber echte Innovation kommt nicht nur durch Technologie,<br />
sie kommt durch Kunst. Kunst ist ein unverzichtbares Hilfsmittel,<br />
die Welt zu verstehen und zu definieren. Das Erwachsenwerden<br />
beginnt in der Phantasie eines Kindes. Aber in den vergangenen<br />
20 Jahren blieb die Phantasie zugunsten des Marktes auf der<br />
Strecke. Und ein Markt macht nur eins – er legt Preise fest. <strong>Die</strong><br />
Rolle von Kultur muss jedoch über das Wirtschaftliche hinausgehen.<br />
Ihr Fokus sollte der Wert sein und nicht der Preis.<br />
Es gibt nur eine einzige soziale Kraft, die stark genug ist, um<br />
der Vermarktung von kulturellen Werten gegenzusteuern: unser<br />
Bildungssystem. Doch im Jahr 2013 werden die Kinder in unseren<br />
Schulen meistens ausgebildet ohne Musik, ohne bildende<br />
Kunst, Tanz oder literarische Künste. <strong>Die</strong> Ausbildung fördert in<br />
erster Linie die analytische Seite des Gehirns, während die andere<br />
Hälfte, die ganzheitliche, intuitive und ästhetische, unterentwickelt<br />
bleibt.<br />
Musik lohnt sich – und das meine ich nicht materiell, auch<br />
wenn ich von der Musik lebe. Musik lohnt sich, weil sie jeden, der<br />
sie mit wachen Sinnen in sich aufnimmt, bereichert und mit Sphären<br />
vertraut macht, die ohne Musik verschlossen blieben. Lasst uns<br />
gemeinsam kämpfen, die Musik zu stärken, damit ihre Strahlkraft<br />
noch mehr Menschen erreicht und bereichert.<br />
Daniel Hope ist Violinist von Weltrang. Sein Memoirenband<br />
„Familien stücke“ war ein Bestseller. Zuletzt erschienen sein Buch<br />
„Toi, toi, toi! – Pannen und Katastrophen in der Musik“ (Rowohlt)<br />
und die CD „Spheres“ (Deutsche Grammophon). Er lebt in Wien<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 125
| S a l o n | G e i s e l d r a m a v o n g l a d b e c k<br />
xxxx<br />
126 <strong>Cicero</strong> 7.2013
xxxx<br />
Der tod trug<br />
viele masken<br />
Vor 25 Jahren wurden Journalisten zu Handlangern<br />
des Verbrechens. Das Geiseldrama von Gladbeck<br />
markiert einen Tabubruch. Offene Fragen bleiben<br />
von Peter Henning<br />
Sie starb im Kugelhagel<br />
auf der A 3:<br />
Silke Bischoff war eines<br />
der drei Todesopfer.<br />
Entführer Degowski<br />
saß mit im Wagen<br />
M<br />
eine schreckliche faszination<br />
begann vor 25 Jahren,<br />
am 16. August 1988. Ich<br />
war damals 29 Jahre alt und<br />
davon überzeugt, dass Bilder<br />
nicht lügen. Eine Hitzewelle hielt das<br />
Land seit Wochen im Griff, als sich in der<br />
nordrhein-westfälischen Stadt Gladbeck<br />
in den frühen Morgenstunden zwei Männer<br />
anschickten, jenes Verbrechen zu begehen,<br />
das zum öffentlichsten der deutschen<br />
Nachkriegsgeschichte werden sollte.<br />
Bis zu jenem unheilvollen 16. August<br />
war der Name Gladbeck den meisten Westdeutschen<br />
eher unbekannt. Wie die Wasser<br />
der bei Holzwickede entspringenden Emscher,<br />
die auf ihrem Weg zur Mündung in<br />
den Rhein bei Dinslaken-Eppinghoven einen<br />
Bogen um Gladbeck macht, war auch<br />
sonst alles Dramatische bis dahin an dem<br />
67 000 Einwohner zählenden Ort vorbeigezogen.<br />
Doch dann, gegen 7.45 Uhr jenes<br />
abermals hochsommerliche Temperaturen<br />
versprechenden Tages, fiel das Dramatische<br />
mit lautloser Wucht in Gladbeck ein. Was<br />
sich von dort ausgehend in den folgenden<br />
54 Stunden ereignen sollte, sollten nicht<br />
nur jene, die direkt oder indirekt an den<br />
Geschehnissen beteiligt waren, anschließend<br />
für immer mit dem Namen Gladbeck<br />
verbinden.<br />
<strong>Die</strong> beiden 31 und 32 Jahre alten, in<br />
Gladbeck aufgewachsenen Männer Hans-<br />
Jürgen Rösner und <strong>Die</strong>ter Degowski setzten<br />
sich am Morgen des 16. August auf<br />
ein gestohlenes Motorrad und fuhren von<br />
der City aus schwer bewaffnet in Richtung<br />
Nordwesten, nach Rentford-Nord,<br />
um eine Filiale der Deutschen Bank zu<br />
überfallen.<br />
Was folgte, ging als „Geiseldrama von<br />
Gladbeck“ sowohl in die europäische Kriminal-<br />
als auch in die bundesdeutsche<br />
Fernsehgeschichte ein: Zwei Berufskriminelle<br />
hielten das Land zweieinhalb Tage<br />
lang in Atem, nahmen Geiseln und kaperten<br />
einen Bus, töteten einen 15-jährigen<br />
Jungen, gaben ungezählte Radio- und<br />
TV-Interviews – und ein Millionenpublikum<br />
sah ihnen vor dem heimischen Fernseher<br />
live zu: staunend und irritiert, erregt<br />
und ungläubig, abgestoßen und fasziniert.<br />
Zwei ehemalige Sonderschüler mutierten<br />
zu Feldherren im Bilderkrieg, Reporter<br />
wurden zu Handlangern. Auch ich saß gebannt<br />
vor dem Fernseher, bis zum blutigen<br />
Showdown auf der <strong>Auto</strong>bahn A 3.<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 127
| S a l o n | G e i s e l d r a m a v o n G l a d b e c k<br />
Das Geiseldrama hatte innerhalb von<br />
54 Stunden ein ganzes Land verändert,<br />
hatte die Fratze des Journalismus und der<br />
Medien ans Licht gezerrt, hatte auch meine<br />
Art zu sehen und zu fühlen erschüttert.<br />
Journalisten machten sich mit Verbrechern<br />
auf irritierende Art und Weise gemein, holten<br />
ihnen Kaffee, Eis und Zigaretten. <strong>Die</strong><br />
Polizei schaute tatenlos zu.<br />
Ich wollte verstehen, was damals in<br />
Gladbeck und mit mir geschah. Aber erst<br />
2009 konnte ich beginnen, im Internet zu<br />
recherchieren; auch trieb ich mich stundenlang<br />
in den Zeitungsarchiven des Hessischen<br />
Rundfunks und des WDR herum,<br />
kopierte Hunderte von Artikeln und lud<br />
immer neue Videos hoch. Einen Plan aber,<br />
wie ein Gladbeck-Roman aussehen könnte,<br />
hatte ich nicht. Bis ich im Netz auf das<br />
knapp fünf Minuten lange Video des Kölner<br />
Filmemachers Florian Jung stieß, in<br />
welchem ich den ehemaligen Dortmunder<br />
SEK-Beamten Rainer Kesting unter Tränen<br />
den Satz sagen hörte: „Ich bin schuld, dass<br />
Silke Bischoff tot ist!“<br />
Ich blickte in das Gesicht eines Mannes,<br />
der nicht fertig wurde mit seiner Schuld.<br />
Er, der am 18. August, gegen Mittag, in<br />
der Kölner Breiten Straße am Geiselwagen<br />
zwischen den Journalisten, die den Gangstern<br />
ihre Mikrofone hinstreckten, gestanden<br />
und seinen Arm um Rösners Schulter<br />
gelegt hatte. „Ich hätte bloß nicken müssen“,<br />
erzählte Kesting mir später, „und<br />
der auf dem Kofferraum sitzende Kollege<br />
hätte Degowski auf mein Zeichen hin per<br />
Kopfschuss eliminiert. Gleichzeitig hätte<br />
ich Rösner ausschalten und durchs offene<br />
Fenster aus dem Wagen ziehen können.<br />
Doch die Einsatzleitung in Recklinghausen<br />
hat es mir unter Androhung eines Disziplinarverfahrens<br />
strikt verboten. Ich habe<br />
nie verstanden, weshalb.“<br />
Gestorben ist die 18-jährige Bremer<br />
Anwaltsgehilfin Silke Bischoff auf der A 3<br />
in Fahrtrichtung Frankfurt beim Zugriff<br />
des Sondereinsatzkommandos der Kölner<br />
Polizei, das auf Höhe der Raststätte<br />
Siegburg unkontrolliert das Feuer auf das<br />
Fluchtfahrzeug eröffnete und dabei mehr<br />
als 60 Schuss auf den von Hans-Jürgen<br />
Rösner gesteuerten BMW abfeuerte.<br />
Ich nahm Kontakt auf mit dem aus dem<br />
Polizeidienst ausgeschiedenen ehemaligen<br />
SEK-Beamten. Wir trafen uns mehrfach<br />
in Köln und Dortmund. Und als ich später<br />
eine Telefonnummer in Hamburg-Harburg<br />
Hans-Jürgen Rösner lieferte den Kameras bereitwillig jene Bilder, nach denen<br />
diese gierten. <strong>Die</strong> Kumpanei der Medien mit den Entführern war ohne Beispiel.<br />
Welche Rolle aber spielte die Polizei? Könnte Silke Bischoff tatsächlich noch leben?<br />
Rösner, überlebensgroß und doch ein Krimineller, kein Archetyp<br />
Zwang und Gewalt: Degowski saß, Rösner stand. Was dachten die Entführten?<br />
Fotos: Peter Meyer (Seiten 126 bis 128), Privat (<strong>Auto</strong>r)<br />
128 <strong>Cicero</strong> 7.2013
wählte, um den Fotografen Peter Meyer um<br />
Mithilfe zu bitten, begann der geplante Roman<br />
Konturen anzunehmen. Doch Meyer,<br />
der im August 1988 für AP und den Stern fotografierte<br />
und in seiner Funktion als freiwilliger<br />
Mittler zwischen Rösner und der Polizei<br />
als Erster in den von den Gangstern gekaperten<br />
Linienbus stieg, um Bilder zu machen,<br />
lehnte meine Anfrage kategorisch ab.<br />
Mit den Worten „Lassen Sie mich mit<br />
dem Scheiß in Ruhe!“ erteilte er meiner<br />
Bitte eine schroffe Absage. Meyer war die<br />
erste, wichtigste Verbindung zwischen<br />
den damals involvierten Journalisten und<br />
den Geiselnehmern. Er hatte eine wichtige<br />
Rolle gespielt. Trotzdem trieb ich mein<br />
Vorhaben voran.<br />
Als ich mich Anfang 2013 wieder bei<br />
Meyer meldete und ihn bat, das bislang<br />
Geschriebene vorlesen zu dürfen, willigte<br />
er zu meiner großen Erleichterung ein. So<br />
erzählte ich ihm die Geschichte von Menschen,<br />
die direkt oder indirekt in die Ereignisse<br />
hineingezogen wurden – und deren<br />
Leben sich dadurch innerhalb von 54 Stunden<br />
für immer veränderten. Rainer Kesting,<br />
der im Buch Rolf Kirchner heißt, war einer<br />
von ihnen, Peter Meyer, dem ich den Namen<br />
Peter Ahrens gab, ein weiterer. Hinzu<br />
kamen eine Kölner Schriftstellerin und<br />
eine Bremer Taxifahrerin sowie der Busfahrer,<br />
der den gekaperten Linienbus von<br />
Bremen bis nach Enschede steuerte, wo es<br />
zum Schusswechsel mit der holländischen<br />
Polizei kam.<br />
<strong>Die</strong> Ereignisse ließen sich anhand der<br />
Bild-, Ton- und Printdokumente, die während<br />
der 54 Stunden entstanden waren, nahezu<br />
lückenlos rekonstruieren. Doch als<br />
ich versuchte, über das Material hinaus<br />
Kontakt zu dem zu lebenslanger Haft plus<br />
anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilten,<br />
seit Jahren in der Justizvollzugsanstalt<br />
Bochum einsitzenden Hans-Jürgen<br />
Rösner aufzunehmen, begannen die Probleme,<br />
Ungereimtheiten und Widersprüche.<br />
Mit der Formulierung „Ich kann es rein<br />
juristisch betrachtet nicht verhindern, dass<br />
Sie Rösner besuchen, doch ich werde alles<br />
tun, damit es Ihnen nicht gelingt“, schmetterte<br />
der zuständige Gefängnispsychologe,<br />
der Rösner seit seinem 17. Lebensjahr<br />
kennt, mein Ansinnen ab, den inzwischen<br />
56 Jahre alten Straftäter, der die interne<br />
Poststelle der Vollzugsanstalt leitet, zu besuchen.<br />
Auf die Frage, weshalb er den Zugang<br />
verweigere, erhielt ich zur Antwort:<br />
Das damalige<br />
Vorgehen der Polizei<br />
erweist sich als eine<br />
Serie vermeidbarer<br />
Fehler<br />
„Weil wir nicht wollen, dass der noch mehr<br />
überschnappt. Außerdem ist der Typ eiskalt.<br />
Um es Ihnen zu illustrieren: Für den<br />
ist ein Menschenleben genauso viel wert<br />
wie eine Schnake, die Sie in den Arm sticht.<br />
Da haut man drauf und schnippt sie weg.“<br />
Auch mein Versuch, über Rösners<br />
Aache ner Anwalt Rainer <strong>Die</strong>tz Kontakt zu<br />
seinem Mandanten zu bekommen, schlug<br />
fehl. Auf die Frage, welche Chance bestünde,<br />
zu Rösner vorzudringen, antwortete<br />
<strong>Die</strong>tz unmissverständlich: „Keine! <strong>Die</strong><br />
halten ihn total unter Verschluss. Außerdem<br />
gab es für Rösner in 25 Jahren nicht<br />
die geringste Hafterleichterung, nichts! <strong>Die</strong><br />
behandeln ihn, als sei er gestern eingefahren.<br />
Warum wohl?“<br />
Ja, warum wohl? Weil er es mit seiner<br />
bornierten Unnachgiebigkeit vermochte,<br />
in nur 54 Stunden ganze Zünfte – nämlich<br />
die der Polizei und jene der Journalisten<br />
– in bis heute anhaltende Krisen zu<br />
stürzen? Weil er einen ganzen Polizeiapparat<br />
an seine Grenzen führte, indem er dessen<br />
Schwachstellen aufdeckte?<br />
Tatsächlich erweist sich das damalige<br />
Vorgehen der Polizei bei genauerer Betrachtung<br />
als eine Serie vermeidbarer Fehler und<br />
Pannen, die unverändert Fragen aufwirft:<br />
Weshalb etwa gewährte die Polizei den Geiselnehmern<br />
in Gladbeck freien Abzug aus<br />
der Bank, wo doch ein ungeschriebenes Polizeigesetz<br />
lautet: Geiselgangster dürfen den<br />
Ort der Geiselnahme nicht verlassen!<br />
Weshalb war kein Krankenwagen vor<br />
Ort, als der 15-jährige Emanuele de Giorgi<br />
auf der <strong>Auto</strong>bahnraststätte Grundbergsee<br />
bei Bremen durch eine Kugel aus <strong>Die</strong>ter<br />
Degowskis Colt lebensgefährlich verletzt<br />
wurde? Wieso verweigerte die Polizei den<br />
Geiselnehmern ab Bremen jeglichen Kontakt?<br />
Weshalb griff sie nicht zu, als <strong>Die</strong>ter<br />
Degowski sich minutenlang von dem<br />
nur noch mit den beiden Geiseln besetzten<br />
Fluchtfahrzeug zum Wasserlassen entfernte,<br />
während Hans-Jürgen Rösner zeitgleich<br />
mit seiner Freundin Monika Löblich<br />
einen Einkaufsbummel durch die Stadt unternahm?<br />
Und warum stoppte das Mobile<br />
Einsatzkommando das Fluchtfahrzeug tags<br />
darauf bei Siegburg unter willentlicher Inkaufnahme<br />
der Tötung der beiden weiblichen<br />
Geiseln mit Dutzenden von scheinbar<br />
wahllos abgefeuerten Schüssen? Und<br />
zuletzt: Verschwand, wie Gerold Bischoff,<br />
der Onkel der getöteten Silke Bischoff später<br />
behauptete, das angebliche Projektil aus<br />
Rösners Waffe, mit dem sie getötet worden<br />
sein soll, tatsächlich im Zuge der Obduktion,<br />
ehe es Stunden später bis zur Unkenntlichkeit<br />
verformt wieder auftauchte?<br />
Fragen an die Kölner Pressestelle dazu<br />
wurden abgeblockt, und die beim SEK<br />
Köln vorliegenden Akten, die Antworten<br />
auf einige der hier gestellten Fragen geben<br />
könnten, sind bis auf den heutigen Tag<br />
nicht zugänglich für Zivilpersonen. <strong>Die</strong><br />
Verlagsleitung des Kölner Express, der seinerzeit<br />
das Kunststück fertigbrachte, in drei<br />
Tagen fast 40 Sonderseiten zum Thema zu<br />
produzieren, hat die entsprechenden Seiten<br />
hausintern gesperrt: Einsichtnahme nicht<br />
möglich! Warum? Allein aus Scham über<br />
die unrühmliche Rolle, die der damalige<br />
stellvertretende Chefredakteur des Blattes,<br />
Udo Röbel, spielte, indem er in der<br />
Breiten Straße zu den Geiselgangstern ins<br />
<strong>Auto</strong> stieg und sie aus der Stadt auf die A 3<br />
in Richtung Frankfurt lotste? Oder steckt<br />
mehr dahinter?<br />
Das Verbrechen forderte damals in zuvor<br />
nicht gekannter Weise die Phantasie<br />
der Berichterstatter heraus. Und ob Fernsehen,<br />
Rundfunk oder Presse: Im aufgeregten<br />
Eifer der Journalisten geriet das<br />
Verbrechen zur Tragödie, zur makabren<br />
Inszenierung, zur gefälschten Wirklichkeit.<br />
Kleinkriminelle wurden zu Archetypen<br />
stilisiert, durch Schlagzeilen verzerrt,<br />
aufgebläht ins Monströse; Wesen, die dem<br />
Wunsch der Angepassten nach Chaos, Anarchie<br />
und Zerstörung scheinbar ein Gesicht<br />
geben, tatsächlich aber nichts anderes<br />
waren als abgestumpfte Menschen hinter<br />
viel zu großen Masken.<br />
Inzwischen bin ich 54 und habe die Bilder<br />
nie vergessen. Doch meine schreckliche<br />
Faszination für sie ist verflogen.<br />
Peter Henning<br />
schrieb den Roman „Ein deutscher<br />
Sommer“ (Aufbau) über<br />
das Geiseldrama von Gladbeck<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 129
| S a l o n | e s s a y<br />
Der Freiheit falsche Freunde<br />
<strong>Die</strong> Ichlinge verdammen den Staat, weil er ihrem Egoismus eine<br />
Grenze setzt. Gegenrede zu Alexander Kissler – und ein Plädoyer<br />
Von Christoph Schwennicke<br />
A<br />
rme, geschundene Freiheit, wofür sie alles herhalten<br />
muss. Neulich, als der SPD-Chef Sigmar Gabriel<br />
Tempo 120 auf deutschen <strong>Auto</strong>bahnen forderte, da<br />
wurde sie wieder ausgiebig missbraucht, die unschuldige Freiheit.<br />
Ein Angriff auf – jawohl! – die Freiheit sei das gewesen, auf<br />
die Freiheit des <strong>Auto</strong>fahrers, die in Deutschland offenbar eine<br />
besonders hoch anzusiedelnde Freiheit ist, den einen oder anderen<br />
Verkehrstoten wert und höhere Emissionen sowieso. Zahlt<br />
ja der Raser im Namen der Freiheit, einerseits als Tankfüllung,<br />
manchmal mit dem eigenen Leben. Aber es ist schließlich sein<br />
Leben, oder?<br />
Es sei Zeit für eine „neue Philosophie und eine neue Praxis<br />
der Freiheit“, postulierte an dieser Stelle in der Juni-Ausgabe zitatenschwer<br />
und wortgewittrig der Kollege Alexander Kissler.<br />
Wie zu vermuten stand, ortete er die Angreifer auf die individuelle<br />
Freiheit dort, wo sie immer zu suchen sind: bei den notorischen<br />
Etatisten der Sozialdemokratie. Weil diese sich den etwas<br />
ungelenken Wahlkampfspruch „Das Wir entscheidet“ zulegte,<br />
ließ Kissler seine Blitze <strong>vom</strong> liberalen Himmel fahren. Der kluge<br />
Kollege stellte sich ahnungslos und behauptete, es bleibe im<br />
Dunkeln, „wer dieses absolut souveräne, radikal dezisionistische<br />
Wir sein soll, wen es umfasst, wen es auschließt“. Und schloss<br />
aus der eigenen Behauptung: „Der Verdacht liegt nahe, es<br />
könnte mit dem Wir ein sozialdemokratisch verwalteter Staatsapparat<br />
gemeint sein.“<br />
Da nun irrt Kollege Kissler zugunsten seiner Thesen und in<br />
seinem Furor gegen alles Sozialdemokratische absichtlich. Es<br />
geht nicht um einen von wem auch immer verwalteten Staatsapparat,<br />
sondern um ein Ding namens Gesellschaft, die am Ende<br />
diesen Staat bildet, die dieser Staat am Ende ist. Zu den grundlegenden<br />
Irrtümern der gerade verstorbenen Margaret Thatcher<br />
gehörte die Behauptung: „There is no such thing as society.“<br />
Eine Gesellschaft gebe es nicht. Das war Thatchers zweitschlimmster<br />
Satz. Der schlimmste war der von der steigenden<br />
Flut, die alle Schiffe anhebe, die Urlüge des Neoliberalismus.<br />
Es gibt sie aber eben doch, diese Gesellschaft. Sie ist die Gesamtheit<br />
aller Individuen in einem definierten Raum. Sie verständigt<br />
sich auf Normen des Verhaltens im Zusammenleben,<br />
diese Normen sind entweder festgeschrieben, dann sind sie Gesetze<br />
(wie in allen anderen Ländern der Welt zum Beispiel jene<br />
zur Geschwindigkeitsbeschränkung auf <strong>Auto</strong>bahnen), oder es<br />
sind ungeschriebene Verhaltensmuster im Umgang miteinander,<br />
die sich bewährt haben. Zum Beispiel, für den Nachbarn die<br />
Sandsäcke mitzufüllen. <strong>Die</strong> Menschen fahren seit Jahrhunderten<br />
ganz gut mit dem Modell Gesellschaft.<br />
In diesem Modell sehen Kissler und die Anhänger der These<br />
von der Über-Wirung die Gefahr der Bevormundung des Ich. Ist<br />
das so? Ja, das ist so. <strong>Die</strong> Freiheit des Einzelnen findet in einer<br />
Gemeinschaft ihre Grenzen an der Freiheit des anderen. Und<br />
das ist gut so. Dazu könnte man nun von der Bergpredigt bis zu<br />
Illustration: Jan Rieckhoff<br />
130 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Anzeige<br />
Foto: Andrej Dallmann<br />
Kants kategorischem Imperativ viele Quellen anführen, die des<br />
sozialistischen Etatismus völlig unverdächtig sind.<br />
Wo das Ich angeblich bevormundet wird, da strebt es meistens<br />
in Wahrheit danach, sich – Vorsicht, jetzt kommt ein ganz<br />
schreckliches Wort für alle Kämpfer für die totale Freiheit – dem<br />
Solidarsystem zu entziehen; es geht um die Freiheit der Ichlinge.<br />
<strong>Die</strong> Flucht aus dem Solidarsystem haben übrigens prompt<br />
alle jungen, gesunden Ichlinge vollzogen, als die privaten Krankenkassen<br />
eingerichtet wurden: War billiger und versprach eine<br />
bessere Versorgung. Inzwischen sind die einst jungen, gesunden<br />
Ichlinge alt und siech geworden und mit ihnen das unsolidarische<br />
Privatversicherungswesen. Jetzt stöhnen viele Gesundheits-Ichlinge<br />
und wollen zurück ins System. Ich habe da wenig<br />
Mitgefühl. Das ist die Folge der Freiheit der Ichlinge. Franz<br />
Müntefering hat das Freiheitsversprechen des Neoliberalismus so<br />
persifliert: Jeder denkt an sich, dann ist an alle gedacht.<br />
Genau so geht es eben nicht in einer intakten Gesellschaft.<br />
Da irrte schon Adam Smith mit seiner wunderlichen unsichtbaren<br />
Hand: Wenn jeder tut, was für sein Geschäft gut ist, entsteht<br />
daraus eben kein Gemeinwohl. Es gibt sie nicht, diese unsichtbare<br />
Hand, die aus Versehen Gutes tut. Es gibt nur eine sichtbare.<br />
Und die heißt Gesellschaft, die heißt Staat.<br />
Ichlinge haben ein seltsames Staatsverständnis. Der Staat<br />
ist aus ihrer Sicht ein fettes, gemästetes, gefräßiges Etwas, das<br />
den Menschen das Mark aus den Knochen saugt. Kein Über-<br />
Ich, sondern ein Über-Wir, ein Moloch, der nichts mit den Bewohnern<br />
des definierten Raumes zu tun hat. Das ist ein Zerrbild<br />
<strong>vom</strong> Staat. Natürlich gibt es Auswüchse. Natürlich krankt<br />
etwa Frankreich an seiner Staatsquote von fast 60 Prozent. Aber<br />
der Staat an sich ist kein zu bekämpfendes Ungeheuer. Der Staat<br />
sind wir, der Staat bin ich: In einer Demokratie darf der Citoyen<br />
zu Recht sagen, was einst der König für sich reklamierte.<br />
Wenn der Mensch perfekt wäre, dann könnte man gerne<br />
über die Herrschaft der Freiheit nachdenken. Wenn jeder<br />
Mensch die Kant’sche Einsicht in sich trüge und auch beherzigte,<br />
dass man stets so handle, dass die Maxime des eigenen<br />
Handelns zu einem allgemeinen Gesetz erhoben werden könnte,<br />
dann ließe ich mit mir über die Herrschaft der totalen individuellen<br />
Freiheit reden. Dem ist aber nicht so. Da können wir unseren<br />
Kindern noch so oft und noch so richtigerweise die Kindervariante<br />
von Kant vorbeten: Was du nicht willst, das man dir tu’,<br />
das füg auch keinem andern zu.<br />
Wir werden uns nicht daran halten, zumindest nicht durchgängig.<br />
Deshalb braucht es einen Staat, deshalb braucht es eine<br />
Definition des Wir, auf das sich die große Mehrheit eines Gemeinwesens<br />
verständigt.<br />
Dafür hat der liebe Gott übrigens den Juden und Christen<br />
die Zehn Gebote gegeben. Du sollst dies nicht, du sollst das nicht,<br />
sagt darin der liebe Gott. Es muss sich bei diesem Gott auch um<br />
einen schlimmen Freiheitsfeind und Etatisten handeln.<br />
Ihr Monopol<br />
auf die Kunst<br />
Lassen Sie sich begeistern:<br />
Jetzt Monopol gratis lesen!<br />
Wie kein anderes Magazin spiegelt<br />
Monopol, das Magazin für Kunst und<br />
Leben, den internationalen Kunstbetrieb<br />
wider.<br />
<strong>Die</strong>sen Monat mit großem Biennale<br />
Venedig-Report: die besten Ausstellungen,<br />
Pavillons, Werke – Monopol<br />
zieht Bilanz.<br />
Hier bestellen:<br />
Telefon 030 3 46 46 56 46<br />
www.monopol-magazin.de/probe<br />
Bestellnr.: 943170<br />
Christoph Schwennicke<br />
ist Chefredakteur von <strong>Cicero</strong><br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 131
| S a l o n | B i b l i o t h e k s p o r t r ä t<br />
Aus einem<br />
Doppelleben<br />
Der Verleger Hubert Burda hat seine Bücher<br />
auf drei Orte verteilt. In München sind<br />
Petrarca und Diderot die Brückenpfeiler in<br />
eine Vergangenheit, die kommen wird<br />
Von holger fuSS<br />
Z<br />
uweilen gerät etwas samtiges in seine Stimme. Etwa<br />
wenn Hubert Burda im Bildband „Im Garten der Dichter“<br />
von Isolde Ohlbaum blättert, einer Dokumentation<br />
der Verleihungen des von ihm 1975 gestifteten Petrarca-<br />
Literaturpreises. Ein bisschen elegisch schweift sein Blick<br />
über die Seiten. „Das sind fast 40 Jahre meines Lebens. Hier sehen<br />
Sie Peter Handke, Nicolas Born, Michael Krüger. Das waren<br />
die einzigen zwei Tage im ganzen Jahr, an denen ich das Gefühl<br />
hatte, dass sie toll waren.“<br />
Oder wenn Hubert Burda über Pop-Art räsoniert. Immerhin<br />
wurde der heute 73-Jährige in Kunstgeschichte promoviert –<br />
über „<strong>Die</strong> Ruine in den Bildern Hubert Roberts“. Auf die Frage,<br />
ob er sich für die Pop-Art begeistere, weil die Pop-Art wie die<br />
alten Meister eine Verzauberung des Gewöhnlichen betreibe, gerät<br />
Burda ins Schwelgen: „Caravaggio ist schon die Mystifizierung<br />
des Alltags, Rembrandt ist so alltäglich, Jan Steen, die ganzen Holländer<br />
eigentlich. In diesem Geist bin ich groß geworden. Es ist<br />
eben immer dieser Spagat: Sie müssen das Leben aushalten zwischen<br />
der Metaphysik und der alltäglichen Trivialität.“<br />
Wer wüsste so etwas besser als Hubert Burda? Zeitlebens hat<br />
dieser Mann ein Doppelleben geführt – zwischen „high and low“,<br />
wie er gern sagt, zwischen Hoch- und Massenkultur. Als Zeitschriftenverleger<br />
setzt er mit Blättern wie Bunte, Focus und Freizeit<br />
Revue jährlich mehr als zwei Milliarden Euro um. Als Kunsthistoriker<br />
empfindet er sich im 18. Jahrhundert geistig beheimatet,<br />
fühlt sich den Renaissance-Bankern der Medici verwandt, die als<br />
132 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Ist es eine<br />
Infografik? Ist es ein<br />
Piranesi? Immer<br />
sind es Bilder, die<br />
zu Bildern werden<br />
Foto: Jan Röder für <strong>Cicero</strong><br />
Mäzene das intellektuelle Klima ihrer Zeit geprägt haben, und ist<br />
überzeugt, dass „die Begegnung mit der Antike eine Revolution<br />
im Denken“ hervorrufen kann.<br />
Seine Bücher hat Hubert Burda über mehrere Domizile verteilt:<br />
am Tegernsee, in St. Moritz und in München. Zu einem<br />
Mittagessen hat er in seine gelb getünchte Gründerzeitvilla im<br />
feinen Münchner Stadtteil Bogenhausen geladen. Wie es sich für<br />
einen viel beschäftigten Wirtschaftskapitän gehört, verspätet er<br />
sich um einige Minuten. In der dunkel getäfelten Bibliothek im<br />
Erdgeschoss scheint die Zeit ohnehin stehen geblieben. Antike<br />
Stein- und Gipsköpfe blicken stumm aus den Regalen zwischen<br />
den Bücherrücken hervor. Neben dem Fenster thronen die ledergebundenen<br />
Original-Folianten der kompletten 35-bändigen<br />
„Encyclopédie“ von Diderot und d’Alembert, eine Art Solarplexus<br />
der Aufklärung.<br />
Hubert Burda stürmt herein. Im Gefolge Chauffeur Fröschl, der<br />
mit einer Digitalkamera behend Erinnerungsfotos knipst, und Berater<br />
Stephan Sattler, ein silbrig ergrauter Vertrauter seit 30 Jahren,<br />
bildungsgesättigter Sekundant während des Gesprächs. Ein<br />
schwarz gekleidetes Hausmädchen deckt einen runden Tisch zum<br />
Lunch. Burda wuchtet einen „Encyclopédie“-Folianten aus dem<br />
Regal und faltet die Illustrationen des italienischen Kupferstechers<br />
Piranesi auf: „Hier die Stadtpläne von Rom. So was hat<br />
mich immer interessiert. Das hat mich zu den Infografiken im<br />
Focus inspiriert.“<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 133
| S a l o n | B i b l i o t h e k s p o r t r ä t<br />
Als Franz Knebel 1858 seine Vedute mit Wasserfall malte, waren die meisten Bücher in Hubert Burdas Bibliothek schon<br />
geschrieben. Und auch die meisten Gedanken der Philosophen, die sie säumen, waren schon gedacht. Doch spricht das gegen sie?<br />
Auch dies gehört zum Doppelleben Hubert Burdas: Was auf<br />
den ersten Blick trivial anmutet, wird auf kurzem <strong>Die</strong>nstweg mit<br />
der Hochkultur verknüpft. Wirken die Infografiken in Focus nicht<br />
wie ein Lasso, damit auch die Lesefaulen sich an ein Nachrichtenmagazin<br />
herantrauen? Aber nein: Schon Diderot machte seine<br />
„Encyclopédie“ mit diesem Stilmittel zum „meistverkauften Buch<br />
des 18. Jahrhunderts“. Wurde die Bunte in den neunziger Jahren<br />
nicht zum People-Magazin umgeklempnert, weil die Burda-Illustrierte<br />
es nie zu einer Wundertüte schaffte wie der Stern? Nicht<br />
doch: Vorbild für die People-Bunte war kein Geringerer als Pop-<br />
Art-Ikone Andy Warhol mit seinem Interview-Magazin. „Warhols<br />
Lifestyle hat mich fasziniert“, sagt Burda. „Er ist der Erfinder der<br />
Celebrity-Culture. Ich begriff: Don’t care about Spiegel, don’t care<br />
about Stern – make a people magazine!“<br />
Auch seinen mittlerweile etablierten Lyrikpreis machte Burda<br />
zum großen Bildungskino. Er geht zu einer Regalwand und weist<br />
mit ausladender Geste: „<strong>Die</strong>s alles ist Petrarca.“ Oben die Werke<br />
des italienischen Renaissance-Dichters, darunter die Preisträger.<br />
Zu den Erstprämierten gehörten Rolf <strong>Die</strong>ter Brinkmann und<br />
Sarah Kirsch. Im dritten Jahr wies Herbert Achternbusch den<br />
Preis zurück. Petrarca als Patron eines Literaturpreises war Mitte<br />
der Siebziger eine konservative Provokation: „Es war ein Gegenprogramm,<br />
eine Alternative zum damaligen Mehrheitskonsens<br />
in der Literatur. <strong>Die</strong> deutsche Literatur war ja sehr stark politisch<br />
engagiert.“<br />
Doch hier hatte Burda ebenfalls weit mehr im Sinn. Alljährlich<br />
hielt er mit einer Schar Kulturschaffender, darunter Freunde<br />
wie Peter Handke, Bazon Brock und Michael Krüger, zweitägige<br />
Prozessionen zu Wallfahrtsstätten der Renaissance ab wie<br />
Siena, Verona und Florenz. Vorbild war die Grand Tour, jene rituelle<br />
Bildungsreise junger englischer Adliger und Bürgersöhne<br />
nach Italien und Griechenland auf den Spuren der Antike. „Das<br />
war in Europa das große Bildungsereignis“, erklärt Burda. „<strong>Die</strong><br />
Idee war, dass erst die Auseinandersetzung mit der Antike das<br />
Neue schafft.“<br />
Neulich hat er im Frankfurter Liebighaus die Ausstellung „Zurück<br />
zur Klassik – Ein neuer Blick auf das alte Griechenland“ besichtigt.<br />
Seither liest er in den Essays des dickleibigen Ausstellungskatalogs.<br />
<strong>Die</strong> griechische Kunst wollte „das Leben in seinem<br />
gesamten Umfang abbilden“, zitiert Burda aus dem Vorwort, und<br />
„den Antagonismus der Kräfte vollständig“ darstellen. <strong>Die</strong> Polarität<br />
des Lebens – allenthalben stößt Burda auf seinen biografischen<br />
Spagat zwischen high and low, sogar in der Antike.<br />
Der Lunch ist serviert. Berater Sattler sitzt mit am Tisch und<br />
verteilt die Vorspeise auf die Teller: gebeizten Lachs und Salat.<br />
Als Hauptgang folgen Steaks auf Blattspinat. Nebenan im Regal<br />
stehen die Bücher von Peter Sloterdijk. Aus den dicken Bänden<br />
seiner „Sphären“-Trilogie ragen Dutzende von Notizzetteln. Mit<br />
Sloterdijk ist Burda befreundet, der Verleger überlässt ihm tageweise<br />
sein Ferienhaus im Schwarzwald. „Eine kolossale Sprachbegabung“<br />
nennt Burda den Vielschreiber. „Er kann die ganze<br />
Philosophiegeschichte in Heldenerzählungen packen.“ Sattler erklärt<br />
nicht ohne Stolz: „Ich habe dich ja Mitte der Neunziger mit<br />
Sloterdijk zusammengebracht. Seitdem ist er eine Art Hausphilosoph<br />
für dich.“<br />
Ein anderer Denker aus Burdas Schwarzwälder Heimat steht vollzählig<br />
in zwei Regalreihen: die Gesamtausgabe von Martin Heidegger.<br />
„Den kannte ich auch, den Heidegger“, erzählt Burda. „Ich<br />
hab mich relativ blöd aufgeführt bei ihm. Ich könnte mich noch<br />
immer in den Arsch beißen. Das war die ganz linke Zeit als Student,<br />
1963. Bei der Einweihung einer Schule sagte ich zu ihm:<br />
Wie werden Sie damit fertig, dass die jetzige Generation nichts<br />
mehr von Ihnen wissen will? Heidegger reagierte sehr nett und<br />
freundlich. Aber ich wusste natürlich, dass ich unten durch gefallen<br />
bin. Man merkte, wie er dachte: Das ist so einer dieser modernen,<br />
linken Vögel.“<br />
Hubert Burda war mal ein Linker? „In den sechziger Jahren<br />
waren das doch viele“, sagt er. „Aber dann kam die Niederschlagung<br />
des Prager Frühlings 1968 durch die Truppen des<br />
Warschauer Paktes. Da war klar, dass der Kommunismus keine<br />
Zukunft hat.“ Und heute? Ein Konservativer? Mit dem Begriff<br />
kann Burda nichts anfangen. „Ich bin für 8000 Leute verantwortlich,<br />
die für uns arbeiten.“ Sogar das Mitarbeiter-Modell des<br />
Spiegel-Verlags („einer der bislang bestgeführten Verlage“) findet<br />
er „hochinteressant, aber riskant“. Kein mögliches Vorbild für<br />
den Burda-Verlag? „Nein, nein. Das weltweit erfolgreichste Wirtschaftsmodell<br />
ist das mittelständische baden-württembergische<br />
Familienunternehmen.“ Dynastisches Denken spiele eine Rolle.<br />
„<strong>Die</strong> Kinder werden sehr früh dazu erzogen, Verantwortung zu<br />
Fotos: Jan Röder für <strong>Cicero</strong>, CAROLINE ELIAS (<strong>Auto</strong>r)<br />
134 <strong>Cicero</strong> 7.2013
übernehmen. Ich habe dieses Unternehmen ja geerbt. Wenn Sie<br />
etwas erben, dürfen Sie nie das Gefühl haben, es sei Ihr Besitz.<br />
Sie müssen das weitergeben.“<br />
Überbleibsel aus den umstürzlerischen Sechzigern haben sich<br />
in Burdas Rhetorik erhalten. An einem Regal hängt ein kleines<br />
Gemälde der Wasserfälle von Tivoli. „Wasserfälle haben immer<br />
eine Bedeutung für mich.“ Als Symbol des Kreativen, des Lebendigen?<br />
„Auch des Stürzens und Risikeneingehens. Im Stürzen<br />
verändert sich alles. Kreativsein heißt unternehmerisch tätig<br />
sein. Sie müssen in Sprüngen denken.“ Als Unternehmer „müssen<br />
Sie in diesen Umbrüchen drin sein und ein Gefühl entwickeln,<br />
dass Zeitenwende ist. Jetzt ist Zeitenwende.“ Der Epochenwechsel<br />
<strong>vom</strong> Schriftzeitalter Gutenbergs zum Bildzeitalter<br />
der elektronischen Medien. „Iconic Turn“ nennt das Burda. Ein<br />
eigenes Buch hat er darüber geschrieben: „In Medias res“. Darin<br />
führt er mit Gegenwartsdiagnostikern wie dem verstorbenen<br />
Friedrich Kittler, Sloterdijk oder Bazon Brock Gespräche darüber,<br />
wie die neue Herrschaft der Bilder die menschliche Wahrnehmung<br />
verändert.<br />
In solchen Projekten erblüht der Kunsthistoriker in Burda.<br />
Entstanden ist dieses Buch in den frühen Morgenstunden. Burda<br />
geht spätestens um 22 Uhr schlafen und wacht um 4 Uhr auf.<br />
Noch im Bett diktiert er seine Traumsequenzen ins digitale Aufnahmegerät<br />
– bis ihn Ehefrau Maria Furtwängler aus dem Schlafzimmer<br />
scheucht. Bis halb acht Uhr währt seine „Zeit der Freiheit“,<br />
wie Sattler einwirft. Da gehört Burda ganz sich selbst.<br />
Verschlingt Bücher, schreibt und diktiert. Am liebsten Aphorismen<br />
wie: „Schon die Teppiche der Nomaden waren so etwas wie<br />
mobile Bilder.“ Oder: „Entlastend oder belastend: Sex im Internet.“<br />
Oder: „Das Schöne, die große Idee des Klassizismus, ist<br />
aus der zeitgenössischen Kunst fast verschwunden. Wohin? In<br />
die Werbefotografie, den Tourismus, den Sport und vor allem<br />
ins Design.“<br />
Burda schaut auf die Uhr. <strong>Die</strong> nächsten Termine drängen.<br />
Ein letzter Blick in die Bücherregale. Neben Geschichtsliteratur<br />
und kunsthistorischen Werken von Ernst Gombrich, Karl<br />
Kerényi und Aby Warburg steht die Münchner Goethe-Ausgabe.<br />
Sein Freund Handke, der „jeden Tag eine Seite Goethe liest“, hat<br />
ihm den Dichter nahegebracht. „An Goethe interessiert mich vor<br />
allem, wie er sich selber als Künstler inszeniert hat“, sagt Burda.<br />
Und eilt davon.<br />
Von Goethe kann sich Burda obendrein abgeguckt haben, wie<br />
der seinen Spagat zwischen Weimarer Staatsdienst und Poesie kultiviert<br />
hat. Auch Goethe wusste um die Kluft zwischen high and<br />
low. Womöglich besteht das Doppelleben des Hubert Burda weniger<br />
in einer Zerrissenheit zwischen unüberwindbar scheinenden<br />
Gegensätzen als vielmehr in einer Schwebeübung zwischen<br />
Möglichkeit und Notwendigkeit. In unserer Zeit, die Widersprüche<br />
lieber übertüncht, müssen wir uns Hubert Burda als Avantgarde<br />
vorstellen.<br />
Anzeige<br />
JOHANNA<br />
WOKALEK<br />
IRIS<br />
BERBEN<br />
RICHY<br />
MULLER<br />
DAVID<br />
KROSS<br />
NACH DEM WELTBESTSELLER VON PAUL WATZLAWICK<br />
ODER WIE DIE LIEBE TIFFANY<br />
TROTZDEM FAND<br />
»<strong>Die</strong><br />
deutsche<br />
Antwort auf<br />
›Amélie‹.«<br />
OK!<br />
holger Fuss<br />
liebt Kathedralen und die Kultur der Romantik<br />
und verfolgt als <strong>Auto</strong>r den postmaterialistischen<br />
Wertewandel in unserer Gesellschaft<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 135<br />
Ein Film von SHERRY HORMANN (»Wüstenblume«)<br />
AB 4. JULI AUF DVD, BLU-RAY<br />
UND VoD ERHÄLTLICH!<br />
www.anleitungzumungluecklichsein.studiocanal.de
136 <strong>Cicero</strong> 7.2013
D i e l e t z t e n 2 4 S t u n d e n | S a l o n |<br />
Nicht mehr fliehen<br />
Der Schriftsteller John von Düffel mag nicht mehr im Meer<br />
sterben, seit er sich mit der Palliativmedizin beschäftigt.<br />
Stattdessen hat er einen <strong>neuen</strong> Traum von seinem Ende<br />
Foto: Maurice Weiss/Ostkreuz<br />
D<br />
en letzten Tag meines Lebens<br />
stelle ich mir anders vor, seit<br />
ich zusammen mit der Palliativmedizinerin<br />
Petra Anwar das Buch<br />
„Geschichten <strong>vom</strong> Sterben“ geschrieben<br />
habe. Es handelt sich dabei um wahre<br />
Geschichten, nicht um Fiktion. Insofern<br />
gab es eine Phantasie <strong>vom</strong> eigenen Tod<br />
vor diesem Buch, und es gibt eine danach.<br />
Beide unterscheiden sich grundlegend.<br />
Meine erste Todesphantasie hatte mit<br />
meiner Schwimmleidenschaft zu tun.<br />
Beim Schwimmen gehe ich oft an meine<br />
Grenzen und bin dem Tod manchmal<br />
sehr nah gewesen. Insofern war für mich<br />
immer klar, dass ich im Wasser sterben<br />
würde, genauer gesagt: im Meer, in einer<br />
Dimension von Unendlichkeit.<br />
Natürlich war mir bei dieser Sterbevision<br />
immer bewusst, dass der Tod im<br />
Wasser auch ein literarischer Mythos ist.<br />
Man denke nur an Shakespeares Ophelia<br />
oder an die junge Unbekannte aus der<br />
Seine, deren Totenmaske die Wände vieler<br />
Künstlerwohnungen geschmückt hat.<br />
Vermutlich hatte meine Vorstellung, im<br />
unendlichen Meer zu verschwinden, etwas<br />
von dem eitlen Wunsch einer scheinbaren<br />
Unversehrtheit. Aber das Ganze<br />
war mehr als bloß ein Traum oder eine<br />
Vision. Es war auch etwas, was mich beim<br />
wirklichen Schwimmen sehr begleitet hat.<br />
Dann ergab sich die Möglichkeit einer<br />
Zusammenarbeit mit Petra Anwar, die<br />
durch den Andreas-Dresen-Film „Halt auf<br />
freier Strecke“ bekannt geworden ist, in<br />
dem sie sich selbst spielt. Für einen vielleicht<br />
schicksalhaften Moment stand ich<br />
Der 1966 in Göttingen geborene<br />
und heute in Potsdam lebende<br />
John von Düffel schwimmt<br />
leidenschaftlich gerne und zieht<br />
hauptberuflich als Schriftsteller,<br />
Dramaturg und Übersetzer seine<br />
Bahnen. Gemeinsam mit Petra<br />
Anwar hat er zuletzt „Geschichten<br />
<strong>vom</strong> Sterben“ veröffentlicht<br />
www.cicero.de/24stunden<br />
vor der Frage, ob ich mich mit dem Sterben<br />
so konkret und unverblümt beschäftigen<br />
will. Ich hatte nicht nur Respekt vor<br />
dem Thema, sondern regelrecht Angst.<br />
Doch im selben Moment wusste ich,<br />
dass ich dieser Angst nicht ausweichen<br />
darf, nicht im Schreiben und nicht im<br />
Leben. Ich bin jetzt in einem Alter, wo in<br />
der Generation meiner Eltern das Sterben<br />
ganz real beginnt, auch in meinem Freundes-<br />
und Kollegenkreis sind die ersten gestorben.<br />
Mithin hat der Tod aufgehört,<br />
ein literarisches, ein geahntes, ein vorgestelltes<br />
Thema zu sein. Er ist eine Realität.<br />
<strong>Die</strong> Palliativmedizinerin Petra Anwar<br />
ermöglicht mit ihrer Arbeit vielen Menschen<br />
einen anderen Traum <strong>vom</strong> Tod: das<br />
Sterben in den eigenen vier Wänden. <strong>Die</strong><br />
meisten Menschen wollen dort sterben,<br />
wo sie gelebt haben. Ich glaube, dass sich<br />
jeder Mensch in seinem Sterbeprozess<br />
wiedererkennen will, anstatt am Ende<br />
seines Lebens im Krankenhaus zu einer<br />
Nummer zu werden, die man – um es<br />
brutal auszudrücken – am finalen Punkt<br />
abschnallt und verklappt. Das Sterben gehört<br />
zum Leben. Es soll das Gesicht tragen,<br />
das der Sterbende sich wünscht. Das<br />
ist der Sinn der Palliativmedizin.<br />
Darum habe ich jetzt eine neue Sterbeutopie.<br />
Ich bin atheistisch erzogen worden<br />
und nicht religiös. Aber ich glaube,<br />
dass es etwas Geistiges, etwas Seelisches<br />
gibt. Ein entschiedener Empiriker oder<br />
Materialist bin ich nicht. Ich möchte auf<br />
keinen Fall im Krankenhaus sterben, sondern<br />
meinen Tagesablauf im Sterben weitgehend<br />
so gestalten wie einen ganz normalen<br />
Tag in der Mitte des Lebens. Mein<br />
großer Traum wäre es, ein paar wache<br />
Stunden zu haben, in denen ich mit meiner<br />
Familie frühstücke, vielleicht ein paar<br />
Sätze aufschreibe und im Grunde das<br />
mache, was ich im Leben auch gemacht<br />
habe. Alles jedoch in dem klaren Wissen:<br />
Das ist mein letzter Tag. Ich möchte so<br />
sterben, wie ich gelebt habe, und möchte<br />
dabei die Menschen um mich haben, die<br />
zu meinem Leben gehören.<br />
Ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam<br />
voneinander <strong>Abschied</strong> nehmen,<br />
uns die Hände reichen und uns noch einmal<br />
spüren, bis der Zeitpunkt gekommen<br />
ist, loszulassen für immer. Und das ist<br />
vielleicht der größte Unterschied zu meiner<br />
früheren Todesvision <strong>vom</strong> Verschwinden<br />
im Schwimmen: dass ich nicht mehr<br />
allein sterben will, sondern zu Hause im<br />
Kreis meiner Familie. Ich will vor dem<br />
letzten <strong>Abschied</strong> nicht länger fliehen.<br />
Aufgezeichnet von Ingo Langner<br />
7.2013 <strong>Cicero</strong> 137
C i c e r o | P o s t S c r i p t u m<br />
Herrlich, dämlich<br />
Von Alexander Marguier<br />
H<br />
errlich, was konnten wir uns wieder über diese dämlichen<br />
Gutmenschen aufregen! Da beschließt die Universität<br />
Leipzig doch tatsächlich, beide Geschlechter<br />
als „Professorin“ zu titulieren. „Herr Professorin“ soll es künftig<br />
also in Sachsen heißen. Es handelte sich bei dieser sprachlichen<br />
Maßnahme offenbar zwar nur um die pragmatische Lösung zur<br />
Vermeidung der <strong>vom</strong> Hochschulsenat als umständlich empfundenen<br />
Schrägstrichvariante „Professor/Professorin“. Aber<br />
manchmal macht Pragmatismus die Dinge eben nicht leichter,<br />
sondern schwieriger. Denn in der ideologisch ohnehin schon<br />
aufgeheizten Männer-Frauen-Debatte vertiefen solche Eingriffe<br />
in die gewohnte Ausdrucksweise die Gräben zwischen den<br />
gegnerischen Lagern. Wer den Feminismus schon immer als<br />
Grundübel und Gefahr für die abendländische Zivilisation angesehen<br />
hat, wird sich nun im Hass auf die vermeintliche Diktatur<br />
des Gender Mainstreaming bestätigt sehen – während von<br />
der anderen Seite unangenehmes Triumphgeschrei zu vernehmen<br />
ist nach dem Motto: „Jetzt wird der Spieß mal umgedreht!“<br />
Natürlich hätte ich keine Lust darauf, offiziell als „stellvertretende<br />
Chefredakteurin“ zu firmieren. Andererseits kann man<br />
sich schon fragen, warum im Impressum dieses Magazins zwei<br />
Frauen ganz selbstverständlich als „Ressortleiter“ bezeichnet werden<br />
und eine weitere Kollegin den Titel „Art Director“ trägt.<br />
Nein, in der Geschlechterfrage, die naturgemäß zuallererst eine<br />
Frage der Gerechtigkeit ist, liegt immer noch einiges im Argen.<br />
Und ich frage mich ernsthaft, wie sehr mir selbst diese offensichtlich<br />
immer noch existierende Gerechtigkeitslücke eigentlich<br />
am Herzen liegt.<br />
Der Schweizer <strong>Auto</strong>r Markus Theunert hat in seinem unlängst<br />
erschienenen Buch „Co-Feminismus: Wie Männer Emanzipation<br />
sabotieren – und was Frauen davon haben“ sehr schön<br />
die Figur des „Co-Feministen“ herausgearbeitet, der Gleichstellung<br />
eine gute Sache findet, solange er damit nichts zu tun hat.<br />
„Aus Indifferenz, Angst oder Kalkül gibt er den Frauenversteher<br />
und drückt sich damit erfolgreich vor der Auseinandersetzung<br />
mit seinem Mann-Sein“, so Theunert. Da ist mehr dran, als einem<br />
lieb sein kann.<br />
Meine bisherige Argumentationsweise als klassischer Co-Feminist<br />
ging ungefähr so: Natürlich bin ich für die bedingungslose<br />
Gleichberechtigung von Männern und Frauen, was denn<br />
sonst! Aber deswegen brauchen wir doch keine Quote, denn<br />
die Frauen holen uns schon seit Jahren ein und werden demnächst<br />
in allen gesellschaftlichen Bereichen mindestens genauso<br />
zahlreich vertreten sein wie Männer. Marissa Mayer ist immerhin<br />
Vorstandschefin bei Yahoo; Angela Merkel Bundeskanzlerin.<br />
Und überhaupt sind Mädchen in der Schule erfolgreicher als<br />
Jungs. Also bitte nicht noch mehr staatliche Eingriffe und erst<br />
recht keine weitere Verhunzung der deutschen Sprache – die berühmte<br />
Binnenversalie war schon schlimm genug. Lauter Sätze,<br />
die einem halt so einfallen, wenn man eigentlich nicht will, dass<br />
sich irgendetwas ändert. So ist es nämlich: <strong>Die</strong> meisten Männer,<br />
die treuherzig von Frauenrechten schwafeln, setzen insgeheim<br />
auf den Status quo. Was auch verständlich ist, wer freut sich<br />
schon über Konkurrenz?<br />
An der Universität Leipzig liegt der Anteil der Professorinnen<br />
übrigens bei unter 20 Prozent (was sicher nicht daran<br />
liegt, dass Frauen über weniger wissenschaftliches Talent verfügen<br />
als Männer). Auf dieses krasse Missverhältnis hat die Leipziger<br />
Hochschulrektorin hingewiesen, als sie sich wegen der auf<br />
den ersten Blick bizarr erscheinenden Sprachregelung öffentlich<br />
rechtfertigen musste. Aber an solche Zahlen ist man ja gewöhnt,<br />
genau deswegen verursachen sie auch keine Empörungswellen.<br />
Ein läppischer „Herr Professorin“ dagegen schon. Solange sich<br />
daran nichts ändert, sollten sich die aufgeregten Hüter der deutschen<br />
Sprache fragen, ob es ihnen in Wahrheit nicht um etwas<br />
ganz anderes geht: Besitzstandswahrung nämlich.<br />
Alexander Marguier<br />
ist stellvertretende Chefredakteurin von <strong>Cicero</strong><br />
Illustration: Christoph Abbrederis; Foto: Andrej Dallmann<br />
138 <strong>Cicero</strong> 7.2013
Jetzt<br />
4 Wochen<br />
kostenlos<br />
testen:<br />
nzz.ch/digital26<br />
Überall und jederzeit.<br />
<strong>Die</strong> «Neue Zürcher Zeitung»<br />
auch auf dem Tablet.<br />
Lesen Sie die «Neue Zürcher Zeitung» neben der gedruckten Ausgabe<br />
auch auf Ihrem Smartphone, Laptop oder auf dem Tablet.<br />
Bestellen per Internet: nzz.ch/digital26