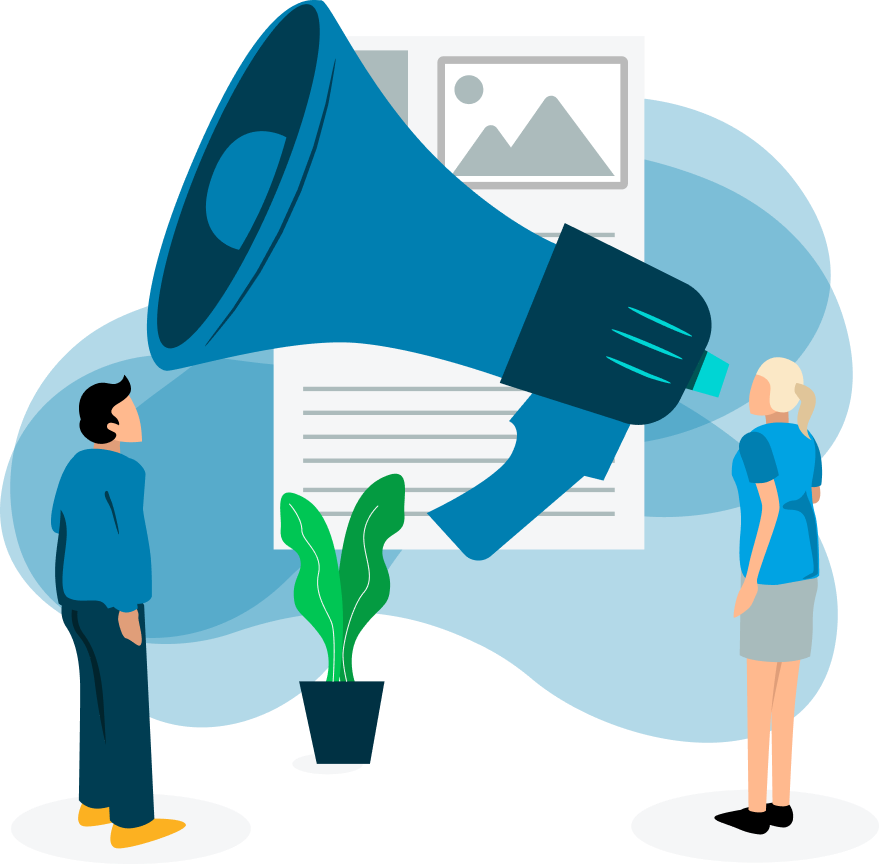Cicero Die 500 wichtigsten Intellektuellen (Vorschau)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WWW.CICERO.DE<br />
Januar 2013<br />
8 EUR / 12,50 CHF<br />
www.cicero.de<br />
Wahl 2013<br />
So wird es kommen<br />
Österreich: 8 EUR, Benelux: 9 EUR, Italien: 9 EUR<br />
Spanien: 9 EUR, Portugal (Cont.): 9 EUR, Finnland: 12 EUR
CICERO<br />
VERSCHENKEN<br />
und Dankeschön<br />
sichern.<br />
Bringen Sie sich Monat für Monat in angenehme<br />
Erinnerung, und beschenken Sie Freunde oder sich<br />
selbst mit einem <strong>Cicero</strong>-Abonnement. Zum Dank<br />
erhalten Sie ein Geschenk Ihrer Wahl.<br />
Mehr Informationen finden Sie auf Seite 51<br />
und online unter www.cicero.de/weihnachten
Wahl 2013<br />
So wird es kommen
cartier.de – 089 55984-221<br />
calibre de cartier<br />
1904 MC MANUFAKTURWERK<br />
DAS KALIBER 1904 MC STEHT, WIE SEIN NAME VERMUTEN LÄSST, FÜR ÜBER 100 JAHRE TECHNISCHE EXZELLENZ<br />
AUS DEM HAUSE CARTIER. DIE UHR CALIBRE DE CARTIER IST MIT EINEM AUTOMATIKWERK AUSGESTATTET,<br />
DAS NEUE STILISTISCHE UND TECHNISCHE MASSSTÄBE IN DER TRADITIONELLEN UHRMACHERKUNST SETZT.<br />
ES WURDE VON CARTIER ENTWORFEN UND ENTWICKELT UND WIRD BEI CARTIER HERGESTELLT.<br />
42 MM STAHLGEHÄUSE. MECHANISCHES MANUFAKTURWERK MIT AUTOMATIKAUFZUG, KALIBER CARTIER 1904 MC<br />
(28.800 HALBSCHWINGUNGEN PRO STUNDE, 27 LAGERSTEINE, DOPPELTES FEDERHAUS, BEIDSEITIG<br />
AUFZIEHENDER ROTOR), KLEINE SEKUNDE, DATUMSFENSTER. FACETTIERTE STAHLKRONE MIT CABOCHON.<br />
SCHWARZES, OPALISIERENDES ZIFFERBLATT. KRATZFESTES SAPHIRGLAS.
C I C E R O | A T T I C U S<br />
Von: <strong>Cicero</strong><br />
An: Atticus<br />
Datum: 20. Dezember 2012<br />
Thema: <strong>Die</strong> Liste der <strong>500</strong>, Colin Crouch, der Countdown zur Bundestagswahl<br />
Vermessung des Geistes<br />
TITELBILD: WIESLAW SMETEK; ILLUSTRATION: CHRISTOPH ABBREDERIS<br />
W<br />
IRTSCHAFTLICHE LEISTUNGSKRAFT IST MESSBAR. Man kann ermitteln, welchen<br />
Geldwert die Waren und <strong>Die</strong>nstleistungen haben, die ein einzelner Mensch<br />
erwirtschaftet. Wie steht es aber mit den geistigen Leistungen? Kann man<br />
messen, welchen Einfluss ein Mensch auf eine Debatte genommen hat? Wie wirkmächtig<br />
einer ist?<br />
Vor sechs Jahren hat <strong>Cicero</strong> es erstmals gewagt, eine Liste der <strong>500</strong> <strong>wichtigsten</strong><br />
<strong>Intellektuellen</strong> im deutschsprachigen Raum vorzulegen. 2007 wurde diese Vermessung des<br />
Geistes wiederholt. Nun hat <strong>Cicero</strong> den Datensammler MAX A. HÖFER erneut gebeten, seine<br />
Maschine anzuwerfen. <strong>Die</strong> Vorgehensweise ist dieselbe geblieben: Höfer misst Präsenz<br />
im Diskurs. Er zählt die Namensnennungen in vier verschiedenen Datensätzen (Details<br />
zur Methode auf den SEITEN 20 UND 26). Herausgekommen ist zum Jahresauftakt 2013 die<br />
dritte <strong>Cicero</strong>-Liste der <strong>wichtigsten</strong> <strong>Intellektuellen</strong> – mit einem neuen Spitzenreiter, vielen<br />
Neueinsteigern und einer Menge Verschiebungen.<br />
Das Ranking erfasst keine Politiker, weder aktive noch ehemalige, weil sonst<br />
unweigerlich ein Politiker-Ranking entstanden wäre. Helmut Schmidt stünde mit weitem<br />
Abstand auf Platz 1, Thilo Sarrazin auf Platz 17. Mit Sicherheit fände sich auch MICHAEL<br />
NAUMANN darauf. Der frühere Kulturstaatsminister und <strong>Cicero</strong>-Chefredakteur schreibt eine<br />
Vermisstenanzeige in 19 Schritten. Gesucht wird in Naumanns ganz eigener Liste: der<br />
Intellektuelle (SEITE 30).<br />
Geistig bereichert hat uns Deutsche unbestreitbar der britische Sozialwissenschaftler<br />
COLIN CROUCH. Nirgendwo sonst fand sein Buch „Postdemokratie“ eine vergleichbare<br />
Resonanz. Ein Jahr nach Erscheinen seines Zweitlings „Das befremdliche Überleben des<br />
Neoliberalismus“ stellt sich Crouch im <strong>Cicero</strong>-Gespräch angesichts des Siechtums der FDP<br />
der Frage: Stirbt er jetzt vielleicht doch, der Neoliberalismus? Crouchs Widerworte finden<br />
Sie AB SEITE 96.<br />
<strong>Die</strong> Landtagswahl in Niedersachsen am 20. Januar läutet den Bundestagswahlkampf<br />
2013 ein (ein Porträt des amtierenden Ministerpräsidenten DAVID MCALLISTER auf SEITE 34).<br />
<strong>Cicero</strong> begleitet in einer Serie die <strong>wichtigsten</strong> Läufer im Rennen um die Regierung.<br />
CONSTANTIN MAGNIS fragt frühere Lehrer nach Tugenden und Schwächen ihrer einstigen<br />
Schützlinge (Christel Braun über Peer Steinbrück auf SEITE 59), Persönlichkeiten aus Kultur<br />
und Gesellschaft stellen ihr Wunschkabinett zusammen (ANNA THALBACH auf SEITE 40).<br />
Und <strong>Cicero</strong> greift den Ereignissen schon mal vor: Drei Zukunftsreportagen beschreiben<br />
die dramatischen Stunden von ANGELA MERKEL, PEER STEINBRÜCK und JÜRGEN TRITTIN am<br />
Wahlabend im Herbst 2013 (AB SEITE 42).<br />
In den „Epistulae ad Atticum“ hat<br />
der römische Politiker und Jurist<br />
Marcus Tullius <strong>Cicero</strong> seinem<br />
Freund Titus Pomponius Atticus<br />
das Herz ausgeschüttet<br />
Mit besten Grüßen<br />
Christoph Schwennicke, Chefredakteur<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 3
C I C E R O | I N H A L T<br />
TITELTHEMA<br />
18<br />
DIE LISTE DER <strong>500</strong><br />
Intellektuelle, die in der Debatte durchdringen: das Ranking, die Aufsteiger, die Absteiger, die Newcomer<br />
26<br />
KRISENTREMOLO<br />
<strong>Die</strong> Debatte im deutschsprachigen Raum dominieren<br />
alte Patriarchen, die warnen und mahnen<br />
VON MAX A. HÖFER<br />
30<br />
DER INTELLEKTUELLE<br />
Noch eine Liste: 19 Eigenschaften einer ruhig<br />
gestellten, wenn nicht gar ermordeten Spezies<br />
VON MICHAEL NAUMANN<br />
ILLUSTRATION: WIESLAW SMETEK<br />
4 <strong>Cicero</strong> 1.2013
I N H A L T | C I C E R O<br />
42 Das Rennen<br />
94<br />
<strong>Die</strong> Zeitungsfrau<br />
66<br />
Der Präsident<br />
BERLINER REPUBLIK WELTBÜHNE KAPITAL<br />
34 | DIE ONE-MAC-SHOW<br />
David McAllister kämpft um<br />
Niedersachsen. Auftritte berauschen ihn<br />
VON GEORG LÖWISCH<br />
60 | JOHN OHNELAND<br />
John Boehner, oberster Republikaner,<br />
steht zwischen Obama und Ultrarechten<br />
VON JACOB HEILBRUNN<br />
90 | „WIR GEHEN DIE WETTE EIN“<br />
Spinnen die Letten? Daniels Pavluts, ihr<br />
Wirtschaftsminister, will den Euro<br />
INTERVIEW VON TIL KNIPPER<br />
36 | AM TISCH VOM STRAUSS<br />
<strong>Die</strong> CSU-Politikerin Gerda Hasselfeldt<br />
übt ohne Gehabe Einfluss aus<br />
VON HARTMUT PALMER<br />
62 | DIE SCHOTTER-MIZZI<br />
Österreichs Finanzministerin Maria<br />
Fekter denkt, was sie sagt<br />
VON BARBARA TÓTH<br />
92 | ER LIEBT DAS PUTZEN<br />
Für Frank Becker ist die Schuhpflege ein<br />
kulturvoller Akt – und ein Geschäft<br />
VON STEFFEN UHLMANN<br />
38 | UNTER DRUCK<br />
Seit knapp einem Jahr Staatsoberhaupt:<br />
Wie agiert Joachim Gauck?<br />
VON ALEXANDER MARGUIER<br />
64 | PEKINGER ORIGINAL<br />
Chinas oberster Copyright-Schützer<br />
bildet sich in Deutschland fort<br />
VON BERNHARD BARTSCH<br />
94 | DIE GRENZGÄNGERIN<br />
Julia Jäkel führt Gruner und Jahr in der<br />
Medienkrise. Glaubt sie an Journalismus?<br />
VON THOMAS SCHULER<br />
FOTOS: PICTURE ALLIANCE/DPA, LAIF; ILLUSTRATIONEN: JAN RIECKHOFF, CHRISTOPH ABBREDERIS<br />
40 | MEIN WUNSCHKABINETT<br />
Wahlserie: Schauspielerin Anna Thalbach<br />
besetzt Kanzleramt und Ministerien<br />
42 | „AUF DIE PLÄTZE …“<br />
Merkel, Steinbrück, Trittin. Wie der<br />
Wahlabend 2013 für sie ablaufen wird<br />
VON GEORG PAUL HEFTY, CHRISTOPH<br />
SCHWENNICKE UND PETER UNFRIED<br />
49 | FRAU FRIED FRAGT SICH …<br />
… wo eigentlich heute die Front verläuft<br />
VON AMELIE FRIED<br />
52 | DER BOLOGNA-FEHLER<br />
<strong>Die</strong> Reform der Hochschulen ist zum<br />
Exzess der Gleichmacher geworden<br />
VON KONRAD ADAM<br />
56 | RAUS AUS DEM REGELKORSETT<br />
Eine Privatuniversität in Friedrichshafen<br />
bricht den durchregulierten Bachelor auf<br />
VON CHRISTIAN FÜLLER<br />
59 | MEIN SCHÜLER<br />
Christel Braun unterrichtete Steinbrück<br />
VON CONSTANTIN MAGNIS<br />
66 | IM AUGE DES STURMS<br />
Frankreich ist in einer tiefen Krise. Kann<br />
François Hollande sein Land retten?<br />
VON JOHANNES WILLMS<br />
72 | DIE SIEBEN IRRTÜMER<br />
Egal, wer die Wahlen in Israel gewinnt,<br />
das Land muss sich den Realitäten stellen<br />
VON JUDITH HART<br />
76 | SOZIALARBEITER MIT RAKETEN<br />
Wer und was ist die Hamas wirklich?<br />
VON FRÉDÉRIC SAUTEREAU (FOTOS) UND<br />
MOHAMAD BAZZI (TEXT)<br />
84 | „SIE HABEN UNS DIE<br />
REVOLUTION GEKLAUT“<br />
Youssria Ghorab half, Mubarak zu<br />
stürzen – heute ist sie desillusioniert und<br />
kämpft dennoch weiter<br />
AUFGEZEICHNET VON JULIA GERLACH<br />
86 | DER FAHRSCHÜLER<br />
Leben nach dem Krieg: Ein Irak-Veteran<br />
muss das Autofahren neu lernen<br />
VON JOHANNES GERNERT<br />
96 | „DEM KAPITALISMUS<br />
FEHLT DER FEIND“<br />
Bestsellerautor Colin Crouch im<br />
Interview über die Europäer, den reinen<br />
Markt und den Tanz am Finanzmarkt<br />
INTERVIEW VON JUDITH HART UND<br />
CHRISTOPH SCHWENNICKE<br />
100 | DIE QUADRATUR DER KÜGELCHEN<br />
Wenn Roboter anthroposophische<br />
Heilmittel herstellen. Ein Fabrikbesuch<br />
VON STEFAN TILLMANN<br />
106 | KULTURSCHWINDEL<br />
Ackermann, die Majestäten der<br />
Deutschen Bank und ihre Feigheit<br />
VON FRANK A. MEYER<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 5
C I C E R O | I N H A L T<br />
CICERO ONLINE<br />
112 Richard Wagner<br />
2013 jährt sich zum 200. Mal<br />
der Geburtstag Richard Wagners.<br />
Deshalb wird das Rückenbild der<br />
<strong>Cicero</strong>-Ausgaben von 2013 den<br />
Komponisten zeigen, Heft für Heft<br />
wird sich sein Konterfei zusammen<br />
setzen. Einen analytischen Vergleich<br />
mit Guiseppe Verdi, einem anderen<br />
Jahrhundert-Künstler finden Sie<br />
in dieser Ausgabe auf Seite 112<br />
MEINUNGSSTARK:<br />
WAHLEN, WÄHLER UND<br />
INTRIGEN<br />
Immer montags schreibt<br />
Online-Ressortleiter<br />
Christoph Seils in seiner<br />
Kolumne über die Parteien<br />
und ihren täglichen<br />
Überlebenskampf.<br />
WWW.CICERO.DE/KOLUMNEN/<br />
CHRISTOPH-SEILS<br />
SALON<br />
108 | HEUTE EIN KÖNIG<br />
Sabin Tambrea spielt in einer<br />
Neuverfilmung Ludwig II von Bayern<br />
VON IRENE BAZINGER<br />
138 | BIBLIOTHEKSPORTRÄT<br />
<strong>Die</strong> private Bücherwand des Direktors<br />
der Anna-Amalia-Bibliothek<br />
VON EVA GESINE BAUR<br />
AKTUELL:<br />
NIEDERSACHSEN WÄHLT<br />
In Niedersachsen wird am<br />
20. Januar 2013 ein neuer<br />
Landtag gewählt. Bei <strong>Cicero</strong><br />
Online lesen Sie, wer bei der<br />
Wahl triumphiert und warum.<br />
WWW.CICERO.DE<br />
110 | OHNE PATHOS KEIN LEBEN<br />
Krassimira Stoyanova ist die große<br />
Unbekannte der Opernwelt<br />
VON EVA GESINE BAUR<br />
112 | DIE SOUNDWERKER EUROPAS<br />
Warum die politische Vereinnahmung<br />
von Verdi und Wagner töricht ist<br />
VON AXEL BRÜGGEMANN<br />
120 | MAN SIEHT NUR, WAS MAN SUCHT<br />
Clemens von Wedels Bilder mit der<br />
Mailbox-Nachricht Christian Wulffs<br />
VON BEAT WYSS<br />
124 | DIE EWIGEN ZOMBIES<br />
Warum Led Zeppelin, die Stones und<br />
Neil Young heute noch Erfolg haben<br />
VON ARNE WILLANDER<br />
126 | DIE LETZTEN TAGE VOR DEM STURM<br />
Im Jahr 1913 öffnete sich die<br />
Tür zu einer neuen Zeit<br />
VON KONSTANTIN SAKKAS<br />
134 | BENOTET<br />
Wie Rostropowitsch eine Komposition<br />
von Benjamin Britten bekam<br />
VON DANIEL HOPE<br />
137 | KÜCHENKABINETT<br />
Der gesellschaftliche Wandel ist jetzt<br />
auch beim Dessert angekommen<br />
VON JULIUS GRÜTZKE UND THOMAS PLATT<br />
142 | DAS SCHWARZE SIND<br />
DIE BUCHSTABEN<br />
Neue Literatur über den<br />
Narzissmus der Deutschen<br />
VON ROBIN DETJE<br />
144 | DIE LETZTEN 24 STUNDEN<br />
<strong>Die</strong> finale Broadway-Show und ein<br />
Abgang in der Gospel-Messe<br />
VON THOMAS HERMANNS<br />
Standards<br />
ATTICUS —<br />
Von Christoph Schwennicke — SEITE 3<br />
STADTGESPRÄCH — SEITE 8<br />
FORUM — SEITE 12<br />
IMPRESSUM — SEITE 45<br />
POSTSCRIPTUM —<br />
Von Alexander Marguier — SEITE 146<br />
<strong>Die</strong> nächste <strong>Cicero</strong>-Ausgabe<br />
erscheint am 24. Januar 2013<br />
Einer wird in Niedersachsen<br />
gewinnen: Ministerpräsident David<br />
McAllister (CDU, links) oder sein<br />
Herausforderer Stephan Weil (SPD)<br />
UNTERHALTSAM:<br />
20 GRÜNDE …<br />
Warum brauchen wir<br />
Tageszeitungen? Warum<br />
nerven Ökobürger? Warum<br />
sollten Politiker nicht<br />
twittern. Es gibt immer ein<br />
paar Gründe, irgendetwas<br />
aufzuspießen. <strong>Die</strong> Kultserie<br />
bei <strong>Cicero</strong> Online.<br />
WWW.CICERO.DE/<br />
DOSSIER/20-GRUENDE<br />
AUSBLICK:<br />
WAS BRINGT DAS NEUE JAHR?<br />
Im September 2013 wird ein<br />
neuer Bundestag gewählt.<br />
Stürzt Merkel über den Euro?<br />
Übernimmt Rot-Rot-Grün<br />
die Macht? Verliert die CSU<br />
in Bayern? <strong>Cicero</strong> Online<br />
wagt den etwas anderen<br />
Blick in die Zukunft.<br />
WWW.CICERO.DE/AUSBLICK2013<br />
ILLUSTRATION: CHRISTOPH ABBREDERIS; FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA; RÜCKENBILD CICERO 2013: PRISMA/UNIVERSAL HISTORY ARC<br />
6 <strong>Cicero</strong> 1.2013
C I C E R O | S T A D T G E S P R Ä C H<br />
HANNELORE KRAFT versucht sich als filmende Ulknudel, Peer Steinbrück entdeckt<br />
Andrea Nahles’ Stärken, die Bundespressekonferenz verschickt eine Steuer-CD,<br />
die Zahl der Euro-Gläubigen sinkt, und Papst Benedikt XVI twittert jetzt<br />
ROLLENTAUSCH:<br />
ULKNUDEL KRAFT<br />
D<br />
IE ROLLENVERTEILUNG zwischen<br />
Politik und Medien ist eigentlich<br />
klar. <strong>Die</strong> einen berichten,<br />
über die anderen wird berichtet. Kürzlich<br />
hat nun Hannelore Kraft einen Rollentausch<br />
versucht. <strong>Die</strong> Ministerpräsidentin<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen drehte<br />
den Spieß um und selbst einen Film –<br />
über den ZDF-Humoristen Oliver Welke.<br />
Der pflegt in seiner „heute-show“ Politiker<br />
zu veräppeln. Er zeigt dann kleine Filmchen,<br />
auf denen man Bundestagsabgeordnete<br />
oder Minister sieht, die im Plenarsaal<br />
gähnen, popeln oder auf dem iPad Kreuzworträtsel<br />
lösen. Das Ganze nennt sich „Satire“<br />
und wird jeden Freitagabend mit hohen<br />
Einschaltquoten gesendet.<br />
Weil sie das spaßig fand, hat die Große<br />
Karnevalsgesellschaft der Stadt Mülheim<br />
dem Komiker den diesjährigen Satirikerpreis<br />
„Spitze Feder“ verliehen. Hannelore<br />
Kraft wiederum, die den Preis im vorigen<br />
Jahr bekommen hatte und deshalb die Laudatio<br />
auf Welke halten musste, hatte die<br />
Idee, ihre Rede in Form einer selbst produzierten<br />
„heute-show“ vorzutragen. In<br />
den Berliner Redaktionsräumen der Rheinischen<br />
Post fand sie die ideale Bühne für<br />
ihren Auftritt als Fernsehreporterin.<br />
Hier nämlich steigt jedes Jahr im November<br />
eine der wichtigen Polit-Partys in<br />
der Hauptstadt. Auf engstem Raum tummeln<br />
sich – und zwar immer ein paar Tage<br />
vor dem Bundespresseball – Minister, Lobbyisten,<br />
Journalisten und Bundestagsabgeordnete.<br />
Das Kabinett ist fast immer komplett<br />
vertreten und die Großkopferten der<br />
Opposition natürlich auch. Man steht beieinander,<br />
schwätzt, isst und trinkt.<br />
Dort also erschien Frau Kraft mit ihrer<br />
privaten Kamera und begann die Gäste zu<br />
filmen und zu interviewen. Erst befragte sie<br />
Bildungsministerin Annette Schavan, später<br />
ihren Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel,<br />
dann den FDP-Vorsitzenden Philipp Rösler,<br />
die Obergrüne Katrin Göring-Eckardt,<br />
den Chef des ARD-Hauptstadtstudios Ulrich<br />
Deppendorf und zum Schluss auch<br />
Bundeskanzlerin Angela Merkel. An alle<br />
richtete sie dieselbe Frage: „Wie finden<br />
Sie es eigentlich, dass dem ZDF-Moderator<br />
Oliver Welke in diesem Jahr die „Spitze<br />
Feder“ verliehen worden ist.“<br />
Tja, wie fand man das? Man fand<br />
Welke „immer für eine Überraschung gut“<br />
(Merkel) und „klasse, besonders wenn<br />
er über mich herfällt“ (Gabriel), „seine<br />
Witze nicht immer gelungen, aber hochpolitisch“<br />
(Rösler) und die Auszeichnung<br />
einfach „Spitze“ (Schavan). Obwohl der<br />
nervige Spaßvogel sie alle schon mal lächerlich<br />
gemacht hat, wollte niemand<br />
es ihm richtig heimzahlen. Alle tranken<br />
den Kakao, durch den er sie gezogen hat –<br />
kreuzbrav und politisch korrekt. Dadurch<br />
bekommt der Film der Ulknudel Kraft<br />
über den Blödel-Moderator Welke eine<br />
unverhoffte Komik. Wahrscheinlich ist er<br />
auch deshalb ein Renner im Netz geworden.<br />
hp<br />
(Das Video unter: www.cicero.de/kraft)<br />
SPD-SPITZEN<br />
STEINBRÜCKS FLAMME<br />
Z<br />
UNEIGUNG UND Antipathie, sagen<br />
die Verhaltensforscher, stellen<br />
sich in den ersten paar Minuten<br />
ILLUSTRATIONEN: CORNELIA VON SEIDLEIN<br />
8 <strong>Cicero</strong> 1.2013
EINE WEGBEREITERIN,<br />
DIE AUF ANDERE ZUGEHT.<br />
INTERKULTURELLE ZUSAMMENARBEIT FÖRDERN.<br />
Mehtap-Buesra Mut weiß aus eigener Erfahrung, dass das<br />
Leben und Arbeiten in einer fremden Kultur mit Herausforderungen<br />
verbunden ist. Als eine von über 45 freiwilligen<br />
Gesundheitsbotschaftern im BMW Werk in München, in dem<br />
Menschen aus mehr als 50 Nationen zusammenarbeiten,<br />
spricht Mehtap deshalb gezielt Kolleginnen und Kollegen<br />
aus anderen Kulturkreisen an. Denn ihr ist aufgefallen,<br />
dass gerade sie Angebote zur gesundheitlichen Vorsorge<br />
weniger nutzen. Das liegt zum Teil an unterschiedlichen<br />
kulturellen Mentalitäten, oder auch schlicht an Verständigungsproblemen.<br />
Der Erfolg gibt ihr recht: Seit Einführung<br />
der Gesundheitsbotschafter ist die Beteiligung an Aktionen<br />
des Gesundheitsmanagements und der BMW BKK um 20 %<br />
gestiegen. Mehr Gesundheit durch mehr Verständigung.<br />
<strong>Die</strong> BMW Group ist zum achten Mal in Folge<br />
nachhaltigster Automobilhersteller der Welt.<br />
Erfahren Sie mehr über den Branchenführer<br />
im Dow Jones Sustainability Index auf<br />
www.bmwgroup.com/whatsnext<br />
Jetzt Film ansehen.
C I C E R O | S T A D T G E S P R Ä C H<br />
des Kennenlernens ein und halten dann<br />
ein Leben lang. Bisher bewahrheitete sich<br />
diese wissenschaftliche These auch bei Peer<br />
Steinbrück und Andrea Nahles. Wann immer<br />
der heutige SPD-Kanzlerkandidat in<br />
den vergangenen Jahren den Namen der<br />
Parteifreundin hörte, konnte man entweder<br />
Zeuge seines sehr feinen englischen Humors<br />
werden oder einfach nur miterleben,<br />
wie der Mann lästern kann. Einmal hat er<br />
sogar öffentlich gesagt, sein Leben sei ohne<br />
die Nahles genauso reich. Dafür hat er sich<br />
inzwischen nicht nur öffentlich entschuldigt:<br />
Er flötet im Hintergrund nachgerade<br />
über die Generalsekretärin der Partei, mit<br />
der er Bundeskanzler werden will: Fähig,<br />
verlässlich, hat was auf dem Kasten. Manche<br />
in der SPD erklären sich diese späte<br />
Zuneigung Steinbrücks mit dem Eindruck,<br />
den der Kandidat von anderen SPD-Spitzen<br />
gewonnen hat. Gemessen daran sei ihm<br />
Nahles dann regelrecht ans Herz gewachsen.<br />
swn<br />
NOCH EINE STEUER-CD:<br />
SCHOCK NACH DEM BALL<br />
D<br />
AS WAR WIRKLICH eine hübsche<br />
Idee der Kollegen, die jedes Jahr<br />
zum Presseball den sogenannten<br />
„Almanach“ gestalten. Der „Almanach“ hat<br />
eine inzwischen 60-jährige Tradition, die<br />
ersten Exemplare aus den fünfziger Jahren<br />
werden längst als antiquarische Kostbarkeiten<br />
gehandelt. Über die Jahre wurde<br />
das Heft immer dicker und glänzender,<br />
inzwischen ist es 146 Seiten stark, eine<br />
bunte Mixtur – halb Titanic, halb Pardon –<br />
mit vielen Cartoons, Fotomontagen und<br />
fröhlichen Geschichten aus dem Berliner<br />
Politik-Betrieb. Natürlich hat jedes Heft<br />
sein Titelthema. <strong>Die</strong>smal hatte die Redaktion<br />
das Schweizer Steuerabkommen im<br />
Visier. Der Umschlag war in den Farben<br />
Schwarz, Rot, Gold gehalten, und in der<br />
Mitte, also im roten Feld, klebte eine rote<br />
CD mit weißem Schweizer Kreuz. Darauf<br />
stand (wie mit einem Filzstift gekritzelt)<br />
„Konten Gäste Bundes Presseball 2012“.<br />
Und darunter im gelben Feld: „Ihr seid<br />
alle Sünder.“ <strong>Die</strong> Scheibe war aber nicht<br />
wirklich festgeklebt, sondern wurde nur<br />
lose von einem runden Stück Filz gehalten.<br />
Und sobald man das Heft öffnete,<br />
fiel sie ab. Darunter stand: „Lieber Ball-<br />
Gast. Vermissen Sie hier die Steuer-CD<br />
mit Ihrem Schwarzgeldkonto? Dann ist<br />
sie schon auf dem Weg zu Ihrem Finanzamt.<br />
Sorry.“<br />
Wenn man die Scheibe dann in ein CD-<br />
Laufwerk steckt, kann man sich elektronisch<br />
durch den Heftinhalt blättern. Dass<br />
das satirische Werk auch in diesem Jahr erst<br />
post festum verschickt wurde, war eine besonders<br />
nette Geste. Keinem der festlich<br />
gekleideten Damen und Herren sollte der<br />
Spaß am Feiern verdorben werden.<br />
Der Schock kam erst nach dem Ball.<br />
Reiner Zufall aber war es, dass das Tanzvergnügen<br />
in diesem Jahr genau an dem<br />
Freitag stattfand, an dem der Bundesrat<br />
endgültig den Daumen über das zwischen<br />
Berlin und Bern fertig ausgehandelte Abkommen<br />
gesenkt hatte, das allen Steuerhinterziehern<br />
gegen ein geringes Entgelt<br />
Straffreiheit verschafft hätte. Aber auch das<br />
passte zum Heft, als wäre es so von Anfang<br />
an geplant gewesen. hp<br />
MODERNER VATIKAN:<br />
BENEDIKT XVI TWITTERT<br />
S<br />
CHON ERSTAUNLICH: Zum Papstbesuch<br />
in Rom durfte der deutsche<br />
Bundespräsident seine Freundin<br />
nicht mitbringen – das päpstliche Protokoll<br />
ließ es nicht zu. Gleichzeitig aber gab<br />
der Heilige Vater sich ganz fortschrittlich.<br />
Wohldosiert öffnet er sich der Moderne –<br />
auf 140-Zeichen-Basis. Der Papst hat einen<br />
Vogel. Oder besser: ein Vögelchen. Er<br />
zwitschert. Benedikt XVI ist seit neuestem<br />
digital – @Pontifex, um genau zu sein –<br />
und twittert göttlichen Segen via Internet.<br />
Irgendwie praktisch, dann können die Sünden<br />
gleich verlinkt werden.<br />
Noch bevor der Heilige Vater überhaupt<br />
ein einziges Zeichen, eine einzige<br />
päpstliche Silbe in die Virtualität entließ,<br />
folgten ihm bereits über eine halbe Million<br />
zwitschernde Schäfchen auf Twitter.<br />
Rekord! Wer seine Fragen direkt an Joseph<br />
Aloisius Ratzinger richten möchte, bedient<br />
sich des Schlagworts beziehungsweise<br />
„Hashtags“ #askpontifex und öffnet den direkten<br />
Kanal nach oben. Greg Burke, Medienberater<br />
des Papstes, versicherte denn<br />
auch sichtlich stolz: „Alle Tweets des Papstes<br />
sind die Worte des Papstes.“ ts<br />
SCHWÄCHE DES EURO –<br />
NUR EINE MEDIENKRISE?<br />
E<br />
S GIBT SIE TATSÄCHLICH noch: die<br />
unerschütterlichen Euro-Verteidiger.<br />
Zu dieser vielleicht schon<br />
bald vom Aussterben bedrohten Spezies<br />
gehört Elmar Brok (CDU). Der EU-Parlamentarier<br />
erklärte unlängst bei einer<br />
Podiumsdiskussion in Berlin, dem Euro<br />
und der Eurozone gehe es hervorragend.<br />
<strong>Die</strong> weltweite Euroskepsis könne er daher<br />
überhaupt nicht verstehen. In Wahrheit<br />
sei die Krise eine Erfindung der Medien.<br />
Vor allem der angelsächsischen. Sie<br />
allein seien schuld am schlechten Image<br />
des Euro, sagte der Vorsitzende des Ausschusses<br />
für Auswärtige Angelegenheiten<br />
des Europäischen Parlaments. Da sich die<br />
internationale Finanzwelt an englischsprachigen<br />
Medien orientiere und diese ja bekanntermaßen<br />
euroskeptisch seien, wirke<br />
sich das entsprechend negativ aus. Es sei<br />
daher höchste Zeit, eine publizistische Gegenoffensive<br />
zu starten. Nur noch deutsche<br />
Blätter lesen? Das hilft nicht weiter. Denn<br />
auch hierzulande sinkt die Zahl der Euro-<br />
Gläubigen, während die der Gläubiger dramatisch<br />
steigt. jh<br />
ILLUSTRATIONEN: CORNELIA VON SEIDLEIN<br />
10 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Auch in 40'000 Fuss<br />
noch atemberaubend.<br />
«Siehst du das?»<br />
Spitfire Chronograph. Ref. 3878: Vorbeiziehende Küsten, von<br />
Sonnenlicht durchbrochene Wolken – auch Piloten von Jagdflugzeugen<br />
bekommen einige schöne Dinge zu sehen, die einem den<br />
Atem stocken lassen. In der Glaskanzel einer Spitfire hatten sie dafür<br />
auch die perfekte Sicht. Ähnlich beeindruckend gestaltet sich der<br />
Blick auf Ihre IWC Spitfire Chronograph – mit mechanischem Flyback<br />
Chronographen, 43mm grossem Gehäuse und Alligatorleder-Armband<br />
auch am Boden ein beneidenswerter Anblick. IWC. Engineered for men.<br />
Mechanisches Chronographenwerk | Automatischer Aufzug |<br />
Gangreserve nach Vollaufzug 68 Stunden | Datumsanzeige |<br />
Stoppfunktion Minute und Sekunde | Flybackfunktion |<br />
Kleine Sekunde mit Stoppvorrichtung | Doppelklinkenaufzug<br />
(Bild) | Verschraubte Krone | Saphirglas, gewölbt,<br />
beidseitig entspiegelt | Wasserdicht 6 bar | 18 Kt. Rotgold<br />
IWC Schaffhausen. Deutschland: +49 89 55 984 210. Schweiz: +41 52 635 63 63. Österreich: +43 1 532 05 80 51. www.iwc.de
C I C E R O | L E S E R B R I E F E<br />
FORUM<br />
Über Gott und die Welt, Hitler und die Homöopathie<br />
ZU CICERO I NSGES AMT, OH N E BE ZUG<br />
AU F EIN EN BES TIMMTEN BEITR AG,<br />
ERREICHTE UNS DIES ER BRIEF AU S<br />
H AMBURG:<br />
GLOCKEN-<br />
GELÄUT<br />
Aufgrund Ihres Namens hätte ich noch nicht einmal in ein Heft hineingeschaut,<br />
geschweige denn, es gekauft. Meine Schwiegertochter hat mich auf <strong>Cicero</strong> aufmerksam<br />
gemacht, und ich bin sofort Abonnent geworden. Sie brauchen nicht<br />
rot zu werden ob des Lobes. Auch der liebe Gott hört es gern, wenn für ihn die<br />
Glocken läuten. Mir gefallen die geistreichen, spritzigen, kaum verletzenden<br />
Formulierungen. Es wird nicht mit dem Säbel gerasselt, sondern mit dem Florett<br />
punktgenau getroffen. Wie früher zu meiner aktiven Zeit, ich bin Jahrgang 1935,<br />
Schmidt-Schnauze contra Strauß, wobei beide hochintelligent sind, Strauß aber<br />
Bayer war. Das, was früher in meinem Jungbullenalter der Spiegel für mich war,<br />
wird wohl <strong>Cicero</strong> werden – auch aufgrund der Eleganz der Formulierungen, hoffentlich<br />
auch wegen gründlicher Recherchen.<br />
Heinrich Barthel, Hamburg<br />
ZUM ARTIK EL „MEHR RELIGIO N<br />
WAGEN“ VON ALEX A N DER KISSLER/<br />
D E ZEMBER 2012<br />
FREI ZU GOTT? UNMÖGLICH<br />
Um die philosophische Tiefe der<br />
kryptischen Aussage „Es gibt keinen<br />
Gott, außer in der Freiheit“ auszuloten,<br />
mangelt es mir an zureichenden Geistesgaben.<br />
Nachvollziehbar war, was für<br />
den Verfasser ein Gott ist, ob dieser nun<br />
durch einen Elefantenrüssel Süßigkeiten<br />
aufnimmt oder Menschen mit Vernunft<br />
begabt. Aber was verstand in diesem<br />
Zusammenhang Alexander Kissler<br />
unter „Freiheit“? Doch wohl nicht, erst<br />
einmal „vernünftig zu denken“, um sich<br />
danach zu einer religiösen Überzeugung<br />
„frei“ entscheiden zu können. Es<br />
gibt gewiss Menschen, die nach einem<br />
„Damaskuserlebnis“, einer dramatischen<br />
Krankheits- oder Traumerfahrung zum<br />
Glauben an Gott, Engel oder ein Leben<br />
nach dem Tode gelangten … Doch zu<br />
einem religiösen Bekenntnis aufgrund<br />
eigener, vorurteilsfreier rationaler Überlegungen<br />
zu gelangen, ist schlechthin<br />
nicht möglich.<br />
Ernst-Gust Krämer, Kalletal<br />
RESPEKTLOSER UMGANG<br />
Den Artikel empfinde ich als respektlosen<br />
und überheblichen Umgang eines<br />
Anhängers einer Religion gegenüber<br />
Nichtgläubigen. Ich selbst unterliege<br />
nicht einem „Irrglauben an die Ökonomisierbarkeit<br />
aller Lebensbezüge“ und<br />
„rufe nicht das Ich zum unumschränkten<br />
Herrscher, dessen Willen sich die Welt<br />
zu fügen habe“ aus. So wie mir wird es<br />
vielen anderen gehen, die nicht Anhänger<br />
einer Religion sind.<br />
<strong>Die</strong> Vorstellung, zu kritisierende<br />
Zustände der Welt seien Folge mangelnder<br />
Gottgläubigkeit, deutet auf die<br />
Selbstüberhebung eines Gläubigen hin.<br />
Eckehard Rüther, Hamburg<br />
SEHR ENTLARVEND<br />
Herr Kissler gibt in seinem Artikel selbst<br />
ein Musterbeispiel, warum sich viele<br />
Menschen von den Religionen wegen<br />
ihrer Intoleranz abwenden. „Profilneurotiker<br />
… abschaffen, verfolgen, verunglimpfen,<br />
zensieren …“ Kennen wir das<br />
nicht schon alles aus der Religionsgeschichte?<br />
<strong>Die</strong>ser Hass gegen Nichtreligiöse!<br />
Von der von ihm propagierten<br />
Demut keine Spur. Sehr entlarvend!<br />
Bruno Rodenbüsch, Bayerbach<br />
ZUM BEITR AG „COP YRIGHT AU F<br />
EIN TABU“ VON PHILIPP BLO M U N D<br />
„HITLERS LETZ TE BOMBE, WARUM<br />
H ITLERS ‚ M EIN KAMPF‘ F R EIG EGEBEN<br />
W ERDEN M USS“ / N OVEMBER 2012<br />
BRILLANT UND SCHLÜSSIG<br />
Philipp Blom zeichnet einen brillant<br />
schlüssigen Appell, die Last der Verantwortung<br />
für die Gräueltaten des Holocaust<br />
der gesamten deutschen Gesellschaft<br />
unter demokratisch legitimierter<br />
NS-Regierung zuzuordnen, und fordert<br />
zu Recht einen offenen Zugang zur<br />
Nazi-Literatur, inklusive „Mein Kampf“.<br />
Sein Vergleich von Holocaust-Leugnern<br />
ILLUSTRATION: CORNELIA VON SEIDLEIN<br />
12 <strong>Cicero</strong> 1.2013
ÜBERZEUGT DAVON, DASS<br />
ER 1951 DEN RICHTIGEN<br />
GESCHMACK BEWIESEN HAT.<br />
NICHTS FÜR UNENTSCHLOSSENE. SEIT 1842.
C I C E R O | L E S E R B R I E F E<br />
R ÜCKBLICK<br />
ZU BESUCH BEIM ALTEN RÖMER<br />
In der 100. Ausgabe lud <strong>Cicero</strong> Leserinnen und Leser zu<br />
einer Werkstattschau ein. <strong>Die</strong> Gäste kamen und sahen<br />
<strong>Die</strong> Redakteure fest im Blick und ganz Ohr: Lutz Quester, Hans und Christa<br />
Wallau, David Meuresch und Marie Kirchner (v. l.) beim <strong>Cicero</strong>-Besuch in Berlin<br />
Im August-Heft bedankte sich <strong>Cicero</strong><br />
bei seinen Lesern mit einer Einladung:<br />
Wer wollte, konnte uns kennenlernen,<br />
eine Redaktionssitzung miterleben,<br />
mit dem Chefredakteur angeln<br />
gehen oder unserem Illustrator bei der<br />
Arbeit über die Schulter schauen. Von<br />
den vielen Hundert Interessenten hatten<br />
etwa drei Dutzend das Losglück<br />
und kamen nach Berlin. Unser durchgängiger<br />
Eindruck aus den Gesprächen:<br />
Wir sind froh über unsere Leser.<br />
Das machen wir wieder. Nicht erst in<br />
100 Monaten. swn<br />
mit Kreationisten unter dem Dach fanatischer<br />
Ewiggestriger fällt allerdings als<br />
überraschende Entgleisung vollständig<br />
aus dem Rahmen seiner ansonsten so<br />
scharfen Analyse. Weil sowohl Evolutionstheorie<br />
als auch Schöpfungslehre<br />
ihren Wahrheitsanspruch wissenschaftlich<br />
auf gleichermaßen unvollständigen<br />
wie umstrittenen Beweisen aufbauen,<br />
setzen beide einen Glauben voraus. Und<br />
gerade von der Glaubensfrage distanziert<br />
Blom sich in seiner historisch ordentlich<br />
nachvollziehbaren Entkräftung der<br />
Aussagen der Holocaust-Leugner. Ohne<br />
Beim Meister in der Werkstatt: Kerstin<br />
Voigt und Frank Bossmann im Gespräch<br />
mit <strong>Cicero</strong>-Illustrator Wieslaw Smetek<br />
diesen irritierenden und ein wenig subtil<br />
ideologischen Bezug wäre ihm beinahe<br />
eine vollständige Objektivierung<br />
gelungen.<br />
Matthias Schultz, Bremen<br />
GEIST IN DER FLASCHE<br />
Solange sich eine Person des öffentlichen<br />
Lebens, wie in diesem Falle Frau<br />
Knobloch, aufgrund ihrer bekannten<br />
politischen Ansichten zu diesem und<br />
ähnlich gelagerten Themen derart schützen<br />
muss, ist offensichtlich, wie tief die<br />
faschistische Ideologie hierzulande noch<br />
verwurzelt ist … <strong>Die</strong> Empfänglichkeit<br />
für rassistisch eingefärbte, populistische<br />
Thesen ist nicht erst mit den Platzierungen<br />
von Herrn Sarrazins Werken in den<br />
Bestsellerlisten offenkundig geworden …<br />
<strong>Die</strong> endlos peinliche Serie von Unwillen<br />
und/oder Unfähigkeit bei der Aufklärung<br />
der Verbrechen des NSU zeigt<br />
anschaulich den Stand der Auseinandersetzung<br />
mit den gesellschaftlichen Fakten,<br />
die aus der Existenz dieser Ideologie<br />
hervorgegangen sind.<br />
Ob dem Wegbereiter der größten<br />
Katastrophe in der deutschen<br />
Geschichte und seinem Werk jetzt oder<br />
später eine erneute Plattform – quasi<br />
mit dem Siegel gesellschaftlicher<br />
Akzeptanz – gegeben werden sollte, die<br />
Erfahrungen mit Wahlergebnissen unter<br />
anderem in Deutschland, Österreich<br />
und Frankreich warnen uns eindringlich,<br />
den (Un-)Geist lieber in der Flasche<br />
zu lassen.<br />
Johannes Mörlein, Gera<br />
RAUS AUS DER NAZI-ECKE<br />
Ich verstehe nicht, warum „Mein<br />
Kampf“ nicht vollständig und vor allem<br />
unbearbeitet veröffentlicht werden soll.<br />
Wir wurden in der Schule und<br />
werden im, fast täglichen, politischen<br />
Leben damit konfrontiert, wie schlecht<br />
wir waren und dass das Täterblut immer<br />
noch an uns klebt und in uns ist … Aber<br />
haben wir nicht dennoch ein Anrecht,<br />
auf die Zeiten davor und danach stolz<br />
sein zu dürfen? Stolz, ein(e) Deutsche(r)<br />
zu sein! Warum lassen wir uns immer<br />
wieder einreden, dass wir schlecht und<br />
grausam sind, sobald wir sagen, dass<br />
es toll ist, Deutsche(r ) zu sein? … Wir<br />
haben Gutenberg, Luther, Beethoven,<br />
Schiller und Goethe, wir haben Widerstandskämpfer<br />
in unserer Geschichte<br />
und sind heute einer der Exportweltmeister.<br />
Unsere Ingenieure sind weltweit<br />
anerkannt. Ist das kein Grund, darauf<br />
stolz zu sein? Das hat mir in Ihren<br />
FOTOS: ANDREJ DALLMANN, CICERO<br />
14 <strong>Cicero</strong> 1.2013
C I C E R O | L E S E R B R I E F E<br />
Artikeln gefehlt: die differenzierte<br />
Aus einandersetzung mit deutschem<br />
Nationalstolz, ohne gleich ein Nationalsozialist<br />
sein zu müssen … Meiner Meinung<br />
nach ist dies nur möglich, wenn<br />
wir uns vollständig unserer Vergangenheit<br />
bewusst sind. Uns bringt man<br />
bei, sich in der Ecke stehend für Fehler<br />
zu schämen, für die wir nichts können.<br />
Aber die Chance, aus Fehlern zu lernen<br />
und ihre Ursprünge zu verstehen, gibt<br />
man uns nicht. Dazu würde auch die<br />
unkommentierte Veröffentlichung von<br />
„Mein Kampf“ gehören. Ich denke, es<br />
ist an der Zeit zu beweisen, dass man<br />
vollmündig ist: mit eigenem Sachverstand<br />
und Reflexion selbst beurteilen,<br />
selbst entscheiden und besonders selbst<br />
seine Vergangenheit und die damals<br />
damit verbundenen Fehler verstehen zu<br />
können. Nur so lernt man. Nicht, indem<br />
man in die Ecke verwiesen wird und nie<br />
wieder da heraus darf.<br />
Kathrin S. Winkelmann (29), Ravensburg<br />
ZU DEN KO LUMNEN VON AMELIE<br />
FRIED „MUTTER-MYTHOS“ UND<br />
„HOM ÖOPATHIE“/ DE ZEMBER UND<br />
N OVEMBER 2012<br />
DER MYTHOS LEBT<br />
Man mag zu der Debatte um die Definition<br />
der familienbewussten Frau stehen,<br />
wie man will, und Anlass, eine solche<br />
anzustoßen, gibt es dank der Einführung<br />
des Betreuungsgeldes genug. Trotz<br />
alledem erscheint mir der Beitrag von<br />
Amelie Fried dramatisch unangemessen<br />
und nicht zeitgemäß. Frau Fried fragt<br />
abschließend, ob der Gute-Mutter-<br />
Mythos denn nie aussterbe. <strong>Die</strong> Antwort<br />
darauf ist denkbar einfach. Nein,<br />
nie, und das ist auch gut so. Denn die<br />
Familie ist der Nukleus der Gesellschaft,<br />
und dieser Nukleus beginnt auseinanderzufallen,<br />
wenn Frauen gegen ihre<br />
biologische Bestimmung aufbegehren<br />
und in der Männerwelt ihre vermeintliche<br />
Selbstverwirklichung suchen. Das<br />
können sie tun, das sei jeder Frau selbst<br />
überlassen. Beides gleichzeitig ist jedoch<br />
zum Scheitern verurteilt. Daher möchte<br />
ich nur davor warnen zu glauben,<br />
Emanzipation bedeute, dass man in<br />
der heutigen Gesellschaft als Frau alles<br />
haben könne.<br />
Martina Lüth (zweifache Mutter), Berlin<br />
FRECH UND PRIMITIV<br />
<strong>Die</strong>sen Brief schreibe ich mit einem<br />
inneren Auftrag für die Frauen, die ihre<br />
Kinder in den ersten drei Jahren selbst<br />
erziehen. Solche kenne ich sehr viele.<br />
<strong>Die</strong>se Frauen als trutschig zu bezeichnen,<br />
finde ich schlicht und einfach mehr als<br />
frech und primitiv.<br />
Hilde Ilg, Uhingen<br />
MERCI, AMELIE<br />
Danke für diesen schönen Artikel,<br />
endlich mal nicht so unbedingt „political<br />
correct“, der die Lage so beschreibt,<br />
wie sie ist. Als Französin (seit 40 Jahren<br />
in Deutschland lebend) kann ich<br />
nur sagen: Wann wird man endlich<br />
in Deutschland sagen können, ich bin<br />
ganz einfach eine Frau, die ihren Beruf<br />
weiter ausüben möchte, die Spaß daran<br />
hat, die sich nicht mit Pampers und<br />
Kinderrutsche und Gesprächen über<br />
den besten Hipp-Brei zufrieden gibt, die<br />
dieses – um bei der Wahrheit zu bleiben<br />
– total öde findet. Trotzdem liebe<br />
ich Kinder. <strong>Die</strong> meisten Französinnen,<br />
die nach Deutschland kommen – und<br />
ich kenne eine ganze Menge – beäugen<br />
diese deutschen Supermütter, als wären<br />
sie Menschen von einem anderen Stern,<br />
und verstehen einfach nicht, „wie die<br />
ticken“. Merci, Amelie Fried, de votre<br />
engagement pour la cause des femmes.<br />
Marie-Catherine Meyer, Düsseldorf<br />
KOMISCHE NADELN<br />
Frau Fried ist offensichtlich eine gestandene<br />
Frau mitten im Leben und spricht<br />
hier in der Tat ganz erfrischend ein<br />
aktuelles Thema an. Wir können ihren<br />
Unmut auch irgendwie nachvollziehen,<br />
obwohl uns vieles daran an die seinerzeit<br />
heftigen Diskussionen über die chinesische<br />
Akupunktur erinnert – „so ein<br />
Blödsinn“ war noch eine milde Beschreibung<br />
dieser doch „völlig unwirksamen<br />
Nadeln“. Dann jedoch gab es „schmerzfreie<br />
Operationen bei vollem Bewusstsein“,<br />
und flugs vermuteten „einige<br />
Leute vom Fach“ „Taschenspielertricks“<br />
und Schlimmeres. Inzwischen werden<br />
Akupunktur und auch sehr viel „andere<br />
komische Dinge“ sogar von vielen<br />
Kassen bezahlt; vermutlich wurde ein<br />
Nachweis der Wirksamkeit erbracht.<br />
Helga Viets und Günter Achtergang, Soltau<br />
ZUM POST S C R IPTU M „STR EIT T U T<br />
G U T “ VON ALEX A N DER MA R G U IER ,<br />
UND ZUM TITELTHEMA „STILLE<br />
M ACHT“ VON GER T RUD HÖHLER /<br />
DEZEMBER 2012<br />
ZUM HOFFEN KEIN ANLASS<br />
Für Ihr Postscriptum „Streit tut gut“<br />
danke ich Ihnen. Ihr Satz: „Hauptsache<br />
keine deutschen Fernsehkorrespondenten<br />
mehr, die mit sorgenvoller Miene …“<br />
befreite mich von dem Gefühl, allein<br />
zu sein. Zumal ich mich des Eindrucks<br />
nicht erwehren konnte, dass all diese<br />
Herren auf Romney gesetzt, ergo<br />
Obama bereits abgeschrieben hatten.<br />
Kein leichtes Unterfangen, vom Nachruf<br />
auf Deutung eines unerklärlichen<br />
Vorfalls umzuschwenken … Wenn man<br />
wenigstens ein wenig journalistische<br />
Konsequenz besäße. Wo blieb der mediale<br />
Widerspruch zu einem der markantesten<br />
Sprüche aus dem alles andere als<br />
wortgewaltigen Arsenal der Kanzlerin:<br />
„Fällt der Euro, fällt Europa.“ Wer hat<br />
da nicht den Albtraum von einem<br />
durch den Fall des Euro hervorgerufenen<br />
Tsunami, der den alten Kontinent<br />
von der Landkarte tilgt? Wenigstens<br />
da bestand die einmalige Chance, die<br />
verschwiegene Kanzlerin einmal beim<br />
Wort zu nehmen, denn – dafür ist<br />
besonders zu danken – die „Stille Macht“<br />
war ein außerordentlich erhellendes<br />
Thema, auch wenn es keinen Anlass zur<br />
Hoffnung gab.<br />
Wieland Becker, Berlin<br />
(<strong>Die</strong> Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.)<br />
ILLUSTRATIONEN: CORNELIA VON SEIDLEIN<br />
16 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Mehr unter www.porsche.de oder Tel. 01805 356 - 911, Fax - 912 (Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise max. 42 ct/min).<br />
Anpassung ist keine Strategie,<br />
die Sie weiterbringt.<br />
Der neue Cayman.<br />
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 12,2–10,6 · außerorts 6,9–5,9 · kombiniert 8,8–7,7; CO 2<br />
-Emissionen 206–180 g/km
T I T E L<br />
DIE LISTE DER <strong>500</strong><br />
18 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Wer dringt durch? Wer wird gehört? Zum dritten Mal präsentiert<br />
<strong>Cicero</strong> eine Rangliste der <strong>Intellektuellen</strong> des deutschsprachigen<br />
Raumes. Ein Panoptikum alter Streiter und neuer Stimmen<br />
„Ein Intellektueller<br />
ist ein Mensch,<br />
dessen Geist<br />
sich selbst<br />
beobachtet“<br />
Albert Camus<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 19
T I T E L<br />
VORGEHENSW EISE<br />
DIE METHODE DES<br />
CICERO-RANKINGS<br />
<strong>Die</strong> <strong>Cicero</strong>-Liste spiegelt den geistigen<br />
Einfluss der deutschsprachigen<br />
<strong>Intellektuellen</strong> wider. Sie bildet deren<br />
öffentliche Deutungsmacht ab,<br />
misst aber keine inhaltliche Qualität.<br />
<strong>Die</strong> Erhebung bezieht sich auf<br />
die vergangenen zehn Jahre. Sie basiert<br />
1. auf der Präsenz in den 160<br />
<strong>wichtigsten</strong> deutschsprachigen Zeitungen<br />
und Zeitschriften. <strong>Die</strong>se werden<br />
über elektronische Datenbanken<br />
nach Referenzhäufigkeiten durchsucht.<br />
2. werden Zitationen im Internet<br />
ermittelt. 3. werden Treffer<br />
in der wissenschaftlichen Literaturrecherche<br />
Google Scholar gezählt.<br />
4. reflektieren Querverweise im biografischen<br />
Archiv Munzinger die Bedeutung<br />
der <strong>Intellektuellen</strong> im Networking.<br />
Aktive und Ex-Politiker<br />
wurden nicht berücksichtigt.<br />
Hinter den aktuellen Platzierungen<br />
ist die Zahl der gewonnenen oder<br />
verlorenen Positionen im Vergleich<br />
zum Rang im Jahr 2007 angegeben,<br />
als die <strong>Cicero</strong>-Liste zuletzt veröffentlicht<br />
wurde.<br />
Das aufwendige Messverfahren<br />
wurde von Max A. Höfer entwickelt,<br />
der bereits 2005 ein erstes <strong>Intellektuellen</strong>-Ranking<br />
veröffentlichte. <strong>Die</strong><br />
erste <strong>Cicero</strong>-Liste erschien 2006.<br />
„An interlectual<br />
(sic!) is a person<br />
who takes more<br />
words than<br />
necessary to tell<br />
more than they<br />
know“<br />
Schild vor einer Buchhandlung in<br />
Rockhampton, Australien<br />
1 +2 Günter Grass, Schriftsteller<br />
2 +4 Peter Handke, Schriftsteller<br />
3 -1 Martin Walser, Schriftsteller<br />
4 +5 Alice Schwarzer, Journalistin<br />
5 +2 Elfriede Jelinek,<br />
Schriftstellerin<br />
6 +4 Jürgen Habermas, Philosoph<br />
7 -2 Marcel Reich-Ranicki,<br />
Journalist<br />
8 +12 Peter Sloterdijk, Philosoph<br />
9 -8 Joseph Ratzinger, Theologe<br />
10 +8 Frank Schirrmacher,<br />
Journalist<br />
11 ±0 Hans Magnus Enzensberger,<br />
Schriftsteller<br />
12 +15 Wolfgang Huber, Theologe<br />
13 -9 Harald Schmidt, Kabarettist<br />
14 +22 Hans-Werner Sinn, Ökonom<br />
15 -1 Paul Kirchhof, Jurist<br />
16 -4 Wolf Biermann, Schriftsteller<br />
17 -4 Botho Strauß, Schriftsteller<br />
18 +16 Alexander Kluge, Publizist<br />
19 +12 Siegfried Lenz, Schriftsteller<br />
20 +19 Hans Küng, Theologe<br />
21 -13 Elke Heidenreich, Publizistin<br />
22 -3 Hans-Olaf Henkel, Ökonom<br />
23 -7 <strong>Die</strong>ter Hildebrandt,<br />
Kabarettist<br />
24 +1 Peter Stein, Theaterregisseur<br />
25 +80 Günter Wallraff, Journalist<br />
26 NEU Margot Käßmann, Theologin<br />
27 +1 Peter Schneider, Schriftsteller<br />
28 +102 Daniel Kehlmann,<br />
Schriftsteller<br />
29 +17 Guido Knopp, Historiker<br />
30 -8 Stefan Aust, Journalist<br />
31 -1 Ulrich Wickert, Journalist<br />
32 ±0 Joachim Kaiser, Journalist<br />
33 -4 Christoph Hein, Schriftsteller<br />
34 NEU Hans-Jürgen Papier, Jurist<br />
35 +31 Heribert Prantl, Journalist<br />
36 +2 Bert Rürup, Ökonom<br />
37 +57 Henryk M. Broder, Journalist<br />
38 +124 Herta Müller, Schriftstellerin<br />
39 -15 Roger Willemsen, Publizist<br />
40 +23 Ulrich Beck,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
41 +20 Durs Grünbein, Schriftsteller<br />
42 -16 Claus Peymann,<br />
Theaterregisseur<br />
43 +2 Adolf Muschg, Schriftsteller<br />
44 +10 Rainald Goetz, Schriftsteller<br />
45 +25 Benjamin von Stuckrad-Barre,<br />
Schriftsteller<br />
46 -4 Peter Scholl-Latour, Journalist<br />
47 +22 Cornelia Funke,<br />
Schriftstellerin<br />
48 ±0 Rolf Hochhuth, Dramatiker<br />
49 -28 Hellmuth Karasek, Journalist<br />
50 +3 Gesine Schwan,<br />
Politikwissenschaftlerin<br />
51 +93 Gerhard Roth, Schriftsteller<br />
52 +50 Götz Aly, Historiker<br />
53 -38 Doris Dörrie, Schriftstellerin<br />
54 +31 Bernhard Schlink,<br />
Schriftsteller<br />
55 -22 Walter Jens, Schriftsteller<br />
56 +19 Ralph Giordano, Schriftsteller<br />
57 +20 Wolfgang Franz, Ökonom<br />
58 +50 Peter Bofinger, Ökonom<br />
59 -15 Julian Nida-Rümelin,<br />
Philosoph<br />
60 +30 Uwe Timm, Schriftsteller<br />
61 -4 Jan Philipp Reemtsma,<br />
Publizist<br />
62 +295 Axel Weber, Ökonom<br />
63 +65 Feridun Zaimoglu,<br />
Schriftsteller<br />
64 +4 Volker Braun, Schriftsteller<br />
65 +19 Hans-Ulrich Wehler,<br />
Historiker<br />
66 +57 Bernd Ulrich, Journalist<br />
67 NEU Charlotte Roche, Schriftstellerin<br />
68 -6 Gerhard Polt, Kabarettist<br />
69 +118 Claus Leggewie,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
70 +97 Fritz J. Raddatz, Journalist<br />
71 -6 Patrick Süskind, Schriftsteller<br />
72 +79 Thomas Straubhaar, Ökonom<br />
73 +204 Udo Di Fabio, Jurist<br />
74 +27 Christian Kracht, Schriftsteller<br />
75 +11 Ingo Schulze, Schriftsteller<br />
76 -33 Josef Joffe, Journalist<br />
77 +191 Herfried Münkler,<br />
Politikwissenschaftler<br />
78 +28 Giovanni di Lorenzo,<br />
Journalist<br />
79 -21 Fritz Pleitgen, Journalist<br />
80 +143 Necla Kelek, Publizistin<br />
81 +67 Micha Brumlik, Pädagoge<br />
82 +61 Michael Stürmer, Historiker<br />
83 +27 Ernst Ulrich von Weizsäcker,<br />
Naturwissenschaftler<br />
84 +40 Wolfgang Benz, Historiker<br />
85 +19 Stefan Klein, Publizist<br />
86 NEU Mathias Döpfner, Publizist<br />
87 NEU Andreas Voßkuhle, Jurist<br />
88 -38 Peter Härtling, Schriftsteller<br />
89 -42 Leander Haußmann, Regisseur<br />
90 -39 Frank Castorf,<br />
Theaterregisseur<br />
ILLUSTRATIONEN: WIESLAW SMETEK (SEITEN 18 BIS 21)<br />
20 <strong>Cicero</strong> 1.2013
GÜNTER GRASS<br />
Moralist, Literat, Grafiker, Dichter,<br />
Denker, Mahner und Nervensäge: Seit<br />
jeher hat Günter Grass sich ungefragt<br />
in den öffentlichen Diskurs des Landes<br />
eingemischt, oft mit treffsicherem<br />
Gespür für das Vergessene,<br />
Totgeschwiegene, mal weniger<br />
treffsicher, wie zuletzt mit seinem<br />
Israel-Gedicht „Was gesagt werden<br />
muss“. Doch dass ein paar Zeilen eines<br />
inzwischen 85-Jährigen das Land über<br />
Wochen beschäftigen können, zeigt,<br />
wie relevant der Nobelpreisträger noch<br />
immer ist.<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 21
T I T E L<br />
ALICE SCHWARZER<br />
Als „Schwanz-ab-Schwarzer“ wurde sie beschimpft, als<br />
„Hexe der Nation“. Kaum eine Frau zog in der Bundesrepublik<br />
derartig viel Häme, ja Hass auf sich wie Alice Schwarzer.<br />
Trotzdem – oder gerade deshalb – haben wenige in den<br />
letzten 40 Jahren so viel bewegt wie sie, die Galionsfigur des<br />
deutschen Feminismus, ob mit Aktionen wie ihrem Protest<br />
gegen den Paragrafen 218 oder ihrem Buch „Der kleine<br />
Unterschied“. Im Dezember ist sie 70 Jahre alt geworden.<br />
22 <strong>Cicero</strong> 1.2013
ILLUSTRATION: WIESLAW SMETEK, FOTOS: JOSEF FISCHNALLER, IZA, PICTURE ALLIANCE (3)<br />
91 +9 Florian Illies, Publizist<br />
92 +35 Christian Meier, Historiker<br />
93 +63 Thomas Mayer, Ökonom<br />
94 -22 Franz Xaver Kroetz,<br />
Dramatiker<br />
95 +94 Juli Zeh, Schriftstellerin<br />
96 +37 Franz Walter,<br />
Politikwissenschaftler<br />
97 +254 Wladimir Kaminer,<br />
Schriftsteller<br />
98 -27 Thomas Brussig, Schriftsteller<br />
99 +299 Martin Suter, Schriftsteller<br />
100 +96 Hermann Simon, Ökonom<br />
101 +35 Rüdiger Safranski, Philosoph<br />
102 +59 Hartmut von Hentig,<br />
Pädagoge<br />
103 +166 Manfred Spitzer, Psychologe<br />
104 -31 Arnulf Baring, Historiker<br />
105 NEU Miriam Meckel,<br />
Medienwissenschaftlerin<br />
106 +41 Otmar Issing, Ökonom<br />
107 -72 Jürgen Flimm,<br />
Theaterregisseur<br />
108 NEU Navid Kermani, Schriftsteller<br />
109 +135 Karl Heinz Bohrer,<br />
Schriftsteller<br />
110 +36 Wolf Lepenies,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
111 +5 Wolf Singer, Neurophysiologe<br />
112 +313 Harald Welzer,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
113 ±0 Hans Leyendecker, Journalist<br />
114 -17 Ulrich Greiner, Journalist<br />
115 +198 Ernst-Wolfgang Böckenförde,<br />
Jurist<br />
116 +65 Paul Nolte, Historiker<br />
117 +63 Hans-Peter Schwarz,<br />
Historiker<br />
118 +17 Jan Assmann,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
119 +54 Iris Radisch, Journalistin<br />
120 ±0 Matthias Horx, Publizist<br />
121 -14 Theo Sommer, Journalist<br />
122 +20 Heinrich August Winkler,<br />
Historiker<br />
123 -30 Hans Mommsen, Historiker<br />
124 -3 Meinhard Miegel,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
125 -70 Helmut Markwort, Journalist<br />
126 +102 <strong>Die</strong>ter Grimm, Jurist<br />
127 -29 Eugen Drewermann,<br />
Theologe<br />
128 +132 Anselm Grün, Theologe<br />
129 -88 Robert Leicht, Journalist<br />
130 +154 Stefan Niggemeier,<br />
Journalist<br />
131 -39 Richard Schröder, Theologe<br />
„Ein großer Geist<br />
irrt sich so gut<br />
wie ein kleiner;<br />
jener, weil er<br />
keine Schranken<br />
kennt, und dieser,<br />
weil er seinen<br />
Horizont für die<br />
Welt hält“<br />
Johann Wolfgang von Goethe<br />
<strong>Die</strong> größten Aufsteiger<br />
Gerald Hüther (+328)<br />
Der Göttinger Hirnforscher wurde durch<br />
seine populärwissenschaftlichen Schriften<br />
und zuletzt als vehementer Kritiker<br />
des deutschen Schulsystems bekannt.<br />
Klaus F. Zimmermann (+325)<br />
Der gestürzte Präsident des<br />
renommierten Wirtschaftsforschungsinstituts<br />
DIW leitet heute das Bonner<br />
Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA).<br />
Harald Welzer (+313)<br />
Lange Experte für Vergangenheitsbewältigung<br />
(„Opa war kein Nazi“), nun auch<br />
Spezialist für Zukunftsfragen („Das Ende<br />
der Welt, wie wir sie kannten“).<br />
Martin Suter (+299)<br />
<strong>Die</strong> Bücher des Ex-Werbetexters – ob<br />
über Alzheimer oder Molekularküche –,<br />
gehören inzwischen zu den <strong>wichtigsten</strong><br />
Schweizer E xportgütern.<br />
Axel Weber (+295)<br />
Ehemals pragmatischer Forscher, dann<br />
Chef der Bundesbank, heute Verwaltungsratschef<br />
der kriselnden Schweizer<br />
Großbank UBS.<br />
132 -36 Günter Kunert, Schriftsteller<br />
133 +52 Norbert Frei, Historiker<br />
134 +3 Oskar Negt, Sozialphilosoph<br />
135 +57 Jean Ziegler, Publizist<br />
136 +106 Christoph Schmidt,<br />
Ökonom<br />
137 -5 Rolf Schneider, Schriftsteller<br />
138 +7 Thomas Steinfeld, Journalist<br />
139 -65 Hans Neuenfels, Theaterautor<br />
140 -61 Christoph Marthaler,<br />
Theaterregisseur<br />
141 -60 Sven Regener, Schriftsteller<br />
142 +203 Norbert Bolz,<br />
Medienwissenschaftler<br />
143 +156 Peter von Matt, Germanist<br />
144 +24 Martin Meyer, Journalist<br />
145 NEU Reinhard Marx, Theologe<br />
146 -47 Friedrich Schorlemmer,<br />
Theologe<br />
147 -65 Wilhelm Genazino,<br />
Schriftsteller<br />
148 -37 Friederike Mayröcker,<br />
Schriftstellerin<br />
149 -69 Max Goldt, Schriftsteller<br />
150 +155 Harald Martenstein, Publizist<br />
151 -10 Urs Widmer, Schriftsteller<br />
152 +328 Gerald Hüther, Neurobiologe<br />
153 -66 Wiglaf Droste, Schriftsteller<br />
154 NEU Richard David Precht,<br />
Philosoph<br />
155 +56 René Pollesch, Dramatiker<br />
156 +54 Ruth Klüger, Schriftstellerin<br />
157 +31 Michael Hüther, Ökonom<br />
158 +62 Bernd Raffelhüschen,<br />
Ökonom<br />
159 +166 Peter Weibel, Publizist<br />
160 +203 Klaus Hurrelmann,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
161 +25 Günter de Bruyn,<br />
Schriftsteller<br />
162 -47 Axel Hacke, Schriftsteller<br />
163 +263 Hans Ulrich Gumbrecht,<br />
Schriftsteller<br />
164 +214 Friedrich Schneider,<br />
Ökonom<br />
165 +102 Martin Mosebach,<br />
Schriftsteller<br />
166 +263 Thomas Schmid, Journalist<br />
167 -18 Ernst Nolte, Historiker<br />
168 +325 Klaus F. Zimmermann,<br />
Ökonom<br />
169 -35 Ulla Hahn, Schriftstellerin<br />
170 -106 Tankred Dorst, Dramatiker<br />
171 -82 Walter Moers, Schriftsteller<br />
172 -69 Erich Loest, Schriftsteller<br />
173 -82 Sigrid Löffler, Publizistin<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 23
T I T E L<br />
174 -115 Peter Hahne, Journalist<br />
175 -15 Wolf Schneider, Publizist<br />
176 -26 <strong>Die</strong>drich <strong>Die</strong>derichsen,<br />
Publizist<br />
177 NEU Gert G. Wagner, Ökonom<br />
178 +5 Gertrud Höhler, Publizistin<br />
179 ±0 Renate Köcher,<br />
Sozialwissenschaftlerin<br />
180 +201 Axel Honneth, Philosoph<br />
181 +17 Robert Menasse, Schriftsteller<br />
182 -17 John von Düffel, Schriftsteller<br />
183 +111 Hans-Ulrich Jörges, Journalist<br />
184 NEU Julius H. Schoeps, Historiker<br />
185 +243 Jutta Allmendinger,<br />
Sozialwissenschaftlerin<br />
186 +31 Heiner Flassbeck, Ökonom<br />
187 -138 Karl Kardinal Lehmann,<br />
Theologe<br />
188 +74 Christoph Ransmayr,<br />
Schriftsteller<br />
189 NEU Patrick Bahners, Journalist<br />
190 +287 Gustav Horn, Ökonom<br />
191 +89 Hans Bertram,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
192 +169 Robert Spaemann,<br />
Philosoph<br />
193 -79 Marlene Streeruwitz,<br />
Schriftstellerin<br />
194 +81 Friedrich Wilhelm Graf,<br />
Theologe<br />
195 +180 <strong>Die</strong>ter Lenzen, Pädagoge<br />
196 -24 Jürgen Kocka, Historiker<br />
197 +92 Raoul Schrott, Schriftsteller<br />
198 -5 Ilse Aichinger, Schriftstellerin<br />
199 +8 Hans Albert, Philosoph<br />
200 +40 Sasha Waltz,<br />
Theaterregisseurin<br />
201 +24 Monika Maron,<br />
Schriftstellerin<br />
202 -33 Gustav Seibt, Journalist<br />
203 -78 Michael Wolffsohn,<br />
Historiker<br />
204 NEU Uwe Tellkamp, Schriftsteller<br />
205 -79 Klaus Harpprecht, Journalist<br />
206 +170 Rudolf Hickel, Ökonom<br />
207 NEU Hans Joachim Schellnhuber,<br />
Klimaforscher<br />
208 NEU Claudia Kemfert, Ökonomin<br />
209 +18 Hans Herbert von Arnim,<br />
Jurist<br />
210 +78 Hubertus Knabe, Historiker<br />
211 +47 Thea Dorn, Publizistin<br />
212 -35 <strong>Die</strong>tmar Dath, Journalist<br />
213 +161 Heinz Bude,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
214 +39 Winfried Hassemer, Jurist<br />
„Wenn ein<br />
wirklich großer<br />
Geist in der<br />
Welt erscheint,<br />
kann man ihn<br />
untrüglich<br />
daran erkennen,<br />
dass sich alle<br />
Dummköpfe<br />
gegen ihn<br />
verbünden“<br />
Jonathan Swift<br />
<strong>Die</strong> <strong>wichtigsten</strong> Frauen<br />
Elfriede Jelinek (5)<br />
Lange wurde die radikale österreichische<br />
Schriftstellerin skandalisiert, heute kommt<br />
kein bedeutender Theaterregisseur am<br />
Werk der Nobelpreisträgerin vorbei.<br />
Elke Heidenreich (21)<br />
Als Literaturkritikerin ist es ihr gelungen,<br />
das Lesen zum kollektiven Ereignis<br />
für das ganze Land gemacht zu haben.<br />
Herta Müller (38)<br />
<strong>Die</strong> Schriftstellerin beschreibt die<br />
Diktatur ihres Heimatlands Rumänien.<br />
2009 bekam sie den Literatur-Nobelpreis.<br />
Sie lebt heute in Berlin.<br />
Cornelia Funke (47)<br />
Mit über 20 Millionen verkauften Büchern<br />
ist die Schöpferin der „Tintenwelt-<br />
Trilogie“ eine der erfolgreichsten<br />
Jugendbuchautorinnen der Welt.<br />
Gesine Schwan (50)<br />
Heißblütige Verteidigerin der Bürgergesellschaft.<br />
Kandidierte vergeblich als<br />
Bundespräsidentin. Leitet die Humboldt-<br />
Viadrina-School of Governance in Berlin.<br />
215 +157 Gabor Steingart, Journalist<br />
216 +275 Beatrice Weder di Mauro,<br />
Ökonomin<br />
217 +124 Sibylle Berg, Schriftstellerin<br />
218 +235 Walter Krämer, Ökonom<br />
219 -11 Jürgen Kluge, Ökonom<br />
220 NEU Sascha Lobo, Blogger<br />
221 +10 Hermann Lübbe, Philosoph<br />
222 NEU Harald zur Hausen,<br />
Mediziner<br />
223 -21 Sten Nadolny, Schriftsteller<br />
224 -58 Brigitte Kronauer,<br />
Schriftstellerin<br />
225 NEU Ranga Yogeshwar, Journalist<br />
226 -35 Bodo Kirchhoff, Schriftsteller<br />
227 +246 Elmar Altvater,<br />
Politikwissenschaftler<br />
228 -28 Wolfgang Büscher,<br />
Schriftsteller<br />
229 -53 Werner Weidenfeld,<br />
Politikwissenschaftler<br />
230 NEU Seyran Ates, Publizistin<br />
231 +112 Christoph <strong>Die</strong>ckmann,<br />
Publizist<br />
232 -18 Volker Hage, Journalist<br />
233 +228 Julia Franck, Schriftstellerin<br />
234 +169 Bernhard Bueb, Pädagoge<br />
235 NEU Ferdinand von Schirach,<br />
Schriftsteller<br />
236 NEU Armin Petras, Theaterregisseur<br />
237 +71 Moritz von Uslar,<br />
Schriftsteller<br />
238 -34 Jörg Friedrich, Historiker<br />
239 -87 Michael Jürgs, Journalist<br />
240 NEU Christina von Braun,<br />
Kulturwissenschaftlerin<br />
241 +81 Horst Möller, Historiker<br />
242 +162 Matthias Matussek,<br />
Journalist<br />
243 -34 Dan Diner, Historiker<br />
244 -1 Lukas Bärfuss, Schriftsteller<br />
245 NEU Claus Kleber, Journalist<br />
246 NEU Andreas Platthaus, Journalist<br />
247 -32 Judith Hermann,<br />
Schriftstellerin<br />
248 NEU Michael Lentz, Schriftsteller<br />
249 -55 Karl-Markus Gauß,<br />
Schriftsteller<br />
250 -66 Herbert Achternbusch,<br />
Schriftsteller<br />
251 NEU Wilhelm Heitmeyer, Pädagoge<br />
252 NEU Hans Joas, Philosoph<br />
253 -113 Moritz Rinke, Schriftsteller<br />
254 +193 Klaus Schroeder, Historiker<br />
255 +40 Jens Jessen, Journalist<br />
256 -103 Salomon Korn, Publizist<br />
FOTOS: PICTURE ALLIANCE (5)<br />
24 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Verschenken Sie<br />
die große Freiheit.<br />
Buchen Sie das entspannteste Weihnachtsgeschenk<br />
der Welt:<br />
An Bord erwarten Sie ausschließlich Suiten<br />
mit Veranda und Meerblick, Ihr privater<br />
Conciergeservice und ein 1.000 m 2 Spa- und<br />
Fitnessbereich.<br />
Reservieren<br />
Sie jetzt unter:<br />
www.hlkf.de
T I T E L<br />
AUFFÄLLIGKEITEN<br />
KRISENTREMOLO<br />
Mit Günter Grass an der Spitze bestimmen<br />
die Mahner und Warner wieder den geistigen<br />
Haushalt der Nation<br />
Von Max A. Höfer<br />
Günter Grass hat es nicht verlernt. Der<br />
Mann kann provozieren, zuletzt mit<br />
seinem israelkritischen Gedicht, von<br />
dem Lästerer behaupten, dass es gar<br />
keines ist, sondern nur so aussieht.<br />
Aber auch die Versform ist wohlkalkuliert,<br />
denn sie passt zum Furor des<br />
Dichters und Denkers, der ausspricht,<br />
„was gesagt werden muss“. Kaum ein<br />
Leitartikler, der sich dazu nicht zu<br />
Wort meldet. Grass weiß, wie man<br />
eine Debatte inszeniert. Kein Wunder,<br />
dass er die Nummer 1 des <strong>Cicero</strong>-Rankings<br />
ist.<br />
Nur wenige verfügen über eine vergleichbare<br />
Wirkungsmacht. Jürgen<br />
Habermas (Platz 6) gehört zweifellos<br />
dazu. Dennoch tat er sich im Sommer<br />
mit dem Ökonomen Peter Bofinger<br />
(58) und dem Philosophen Julian<br />
Nida-Rümelin (59) zusammen, um seinem<br />
Plädoyer für einen europäischen<br />
Bundesstaat die größtmögliche Medienaufmerksamkeit<br />
zu verleihen.<br />
Ohne die Deutungsmacht eines<br />
Hans-Werner Sinn (14) hätten es<br />
die sperrigen „Target-Salden“ nie in<br />
den Bundestag und in die Schlagzeilen<br />
geschafft. Dabei geht es um offene<br />
Soll-Positionen säumiger südeuropäischer<br />
Eurostaaten in dreistelliger Milliardenhöhe,<br />
die bei der Bundesbank<br />
auflaufen. <strong>Die</strong> Berliner Politik hätte<br />
das Thema gern totgeschwiegen. Sinn<br />
hievte es nahezu im Alleingang auf die<br />
Agenda. Einem einfachen Professor für<br />
Volkswirtschaft wäre so ein Coup nie<br />
gelungen.<br />
Wer solche Debatten anstoßen<br />
kann, ist ein Schwergewicht. Das <strong>Cicero</strong>-Ranking<br />
misst die Zitationen jedes<br />
<strong>Intellektuellen</strong> über einen Zeitraum<br />
von zehn Jahren. Das ist lang genug,<br />
damit kurzfristige Medienhypes<br />
nicht das Gesamtbild<br />
verzerren, und kurz genug,<br />
um Newcomern eine<br />
Chance gegenüber den etablierten<br />
Alphatieren zu lassen.<br />
Oben kann sich nur halten,<br />
wer Substanz und Kontinuität<br />
hat. Wie ein Uhrwerk liefern Autoren<br />
wie Martin Walser (3) oder Elfriede<br />
Jelinek (5) ihre Bücher und<br />
Stücke ab und greifen Publizisten wie<br />
Alice Schwarzer (4) oder Frank Schirrmacher<br />
(10) in aktuelle Debatten ein.<br />
Aber auch Forscher wie Manfred Spitzer<br />
(103) oder Theologen wie Hans<br />
Küng (20) verdanken ihre Position ihrer<br />
großen Produktivität.<br />
<strong>Die</strong> Kehrseite ist die starke Überalterung<br />
der intellektuellen Elite. Man<br />
kann es nicht anders ausdrücken. Vieles<br />
läuft selbstreferenziell ab: Ein Peter<br />
Handke (2) kann sogar einen „Versuch<br />
über den stillen Ort“ veröffentlichen,<br />
und alle Feuilletonisten klatschen begeistert.<br />
Das Durchschnittsalter der<br />
Top 100 liegt unverändert bei 66 Jahren.<br />
Umso bemerkenswerter der Vormarsch<br />
der unter 40-Jährigen: Daniel<br />
Kehlmann auf Platz 28, Benjamin von<br />
Stuckrad-Barre auf 45 und die schrille<br />
Charlotte Roche auf 67. Auch der<br />
Frauenanteil liegt, wie 2007, wieder<br />
nur bei 13 Prozent, woran auch Margot<br />
Käßmanns sensationeller Durchbruch<br />
auf Platz 26 nichts ändert.<br />
Nichts ist gut im geistigen Deutschland,<br />
auf dessen Gipfeln immer noch<br />
die alten Patriarchen thronen.<br />
Bemerkenswert gegenüber 2007 ist<br />
der Aufstieg der Ökonomen und, im<br />
Umfang kleiner, der Juristen. Beides<br />
hat mit der Euro- und Europakrise zu<br />
tun. Überhaupt die Krise: Wenn es einen<br />
Trend gibt, dann ist es die Rückkehr<br />
der Warner und Mahner, nachdem<br />
die Optimisten 2007 kleinere<br />
Terraingewinne verzeichnen konnten.<br />
Mit Günter Grass als Vorsänger ist das<br />
Beschwören des Untergangs die Lieblingsbotschaft<br />
unserer <strong>Intellektuellen</strong>:<br />
Bei Grass ist es der drohende Atomkrieg,<br />
bei Habermas Europas „Abschied<br />
von der Weltgeschichte“. Frank<br />
Schirrmacher sorgt sich vor dem digitalen<br />
Kontrollverlust über unser Denken,<br />
und Hans-Werner Sinn sieht unsere<br />
Sparguthaben im Eurostrudel dahinschwinden.<br />
Günter Wallraff (25) warnt<br />
wie immer vor Dumpinglöhnen, zuletzt<br />
bei Lidl, und Rolf Hochhuth meldete<br />
sich kürzlich mit der Erkenntnis,<br />
dass die Qualität der Berliner Kaffeehäuser<br />
furchtbar nachgelassen habe.<br />
So ist für jeden etwas dabei. Gemessen<br />
am Krisentremolo der <strong>Intellektuellen</strong><br />
macht die Bevölkerung noch einen<br />
recht zuversichtlichen Eindruck. Also<br />
möchte ich vor den Warnern warnen:<br />
Wenn es so weitergeht, erlebt Deutschland<br />
vielleicht eine Selffulfilling Prophecy<br />
im Großformat.<br />
M AX A . HÖFER<br />
ist Kommunikationsberater<br />
und Publizist. Er erstellte für<br />
<strong>Cicero</strong> bereits zum dritten Mal<br />
die Rangliste der <strong>Intellektuellen</strong><br />
ILLUSTRATION: CHRISTOPH ABBREDERIS; FOTO: PRIVAT (AUTOR)<br />
26 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Anzeige<br />
257 +200 Jörg Lau, Journalist<br />
258 +220 Dirk Baecker,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
259 NEU Bazon Brock, Publizist<br />
260 NEU Amelie Fried, Schriftstellerin<br />
261 NEU Christoph Markschies,<br />
Theologe<br />
262 -11 Lothar Gall, Historiker<br />
263 +8 Hans Belting, Historiker<br />
264 +233 Felicitas von Lovenberg,<br />
Journalistin<br />
265 NEU <strong>Die</strong>ter Nuhr, Kabarettist<br />
266 NEU Thomas Ostermeier,<br />
Theaterregisseur<br />
267 +173 Roger Köppel, Journalist<br />
268 -39 Florian Rötzer, Journalist<br />
269 NEU Joachim Starbatty, Ökonom<br />
270 +107 Bastian Sick, Journalist<br />
271 +229 Andres Veiel,<br />
Theaterregisseur<br />
272 +31 Karl Schlögel, Publizist<br />
273 +132 <strong>Die</strong>ter Wellershoff,<br />
Schriftsteller<br />
274 -33 Franzobel, Schriftsteller<br />
275 +119 <strong>Die</strong>ter E. Zimmer, Publizist<br />
276 NEU Werner Spies, Historiker<br />
277 -113 Wolfgang Frühwald,<br />
Literaturwissenschaftler<br />
278 NEU Hans-Jörg Bullinger,<br />
Arbeitswissenschaftler<br />
279 NEU Georg Klein, Schriftsteller<br />
280 +26 Willi Winkler, Journalist<br />
Erfolgreichste Newcomer<br />
Margot Käßmann (26)<br />
Trotz des Rücktritts als Bischöfin und<br />
EKD-Chefin nach Trunkenheit am Steuer<br />
noch immer Deutschlands oberste<br />
Moralistin.<br />
Hans-Jürgen Papier (34)<br />
Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts<br />
mischt sich immer<br />
wieder in öffentliche Debatten wie die<br />
zur Europolitik ein.<br />
Charlotte Roche (67)<br />
Früher die „Queen of German Pop<br />
Television“ (Harald Schmidt) bei Viva,<br />
heute Königin der skandalträchtigen<br />
Selbstvermarktung.<br />
Mathias Döpfner (86)<br />
Der hünenhafte Musikwissenschaftler<br />
hat dem Springer-Verlag als CEO Rekordergebnisse<br />
beschert. Friede Springer<br />
dankte es ihm mit üppigen Aktienpaketen.<br />
Andreas Voßkuhle (87)<br />
Der neue Präsident des Bundesverfassungsgerichts<br />
wurde schon als<br />
mächtigster Mann Europas bezeichnet.<br />
Den ESM winkte er durch.<br />
FOTOS: PICTURE ALLIANCE (5)<br />
281 NEU Denis Scheck, Journalist<br />
282 -49 Klaus Berger, Theologe<br />
283 -171 Gunter Hofmann, Journalist<br />
284 -94 <strong>Die</strong>trich Grönemeyer,<br />
Mediziner<br />
285 +31 Alexander Kissler, Journalist<br />
286 -74 Fredmund Malik, Ökonom<br />
287 NEU Carl Christian von<br />
Weizsäcker, Ökonom<br />
288 +16 Hanns-Josef Ortheil,<br />
Schriftsteller<br />
289 NEU Ilija Trojanow, Publizist<br />
290 -58 Ulf Poschardt, Journalist<br />
291 +37 Karen Duve, Schriftstellerin<br />
292 NEU Horst Bredekamp, Historiker<br />
293 +38 Georg <strong>Die</strong>z, Journalist<br />
294 +18 Odo Marquard, Philosoph<br />
295 -96 Hans Christoph Buch,<br />
Schriftsteller<br />
296 +188 Friedrich Christian Delius,<br />
Schriftsteller<br />
297 NEU Wolf Haas, Schriftsteller<br />
298 -180 Eckhard Henscheid,<br />
Schriftsteller<br />
„Der Intellektuelle<br />
ist nicht nur durch<br />
den Intellekt zu<br />
definieren, sondern<br />
ebenso durch die<br />
Art, wie er ihn zeigt:<br />
Intellektualität ist<br />
auch Auftritt und<br />
Schauspiel“<br />
Hannelore Schlaffer<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 27<br />
Ambition<br />
Außergewöhnliche Schreibgeräte<br />
mit einem Schaft aus<br />
auffällig gemasertem Cocosholz<br />
A. W. Faber-Castell Vertrieb GmbH<br />
D-90546 Stein • Telefon: 0911-9965-5410<br />
www.Faber-Castell.com
T I T E L<br />
„<strong>Die</strong>se Schlamperei, Nachlässigkeit, Unordentlichkeit,<br />
Ungenauigkeit, die nervöse Hast, die Neigung, Taten durch<br />
Diskussionen, Arbeit durch Gerede zu ersetzen, diese<br />
Neigung, alles in der Welt anzufangen und nichts zu Ende zu<br />
führen, ist eine jener Eigenschaften der ‚Gebildeten‘, die sich<br />
keineswegs aus ihrer schlechten Natur und noch weniger aus<br />
Böswilligkeit, sondern aus allen ihren Lebensgewohnheiten,<br />
ihren Arbeitsverhältnissen, ihrer Übermüdung, der anormalen<br />
Trennung der geistigen Arbeit von der körperlichen usw. ergeben“<br />
Wladimir Iljitsch Lenin<br />
299 -77 Petra Gerster, Journalistin<br />
300 NEU Jürgen Kaube, Journalist<br />
301 -56 Ulrich Herbert, Historiker<br />
302 -68 Thomas Assheuer, Journalist<br />
303 +98 Dirk Kurbjuweit, Journalist<br />
304 +81 Arno Geiger, Schriftsteller<br />
305 NEU Christine Nöstlinger,<br />
Schriftstellerin<br />
306 NEU Hans-Jürgen Jakobs,<br />
Journalist<br />
307 NEU Sarah Kuttner, Publizistin<br />
308 +102 Wolfgang Schmidbauer,<br />
Psychoanalytiker<br />
309 -180 Andreas Kilb, Journalist<br />
310 -172 Franz Alt, Journalist<br />
311 NEU Ernst Peter Fischer, Publizist<br />
312 +102 Axel Meyer,<br />
Evolutionsbiologe<br />
313 +73 Michael Thalheimer,<br />
Theaterregisseur<br />
314 -132 Benjamin Lebert,<br />
Schriftsteller<br />
315 +173 Horst W. Opaschowski,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
316 NEU Wilhelm Schmid, Philosoph<br />
317 +53 Wolfgang Kraushaar,<br />
Politikwissenschaftler<br />
318 +99 Peter Bieri, Philosoph<br />
319 +29 Felicitas Hoppe,<br />
Schriftstellerin<br />
320 NEU Josef Winkler, Schriftsteller<br />
321 -19 Eckhard Jesse,<br />
Politikwissenschaftler<br />
322 -25 Iring Fetscher,<br />
Politikwissenschaftler<br />
323 +167 Michael Miersch, Journalist<br />
324 -60 Thomas Hettche, Schriftsteller<br />
28 <strong>Cicero</strong> 1.2013<br />
325 -11 Kurt Flasch, Philosoph<br />
326 -129 Thomas Hürlimann,<br />
Schriftsteller<br />
327 NEU Fritz B. Simon, Mediziner<br />
328 NEU Otfried Höffe, Philosoph<br />
329 -83 Lorenz Jäger, Journalist<br />
330 NEU Jakob Augstein, Journalist<br />
331 NEU Hugo Müller-Vogg, Journalist<br />
332 NEU Andreas Maier, Schriftsteller<br />
333 NEU Gerhard Schulze,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
334 +45 Peter von Becker, Journalist<br />
335 +33 Andrea Breth,<br />
Theaterregisseurin<br />
336 -227 Jens Reich,<br />
Naturwissenschaftler<br />
337 +97 Hans Werner Kilz, Journalist<br />
338 -83 Wolfgang Wiegard, Ökonom<br />
339 -134 Uwe Wittstock, Journalist<br />
340 NEU Kathrin Röggla,<br />
Schriftstellerin<br />
341 NEU Robert Misik, Publizist<br />
342 -225 Lea Rosh, Journalistin<br />
343 -93 Jan Weiler, Schriftsteller<br />
344 +110 <strong>Die</strong>ter Henrich, Philosoph<br />
345 +82 Michael Maier, Journalist<br />
346 -8 Peter Gross,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
347 NEU Christian Geyer, Journalist<br />
348 +41 Peter Bichsel, Schriftsteller<br />
349 +41 Gerd Langguth,<br />
Politikwissenschaftler<br />
350 NEU Georg M. Oswald,<br />
Schriftsteller<br />
351 -5 Jakob Hein, Schriftsteller<br />
352 NEU Volker Gerhardt, Philosoph<br />
353 -71 Wolfgang Gerke, Ökonom<br />
354 +29 Katja Lange-Müller,<br />
Schriftstellerin<br />
355 -69 Udo Steinbach, Historiker<br />
356 NEU Michael Hartmann,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
357 NEU Joachim Bauer, Mediziner<br />
358 -79 Bascha Mika, Journalistin<br />
359 NEU Christoph Schönborn,<br />
Theologe<br />
360 -86 Frank Goosen, Schriftsteller<br />
361 +6 Aleida Assmann,<br />
Kulturwissenschaftlerin<br />
362 NEU Clemens Fuest, Ökonom<br />
363 -76 Alan Posener, Journalist<br />
364 NEU Lutz Hachmeister,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
365 -72 Franz Schuh, Schriftsteller<br />
366 -24 Karl-Rudolf Korte,<br />
Politikwissenschaftler<br />
367 -143 Ludwig Harig, Schriftsteller<br />
368 NEU Thomas Macho, Publizist<br />
369 -49 Gerd Koenen, Publizist<br />
370 +111 Thomas Leif, Journalist<br />
371 NEU Mathias Müller von<br />
Blumencron, Journalist<br />
372 -156 Wolf Wondratschek,<br />
Schriftsteller<br />
373 NEU Jochen Hörisch,<br />
Medienwissenschaftler<br />
374 -307 Ernst-Ludwig Winnacker,<br />
Biochemiker<br />
375 NEU Christoph Butterwegge,<br />
Politikwissenschaftler<br />
376 NEU Manfred Lütz, Mediziner<br />
377 NEU Kathrin Passig, Journalistin<br />
378 NEU Klaus J. Bade, Historiker<br />
379 -14 Burkhard Spinnen,<br />
Schriftsteller<br />
380 -185 Jürgen Leinemann, Journalist<br />
„Intellektuell ist die Bezeichnung<br />
einer Berufung“<br />
José Ortega y Gasset
Ich seh was Besseres.<br />
Ohne HD ist es einfach<br />
nicht das Gleiche.<br />
Sorry Hollywood. Deutschland verdient das beste HD.<br />
Erleben Sie die größte Programmvielfalt in HD nur auf Sky.<br />
Mehr dazu unter sky.de/hd oder facebook.com/deinskyfilm
T I T E L<br />
N OCH EINE L ISTE<br />
DER INTELLEKTUELLE<br />
19 Eigenschaften einer ruhig gestellten Spezies<br />
Von Michael Naumann<br />
1. Der Intellektuelle als solcher wird<br />
nicht mehr benötigt. Das faschistische,<br />
kommunistische, kapitalistische,<br />
autoritäre, sogenannte<br />
„gesamtverblendete“ System hat<br />
den <strong>Intellektuellen</strong> im Laufe des<br />
20. Jahrhunderts aus seiner freischwebenden<br />
Existenz befreit und<br />
mit einer Professur ruhig gestellt –<br />
wenn es ihn nicht ermordet hat.<br />
2. Theodor W. Adorno hat<br />
schon alles gesagt.<br />
3. Er war ein großer Intellektueller,<br />
aber heimlich,<br />
so lästerte einmal<br />
sein Freund Max<br />
Horkheimer, sehnte er sich im Exil<br />
nach einer sicheren Existenz auf einer<br />
kleinen Forschungsstelle in<br />
Kalifornien.<br />
4. Der wohlsituierte deutsche Privatgelehrte<br />
verliert seine diskret mitgeschleppte<br />
Berufsbezeichnung „Intellektueller“<br />
an dem Tag, an dem er<br />
in einer blöden Talkshow sitzt. Das<br />
ist der Augenblick, an dem er plötzlich<br />
öffentlich als „Intellektueller“,<br />
mithin als „schwierig“ gilt. Fortan<br />
schämt er sich.<br />
5. Aber es gibt ihn noch im Land seiner<br />
Herkunft: Er schreibt<br />
(wie einst Zola) Romane,<br />
berät Präsidenten<br />
(wie Régis Debray oder<br />
Bernard-Henri Lévy), lebt<br />
wie früher Jean-Paul Sartre im Café<br />
de Flore oder nebenan im Deux<br />
Magots in Paris und wird dann Botschafter<br />
auf Malta, wo er seine Memoiren<br />
vorbereitet. Alles, so wird er<br />
sagen, war ganz anders.<br />
6. Der Intellektuelle weiß alles, der<br />
Philosoph deutet viel. Der Intellektuelle<br />
jammert, der Philosoph trauert.<br />
Der Intellektuelle raucht und<br />
trinkt Kaffee, der Philosoph streichelt<br />
seine Katze.<br />
7. Früher saßen Deutschlands führende<br />
Intellektuelle als Lektoren im Suhrkamp-Verlag.<br />
Karl Markus Michel,<br />
Walter Boehlich, Günther Busch:<br />
Vom Kursbuch bis zur „edition suhrkamp“<br />
– die Verlagsarbeit dieser humanistisch<br />
gebildeten, aufgeklärten<br />
Dialektiker etablierten Siegfried Unselds<br />
Haus als geistiges Kraftzentrum<br />
der 68er-Generation, mit der sie<br />
selbst in Wirklichkeit herzlich wenig<br />
zu tun haben mochten. Sie wollten<br />
lesen, redigieren und die deutsche<br />
Sprache retten. Sie sind alle tot.<br />
8. Eine Rangliste deutscher Intellektueller<br />
hätten sie mit dem angemessenen<br />
Spott überzogen, dem ihr Freund<br />
Robert Gernhardt – kein Intellektueller<br />
– eine kleine Zeichnung hinzugefügt<br />
hätte. Drei Intellektuelle, ein<br />
Philosoph.<br />
9. <strong>Die</strong> „konstruktiven <strong>Intellektuellen</strong>“,<br />
eine Subspezies des Kapitalismus,<br />
sitzen in Partei-Stiftungen, Thinktanks,<br />
Max-Planck-Instituten und<br />
glauben, dass die Mächtigen, denen<br />
stets ihre wahre Liebe galt, ihre Texte<br />
lesen und ihre Ratschläge befleißigen.<br />
Überhaupt: Intellektuelle schreiben<br />
„Texte“, keine Artikel. Doch ein<br />
„konstruktiver Intellektueller“ hat<br />
seine Berufung verfehlt – als dekonstruktiver,<br />
ablehnender, Vorurteile<br />
niederreißender, nörgelnder, böswilliger,<br />
melancholischer, satirischer,<br />
selbstverliebter, auf alle Fälle aber beredter<br />
Denker hätte er auch keine<br />
Chance mehr, wahrgenommen zu<br />
werden. Der „konstruktive Intellektuelle“<br />
hat dafür, im Gegensatz zum<br />
anderen, gute Manieren.<br />
10. <strong>Intellektuellen</strong>feindlichkeit war<br />
einmal die kleine Schwester des<br />
Antisemitismus.<br />
11. Fritz J. Raddatz kannte viele Intellektuelle<br />
– oder solche, die sich dafür<br />
hielten. Weil er sie beim Namen<br />
nennt, haben sie sein Tagebuch (eine<br />
Art Roman) gekauft, um im opulenten<br />
Namensregister nachzuschauen,<br />
ob sie noch leben.<br />
12. <strong>Die</strong> größten <strong>Intellektuellen</strong> der jüngeren<br />
Neuzeit sprachen Englisch,<br />
zum Beispiel Thomas Jefferson und<br />
John Adams. Letzterer<br />
stellte sich den Himmel<br />
als Debattierclub vor.<br />
Vorher haben sie noch<br />
schnell eine Revolution<br />
initiiert und eine<br />
Nation gegründet.<br />
13. Da wir schon in Amerika<br />
sind: In New Yorks ästhetisch<br />
versierten Kreisen lautete Ausgang<br />
des vorigen Jahrhunderts die Reihenfolge<br />
des Dinners: Vorspeise,<br />
Hauptspeise, Nachspeise,<br />
and then let’s talk about<br />
Susan Sontag. Sie bildete<br />
das Zentralkomitee<br />
der amerikanischen <strong>Intellektuellen</strong><br />
und war<br />
sein einziges Mitglied.<br />
Manchmal saß sie in Berlins „Paris<br />
Bar“ und wartete sehnsüchtig auf<br />
Walter Benjamin. Aber es kamen nur<br />
Heiner Müller und ein stiller Mann<br />
von der Stasi.<br />
14. Intellektuelle sind ihrem Land gram.<br />
Doch heimlich lieben sie es. Wie ein<br />
aristokratischer Mäzen<br />
einmal Jonathan Swift<br />
zurief: „Würden Sie<br />
ihre Nation wirklich so<br />
sehr verachten, wie Sie<br />
behaupten, dann wären<br />
Sie ihr nicht so böse.“<br />
15. <strong>Die</strong> Sonderform des deutschen katholischen<br />
<strong>Intellektuellen</strong> blühte in<br />
der Zeit des Kalten Krieges. Als Jesuiten<br />
kannten sie sich besser in Karl<br />
Marx’ Theorien aus als die Politruks<br />
im Osten. Das lag daran, dass sie<br />
sich als Transzendenz-Fraktion seiner<br />
eschatologischen Erlösungslehre<br />
empfanden. Dass ein deutscher Intellektueller<br />
einmal Papst werden<br />
sollte, ahnten sie nicht. Der hat einen<br />
Vorgänger, Coelestin II, ein Anhänger<br />
Abaelards. Coelestin wurde<br />
1144 vergiftet, Pater Abaelard hatte<br />
ILLUSTRATIONEN: CHRISTOPH ABBREDERIS<br />
30 <strong>Cicero</strong> 1.2013
FOTO: ANDREJ DALLMANN<br />
man schon vorher mit zwei Ziegelsteinen<br />
entmannt; denn er lehnte<br />
das Zölibat ab und wollte den<br />
christlichen Glauben mit menschlicher<br />
Vernunft versöhnen. Ein<br />
tragischer, früher Intellektueller –<br />
seine Bücher wurden gleich mehrfach<br />
verbrannt.<br />
16. Konsequenz ist eine fürchterliche<br />
deutsche <strong>Intellektuellen</strong>tugend.<br />
Darum ist jede <strong>Intellektuellen</strong>-<br />
Liste, die Hans Magnus Enzensbergers<br />
Namen aufführt, ein Dokument<br />
bürokratischer Blödheit.<br />
Er ist viel zu klug, um intellektuell,<br />
also konsequent zu sein.<br />
17. Lenin und Trotzki kamen als revolutionäre<br />
Intellektuelle an die<br />
Macht und brachten<br />
dann Tausende Menschen<br />
um. Ihr Nachfolger<br />
gehörte nicht<br />
zu den <strong>Intellektuellen</strong>,<br />
sondern ließ sie<br />
reihenweise ermorden. Einer von<br />
ihnen war so dumm, die Frau des<br />
NKWD-Chefs zu verführen. Daraus<br />
folgt nichts außer Grauen.<br />
18. Blaise Pascal hat die Rechenmaschine<br />
erfunden. Aber seine Behauptung,<br />
alles Unglück der<br />
Welt beruhe darauf, dass<br />
der Mensch nicht einen<br />
Tag lang allein in seinem<br />
Zimmer sitzen könne,<br />
stimmt nicht mehr. Heute<br />
kann der Mensch wochenlang<br />
ganz allein bei sich bleiben –<br />
vor seinem iPad oder seinem Mac.<br />
Und alles Unglück der Welt wird<br />
darauf beruhen, dass er glaubt, er<br />
sei draußen in der Wirklichkeit<br />
gewesen.<br />
19. Damit das klar ist:<br />
Steve Jobs hat die Rechenmaschine<br />
nicht erfunden<br />
und war auch<br />
kein Intellektueller.<br />
M ICHAEL N AUMANN<br />
ehemaliger Chefredakteur von<br />
<strong>Cicero</strong>, ist Geschäftsführer<br />
der neuen Barenboim-Said-<br />
Akademie in Berlin<br />
381 NEU Holger Steltzner, Journalist<br />
382 +18 Joachim Sartorius,<br />
Schriftsteller<br />
383 NEU Sibylle Lewitscharoff,<br />
Schriftstellerin<br />
384 -183 Wolfram Weimer, Journalist<br />
385 NEU Wolfgang Ullrich, Historiker<br />
386 NEU Gerald Braunberger,<br />
Journalist<br />
387 -224 Christian Weber, Journalist<br />
388 -139 Hermann Kant, Schriftsteller<br />
389 -57 Hans-Peter Dürr, Physiker<br />
390 NEU Michael Spreng, Politikberater<br />
391 +28 Volker Perthes,<br />
Politikwissenschaftler<br />
392 -179 Tilman Spengler,<br />
Schriftsteller<br />
393 NEU Wolf-<strong>Die</strong>ter Narr,<br />
Politikwissenschaftler<br />
394 NEU Hans-Martin Lohmann,<br />
Journalist<br />
395 NEU Fritz W. Scharpf,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
396 -239 Wolf Jobst Siedler, Publizist<br />
397 -41 Peter Hamm, Schriftsteller<br />
398 NEU Hubert Winkels, Journalist<br />
399 -133 Daniela Dahn, Schriftstellerin<br />
400 NEU Manfred Prenzel,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
401 -52 Bert Hellinger,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
402 NEU Konrad Paul Liessmann,<br />
Philosoph<br />
403 +5 Harald Lesch, Physiker<br />
404 NEU Günther Nonnenmacher,<br />
Journalist<br />
405 NEU Gerhard Henschel,<br />
Schriftsteller<br />
406 NEU Thorsten Polleit, Ökonom<br />
407 -172 Hans-Ulrich Treichel,<br />
Schriftsteller<br />
408 NEU Nicolas Stemann,<br />
Theaterregisseur<br />
409 NEU Jürgen Osterhammel,<br />
Historiker<br />
410 +5 Klaus Theweleit,<br />
Literaturwissenschaftler<br />
411 NEU Anton Zeilinger,<br />
Quantenphysiker<br />
412 -131 Ror Wolf, Schriftsteller<br />
413 NEU Ursula Krechel,<br />
Schriftstellerin<br />
414 -319 Maxim Biller, Schriftsteller<br />
415 -240 Mathias Richling, Kabarettist<br />
416 -61 Elisabeth Bronfen,<br />
Schriftstellerin<br />
Anzeige<br />
© Foto Buschkowsky: Bezirksamt Neukölln; Meyer, Marguier: Antje Berghäuser<br />
Integration<br />
statt Multikulti<br />
Der Neuköllner Bürgermeister fordert,<br />
dass nicht nur der Staat, sondern jeder<br />
Einzelne Verantwortung übernimmt.<br />
Das <strong>Cicero</strong>-Foyergespräch<br />
<strong>Cicero</strong>-Kolumnist Frank A. Meyer und<br />
Alexander Marguier, stellvertretender<br />
<strong>Cicero</strong>-Chefredakteur, im Gespräch<br />
mit Heinz Buschkowsky.<br />
Sonntag, 27. Januar 2013, 11 Uhr<br />
Berliner Ensemble,<br />
Bertolt-Brecht-Platz 1, 10117 Berlin<br />
Tickets: Telefon 030 28408155<br />
www.berliner-ensemble.de<br />
BERLINER<br />
ENSEMBLE<br />
27. JANUAR<br />
In Kooperation<br />
mit dem Berliner Ensemble<br />
Heinz<br />
Buschkowsky<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 31
T I T E L<br />
417 NEU <strong>Die</strong>ter Thomä, Philosoph<br />
418 NEU Peter Körte, Journalist<br />
419 NEU Robert Schindel, Schriftsteller<br />
420 -163 Gabriele Wohmann,<br />
Schriftstellerin<br />
421 -97 Ulrich Raulff, Philosoph<br />
422 NEU Jutta Ditfurth, Publizistin<br />
423 NEU Paul Ingendaay, Schriftsteller<br />
424 NEU Max Otte, Ökonom<br />
425 NEU Elisabeth von Thadden,<br />
Journalistin<br />
426 NEU Bassam Tibi,<br />
Politikwissenschaftler<br />
427 -208 Konrad Adam, Publizist<br />
428 NEU Kathrin Schmidt,<br />
Schriftstellerin<br />
429 +69 Thomas Meinecke,<br />
Schriftsteller<br />
430 +18 Wolfgang Welsch, Philosoph<br />
431 -179 Lutz Rathenow, Schriftsteller<br />
432 NEU Jan Fleischhauer, Journalist<br />
433 -133 Ludger Lütkehaus, Philosoph<br />
434 NEU Wolfram Schütte, Journalist<br />
435 -181 Alexander Osang, Journalist<br />
436 -138 Jens Bisky, Journalist<br />
437 -71 Kurt Kister, Journalist<br />
438 -76 Gregor Schöllgen, Historiker<br />
439 NEU Wilhelm Hankel, Ökonom<br />
440 -101 Reinhard Selten, Ökonom<br />
441 +35 Wolfgang Streeck,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
442 -236 Christiane Nüsslein-Volhard,<br />
Biologin<br />
443 -272 Johano Strasser, Schriftsteller<br />
444 NEU Verena Kast, Psychologin<br />
445 NEU Josef H. Reichholf, Zoologe<br />
446 -3 Tanja Dückers, Schriftstellerin<br />
447 NEU Sarah Kirsch, Schriftstellerin<br />
448 +22 Jens König, Journalist<br />
449 NEU Michael Köhlmeier,<br />
Schriftsteller<br />
450 NEU Horst Dreier, Jurist<br />
451 -320 Klaus Bednarz, Journalist<br />
452 -28 Notker Wolf, Theologe<br />
453 NEU Clemens Meyer, Schriftsteller<br />
454 NEU Klaus von Beyme,<br />
Politikwissenschaftler<br />
455 NEU Hermann Parzinger, Historiker<br />
456 NEU Wolfgang Sofsky,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
457 -198 Bettina Röhl, Journalistin<br />
458 NEU Josef Haslinger, Schriftsteller<br />
459 -129 Winfried Schulze, Historiker<br />
460 NEU Michael Brenner, Historiker<br />
„Intellektuelle sind in<br />
der Tat Leute, die die<br />
Macht des gesprochenen<br />
und des geschriebenen<br />
Wortes handhaben, und<br />
eine Eigentümlichkeit,<br />
die sie von anderen<br />
Leuten, die das Gleiche<br />
tun, unterscheidet, ist<br />
das Fehlen einer direkten<br />
Verantwortlichkeit für<br />
praktische Dinge“<br />
Joseph Schumpeter<br />
<strong>Die</strong> tiefsten Abstürze<br />
Klaus Bednarz (-320)<br />
Von 1983 bis 2001 Chef und Gesicht des<br />
ARD-Politmagazins „Monitor“. Heute dreht<br />
er für den WDR Reportagen in Osteuropa<br />
und Südamerika.<br />
Maxim Biller (-319)<br />
Ewig schimpfender Rohrspatz des deutschen<br />
Feuilletons, sein Roman „Esra“<br />
wurde gerichtlich zensiert und er damit<br />
zum Märtyrer für die Kunstfreiheit.<br />
Ernst-Ludwig Winnacker (-307)<br />
Stammzellen-, Gen- und Virenexperte,<br />
Ex-Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
und Träger einer ganzen<br />
Reihe von Verdienstorden.<br />
Johano Strasser ( -272)<br />
Der Vordenker der deutschen Linken<br />
ging von der Apo über die Jusos in<br />
die SPD und ist heute Präsident des<br />
deutschen Pen-Clubs.<br />
Wieland Schmied (-24 4)<br />
Der Ex-Präsident der Bayerischen<br />
Akademie der Schönen Künste gilt als<br />
einer der bedeutendsten europäischen<br />
Kunsthistoriker.<br />
461 NEU Stefan Homburg, Ökonom<br />
462 NEU Ulrich von Alemann,<br />
Politikwissenschaftler<br />
463 +4 Manfred Güllner,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
464 NEU Hartmut Rosa,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
465 NEU Helene Hegemann,<br />
Schriftstellerin<br />
466 -126 Hajo Schumacher, Journalist<br />
467 -58 Detlev Ganten, Mediziner<br />
468 +3 Thomas Fricke, Journalist<br />
469 NEU Thomas Glavinic,<br />
Schriftsteller<br />
470 NEU Alfred Grosser, Publizist<br />
471 NEU Gerd Gigerenzer, Psychologe<br />
472 NEU Wolfgang Münchau,<br />
Journalist<br />
473 NEU Frank A. Meyer, Journalist<br />
474 -244 Wieland Schmied, Publizist<br />
475 NEU Peter Kruse, Psychologe<br />
476 -215 Jan Ross, Journalist<br />
477 NEU Fritz Göttler, Journalist<br />
478 -118 Arno Widmann, Journalist<br />
479 NEU Clemens S. Setz, Schriftsteller<br />
480 NEU Thomas Rauschenbach,<br />
Pädagoge<br />
481 -127 Johannes Willms, Journalist<br />
482 NEU Martin Hellwig, Ökonom<br />
483 -133 Gero von Randow, Journalist<br />
484 NEU Michael Winterhoff,<br />
Sozialwissenschaftler<br />
485 -39 Volker Weidermann,<br />
Journalist<br />
486 NEU Constanze Kurz, Publizistin<br />
487 NEU Manfred G. Schmidt,<br />
Politikwissenschaftler<br />
488 -55 Peter Gruss, Zellbiologe<br />
489 -213 Matthias Politycki,<br />
Schriftsteller<br />
490 -171 Brigitte Hamann,<br />
Historikerin<br />
491 NEU Wolfgang Kohlhaase,<br />
Schriftsteller<br />
492 NEU Michael von Brück, Theologe<br />
493 -81 Udo Pollmer,<br />
Lebensmittelchemiker<br />
494 -22 Albrecht Beutelspacher,<br />
Mathematiker<br />
495 NEU Hanno Beck, Ökonom<br />
496 NEU Gertrude Lübbe-Wolff,<br />
Juristin<br />
497 NEU Gerd Scobel, Publizist<br />
498 NEU Martin Seel, Philosoph<br />
499 -5 Roland Tichy, Journalist<br />
<strong>500</strong> NEU Hans-Joachim Maaz,<br />
Psychoanalytiker<br />
FOTOS: PICTURE ALLIANCE (4), DDP IMAGES/DAPD<br />
32 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Ausgezeichnet<br />
<strong>Die</strong> <strong>Cicero</strong>-Titelbilder sind unverwechselbar und werden von den Lesern geschätzt.<br />
Im Wettbewerb „Cover des Monats“ haben es diese sechs in die Top 5 geschafft:<br />
Zweimal<br />
1. PLATZ<br />
Juni 2012<br />
September 2012<br />
2. Platz 2. Platz 4. Platz 5. Platz<br />
April 2012<br />
Februar 2012 Oktober 2012 Juli 2012<br />
Einmal im Monat wählen Chefredakteure, Kreativdirektoren,<br />
Vertriebsexperten und andere Medienprofis die besten Titelbilder<br />
aus allen deutschen Zeitschriften. Bewertet werden künstlerische<br />
Aspekte genauso wie die journalistische Originalität und die<br />
Ausstrahlung des Covers auf den Leser.<br />
Weitere Informationen: www.cover-des-monats.de
| B E R L I N E R R E P U B L I K<br />
DIE ONE-MAC-SHOW<br />
Ziele? Inhalte? David McAllister berauscht der Auftritt. Jetzt kämpft er um sein Amt als Ministerpräsident<br />
VON G EORG L ÖW ISCH<br />
N<br />
ACH SEINER REDE, bevor die Gans<br />
auf den Tisch kommt, verschwindet<br />
er kurz. Sie haben ihn ja<br />
gleich wieder, die Manager, die Senatorin,<br />
die Arbeitgeberfunktionäre. Er steht<br />
nun vor dem Hamburger Congress Center,<br />
David McAllister, CDU, Ministerpräsident<br />
von Niedersachsen, Redner beim<br />
Martinsgansessen von Nordmetall. Er zieht<br />
die kalte Abendluft in die Lungen, sein Gesicht<br />
hat Farbe, die Züge sehen scharf aus,<br />
der Mann ist berauscht. Noch eine Marlboro<br />
obendrauf, der Siemens-Filialleiter an<br />
seiner Seite kriegt auch eine ab. Ha! Der<br />
Szenenapplaus eben, die Lacher, sogar die<br />
SPD-Senatorin am Tisch hat geschmunzelt,<br />
und den Gewerkschafter hat er extra<br />
erwähnt. „Mac ist für alle da“, sagt er.<br />
Fünf Minuten später ist er zurück, die<br />
Kellner reichen Rotkraut und Klöße, das<br />
Gänsefleisch ist goldbraun, die Soße dick,<br />
die Nordmetaller packen zu und schlemmen.<br />
McAllister tut sich auf, aber er hatte<br />
seinen Genuss schon.<br />
Man kann sich wundern über diese Zufriedenheit.<br />
Als der Fall Wulff auf die CDU<br />
einprasselte wie ein kalter, lang anhaltender<br />
Regen, wirkte er erschöpft. Er sprach über<br />
eine Zeit ohne Politik, „bei der nächsten<br />
Dateibereinigung fällt dein Name raus aus<br />
dem Verteiler“. Es klang sarkastisch. Eigentlich<br />
hat sich seine Situation verschlechtert.<br />
<strong>Die</strong> Prognosen zur Niedersachsen-Wahl<br />
am 20. Januar sagen sein Scheitern voraus.<br />
<strong>Die</strong> FDP, sein Koalitionspartner, ist<br />
in Umfragen unter 5 Prozent eingepfercht.<br />
Im Drei-Parteien-Parlament hätte Rot-<br />
Grün ziemlich sicher die Mehrheit. Dass<br />
ihn diese Aussicht nicht lähmt, mag daran<br />
liegen, dass er anders als während des Wulff-<br />
Skandals nun wieder die Chance hat, dem<br />
Publikum zu gefallen. Sich zu gefallen.<br />
<strong>Die</strong> Politik hat für diesen Mann mit<br />
Wahlkampf angefangen. Im Landkreis<br />
Cuxhaven hat er als Student einen CDU-<br />
Landtagsabgeordneten begleitet. Er verteilte<br />
Kulis, machte Fotos und lernte, wie<br />
man das Publikum gewinnt, Pointen setzt,<br />
einen Saal aufputscht. Er fand das gut. Es<br />
ist sein Lebensinhalt geworden.<br />
9:10 Uhr. <strong>Die</strong> Frühvorstellung an diesem<br />
Tag ist eine Wissenschaftskonferenz<br />
zu den Grenzen des Wachstums. Hannover,<br />
Schloss Herrenhausen, man spricht<br />
Englisch. McAllister intoniert so bedeutsam<br />
wie ein Haushofmeister der Queen<br />
und so britisch auch, sein Vater kam ja von<br />
der Insel. Nach ihm ist Hannovers Oberbürgermeister<br />
dran, Stephan Weil, SPD,<br />
McAllisters Herausforderer bei der Wahl.<br />
Den Namen des Stargasts Dennis Meadows<br />
verhunzt Weil. „Miiiedows“. Über<br />
McAllisters Gesicht fliegt ein verzücktes<br />
Lächeln.<br />
Meadows ist ein berühmter Ökonom<br />
aus Amerika, der 1972 der Welt den Kollaps<br />
vorhersagte, wenn die Menschen nichts<br />
ändern. Heute rechnet er vor, dass die Politiker<br />
die Kontrolle völlig verloren haben.<br />
Klima katastrophe, Bevölkerungswachstum.<br />
Hinter Hannover lässt der Fahrer den<br />
Audi über die Autobahn schießen. Meadows’<br />
Analyse? McAllister heuchelt nicht<br />
einmal Nachdenklichkeit. „Ist nicht meine<br />
Haltung“, sagt er. Bloß eine Nummer vorm<br />
Frühstück. Jetzt erst mal zu McDonalds,<br />
Rührei und Kaffee mit Milch und Zucker.<br />
McAllisters Büroleiter hat in der Staatskanzlei<br />
eine Niedersachsenkarte. Wo der<br />
Chef gastiert hat, steckt ein Fähnchen. <strong>Die</strong><br />
Karte ist voll. 16-, 18-Stunden-Tage, die<br />
One-Mac-Show ist die letzten Jahre durchs<br />
Land gerast. Aber die Frage, was er bewirken<br />
will, für welche Zukunft er arbeitet,<br />
ist unbeantwortet geblieben. Landkreistag,<br />
Grundsteinlegung, Parteiabend: Eigentlich<br />
eine dröge, eine einsame Beschäftigung,<br />
doch er sagt, dass er vor den Terminen<br />
Aufregung verspürt. „Ich möchte<br />
einen ordentlichen Auftritt hinlegen.“ Ordentlich?<br />
Er will glänzen, das gibt ihm den<br />
Kick. Klar, die Herausforderungen können<br />
wachsen, und viele Kanzleroptionen<br />
für später hat die Union nicht. Aber er ist<br />
erst 41, da kann er sich die großen Bühnen<br />
für später aufheben.<br />
Im Auto denkt er sich vorher in die<br />
Situationen hinein, Ton, Tempo, Themen<br />
müssen passen. Er nimmt die Manuskripte<br />
aus der Staatskanzlei, schmeckt ab, würzt<br />
nach. Gerade schmeißt er eins lustvoll vor<br />
seine Füße. Braucht er nicht, es geht nach<br />
Bad Bederkesa, sein Heimatort, sein Gymnasium,<br />
sie feiern Richtfest für ein neues<br />
Fachraumgebäude. Der Wagen biegt auf<br />
die L 120 ab. Es ist noch Zeit bis zum Termin,<br />
er braucht ein Ladegerät von zu Hause.<br />
An einem Wald liegt das Klinkerhaus der<br />
McAllisters, zwei Kinderräder stehen davor,<br />
ein Grill. Dunja McAllister öffnet, Juristin,<br />
Hausfrau, dunkle Haare, scharfer Blick. Sie<br />
hat den Tisch gedeckt für sich und die zwei<br />
Töchter. Ob die Kinder gleich zum Richtfest<br />
rüberkommen, fragt er. Sie schaut ihn<br />
perplex an. Der Blick sagt: Was weißt du<br />
schon, was hier zu Hause läuft.<br />
Auf dem Richtfest duzt er viele, es ist<br />
ja sein Gymnasium. Trotzdem steht er seltsam<br />
allein in der Menge. Er spürt das wohl,<br />
denn er feixt wie ein Junge, als ein Amtsleiter<br />
referiert, aber das wirkt auch schief.<br />
David und Ministerpräsident, er bekommt<br />
das nicht zusammen. „In welche Klasse<br />
gehst du?“, fragt er aus Versehen eine Lehrerin.<br />
Egal, es kommt der nächste Termin.<br />
Er braucht das Tourneeleben wie Essen<br />
und Trinken. Leute, die ihn lange<br />
kennen, sagen, dass er weitermachen<br />
wird, wenn er verliert. Lag ja an der FDP,<br />
wird es heißen, die CDU ist doch stärkste<br />
Kraft, der David hat die Zukunft vor sich.<br />
So geht Plan B. Und Plan A? Er gewinnt<br />
doch, ohne FDP, Mac gegen alle, absolute<br />
Mehrheit, was für eine Show das erst wäre.<br />
Was für ein Rausch.<br />
G EORG L ÖWISCH<br />
ist Textchef von <strong>Cicero</strong>.<br />
David McAllisters Weg<br />
verfolgt er seit 2007<br />
FOTOS: STEFAN KRÖGER FÜR CICERO, ANDREJ DALLMANN (AUTOR)<br />
34 <strong>Cicero</strong> 1.2013
David McAllister<br />
will glänzen.<br />
Das ist sein Kick<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 35
| B E R L I N E R R E P U B L I K<br />
AM TISCH VOM STRAUSS<br />
Wenn sich Platzhirsche blockieren, gewinnt Gerda Hasselfeldt. Auch so kommt man in der CSU nach oben<br />
VON H ARTMUT PALMER<br />
D<br />
IE KELLNERIN STELLTE energisch<br />
das Tablett mit den Biergläsern<br />
ab und sagte: „Des könnt’s doch<br />
ned machen.“ <strong>Die</strong> Herren schauten verdutzt<br />
drein. Sie saßen im „Gasthaus Rainer“<br />
und wollten gerade die Ortsgruppe der<br />
Jungen Union auflösen. Zu wenig Interesse,<br />
zu wenig aktive Mitglieder – sogar im<br />
tiefschwarzen niederbayerischen Haibach<br />
drohte der CSU-Nachwuchsorganisation<br />
im Frühjahr 1968 das Aus.<br />
Da mischte sich die Gerda ein. Erzürnt<br />
wie eine bayerische Seeräuber-Jenny stand<br />
die Tochter des Wirts bei ihren Gläsern:<br />
„Des könnt’s doch ned machen. Dann ham<br />
die Jungen überhaupt nix mehr zum sog’n.“<br />
Betretenes Schweigen. „Ja, wann du scho so<br />
gscheit daherredst, dann machst des doch<br />
du“, sagte einer. Und sie sagte tapfer: „Ja,<br />
dann mach’s halt ich!“ So kam es, dass Gerda<br />
Hasselfeldt, die damals noch Gerda Rainer<br />
hieß, mit 17 Jahren die Junge Union von<br />
Haibach vor der Auflösung bewahrte und<br />
ihr erstes politisches Amt übernahm.<br />
Heute sitzt sie im Bundestag, Jakob-<br />
Kaiser-Haus, Blick auf die Spree. Und<br />
sie arbeitet am begehrtesten Möbelstück,<br />
das die CSU zu vergeben hat. Jeder, der<br />
es hierhin schaffte, wurde später mindestens<br />
Minister: Franz Josef Strauß, der den<br />
Schreibtisch aus rötlichem Holz einst in<br />
Bonn erwarb, Friedrich Zimmermann,<br />
Richard Stücklen, Hermann Höcherl,<br />
Theo Waigel, Michael Glos, Peter Ramsauer,<br />
Hans-Peter Friedrich. Für Hasselfeldt<br />
aber ist dieser Schreibtisch keine Zwischenstation,<br />
sondern ein Traum, den sie<br />
nie zu träumen wagte und deshalb auch<br />
nicht geträumt hat. Als Vorsitzende der<br />
CSU-Landesgruppe redet sie überall mit<br />
und wird frühzeitig in alle wichtigen Vorhaben<br />
und Projekte der Regierung und der<br />
Fraktion eingeweiht.<br />
„An der Spitze der Landesgruppe ist<br />
man schon ziemlich einflussreich,“ sagt<br />
sie untertreibend. Einflussreicher jedenfalls,<br />
als viele Kabinettsposten, das Scharnier<br />
zwischen CDU und CSU. Fünf ehrgeizige<br />
CSU-Männer, darunter CSU-Generalsekretär<br />
Alexander Dobrindt, balgten<br />
sich um das Amt, als Landesgruppenchef<br />
Hans-Peter Friedrich im März vorigen Jahres<br />
Innenminister wurde. „Es drohte ein<br />
fürchterliches Hauen und Stechen zu werden“,<br />
erinnert sich Peter Ramsauer. Erst als<br />
er vorschlug, Gerda Hasselfeldt zu nehmen,<br />
„da war plötzlich Ruhe im Karton“.<br />
So war es eigentlich immer. Gerda<br />
Hasselfeldt wurde alles, was sie bisher war,<br />
weil andere sich entweder gegenseitig blockierten<br />
oder nicht mehr wollten: In den<br />
Bundestag kam sie 1987 als Nachrückerin<br />
über die Landesliste, weil CSU-Chef<br />
Strauß keine Lust mehr hatte, in Bonn nur<br />
Zweiter unter Helmut Kohl zu sein. Das<br />
Bauministerium übernahm sie zwei Jahre<br />
später, weil Oscar Schneider hingeschmissen<br />
hatte, und Theo Waigel meinte, eine<br />
CSU-Frau müsse ins Kabinett. Gesundheitsministerin<br />
wurde sie 1991, als Kohl<br />
das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend<br />
und Gesundheit aufgespalten und<br />
sein „Dreimädelhaus“ gebastelt hatte: Familie<br />
und Jugend für Hannelore Rönsch,<br />
Gesundheit für Hasselfeldt, und Frauen für<br />
die damals noch völlig unbekannte Angela<br />
Merkel.<br />
Merkel stieg auf, Hasselfeldt nicht. Ihr<br />
Blitzstart endete schon ein Jahr später mit einer<br />
Bruchlandung. Unter dem Ansturm der<br />
Lobbyisten aus Pharmaindustrie und Versicherungswirtschaft<br />
brach die junge CSU-Gesundheitsministerin<br />
buchstäblich zusammen.<br />
Eine angebliche Spionage affäre, in die einer<br />
ihrer engsten Mitarbeiter verwickelt war, kam<br />
hinzu. Zermürbt und gesundheitlich angeschlagen<br />
trat sie zurück und verschwand erst<br />
einmal in der Versenkung. Horst See hofer<br />
wurde ihr Nachfolger.<br />
In den wenigen Jahren als Ministerin<br />
sind ihre einst dunklen Haare erst grau,<br />
dann weiß geworden. Sie arbeitete zäh und<br />
fleißig weiter, kümmerte sich um Verkehrspolitik,<br />
um Arbeit und Soziales und zum<br />
Schluss um die Finanzen. 2009 holte Merkel<br />
sie in ihr Schattenkabinett, aber nach dem<br />
Wahlsieg wurde sie auf den Platz der Bundestagsvizepräsidentin<br />
weggelobt.<br />
Sie fand es in Ordnung: „Man kann<br />
eine Karriere nicht von Anfang an planen“,<br />
sagt sie. „Meine Devise war immer: Das<br />
Amt kommt zum Mann oder zur Frau.“<br />
Andere in der Union sehnen sich danach,<br />
einmal als Bundesminister oder Ministerpräsident<br />
von den Scheinwerfern angeleuchtet<br />
zu werden und mit knalligen<br />
Sätzen den Lauf der Dinge zu bestimmen.<br />
Hasselfeldt ist ein anderer Typ. Sie ist auf<br />
andere Art mächtig: moderierend, still.<br />
Sie kennt ja das Gebahren der balzenden<br />
Auerhähne in der Politik von Jugend<br />
an. Ihr Vater, Alois Rainer, war nicht nur<br />
Gastwirt und Metzger in Haibach, sondern<br />
30 Jahre lang CSU-Bürgermeister und<br />
18 Jahre Bundestagsabgeordneter in Bonn –<br />
ein Patriarch. Fünf Töchter, dann erst kam<br />
der Stammhalter. <strong>Die</strong> Mädels mussten in<br />
der Schankstube helfen, aber „von Frauen<br />
in der Politik hat mein Vater eigentlich<br />
nicht so viel gehalten“. Sie sollten lieber<br />
still sein, wenn die Männer politisierten<br />
oder Schafkopf spielten. Das änderte sich<br />
erst, als sie selbst in den Bundestag kam.<br />
Da war er stolz auf die Tochter.<br />
Gefördert aber hat sie ein anderer Mann,<br />
Walter Rietschl hieß er, war auch in der<br />
CSU und Lehrer. Er nahm sie ernst. Bei<br />
ihm habe sie zu argumentieren gelernt, und<br />
sich aufgehoben gefühlt. „Mit ihm konnte<br />
ich auch kontrovers diskutieren, ohne gleich<br />
in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden.“<br />
Ohne den Rietschl, da ist sie sicher, hätte<br />
„ich mich damals, im Frühjahr 1968, bestimmt<br />
nicht getraut, bei der Jungen Union<br />
den Mund aufzumachen.“<br />
H ARTMUT PALMER<br />
ist politischer Chefkorrespondent<br />
von <strong>Cicero</strong>. Er lebt und arbeitet<br />
in Bonn und Berlin<br />
FOTOS: JULIA ZIMMERMANN FÜR CICERO, ANDREJ DALLMANN (AUTOR)<br />
36 <strong>Cicero</strong> 1.2013
„Von Frauen<br />
in der Politik<br />
hat mein<br />
Vater nicht<br />
viel gehalten“<br />
Gerda Hasselfeldt<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 37
| B E R L I N E R R E P U B L I K<br />
UNTER DRUCK<br />
<strong>Die</strong> Erwartungen an Joachim Gauck sind enorm – aber der Bundespräsident lässt sich nicht vereinnahmen<br />
VON ALEXANDER MARGUIER<br />
A<br />
NTRITTSREISEN sind für Bundespräsidenten<br />
protokollarisches Standardprogramm.<br />
Zum Beispiel<br />
der Besuch Nordrhein-Westfalens an einem<br />
regnerischen Montag Ende November: Um<br />
9:35 Uhr landet die Sondermaschine aus<br />
Berlin auf dem Düsseldorfer Flughafen,<br />
von dort geht es in einer Ehrfurcht gebietenden<br />
Wagenkolonne zur Staatskanzlei,<br />
wo ein Pulk brötchenkauender Journalisten<br />
auf den Moment wartet, in dem<br />
Joachim Gauck seinen Namen ins Goldene<br />
Buch setzt. Nach wenigen Minuten<br />
im Blitzlichtgewitter folgt die kurze Fahrt<br />
zur nächsten Begrüßungszeremonie, hinüber<br />
in den Landtag. Dann gleich weiter ins<br />
Düsseldorfer Rathaus, wo der Oberbürgermeister<br />
mit einer kurzen Rede aufwartet, in<br />
der er den Regen in der Landeshauptstadt<br />
als „Freudentränen“ über Gaucks Visite<br />
interpretiert. Der wiederum nimmt huldvoll<br />
eine weiße Reiterstatuette entgegen,<br />
bedankt sich artig für das Gastgeschenk –<br />
und bringt den ersten typischen Gauck-<br />
Spruch des Tages: „<strong>Die</strong> Menschen müssen<br />
erfahren, dass ihr Engagement sich lohnt.“<br />
Am nächsten Tag wird dieser Satz in den<br />
örtlichen Zeitungen nachzulesen sein.<br />
Gauck weiß um seine Wirkung, die<br />
sich speist aus einer Mischung von pastoraler<br />
Väterlichkeit, staatsmännischem Gestus<br />
und gleichzeitiger Tuchfühlung mit den<br />
Menschen, denen er begegnet. An einem<br />
Tag wie diesem zählen dazu: Kleinkinder in<br />
einem Duisburger Familienzentrum, Mitarbeiter<br />
einer Öko-Beratungsstelle, lokale<br />
Honoratioren, Streetworker, Bürger mit<br />
Ehrenamt sowie Herr und Frau Kronenberg<br />
aus Bottrop-Welheim, die gemeinsam<br />
mit ihren beiden Söhnen den Bundespräsidenten<br />
in ihrer vorbildlich energiesanierten<br />
Doppelhaushälfte in Empfang nehmen<br />
dürfen. Abends um neun Uhr trägt<br />
die Sondermaschine den Bundespräsidenten<br />
zurück nach Berlin. Dort, in der<br />
Hauptstadt, lassen sich derweil „führende<br />
FDP-Politiker“ anonym in der Presse mit<br />
den Worten zitieren, Gauck werbe nicht<br />
genug für die Idee von Europa. Und: Das<br />
Staatsoberhaupt rede „zu allgemein und zu<br />
pathetisch“ über das Thema Freiheit.<br />
Sollten diese „führenden FDP-Politiker“<br />
gehofft haben, dass sich Joachim Gauck für<br />
seine Kür bei den Liberalen bedankt, indem<br />
er öffentlich Steuersenkungen fordert,<br />
kann man deren Unmut durchaus nachvollziehen.<br />
Dann hätten sie allerdings nicht<br />
viel verstanden – weder von Gauck noch<br />
von dem Amt, zu dem sie ihm im Februar<br />
2012 gegen den Willen der Kanzlerin<br />
verhalfen. Aber auch die Kollegen von<br />
den Grünen und von der SPD dürften enttäuscht<br />
sein, falls sie die Erwartung hatten,<br />
ihr Kandidat würde sich parteipolitisch vereinnahmen<br />
oder gar gegen Angela Merkel<br />
in Stellung bringen lassen.<br />
Seit einem knappen Jahr ist der ehemalige<br />
Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen<br />
Deutschlands Staatsoberhaupt. Sein<br />
„privates, persönliches Ich“ sei „im Amt<br />
noch nicht ganz aufgegangen“, bekannte<br />
der Parteilose unlängst in einem Interview<br />
mit der Welt am Sonntag. Und schien damit<br />
alle Kritiker zu bestätigen, die jetzt monieren,<br />
er sei regelrecht verstummt.<br />
Natürlich gab es da diese viel beachtete<br />
Stelle im ZDF-Sommerinterview, an<br />
der Joachim Gauck sagte, die Bundeskanzlerin<br />
habe im Zuge ihrer Euro-Rettungspolitik<br />
„nun die Verpflichtung, sehr detailliert<br />
zu beschreiben, was das bedeutet,<br />
auch fiskalisch bedeutet“. Doch als Kritik<br />
will man den Halbsatz – entgegen der naheliegenden<br />
Interpretation – im Bundespräsidialamt<br />
nicht verstanden wissen. Eine<br />
etwas unglückliche Wortwahl sei das gewesen,<br />
heißt es beschwichtigend. Woraus<br />
wiederum zweierlei ersichtlich wird: Gauck<br />
beabsichtigt nicht, anders als etwa Horst<br />
Köhler, den bequemen Weg des Volkstribunen<br />
zu gehen, der sich auf Kosten<br />
der Regierung profiliert. Und: Sogar ein<br />
Freund des unverblümten Wortes wie der<br />
ehemalige Rostocker Pfarrer lässt sich als<br />
Staatsoberhaupt rhetorisch glatt schleifen.<br />
Beide Aspekte sind übrigens Facetten einer<br />
Staatsräson, die Gauck, der nie zuvor ein<br />
politisches Amt im engeren Sinne bekleidet<br />
hat, stärker zu beherzigen scheint als so<br />
mancher Vollprofi.<br />
Joachim Gauck und Angela Merkel sind<br />
sehr unterschiedliche Charaktere. Er, der<br />
leidenschaftliche Redner mit dem direkten<br />
Draht zum Publikum. Sie, die immer seltsam<br />
verstockt wirkende und auf Distanz<br />
bedachte Technikerin der Macht. Trotzdem<br />
können beide gut miteinander. Gauck trägt<br />
es der Kanzlerin nicht nach, dass sie seinen<br />
Einzug in Schloss Bellevue mit allen<br />
Mitteln verhindern wollte; auch bei Besprechungen<br />
im Kreise seiner engsten Mitarbeiter<br />
rede er nie schlecht über Merkel, heißt<br />
es. Womöglich verbinde sie der ähnliche Erfahrungshorizont<br />
aus der Wendezeit. In jedem<br />
Fall aber fänden die Regierungschefin<br />
und der Bundespräsident über ihren jeweils<br />
eigentümlich trockenen Humor gut zueinander,<br />
sagen Leute, die ihm nahestehen.<br />
Auf Gauck lastet ein enormer Erwartungsdruck<br />
– nicht nur durch die Parteien,<br />
auch durch die Bevölkerung. Er hat<br />
bisher keineswegs den Eindruck erweckt,<br />
als könne er diesem Druck nicht standhalten,<br />
im Gegenteil. Allein die Tatsache,<br />
dass seit dem unrühmlichen Abgang seines<br />
Vorgängers Christian Wulff sämtliche Diskussionen<br />
darüber verstummt sind, ob es<br />
das Amt des Bundespräsidenten überhaupt<br />
noch brauche, spricht für sich. Und was die<br />
große europapolitische Rede angeht, nach<br />
der die FDP so laut ruft: Anfang 2013 ist<br />
es dann so weit.<br />
A LEXANDER M ARGUIER<br />
ist stellvertretender<br />
Chefredakteur von <strong>Cicero</strong><br />
FOTOS: ANATOL KOTTE/LAIF, ANDREJ DALLMANN (AUTOR)<br />
38 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Joachim Gauck hat<br />
nicht vor, sich auf<br />
Kosten der Regierung<br />
zu profilieren<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 39
| B E R L I N E R R E P U B L I K<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
1 2 3<br />
4 5 6 7<br />
8 9 10 11 12<br />
Anna Thalbach,<br />
39, ist<br />
Schauspielerin.<br />
Rollen in<br />
Theater, Kino,<br />
Fernsehen und<br />
häufig mit<br />
ihrer Mutter<br />
Katharina<br />
Thalbach<br />
13 14 15 16<br />
(1) BUNDESKANZLERIN: Meine Mutter, die ist so gerecht; (2) VIZEKANZLERIN: Wenka von Mikulicz (Das<br />
ist meine Assistentin); (3) INNERES: Kurt Krömer; (4) JUSTIZ: Richter Alexander Hold; (5) FINANZEN:<br />
Peter Zwegat; (6) WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE: Stefan Raab; (7) ARBEIT UND SOZIALES:<br />
Gunter Gabriel; (8) ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT, VERBRAUCHERSCHUTZ: Reiner Calmund;<br />
(9) VERTEIDIGUNG: Axel Schulz; (10) FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND: Nena und Jorge<br />
Gonzalez (<strong>Die</strong> sollen das zusammen machen); (11) GESUNDHEIT: Ben Becker; (12) VERKEHR, BAU UND<br />
STADTENTWICKLUNG: Gina Lisa Schaffrath; (13) UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT:<br />
<strong>Die</strong> Jungs von Rammstein; (14) BILDUNG UND FORSCHUNG: Aiman Abdallah; (15) WIRTSCHAFTLICHE<br />
ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG: Sonya Kraus – äh Sonja Zietlow; (16) BUNDESMINISTER<br />
FÜR BESONDERE AUFGABEN UND CHEF DES BUNDESKANZLERAMTS: Hape Kerkeling<br />
ILLUSTRATION: JAN RIECKHOFF; FOTOS: PICTURE ALLIANCE (16), MONIQUE WÜSTENHAGEN, FLASHMEDIA BILD, OLIVER WIA<br />
40 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Unsere Programme<br />
jetzt auch im<br />
neuen Digitalradio<br />
Weitere Informationen:<br />
digitalradio.de<br />
deutschlandradio.de<br />
Hörerservice 0221.345-1831
| B E R L I N E R R E P U B L I K | 2 2 . S E P T E M B E R 2 0 1 3 – D E R T A G D E R E N T S C H E I D U N G<br />
„AUF DIE PLÄTZE …“<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Wettlauf um die Bundestagswahl<br />
im September 2013 geht los. <strong>Die</strong><br />
Nominierungsparteitage liegen hinter<br />
Der Countdown<br />
den Kandidaten, die Strecke und der<br />
Wahlkampf vor ihnen. Wer macht das Rennen? Und<br />
wer koaliert hinterher mit wem? <strong>Cicero</strong> greift den<br />
Dingen voraus und schildert die entscheidenden<br />
Stunden des Wahlsonntags aus der Sicht von Angela<br />
Merkel, Peer Steinbrück und Jürgen Trittin<br />
42 <strong>Cicero</strong> 1.2013
1.2013 <strong>Cicero</strong> 43
| B E R L I N E R R E P U B L I K | 2 2 . S E P T E M B E R 2 0 1 3 – D E R T A G D E R E N T S C H E I D U N G<br />
VOR DEN TRÜMMERN<br />
Kanzleramt, Wahlnacht, das Ergebnis liegt vor: <strong>Die</strong> FDP ist erledigt. Angela Merkel hat den<br />
Wunschpartner verloren. Abermals muss sie sich zur Retterin aus der eigenen Not machen<br />
VON G EORG PAUL H EFTY<br />
A<br />
N SCHLAF IST nicht zu denken.<br />
<strong>Die</strong> Nachwahlumfragen hatten<br />
ebenso wie die Hochrechnungen<br />
die größten Umwälzungen<br />
seit den achtziger Jahren angekündigt.<br />
Das vorläufige amtliche Endergebnis<br />
hat sie bestätigt. Für die Bevölkerung<br />
und die Theoretiker ist der<br />
Unterschied zu vorgestern geringfügig,<br />
für die Berufspolitiker hingegen umwerfend.<br />
Das Fünf-Fraktionen-Sechs-Parteien-Parlament<br />
ist im Grundsatz erhalten<br />
geblieben, an die Stelle der FDP<br />
sind die Piraten getreten, die wegen ihrer<br />
Unübersichtlichkeit ebenfalls als freiheitliche<br />
Demokraten gelten. Das haben<br />
die Liberalen sich selbst zuzuschreiben.<br />
Röslers oder doch Brüderles, Westerwelles,<br />
letztlich Genschers Partei ist mangels<br />
einiger Hundert Zweitstimmen an<br />
der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, die<br />
Piraten – kein Name außer dem Parteinamen<br />
selbst bedeutet da etwas – haben<br />
die Hürde mit derselben Anzahl von<br />
Stimmen übersprungen: Einige besonders<br />
Weitsichtige haben ihre Zukunft<br />
auf die neue Karte gesetzt.<br />
Angela Merkel steht mitten im Kanzleramt<br />
vor den Trümmern ihrer amtlich<br />
verkündeten Politik, der erst beschworenen<br />
und dann viel zu lange gepriesenen<br />
Wunschkoalition mit der FDP. Dabei war<br />
der Wunsch der CDU, erst recht der CSU,<br />
mit der FDP zu koalieren, in den ersten<br />
Sekunden nach deren unverschämtem –<br />
Merkels columbushafter Entdecker hätte<br />
treffender gesagt: ganz und gar unerträglichem<br />
– Wahlerfolg von damals 14,6 Prozent<br />
im Herbst 2009 verflogen. Von da an<br />
war es die Pflicht der CDU-Vorsitzenden,<br />
die FDP nie mehr die Hälfte der Stimmenzahl<br />
der CDU erreichen zu lassen. Nun ist<br />
die CDU wieder um ein Vielfaches stärker<br />
als die FDP, aber die Kanzlerkandidatin<br />
steht ohne „natürlichen“ Koalitionspartner<br />
da. „Ihr Wunschpartner, verehrte Frau<br />
Bundeskanzlerin, hat sich in nichts aufgelöst.“<br />
So hatte es die Linke-Vorsitzende<br />
„Ich mach’s“, sagt sie.<br />
„Lassen wir die anderen<br />
erst mal zappeln“<br />
Kipping in der Elefantenrunde und vor wenigen<br />
Minuten auch der Chefredakteur des<br />
Bayerischen Rundfunks gesagt. „Anstatt<br />
dass der mich dafür loben würde“, spottet<br />
sie, „mir ist doch gelungen, was Strauß<br />
gewollt, aber weder er noch seine Erben<br />
geschafft haben.“<br />
Merkels Strategie ist nicht das Kämpfen<br />
für Erfolge, sondern das Beseitigen von<br />
Gegnern, dann stellen sich ihre Erfolge von<br />
selber ein. Ein Anflug von Stolz huscht im<br />
Kreis der Getreuen über ihr Gesicht. Für<br />
den Moment wirkt sie wieder so mädchenhaft<br />
wie auf dem Foto im Jubiläumsband<br />
des Aachener Karlspreises.<br />
Doch nun ist nicht nur die FDP einstweilen<br />
erledigt, ihre eigene Zukunft steht<br />
auf dem Spiel. Während Pofalla, Gröhe, de<br />
Maizière und Kauder auf sie einreden und<br />
Beate Baumann wie Eva Christiansen ganz<br />
im Sinne der Chefin sich ein Mona-Lisahaftes<br />
Lächeln gönnen nach dem Motto<br />
„Wie mitleidheischend sind doch die<br />
Männer, wenn sie sich auf ihre eigene<br />
Potenz nicht verlassen können“, macht<br />
sich Angela Merkel daran, sich neu zu<br />
erfinden oder sich von neuem in die<br />
Rolle der Retterin aus eigener wie fremder<br />
Not hineinzufinden.<br />
Ohne den alten Koalitionspartner<br />
ist das Fundament ihrer dritten Kanzlerschaft<br />
dahin, ihr Anspruch auf den<br />
Verbleib im Kanzleramt brennt umso<br />
mehr in ihr. <strong>Die</strong> Gedanken gehen zurück<br />
zu einem Artikel, der vor der Bundestagswahl<br />
2009 beleuchtet hatte, wie<br />
verwegen ihr Entschluss war, aus der<br />
Koalition mit der SPD heraus nach der<br />
vermeintlich schwächeren FDP zu greifen.<br />
Noch nie hatte bis dahin ein Kanzler<br />
den Wechsel der eigenen Partei in<br />
eine andersfarbige Koalition politisch<br />
überlebt. Mehr noch: Seit 1963 hatte jedes<br />
neue Parteienbündnis seinen eigenen<br />
Kanzler, der spätestens mit dem Ende des<br />
Bündnisses selbst erledigt war. <strong>Die</strong>s galt<br />
auch für Ludwig Erhard, den sich das<br />
„Mädchen“ im Amt der Bundesjugendministerin<br />
einst zum Vorbild genommen<br />
hatte. 1991 antwortete sie auf die Frage,<br />
was sie später einmal sein wolle, mit Unschuldsmiene:<br />
„Wirtschaftsminister wie<br />
Ludwig Erhard.“ Als ihr entgegengehalten<br />
wurde, Erhard sei der einzige Wirtschaftsminister<br />
gewesen, der es zum Bundeskanzler<br />
gebracht hatte, schwieg sie. Dass selbst<br />
große Beliebtheit im Volk nicht weit genug<br />
ILLUSTRATIONEN: WIESLAW SMETEK (SEITEN 42 BIS 44)<br />
44 <strong>Cicero</strong> 1.2013
I M P R E S S U M<br />
FOTO: FAZ<br />
trägt, um die eigene Kanzlerschaft in eine<br />
andere Koalition hinüberzuretten oder, etwas<br />
anders gesagt, die eigene Kanzlerschaft<br />
mit einer neuen Koalition zu retten, dafür<br />
war Erhard Beweis genug. Solange auch<br />
nur ein Einziger in der eigenen Partei als<br />
kanzleramtsfähig gilt, wie Kurt Georg Kiesinger<br />
zur Zeit Erhards, ist der Amtsinhaber<br />
Spielball in den Händen zweitrangiger<br />
Parteifreunde.<br />
Merkel lässt in sich gekehrt die Gefährdungen<br />
Revue passieren. Sie ist überzeugt,<br />
dass die SPD weder mit der Linken<br />
noch mit den Piraten regieren wolle. Also<br />
bleibt es an ihr, zwischen der SPD und den<br />
Grünen als Partner zu wählen. Den Joker<br />
Trittins, in Koalitionsverhandlungen die<br />
Macht der Grünen zu steigern, indem sie<br />
im Amt des Kanzlers den Wechsel zu Röttgen<br />
durchsetzen, hatte Merkel unter Mittun<br />
Seehofers aus dem Spiel genommen,<br />
sobald amtlich war, dass Röttgen nicht als<br />
Ministerpräsident an NRW gefesselt sein<br />
würde. Den Ehrgeiz der Sozialministerin<br />
von der Leyen, eine abermalige große Koalition<br />
für den eigenen Einzug ins Kanzleramt<br />
zu nutzen, hatte sie im Wahlkampf<br />
so unbarmherzig bloßgestellt, wie es einst<br />
Kohl mit den Kanzlerambitionen des Vaters<br />
Albrecht getan hatte. Wo bitte ist jetzt<br />
noch jemand in der Union, der als Regierungschef<br />
infrage käme? Merkel schließt<br />
die Augen, sogleich bangen die Herren<br />
rundum, die Chefin könnte doch amtsmüde<br />
sein. Sie hingegen zitiert jeden Einzelnen<br />
vor ihr geistiges Auge, ohne dass ihr<br />
Blick unwillkürlich verriete, an welchen der<br />
Herren sie gerade denkt. Von diesen droht<br />
keine Gefahr, nicht einmal von Schäuble,<br />
schon gar nicht von de Maizière! Sie wendet<br />
sich Christiansen zu. „Ich mach’s“, sagt<br />
sie, „aber lassen wir die anderen erst einmal<br />
zappeln. Es reicht, wenn ich darauf bestehe,<br />
dass eine Koalition gegen die CDU<br />
den Wählerwillen hintergehen würde.“<br />
„Im Morgenmagazin“, schlägt Christiansen<br />
vor, „im Morgenmagazin“ bekräftigt<br />
Baumann. Merkel genügt es zu schweigen –<br />
wie 1991, als sie erstmals mit der K-Frage<br />
konfrontiert wurde.<br />
G EORG PAUL H EFTY<br />
war langjähriger leitender<br />
politischer Redakteur der FAZ<br />
VERLEGER Michael Ringier<br />
CHEFREDAKTEUR Christoph Schwennicke<br />
STELLVERTRETER DES CHEFREDAKTEURS<br />
Alexander Marguier<br />
REDAKTION<br />
TEXTCHEF Georg Löwisch<br />
RESSORTLEITER Judith Hart (Weltbühne), Til Knipper<br />
(Kapital), Dr. Alexander Kissler (Salon), Constantin Magnis<br />
(Reportagen), Christoph Seils (<strong>Cicero</strong> Online)<br />
POLITISCHER CHEFKORRESPONDENT Hartmut Palmer<br />
ASSISTENZ DER CHEFREDAKTION Ulrike Gutewort<br />
REDAKTIONSASSISTENZ Monika de Roche<br />
PUBLIZISTISCHER BEIRAT Heiko Gebhardt,<br />
Klaus Harpprecht, Frank A. Meyer, Jacques Pilet,<br />
Prof. Dr. Christoph Stölzl<br />
ART DIRECTOR Kerstin Schröer<br />
BILDREDAKTION Antje Berghäuser, Tanja Raeck<br />
PRODUKTION Utz Zimmermann<br />
VERLAG<br />
GESCHÄFTSFÜHRUNG<br />
Rudolf Spindler<br />
VERTRIEB UND UNTERNEHMENSENTWICKLUNG<br />
Thorsten Thierhoff<br />
REDAKTIONSMARKETING Janne Schumacher<br />
ABOMARKETING Mark Siegmann<br />
NATIONALVERTRIEB/LESERSERVICE<br />
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH<br />
Düsternstraße 1–3, 20355 Hamburg<br />
ANZEIGEN-DISPOSITION Erwin Böck<br />
HERSTELLUNG Lutz Fricke<br />
GRAFIK Franziska Daxer, Dominik Herrmann<br />
DRUCK/LITHO NEEF+STUMME, premium printing<br />
GmbH & Co.KG, Schillerstraße 2, 29378 Wittingen<br />
Holger Mahnke, Tel.: +49 (0)5831 23-161<br />
cicero@neef-stumme.de<br />
SERVICE<br />
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,<br />
haben Sie Fragen zum Abo oder Anregungen und Kritik zu einer<br />
<strong>Cicero</strong>-Ausgabe? Ihr <strong>Cicero</strong>-Leserservice hilft Ihnen gerne weiter.<br />
Sie erreichen uns werktags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr und<br />
samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr.<br />
ABONNEMENT UND NACHBESTELLUNGEN:<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Telefon: 0800 282 20 04 (kostenfrei)<br />
Telefax: 0800 77 88 790 (kostenfrei)<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Online: www.cicero.de/abo<br />
ANREGUNGEN UND LESERBRIEFE:<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserbriefe<br />
Friedrichstraße 140<br />
10117 Berlin<br />
E-Mail: info@cicero.de<br />
*Preise inkl. gesetzlicher MwSt und Versand im Inland, Auslandspreise auf<br />
Anfrage. Der Export und Vertrieb von <strong>Cicero</strong> im Ausland sowie das Führen von<br />
<strong>Cicero</strong> in Lesezirkeln ist nur mit Genehmigung des Verlags statthaft.<br />
ANZEIGENLEITUNG (verantw. für den Inhalt der Anzeigen)<br />
Tina Krantz, Anne Sasse<br />
ANZEIGENVERKAUF ONLINE Kerstin Börner<br />
ANZEIGENMARKETING Inga Müller<br />
ANZEIGENVERKAUF BUCHMARKT<br />
Thomas Laschinski, PremiumContentMedia<br />
<strong>Die</strong>ffenbachstraße 15 (Remise), 10967 Berlin<br />
Tel.: +49 (0)30 609 859-30, Fax: -33<br />
VERKAUFTE AUFLAGE 82 670 (IVW Q3/2012)<br />
LAE 2012 93 000 Entscheider<br />
REICHWEITE 390 000 Leser<br />
CICERO ERSCHEINT IN DER<br />
RINGIER PUBLISHING GMBH<br />
Friedrichstraße 140, 10117 Berlin<br />
info@cicero.de, www.cicero.de<br />
REDAKTION Tel.: +49 (0)30 981 941-200, Fax: -299<br />
VERLAG Tel.: +49 (0)30 981 941-100, Fax: -199<br />
GRÜNDUNGSHERAUSGEBER Dr. Wolfram Weimer<br />
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in<br />
Onlinedienste und Internet und die Vervielfältigung auf<br />
Datenträgern wie CD-ROM, DVD-ROM etc. nur nach<br />
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags.<br />
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder<br />
übernimmt der Verlag keine Haftung.<br />
Copyright © 2012, Ringier Publishing GmbH<br />
V.i.S.d.P.: Christoph Schwennicke<br />
Printed in Germany<br />
EINE PUBLIKATION DER RINGIER GRUPPE<br />
EINZELPREIS<br />
D: 8,- €, CH: 12,50 CHF, A: 8,- €<br />
JAHRESABONNEMENT (ZWÖLF AUSGABEN)<br />
D: 84,- €, CH: 132,- CHF, A: 90,- €*<br />
Schüler, Studierende, Wehr- und Zivildienstleistende<br />
gegen Vorlage einer entsprechenden<br />
Bescheinigung in D: 60,- €, CH: 108,- CHF, A: 72,- €*<br />
<strong>Cicero</strong> erhalten Sie im gut sortierten<br />
Presseeinzelhandel sowie in Pressegeschäften<br />
an Bahnhöfen und Flughäfen.<br />
Falls Sie <strong>Cicero</strong> bei Ihrem Pressehändler<br />
nicht erhalten sollten, bitten Sie ihn, <strong>Cicero</strong> bei<br />
seinem Großhändler nachzubestellen. <strong>Cicero</strong> ist<br />
dann in der Regel am Folgetag erhältlich.<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 45
| B E R L I N E R R E P U B L I K | 2 2 . S E P T E M B E R 2 0 1 3 – D E R T A G D E R E N T S C H E I D U N G<br />
ES REICHT NICHT<br />
Peer Steinbrücks Fahrt in die Parteizentrale: Wie ihm Winston Churchill weiterhilft,<br />
Matthias Machnig in Gotha feststeckt und Gerhard Schröder eine Idee hat<br />
VON C HRISTOP H S CHW ENNICKE<br />
D<br />
ER DUNKLE AUDI A8 rauscht<br />
von Hamburg kommend mit<br />
Tempo 230 am Dreieck Wittstock-Dosse<br />
vorbei. „Peer,<br />
für dich. Der Donnermeyer.“<br />
Hans-Roland Fäßler, Freund, Coach, One-<br />
Dollar-Man, reicht Steinbrück auf dem<br />
Rücksitz des Wagens das Handy rüber.<br />
16 Uhr 37, eineinhalb Stunden, bis die<br />
Wahllokale schließen und 72 Kilometer<br />
bis zum Willy-Brandt-Haus in Berlin,<br />
wie das Navi anzeigt.<br />
„Ja, Michael?“<br />
Steinbrücks massiges Gesicht bekommt<br />
einen starren Zug, darin dieses<br />
Steinbrück’sche Wolfsgrinsen, das<br />
immer etwas von Lachen und Fletschen<br />
zugleich hat. Fäßler hört bruchstückhaft<br />
die Zahlen, die Donnermeyer<br />
vermeldet. „Danke, Michael, wir sehen<br />
uns gleich im WBH. Und ruf meine<br />
Frau bitte noch an, damit sich wenigstens<br />
eine freut.“ Steinbrück tapst linkisch<br />
auf Fäßlers Handy herum, bis der<br />
es ihm wegnimmt.<br />
„Und?“, fragt Fäßler.<br />
Steinbrück richtet sich in den Ledersitzen<br />
auf, er weiß nicht genau, was<br />
mehr dröhnt in seinem Schädel: Donnermeyers<br />
Zahlen oder der Weißwein vom andern<br />
Abend nach der letzten Kundgebung<br />
in Hamburg. Er reckt das Kinn und sagt in<br />
geschliffenem Englisch und mit verstellter<br />
Stimme: „Let us therefore brace ourselves<br />
to our duties, and so bear ourselves that, if<br />
the British Empire and its Commonwealth<br />
last for a thousand years, men will still say:<br />
‚This was their finest hour‘.“<br />
Es ist die Schlüsselpassage einer der drei<br />
<strong>wichtigsten</strong> Kriegsreden Winston Churchills.<br />
Steinbrück hat was übrig für den<br />
englischen Bollerkopf. Fäßler hat ihm im<br />
Frühjahr die BBC-Mitschnitte auf CD geschenkt,<br />
er hört sie im Auto, bis er sie mit<br />
aufsagen kann. We shall never surrender.<br />
Churchill hat ihm geholfen in diesen Monaten.<br />
Nicht aufgeben, weitermachen, das<br />
Gefühl von Aussichtslosigkeit abschütteln.<br />
Schröders Zigarre hüllt<br />
den Raum in Rauch.<br />
„Jürgen hat recht“, sagt er<br />
Michael Donnermeyer, Haudegen aus<br />
Schröders Zeiten und Steinbrücks reaktiver<br />
Legionär für den Wahlkampf, hatte<br />
dem Kandidaten eben die Trends zugerufen.<br />
29 Prozent sagen die Befragungen an<br />
den Wahlkabinen für die SPD voraus, 12<br />
für die Grünen. Das reicht nicht für Rot-<br />
Grün. Hinten nicht und vorne auch nicht.<br />
Der Audi passiert den Berliner Betonbären,<br />
da, wo die Autobahn kurvig wird<br />
und man besser die Tempo-60-Schilder berücksichtigt.<br />
„Haben Sie Ihre meditative<br />
Phase?“, herrscht Steinbrück den Fahrer<br />
an. Der beschleunigt, ein roter Blitz von<br />
der Straßenseite, und Steinbrücks Fahrt ins<br />
Willy-Brandt-Haus ist hiermit auch polizeilich<br />
festgehalten. Es klingelt wieder ein<br />
Handy. „Hallo Gerhard“, sagt Steinbrück,<br />
und Fäßler versucht mitzuhören. Schröders<br />
Stimme ist so sonor, dass das sogar<br />
geht. Der Name Kipping fällt, Steinbrücks<br />
Miene verfinstert sich. „Dass gerade du<br />
mir das rätst“, sagt er. „Bis gleich im<br />
WBH.“<br />
Oben im fünften Stock haben sich<br />
die üblichen Verdächtigen eingefunden.<br />
Auch Andrea Nahles, die Generalsekretärin,<br />
die Steinbrück im Laufe<br />
des Wahlkampfs schätzen gelernt hat,<br />
auch weil er vorher die charakterlichen<br />
Abgründe des Mannes kennengelernt<br />
hatte, in dessen Büro sich jetzt<br />
alle um den Konferenztisch versammeln.<br />
Drei Flaschen Weißwein stehen<br />
bereit, Steinbrück packt eine am<br />
Hals, als wollte er sie würgen wie eine<br />
Ente, und greift nach dem Korkenzieher.<br />
„Hoffentlich keiner unter 5 Euro“,<br />
versucht er es mit einem Witz auf eigene<br />
Kosten.<br />
Schröder kommt rein. Steinbrück<br />
beobachtet ihn interessiert, als sähe er<br />
ihn zum ersten Mal im Leben: Mein Gott,<br />
der ist ja fast so klein wie die Willy-Statuette<br />
vor Gabriels Zimmer. Er sagt: „Good<br />
to see you, Gerd.“ Er spricht es aus wie:<br />
Görd.<br />
Sigmar Gabriel betritt den Raum. Auch<br />
ihn betrachtet der Kandidat verwundert.<br />
Mein Gott, der Gabriel ist ja fast so breit<br />
wie der Calmund. Er sagt: „Hallo Sigmar!“<br />
Das Vorzimmer stellt Matthias Machnig<br />
aufs Telefon, und Gabriel drückt die<br />
Lautsprechertaste. Machnig hängt in Thüringen<br />
fest, in Gotha, ausgerechnet Gotha,<br />
die Bahn, Störungen im Betriebsablauf. Er<br />
ist blockiert, aber er klingt wie meistens<br />
ILLUSTRATION: WIESLAW SMETEK<br />
46 <strong>Cicero</strong> 1.2013
FOTO: ANDREJ DALLMANN<br />
Anzeige<br />
etwas verschwitzt. <strong>Die</strong> FDP, sagt Machnig:<br />
Bei 5 Prozent sehen die vorläufigen Prognosen<br />
die Liberalen.<br />
Ampel? Kanzler einer Ampel? Grüne<br />
und Liberale zusammenhalten, Öko-Etatisten<br />
und Marktanbeter, Feuer und Wasser<br />
versöhnen? Steinbrück braucht dringend<br />
einen Schluck Feuerwasser.<br />
Unten im Atrium, bei der großen<br />
Willy-Statue versammeln sich die Journalistengrüppchen<br />
vor den Fernsehern. Es geht<br />
auf 18 Uhr zu. „Mach ma’n Fernseher an“,<br />
sagt Schröder zu Nahles. Bettina Schausten<br />
ist zu sehen, das Mikro vor dem Mund,<br />
ein wichtiges Gesicht machend, redet die<br />
ZDF-Frau die letzten Sekunden weg, bevor<br />
die farbigen Türme das erste Mal an<br />
diesem Abend aufsteigen. Der rote Turm<br />
stagniert bei 28,5 Prozent. Der schwarze<br />
ragt weit über ihn hinaus. Der grüne Turm<br />
wächst und wächst und bleibt bei 12,1 Prozent.<br />
„Das reicht nicht“, sagt Gabriel und<br />
spricht aus, was alle denken. Schröder versucht<br />
es mit Optimismus. „Abwarten. Hinten<br />
sind die Enten fett.“ Den Spruch hat<br />
er mal als niedersächsische Bauernweisheit<br />
aufgeschnappt. Er passt fast immer.<br />
Aber er stimmt nicht immer. Das weiß<br />
Schröder selbst. Just in diesem Raum<br />
schrumpfte seine Hoffnung 2005, auch<br />
wenn ihm Manfred Güllner noch auf dem<br />
Weg in die Elefantenrunde zugerufen hatte,<br />
es könne noch reichen, was ihn so aufgepeitscht<br />
hatte in der Sendung.<br />
Jürgen Trittin ist in der Leitung. Rot-<br />
Rot-Grün, darauf will der Grüne hinaus.<br />
Steinbrück hat das Bündnis mit sich als<br />
Kanzler genauso oft ausgeschlossen wie<br />
eine Vizekanzlerschaft unter Merkel.<br />
Gerhard Schröders Zigarre hat inzwischen<br />
den ganzen Raum in Nebel gehüllt.<br />
„Der Jürgen hat recht“, sagt er hinter seinen<br />
Schwaden.<br />
<strong>Die</strong> Dame aus dem Vorzimmer kommt<br />
rein. Zwei Anrufer auf zwei Leitungen, wen<br />
sie durchstellen solle: Lafontaine oder<br />
Merkel?<br />
Alle schauen auf Steinbrück, alles ist<br />
starr, als hätte ein beinkalter Wind die<br />
Szene in Eis gefroren.<br />
„<strong>Die</strong> Merkel“, sagt Steinbrück.<br />
C HRISTOP H S CHW ENNICKE<br />
ist Chefredakteur von <strong>Cicero</strong><br />
Herzlichen Dank für Ihr<br />
Berlin-Engagement!<br />
www.berlin-partner.de<br />
Starke Partner für ein starkes Berlin.
| B E R L I N E R R E P U B L I K | 2 2 . S E P T E M B E R 2 0 1 3 – D E R T A G D E R E N T S C H E I D U N G<br />
SO GEHT EIN TRITTIN NICHT<br />
Wahlsonntag, nach 16 Uhr, in seiner Wohnung fährt sich Jürgen Trittin durchs Haar. Es reicht<br />
nicht für Rot-Grün. Wie soll er jetzt noch historisch werden? Er macht sich an die Arbeit<br />
VON PETER U NFRIED<br />
T<br />
RITTIN SCHAUT AUF sein HTC<br />
Android Smartphone. „Das<br />
wär’ jetzt auch zu einfach gewesen“,<br />
murmelt er. Es ist Sonntag,<br />
16 Uhr. Er war gerade dabei, in<br />
seinen Finanzminister-Anzug zu steigen,<br />
als er die Vorprognose der Bundestagswahl<br />
gesimst bekam. Nichts entschieden<br />
– außer, dass es für Rot-Grün nicht<br />
reicht. Er fährt sich mit der Rechten<br />
durch die Frisur. Das soll er nicht, sagen<br />
seine Berater immer. Weil es nicht<br />
gut aussähe beim Zustand seiner Haare.<br />
Joschka hat selbstverständlich eine<br />
dichte Matte. Ihm sind die Sachen immer<br />
zugefallen. <strong>Die</strong> Frauen auch. <strong>Die</strong><br />
erste rot-grüne Bundesregierung gilt<br />
als sein historisches Verdienst. Obwohl<br />
sie das damals nur gemeinsam<br />
geschafft haben oder vielleicht besser<br />
formuliert: zu zweit. Aber immer hieß<br />
es nur: Joschka Fischer, Number One.<br />
Trittin ist klar, dass seine historische<br />
Aufgabe nur darin bestehen kann,<br />
die Grünen in ihre zweite Bundesregierung<br />
zu führen. Das und nur das<br />
wird ihn in der Geschichte der Bundesrepublik<br />
auf eine Stufe mit Joschka<br />
stellen. Wenn nicht gar eine halbe Stufe<br />
darüber, denn dann waren beide Vizekanzler,<br />
aber nur er war zweimal Minister.<br />
<strong>Die</strong> Grünen in weitere vier Jahre Opposition<br />
zu führen, ist dagegen definitiv nicht<br />
historisch. Sondern zum Kotzen. Klar, er<br />
könnte weiter den Fraktionsvorsitzenden<br />
machen. Aber was wäre die Regierungsperspektive?<br />
Und ewig wird er die sogenannten<br />
Jungen auch nicht mehr ruhig<br />
halten können. Egal, wie feige Özdemir<br />
bisher agiert hat. Nach anderthalb Jahren<br />
kommen die und wollen den Wechsel. So<br />
geht ein Trittin nicht.<br />
„Kanzlerin kontaktieren,<br />
Katrin“, simst Trittin.<br />
Tolle Alliteration<br />
Selbstverständlich hat er im Wahlkampf<br />
hunderttausendmal erklärt, warum<br />
eine Koalition mit der Union auszuschließen<br />
sei. Vermögensabgabe, Spitzensteuersatz,<br />
Mindestlohn, Quote hier, fehlender<br />
Anstand dort. Er hat sein grimmiges Gesicht<br />
gemacht, als Katrin Göring-Eckardt<br />
beim Parteitag „Grün oder Merkel“ rief …<br />
das war ja auch irgendwie süß.<br />
Er schickt ihr gleich mal eine SMS.<br />
„Kanzlerin kontaktieren, Katrin.“ Tolle<br />
Alliteration.<br />
Und … was schreibt diese sogenannte<br />
Spitzenkandidatin? „Mach du das, bitte.“<br />
Auf keinen Fall. Das könnte später auf<br />
ihn zurückfallen.<br />
„Nein, du.“<br />
„Okay.“<br />
Na, bitte.<br />
Im Parteirat hat er schon vor über einem<br />
Jahr gesagt, dass man zur Not auch<br />
Schwarz-Grün machen würde, auch wenn<br />
die Schnittmengen mit der SPD größer<br />
waren. Aber was nutzt eine Schnittmenge<br />
ohne Mehrheit?<br />
Während Katrin die Kanzlerin anbaggert,<br />
ruft er mal schnell die Nummer von<br />
Jürgen Reents auf, seinem alten Kumpel<br />
vom undogmatischen Kommunistischen<br />
Bund. Klar, dass er auch Rot-<br />
Grün-Rot austesten muss. Moment,<br />
Telefon klingelt … ah, da ist Reents ja<br />
schon. Gedankenübertragung.<br />
„<strong>Die</strong> Zeit für Rot-Rot-Grün ist gekommen“,<br />
sagt Reents.<br />
„Rot-Grün-Rot, wenn schon“, sagt<br />
Trittin. Und du mich auch, sagt sein<br />
Gesicht.<br />
Er hat das ja nun seit zwei Jahren<br />
durchgespielt. Zeit war ja. Er weiß definitiv,<br />
dass er kein historischer Staatsmann<br />
wird, wenn er mit zwei Sorten<br />
Rot regieren muss, die sich noch<br />
mehr hassen als Rote und Grüne. Das<br />
macht er nur, wenn sonst gar nichts<br />
geht. Er tippt eine SMS an Gabriel:<br />
„Rot-Grün-Rot sondieren, Kanzler.“<br />
Dabei lächelt er sein Trittin-Lächeln,<br />
aber das sieht Gabriel ja nicht. Das HTC<br />
Android vibriert. „Gerhard Schick“ leuchtet<br />
auf. „Ja, haben wir jetzt Bürgerstunde<br />
oder was?“, blafft Trittin und drückt den<br />
Anruf weg.<br />
Er macht sich auf den Weg von seinem<br />
Haus in Treptow zur Grünen-Wahlparty,<br />
wo er im Nebenzimmer mit den anderen<br />
verabredet ist. An einer Ampel hält<br />
sein Fahrer an. „Steinbrück“, entfährt es<br />
Trittin. Er wählt die Nummer. Das hat er<br />
bis jetzt rausgezögert, weil er sich vorstellen<br />
kann, wie miserabel der gelaunt ist. Aber<br />
das muss sein. Nicht dass Steinbrück direkt<br />
bei der Schausten an Steinmeier übergibt<br />
ILLUSTRATION: WIESLAW SMETEK<br />
48 <strong>Cicero</strong> 1.2013
F R A U F R I E D F R A G T S I C H …<br />
ILLUSTRATION: JAN RIECKHOFF; FOTO: ANJA WEBER<br />
und die Große Koalition nicht mehr rückholbar<br />
ist. Alles, nur das nicht.<br />
„Sprich mit Lindner“, sagt er zu Steinbrück.<br />
Mehr nicht. Obwohl Trittin eigentlich<br />
immer weiß, was seine Partei mitmacht,<br />
ist er nicht 100-prozentig sicher,<br />
dass Schwarz-Grün durchgehen würde.<br />
<strong>Die</strong> SPD soll auch mal die Ampel austesten.<br />
In dem kleinen Raum hinter der Wahlparty-Halle<br />
sitzt Claudia Roth unter einem<br />
funkelnden Kronleuchter. Umarmung.<br />
Dann quatscht sie ihm das Ohr mit Rot-<br />
Grün-Rot voll. Sie verstummt, als er erklärt,<br />
dass in einer Drei-Parteien-Regierung für<br />
sie auf keinen Fall ein Ministeramt abfällt.<br />
Sonst auch nicht. Sagt er aber nicht.<br />
Jetzt kommt Göring-Eckardt und wirft<br />
ihre Haare durch die Luft. Trittin schaut<br />
interessiert; Roth schaut giftig. Er nimmt<br />
Göring-Eckardt schnell beiseite, um zu erfahren,<br />
was die Kanzlerin gesagt hat.<br />
Erste Hochrechnung. <strong>Die</strong> Claqeure<br />
vom Berliner Landesverband verausgaben<br />
sich, damit es im Fernsehen aussieht, als sei<br />
alles ganz toll. Um 18:30 Uhr geht er auf<br />
die Bühne, Göring-Eckardt ist dabei. Er<br />
hebt die Hände in die Höhe, dankt und<br />
sagt, dass es angesichts des Ergebnisses als<br />
Demokrat selbstverständlich sei, mit allen<br />
Parteien zu sprechen, selbst mit der FDP. Er<br />
ruft, dass die Mitte grün sei, dass es nicht<br />
um Personen gehe, sondern um Inhalte.<br />
Dramaturgische Pause. Während die Claqeure<br />
ihre Arbeit verrichten, piepst es in<br />
seiner Jacke und er liest schnell die SMS.<br />
„Kraftvoll in die Opposition! Joschka.“<br />
Selbst hinten in der Halle sieht man,<br />
wie sich sein Körper spannt. Jetzt gilt es.<br />
„Es ist die entscheidende Aufgabe unserer<br />
Zeit, die Energiewende in Deutschland<br />
zum Gelingen zu bringen“, sagt er. Das<br />
sei mit einer Koalition von CDU und SPD<br />
unmöglich. Das gehe nur mit den Grünen.<br />
Hinter dieser historischen und globalen<br />
Verantwortung müsse alles zurückstehen.<br />
Er nimmt die Rechte aus der Hosentasche,<br />
fährt sich durchs Haar, verschränkt dann<br />
die Hände vor der Brust. Für einen Moment<br />
bekommen die Leute im Raum sein<br />
maliziöses Lächeln zu sehen. Joschka, sagt<br />
dieses Lächeln: Be my Number Two.<br />
PETER U NFRIED<br />
ist Chefreporter der taz in Berlin<br />
… wo eigentlich heute die<br />
Front verläuft?<br />
F<br />
RÜHER HÄTTE ICH mit einem, der<br />
Franz Josef Strauß wählt, nicht<br />
mal geredet. Heute bin ich mit<br />
Leuten befreundet, die nicht nur für Mitt<br />
Romney gestimmt haben, sondern auch<br />
daran glauben, dass Homosexualität eine<br />
Todsünde ist und Gott die Welt vor<br />
6000 Jahren erschaffen hat. Sie halten<br />
Obama für einen getarnten Moslem<br />
und natürlich für einen Sozialisten.<br />
Unsere politischen Ansichten<br />
könnten nicht weiter voneinander<br />
entfernt sein, und wenn ich mit<br />
ihnen diskutiere, stehen mir die<br />
Haare zu Berge. Trotzdem schätze<br />
und achte ich sie und habe ihnen<br />
sogar meine Kinder anvertraut. Mein<br />
Sohn und meine Tochter haben jeweils<br />
ein Jahr bei ihnen in Kentucky gelebt und<br />
eine wertvolle Lektion in Toleranz und Respekt gelernt. Sie besuchten jeden Sonntag<br />
die Gottesdienste der „Kirche des lebendigen Wassers“, durften mit zu Wahlkampfveranstaltungen<br />
von Sarah Palin und wurden mit Fox News dauerberieselt.<br />
Sie führten lange Gespräche mit ihrer Gastmutter und lernten zu verstehen, dass<br />
Menschen auf erstaunliche Weise anders denken und dennoch ähnliche Grundwerte<br />
haben können.<br />
Mein schön geordnetes Weltbild ist – nicht nur durch diese Erfahrung – ins<br />
Wanken gekommen. Heute rede ich nicht nur mit CDU-Wählern, ich muss sogar<br />
zugeben, dass Ursula von der Leyen in kürzester Zeit mehr für Frauen und Familien<br />
getan hat als die SPD in Jahrzehnten. Der ehemalige NRW-Familienminister<br />
Armin Laschet (CDU) ist ein so vernünftiger Mann – man kann nur bedauern,<br />
dass Hannelore Kraft ihn in ihrem Kabinett nicht weiter beschäftigen konnte.<br />
Und dass Heiner Geißler nicht längst die Partei gewechselt hat, ist wohl nur seinem<br />
unbändigen Spaß an der Provokation zuzuschreiben. Zum Ausgleich gibt’s in<br />
der CDU glücklicherweise noch Erika Steinbach und Volker Kauder, die dafür sorgen,<br />
dass man nicht beginnt, am eigenen Verstand zu zweifeln.<br />
Andererseits gehen mir viele Vertreter der Linken mit ihrer Verbohrtheit auf<br />
die Nerven, ebenso wie einige grüne Ökospießer, von den Piraten ganz zu schweigen.<br />
Mit Staunen nehme ich weiterhin zur Kenntnis, dass der Kanzlerkandidat der<br />
SPD den Kapitalismus besser begriffen hat als mancher Wirtschaftsliberale in der<br />
FDP, und so frage ich mich, wo eigentlich heute die Front verläuft? Wo kann ich<br />
mich weltanschaulich verorten, wenn nicht mehr klar ist, wer die Guten und wer<br />
die Bösen sind? Einerseits finde ich es toll, dass uns die Ideologie nicht mehr automatisch<br />
den Blick auf einen Menschen verstellt, andererseits war die Welt früher<br />
übersichtlicher. Manchmal wünsche ich mir deshalb die alten Feindbilder zurück.<br />
Und hin und wieder sogar Franz Josef Strauß.<br />
A MELIE F RIED ist Fernsehmoderatorin und Bestsellerautorin. Für <strong>Cicero</strong> schreibt sie über<br />
Männer, Frauen und was das Leben sonst noch an Fragen aufwirft<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 49
Das <strong>Cicero</strong>-Abonnement:<br />
<strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis: Sie sparen über 10 % gegenüber dem Einzelkauf.<br />
<strong>Cicero</strong> portofrei und bequem nach Hause geliefert.<br />
Wählen Sie zusätzlich ein Dankeschön aus unserer <strong>Cicero</strong>-Kollektion.<br />
Eine größere Dankeschön-Auswahl finden Sie unter www.cicero.de/weihnachten
<strong>Cicero</strong> lesen<br />
oder verschenken.<br />
Bringen Sie sich Monat für Monat in angenehme Erinnerung, und beschenken<br />
Sie Freunde oder sich selbst mit einem <strong>Cicero</strong>-Abonnement.<br />
Zum Dank erhalten Sie zusätzlich ein Geschenk Ihrer Wahl.<br />
Wählen Sie Ihr Geschenk:<br />
<strong>Cicero</strong>-Kalender<br />
Mit praktischer Wochenansicht<br />
auf einer Doppelseite und<br />
herausnehmbarem Adressbuch.<br />
Begleitet von Karikaturen, bietet<br />
der Kalender viel Platz für Ihre<br />
Termine und Notizen. Handliches<br />
Din-A5-Format mit rotem<br />
Surbalin-Einband.<br />
Illy Espressotassen-Set<br />
Vom Künstler Tobias Rehberger<br />
entworfen, besteht dieses Set<br />
aus zwei Tassen inklusive einer<br />
Packung Illy-Espresso. <strong>Die</strong> geometrischen<br />
Motive spiegeln sich<br />
auf dem feinen Porzellan wider,<br />
wodurch ein unverkennbarer<br />
Camouflage-Effekt kreiert wird.<br />
„Recomposed<br />
by Max Richter“<br />
Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten<br />
– ein komponierter Remix!<br />
Der britische Komponist Max<br />
Richter holt zusammen mit Daniel<br />
Hope eines der beliebtesten Werke<br />
der klassischen Musik in die<br />
Gegenwart.<br />
Rotweinpaket<br />
Genießen Sie zwei außergewöhnliche<br />
Rotweine: Den Vindemio,<br />
Regain, rouge 2010 – sinnlichprovenzalisch<br />
mit dichter, samtener<br />
Textur, und den eleganten,<br />
gleichzeitig komplexen Guillaume<br />
Gros, Domaine Guillaume Gros,<br />
rouge 2008.<br />
Am besten heute noch bestellen!<br />
Kostenfrei anrufen: 0800 282 20 04<br />
Telefax: 0800 77 88 790<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Internet: www.cicero.de/weihnachten<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 907905 (für mich)<br />
Bestellnr.: 907947 (als Geschenk)
| B E R L I N E R R E P U B L I K | H O C H S C H U L B I L D U N G<br />
DER BOLOGNA-FEHLER<br />
Immerhin: <strong>Die</strong> Langzeitstudenten mit 21 Semestern gibt<br />
es nicht mehr. Aber nun, zwei Jahre nach Abschluss der<br />
europäischen Studienreform, regieren an Deutschlands<br />
Hochschulen Einheitsmaß und wild gewordene<br />
Evaluationsagenturen. Eine kritische Zwischenbilanz<br />
VON KONRAD A DAM<br />
Z<br />
UMINDEST DER TITEL der Aktion<br />
war gut gewählt. Das internationale<br />
Großunternehmen mit dem<br />
Ziel, die Studienbedingungen in<br />
Europa einheitlich zu gestalten,<br />
nannte sich nach Bologna, der Stadt, in der<br />
sich, neben oder nach Paris, die erste europäische<br />
Universität befunden haben soll.<br />
Von dort, von Norditalien oder von der Île<br />
de France, ging die Bewegung aus, die nach<br />
und nach in ganz Europa ähnliche Einrichtungen<br />
hervorbrachte. Auf dem Boden des<br />
Heiligen Römischen Reiches folgten Residenzstädte<br />
wie Prag, Heidelberg und Wien,<br />
in Frankreich Toulouse, Salamanca in Spanien,<br />
in Schweden Uppsala sowie Oxford<br />
und Cambridge in England.<br />
In dieser frühen Zeit hatte sich<br />
von selbst verstanden, was Jahrhunderte<br />
später unter dem Namen Bologna<br />
neu in Gang gesetzt werden sollte: die<br />
Internationalisierung der höheren Bildung,<br />
äußerlich erkennbar an der Leichtigkeit,<br />
mit der Studenten und Professoren von einem<br />
Land ins andere wechselten. Erasmus<br />
von Rotterdam, der heute dem europäischen<br />
Stipendienprogramm als Namenspatron<br />
dient, hatte in Paris studiert, war<br />
in Italien promoviert worden und als akademischer<br />
Lehrer in seiner Heimat, den<br />
Niederlanden, aber auch in England und<br />
in der Schweiz tätig gewesen. <strong>Die</strong>ser Beweglichkeit<br />
hofften die europäischen Bildungsminister<br />
aufzuhelfen und damit einen<br />
Beitrag zum Zusammenwachsen des<br />
Kontinents zu leisten, als sie für Dauer,<br />
Gestalt und Abschluss des Studiums einheitliche<br />
Maßstäbe beschlossen.<br />
Ein schöner Plan, der wohl aufgegangen<br />
wäre, wenn den Bildungspolitikern<br />
vor Augen gestanden hätte, dass ihre Aufgabe<br />
darin bestand, über das Schicksal der<br />
ILLUSTRATION: MIRIAM MIGLIAZZI & MART KLEIN<br />
52 <strong>Cicero</strong> 1.2013
1.2013 <strong>Cicero</strong> 53
| B E R L I N E R R E P U B L I K | H O C H S C H U L B I L D U N G<br />
nächsten Generation zu entscheiden statt<br />
einer wild gewordenen Zulassungsindustrie<br />
zu Macht und Einkommen zu verhelfen.<br />
Genau das haben sie jedoch getan. Gewinner<br />
des Bologna-Prozesses sind nicht die<br />
Studenten, sondern die Akkreditierungsräte<br />
und Evaluationsagenturen. Sie wirken<br />
als Gleichmacher der Bildung, denn<br />
sie belohnen jene, die einen Standard perfekt<br />
umsetzen. Überall, auf Landes-, Bundes-<br />
und europäischer Ebene, sind sie tätig<br />
und verdienen ihr Geld damit, dass sie<br />
die Hochschulen von der Pflicht befreien,<br />
sich die jungen Leute, die als Studenten zu<br />
ihnen kommen, näher anzusehen.<br />
UM DIE REFORM von Bologna einschätzen<br />
zu können, lohnt es sich, an ihren Anfang<br />
zurückzugehen und sich ihrer Motive zu<br />
besinnen. 1999 unterzeichneten die europäischen<br />
Bildungsminister die Bologna-Erklärung,<br />
nach der bis 2010 ein einheitlicher<br />
Hochschulraum in Europa geschaffen werden<br />
sollte. Deutschland verfolgte daneben<br />
ein weiteres, bis heute gern verschwiegenes<br />
Ziel. Mithilfe des Bologna-Prozesses wollte<br />
man endlich erreichen, was immer wieder<br />
angemahnt und versprochen, aber genauso<br />
oft verfehlt und hintertrieben worden war,<br />
eine Verkürzung des Studiums. Im internationalen<br />
Vergleich lagen die Deutschen mit<br />
ihren Studienzeiten von zwölf und mehr<br />
Semestern weit an der Spitze; was nicht nur<br />
teuer war, sondern deutsche Absolventen<br />
gegenüber Mitbewerbern aus den übrigen<br />
Ländern auch zurückwarf.<br />
Hauptverantwortlich dafür, dass es mit<br />
der Studienzeitverkürzung nicht voranging,<br />
war der Staat. Bei ihm fand ja, einer<br />
alten deutschen Tradition folgend, der Löwenanteil<br />
der Hochschulabsolventen sein<br />
<strong>Die</strong><br />
überkommene<br />
Studienfreiheit<br />
wurde durch<br />
lückenlose<br />
Regulierung<br />
ersetzt<br />
Ein- und Unterkommen; nach Grundsätzen<br />
allerdings, die das lange Studium belohnten,<br />
nicht das kurze. Mit zwölf oder<br />
mehr Semestern landete man im höheren,<br />
nach einem Kurzstudium von neun<br />
Semestern nur im gehobenen <strong>Die</strong>nst, der<br />
deutlich schlechter bezahlt wurde. Solange<br />
das so blieb, waren ein paar Semester mehr<br />
ein glänzendes Geschäft, das sich ein ganzes<br />
Leben lang rentierte. An diesem naheliegenden<br />
Kalkül sind alle Versuche, das<br />
Studium zu verkürzen, zunächst einmal<br />
gescheitert.<br />
Bis zur Mitte der siebziger Jahre blieb<br />
der Staat seiner Rolle als Hauptabnehmer<br />
der Universitäten treu; 1972, als die<br />
von Willy Brandt versprochene Verbreiterung<br />
des öffentlichen Korridors im vollen<br />
Gange war, fanden mehr als zwei Drittel<br />
aller Hochschulabsolventen ihren Dauerarbeitsplatz<br />
im <strong>Die</strong>nst des Staates. Doch<br />
dann, rund fünf Jahre später, lief die Einstellungswelle<br />
aus, weil das Geld ausging.<br />
Damit geriet die Hochschulreform<br />
in eine neue Krise: Der öffentliche Sektor<br />
war nicht mehr, die private Wirtschaft<br />
war noch nicht dazu bereit, die steigende<br />
Zahl von Hochschulabsolventen zu übernehmen,<br />
zumindest nicht zu den komfortablen<br />
Bedingungen, die im Staatsdienst<br />
üblich waren.<br />
Da sie das Recht auf Bildung, das sie so<br />
großzügig verkündet hatten, nicht durch<br />
das Recht auf einen Arbeitsplatz im öffentlichen<br />
<strong>Die</strong>nst ergänzen konnten, verfielen<br />
die Kultuspolitiker auf den fatalen Gedanken,<br />
die Universität als Warteraum zu benutzen,<br />
als Zwischenlager für Studenten,<br />
die anderswo nicht unterkommen konnten<br />
oder wollten. Was sprach dagegen, die<br />
viel zu vielen durch zusätzliche Semester<br />
noch eine Zeit vom Arbeitsmarkt fernzuhalten<br />
und so die wichtigste von allen amtlichen<br />
Dateien, die Arbeitslosenstatistik,<br />
zum Vorteil der Regierung zu entlasten?<br />
<strong>Die</strong> Einladung wurde angenommen und<br />
ließ die Zahl der ewigen Studenten drastisch<br />
steigen. Im Bewusstsein, den Zeitgeist<br />
im Rücken zu haben, trumpften die<br />
Dauerstudenten auf und bekannten sich<br />
demonstrativ zu ihrem 20., 21. oder noch<br />
höheren Semester.<br />
ZWAR ENTWARFEN REFORMKOMMISSIONEN<br />
Studiengänge, verabschiedeten Prüfungsordnungen<br />
und stritten über den Begriff<br />
der Regelstudienzeit. Am Alltag änderte<br />
das aber wenig, der Betrieb lief in seinen<br />
alten Bahnen weiter, nur langsamer, umständlicher<br />
und schwerfälliger als je zuvor.<br />
Während sich die Professoren, um der Last<br />
der ihnen auferlegten Lehrverpflichtungen<br />
zu entkommen, an irgendwelche Centers<br />
for Advanced Studies zurückzogen, fanden<br />
sich die Studenten im Irrgarten der Massenuniversität<br />
nicht mehr zurecht. Unter<br />
dem Titel „Uni-Angst und Uni-Bluff“ riet<br />
ein seinerzeit weitverbreitetes Handbüchlein<br />
den kopflosen jungen Leuten, sich auf<br />
das Nötigste zu beschränken. „Wenn du<br />
ILLUSTRATION: MIRIAM MIGLIAZZI & MART KLEIN<br />
54 <strong>Cicero</strong> 1.2013
herausgefunden hast, was die Minimalanforderungen<br />
in deinem Fach sind, dann belege<br />
und besuche nur die!“<br />
Auch das war aber noch zu viel, solange<br />
sich die Studenten auf das fragwürdige Privileg<br />
der Studienfreiheit berufen konnten.<br />
<strong>Die</strong> Einsicht, dass man 30 oder 40 Prozent<br />
eines Altersjahrgangs nicht nach Methoden<br />
unterrichten konnte, die seinerzeit<br />
für 5 oder 6 Prozent entworfen worden waren<br />
(und die auch da nicht immer griffen),<br />
blieb eine anerkannte, aber folgenlose Theorie.<br />
„Überlast auf Zeit“ hieß das Verfahren,<br />
das Lehrenden und Lernenden immer<br />
weitere Verpflichtungen aufbürdete und so<br />
den Ruf des deutschen Universitätswesens<br />
ramponierte. Das Bundesverwaltungsgericht<br />
zog nur die letzte Konsequenz, als es<br />
den Wunsch einer Massenuniversität, neben<br />
den Quantitäten auch die Qualität von<br />
Forschung und Lehre im Auge zu behalten,<br />
als „unzulässige Niveaupflege“ bezeichnete<br />
und verwarf.<br />
Da kam Bologna gerade recht. Es<br />
schuf den Druck, auf den man sich berufen<br />
konnte, um das nachzuholen, was<br />
jahrelang versäumt worden war. Nur dass<br />
man auch diesmal wieder der Versuchung<br />
nachgab, dem alten mit einem neuen Exzess<br />
zu begegnen, indem man an die Stelle<br />
der überkommenen Studienfreiheit ein<br />
ziemlich lückenloses Reglement setzte. <strong>Die</strong><br />
durchaus dehnbaren Empfehlungen der<br />
Bologna-Planer – der erste Teil des Studiums<br />
bis zum Bachelor sollte drei bis vier<br />
Jahre, der zweite mit dem Master als Abschluss<br />
ein bis zwei Jahre dauern – wurden<br />
in Deutschland so eng wie möglich umgesetzt,<br />
enger als in jedem anderen Land der<br />
Gemeinschaft. Das Ganze dann auch noch<br />
auf Englisch, mit Bachelor und Master anstelle<br />
von Diplom und Magister, da deutsche<br />
Wissenschaftsverwalter das Englische<br />
auch dann als Ausweis höherer Bildung betrachten,<br />
wenn sie es selbst nur unvollkommen<br />
beherrschen.<br />
All das hätte den Kern des Studiums<br />
nicht berühren müssen, hätte Bologna<br />
nicht als Waffe gedient, die alte Vorstellung<br />
vom Fach zu zerschlagen und durch<br />
das neue Einheitsmaß, das Modul, zu ersetzen.<br />
Das Fach bewahrte ja, wie fragwürdig<br />
auch immer, den Glauben an die Möglichkeit,<br />
zwar nur einen Teil der Welt, den<br />
aber einigermaßen gründlich kennenzulernen,<br />
ihn zu überblicken und mit Fleiß und<br />
Glück zu erweitern. Als Teil einer größeren<br />
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> finden Sie auch in<br />
diesen exklusiven Hotels<br />
»Für uns gehört zu einer gelungenen Auszeit nicht nur<br />
Körper und Seele in Einklang zu bringen, sondern auch die<br />
Anregung des Geistes. Wir freuen uns in der Traube Tonbach<br />
immer, wenn wir unseren Gästen etwas Außergewöhnliches<br />
bieten können. Das anspruchsvolle politische Magazin<br />
<strong>Cicero</strong> liefert unseren Gästen inspirierende Momente –<br />
eben ganz zu unserem Anspruch passend.«<br />
HEINER FINKBEINER, INHABER<br />
<strong>Die</strong>se ausgewählten Hotels bieten <strong>Cicero</strong> als besonderen Service:<br />
Bad Doberan – Heiligendamm: Grand Hotel Heiligendamm · Bad Pyrmont: Steigenberger Hotel · Baden-<br />
Baden: Brenners Park-Hotel & Spa · Baiersbronn: Hotel Traube Tonbach · Bergisch Gladbach: Grandhotel<br />
Schloss Bensberg, Schlosshotel Lerbach · Berlin: Hôtel Concorde Berlin, Brandenburger Hof, Grand Hotel<br />
Esplanade, InterContinental Berlin, Kempinski Hotel Bristol, Hotel Maritim, The Mandala Hotel, Savoy Berlin,<br />
The Regent Berlin, The Ritz-Carlton Hotel · Binz/Rügen: Cerês Hotel · Dresden: Hotel Taschenbergpalais Kempinski<br />
· Celle: Fürstenhof Celle · Düsseldorf: InterContinental Düsseldorf, Hotel Nikko · Eisenach: Hotel auf der<br />
Wartburg · Essen: Schlosshotel Hugenpoet · Ettlingen: Hotel-Restaurant Erbprinz · Frankfurt a. M.: Steigenberger<br />
Frankfurter Hof, Kempinski Hotel Gravenbruch · Hamburg: Crowne Plaza Hamburg, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten,<br />
Hotel Atlantic Kempinski, InterContinental Hamburg, Madison Hotel Hamburg, Panorama Harburg, Renaissance<br />
Hamburg Hotel, Strandhotel Blankenese · Hannover: Crowne Plaza Hannover · Hinterzarten: Parkhotel<br />
Adler · Jena: Steigenberger Esplanade · Keitum/Sylt: Hotel Benen-Diken-Hof · Köln: Excelsior Hotel Ernst<br />
Königswinter: Steigenberger Grand Hotel Petersberg · Konstanz: Steigenberger Inselhotel · Magdeburg: Herrenkrug<br />
Parkhotel, Hotel Ratswaage · Mainz: Atrium Hotel Mainz, Hyatt Regency Mainz · München: King’s Hotel<br />
First Class, Le Méridien, Hotel München Palace · Neuhardenberg: Hotel Schloss Neuhardenberg · Nürnberg:<br />
Le Méridien · Potsdam: Hotel am Jägertor · Rottach-Egern: Park-Hotel Egerner Höfe, Hotel Bachmair am See,<br />
Seehotel Überfahrt · Stuttgart: Hotel am Schlossgarten, Le Méridien · Wiesbaden: Nassauer Hof · ITALIEN Tirol<br />
bei Meran: Hotel Castel · ÖSTERREICH · Lienz: Grandhotel Lienz · Wien: Das Triest · PORTUGAL Albufeira:<br />
Vila Joya · SCHWEIZ Interlaken: Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa · Lugano: Splendide Royale · Luzern:<br />
Palace Luzern · St. Moritz: Kulm Hotel, Suvretta House · Weggis: Post Hotel Weggis<br />
Möchten auch Sie zu diesem<br />
exklusiven Kreis gehören?<br />
Bitte sprechen Sie uns an:<br />
E-Mail: hotelservice@cicero.de<br />
Hotel Traube Tonbach<br />
Tonbachstraße 237 · 72270 Baiersbronn<br />
Telefon: +49 (0) 7442-492 0 · E-Mail: info@traube-tonbach.de<br />
www.traube-tonbach.de · www.facebook.com/traubetonbach
| B E R L I N E R R E P U B L I K | H O C H S C H U L B I L D U N G<br />
M ODELL<br />
RAUS AUS DEM REGELKORSETT<br />
<strong>Die</strong> Zeppelin-Universität in Friedrichshafen bricht die Bachelor-Studiengänge auf.<br />
Statt strenger Regulierung bietet sie Freiheit, kreative Unruhe und Zeit zum Lesen<br />
Von Christian Füller<br />
<strong>Die</strong> Studenten in Deutschland ächzen.<br />
Sie leiden unter dem Bachelor, jenem<br />
Studiengang, der im Zuge der Bologna-<br />
Reform das Studieren eigentlich leichter<br />
machen sollte. Unstudierbar, weil überladen<br />
und überreglementiert, so lautet<br />
die Kritik. Doch tief im Süden des Landes<br />
macht man sich ganz andere Gedanken.<br />
„Das neue ‚Humboldt-Jahr‘ wird<br />
eine große Herausforderung für uns Studenten“,<br />
sagt Sigfried Eisenmeier. „Denn<br />
es ist sehr frei organisiert.“<br />
Eisenmeier, 21 Jahre alt, hat an der<br />
Zeppelin-Universität in Friedrichshafen<br />
den Studiengang „Sociology, Politics,<br />
Economics“ belegt. Das „Humboldt-Jahr“<br />
ist eine Idee seiner Uni, um den Bachelor<br />
zu reformieren. 2003 war die kleine Privatuniversität<br />
– einst gegründet vom Autozulieferer<br />
ZF Friedrichshafen und der<br />
Zeppelin Baumaschinen GmbH – eine<br />
der ersten in Deutschland, die den neuen<br />
Studiengang einführte. Als aber 2009<br />
Studierende staatlicher Hochschulen<br />
landauf, landab gegen den Bachelor protestierten,<br />
nahm die kleine Universität<br />
den Impuls für ihre 1000 Studierenden<br />
auf und leitete die Reform der Reform<br />
ein. Der Präsident der Zeppelin-Uni,<br />
Stephan Jansen, sagt: „<strong>Die</strong> wahre Eurokrise,<br />
unter der wir leiden, ist nicht die<br />
der Geldwährung. Es ist das selbst verschuldete<br />
Euro-Credit-Transfer-System<br />
der Studienleistungen.“<br />
<strong>Die</strong> Uni am Bodensee streckte den<br />
Studiengang um ein Jahr und nannte es<br />
das „Humboldt-Jahr“. Statt drei haben<br />
die Zeppelin-Studenten seit 2011 vier<br />
Jahre Zeit bis zum Abschluss. Gleich zu<br />
Beginn gibt es ein „Zeppelin-Jahr“ mit<br />
Workshops wie „implizites Wissen“ oder<br />
„Grundlagen des Unternehmertums“.<br />
Der reformierte Bachelor ist in Friedrichshafen<br />
eine Mixtur aus Pflicht und<br />
Kür – mit ganz viel Kür.<br />
<strong>Die</strong> Zeppelin-Universität Friedrichshafen gibt ihren Studenten<br />
zwölf Monate mehr Zeit: das „Humboldt-Jahr“<br />
<strong>Die</strong> Zeppelin-Uni ist denselben Bachelor-Regeln<br />
unterworfen wie alle anderen<br />
Hochschulen. Dennoch läuft das<br />
Studium hier schon immer anders. Wo<br />
staatliche Studenten in Zeitkorsette gepresst<br />
sind, scheinen die Zeppelin-Freiheiten<br />
unendlich. Im Wunsch-Seminar<br />
etwa. <strong>Die</strong> Studierenden suchen sich zu<br />
Semesterbeginn ein Thema, das sie interessiert.<br />
Das war zuletzt Gamification,<br />
also die Mode, Computerspiele selbst<br />
für Einstellungstests und beim Lernen<br />
einzusetzen. <strong>Die</strong> Studierenden heuerten<br />
externe Game-Designer an, die sie<br />
über Dramaturgien der Spiele aufklärten.<br />
„Wir achten natürlich darauf, dass<br />
ein universitäres Niveau gewahrt bleibt“,<br />
sagt die Kunstprofessorin Karen van den<br />
Berg. Darum grenzte sie in einem interdisziplinären<br />
Ansatz den auf Punktejagd<br />
verengten Spielbegriff der Computer-<br />
Games von einer philosophisch-ästhetischen<br />
Idee des freien Spiels ab.<br />
An der Zeppelin-Uni, in einem gläsernen<br />
Bau direkt am Bodensee und<br />
Containern im Norden Friedrichshafens<br />
untergebracht, gibt es auch ganz normale<br />
Kurse: Der Studiengang „Corporate<br />
Management and Economics“ etwa<br />
bietet Einführungen in Betriebswirtschaftslehre<br />
oder Bürgerliches Recht.<br />
Das „Zeppelin-Jahr“ zu Beginn des reformierten<br />
Bachelors aber soll die Studierenden<br />
ab Minute eins zum Forschen<br />
bringen. <strong>Die</strong> bisherige „Einführung in<br />
das wissenschaftliche Arbeiten“ wird mit<br />
einer thematischen Fragestellung aufgewertet<br />
– die sich die Studenten, bitte<br />
schön, selbst suchen sollen.<br />
Erstsemester Katharina Bremer, 20,<br />
hat sich die Rockergruppe Hells Angels<br />
als Thema gewählt. „Ich weiß bloß<br />
noch nicht, wie ich die Empirie machen<br />
soll“, sagt sie. „Ich muss wohl mal<br />
einen von denen interviewen.“ Sie hat<br />
mit ihrer Studiengruppe das Oberthema<br />
FOTOS: ANJA KOEHLER/ZEPPELIN UNIVERSITÄT, PRIVAT (AUTOREN)<br />
56 <strong>Cicero</strong> 1.2013
„Architekturen“ des jüngsten Zeppelin-Jahrgangs<br />
eigenwillig interpretiert.<br />
„Klandestine soziale Architekturen“<br />
ließe sich das Kapitel nennen.<br />
Geheimlogen, Mafia und Hells Angels<br />
sind jetzt Forschungsgegenstände.<br />
<strong>Die</strong> Universität will den Studenten<br />
Luft lassen. Sie sollten Literatur nicht<br />
nur als pdf-Dateien kennen, fordert<br />
Kunstprofessorin van den Berg. „Wir<br />
müssen Studierenden wieder Zeit einräumen,<br />
meterweise Bücher mit großen<br />
Theorien zu lesen.“<br />
Es gibt in Deutschland einige kreative<br />
Bachelor-Programme. Der Stifterverband<br />
für die Deutsche Wissenschaft<br />
hat sie in einem Wettbewerb<br />
sichtbar gemacht – etwa „Philosophie<br />
und Wirtschaft“ in Bayreuth oder<br />
„Mechanical and Process Engineering“<br />
an der TU Darmstadt. Aber der<br />
stinknormale deutsche Bachelor-Studiengang<br />
ist durchreguliert wie eine<br />
Weltraummission.<br />
Präsident Jansen geht einen anderen<br />
Weg. „Wir wollten die Idee der<br />
Uni von einer Vermittlungsanstalt auf<br />
eine Ermittlungsarena umstellen“, sagt<br />
er. Heißt: Keine Antworten vorgeben,<br />
sondern mit den Studenten Fragen erarbeiten.<br />
Reinsetzen und zuhören gilt<br />
an der Bodensee-Uni nicht. <strong>Die</strong> Studenten<br />
sollen eigene Themen finden,<br />
eigene Zugänge entwickeln und sich<br />
jene Professoren aus der Republik suchen,<br />
die gerade spannend sind.<br />
Bleibt das Studienprogramm jetzt<br />
erst einmal für eine Weile fixiert? Damit<br />
ist nicht zu rechnen. „Wir brauchen<br />
mehr Unruhe und Turbulenzspezialisten“,<br />
sagt Jansen. Im kommenden<br />
Jahr soll es daher sogenannte Diversity-Stipendien<br />
geben: Ein Studienabbrecher-<br />
und ein Sitzenbleiber-Stipendium<br />
zum Beispiel. Oder ein<br />
Marxismus-Stipendium für Studentenvertreter,<br />
die sich im „Kapital“ festgelesen<br />
haben.<br />
C HRISTIAN F ÜLLER<br />
arbeitet als Fachjournalist für<br />
Bildung. Er bloggt unter<br />
pisa-versteher.de<br />
Gemeinschaft, der scientific community,<br />
sollte der Student lernen, die Wissenschaft,<br />
wie Wilhelm von Humboldt sich ausgedrückt<br />
hatte, „als etwas noch nicht ganz<br />
Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes<br />
zu betrachten und unablässig als solche zu<br />
suchen“.<br />
DIE MODULARISIERUNG BRICHT MIT diesem<br />
Glauben. Sie ersetzt das Fachprinzip<br />
durch den Baustein, besser gesagt: durch<br />
eine Unzahl von Bausteinen, die sich<br />
nach dem Lego-System zu allen möglichen<br />
Formen zusammensetzen, auseinandernehmen<br />
und neu verbinden lassen.<br />
Der Modulator serviert Häppchen, keine<br />
Mahlzeiten; er betrachtet das Lernen als<br />
Akkordarbeit, differenziert nach Studium,<br />
bei dem der Student im Hörsaal sitzt, und<br />
Selbststudium, bei dem er zu Hause sitzt.<br />
<strong>Die</strong> Einheit, in der abgerechnet und bewertet<br />
wird, ist der credit point, der einem<br />
Zeitaufwand von 25 bis 30 Stunden entspricht<br />
oder doch entsprechen soll. Wenn<br />
davon 180 beisammen sind, hat man den<br />
Bachelor erworben, mit 300 den nächst<br />
höheren Abschluss, den Master. In Sonderfällen<br />
schließt sich die Promotion als<br />
dritte und letzte Stufe an.<br />
Das Studium als Weg zur Bildung, zur<br />
Selbsterfüllung oder Selbstverwirklichung,<br />
um hier die Schlagwörter der Achtundsechziger<br />
noch einmal zu gebrauchen,<br />
hat ausgedient. Humboldt, hört man in<br />
Deutschland überall, sei tot; hierzulande<br />
gewiss. Wer ihm begegnen will, muss nach<br />
Amerika gehen, nach Stanford beispielsweise,<br />
dessen langjähriger Präsident Gerhard<br />
Casper bis heute das Hohe Lied auf<br />
Humboldt singt. <strong>Die</strong> deutschen Bildungsmanager<br />
sind da anderer Meinung; sie halten<br />
sich an den BDI, der schon vor Jahren<br />
Präsidenten und Rektoren dazu aufgefordert<br />
hatte, sich selbst als Unternehmer, die<br />
Hochschule als Firma und die Studenten<br />
als Kunden zu betrachten. <strong>Die</strong> Wirtschaft<br />
schwört auf Praxisbezug, Output-Orientierung<br />
und Effizienz; sie wünscht sich eine<br />
gehorsame, keine skeptische Generation,<br />
karrierebewusste statt umweltbewusste<br />
Mitarbeiter und einen Nachwuchs, der<br />
sich für Produkte interessiert, deren Entstehung<br />
ihn nicht kümmert.<br />
<strong>Die</strong> Modularisierung, berichtet eine<br />
vom Universitätsbetrieb ernüchterte Studentin<br />
in einem Zeitschriftenbeitrag, verflache<br />
das Lehrangebot. Sie hemme, ja<br />
verhindere die Entwicklung zu intellektueller<br />
Selbstständigkeit: „Es gibt kaum noch<br />
Studierende, die ‚einfach so‘ in der Bibliothek<br />
stöbern (wenn sie denn überhaupt<br />
noch offen hat); denn es bleibt gerade<br />
noch Zeit, zielstrebig für das nächste Referat<br />
zu recherchieren.“ Wo früher thematisch<br />
breit gefächerte Seminare angeboten<br />
wurden, gebe es nur noch Spezialissima wie<br />
Metapherntheorie hier, Erzähltheorie dort.<br />
Insgesamt, so lautet das abschließende Urteil,<br />
habe sich Ängstlichkeit breitgemacht,<br />
die stets fragt: „Werde ich alle Belegpflichten<br />
in diesem Semester erfüllen können?<br />
Werde ich schnell genug durch das Studium<br />
kommen, um den Anforderungen<br />
des Arbeitsmarkts zu genügen?“<br />
Wer so etwas liest, wird einsehen, dass<br />
Humboldt wirklich tot ist. Doch warum<br />
sollte man darüber froh sein?<br />
Auch wenn es für ein Urteil über den<br />
Bologna-Prozess noch zu früh ist, zeichnet<br />
sich schon ab, dass die Reform ihr ehrgeizigstes<br />
Ziel, den Austausch zwischen Ländern<br />
und Kulturen zu befördern, nicht erreichen<br />
wird. <strong>Die</strong> „Mannigfaltigkeit der<br />
Situationen“, von der sich Humboldt den<br />
bildenden Effekt des Studiums versprochen<br />
hatte, wird von der einen Seite, den Hochschulen,<br />
nicht mehr geboten, auf der anderen,<br />
von Seiten der Studenten, nicht länger<br />
gesucht: Wozu wechseln und dabei noch<br />
Zeit verlieren, wenn man das durchnormierte<br />
Studium so schnell wie möglich hinter<br />
sich bringen kann und soll?<br />
Um Originalität und Neugier zu belohnen<br />
und den Wechsel attraktiv zu machen,<br />
müssten die Hochschulen ihre Eigenheiten<br />
pflegen, ihre Stärken bekannt machen<br />
und ihre Unterschiede herausstellen, also<br />
das tun, was unter dem Schlagwort Profilbildung<br />
läuft: Vielfalt ist besser als Einfalt,<br />
vor allem in der Wissenschaft. Sie hätten<br />
sich daran zu erinnern, dass die Universität<br />
europäischer Prägung neben allem anderen<br />
einen Bildungs- und Erziehungsauftrag<br />
hatte, und dass ihre Aufgabe darin<br />
besteht, die Studenten berufsfähig, nicht<br />
berufsfertig zu entlassen. Aber werden die<br />
auf Gleichförmigkeit eingeschworenen Bildungsmanager<br />
ihnen das erlauben?<br />
KONRAD A DAM<br />
ist Publizist und Fachmann für<br />
Bildungspolitik. Er schrieb unter<br />
anderen das Buch „<strong>Die</strong> alten<br />
Griechen“<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 57
Jahresrückblick<br />
Der schönste Blick zurück.<br />
<strong>Die</strong> wichtigen Ereignisse des Jahres, ausgewählt, analysiert und kommentiert von<br />
der Redaktion der Süddeutschen Zeitung – im großen Jahresrückblick 2012.<br />
Mit<br />
Namenstags-<br />
Kalender für<br />
2013<br />
Erhältlich für nur 6,– €. Am Kiosk oder<br />
bestellen unter www.sz-shop.de
M E I N S C H Ü L E R | B E R L I N E R R E P U B L I K |<br />
„Wir waren seine Rettung“<br />
Er kam an ihre Schule, nachdem er zweimal sitzen geblieben war. C H R I STEL BR AUN, 88,<br />
war PEER ST EINBRÜC KS Lehrerin in Politik und Englisch an der Handelsschule am<br />
Lämmermarkt in Hamburg. 1968 schaffte der SPD-Kandidat dort den Abschluss<br />
„Steinbrück kam damals nach einer katastrophalen<br />
Unter- und Mittelstufe, für die er fünf oder<br />
sechs Jahre gebraucht hatte, zu uns auf das Wirtschaftsgymnasium.<br />
Wir waren angeblich die leichtere<br />
Schule, die Hälfte der Schüler waren vorher<br />
schlechte Gymnasiasten, die andere waren fleißige<br />
Realschüler. Bei uns wagten sie alle einen Neuanfang.<br />
Steinbrück hat sich das erst einmal angeguckt.<br />
In Englisch war er nicht so erfolgreich. Aber heute zeigt er ja in<br />
vielen finanzpolitischen Auseinandersetzungen, dass er das inzwischen<br />
kann. Reden konnte er damals tatsächlich schon gut. Das<br />
hat die Klasse teils beeindruckt, teils fanden sie ihn auch arrogant.<br />
Im Politikunterricht sollte sich jeder Schüler ein Printmedium<br />
heraussuchen und das besprechen. Steinbrück hat sich die<br />
Bild-Zeitung ausgesucht und sie ätzend kommentiert, wir haben<br />
also schon damals seine schrägen Bemerkungen erlebt. Ich habe<br />
im Unterricht damals auch Iring Fetschers Buch über Marx eingeführt.<br />
Steinbrück fand das im Gegensatz zu anderen Schülern<br />
Wahljahr 2013<br />
Der Countdown<br />
gut, glaube ich. Natürlich ist Steinbrück auch aufbrausend.<br />
Aber in der Schule hat er keine Schwierigkeiten<br />
gemacht. Erst hinterher habe ich erfahren,<br />
dass unsere Schule für ihn die Rettung war. Wir sind<br />
in Kontakt. Er schickte mir einen Brief und sagte,<br />
seine Frau würde heute einen ganz ähnlichen Unterricht<br />
machen wie ich damals. Das finde ich witzig,<br />
denn er kennt den Unterricht seiner Frau doch<br />
gar nicht. Sie setzt sich aber jedenfalls in der Ehe ordentlich durch,<br />
das erzählt er ja auch. Ich schicke ihm gerade ein Fontane-Gedicht.<br />
Was jetzt aus ihm geworden ist, ist mir eine große Befriedigung.<br />
Ich würde auch sagen, er ist ein guter Kanzlerkandidat. Wie gut<br />
er allerdings ein Kabinett leiten kann, ist die zweite Frage. Denn<br />
die Erfahrung in Nordrhein-Westfalen haben die Grünen noch<br />
nicht vergessen.“<br />
In einer <strong>Cicero</strong>-Serie zur Bundestagswahl spürt<br />
Constantin Magnis Lehrer unserer Spitzenpolitiker auf<br />
FOTO: PRIVAT<br />
Peer Steinbrück 1961, 14 Jahre alt, mit seiner Klasse am Gymnasium Uhlenhorst-Barmbek in Hamburg. Nach mehreren<br />
Schulwechseln kam er schließlich zu Christel Braun an die Staatliche Handelsschule am Lämmermarkt<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 59
| W E L T B Ü H N E<br />
JOHN OHNELAND<br />
Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses ist kompromissbereit. Doch seine Partei lässt John Boehner nicht<br />
VON JACOB H EILBRUNN<br />
A<br />
MERIKAS KONSERVATIVE ähneln<br />
Tantalos. Jenem König aus der<br />
griechischen Mythologie, den<br />
die Götter für seine Freveltaten damit bestraften,<br />
dass er bis in alle Ewigkeit in einem<br />
Teich unter einem Obstbaum stehen<br />
musste, ohne je das Wasser trinken zu können<br />
oder an die Früchte zu gelangen. Beinahe<br />
so ergeht es den Republikanern im<br />
Jahr 2013. Obwohl sie Barack Obama als<br />
Sozialisten und Bolschewiken verunglimpften,<br />
der mit seinen Steuer- und Krankenversicherungsplänen<br />
Amerika zerstöre, und<br />
obwohl sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus<br />
stellen, haben es die Tantalos’ unserer<br />
Zeit nicht vermocht, den Mann aus<br />
dem Weißen Haus zu vertreiben. Im Gegenteil.<br />
Obama, der mächtigste und gerissenste<br />
Präsident seit Ronald Reagan, treibt<br />
die Republikaner vor sich her. <strong>Die</strong> USA erleben<br />
eine Haushaltskrise, und die Republikaner<br />
erwartet dabei ein Debakel.<br />
Einer aber könnte vielleicht doch noch<br />
die Partei vor den extremen Rechten in den<br />
eigenen Reihen retten und zu einer gewissen<br />
Normalität zurückführen. John Boehner.<br />
Seit das Repräsentantenhaus die einzige<br />
Staatsgewalt ist, die noch von den<br />
Republikanern kontrolliert wird, ist dessen<br />
Sprecher zu Obamas großem Gegenspieler<br />
geworden. Und die Republikaner<br />
können heilfroh sein, ihn zu haben.<br />
Blickt man in Boehners Vergangenheit,<br />
würde man ihn als stockkonservativ<br />
bezeichnen. Im Vorfeld der Kongresswahlen<br />
1994 war er am Entwurf für den<br />
„Contract with America“ beteiligt, der dem<br />
Hitzkopf Newt Gingrich die Kontrolle<br />
über das Repräsentantenhaus verschaffte.<br />
1995 verteilte Boehner in den Parlamentsfluren<br />
Wahlkampfspenden der Tabaklobby<br />
an die Abgeordneten – was er heute, wie er<br />
versichert, zutiefst bereut. Es ist wie mit allen<br />
Revolutionären, die lange genug an der<br />
Macht sind, auch Boehner ist inzwischen<br />
Teil des Establishments geworden. Im Vergleich<br />
mit den jungen Konservativen heute,<br />
die ihn beständig attackieren, weil er bereit<br />
ist, Kompromisse mit dem Präsidenten einzugehen,<br />
wirkt Boehner geradezu gemäßigt.<br />
Boehner ist in Ohio als eines von zwölf<br />
Geschwistern aufgewachsen, eine katholische<br />
Familie mit deutschen Vorfahren. Bereits<br />
als Achtjähriger half John, die Kneipe<br />
zu putzen, die seine Eltern in Cincinnati<br />
betrieben. Er ist kein asketischer Fanatiker,<br />
sondern genießt das Leben, raucht, liebt<br />
Rotwein – Obama schenkte ihm jüngst<br />
zum Geburtstag einen guten Brunello –,<br />
und er ist stets braun gebrannt. Während<br />
der Wahlkampf um die Präsidentschaft lief,<br />
hat er darauf verzichtet, in der Öffentlichkeit<br />
seinen Lastern zu frönen, denn der<br />
Mormone Mitt Romney, der keinen Alkohol<br />
trinkt, sollte der Held der Konservativen<br />
sein. <strong>Die</strong> Republikaner im Repräsentantenhaus<br />
hofften, dass Romney ihre<br />
Pläne Wirklichkeit werden lässt: Steuerkürzungen<br />
für die Wohlhabenden, das Ende<br />
der Sozialversicherung und der Gesundheitsfürsorge.<br />
Doch dann siegte Obama –<br />
die Republikaner haben immer noch<br />
Mühe, das zu begreifen.<br />
NUN KOMMT ES zum Duell zwischen Boehner<br />
und Obama. Der Präsident hält an seinen<br />
Steuerplänen fest, und die Republikaner<br />
tun so, als seien Steuererhöhungen für<br />
die Reichsten unamerikanisch und gleichbedeutend<br />
mit der Versteigerung der Freiheitsstatue.<br />
So erklärte Boehner auf Fox<br />
News, dem Haussender der amerikanischen<br />
Rechten, dass er Obamas Steuerpläne<br />
für „Unsinn“ halte.<br />
Allerdings ist Boehners Empörung pures<br />
Theater. Er weiß genau, dass sein größter<br />
Feind nicht Barack Obama ist, sondern<br />
die Tea-Party-Republikaner, die die<br />
reine ideologische Lehre vertreten. Fast<br />
100 Kongressabgeordnete kommen aus der<br />
Tea-Party-Bewegung. Es sind diese Fanatiker,<br />
die Boehner zur Geisel ihrer Unbeugsamkeit<br />
machen können, wenn es um Kürzungen<br />
im Bundeshaushalt geht.<br />
Käme es auf ihn allein an, würde er<br />
sich schnell mit Obama einigen. Trotzdem<br />
täusche man sich nicht: Auch Boehner<br />
glaubt an das konservative Mantra, dass<br />
es in Amerika jeder schaffen kann. Schließlich<br />
hat es bei ihm funktioniert – er war der<br />
Erste seiner Familie, der studieren konnte.<br />
„Ich habe mein ganzes Leben dem amerikanischen<br />
Traum nachgejagt“, sagte er unter<br />
Tränen nach dem Sieg der Republikaner<br />
bei den Zwischenwahlen 2010. Nach<br />
seiner Lesart ist der amerikanische Traum<br />
gleichbedeutend mit Freiheit – der Freiheit,<br />
Reichtum und Einfluss zu erringen ohne<br />
Rücksicht auf den Preis, den andere dafür<br />
zahlen müssen. Mit dieser Philosophie hat<br />
es der Sprecher des Repräsentantenhauses<br />
weit gebracht: vom kleinen Jungen, der den<br />
Kneipenboden seiner Eltern wischt, zum<br />
Chef eines Verpackungsunternehmens und<br />
schließlich zu einem der einflussreichsten<br />
Politiker in Washington.<br />
Als solcher hat Boehner registriert,<br />
dass die jüngste Präsidentenwahl auch ein<br />
Volksentscheid über das Wahlprogramm<br />
seiner Partei war, das die Mehrheit im Land<br />
ganz entschieden ablehnte. Sollten die Republikaner<br />
nun tatsächlich Obamas Wirtschaftspolitik<br />
torpedieren, dann wird dies<br />
nicht mit der Demontage des Präsidenten,<br />
sondern der Republikaner selbst enden.<br />
Meinungsumfragen belegen, dass eine<br />
überwältigende Mehrheit der Amerikaner<br />
den Republikanern die Schuld am Scheitern<br />
der Verhandlungen um den Haushalt<br />
geben würde. Ungeachtet dessen könnten<br />
die Konservativen dennoch versucht sein,<br />
ihren niedersten Beweggründen zu erliegen.<br />
John Boehner wird verzweifelt versuchen,<br />
dieses Schicksal abzuwenden. Aber<br />
seine Partei wird ihn wohl nicht lassen. So<br />
könnte er sich als Führer ohne echte Gefolgschaft<br />
erweisen. Sollte es so kommen,<br />
verdiente er Mitleid und keine Häme.<br />
J A COB H EILBRUNN<br />
ist Senior Editor bei der<br />
amerikanischen Zeitschrift<br />
„National Interest“<br />
FOTOS: TOM WILLIAMS/CQ ROLL CALL/GETTY IMAGES, PRIVAT (AUTOR)<br />
60 <strong>Cicero</strong> 1.2013
John Boehner,<br />
Obamas<br />
Gegenspieler<br />
in Washington<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 61
| W E L T B Ü H N E<br />
DIE SCHOTTER-MIZZI<br />
Maria Fekter brachte es fast zur persona non grata in Brüssel. Was treibt Österreichs Finanzministerin?<br />
VON B ARBARA TÓTH<br />
E<br />
S WAR EINMAL ein hübsches und<br />
tüchtiges Mädchen aus der Provinz.<br />
Vorlaut und aufmüpfig war<br />
sie gelegentlich und fiel damit dem großen<br />
Landesfürsten auf, der sie in die Politik<br />
schickte.“ <strong>Die</strong>se Zeilen sandte Maria<br />
Fekter vor fast 20 Jahren dem Geschichtenerzähler<br />
Folke Tegetthoff, der Politiker um<br />
ein Märchen für einen Sammelband gebeten<br />
hatte. <strong>Die</strong> Oberösterreicherin, Tochter<br />
einer wohlhabenden Kieswerkdynastie,<br />
war damals noch Staatssekretärin für Tourismus,<br />
nichts weiter als ein „blondes Mädchen,<br />
das einen guten Eindruck machen<br />
und die Männerreihen behübschen“ sollte.<br />
Aber so wie ihr märchenhaftes Alter Ego<br />
sollte auch Fekter es einmal weit bringen.<br />
Seit April 2011 ist sie fast ganz oben angekommen<br />
in Österreichs Politik. Als erste<br />
Frau in der Geschichte des Landes lenkt die<br />
56-Jährige das Finanzministerium. Davor<br />
war sie Innenministerin, Koalitionskoordinatorin<br />
für ihre Partei, die christlich-soziale<br />
Volkspartei (ÖVP), Volksanwältin<br />
und langjährige Parlamentarierin. Dass<br />
ihr Name inzwischen auch in Deutschland,<br />
Frankreich und Italien ein Begriff<br />
ist, liegt weniger an ihrer Politik als an ihrer<br />
Art. Wie fabulierte sie damals? Hübsch<br />
und tüchtig sei sie, aber eben auch vorlaut<br />
und aufmüpfig.<br />
Beim EU-Gipfel Ende März in Kopenhagen<br />
etwa düpierte die Bürgerliche<br />
den Luxemburger Jean-Claude Juncker,<br />
als sie ausplauderte, wie hoch der Euro-<br />
Rettungsschirm aufgestockt werden soll.<br />
Er wäre ja nur böse, weil er an diesem Tag<br />
wegen eines Nierenleidens Bauchschmerzen<br />
gehabt habe, rechtfertigte sie sich hinterher<br />
– eine weitere Indiskretion. Italiens<br />
„Ich muss zu meiner Art stehen“<br />
Maria Fekter<br />
Ministerpräsidenten Mario Monti brachte<br />
sie im Juni aus der Fassung, als sie darüber<br />
spekulierte, dass sein Land bald „Hilfsunterstützungen“<br />
aus einem der Rettungsfonds<br />
benötigen könne. Kurz darauf<br />
nannte sie das Wirtschaftsprogramm des<br />
frisch gewählten französischen Präsidenten<br />
François Hollande „vorgestrigen Unfug“.<br />
Brüsseler Journalisten freuen sich über<br />
das schnellzüngige Enfant terrible. Europas<br />
Spitzenpolitiker versuchen die Plaudertasche<br />
höflich zu ignorieren. In ihrem<br />
Heimatland kommt Fekters muntere Bodenständigkeit<br />
hingegen gut an. Als sie<br />
nach einer EU-Krisensitzung sagte: „<strong>Die</strong><br />
Zeit, die wir uns gegeben haben, ist shortly.<br />
Und auf Ihre Frage, was das heißt, sage<br />
ich Ihnen: shortly, without von delay“,<br />
wurde ihr Austro-Bad-Englisch-Mix zum<br />
Youtube-Hit und Spruch des Jahres 2011.<br />
Nur als sie bei einem EU-Treffen in Polen<br />
darüber philosophierte, dass „wir gerade<br />
enorme Feindbilder gegen die Banken und<br />
die Reichen aufbauen. So was hatten wir<br />
schon einmal, damals verbrämt gegen die<br />
Juden … Es hat zwei Mal in einem Krieg<br />
geendet“ – da wurde es auch der österreichischen<br />
Presse zu steil. „Sie kann gewaltigen<br />
Unsinn reden“, urteilte das ihr sonst<br />
sehr gewogene Heimatblatt Oberösterreichische<br />
Nachrichten.<br />
Bereut sie ihre Aussagen? „Nein, ich<br />
muss zu meiner Art stehen“, antwortet sie.<br />
Und damit ist das Phänomen Fekter auch<br />
schon erklärt. Politiker, die den Brüsseler<br />
Bürokratensprech verinnerlicht haben,<br />
gibt es in Österreich genug. Da wirkt ein<br />
wenig Stegreifbühnencharme erfrischend.<br />
Dass Fekter ihre verbalen Fauxpas unbeschadet<br />
überstand, hat aber vor allem einen<br />
Grund: In Österreich stehen im kommenden<br />
Herbst Nationalratswahlen an, und dabei<br />
soll die Finanzministerin für die ÖVP<br />
ihre eigentliche Paraderolle spielen: die eiserne<br />
Lady.<br />
Ihren strengen Ruf hat sich die Ökonomin<br />
und promovierte Juristin schon<br />
Ende der neunziger Jahre erarbeitet, als<br />
sie als Justizsprecherin Homo-Ehe, Sex<br />
vor Erreichen des 16. Geburtstags und den<br />
ehelichen Seitensprung geißelte. Davor<br />
wurde sie noch als „Schotter-Mizzi“ belächelt.<br />
Schotter heißt auf österreichisch<br />
Kies, ist aber auch ein umgangssprachlicher<br />
Ausdruck für reichlich Geld. Und<br />
Mizzi ist eine Kurzform für Maria, aber<br />
auch ein anderes Wort für „Tussi“.<br />
Fekters große Stunde schlug, als sie<br />
2008 Innenministerin wurde. Aus der<br />
„Mizzi“ wurde die „Maria ohne Gnaden“,<br />
erst recht, als sie die Abschiebung des kosovarischen<br />
Flüchtlingsmädchens Arigona<br />
Zogaj mit den in Österreich berühmt gewordenen<br />
Worten rechtfertigte, sie könne<br />
sich von ihren „Rehleinaugen“ nicht beeindrucken<br />
lassen.<br />
<strong>Die</strong> Politikerin Fekter braucht offenbar<br />
die Polarisierung. Im anlaufenden österreichischen<br />
Wahlkampf tummeln sich bereits<br />
drei populistische Parteien rechts der<br />
Mitte, dort wo auch ihre ÖVP Stimmen<br />
holen muss. Sie alle setzen mehr oder weniger<br />
verbrämt auf Europakritik und Euro-<br />
Schelte. Ein paar Brüsseler Spitzen können<br />
da nicht schaden, und so müssen die Griechen<br />
für die Inszenierung der Finanzministerin<br />
herhalten – oder eben Juncker, Monti<br />
oder Hollande. <strong>Die</strong> eine oder andere Zugabe<br />
hat das Provinzmädl sicher auch für<br />
die Heimatbühne in petto.<br />
B ARBARA T ÓTH<br />
ist Publizistin und Historikerin<br />
und schreibt für die Wiener<br />
Wochenzeitung Der Falter<br />
FOTOS: GIANMARIA GAVA/ANZENBERGER, PRIVAT (AUTORIN)<br />
62 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Maria Fekter lässt<br />
gern mal eine<br />
Frechheit los – die<br />
Polarisierung gehört<br />
zu ihrer Strategie<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 63
| W E L T B Ü H N E<br />
PEKINGER ORIGINAL<br />
Tian Lipu ist Chinas höchster Schützer von Patentrechten. Welche Agenda er verfolgt, ist allerdings unklar<br />
VON B ERNHARD B ARTSCH<br />
W<br />
AS FÜR EINE BEGRÜSSUNG. Ein trister<br />
Pekinger Behördenbau, lange<br />
Korridore, eine Tür geht auf –<br />
und plötzlich schallt „Im Frühtau zu Berge“<br />
aus den Lautsprechern, und ein strahlender<br />
Chinese in Trachtenjacke schmettert<br />
dem Gast ein herzliches „Grüß Gott“ entgegen.<br />
Chinas Patentamtschef Tian Lipu,<br />
der Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer<br />
im April 2010 so empfing, wird gewusst<br />
haben, welchen Eindruck sein Auftritt<br />
auf den CSU-Politiker machen würde.<br />
Wie sollte ihm Seehofer nach einem solchen<br />
Willkommen noch böse sein?<br />
Dabei repräsentiert Tian einen Pekinger<br />
Machtapparat, auf den viele deutsche<br />
Unternehmen schlecht zu sprechen sind.<br />
Der 59-jährige Ingenieur ist Chinas höchster<br />
Wächter über geistige Eigentumsrechte,<br />
und damit auch verantwortlich, wenn Patente<br />
ausländischer Firmen in der Volksrepublik<br />
verletzt werden. Das kommt häufig<br />
vor, so häufig, dass China sich vorwerfen<br />
lassen muss, systematischen und staatlich<br />
sanktionierten Technologieklau zu betreiben.<br />
Tians Job ist es, diesen Vorwurf zu<br />
entkräften.<br />
Seine Aufgabe erfüllt er mit einer Mischung<br />
aus Charme und Unerbittlichkeit,<br />
wie er zuletzt Mitte November beim Parteitag<br />
der Kommunistischen Partei demonstrierte.<br />
Zwar räumte Tian ein, dass es in<br />
China beim Schutz geistigen Eigentums<br />
Probleme gebe, doch das Eingeständnis<br />
war nur der Auftakt für einen Gegenangriff.<br />
„Westliche Medien verzerren Chinas<br />
Image“, klagte er. Inzwischen sei der<br />
Patentschutz viel besser als sein Ruf: 2011<br />
seien in China 526 000 Erfindungen angemeldet<br />
worden, ein Fünftel mehr als im<br />
Vorjahr und 13 Mal so viel wie noch vor<br />
einem Jahrzehnt. Damit liege die Volksrepublik<br />
in der Rangliste innovativer Länder<br />
auf Platz vier. Außerdem bezahle kein<br />
Land der Welt mehr Geld für Lizenzen,<br />
etwa für Technologie, Software oder Fernsehprogramme.<br />
„Aber darüber spricht fast<br />
nie jemand“, beschwerte sich Tian. Statt<br />
China Vorhaltungen zu machen, solle man<br />
„Westliche Medien verzerren<br />
Chinas Image“<br />
Tian Lipu<br />
ihm lieber dankbar sein und ansonsten Zeit<br />
geben, sein System zu verbessern, schließlich<br />
befinde es sich auf dem richtigen Weg.<br />
Aber tut es das? So einleuchtend Tians<br />
Argumentation zunächst klingen mag, so<br />
geschickt umschifft sie die aus westlicher<br />
Sicht entscheidenden Fragen: Warum kann<br />
ein Land, das stolz auf sein hohes Entwicklungstempo<br />
ist und das Internet nahezu<br />
lückenlos überwacht, nicht mit der gleichen<br />
Geschwindigkeit und Effektivität den<br />
Schutz geistigen Eigentums verbessern?<br />
Denn allen Pekinger Rechtfertigungsreden<br />
zum Trotz sind Patentrechtsverletzungen<br />
nach wie vor ein grassierendes Problem.<br />
Das Spektrum reicht von imitierten Markenhandtaschen<br />
und kopierten DVDs bis<br />
zu gefälschten Arzneimitteln und nachgebauter<br />
Technologie. In einer Umfrage der<br />
Deutschen Handelskammer in China aus<br />
dem Jahr 2011 gaben 57 Prozent der Mitgliedsunternehmen<br />
an, Opfer von Copyrightverstößen<br />
geworden zu sein, 17 Prozent<br />
sogar wiederholt. Studien anderer<br />
Verbände kommen zu ähnlichen Ergebnissen.<br />
Der finanzielle Schaden lässt sich<br />
nur grob abschätzen. <strong>Die</strong> International<br />
Intellectual Property Alliance, ein Zusammenschluss<br />
amerikanischer Unterhaltungs-<br />
und IT-Konzerne, gibt an, dass<br />
ihren Unternehmen 2009 allein durch illegale<br />
Software Einnahmen von 3,5 Milliarden<br />
Dollar entgangen seien. Noch schwerer<br />
wiegt für viele Firmen allerdings, dass<br />
Chinas Zulassungsbehörden ihnen den Zugang<br />
zum chinesischen Markt häufig nur<br />
gewähren, wenn sie vorab Entwicklungsdetails<br />
offenlegen. <strong>Die</strong> Informationen, etwa<br />
über die Programmierung von Chips oder<br />
die Rezeptur von Medikamenten, würden<br />
dann an chinesische Konkurrenten weitergegeben<br />
und von diesen immer öfter sogar<br />
als Patente registriert, klagen ausländische<br />
Unternehmensvertreter.<br />
Man darf davon ausgehen, dass Tian<br />
all diese Probleme bestens kennt. Schließlich<br />
hat er sein gesamtes Berufsleben im<br />
chinesischen Patentrechtsapparat verbracht.<br />
Nach zwei Studienabschlüssen in Tianjin<br />
und Peking trat er 1981 in den <strong>Die</strong>nst der<br />
staatlichen Copyrightschützer und wurde<br />
in den folgenden Jahren mehrfach für längere<br />
Studienaufenthalte nach Deutschland<br />
geschickt. Unter anderem forschte er beim<br />
Patentamt in München, am europäischen<br />
Patentgerichtshof und am Max-Planck-Institut<br />
für ausländisches und internationales<br />
Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht.<br />
Zu Hause machte er schrittweise Karriere<br />
im Patentamt, bis er 2005 Direktor des<br />
State Intellectual Property Office und seiner<br />
rund 10 000 Mitarbeiter wurde. Ausländischen<br />
Besuchern erklärt Tian gerne,<br />
dass es in seiner Behörde ausgesprochen<br />
deutsch zugehe. Doch welche Agenda sie in<br />
Wirklichkeit verfolgt, bleibt unklar, Trachtenjacke<br />
hin oder her.<br />
B ERNHARD B ARTSCH<br />
lebt seit 1999 in Peking und<br />
ist dort freier Korrespondent<br />
FOTOS: SHENG JIAPENG/COLOR CHINA PHOTO/AP IMAGES, PRIVAT (AUTOR)<br />
64 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Tian Lipu begrüßt deutsche<br />
Gäste gerne mit einem<br />
fröhlichen „Grüß Gott“<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 65
| W E L T B Ü H N E | F R A N K R E I C H<br />
IM AUGE DES STURMS<br />
François Hollande ist mit großen Versprechungen<br />
gestartet. Nun ist der französische Präsident<br />
in der Wirklichkeit angekommen. Und<br />
die sieht weder für den Staatschef noch<br />
für sein Land vielversprechend aus<br />
VON JOHANNES WILLMS<br />
E<br />
INE DER STÄRKEN von François<br />
Hollande ist, dass er stets von denen<br />
unterschätzt wurde, die sich<br />
selbst überschätzen. Das gilt zumal<br />
für die „camarades“, die Genossen<br />
in der Parti Socialiste (PS). Seit<br />
dem Parteikongress von Épinay 1971 ist<br />
die PS ein Zweckbündnis von nichtkommunistischen<br />
Strömungen oder Clans, das<br />
sich François Mitterrand zur Eroberung<br />
der Macht schuf. <strong>Die</strong>se Genese prägt die<br />
Partei bis heute und ist ursächlich für ihr<br />
strukturelles Manko. Das äußert sich vor<br />
allem im Führungsanspruch der einzelnen,<br />
als „Elefanten“ bezeichneten, Clanführer.<br />
Hollande vermied es von Anfang an,<br />
sich einer dieser Strömungen anzuschließen.<br />
Stattdessen war er maßgeblich an der<br />
1985 gegründeten parteiinternen Bewegung<br />
„Transcourants“ beteiligt, die die<br />
Clan wirtschaft der PS zu überwinden<br />
suchte. Bislang vergebens. Seine Weigerung,<br />
sich zu einem der Fähnleinführer<br />
zu bekennen, wurde Hollande damit vergolten,<br />
dass er nie ein Ministeramt erhielt.<br />
Andererseits erwies sich seine parteiinterne<br />
Bindungslosigkeit als ideale Voraussetzung<br />
für die Übernahme der Parteiführung.<br />
In dem Amt gelang es Hollande<br />
nicht nur, die Partei trotz zweier Niederlagen<br />
in Präsidentschaftswahlen und ihrem<br />
sehr enttäuschenden Abschneiden bei<br />
den Wahlen zur Nationalversammlung<br />
im Juni 2002 zusammenzuhalten, sondern<br />
ihr auch neue Siegeszuversicht einzuflößen.<br />
<strong>Die</strong> fand ihre Bestätigung darin,<br />
dass die Sozialisten bei allen seither stattgefundenen<br />
Wahlen kontinuierlich Stimmen<br />
hinzugewannen.<br />
<strong>Die</strong>se Erfolge lassen sich zwar nicht allein<br />
dem Parteivorsitzenden zugutehalten.<br />
Deshalb verraten sie auch nicht, ob Hollande<br />
mehr ist als ein blasser Parteisoldat<br />
mit der Anmutung eines Präsidenten des<br />
Drogistenverbands, der dank seiner stets<br />
freundlichen Zuvorkommenheit lediglich<br />
den kleinsten gemeinsamen Nenner der<br />
divergierenden Parteiströmungen verkörperte.<br />
Eben darauf stellt der häufig zitierte<br />
Spott des innerparteilichen Widersachers<br />
Arnaud Montebourg ab, der Hollande als<br />
„flanby“, als Wackelpudding, charakterisierte.<br />
Tatsächlich scheint die Fähigkeit,<br />
im politischen Geschäft Härte zu zeigen,<br />
nicht zu den hervorstechenden Charaktereigenschaften<br />
Hollandes zu gehören. <strong>Die</strong><br />
aber wird er als Staatspräsident brauchen,<br />
wenn er das Amt für Frankreich erfolgreich<br />
ausüben will.<br />
66 <strong>Cicero</strong> 1.2013
François Hollande<br />
hat viel versprochen<br />
und bislang nur<br />
wenig gehalten<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 67
| W E L T B Ü H N E | F R A N K R E I C H<br />
Staatsschulden (in % des Bruttoinlandsprodukts)<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Staatsausgaben (in % des Bruttoinlandsprodukts)<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011<br />
Nominales Bruttoinlandsprodukt (in %)<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
-2<br />
-4<br />
-6 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011<br />
Frankreich Spanien Deutschland<br />
Griechenland Italien Großbritannien<br />
Quelle: OECD<br />
Quelle: OECD<br />
Durchschnitt Eurozone<br />
2013*<br />
2013*<br />
2013*<br />
* Prognose<br />
*Prognose<br />
Von allen demokratisch legitimierten<br />
Staatschefs gebietet der unmittelbar vom<br />
Volk gewählte französische Präsident nach<br />
der Verfassung über die größte Machtfülle.<br />
So verfügt er über einen politischen Entscheidungsspielraum,<br />
der ihn von Parteien<br />
und Fraktionen unabhängig macht. Allein<br />
seine eigene Agenda und nicht ein Parteiprogramm<br />
oder gar ein Koalitionsvertrag<br />
ist die Vorgabe seines Handelns. Hollandes<br />
Wahlversprechen war ein Katalog<br />
von 60 Punkten, in denen allzu konkrete<br />
Festlegungen vermieden wurden. Außerdem<br />
enthielt dieses Dokument eine Reihe<br />
wohlfeiler Ankündigungen, die den Erwartungen<br />
der eigenen Klientel entsprachen,<br />
aber nichts dazu beitragen, der<br />
Frankreich drohenden Krise wirksam zu<br />
begegnen. Dazu gehört etwa die Einführung<br />
der Homo-Ehe, die Schaffung von<br />
Arbeitsplätzen für Jugendliche aus sozialen<br />
Brennpunkten auf Staatskosten oder die<br />
Einstellung von Lehrern, deren Mehrkosten<br />
durch nicht spezifizierte Einsparungen<br />
wieder ausgeglichen werden sollen. Anderes<br />
dürfte die Krise sogar verschärfen. Das<br />
gilt etwa für die Bekräftigung der Rente<br />
mit 60 oder der 35-Stunden-Woche, die<br />
ein riesiges Kontingent an Überstunden<br />
schafft, die abgefeiert werden müssen. Zu<br />
nennen wäre auch die unterdessen verabschiedete,<br />
auf zwei Jahre befristete Spitzensteuer<br />
von 75 Prozent, die 1<strong>500</strong> Bezieher<br />
von Jahreseinkommen von über einer<br />
Million Euro trifft. <strong>Die</strong>se Steuer soll dem<br />
Fiskus 210 Millionen Euro im Jahr einbringen,<br />
wird aber einen noch weit größeren<br />
Schaden stiften, weil sie Spitzenverdiener<br />
aus dem Land treibt. Zu den<br />
wahrhaft politischen Mätzchen des frisch<br />
gekürten Staatspräsidenten gehörte auch<br />
die nur für die Dauer der Ferienzeit verordnete<br />
Senkung des Benzinpreises um<br />
sechs Cent pro Liter.<br />
All dies wie auch der unterhaltsame Zickenkrieg,<br />
den Hollandes derzeitige Lebensgefährtin<br />
gegen dessen Ex Ségolène<br />
Royal anzettelte, trugen dazu bei, dass der<br />
Popularitätsbonus des neuen Präsidenten<br />
schneller und tiefer abstürzte als bei jedem<br />
seiner Amtsvorgänger. Das ließe sich<br />
ja verschmerzen, wäre dieser tiefe Fall in<br />
der Publikumsgunst die öffentliche Reaktion<br />
auf die Ankündigung von „Blut,<br />
Schweiß und Tränen“ gewesen. Zumal<br />
sich die Perspektiven Frankreichs als sehr<br />
prekär darstellen.<br />
FOTO: IAN LANGSDON/EPA/PICTURE ALLIANCE/DPA (SEITEN 66 BIS 67)<br />
68 <strong>Cicero</strong> 1.2013
INFOGRAFIKEN: KRISTINA DÜLLMANN (SEITEN 68 BIS 69)<br />
Den Befund belegen einige Zahlen und<br />
Vergleiche. 1981, als François Mitterrand<br />
Staatspräsident wurde, herrschte Konjunktur,<br />
war das Haushaltsdefizit klein und belief<br />
sich die Staatsverschuldung auf lediglich<br />
22 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Außerdem<br />
besaß Frankreich noch den Franc,<br />
das bedeutete, das Land konnte Wettbewerbsnachteile<br />
gegenüber seinen ausländischen<br />
Handelspartnern durch Abwertung<br />
seiner Währung, die Exporte verbilligte,<br />
Importe aber verteuerte, leicht ausgleichen.<br />
Heute ist dieser Ausweg durch die<br />
Zugehörigkeit Frankreichs zur Eurozone<br />
versperrt, das Wirtschaftswachstum tendiert<br />
gegen null und droht in eine Rezession<br />
abzukippen. Das Haushaltsdefizit beläuft<br />
sich für 2012 auf rund 4,7 Prozent<br />
und liegt damit noch immer deutlich über<br />
dem Limit von 3 Prozent, das für die Eurozone<br />
als verbindlich festgelegt ist. Auch<br />
die Staatsverschuldung hat stark zugenommen<br />
und beträgt jetzt mehr als 90 Prozent<br />
des Bruttoinlandsprodukts.<br />
Allein unter der Präsidentschaft von<br />
Hollandes Amtsvorgänger Nicolas Sarkozy<br />
wuchs dieser Schuldenberg nach Angaben<br />
des Internationalen Währungsfonds<br />
um rund <strong>500</strong> Milliarden Euro und überschreitet<br />
jetzt die Marke von 1900 Milliarden<br />
Euro. Ein privater Haushalt oder ein<br />
Unternehmen wäre angesichts einer solchen<br />
Verschuldung pleite. Nicht aber ein<br />
Staat, der sich, je nach Kreditwürdigkeit,<br />
schier unbegrenzt frisches Geld besorgen<br />
kann, allerdings in aller Regel nur zu steigenden<br />
Zinsen, die ihrerseits die Schuldenlast<br />
zusätzlich vergrößern. <strong>Die</strong>se Regel gilt<br />
für Frankreich trotz der Herabstufung seiner<br />
Kreditwürdigkeit durch zwei der drei<br />
großen Ratingagenturen noch nicht; das<br />
Land kann nach wie vor problemlos Kredite<br />
aufnehmen, deren Zinsen seit Hollandes<br />
Amtsantritt sogar gesunken sind und<br />
unterhalb der Inflationsrate im Euroraum<br />
liegen, die sich nach einer ersten Schätzung<br />
für 2012 auf 2,7 Prozent beläuft. Das kann<br />
sich jedoch plötzlich ändern, wenn die internationalen<br />
Finanzmärkte die wirtschaftlichen<br />
Aussichten Frankreichs als negativ<br />
bewerten.<br />
DIESEM BEFUND WILL Präsident Hollande zuvorkommen,<br />
indem er, wie von ihm angekündigt,<br />
binnen zwei Jahren Reformen verwirklicht.<br />
Davon ist bislang allerdings erst<br />
eine Maßnahme beschlossen worden: <strong>Die</strong><br />
Kapitalismus<br />
Das System des Kapitalismus funktioniert<br />
gut und sollte erhalten bleiben, sagen...<br />
(Angaben in %)<br />
65<br />
China<br />
55<br />
USA<br />
54<br />
Polen<br />
46<br />
Deutschland<br />
45<br />
Großbritanien<br />
26<br />
Italien<br />
15<br />
Frankreich<br />
Quelle: Ifop, 2010<br />
Unternehmen werden in den kommenden<br />
vier Jahren um 20 Milliarden Euro entlastet.<br />
Das soll Investitionsanreize schaffen. Problematisch<br />
ist allerdings die gewählte Form.<br />
Der Staat stundet ihnen Steuern, allerdings<br />
erst 2014 und mit einem großen bürokratischen<br />
Aufwand. Auch mittelständische Unternehmen<br />
sollen gezielt finanziell gefördert<br />
werden. Da aber die bloße Ankündigung<br />
noch keinen Wandel schafft, könnte sich die<br />
Zeitspanne von zwei Jahren als viel zu lang<br />
erweisen. Also gilt es, möglichst rasch umfassende<br />
und wirksame Reformen zu beginnen.<br />
Daran aber haperte es bislang entschieden,<br />
monierten zahlreiche Kritiker. Denen<br />
hielt Hollande bei der ersten Pressekonferenz<br />
seiner Präsidentschaft im November<br />
entgegen, Politik sei keine „Addition von<br />
Reformen, keine Buchhaltung von Versprechen,<br />
sondern eine kohärente Antwort auf<br />
die Erwartungen des Volkes“.<br />
Damit beschrieb er die Programmatik<br />
wie die Krux seines künftigen Handelns<br />
als Präsident, seine Entschlossenheit, nur<br />
Veränderungen anzupacken, die wenigstens<br />
nicht allzu viele Wähler enttäuschen. Dem<br />
entsprechen auch die ersten Ankündigungen,<br />
die anmuten, als solle ein Buschfeuer<br />
mit der Gießkanne gelöscht werden. Das<br />
erinnert andererseits an jene homöopathische<br />
Therapie, mit der es Hollande als Chef<br />
der PS gelang, die Partei zum Erfolg zu<br />
führen und für sich selber die Präsidentschaft<br />
zu erobern.<br />
Das rasch anwachsende Crescendo<br />
des Kritikerlärms, das seinen Vorgänger<br />
Sarkozy spürbar nervte und ihn zu einer<br />
stetig hektischeren Geschäftsführung provozierte,<br />
perlt an Hollande spurlos ab. Damit<br />
beweist er erneut die Stärke, die ihm<br />
die Präsidentschaft verschaffte, weil sie<br />
sich von der gleichermaßen ermüdenden<br />
wie erfolglosen Quirligkeit des Konkurrenten<br />
so deutlich abhob. Nicht weil sein<br />
Programm die Wähler überzeugte, wurde<br />
Hollande gewählt, sondern weil er ihnen<br />
verhieß, auch als Präsident „normal“ zu<br />
sein, sprich: freundlich, nett, berechenbar.<br />
Das und nicht das Versprechen auf wundersame<br />
Heilung aller Leiden Frankreichs<br />
war auch der Sinngehalt seines Wahlslogans:<br />
„Le changement, c’est maintenant“,<br />
unter dem man wohl einen Wandel verstehen<br />
soll, der sich über die gesamte Zeit seiner<br />
Präsidentschaft erstreckt.<br />
SOLCHE GEMÄCHLICHKEIT verheißt nicht<br />
Revolution, mit der die Franzosen seit<br />
bald 225 Jahren reiche, aber auch sehr<br />
gemischte Erfahrungen gemacht haben,<br />
sondern behutsame Evolution, die als verständiger<br />
Geburtshelfer zu begleiten sich<br />
Hollande weder durch die Kritiker noch<br />
durch die Märkte stören lassen will. In diesem<br />
Vorsatz unterscheidet sich Hollande<br />
im Übrigen auch nicht allzu sehr von Angela<br />
Merkel, wie hierzulande gerne gemutmaßt<br />
wird, denn die behauptet ihre<br />
Macht keineswegs durch kühne Reformen,<br />
wegen deren Durchsetzung ihr Vorgänger<br />
das Amt verlor, sondern ebenfalls durch<br />
eine sich nach allen Seiten und Interessen<br />
absichernde Moderation.<br />
Ob Hollande aber wie Merkel trotz aller<br />
Verbindlichkeit auch unnachgiebige Härte<br />
zeigen kann, muss sich noch erweisen. Einen<br />
ersten Test auf europäischer Ebene hat<br />
er jedenfalls nicht bestanden. Das von ihm<br />
im Wahlkampf wiederholt abgelegte Versprechen,<br />
Europa vor dem „Spardiktat“ zu<br />
retten, auf dem die deutsche Kanzlerin beharrt<br />
und das von ihr als Allheilmittel für<br />
die Eurokrise ausgegeben wird, hat er einfach<br />
kassiert. Stattdessen ratifizierte er den<br />
europäischen Fiskalpakt und irritierte so<br />
die Parteilinke. Möglich jedoch, dass das<br />
nur ein taktisches Zugeständnis war, um<br />
das Pulver vor der anstehenden wichtigeren<br />
Schlacht über die Verabschiedung des<br />
EU-Haushalts für die kommenden Jahre<br />
nicht zu verschießen. Fast die Hälfte der<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 69
| W E L T B Ü H N E | F R A N K R E I C H<br />
Arbeitslosigkeit (in %)<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12<br />
Arbeitsproduktivität in der Gesamtwirtschaft (in %)<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
-2<br />
-4<br />
-6<br />
1999<br />
Frankreich<br />
Griechenland<br />
Quelle: OECD<br />
2001<br />
2003<br />
Spanien<br />
Italien<br />
2005<br />
Deutschland<br />
Großbritannien<br />
europäischen Haushaltsmittel kommt als<br />
Subventionen der Landwirtschaft zugute.<br />
In der rangiert Frankreich zwar in der Weltspitze,<br />
wird aber dennoch wie stets darauf<br />
beharren, auch weiterhin den größten<br />
Batzen der EU-Agrarmarktförderung einzustreichen.<br />
Merkel wird Hollande kaum<br />
etwas entgegenhalten können, denn der<br />
deutsche „Nährstand“ wird ebenfalls von<br />
den Brüsseler Subventionen bis zum Umfallen<br />
gemästet.<br />
HÄRTE WIRD HOLLANDE brauchen, wenn er<br />
die große Herausforderung seiner Präsidentschaft,<br />
die französische Wirtschaftsund<br />
Finanzkrise, meistern will. Hier plagt<br />
ihn allem Anschein nach ein Handicap,<br />
das er trotz seiner präsidialen Machtfülle<br />
nicht ignorieren kann: die französischen<br />
Sozialisten, die ihre ideologische, intellektuelle<br />
und strategische Neuaufstellung<br />
bislang vermieden haben, weshalb von ihnen<br />
jeglicher Marktliberalismus als kapitalistische<br />
Teufelei abgelehnt wird. <strong>Die</strong>ses<br />
2007<br />
2009<br />
2011<br />
Durchschnitt Eurozone<br />
*Prognose<br />
2013*<br />
* Prognose<br />
Credo personifiziert in der Regierung ein<br />
junger Mann wie Ar naud Montebourg, der<br />
als „Ministre du Redressement productif“<br />
ausgerechnet für die Rettung der französischen<br />
Wirtschaft und Industrie zuständig<br />
ist. Nicht nur marktliberale Hollande-Kritiker<br />
sehen in Montebourg den sprichwörtlichen<br />
Bock, der zum Gärtner gemacht<br />
wurde. So viel Rücksichtnahme auf den<br />
eigenen politischen Verein legt den Eindruck<br />
nahe, dass der Präsident noch immer<br />
von den therapeutischen Reflexen seines<br />
früheren Selbst als Parteichef geplagt wird.<br />
Eine konsistente Antwort auf die Herausforderungen<br />
durch die Krise, der sich<br />
Frankreich gegenübersieht, beschränkt sich<br />
aber nicht nur darauf, das finanzielle und<br />
wirtschaftliche Soll und Haben auszugleichen;<br />
eine solche Antwort verlangt vor allem<br />
auch eine Redimensionierung, sprich:<br />
eine der Wirklichkeit entsprechende<br />
Schrumpfung des eigenen Selbstbilds.<br />
Frankreich ist eine europäische Mittelmacht,<br />
die sich aber immer noch gerne als<br />
Weltmacht geriert, ohne auch nur annähernd<br />
die Bedeutung oder die Mittel zu haben,<br />
diesem Anspruch Geltung zu verschaffen.<br />
Auch Hollande hat unlängst diesem<br />
Affen Zucker gegeben, als er eine Intervention<br />
im syrischen Bürgerkrieg aufwarf.<br />
Das aber sind nur Glasperlenspiele, von<br />
denen ein französischer Präsident traditionell<br />
nicht lassen kann. Anlass zu Bedenken<br />
gibt diese Haltung jedoch, projiziert<br />
man sie auf den Horizont der angestrebten<br />
europäischen Einigung. <strong>Die</strong> könnte<br />
schlicht daran scheitern, dass Frankreich<br />
kein Stück seiner Souveränität preisgeben<br />
will, weil diese mit dem Selbstbild der eigenen<br />
Größe identisch ist.<br />
Eine andere, ebenfalls sehr schwierige<br />
Aufgabe, die sich dem Krisenmanagement<br />
Hollandes stellt, ist die Beschneidung des<br />
auswuchernden und seit langem eingelebten<br />
französischen Etatismus, der das reichlich<br />
prosaische Gerüst für das vielbewunderte<br />
Savoir-vivre ist. Weit mehr als in<br />
vergleichbaren anderen Ländern wird in<br />
Frankreich das Lebensglück des Einzelnen<br />
wie das Wohlergehen von Produktionszweigen,<br />
Gewerkschaften, Berufsgruppen,<br />
Familien, Verbänden und Vereinen durch<br />
staatliche Vorgaben und Transferleistungen<br />
beeinflusst und geregelt. Der Geldwert aller<br />
dieser zumeist als selbstverständlich betrachteten<br />
Aufwendungen summiert sich<br />
zu der wahrhaft immensen Staatsquote von<br />
rund 57 Prozent am jährlich erwirtschafteten<br />
Bruttosozialprodukt und schlägt sich<br />
nieder in einem riesigen Heer von Beamten<br />
– jeder vierte Erwerbstätige arbeitet für<br />
den Staat –, die mehrheitlich zu den treuesten<br />
Wählern der Sozialisten zählen.<br />
Insbesondere das französische Sozialstaatsmodell<br />
gilt als unantastbar. Dessen<br />
Reform wird der Präsident den Franzosen<br />
geduldig als notwendige Voraussetzung dafür<br />
erklären müssen, wenn sie sich auch unter<br />
den Zwängen der Globalisierung das Savoir-vivre<br />
in Gallien bewahren wollen. Das<br />
verlangt gewiss viel Fingerspitzengefühl und<br />
auch eine Leidenschaft für Pädagogik. Eigenschaften,<br />
die man François Hollande<br />
eher zutrauen kann als reformerischen Willen.<br />
Den muss er erst noch beweisen.<br />
JOHANNES WILLMS<br />
befasst sich seit vielen Jahren<br />
publizistisch mit Frankreichs<br />
Gegenwart und Geschichte<br />
FOTO: VERLAG C. H. BECK; INFOGRAFIKEN: KRISTINA DÜLLMANN<br />
70 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Ihr Sparpaket: iPad 4<br />
mit Tagesspiegel E-Paper<br />
für nur 24 ¤ im Monat.<br />
*<br />
Sichern Sie sich Ihr Sparpaket<br />
zum einmaligen Vorzugspreis:<br />
• iPad (4. Generation)<br />
• Tagesspiegel E-Paper<br />
• Tagesspiegel-App<br />
für iPad und iPhone<br />
• Hardcase mit Standfunktion<br />
im Wert von 34,99 ¤ gratis dazu –<br />
für alle Besteller bis zum<br />
31. März 2013!<br />
für nur 24 ¤ im Monat! *<br />
Über<br />
1 Million<br />
Downloads:<br />
<strong>Die</strong> Tagesspiegel-App –<br />
eine der beliebtesten<br />
Nachrichten-Apps<br />
in Deutschland.<br />
Gleich bestellen:<br />
Telefon (030) 290 21 - <strong>500</strong><br />
www.tagesspiegel.de/ipad4<br />
* Einmalige Zuzahlung für iPad (4. Generation), schwarz, 16 GB mit Wi-Fi: 99,– ¤ / mit Wi-Fi und Cellular: 195,– ¤. <strong>Die</strong> Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Nach Ablauf der<br />
Mindestlaufzeit gilt der dann gültige Preis für das E-Paper (zzt. 16,99 ¤ monatlich). Preise inkl. MwSt. Der Kauf des iPad steht unter Eigentumsvorbehalt innerhalb der ersten<br />
2 Jahre. <strong>Die</strong> Garantie für das iPad beläuft sich auf ein Jahr. Mit vollständiger Zahlung des Bezugspreises für die Mindestvertragslaufzeit geht das Eigentum am iPad an den Käufer<br />
über. Es gelten die unter tagesspiegel.de/ipad4 veröffentlichten AGB. <strong>Die</strong> einmalige Zuzahlung wird bei Lieferung des Gerätes fällig. Zusätzlich zur Zahlung werden 2,– ¤ Nachentgelt<br />
erhoben. Nur so lange der Vorrat reicht.
| W E L T B Ü H N E | I S R A E L<br />
DIE SIEBEN IRRTÜMER<br />
Im Januar wählt Israel ein neues Parlament. Unabhängig davon, wer die Wahlen<br />
gewinnen wird: <strong>Die</strong> Regierung wird sich endlich den Realitäten stellen müssen<br />
VON JUDITH H ART<br />
Irrtum 1: Durch eine<br />
militärische Intervention<br />
lässt sich Frieden schaffen<br />
Ist die Hamas nun gestärkt oder geschwächt<br />
aus der jüngsten militärischen<br />
Auseinandersetzung hervorgegangen? Experten<br />
inner- und außerhalb Israels sind<br />
sich über diese wesentliche Frage keineswegs<br />
einig, und das aus einem einfachen<br />
Grund: Seit mehr als zwei Jahrzehnten<br />
ficht Israel keine Kriege mit regulären<br />
Armeen aus. Stattdessen muss es sich mit<br />
dem organisierten Widerstand einer Zivilbevölkerung<br />
auseinandersetzen oder<br />
mit hochgerüsteten und gut ausgebildeten<br />
Milizen wie der Hisbollah im Südlibanon<br />
oder dem bewaffneten Flügel der<br />
Hamas in Gaza. <strong>Die</strong>se Milizen führen<br />
ihre Angriffe mit Bedacht aus dicht besiedelten<br />
Gebieten heraus, was Israels Armee<br />
die Kriegsführung erschwert. Asymmetrische<br />
Kriege gegen nicht reguläre<br />
Kämpfer aber – das lernen die USA und<br />
ihre Verbündeten in Afghanistan –, sind<br />
nicht wirklich zu gewinnen. <strong>Die</strong> potenziellen<br />
politischen Schäden jedoch sind<br />
enorm, so war das auch nach der Gaza-<br />
Intervention von 2008/2009. Hatte Israel<br />
wegen des andauernden Raketenbeschusses<br />
durch die Hamas anfangs noch einige<br />
Sympathien auf seiner Seite, verlor es<br />
diese, je länger die Bodenoffensive dauerte<br />
und immer mehr Palästinenser starben. Israel<br />
kann, und das ist wesentlicher Bestandteil<br />
der Sicherheitsdoktrin des Landes,<br />
ein gewisses Maß an Abschreckung<br />
aufrechterhalten, um damit den radikalen<br />
Milizen zu signalisieren, dass es Aggressionen<br />
nicht hinzunehmen bereit ist. Aber es<br />
kann keine Kriege entscheiden und so als<br />
Sieger einen Frieden erzwingen.<br />
Irrtum 2: <strong>Die</strong> Zeit spricht<br />
für Israel<br />
<strong>Die</strong> Haltung des israelischen Regierungschefs<br />
Benjamin Netanjahu könnte man in<br />
etwa so umschreiben: Solange die Palästinenser<br />
nicht bereit sind, auf Maximalforderungen<br />
wie das Rückkehrrecht für die<br />
heute etwa 3,7 Millionen palästinensischen<br />
Flüchtlinge beziehungsweise deren<br />
Nachkommen in bereits dritter und vierter<br />
Generation zu verzichten, solange damit<br />
faktisch das Existenzrecht Israels infrage<br />
gestellt wird, weil mit einer Rückkehr<br />
der Flüchtlinge eine jüdische Mehrheit im<br />
Staat Israel nicht mehr gewährleistet wäre,<br />
solange muss man den Konflikt eher „managen“<br />
als lösen.<br />
Nun ist der israelisch-palästinensische<br />
Konflikt sicherlich nicht das wichtigste<br />
Problem in der Region – das ist<br />
eher die Unfähigkeit arabischer Regierungen,<br />
korruptionsfrei zu regieren oder<br />
etwa zukunftsfähige Ökonomien aufzubauen.<br />
Aber ein Anhalten des Konflikts<br />
destabilisiert den Nahen Osten. <strong>Die</strong><br />
Lage in der Region entwickelt sich ohnehin<br />
nicht gerade zum Vorteil Israels.<br />
In Ägypten regieren Islamisten – ob sie<br />
den strategisch für Israel äußerst wichtigen<br />
Friedensvertrag auf Dauer respektieren<br />
werden, ist ungewiss. Syrien zerfällt in<br />
einem schon Monate währenden Bürgerkrieg,<br />
der auch Jordanien und den Libanon<br />
destabilisieren könnte. Auf palästinensischer<br />
Seite schrumpft die Gruppe jener,<br />
die eine Zwei-Staaten-Lösung anstreben.<br />
Und in Europa verliert selbst Bundeskanzlerin<br />
Angela Merkel die Geduld mit einem<br />
Regierungschef, dem offensichtlich<br />
jegliche strategische Weitsicht fehlt und<br />
der bislang mit keiner Idee aufgefallen ist,<br />
wie man wieder zu aussichtsreichen Verhandlungen<br />
mit den Palästinensern kommen<br />
könnte. Natürlich ist der Weg zu einer<br />
Zwei-Staaten-Lösung – deren Ziele im<br />
Übrigen längst vorgezeichnet sind – nicht<br />
leicht. Aber sie ist die einzige Möglichkeit,<br />
Israel als jüdischen und demokratischen<br />
Staat zu erhalten.<br />
Aussitzen ist also auf Dauer keine<br />
Option.<br />
Irrtum 3: Ein Waffengang<br />
gegen den Iran wird dessen<br />
Atomträume vernichten<br />
Kardash, Arak und Fordo sind die <strong>wichtigsten</strong><br />
Anlagen des Iran, in denen Uran bis<br />
zur Waffenfähigkeit angereichert werden<br />
könnte. Sie sind quer über den Iran verteilt<br />
oder wie im Fall Fordos unter dicken Gesteinsschichten<br />
versteckt. Ein Militärschlag<br />
der israelischen Armee müsste nicht nur<br />
72 <strong>Cicero</strong> 1.2013
politisch bestens vorbereitet sein – schließlich<br />
müssen auf dem Weg in den Iran Überflugrechte<br />
von Ländern eingeholt werden,<br />
die man nicht gerade als „befreundet“ bezeichnen<br />
kann. Er müsste zudem äußerst<br />
schnell und sehr präzise geführt werden,<br />
um die Zahl der Opfer gering zu halten<br />
und um möglichst wenig politischen Schaden<br />
anzurichten. Dass der Iran nach einem<br />
Militärschlag die Straße von Hormuz und<br />
damit den Persischen Golf sperrt, ist keineswegs<br />
ausgeschlossen. Zudem könnte die<br />
mit dem Iran verbündete Hisbollah Terroranschläge<br />
verüben. Wohl am <strong>wichtigsten</strong><br />
aber ist: Israel verfügt gar nicht über<br />
die militärische Ausrüstung, um Anlagen<br />
wie Fordo wirksam zu zerstören. <strong>Die</strong> israelische<br />
Luftwaffe, die nur kleinere Kampfflugzeuge<br />
besitzt, kann keine sogenannten<br />
„Bunker Busters“ transportieren. <strong>Die</strong> aber<br />
benötigt man, um die dicken Gesteinsschichten<br />
zu durchdringen. Selbst wenn<br />
Israel sehr präzise zuschlägt und die politischen<br />
Folgewirkungen minimieren kann,<br />
wäre Irans Atomprogramm höchstens um<br />
einige Jahre zurückgeworfen, aber nicht<br />
beendet. So überrascht es kaum, dass sich<br />
fast das gesamte Sicherheitsestablishment<br />
Israels offen gegen eine militärische Lösung<br />
ausgesprochen hat.<br />
Irrtum 4: Innenpolitische<br />
Lösungen haben bis zu einer<br />
Friedenslösung Zeit<br />
Tausende Israelis campierten im Sommer<br />
2011 auf dem Tel Aviver Rothschild-<br />
Boulevard, um gegen unerschwingliche<br />
Immobilienpreise im Kernland Israels zu<br />
protestieren. Auch wenn die Aktion nach<br />
einigen Wochen langsam an Kraft verlor,<br />
sind wesentliche Probleme immer noch<br />
aktuell. Nur etwa 60 Prozent der arbeitsfähigen<br />
Bevölkerung Israels tragen wesentlich<br />
zum Bruttosozialprodukt und<br />
Steueraufkommen des Landes bei. Zwei<br />
der am schnellsten wachsenden Gruppierungen<br />
– die arabischen Israelis und die<br />
Ultraorthodoxen – sind die Sorgenkinder<br />
der Gesellschaft.<br />
Arabische Staatsbürger machen etwas<br />
mehr als 20 Prozent der Bevölkerung aus.<br />
Sie sind im Durchschnitt immer noch<br />
schlechter ausgebildet, verdienen weniger<br />
und sind weniger produktiv – und das ist<br />
nicht nur der zweifelsohne vorhandenen<br />
Diskriminierung durch jüdische Israelis geschuldet,<br />
sondern beispielsweise auch der<br />
Benachteiligung von Frauen in der arabischen<br />
Gesellschaft. Ultraorthodoxe Juden<br />
erkennen den Staat Israel formal nicht an,<br />
sie leisten keinen Militärdienst – eine Gesetzesreform,<br />
die dies ändert, wird gerade<br />
erst durchgesetzt –, und sie empfangen<br />
den größten Teil der Transferleistungen<br />
des Staates. <strong>Die</strong> meisten ultraorthodoxen<br />
Männer arbeiten nicht, sondern studieren<br />
in Religionsschulen. Dass diese Gruppe<br />
weiterhin subventioniert wird, dafür sorgt<br />
die komplizierte Koalitionspolitik in Israel.<br />
Bislang haben es ultraorthodoxe Parteien<br />
immer geschafft, als Zünglein an der<br />
Waage zu fungieren und damit ihre Privilegien<br />
zu schützen.<br />
Und damit sind nur die wirtschaftlichen<br />
Probleme angesprochen. Der Beteiligung<br />
religiöser Parteien in fast allen Regierungskoalitionen<br />
ist zu verdanken, dass<br />
sich Paare immer noch nicht zivilrechtlich<br />
trauen oder scheiden lassen können – sehr<br />
zum Verdruss der Säkularen, die nicht nur<br />
Militärdienst leisten, sondern auch für die<br />
Transferleistungen an die Ultraorthodoxie<br />
aufkommen müssen.<br />
So ungeklärt wie das Verhältnis von<br />
Staat und Religion in einem eigentlich säkularen<br />
Staat blieb auch der Platz der arabischen<br />
Bürger innerhalb eines jüdischen<br />
Staates. Ohne Frage: Arabische Bürger Israels<br />
genießen größere Freiheiten und<br />
ILLUSTRATION: JULIAN RENTZSCH<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 73
| W E L T B Ü H N E | I S R A E L<br />
besseren sozialen Schutz als die Bürger der<br />
meisten arabischen Staaten. Je weiter ein<br />
Abkommen mit den Palästinensern in die<br />
Ferne rückt, desto schwächer aber wird<br />
auch die Loyalität, die israelische Araber<br />
dem Staat gegenüber empfinden, dessen<br />
Bürger sie sind. Israel wird ein Staat bleiben,<br />
in dem Raum sein muss für höchst<br />
verschiedene Erzählungen – denn was für<br />
jüdische Israelis der „Unabhängigkeitstag“<br />
und damit Grund für Feiern und Jubel ist,<br />
bleibt für die meisten Araber ein „Tag der<br />
Katastrophe“.<br />
Sollen sich die Friktionen innerhalb<br />
der israelischen Gesellschaft nicht weiter<br />
verstärken, dann können Reformen, dann<br />
kann eine Neuordnung des Verhältnisses<br />
von Staat und Religion und ein klareres<br />
Bekenntnis zum Staat Israel als „Staat für<br />
all seine Bürger“ nicht auf einen Friedensschluss<br />
warten.<br />
Irrtum 5: Israel steht<br />
wirtschaftlich super da<br />
Im Vergleich zu den Ländern der Region –<br />
inklusive der Türkei – ist Israel eine echte<br />
und durchaus beneidete Ausnahmeerscheinung.<br />
Es gehört zu den 15 innovativsten<br />
Ländern mit den meisten genehmigten Patenten<br />
der Welt; es verfügt bei nur acht<br />
Millionen Einwohnern über ein Bruttoinlandsprodukt<br />
von knapp 30 000 Dollar<br />
pro Kopf. Zum Vergleich: Ägyptens BIP<br />
pro Kopf beträgt 3000 Dollar, Jordaniens<br />
5100 Dollar, das der Türkei liegt bei<br />
knapp 12 000 Dollar, und selbst das ölreiche<br />
Saudi-Arabien kommt nur auf knapp<br />
22 000 Dollar.<br />
Aber diese Durchschnittswerte verdecken<br />
einige ernsthafte Probleme der israelischen<br />
Volkswirtschaft: Der Großteil der<br />
Patente stammt aus der Computer- und<br />
Elektroindustrie, der größte Teil des seit<br />
Jahren bei mehr als 3 Prozent liegenden<br />
Wirtschaftswachstums ist Israels Hightechund<br />
Biotech-Industrie geschuldet; diese<br />
aber sind Know-how-, nicht jobintensiv.<br />
Sie bieten hervorragende Karriere- und<br />
Verdienstmöglichkeiten für Hochqualifizierte,<br />
aber wenige für Geringqualifizierte.<br />
Kein Wunder, dass das einstmals äußerst<br />
egalitäre Israel mittlerweile einen der<br />
höchsten Gini-Koeffizienten aufweist, der<br />
die Kluft zwischen Arm und Reich misst.<br />
Neben China und den USA gehört Israel<br />
inzwischen zu den Ländern, in denen die<br />
Ungleichheit am größten ist.<br />
Irrtum 6: Siedlungen sind<br />
der Garant für Sicherheit<br />
Als Faustpfand waren sie zunächst gedacht.<br />
Bereits nach dem Sechstagekrieg befürwortete<br />
die von der Arbeiterpartei geführte Regierung<br />
den Bau von „Wehrdörfern“, vor<br />
allem im Jordantal, um eine Infiltration palästinensischer<br />
Terroristen aus Jordanien zu<br />
verhindern. Sollte die arabische Seite für einen<br />
Frieden bereit sein, das war die Überlegung,<br />
könnte man diese Siedlungen wieder<br />
räumen. In den späten siebziger Jahren<br />
und unter der Führung der rechten Likud-<br />
Regierung wurde aus dem sicherheitspolitischen<br />
Unterfangen ein ideologisches. Siedlungen<br />
wurden in direkter Nähe zu großen<br />
arabischen Städten errichtet – wie Beit El<br />
nahe Ramallah, Kiryat Arba bei Hebron<br />
oder Elon Moreh bei Nablus. <strong>Die</strong>se Siedlungen<br />
waren dazu gedacht, eine Rückgabe<br />
des ursprünglichen biblischen Landes<br />
„Judäa und Samaria“ zu erschweren,<br />
wenn nicht zu verhindern.<br />
Käme es heute zum Friedensschluss, so<br />
würde ein Großteil der Siedlungen gegen<br />
einen fairen Landaustausch dem Kernland<br />
Israel zugeschlagen werden. So ist es in den<br />
„Clinton Parameters“ aus dem Jahr 2000<br />
festgehalten, und so sieht es auch die Genfer<br />
Initiative vor, auf die sich israelische<br />
und palästinensische Politiker informell<br />
im Jahr 2003 einigten. Was die Siedlungen<br />
betrifft, die außerhalb dieser Kordons<br />
liegen, so würde sich ein Großteil der<br />
nichtideologischen Siedler nicht gegen eine<br />
Räumung wehren, sollten ihnen Entschädigungen<br />
und Ersatz für ihre Häuser angeboten<br />
werden. <strong>Die</strong> meisten von ihnen sind<br />
nur wegen des subventionierten billigeren<br />
Wohnraums in besetztes Gebiet gezogen.<br />
Doch inzwischen hat sich in zweiter Generation<br />
ein Kern radikaler Siedler vor allem<br />
in Kiryat Arba, Elon Moreh oder Beit El<br />
gebildet, der sich einer Räumung mit allen<br />
politischen, wenn nicht sogar gewaltsamen<br />
Mitteln widersetzen würde. Das Argument,<br />
Israel habe bei seinem Rückzug aus dem Sinai<br />
1981 und aus dem Gaza streifen 2005<br />
ja schon Siedlungen erfolgreich geräumt,<br />
zählt für sie nicht. Weder der Gazastreifen<br />
noch die Sinai-Halbinsel haben die historische<br />
und religiöse Bedeutung der West<br />
Bank – für die religiöse Rechte ist dieses<br />
Land das biblische Judäa, in dem sich die<br />
historischen Stätten der Bibel und damit<br />
die „Wiege des Judentums“ befinden.<br />
Israel hat mit dem Ausbau der Siedlungen,<br />
der vor allem nach den Osloer Verträgen<br />
von 1993 immer schneller gesteigert<br />
wurde, nicht nur das Vertrauen aufs Spiel<br />
gesetzt, es meine es ernst mit der Formel<br />
„Land für Frieden“. Es hat Milliarden Euro<br />
in dieses Unterfangen investiert und damit<br />
Transferleistungen an die Siedler in schwindelerregender<br />
Höhe ermöglicht – wie viel<br />
Geld Israel genau ausgegeben hat, ist unmöglich<br />
festzustellen, da Kosten für Infrastruktur,<br />
Bau, Schutz durch das Militär und<br />
vieles mehr über die Jahrzehnte in verschiedenen<br />
Ministerien verankert wurden. Israelische<br />
Regierungen haben dadurch überdies<br />
die Entstehung einer ideologischen Siedlerbewegung<br />
gefördert, die im Zweifelsfall<br />
bereit wäre, sich über die Beschlüsse einer<br />
demokratisch gewählten Regierung hinwegzusetzen,<br />
und sich damit selbst ein Hindernis<br />
für den Frieden geschaffen.<br />
ILLUSTRATION: JULIAN RENTZSCH; FOTO: ANDREJ DALLMANN<br />
74 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> im Probeabo<br />
Irrtum 7: Israel kann es sich<br />
leisten, auf europäische<br />
Bündnispartner zu verzichten<br />
Am Ende waren es nur noch die USA, Kanada<br />
und Tschechien unter den westlichen<br />
Ländern und politische Schwergewichte<br />
wie Palau, Nauru und Mikronesien, die mit<br />
Israel gegen eine Anerkennung Palästinas<br />
als Staat mit Beobachterstatus in den Vereinten<br />
Nationen stimmten. Deutschland<br />
hat sich enthalten, die meisten anderen<br />
europäischen Staaten haben für eine Anerkennung<br />
gestimmt. Israels Premier Netanjahu<br />
zeigte sich über das Abstimmungsverhalten<br />
der Bundesrepublik verstimmt.<br />
Dass vor allem die Westeuropäer stramm<br />
und einseitig propalästinensisch seien, das<br />
halten ein großer Teil der israelischen Bevölkerung<br />
und die rechte Koalition unter<br />
Netanjahu ohnehin für ausgemacht.<br />
Kann man deshalb auf sie verzichten<br />
und sich hauptsächlich auf die USA stützen,<br />
die auch schon manch einseitige Resolution<br />
im UN-Sicherheitsrat mit einem<br />
Veto gekippt haben? Wohl nicht. Europa<br />
ist immer noch der größte Handelspartner<br />
Israels, knapp 35 Prozent der israelischen<br />
Importe stammen aus der EU, etwas mehr<br />
als 26 Prozent seiner Exporte gingen 2010<br />
nach Europa.<br />
Wichtiger aber ist: Nicht nur für eine<br />
Friedenslösung braucht Israel neben den<br />
USA die Unterstützung der Europäer, die<br />
seit Jahrzehnten einen erheblichen Anteil<br />
an der infrastrukturellen Aufbauarbeit in<br />
den palästinensischen Gebieten leisten –<br />
und sich durchaus auch für Sicherheitsarrangements<br />
im Fall eines Rückzugs engagieren<br />
sollten. Israel braucht Europa auch,<br />
um sein größtes strategisches Problem lösen<br />
zu können: eine nukleare Aufrüstung<br />
des Iran zu verhindern. Durch einen militärischen<br />
Alleingang wäre das nämlich<br />
nicht zu schaffen (siehe oben). Dafür bedarf<br />
es der europäischen Verhandlungspartner<br />
und des Drucks, der durch deren Initiative<br />
mit einem Ölembargo gegen den Iran<br />
entstanden ist.<br />
Lernen Sie <strong>Cicero</strong> sechs Monate kennen, und erhalten Sie<br />
als Dankeschön den Füllfederhalter von Faber-Castell.<br />
Ich möchte <strong>Cicero</strong> zum Vorzugspreis von 42,– EUR* kennenlernen!<br />
Bitte senden Sie mir die nächsten sechs <strong>Cicero</strong>-Ausgaben für 42,– EUR* frei Haus. Wenn mir <strong>Cicero</strong> gefällt, brauche ich nichts weiter zu<br />
tun. Ich erhalte <strong>Cicero</strong> dann weiterhin monatlich frei Haus zum Vorzugspreis von zurzeit 7,– EUR pro Ausgabe inkl. MwSt. (statt 8,– EUR<br />
im Einzelverkauf) und spare so über 10 %. Falls ich <strong>Cicero</strong> nicht weiterlesen möchte, teile ich Ihnen dies innerhalb von zwei Wochen<br />
nach Erhalt der sechsten Ausgabe mit. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin,<br />
Geschäftsführer Rudolf Spindler. *Angebot und Preise gelten im Inland, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
Vorname<br />
Name<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Telefon<br />
Ort<br />
E-Mail<br />
Geburtstag<br />
Hausnummer<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail über interessante Angebote<br />
des Verlags informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch das Senden einer E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg, jederzeit widerrufen werden.<br />
Datum<br />
Unterschrift<br />
Faber-Castell: Füllfederhalter<br />
<strong>Die</strong> edle Optik und das angenehme<br />
Schreibgefühl machen diesen<br />
Füllfederhalter zum idealen<br />
Begleiter in Beruf und Freizeit.<br />
Das Probeabo können Sie auch verschenken.<br />
Rufen Sie uns einfach kostenfrei an.<br />
JUDITH H ART<br />
leitet das Ressort Weltbühne von<br />
<strong>Cicero</strong>. Sie bereist Israel regelmäßig<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Bestellnr.: 907007<br />
Telefon: 0800 282 20 04<br />
Telefax: 0800 77 88 790<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: www.cicero.de/weihnachten
| W E L T B Ü H N E | G A Z A<br />
76 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Sozialarbeiter<br />
mit Raketen<br />
Seit 2007 herrscht die Hamas in Gaza, und seit 25 Jahren rufen<br />
ihre Führer zur Vernichtung Israels auf. Wer sind diese radikalen<br />
Palästinenser wirklich? Der Fotograf Frédéric Sautereau und der<br />
Autor Mohamad Bazzi suchen nach Antworten<br />
Demonstration: Der Gründungstag der Hamas<br />
wird mit einem Motorradkorso gefeiert<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 77
| W E L T B Ü H N E | G A Z A<br />
Privilegiert: Der Al-Noor-Park ist für die Familienangehörigen von sogenannten Märtyrern<br />
reserviert. <strong>Die</strong> Anlage wurde auf der früheren israelischen Siedlung Netzarim errichtet<br />
Unbeeindruckt: Erst wurde Hatems Friseursalon 2007 und 2008 Ziel eines Bombenattentats, dann verbot die Hamas auf<br />
Drängen der Salafisten Männern, die Haare von Frauen zu schneiden. Seinen Laden wird er dennoch nicht schließen<br />
78 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Verletzt: Der<br />
20-jährige Ismail<br />
wurde bei einem<br />
israelischen Angriff<br />
2009 schwer<br />
getroffen. Er<br />
leidet bis heute an<br />
den Folgen seiner<br />
Verwundungen<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 79
| W E L T B Ü H N E | G A Z A<br />
80 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Solidarität: Mitglieder des Islamischen Dschihads<br />
demonstrieren zur Verteidigung der Al-Aqsa-<br />
Moschee in Jerusalem. Unterdessen versucht die<br />
Hamas, die Exzesse der immer radikaler werdenden<br />
Gruppen unter Kontrolle zu bekommen<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 81
| W E L T B Ü H N E | G A Z A<br />
W<br />
AS AUCH IMMER MAN VON DER HAMAS HALTEN MAG, an einem<br />
kommt keiner vorbei: <strong>Die</strong> Hamas ist ein wichtiger politischer<br />
und sozialer Faktor in der palästinensischen Gesellschaft.<br />
Vor 25 Jahren als Ableger der Muslimbrüder gegründet,<br />
hat die Organisation heute viele Gesichter: ein sunnitisch-islamistisches,<br />
ein soziales und ein terroristisches. Vor allem aber ist Hamas<br />
eine Guerillabewegung, die im Geheimen wirkt, obwohl sie<br />
längst politische Macht erlangt hat.<br />
Ob es einem gefällt oder nicht: Hamas vertritt einen erheblichen<br />
Teil der palästinensischen Bevölkerung. Ohne deren Beteiligung<br />
wird es daher zwischen Israel und den Palästinensern keine<br />
tragfähige Vereinbarung zur Beilegung des Konflikts geben. Israel<br />
aber lehnt direkte Gespräche ab mit dem Verweis, man verhandle<br />
nicht mit Terroristen, die Hamasführung wiederum sendet widersprüchliche<br />
Signale. Vor allem zeigt sie keinerlei Bereitschaft, die<br />
Vernichtung Israels aus ihrer Charta zu streichen. Im Gegenteil.<br />
Bei seinem Besuch im Dezember bekräftigte Hamas-Chef Chalid<br />
Maschaal: „Wir geben keinen Zoll von Palästina auf. Es wird islamisch<br />
und arabisch bleiben. Der Heilige Krieg und der bewaffnete<br />
Widerstand sind der einzige Weg. Wir können Israels Legitimität<br />
nicht anerkennen.“<br />
<strong>Die</strong> Uneinigkeit innerhalb der Hamas hat ihren Ursprung in<br />
der Zersplitterung der Organisation: Es gibt einen politischen Flügel,<br />
der sich zum Teil im Exil und zum anderen Teil innerhalb der<br />
palästinensischen Gebiete befindet, und es gibt den militärischen<br />
Arm, die Al-Qassam-Brigaden. Jeder Flügel repräsentiert eine andere<br />
Strömung. Paradoxerweise verfügen die Führer im Exil, die<br />
zu den Hardlinern zählen, über den größten Einfluss.<br />
Einer der Gründe dafür dürfte sein, dass die Exilführung in<br />
ihrer kompromisslosen Haltung – ideell und vor allem finanziell<br />
– tatkräftig von Syrien und Iran unterstützt wird. Das hat seinen<br />
Preis. Manches Mal hat Hamas Maßnahmen ergriffen, die<br />
den Interessen Syriens und Irans dienten, sicherlich aber nicht denen<br />
der Palästinenser. So sind die Raketenangriffe auf Israel, die<br />
der Iran als Erfolg im Kampf gegen das „zionistische Gebilde“ betrachtet<br />
und für deren Abwehr Israel enorme Militärinvestitionen<br />
aufwenden muss, sicherlich nicht im Interesse der Palästinenser,<br />
die schließlich den israelischen Gegenangriffen ausgesetzt sind.<br />
<strong>Die</strong> Führung in Gaza, die von der Außenwelt abgeschnitten<br />
ist, ist darauf angewiesen, dass die Exilanten Geld sammeln und<br />
dadurch das Überleben der Organisation sichern. Jene Exilführer,<br />
die in komfortablen Verhältnissen weit entfernt von Gaza und<br />
der Westbank leben, können es sich leisten, in ihrer Haltung unnachgiebig<br />
zu sein. Weder leben sie unter ganz gewöhnlichen Palästinensern<br />
noch müssen sie ihnen gegenüber Rechenschaft ablegen.<br />
Aus der Ferne lässt sich die Fortsetzung des bewaffneten<br />
Kampfes mit allen Mitteln leicht fordern. Aber man täusche sich<br />
nicht: Auch wenn die Menschen in Gaza des tagtäglichen Kampfes<br />
müde geworden sein mögen, werden die Hardliner, angeführt von<br />
Chalid Maschaal, den Diskurs in Gaza auch weiterhin dominieren.<br />
Der Westen ist an dieser Entwicklung nicht ganz unschuldig.<br />
<strong>Die</strong> USA und Europa haben durch ihre Politik der Isolierung indirekt<br />
dazu beigetragen, dass die Exilführung die Hamas auf Kosten<br />
Heute besteht die<br />
Gefahr darin, dass eine<br />
noch tödlichere Kraft in<br />
den palästinensischen<br />
Gebieten entsteht:<br />
radikal-islamistisch<br />
motiviert oder von<br />
Al Qaida inspiriert<br />
der Führung innerhalb der palästinensischen Gebiete zu beherrschen<br />
begann. Vor der Übernahme Gazas durch die Hamas 2006<br />
hatte der Westen die Chance, sich mit Hamasführern aus den Gebieten,<br />
etwa mit Ismail Hanija, dem heutigen Chef der Hamas in<br />
Gaza, auseinanderzusetzen und sie in ein Gespräch einzubinden.<br />
Israelis und Amerikaner ließen diese Gelegenheit verstreichen in<br />
der Annahme, die Palästinenser würden schon irgendwann die<br />
Regierung stürzen. Sie haben aber eins nicht bedacht: Solange<br />
Gaza abgesperrt bleibt, wird Hamas die Ächtung durch den Westen<br />
als Vorwand benutzen, um von den eigenen Unzulänglichkeiten<br />
abzulenken. Wie aber sollen die Palästinenser je das politische<br />
Versagen der Hamas erkennen, solange sie nicht wirklich regieren<br />
kann? Statt die Palästinenser durch die Blockade gegen die Hamas<br />
aufzubringen, hat die Blockade die Menschen nur noch abhängiger<br />
von der Organisation gemacht. Als etwa Israel 2008 die Benzinversorgung<br />
in Gaza mehrfach eingeschränkt hatte, schlug Hamas<br />
sehr schnell Kapital daraus. Sie versah Polizeifahrzeuge mit<br />
Aufklebern, auf denen stand: „Wir sind bereit, Sie kostenlos zu<br />
fahren“, und setzte die Wagen als öffentliche Verkehrsmittel ein.<br />
In den Achtzigern glaubte man, dass die Palästinenser den<br />
Konflikt eines Tages schon leid sein und eine Alternative zu Jassir<br />
Arafat und seiner PLO finden würden. <strong>Die</strong> Alternative war noch<br />
militanter und noch kompromissloser: die Hamas. Es ist ihr in den<br />
25 Jahren ihres Bestehens gelungen, sich als Alternative zu der korrupten,<br />
ineffizienten und größtenteils diskreditierten PLO-Führung<br />
zu positionieren. Sollte die Hamas weiterhin isoliert bleiben,<br />
dann besteht heute die Gefahr, dass eine noch tödlichere Kraft in<br />
den palästinensischen Gebieten entsteht: radikal-islamistisch motiviert<br />
oder von Al Qaida inspiriert. Sollte es dem Westen daher<br />
nicht gelingen, sich mit der Hamas konstruktiv auseinanderzusetzen,<br />
wird das erneut den Radikalen helfen.<br />
M OHAMAD B A ZZI<br />
ist Adjunct Senior Fellow for Middle Eastern Studies beim<br />
Council on Foreign Relations und Professor für Journalistik<br />
an der New York University<br />
82 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Erinnerungsfoto: Der Hafen von Gaza ist ein beliebtes Ausflugsziel. Mit Trümmern der von<br />
Israel 2009 zerstörten Gebäude wurde die Kaimauer verstärkt und ausgebaut<br />
FOTO: CFR (AUTOR)<br />
Wirtschaftsfaktor: Durch die Tunnel in Rafah werden neben Lebensmitteln,Wasser und Dingen des<br />
täglichen Bedarfs auch und vor allem Waffen aller Art in den Gazastreifen geschmuggelt<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 83
| W E L T B Ü H N E | Ä G Y P T E N<br />
„SIE HABEN UNS DIE<br />
REVOLUTION GEKLAUT“<br />
<strong>Die</strong> Jugend Ägyptens hat das Mubarak-Regime aus dem Amt gejagt. Bekommen hat sie<br />
einen autoritären, islamistischen Präsidenten. Protokoll einer persönlichen Enttäuschung<br />
VON YOUSSRIA G HORAB<br />
I<br />
CH WAR VON ANFANG AN DABEI: Wir haben<br />
die Revolution angefangen. Ich<br />
gehörte zur „Bewegung des 6. April“<br />
und habe Graffiti-Schablonen<br />
gemacht. Mit diesen wurde in der<br />
ganzen Stadt gesprüht, um für die Revolution<br />
zu mobilisieren. <strong>Die</strong> Islamisten wollten<br />
am Anfang gar nicht mitmachen. Wir<br />
mussten sie überreden, und jetzt haben sie<br />
uns die Revolution geklaut.<br />
Es gibt heute viele, die sagen, die Revolution<br />
sei ein Fehler gewesen. Mit Mubarak<br />
seien wir besser dran gewesen als jetzt<br />
mit den Muslimbrüdern. Das ist Quatsch.<br />
Das Regime Mubarak war korrupt und hat<br />
das Volk ausgeplündert. Korruption gibt es<br />
immer noch, und auch die Muslimbrüder<br />
sind Geschäftsleute, die auf ihre eigenen<br />
Interessen schauen. Doch die Regierung<br />
Mubarak hatte einfach ausgedient.<br />
Es war uns immer klar, dass eine harte<br />
Zeit auf uns zukommt. Es ist eben nicht<br />
so einfach, Revolution zu machen und ein<br />
Regime zu stürzen, das sich 30 Jahre lang<br />
eingefressen hat. Dass es aber so hart werden<br />
würde, habe ich nicht gedacht. Was<br />
Revolutionärin der ersten Stunde: Youssria Ghorab, 31, Aktivistin, Filmemacherin, Sprayerin<br />
wir jetzt erleben, ist schlimmer als meine<br />
schlimmsten Horrorvorstellungen.<br />
<strong>Die</strong> Muslimbrüder haben, seit sie an<br />
der Macht sind, nichts unternommen, um<br />
das Land nach vorne zu bringen. Kein einziges<br />
Gesetz haben sie erlassen, das der Bevölkerung<br />
dient. Alles zielt nur darauf ab,<br />
ihre Macht zu festigen.<br />
Sie tun so, als ginge es um das islamische<br />
Projekt, aber sie sind doch extrem weit<br />
vom Islam entfernt. Was wir neulich gesehen<br />
haben, als die Schlägerbanden der<br />
Muslimbrüder die Demonstranten angegriffen<br />
haben, war ganz und gar unislamisch.<br />
Sie haben Frauen geschlagen, mit<br />
der Faust haben sie einer Frau ins Gesicht<br />
geschlagen, und andere Frauen wurden sexuell<br />
belästigt. Das widerspricht jeglicher<br />
Vorstellung vom Islam. Sie benutzen die<br />
Religion nur, um ihre Macht zu festigen.<br />
Leider tun das auch radikale Salafisten-<br />
Gruppen. <strong>Die</strong> machen mir richtig Angst.<br />
Mit ihren extremen Ansichten und ihren<br />
Verbindungen zu Al Qaida und anderen<br />
bewaffneten Gruppen sind sie eine echte<br />
Gefahr.<br />
Was mich am meisten an den Muslimbrüdern<br />
aufregt, ist, dass sie uns ihre ganz<br />
und gar altmodische Politik andrehen wollen.<br />
Hier gibt es einen Generationenkonflikt.<br />
<strong>Die</strong> alte, autoritäre Generation trifft<br />
auf eine neue, sehr mobile, flexible und<br />
weltoffene Generation. Uns kann man<br />
mit diesen Hierarchien und diesen eingeschränkten<br />
Rechten nicht kommen. Da<br />
braucht man sich doch nur mal den Verfassungsentwurf<br />
anzuschauen, den sie vorgelegt<br />
haben: Das Wort Frau kommt darin<br />
nicht vor. Sie sprechen vom weiblichen<br />
FOTOS: KATHARINA EGLAU FÜR CICERO, PRIVAT (AUTORIN)<br />
84 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Geschlecht. Das zeigt doch deren Geisteshaltung:<br />
Sie denken nur ans Schlafzimmer.<br />
Es gab einen Moment in den Tagen auf<br />
dem Tahrir-Platz und danach, als die Männer<br />
gesehen haben, dass auch wir Revolution<br />
machen können. In diesen Tagen habe<br />
ich gehofft, dass sich grundlegend etwas<br />
ändern könnte. Hat es aber nicht.<br />
Für mich ganz persönlich hat sich<br />
durch die Revolution hingegen viel verändert.<br />
Ich habe mich früher immer eingeengt<br />
gefühlt. Ich hatte Träume, habe mich<br />
aber nicht mal getraut, sie fertig zu träumen,<br />
weil ich sicher war, dass sie nie in Erfüllung<br />
gehen. Seit der Revolution weiß ich,<br />
dass alles möglich ist. Anders als die meisten<br />
anderen Menschen in Ägypten stehe<br />
ich auch finanziell besser da. Ich bin Absolventin<br />
der Kunstschule und gehörte zu den<br />
Jahrgangsbesten. Damit hatte ich einen Anspruch<br />
auf eine Anstellung im Kulturministerium.<br />
Da ich aber keine Beziehungen<br />
hatte, habe ich unter der alten Regierung<br />
diese Stelle nicht bekommen. Kurz nach<br />
dem Sturz Mubaraks wurde ich angestellt.<br />
Na ja, die Stelle ist nicht toll, und das Ministerium<br />
braucht dringend eine Revolution.<br />
Vielleicht sollte man es abschaffen.<br />
Andererseits gibt mir diese Stelle Spielraum.<br />
Natürlich habe ich Angst vor der Zukunft.<br />
Neulich wurde eine Freundin von<br />
mir – sie ist Tänzerin und macht modernen<br />
Tanz – auf der Straße angegriffen. Mehrere<br />
verschleierte Frauen umringten sie und<br />
wollten ihr die Haare anzünden, weil sie<br />
kein Kopftuch trug. Zum Glück kamen<br />
ihr Leute zu Hilfe. Ich bin überzeugt, die<br />
Muslimbrüder werden ein Gesetz erlassen,<br />
das das Kopftuch zur Pflicht macht. Jetzt<br />
sagen sie zwar, dass sie es nicht vorhaben,<br />
aber sie haben schon viele Versprechen gebrochen,<br />
und es ist klar: Sie haben ein Ideal,<br />
wie die Gesellschaft aussehen soll, und sie<br />
werden dies zur Not mit Gewalt durchsetzen.<br />
Wir haben ihre Schlägerbanden erlebt.<br />
Nein, ich war nicht dabei, als sie neulich<br />
auf die Demonstranten vor dem Präsidentenpalast<br />
losgingen. Meine Mutter und<br />
ich haben da einen Konflikt. Manchmal<br />
lässt sie mich zu Demonstrationen gehen,<br />
aber manchmal auch nicht. Wir streiten.<br />
Sie ist krank, und die Aufregung schadet<br />
ihr. Wenn ich sie nicht überzeugen kann,<br />
gehe ich nicht. Dabei denkt sie auch, es sei<br />
höchste Zeit, dass die Ägypter sich erheben<br />
und sich gegen die Herrschaft der Islamisten<br />
auflehnen. Absurd, oder?<br />
Inzwischen gehöre ich nicht mehr zur<br />
„Bewegung des 6. April“. Als die Mitglieder<br />
der Bewegung sich vergangenen Sommer<br />
entschieden haben, Mohammed Mursi<br />
im Wahlkampf zu unterstützen, habe ich<br />
mich von ihnen getrennt. Natürlich war<br />
das eine schwierige Situation. Da stand<br />
Mursi gegen Ahmed Schafik zur Wahl, und<br />
wir wollten natürlich verhindern, dass das<br />
alte Regime wieder an die Macht kommt.<br />
Aber ich hielt schon damals Mursi für sehr<br />
gefährlich, und inzwischen haben sich ja<br />
auch die anderen aus der Bewegung von<br />
ihm distanziert.<br />
Ab wann es schiefgelaufen ist mit unserer<br />
Revolution? Ich glaube, das Grundproblem<br />
war, dass wir uns zu Wahlen drängen<br />
ließen, bevor die Menschen und die politische<br />
Landschaft reif waren. Wir hätten<br />
als Allererstes eine neue Verfassung schreiben<br />
sollen, damit die Grundlagen klar sind.<br />
Es wurden viele Chancen vertan. Trotzdem<br />
bin ich optimistisch: Unsere Generation<br />
wird sich eine neue Diktatur nicht gefallen<br />
lassen.<br />
Wir sind immer noch in einer Übergangsphase,<br />
und das Besondere an dieser<br />
Phase ist, dass sich alle outen müssen.<br />
Das Militär galt ja, als es nach dem Sturz<br />
Mubaraks die Macht übernahm, vielen als<br />
freundlicher Partner, der die Geschäfte der<br />
Regierung im Sinne der Revolution verwalten<br />
werde. Fehlanzeige. <strong>Die</strong> Muslimbrüder<br />
kannten wir bisher auch nicht so recht.<br />
Sie waren immer eine Geheimorganisation,<br />
und man wusste nicht, was sie eigentlich<br />
wollen. Jetzt ist die Maske gefallen oder zumindest<br />
verrutscht, und wir erkennen, um<br />
was für einen machthungrigen, autoritären<br />
Verein es sich handelt.<br />
Vor einem Jahr steckten wir auch schon<br />
in einer großen Krise. <strong>Die</strong> Militärregierung<br />
hatte gezeigt, wes Geistes Kind sie<br />
ist, und es gab große Befürchtungen, dass<br />
die Generäle die Macht nicht wieder hergeben<br />
würden. Wir setzten alle auf einen<br />
gewählten Präsidenten und haben gesagt:<br />
Egal, wer es wird, es wird besser. Jetzt haben<br />
wir den gewählten Präsidenten, und<br />
er ist mindestens genauso schlimm wie die<br />
Militärregierung.<br />
Wovon ich träume? Ich würde gerne in<br />
einem Land leben, in dem die Menschen<br />
respektiert werden. Ich hatte nicht vor, dafür<br />
auszuwandern.<br />
Aufgezeichnet von Julia Gerlach<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 85<br />
Anzeige<br />
XXX.<br />
Europaratsausstellung<br />
17.10.2012<br />
10.02. 2013<br />
VER FÜH RUNG<br />
FREIHEIT<br />
Kunst<br />
in Europa<br />
seit 1945<br />
Deutsches<br />
Historisches<br />
Museum<br />
Unter den Linden 2<br />
Berlin<br />
Täglich 10 –18 Uhr<br />
www.dhm.de
| W E L T B Ü H N E | L E B E N N A C H D E M K R I E G<br />
DER FAHRSCHÜLER<br />
Was richtet der Krieg im Kopf an? Sergeant Campbell war im Irak. Jetzt muss er etwas<br />
neu erlernen, das in Amerika nicht weniger als die Freiheit bedeutet: das Autofahren<br />
VON JOHANNES G ERNERT<br />
E<br />
RIC CAMPBELL KANN nicht aufhören,<br />
die Bomben zu suchen. Sobald<br />
er in Kingsburg, Kalifornien,<br />
im Auto sitzt, tasten seine Augen<br />
die Umgebung ab. Sein Blick irrt<br />
los: Er heftet sich an Stoßstangen, prallt auf<br />
die Fahrbahn, untersucht klaffende Schlaglöcher,<br />
sticht in blutverschmierte Tierkadaver,<br />
stochert in wehende Mülltüten, er schrammt<br />
über frisch gestrichene Leitplanken.<br />
Campbell ist vor fünf Jahren beim United<br />
States Marine Corps ausgeschieden,<br />
den berüchtigten Kriegern der US-Streitkräfte.<br />
Dem Irak hat er die Freiheit geschenkt,<br />
so steht das jedenfalls in seiner<br />
E-Mail-Signatur. Jetzt, zu Hause zurück,<br />
ringt er um seine eigene Freiheit.<br />
Sergeant Eric Campbell, 32 Jahre alt.<br />
Seine Wirbelsäule war zweimal gebrochen,<br />
seine Schulter ist kaputt, seine Knie auch.<br />
Der Soldat Eric Campbell im Irak: Überall konnten Bomben sein,<br />
am Straßenrand, in Schlaglöchern, hinter der nächsten Biegung<br />
Aber er hat noch zwei Beine, von denen<br />
eines das Gaspedal seines Chevrolet Silverado<br />
tritt, und zwei Hände, die das Lenkrad<br />
des Pick-up-Trucks umfassen. Er kann<br />
nur nicht mehr damit fahren, nicht länger<br />
als eine halbe Stunde.<br />
Wenn er in ein Auto steigt, geht Eric<br />
Campbell die Gefahren durch. Bombenangriff,<br />
Scharfschützen, vielleicht auch: Flugzeugabsturz.<br />
Er überlegt sich die Schritte,<br />
die nötig sein könnten. Danach. Er ist auf<br />
jede Gefahr vorbereitet. Auch wenn es hier<br />
keine gibt.<br />
<strong>Die</strong> größte Gefahr auf dem Highway<br />
99 von Kingsburg, Kalifornien, wo er<br />
in seinem Trailer lebt, nach Fresno, Kalifornien,<br />
zur Veteranenklinik, ist Eric Campbell<br />
selbst. Seine Angst. Sein Blick.<br />
„In Amerika hängt deine Freiheit<br />
an deinem Auto“, sagt er. Es ist einer<br />
seiner ruhigen Cowboy-Sätze, er klingt, als<br />
müsste er ein nervöses Pferd besänftigen.<br />
Nicht einfach hinfahren zu können, wohin<br />
er möchte, bedeutet für ihn, gefangen<br />
zu sein: „Als würden sie dich mit Stahlbügeln<br />
an der Wand festnageln.“<br />
Da steht er jetzt.<br />
ALS DIE SOLDATEN aus den früheren Kriegen<br />
der USA zurückkamen, aus Vietnam,<br />
aus Korea, sind manche im Auto ausgerastet<br />
auf der Straße. Road Rage nannten<br />
das die Psychologen damals. <strong>Die</strong> Veteranen<br />
fuhren riskanter, schneller, ohne Gurt. Sie<br />
waren reizbarer, sie tickten aus. <strong>Die</strong> Soldaten,<br />
die aus den neuen Kriegen, aus dem<br />
Irak und aus Afghanistan, zurückkommen,<br />
haben ein anderes Problem. Sie fliehen vor<br />
der Gefahr.<br />
Steve Woodward will helfen. Er schaute<br />
Fernsehen, als er zu begreifen begann, dass<br />
da etwas Neues auf ihn zukam, auf die USA.<br />
Es war 2005, ein Bericht von einem Veteranen,<br />
der irgendwo in Montana auf dem<br />
Land lebte und erzählte, dass Gegenstände<br />
am Straßenrand ihn zurück in den Irakkrieg<br />
versetzten. Woodward ist Psychologe an der<br />
größten Veteranenklinik der Westküste in<br />
Palo Alto, in Kalifornien. Ein grauhaariger<br />
sportlicher Typ. Er forscht zu Kriegstraumata<br />
und sucht nach Behandlungsmethoden.<br />
Steve Woodward beantragte Forschungsgelder,<br />
2009 startete er eine Studie,<br />
die erkunden soll, wie diese Soldaten sich im<br />
Straßenverkehr verhalten. Damit sie dann<br />
das Fahren neu lernen können, die Männer,<br />
die ihr Leben lang hinterm Steuer saßen.<br />
Das erste Auto, das Eric Campbell in<br />
seinem Leben fuhr, war ein Mercury Topaz.<br />
Er kostete 2000 Dollar, die er mit seinen<br />
Jobs bei Kentucky Fried Chicken und<br />
McDonalds bezahlte. Der Topaz ist ein<br />
kleiner, gewöhnlicher Wagen. Campbell<br />
86 <strong>Cicero</strong> 1.2013
„Deine Freiheit hängt am Auto.“ – Wenn Eric Campbell heute in Kalifornien hinterm Steuer sitzt, überfällt ihn die<br />
Angst. Deshalb muss er von vorn anfangen. Vom Beifahrersitz aus coacht ihn der Psychologe Steve Woodward<br />
FOTOS: PRIVAT, JOHANNES GERNERT<br />
sagt, dass er damals kein verwegener Fahrer<br />
war. Am Wochenende cruisten er und<br />
sein Bruder manchmal raus in die Maisfelder<br />
von Indiana. Einfach irgendwohin.<br />
Das ist die Freiheit, sagt Eric Campbell.<br />
„Du springst ins Auto und fährst los.“<br />
Er fuhr mit dem Mercury Topaz zur<br />
Schule. Campbell war damals 17, zwei<br />
Jahre vor dem High-School-Abschluss,<br />
aber er hatte sich schon bei den Marines<br />
verpflichtet. Auf den blaugrünen Lack seines<br />
Topaz hatte er Marines-Sticker geklebt,<br />
neben die anderen: „Böse bis auf die Knochen“,<br />
„Jung und unbesiegbar“. Der Vertrag<br />
war unterschrieben. Sie erwarteten ihn.<br />
Im Frühjahr 2012 hat die Versicherungsgesellschaft<br />
USAA einen Report veröffentlicht,<br />
der zeigt, dass Veteranen deutlich<br />
mehr Unfälle verursachen als andere<br />
Verkehrsteilnehmer. Bei Soldaten, die drei<br />
Mal oder häufiger im Auslandseinsatz waren,<br />
stieg die Zahl der Unfälle zwischen<br />
2007 und 2010 um 36 Prozent. Der wichtigste<br />
Grund: Gegenstände am Fahrbahnrand.<br />
Hastige Blicke.<br />
Zum ersten Mal zog Eric Campbell<br />
2003 in den Irak, mit 22. Aus den Lautsprechern<br />
in den Quartieren hallte Metal,<br />
„Let the Bodies hit the Floor“. In Bagdad<br />
stürzte die Saddam-Statue, Campbell war<br />
dabei. An seinem Hals hängt heute eine<br />
Metallmarke von Saddams Leibgardisten,<br />
den er erschossen hat. Der Mann trat aus<br />
einem Busch, er habe eine Panzerfaust auf<br />
ihn gerichtet. Campbell spürte die Hitze<br />
des Geschosses über seinem Kopf. Dann<br />
erschoss er den Mann.<br />
ERIC CAMPBELL HAT FRÜHER gern im Garten<br />
gearbeitet, aber er kann sich jetzt nicht<br />
mehr in der Nähe von Büschen aufhalten.<br />
2005 wird er zum zweiten Mal in den<br />
Irak geschickt. „Da fing der ganze Spaß<br />
dann an“, sagt er. Es klingt cool. Es soll<br />
cool klingen. Ein schwerer junger Mann<br />
mit Hemd überm T-Shirt, Cap, Kinnbart<br />
und Freundschaftsbändern am Arm<br />
sitzt da in einem Raum der Veteranenklinik<br />
von Palo Alto. Ein Mann, der seine<br />
Sätze vorsichtig zusammensetzt wie einen<br />
vorher zerlegten Motor. Stück für Stück.<br />
Schraube für Schraube. Seine Freundin hat<br />
ihn hergefahren.<br />
Der Himmel ist blau. Ein warmer windiger<br />
Herbsttag in Kalifornien. Über der<br />
Klinik schwebt ein Zeppelin.<br />
Ihr Camp lag vor Falludscha. Das Problem<br />
hieß IED. Improvised explosive devices.<br />
Improvisierte Bomben. Das Problem<br />
begann, wenn sie aus dem Lager rausfuhren.<br />
Es war wie mit Katzen, die Mäuse jagen,<br />
sagt Eric Campbell.<br />
Anfangs versteckten sie die Bomben am<br />
Straßenrand, unter den Gehwegstellen, die<br />
frisch renoviert waren. Daran konnte man<br />
sie erkennen. Als die Soldaten das gelernt<br />
hatten und in der Mitte der Straße fuhren,<br />
verscharrten ihre Gegner die IEDs in den<br />
Schlaglöchern und zündeten sie aus der<br />
Ferne. Als die Störsignale der Amerikaner<br />
die Zünder außer Gefecht setzten, führten<br />
Kabel zu den Bomben, Männer standen<br />
hinter Häusern und wenn sie einen Panzer<br />
kommen hörten, drückten sie ab. Sie<br />
standen am Straßenrand, ihre Hände in<br />
einem Buch, im Koran etwa, und ließen<br />
die Bomben explodieren. Bis die Amerikaner<br />
merkten, dass in einem Buch verborgene<br />
Hände eine Gefahr sein konnten.<br />
<strong>Die</strong> Gefahr veränderte sich ständig. Auf alles<br />
musste man achten.<br />
<strong>Die</strong> Marines fuhren mit 30, 40 Metern<br />
Abstand zueinander. Ein US-Fahrzeug hinter<br />
dem anderen.<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 87
| W E L T B Ü H N E | L E B E N N A C H D E M K R I E G<br />
Eric Campbells Auto war ein Humvee.<br />
Ein gepanzerter Jeep. Sein Job war es, die<br />
Autos am Laufen zu halten. Er war Mechaniker.<br />
Einmal fuhren sie zu einem Panzer,<br />
der explodiert war. Sie schnitten den Fahrer<br />
raus. Fünf Stunden lang, nach dreien<br />
war er tot.<br />
Sieben IEDs hat er überlebt. Er war<br />
nie in der Killing Zone, wo es ihn zerrissen<br />
hätte. Sie gingen vor seinem Humvee<br />
oder dahinter los. Danach fühlt man sich<br />
manchmal unbesiegbar, sagt Campbell.<br />
Er hatte genaue Anweisungen, was du<br />
zu tun hast, wenn eine Bombe hochgeht.<br />
Fahr weiter. Fahr immer weiter. Fahr zurück,<br />
fahr ins Camp.<br />
Eric Campbell steckt seine Sätze zusammen,<br />
sein Blick ist gerade und ruhig<br />
dabei. Er bewegt sich nur langsam<br />
von einem Gesprächspartner zum nächsten.<br />
Manchmal rastet er einen Moment<br />
zu lange. Wie ein Wagen an einer Ampel,<br />
die schon grün ist.<br />
„<strong>Die</strong> meisten Amerikaner könnten ohne<br />
ihr Auto nicht überleben“, sagt Campbell.<br />
Als dem Psychologen Steve Woodward<br />
die Gelder genehmigt worden waren,<br />
stellte er ein Team zusammen und beauftragte<br />
eine deutsche Doktorandin mit<br />
der Studie. Sie verwendeten einen weißen<br />
Pontiac Bonneville, der ein wenig an Eric<br />
Campbells erstes Auto erinnerte. Klein und<br />
nicht besonders auffällig.<br />
Wenn Eric Campbell das Lenkrad dieses<br />
Pontiacs hielt und über die Straßen<br />
von Palo Alto fuhr, lag um seine Brust ein<br />
Messgurt, der seine Herzschläge registrierte.<br />
Drei iPod-Touch maßen die Bewegungen<br />
der Pedale, die Geschwindigkeit, das Bremsen.<br />
Alle Signale, die Campbell aussendete,<br />
liefen in einem Gerät zusammen, das die<br />
Fujitsu Laboratories entwickelt haben.<br />
Man kann so sehen, an welchen Stellen<br />
auf der Fahrt sein Herzschlag stieg, wann<br />
er das Gaspedal zu heftig trat, wann er zu<br />
scharf bremste. Neben ihm saß der Fahrcoach,<br />
der ebenfalls ein Gaspedal vor seinen<br />
Füßen hatte und eine Bremse. Wie<br />
in der Fahrschule. Auf einem iPod-Touch<br />
kann der Lehrer Ereignisse markieren: Baustelle.<br />
Von einem anderen Fahrer geschnitten.<br />
Müll am Straßenrand. Lärm.<br />
Das ist der Anfang, sagt der Psychologe<br />
Steve Woodward, der Karten anfertigen<br />
lässt, auf denen die Wege rot markiert sind,<br />
auf denen Eric Campbells Herz schneller<br />
schlug als sonst. Es ist der allererste Schritt:<br />
Eric Campbell und seine Freundin. Einmal fuhren sie vom Kino nach<br />
Hause. Er übersah ein Schlagloch. Dann raste er los. Sie schrie. Back to base,<br />
murmelte er, zurück zur Basis<br />
herausfinden, womit die Veteranen nicht<br />
umgehen können. Es hat auch mit der<br />
Frage zu tun, ob Angst messbar ist.<br />
Woodward hat mit Campbell geübt,<br />
wie man anhält, wie man atmet, wie<br />
man ruhiger weiterfährt danach. Einundzwanzig,<br />
zweiundzwanzig, dreiundzwanzig.<br />
Der Coach hat ihm gesagt, was sein<br />
Blick macht, wie er tastet, sucht, stochert.<br />
Da erst fing Campbell an zu merken, wie<br />
das alles zusammenhängt. Es sind Fahrstunden,<br />
aber er lernt dabei nicht, wie das<br />
Auto funktioniert. Er lernt, wie er selbst<br />
tickt. Danach hat er Fragebögen ausgefüllt:<br />
Das Auto vorm Einsteigen auf Sprengstoff<br />
überprüft? <strong>Die</strong> Route spontan geändert,<br />
um nicht vorhersehbar zu fahren? Beim<br />
Fahren plötzlich geduckt?<br />
Er mag nicht, wenn ein Auto direkt<br />
vor ihm ist und eines neben ihm. Er kann<br />
Nähe nicht ertragen.<br />
NEULICH IST WIEDER DIESER WEISSE Truck<br />
hinter ihm hergefahren, eine ganze Weile.<br />
Er ist rübergezogen auf die andere Spur.<br />
Der Truck auch. Er ist langsamer gefahren.<br />
Der Truck auch. Campbell raste zu<br />
einer Kreuzung, hielt am Stoppschild, er<br />
wartete, bis der Laster, der von links heranrumpelte,<br />
kurz vor ihm angekommen war,<br />
dann schoss er daran vorbei, rüber über die<br />
Straße, raus in den Wald, sodass ihm keiner<br />
folgen konnte.<br />
Eric Campbell ist zwei Mal verheiratet<br />
gewesen und zwei Mal geschieden worden,<br />
nach dem ersten und nach dem zweiten<br />
Irak-Einsatz. Posttraumatisches Stresssyndrom,<br />
sagt er, wenn man ihn fragt, warum.<br />
Mit seiner zweiten Frau war er einmal<br />
im Kino. „Flags of our Fathers“, Clint Eastwoods<br />
Film über die Schlacht von Iwojima,<br />
1945. Er konnte ihn nicht zu Ende sehen.<br />
Das alles war dem Irak zu ähnlich. Sie fuhren<br />
nach Hause und er übersah das Schlagloch,<br />
der Aufprall warf ihn zurück.<br />
Eric Campbell raste los. Seine Frau<br />
muss ihn angeschrien haben, aber er reagierte<br />
nicht. Er murmelte, back to base,<br />
back to base, zurück zur Basis, ins Camp.<br />
Sie hat ihm das nachher erzählt.<br />
Es ist, als glühte die Erinnerung in<br />
seinem Kopf, manchmal lodert sie hoch,<br />
manchmal ist da auch nur Rauch, und er<br />
kann sich an andere Dinge nicht erinnern.<br />
Wo liegt der Autoschlüssel? Eric Campbell<br />
hat gern an Autos geschraubt, aber er kriegt<br />
den Motor nicht mehr zusammen, nicht<br />
mehr richtig. Er vergisst Dinge.<br />
TBI, sagen die Ärzte. Traumatic Brain<br />
Injuries. Traumatische Hirnschäden.<br />
Sieben IEDs. Sieben Bomben. Jedes<br />
Mal ist sein Kopf gegen irgendetwas<br />
geknallt.<br />
Er hatte nach seiner ehrenhaften Entlassung<br />
einen Job als Netzwerk-Techniker,<br />
er hat an großen Übertragungsanlagen<br />
FOTOS: JOHANNES GERNERT, PRIVAT (AUTOR)<br />
88 <strong>Cicero</strong> 1.2013
eines Kabelfernsehkonzerns gearbeitet. Bis<br />
er ein Mal einfach umfiel. Sein Arbeitgeber<br />
schickte ihn einige Monate in den unbezahlten<br />
Krankenstand und warf ihn dann<br />
mit einer kurzen E-Mail raus.<br />
Pseudo-Anfall, sagten die Ärzte.<br />
ERIC CAMPBELL BEKOMMT eine Invalidenrente,<br />
er gilt als 70 Prozent behindert. Er<br />
könne damit seine Rechnungen zahlen,<br />
sagt er, nicht davon leben. Wenn er am<br />
Steuer noch ein einziges Mal einen Anfall<br />
hat, müssen sie das der Führerscheinbehörde<br />
melden, haben die Leute vom Veteranenministerium<br />
gesagt. Das Department<br />
of Motor Vehicles California könnte dann<br />
seine Fahrerlaubnis einziehen. Das ist seine<br />
größte Sorge.<br />
Irgendetwas liegt fast immer am Rande<br />
der Highways. Blutige Hasen, Reifenteile,<br />
Papiertüten.<br />
Eric Campbell besitzt einen Chevrolet<br />
Silverado, ein Pick-up-Truck. Es ist ein<br />
Auto, das in den USA so oft gekauft wird<br />
wie kaum ein anderes. Nummer zwei in<br />
der Fahrzeugstatistik. Den Silverado fährt<br />
man da, wo Amerika weit ist und staubig.<br />
Da, wo es keine Parklücken gibt. Der Silverado<br />
heißt wie ein Westernfilm aus den<br />
Achtzigern. Er ist schwer und breit und<br />
hat eine Ladefläche. Auf den Werbeplakaten<br />
steht er wie ein Superheld in der Landschaft,<br />
dunkel, geheimnisvoll. Mit dem Silverado<br />
kann Eric Campbell seinen Trailer<br />
bewegen, sein Zuhause.<br />
Er weiß nicht so genau, wie viele Unfälle<br />
es waren. Zehn, vielleicht fünfzehn.<br />
Alle nach dem Irak. „Fender bender“, sagt<br />
Campbell. Kotflügeldellen. „Alles selbst<br />
repariert.“ Er versucht, die Unfälle harmlos<br />
zu lächeln, aber das Lächeln wird zu<br />
matt.<br />
Der Vietnamkrieg, sagt Steve Woodward,<br />
der Trauma-Psychologe, war ein Dschungelkrieg.<br />
Wenn man aus dem Dschungel raus<br />
war, erinnerte einen wenig daran. Der Irakkrieg<br />
und auch der Krieg in Afghanistan finden<br />
in Städten statt. Auf Straßen.<br />
Straßen gibt es überall.<br />
„Wir können heute mit dem Auto in<br />
drei oder vier Tagen das ganze Land durchqueren“,<br />
sagt Eric Campbell. „<strong>Die</strong> ersten<br />
Siedler haben in ihren Planwagen früher<br />
mehrere Monate für einen einzigen Staat<br />
gebraucht.“<br />
Das Auto verschafft Freiheit. Er ringt<br />
um sie. Er versucht sich zu beruhigen. Er<br />
hält an zwischendurch. Er atmet, einundzwanzig,<br />
zweiundzwanzig, dreiundzwanzig.<br />
Aber bisher schafft er nicht mehr als<br />
eine halbe Stunde. Wenn überhaupt.<br />
Wer steht da oben auf der Überführung?<br />
Meistens muss seine Freundin fahren.<br />
Er hat sie bei einem Veteranentreffen<br />
kennengelernt, sie war bei der Navy. Sie<br />
hat ihm durch einige Flashbacks geholfen,<br />
sagt er, wenn der Irak zurückkommt,<br />
wenn es heiß ist wie dort. Sie wohnen in<br />
dem Wohnwagen, mit ihren drei Kindern,<br />
manchmal auch mit seinen zweien dazu,<br />
mit Hunderten DVDs. Kurz hat er einmal<br />
als Türsteher gearbeitet, aber sie haben ihn<br />
dann nicht mehr gebucht. „Meine Arzttermine<br />
sind mein Job“, sagt er.<br />
Sechs Wochen hat es gedauert, bis er<br />
mit 16 seinen Führerschein hatte. Er weiß<br />
nicht, wann er so weit ist, dass er ihn behalten<br />
kann.<br />
Er muss wieder ein Treffen mit dem<br />
Fahrcoach vereinbaren. Er muss sich das<br />
vom Arzt verschreiben lassen. <strong>Die</strong> Studie<br />
hat nur drei Sitzungen umfasst. <strong>Die</strong><br />
Forschung steht am Anfang. <strong>Die</strong> Veteranen<br />
haben ihr eigenes Gesundheitssystem.<br />
100 Millionen Dollar, hat ihr Ministerium<br />
angekündigt, sollen in die Erforschung<br />
posttraumatischer Belastungsstörungen<br />
und traumatischer Hirnschäden fließen.<br />
Auch die Fahrerforschung wird mehr Geld<br />
brauchen.<br />
Wenn Steve Woodward Eric Campbell<br />
zuhört, sagt er manchmal „Aha“, wie ein<br />
Tourist auf einem fernen, exotischen Eiland.<br />
Aha, so ist das also.<br />
Woodward freut sich, dass sie dieses<br />
neue Gerät haben, in dem alle Datenströme<br />
der Fahrer zusammenlaufen. In<br />
dem Projekt steckt die Hoffnung, dass<br />
Technik den ursprünglichen Zustand wiederherstellen<br />
kann. Vielleicht ist sie ähnlich<br />
trügerisch wie jene, dass der Fortschritt irgendwann<br />
einen Krieg mit vielen Drohnen,<br />
aber ohne Tote ermöglicht.<br />
Wenn Eric Campbell seinen Bruder<br />
trifft, der auch bei den Marines war, fahren<br />
sie heute nicht mehr raus in die Felder.<br />
Sie sitzen und reden. „Was er erlebt hat,<br />
was ich erlebt habe. Düstere Gespräche“,<br />
sagt Campbell.<br />
Eric Campbell läuft über den Parkplatz<br />
der Klinik in Palo Alto, seine Freundin<br />
neben ihm, ein leichter Wind. Er, in<br />
festen Stiefeln, mit seiner roten Cap, mit<br />
der Marke des toten Leibgardisten um den<br />
Hals. Sie in ihrer navyblauen Veteranenuniform,<br />
mit der Veteranenmütze.<br />
<strong>Die</strong> Sonne scheint. Es gibt gute und<br />
schlechte Tage, sagt Campbell. Eigentlich<br />
ist heute ein guter Tag. Er hat bisher gar<br />
nicht so viel vergessen.<br />
Er stellt sich vor den Van seiner Freundin,<br />
ein Chevrolet Suburban. Er steht da<br />
und schaut ernst. Es sieht aus, als würde<br />
er stolz seinen Wagen präsentieren. Und<br />
gleichzeitig wirkt dieser staubige, schwarze<br />
Chevrolet Suburban wie eine Bedrohung.<br />
Er wirft einen Schatten auf den Asphalt.<br />
Sie steigen ein. Der Motor röhrt. Seine<br />
Freundin fährt los.<br />
Sein Blick wird wieder die Umgebung<br />
abtasten. Er kann nicht aufhören, die Bomben<br />
zu suchen.<br />
Auch als Beifahrer nicht.<br />
Anzeige<br />
ISBN 978-3-351-02752-0. € 19,99<br />
JOHANNES G ERNERT<br />
bereiste als Fellow des Arthur<br />
F. Burns-Journalistenprogramms<br />
für junge Journalisten ein Vierteljahr<br />
lang die USA<br />
www.aufbau-verlag.de<br />
»Das ist der<br />
Humor,<br />
den man zum<br />
Altern braucht.«<br />
dieter<br />
hildebrandt<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 89
| K A P I T A L<br />
„WIR GEHEN DIE WETTE EIN“<br />
Daniels Pavluts, Wirtschaftsminister Lettlands, erklärt, warum sein Land trotz allem 2014 in den Euro will<br />
H<br />
err Pavluts, Lettland hat zurzeit<br />
Wachstumsraten von mehr als<br />
5 Prozent und gilt als Musterbeispiel<br />
für die wirtschaftliche Erholung<br />
eines Landes, das eine schwere Krise hinter<br />
sich hat. Trotzdem wollen die Letten in<br />
einem Jahr der dauerkriselnden Eurozone<br />
beitreten. Spinnen die Letten?<br />
Nein, und ich muss auch Ihrer Einschätzung<br />
teilweise widersprechen. <strong>Die</strong> Regierungen<br />
der Eurozone sind dabei, das<br />
System der Gemeinschaftswährung zu reformieren,<br />
und ich sehe Licht am Ende<br />
des Tunnels. Im Übrigen ist der Euro<br />
nach dem Dollar immer noch die wichtigste<br />
Reservewährung der Welt. So<br />
schlimm kann es daher nicht um ihn bestellt<br />
sein.<br />
Welche Reformen des europäischen Währungssystems<br />
meinen Sie genau?<br />
<strong>Die</strong> Einrichtung eines permanenten Rettungsschirms,<br />
die Stärkung der EZB, die<br />
Diskussionen über eine bessere Abstimmung<br />
der Finanzpolitik und die Einführung<br />
einer Bankenunion, das sind alles<br />
Schritte in die richtige Richtung. Man<br />
kann sich immer wünschen, dass noch<br />
weitreichendere Maßnahmen beschlossen<br />
und Anpassungen schneller durchgezogen<br />
werden, aber ich halte diese Diskussionen<br />
für absolut notwendig. Gestärkt<br />
werden wir als EU aus dieser Krise nur<br />
hervorgehen können, wenn an deren<br />
Ende ein stärker integriertes, föderales<br />
Europa steht. Aber wir dürfen uns dabei<br />
nicht zu viel Zeit lassen, weil Europa Gefahr<br />
läuft, seine derzeitige politische und<br />
wirtschaftliche Bedeutung in der Welt<br />
einzubüßen.<br />
Warum ist es für Lettland so wichtig, der<br />
Eurozone beizutreten?<br />
Nachdem wir Mitglied in der Nato<br />
und der EU geworden sind, ist dies<br />
der nächste logische Schritt. Wichtiger<br />
als der Beitritt ist für uns aber eigentlich<br />
die Tatsache, dass wir die Voraussetzungen<br />
geschaffen haben, Mitglied der<br />
Gemeinschaftswährung werden zu dürfen.<br />
Wir sind zurzeit eines der wenigen<br />
Länder in Europa, das die Maastrichtkriterien<br />
erfüllt. Kaum einer der Eurostaaten<br />
schafft das im Moment.<br />
Das sind hauptsächlich politische Argumente.<br />
Was hat Lettland als Volkswirtschaft,<br />
was haben die lettischen Unternehmen<br />
davon?<br />
Als Euromitglied mit hohen Wachstumsraten<br />
werden wir ein höheres Vertrauen<br />
der Märkte genießen. Das senkt die<br />
Transaktions- und Refinanzierungskosten<br />
der Unternehmen, aber auch des Staates.<br />
Schon im Zuge unserer Reformanstrengungen<br />
nach der Krise 2008 haben uns<br />
die Ratingagenturen bessere Noten gegeben,<br />
während die meisten anderen Länder<br />
abgewertet wurden.<br />
Ein Risiko für Lettland sehen Sie durch<br />
den Beitritt zur Eurozone demnach nicht?<br />
Wie es genau weitergeht in Europa,<br />
weiß keiner. Insofern gehen wir mit<br />
diesem Schritt in gewisser Weise eine<br />
Wette ein. Wir setzen dabei darauf, dass<br />
die Eurozone in welcher Konstellation<br />
auch immer fortbestehen wird als eine<br />
Gruppe von Ländern mit leistungsstarken,<br />
wettbewerbsfähigen Volkswirtschaften,<br />
die gemeinsam eine wichtige<br />
Rolle in der Weltwirtschaft spielen werden.<br />
Und da möchten wir auf jeden Fall<br />
dabei sein.<br />
Ist der Beitritt Lettlands zum Euro andersherum<br />
für die Gemeinschaftswährung ein<br />
Risiko?<br />
Nein, warum?<br />
Sie haben in der Krise 2008/2009<br />
30 Prozent Ihrer wirtschaftlichen<br />
Leistungsfähigkeit eingebüßt, es gab<br />
Lohnkürzungen von bis zu 50 Prozent,<br />
und die Arbeitslosenquote ist noch immer<br />
die vierthöchste in der EU. Kritiker wie<br />
der US-Nobelpreisträger Paul Krugman<br />
bezweifeln, dass der jetzige Aufschwung<br />
und Ihre radikalen Sparanstrengungen<br />
nachhaltig sind.<br />
Vor 2008 haben wir einen künstlichen<br />
Boom in Lettland erlebt, der infolge der<br />
Finanzkrise brutal und abrupt beendet<br />
wurde. Daraus haben wir gelernt. Neben<br />
unseren Sparanstrengungen verfolgen<br />
wir eine Wachstumsstrategie und fördern<br />
vor allem Investitionen in die produzierende<br />
Industrie, aber auch in <strong>Die</strong>nstleistungssektoren<br />
wie Tourismus, die Finanzindustrie<br />
und Unternehmensberatungen.<br />
Außerdem verstehen wir uns als Brücke,<br />
vor allem auch für deutsche Unternehmen,<br />
in den Osten. Das alles funktioniert<br />
aber nur, wenn Sie die Wettbewerbsfähigkeit<br />
und die Produktivität erhöhen. Sparen<br />
und gleichzeitig die Löhne erhöhen ist<br />
schwierig. <strong>Die</strong> sozialen Einschnitte, die<br />
wir vornehmen mussten, waren tatsächlich<br />
extrem hart. Aber gerade deswegen<br />
achten wir jetzt im Aufschwung darauf,<br />
dass das Wachstum gerecht verteilt wird.<br />
Könnte Lettland also als Vorbild für andere<br />
Krisenländer innerhalb der Eurozone<br />
dienen?<br />
Das will ich nicht beurteilen. Mein Eindruck<br />
ist, dass andere Länder dazu neigen,<br />
ihre Probleme in die Zukunft zu<br />
transferieren. <strong>Die</strong>se Möglichkeit hatten<br />
wir gar nicht, als unsere Volkswirtschaft<br />
zusammenbrach. Wenn harte Anpassungen<br />
unausweichlich sind, dann sollte man<br />
sie so schnell wie möglich vornehmen.<br />
An der Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit<br />
kommt ohnehin keiner<br />
vorbei, und ein Schuldenschnitt allein<br />
hilft nur bedingt. Bei der Durchsetzung<br />
der Reformen hatten wir es einfacher,<br />
weil sich die Letten nicht über Jahrzehnte<br />
an einen stetig wachsenden Wohlstand<br />
gewöhnt haben. Hinzu kommt, dass wir<br />
hier im Norden etwas introvertierter sind<br />
und die Erwartungen an den Staat auch<br />
aus historischen Gründen deutlich niedriger<br />
sind.<br />
Das Gespräch führte Til Knipper<br />
FOTO: LENE MÜNCH FÜR CICERO<br />
90 <strong>Cicero</strong> 1.2013
„Der Euro ist<br />
nach dem Dollar<br />
die wichtigste<br />
Reservewährung<br />
der Welt. So<br />
schlimm kann<br />
es also nicht um<br />
ihn stehen“<br />
Daniels Pavluts<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 91
| K A P I T A L<br />
ER LIEBT DAS PUTZEN<br />
Frank Becker arbeitet bei Collonil für sein Hobby und verleiht dabei der alten Marke neuen Glanz<br />
VON S TEFFEN U HLMANN<br />
F<br />
RANK BECKER HAT EINEN TICK: Er sammelt<br />
Schuhe und putzt sie leidenschaftlich<br />
gern. 62 Paare hat der<br />
51 Jahre alte Wahlberliner im Schrank, die<br />
er so behandelt, wie seine Mutter es ihm<br />
beigebracht hat: zuerst mit Bürste und<br />
Tuch, das auch feucht sein kann, die vom<br />
Straßendreck beleidigten Ledertreter säubern.<br />
Dann trocknen lassen. Darauf die<br />
Creme mit sachten Bewegungen einmassieren.<br />
Danach wieder Pause, um das aufgetragene<br />
Fett einwirken zu lassen. Schließlich<br />
mit einem weichen Tuch polieren – das<br />
bringt den Glanz. „Für die meisten Deutschen<br />
ist das Sklavenarbeit“, sagt Becker.<br />
„Für mich ist das ein kulturvoller Akt, dem<br />
ich noch heute fröne.“ Seine Leidenschaft<br />
lebt er nicht nur an der eigenen Sammlung<br />
aus. Er macht sich regelmäßig auch<br />
über die Schuhwerk-Armada seiner Familie<br />
– vier Kinder und eine Frau – her: „Das<br />
ist für mich purer Luxus.“<br />
Da fügt es sich gut, dass Becker Geschäftsführer<br />
und Mitinhaber einer Firma<br />
ist, die vom und für den Putzfimmel der<br />
Leute lebt. Collonil ist Marktführer unter<br />
den deutschen Herstellern von hochwertigen<br />
Schuh- und Lederpflegemitteln und<br />
hat derzeit mehr als 2000 Artikel im Sortiment.<br />
Imprägniersprays, Pflegelotions,<br />
Hochglanzcremes, die in unzähligen Farben<br />
und mit den verschiedensten Düften<br />
angeboten werden. Dazu gibt es passend<br />
Wachsauftrags- oder Feinglanzbürsten,<br />
zum Beispiel aus Ziegenhaar, sowie Schuhlöffel<br />
aus Bambusholz.<br />
Vieles erinnert an Produkte der Kosmetikindustrie.<br />
Aber Becker findet das normal.<br />
Leder sei nun mal eine Tierhaut, die ebenso<br />
gepflegt werden müsse wie die menschliche<br />
Haut. <strong>Die</strong> Grundstoffe Wachs, Öl und Fett<br />
sind überall gleich. Das Geheimnis liegt in<br />
der Diversifizierung und den dafür nötigen<br />
Zusatzstoffen. Becker: „<strong>Die</strong> Rezepturen<br />
sind streng geheim. Wir hüten sie besser<br />
als eine Schweizer Bank.“<br />
Gestartet ist Collonil vor über 100 Jahren<br />
in einer Dreizimmerwohnung in Berlin-Kreuzberg.<br />
Dort füllte Karl Esslen Lederöl<br />
aus Schweden in Fläschchen. Als<br />
ihm die Bestellungen zuviel<br />
wurden, suchte der Geschäftsmann<br />
Hilfe bei den<br />
Gebrüdern Paul und Walter<br />
Salzenbrodt. Aus der fortan<br />
gemeinsamen Generalvertretung<br />
für das schwedische Lederöl<br />
machte das Trio bald<br />
eine eigene Firma, die unter<br />
dem Markennamen Collonil<br />
(französisch „coller“ =<br />
kleben) Schuh- und Lederpflegemittel<br />
produzierte.<br />
Ihr erster Renner war eine<br />
Creme mit wasserabweisenden<br />
Eigenschaften. Später<br />
kam ein Fett hinzu, das<br />
das Schuhleder nicht nur<br />
geschmeidig, sondern auch<br />
glänzend machte. „Schuhe<br />
wollen Collonil“ hieß ihr<br />
Slogan dazu. Auch Ufa-Star<br />
Marlene <strong>Die</strong>trich warb damit<br />
und machte die schnell<br />
wachsende Firma bald weltbekannt. 1930<br />
entstand der erste Zweigbetrieb in Wien,<br />
der noch heute existiert. Und in Berlin zog<br />
man in Mühlenbeck am Rande der Stadt<br />
eine komplett neue Firma hoch.<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg saß der<br />
letzte noch verbliebene Firmengründer<br />
Walter Salzenbrodt mit seinem Betrieb in<br />
der sowjetischen Besatzungszone. Vor der<br />
Anfang der fünfziger Jahre drohenden Enteignung<br />
setzte er sich in den Westteil der<br />
Stadt ab. Seitdem residiert das 1952 in<br />
Salzenbrodt & Co. KG umbenannte Unternehmen<br />
in Berlin-Wittenau. Mitte der<br />
neunziger Jahre kamen die Probleme. <strong>Die</strong><br />
Berlin-Förderung ist weg, weniger Menschen<br />
kaufen im Schuhfachhandel und das<br />
Geschäft der Billiganbieter wächst.<br />
MYTHOS<br />
MITTELSTAND<br />
„Was hat Deutschland,<br />
was andere nicht<br />
haben? Den<br />
Mittelstand!“, sagt jetzt<br />
auch der Deutsche-<br />
Bank-Chef Anshu<br />
Jain. <strong>Cicero</strong> weiß das<br />
schon länger und stellt<br />
den Mittelstand in<br />
einer Serie vor. <strong>Die</strong><br />
bisherigen Porträts aus<br />
der Serie unter:<br />
www.cicero.de/mittelstand<br />
Als sich bei Collonil die Verluste häuften,<br />
heuerten die Salzenbrodt-Firmeneigner<br />
1998 Frank Becker an. Der ehemalige<br />
BASF-Manager und -Sanierer<br />
krempelte das Unternehmen<br />
komplett um, ordnete<br />
das Produktportfolio neu,<br />
fokussierte Collonil auf die<br />
Außenmärkte und nutzte<br />
die eingeführte Marke für<br />
neue Produkte. Heute gibt<br />
es unter dem Namen Collonil<br />
auch Socken, Einlegesohlen,<br />
Schnürsenkel,<br />
Schuhspanner oder gar<br />
Fußpflegemittel. Hinzu<br />
kommen Pflegemittel für<br />
Motorradbekleidung, Autoinnenausstattungen<br />
oder<br />
für Passagiersitze in Flugzeugen.<br />
Und seit kurzem<br />
auch Pflegesprays für<br />
Outdoor-Bekleidung.<br />
In 100 Länder exportieren<br />
die Berliner. Das beschert<br />
ihnen einen Umsatz<br />
von derzeit 40 Millionen<br />
Euro im Jahr. Und sie sind<br />
weiter auf Wachstumskurs. Gerade hat Becker<br />
auf dem alten Firmengelände in Mühlenbeck<br />
das Richtfest für ein neues Produktions-<br />
und Logistikzentrum ausgerichtet,<br />
das im Frühjahr 2013 in Betrieb gehen soll.<br />
„Dann werden zu den jetzt 180 Beschäftigten<br />
in zwei Stufen weitere 60 Mitarbeiter<br />
hinzukommen“, sagt Becker, der noch mindestens<br />
20 Jahre „oberster Schuhputzer“ im<br />
Unternehmen bleiben will. „Ich bin bei Collonil<br />
kleben geblieben“, sagt er. „Das ist das<br />
Beste, was mir passieren konnte.“<br />
S TEFFEN U HLMANN<br />
ist freier Wirtschaftsjournalist.<br />
Er lebt und arbeitet in Berlin<br />
FOTOS: GÖTZ SCHLESER FÜR CICERO, PRIVAT (AUTOR)<br />
92 <strong>Cicero</strong> 1.2013
62 Paar Schuhe<br />
hat Collonil-Chef<br />
Frank Becker im<br />
Schrank. Er putzt sie<br />
leidenschaftlich gern<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 93
| K A P I T A L<br />
DIE GRENZGÄNGERIN<br />
Julia Jäkel führt den Medienkonzern Gruner und Jahr in die Zukunft. Glaubt sie an den Journalismus?<br />
VON T HOMAS S CHULER<br />
S<br />
IE ARBEITET HART. Man weiß, dass<br />
sie gegen 5:30 Uhr aufsteht, um<br />
vor der Arbeit Zeit mit ihren Zwillingen<br />
zu verbringen. Es ist auch bekannt,<br />
dass sie oft bis spätnachts telefoniert und<br />
E-Mails verschickt, dass sie den Duft von<br />
Dior liebt, in einen Kalender von Tiffany’s<br />
schreibt und dass ihr Mann Ulrich Wickert<br />
einst ihr Herz mit Blumen eroberte. All das<br />
ist über Julia Jäkel, 41, Vorstand des Medienkonzerns<br />
Gruner und Jahr, schon berichtet<br />
worden. Aber eines ist seltsam offengeblieben:<br />
ihr Verhältnis zum Journalismus.<br />
Jäkel führt seit September das Deutschlandgeschäft<br />
und die digitalen Aktivitäten<br />
von Gruner und Jahr. Der von ihr berufene<br />
Chefredakteur von Brigitte ist zugleich Geschäftsführer<br />
geworden, was Debatten über<br />
die Abgrenzung des redaktionellen Teils<br />
von den Anzeigen auslöste. Gerade hat sie<br />
die Financial Times Deutschland eingestellt.<br />
Wie viel Journalismus steckt in dieser Frau?<br />
Um das zu sehen, lohnt es sich, an den<br />
Anfang ihres Berufslebens zurückzugehen.<br />
Es war vor 15 Jahren, als sich Jäkel für<br />
den Journalismus entschied. Sie wollte lernen,<br />
zu recherchieren und zu schreiben. Ihr<br />
standen 1998 die Türen offen bei Bertelsmann,<br />
sie hatte nach dem Studium in Heidelberg,<br />
Harvard und Cambridge das Karriereprogramm<br />
des Konzerns durchlaufen.<br />
Sie hätte zurück zum Buchverlag Random<br />
House nach München gehen können, wo<br />
sie während der Ausbildung ihre erste Praxisstation<br />
absolviert hatte. Oder nach Luxemburg,<br />
wo der Chef der Fernsehsparte<br />
RTL, Rolf Schmidt-Holtz, sie gerne als Assistentin<br />
behalten hätte. Jäkel lehnte ab. Sie<br />
zog es zu Gruner und Jahr – der Inhalte wegen,<br />
wie sie einmal erklärte. Um zu erfahren,<br />
wie Journalisten ticken und Journalismus<br />
funktioniert, bat sie Verlagschef Gerd<br />
Schulte-Hillen nach Ende ihrer Ausbildung,<br />
noch in der Redaktion der Berliner Zeitung<br />
arbeiten zu dürfen. Das Blatt galt als großes<br />
Experiment des Qualitätsjournalismus, als<br />
Versprechen. Der Versuch, aus der ehemaligen<br />
SED-Zeitung eine deutsche Washington<br />
Post zu machen, war gescheitert, aber<br />
nun wollte Gruner und Jahr einen zweiten<br />
Versuch wagen. <strong>Die</strong> 27-Jährige kam<br />
in eine Redaktion, in der Aufbruchstimmung<br />
herrschte: Der Chefredakteur Michael<br />
Maier und sein Chefreporter Alexander<br />
Osang waren noch keine 40 Jahre<br />
alt. In guten Tagen empfahl Maier seinen<br />
Schreibern, sie sollten sich in einer Liga mit<br />
der New York Times sehen. Manche glaubten<br />
ihm. Er durfte Millionen ausgeben, um<br />
50 Mitarbeiter der alten Mannschaft abzufinden<br />
und Edelfedern von der FAZ, taz,<br />
Süddeutsche Zeitung, Spiegel und Wochenpost<br />
zu holen und sie mit Blattmachern von<br />
Bild und Focus zu ergänzen.<br />
Für drei Monate bezog Julia Jäkel eine<br />
Verlagswohnung am Kotti in Kreuzberg<br />
und arbeitete in der 12. Etage im sozialistisch<br />
angehauchten Verlagsgebäude am Alexanderplatz.<br />
Nur wenige Kollegen in der<br />
Wirtschaftsredaktion wussten, dass sie bei<br />
Bertelsmann für Höheres auserwählt war.<br />
Manche sahen die Arzttochter aus Wiesbaden<br />
als ehrgeizige Praktikantin, die jeden<br />
Morgen in der Konferenz lauschte, wenn es<br />
krachte zwischen den Feuilletonisten und<br />
den Lokaljournalisten. Sie suchte Pressestimmen<br />
für die Meinungsseite heraus.<br />
<strong>Die</strong> drei Monate bei der Berliner Zeitung<br />
blieben die einzige Zeit, in der Julia<br />
Jäkel originär journalistisch arbeitete: Sie<br />
recherchierte und schrieb über einen Streit<br />
um das traditionsreiche Hotel Bristol am<br />
Kurfürstendamm, über Pläne für <strong>500</strong> Entlassungen<br />
beim französischen Mischkonzern<br />
Alcatel in Berlin. Mit einem Artikel<br />
über Ermittlungen gegen die Berliner Bank<br />
schaffte sie es sogar auf Seite eins. Mehrmals<br />
berichtete sie gemeinsam mit Kollegen.<br />
Sie nutzte ihre Kontakte und befragte<br />
in einem Bericht über geplante Abhörgesetze<br />
auch Gerd Schulte-Hillen. Den Mann<br />
also, der sie zur Berliner Zeitung geschickt<br />
hatte. In Berlin war eben vieles möglich.<br />
Am Ende entschied sich Julia Jäkel jedoch<br />
gegen das Schreiben, weil sie fand, dass<br />
andere darin besser seien. Sie wurde geschäftsführende<br />
Redakteurin beim Promiblatt<br />
Gala, doch inhaltlich befriedigte sie<br />
das nicht. Als Christoph Keese, der frühere<br />
Wirtschaftschef der Berliner, sie anrief<br />
und fragte, ob sie die Financial Times<br />
Deutschland mitgründen wolle, machte sie<br />
mit. Wieder ein Aufbruch, wieder ein Labor<br />
des Journalismus, dessen Teil sie sein<br />
wollte. Aber sie wurde Keeses geschäftsführende<br />
Redakteurin, es ging mehr ums<br />
Organisieren als ums Recherchieren und<br />
Schrei ben. Als die PR-Frau ausfiel, übernahm<br />
sie auch deren Aufgaben.<br />
Wieder stellte sich die Frage: Wohin<br />
soll sie gehen? Tiefer in den Journalismus?<br />
Oder hin zur Verlagsseite? Sie kümmerte<br />
sich für die FTD um das Luxusmagazin<br />
How to spend it und andere Beilagen, die<br />
Anzeigen versprachen. 2004 wechselte sie<br />
ins Management von Gruner und Jahr, nun<br />
steht sie an der Spitze des Unternehmens.<br />
Sie hat ihr eigenes Labor. Mit der FTD<br />
wurde sie einen Verlustbringer los, aber ihr<br />
Haus büßt damit an Bedeutung ein. Während<br />
im Wirtschaftsjournalismus 360 Arbeitsplätze<br />
wegfielen, expandiert die Tochter<br />
für Firmenmagazine und eröffnete ein<br />
neues Büro in München. Wer wird Gruner<br />
und Jahr künftig journalistisch repräsentieren:<br />
Stern und Geo oder Lifestyle-Blätter<br />
wie Couch? Liegt die Zukunft der Medien<br />
in der Glaubwürdigkeit oder in der<br />
Geschmeidigkeit gegenüber den Anzeigenkunden?<br />
Mehr Journalismus – oder weniger?<br />
Julia Jäkel wird das wieder einmal entscheiden<br />
müssen.<br />
T HOMAS S CHULER<br />
ist Medienjournalist in<br />
München. Von ihm erschien<br />
das Buch „Bertelsmannrepublik<br />
Deutschland“<br />
FOTOS: BARBARA DOMBROWSKI/LAIF, PRIVAT (AUTOR)<br />
94 <strong>Cicero</strong> 1.2013
<strong>Die</strong> Financial Times<br />
Deutschland hat<br />
sie eingestellt. Ein<br />
Verlustbringer ist weg,<br />
Bedeutung aber auch<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 95
| K A P I T A L | F I N A N Z K R I S E<br />
„DEM KAPITALISMUS<br />
FEHLT DER FEIND“<br />
Bestsellerautor COLIN CROUCH über verfehlten Liberalismus,<br />
falsche Griechenland-Politik und die sieche FDP<br />
H<br />
err Crouch, vor einem Jahr haben<br />
Sie das „befremdliche Überleben<br />
des Neoliberalismus“ konstatiert.<br />
Hat jetzt mit ein wenig Verzögerung doch<br />
das Sterben eingesetzt?<br />
Nein, im Gegenteil. Wir erleben in Europa<br />
eine neue Kraft des Neoliberalismus.<br />
Schauen Sie sich doch nur die Auflagen<br />
für Griechenland an: Sie sind Ausfluss<br />
eines reinen dogmatischen Neoliberalismus.<br />
Der wirtschaftliche Erfolg wird<br />
allein an der Deregulierung des Arbeitsmarkts<br />
gemessen, um Strukturreformen<br />
hingegen geht es nur sehr wenig. In der<br />
europäischen Politik gibt es in der Regel<br />
stets eine Akzentuierung von neoliberalen<br />
Maßnahmen. Das kann man<br />
auch durchaus verstehen, denn es müssen<br />
Märkte entstehen, und dafür braucht<br />
man ein wenig Liberalismus. Normalerweise<br />
geht das aber einher mit ein wenig<br />
Sozialpolitik. In der Krise aber ist man<br />
atavistisch zu einem reinen Neoliberalismus<br />
zurückgekehrt. <strong>Die</strong> Eurokrise ist<br />
das beste Beispiel für das Überleben des<br />
Neoliberalismus.<br />
Für Deutschland scheint das nicht zu<br />
gelten. <strong>Die</strong> FDP hat mit Umfragewerten<br />
von unter 5 Prozent zu kämpfen.<br />
Ich habe nie verstanden, warum die Liberalen<br />
vor drei Jahren so gut dastanden.<br />
<strong>Die</strong> Deutschen verstehen, wie wichtig der<br />
Sozialstaat ist, und sie wollen ihn nicht<br />
verlieren. Doch jetzt ist er bedroht. Sowohl<br />
die OECD als auch der Internationale<br />
Währungsfonds haben festgestellt,<br />
dass das Niveau der Ungleichheit in den<br />
USA und in vielen europäischen Ländern<br />
so groß ist, dass sie die Wirtschaft bedroht.<br />
Das ist etwas vollkommen Neues.<br />
Ist der Liberalismus beziehungsweise<br />
Neo liberalismus das richtige Mittel, um<br />
diese Entwicklung aufzuhalten?<br />
In einem echten, reinen Markt würde es<br />
Ungleichheiten geben, aber die Unterschiede<br />
wären aufgrund des gesunden<br />
Wettbewerbs geringer. Der heute existierende<br />
Neoliberalismus ist keine reine<br />
Marktwirtschaft, sondern eine Wirtschaft<br />
der großen, quasi monopolistischen Konzerne,<br />
was vollkommen marktwidrig ist.<br />
Wir erleben eine Vermischung von politischer<br />
und wirtschaftlicher Macht, die<br />
eine Folge der Konzentration des Reichtums<br />
ist. Auch das ist marktwidrig, denn<br />
FOTOS: ANDREJ DALLMANN FÜR CICERO<br />
Colin Crouch ist emeritierter<br />
Professor der University<br />
of Warwick. Bekannt<br />
wurde der britische<br />
Politikwissenschaftler<br />
und Soziologe mit seinen<br />
Schriften über „Das<br />
befremdliche Überleben<br />
des Neoliberalismus“<br />
und „Postdemokratie“<br />
96 <strong>Cicero</strong> 1.2013
in einer Marktwirtschaft sollte es eine<br />
solche Vermischung nicht geben.<br />
Was kennzeichnet denn den Liberalismus?<br />
Im klassischen Liberalismus gibt es immer<br />
die Möglichkeit des Misserfolgs und<br />
des Unvorhergesehenen; es gibt keinen<br />
großen Staat, der alles planiert. Zu Problemen<br />
kommt es erst dann, wenn der<br />
Liberalismus zu einer Doktrin wird, die<br />
keiner Korrekturen bedarf. Wozu das<br />
führt, sehen wir heute.<br />
Haben Sie den Eindruck, dass Europa aus<br />
der Krise gelernt hat?<br />
<strong>Die</strong> Politiker haben einiges gelernt. Aber<br />
wir können keine durchgehende Logik erwarten,<br />
da viele widersprüchliche Schlüsse<br />
gezogen haben. Politik an sich ist schon<br />
kompliziert, in der Krise aber ist sie besonders<br />
schwierig.<br />
Was sollten denn die Lehren aus der Wirtschafts-<br />
und Finanzkrise sein?<br />
<strong>Die</strong> Finanzmärkte brauchen eine globale<br />
Regulierung. Aber ebenso wichtig<br />
ist die Erkenntnis, dass wir einander in<br />
Europa brauchen. Nicht Staaten stehen<br />
im Wettbewerb, sondern Unternehmen,<br />
die um Märkte konkurrieren. Deutschland<br />
braucht die anderen, die seine Waren<br />
kaufen. Wenn die anderen sich aber<br />
diese Waren nicht leisten können, dann<br />
können sie die Deutschen auch nicht verkaufen.<br />
Es gibt also eine wechselseitige<br />
Abhängigkeit, mit der Folge, dass wir uns<br />
„<strong>Die</strong> Finanzmärkte brauchen eine<br />
globale Regulierung. Aber ebenso<br />
wichtig ist die Erkenntnis, dass wir<br />
einander in Europa brauchen. Nicht<br />
Staaten stehen im Wettbewerb,<br />
sondern Unternehmen, die um<br />
Märkte konkurrieren“<br />
gegenseitig unterstützen müssen. <strong>Die</strong><br />
Menschen aber lernen aus der Eurokrise<br />
genau das Gegenteil.<br />
Stellen Sie sich vor, Sie wären die deutsche<br />
Kanzlerin und müssten den Deutschen<br />
erklären, dass immer mehr Millionen<br />
Euro an Griechenland gezahlt werden<br />
müssen.<br />
<strong>Die</strong> Zahlungen waren und sind richtig.<br />
Griechenland ist ein Paradebeispiel<br />
für die Verquickung von politischer und<br />
wirtschaftlicher Macht. Es gibt eine<br />
kleine Elite. <strong>Die</strong>se Elite beherrscht das<br />
Land, die Politik, die Massenmedien, sie<br />
zahlt keine Steuern, ihr gesamtes Vermögen<br />
befindet sich im Ausland. Hinzu<br />
kommt, es gibt eine sehr hohe Zahl von<br />
Selbstständigen, und die zahlt nicht sehr<br />
viel Steuern. <strong>Die</strong> Einzigen, die wirklich<br />
Steuern zahlen, sind die im öffentlichen<br />
<strong>Die</strong>nst Beschäftigten und einige wenige<br />
kleine Unternehmen. Es ist daher vollkommen<br />
richtig zu verlangen, dass die<br />
Griechen ihr Verhalten ändern. Doch<br />
welche Hoffnung geben wir ihnen? Wir<br />
sagen ihnen ständig: Baut euren Sozialstaat<br />
ab. Doch damit können sie keine<br />
moderne Wirtschaft aufbauen. Griechenland<br />
braucht Hilfe, um sein Staatsmodell<br />
zu verändern, dies würde aber viel weitreichendere<br />
Eingriffe in die Autonomie<br />
eines souveränen Staates erfordern.<br />
Sie sehen die Ursache für den großen<br />
Crash vornehmlich in der Gier der<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 97
| K A P I T A L | F I N A N Z K R I S E<br />
Finanzindustrie. Vielleicht kommt noch<br />
eine weitere Komponente hinzu, nämlich<br />
die „Gier auf den Sozialstaat“?<br />
<strong>Die</strong>ser These widerspreche ich. Ökonomien<br />
Südeuropas, vielleicht mit Ausnahme<br />
Italiens, sind keine Sozialstaaten.<br />
Lassen wir mal die osteuropäischen Länder,<br />
die sehr unterschiedlich sind, außen<br />
vor und betrachten nur Westeuropa,<br />
dann stellen wir fest, dass dort der Wohlfahrtsstaat<br />
sehr schlecht organisiert ist.<br />
Transferzahlungen haben in dieser Region<br />
ein zu hohes Gewicht, während die<br />
Bereitstellung von <strong>Die</strong>nstleistungen viel<br />
zu kurz kommt. Hinzu kommt: Beim<br />
Schutz des Arbeitsmarkts geht es in diesen<br />
Staaten vorwiegend um den Schutz<br />
bestehender Arbeitsplätze und weniger<br />
um die Hilfe, Unterstützung und Weiterbildung<br />
von Arbeitslosen. Wohlfahrtsstaaten<br />
haben ein strukturelles Problem,<br />
Man kann aber nicht die Amerikaner dafür<br />
verantwortlich machen – sie haben<br />
die anderen schließlich nicht eingeladen<br />
mitzumachen. Alle wollten dabei sein.<br />
Glauben Sie, Großbritannien und die USA<br />
haben aus der Krise gelernt?<br />
Großbritannien hat neue Regeln eingeführt,<br />
die aber einige Finanzexperten bereits<br />
für viel zu schwach halten. Jedenfalls<br />
werden sie erst im Jahr 2019 umgesetzt<br />
sein. Bis dahin wird es mindestens eine<br />
Parlamentswahl geben, und Lobbyisten<br />
aus dem Finanzsektor werden ausreichend<br />
Zeit haben, gegen die Maßnahmen<br />
vorzugehen. Was in den USA<br />
geschehen wird, müssen wir abwarten.<br />
Während Obamas erster Amtszeit war er<br />
sehr auf den Finanzsektor angewiesen. In<br />
seiner zweiten Amtszeit könnte ihm das<br />
egal sein, und er könnte Maßnahmen zur<br />
Regulierung in Angriff nehmen. Allerdings<br />
wird er es ohne die Unterstützung<br />
des Kongresses schwer haben, und dort<br />
haben Lobbygruppen einen unglaublich<br />
großen Einfluss.<br />
„Es gibt die Chance, dass sich Europa<br />
föderaler entwickelt und damit wieder<br />
demokratischer wird. Wenn wir<br />
beginnen, Europa zu stärken, werden<br />
wir auch die Demokratie stärken“<br />
und sie sind auch nicht großzügig. Es ist<br />
wichtig, dass alle Konsumenten sein können,<br />
und das bedeutet, dass sie ein Einkommen<br />
haben müssen und sich sicher<br />
fühlen müssen, um auch die Risiken des<br />
Konsums tragen zu können.<br />
Angesichts der Tatsache, dass die Finanzkrise<br />
in den USA ausgebrochen ist, erscheint<br />
es sehr unfair, dass wir in Europa<br />
nun das Ganze ausbaden müssen.<br />
Ja, das ist es. Aber es ist auch deswegen<br />
dazu gekommen, weil die europäischen<br />
Banken bei den Finanzmarktgeschäften<br />
in Amerika mitgemacht haben. Experten<br />
sagen, dass sie damit grandios gescheitert<br />
sind, weil sie erst spät in das Geschäft mit<br />
Derivaten eingestiegen sind, sie das System<br />
nie ganz durchdrungen und sie daher<br />
die größten Fehler gemacht haben.<br />
So konnte sich die Krankheit ausbreiten.<br />
Nach dem Motto: Wenn die Amerikaner<br />
niesen, bekommt jeder eine Erkältung.<br />
Ebenso könnte man sagen, die Banken<br />
haben doch nur ihren Job gemacht und<br />
nach Gewinnmaximierung gestrebt. Einen<br />
Crash hatten die Banker doch sicher nicht<br />
beabsichtigt, oder?<br />
Nach der Markttheorie von Eugene<br />
Fama kann der Markt nie scheitern, da<br />
die Handelnden perfekt informierte, rationale<br />
Akteure sind, die niemals Fehler<br />
machen. Nur: <strong>Die</strong>smal waren die Händler<br />
nicht perfekt informiert. Das Geschäft<br />
mit Derivaten muss schnell vonstattengehen<br />
– je schneller, desto größer<br />
der Gewinn. Bei dieser Art von Handel<br />
gibt es keine Zeit zu überprüfen, welchen<br />
Inhalt das Paket hat, das man weiterverkauft.<br />
<strong>Die</strong> Händler hatten keine<br />
Ahnung, was sie verkauften, sie haben es<br />
einfach weiterverkauft. Es reichte vollkommen<br />
zu glauben, dass jemand anderes<br />
glaubt, dass man etwas mit Gewinn<br />
weiterveräußern kann. <strong>Die</strong> einzige Information,<br />
die die Händler benötigten,<br />
war: Das System funktioniert. Man kann<br />
daher tatsächlich nicht dem einzelnen<br />
Händler die Schuld für den Crash geben.<br />
Denn das System funktioniert nach dem<br />
Motto: Solange die Musik spielt, muss<br />
man weitertanzen. Hierin liegt das Versagen<br />
des Systems. Wenn eine Gruppe<br />
normalerweise dasselbe Problem hat und<br />
man davon ausgehen kann, dass dieses<br />
Problem zu einem Desaster führt, wird<br />
diese Gruppe in der Regel Gegenmaßnahmen<br />
ergreifen. Bei der Finanzmarktkrise<br />
aber konnte niemand den ersten<br />
Schritt wagen. Denn derjenige, der es<br />
doch gewagt hätte, wäre aus dem Geschäft<br />
raus gewesen.<br />
Hat der Kapitalismus durch den Untergang<br />
des Kommunismus seinen Gegner<br />
und dadurch die gegenseitige Kontrolle<br />
verloren?<br />
Durchaus. Nach dem Ende des Zweiten<br />
Weltkriegs waren die USA unglaublich<br />
großzügig und haben eine heterogene politische<br />
Landschaft unterstützt. Entscheidend<br />
war, ein Gegengewicht gegen den<br />
Kommunismus aufzubauen. Es gab damals<br />
tatsächlich eine Wahl. Staaten in der<br />
Dritten Welt konnten sagen: Wenn wir<br />
keine Unterstützung von den USA bekommen,<br />
dann gibt es immer noch die<br />
Sowjetunion. Auch wenn die Alternative<br />
schrecklich war, es gab sie. Aufgrund dessen<br />
war der Kapitalismus sehr viel eher<br />
bereit zu sozialen Kompromissen.<br />
Friedrich Hölderlin hat gesagt: „Wo aber<br />
Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“<br />
Gibt es für Europa in der Krise die Chance,<br />
ein besseres Europa entstehen zu lassen,<br />
oder wird es zersplittern?<br />
Europa wird nicht zersplittern, aber vielleicht<br />
geschwächt. Es gibt aber auch die<br />
Chance, dass sich Europa föderaler entwickelt<br />
und damit wieder demokratischer<br />
wird. Wenn wir beginnen, Europa<br />
zu stärken, werden wir dadurch auch die<br />
Demokratie stärken.<br />
Das Gespräch führten Judith Hart<br />
und Christoph Schwennicke<br />
98 <strong>Cicero</strong> 1.2013
EURO-KRISE Wie viel Rettung muss sein?<br />
SYRIEN Ein Land versinkt in Blut und Gewalt<br />
USA Zweite Chance ohne Charisma<br />
www.spiegel.de<br />
Jetzt<br />
im<br />
Handel.
| K A P I T A L | A R Z N E I M I T T E L<br />
DIE QUADRATUR<br />
DER KÜGELCHEN<br />
100 <strong>Cicero</strong> 1.2013
In der Fabrik der<br />
Anthroposophen. Huningue,<br />
Frankreich, ein Industrieroboter<br />
verpackt Fläschchen mit<br />
Baldriankügelchen<br />
<strong>Die</strong> alternative Medizin boomt. Immer mehr Menschen<br />
nehmen homöopathische Globuli. <strong>Die</strong> Anbieter produzieren<br />
industriell, um die Nachfrage nach den Arzneimitteln mit<br />
der ganzheitlichen Aura zu stillen. Wie geht das zusammen?<br />
VON S TEFAN T ILLMANN<br />
FOTO: BASILE BORNAND/13PHOTO FÜR CICERO<br />
S<br />
PÄTESTENS AN DIESEM MORGEN in<br />
der Produktionshalle in Schwäbisch<br />
Gmünd verliert die Baldrianwurzel<br />
ihre Unschuld. Ein<br />
Brei ist sie schon, aber nun rollt<br />
ein elektrischer Hebewagen über den Fliesenboden<br />
und kippt die Masse in einen Riesenkessel<br />
aus Edelstahl. 800 Liter fasst der<br />
Behälter, darin wird der Brei erhitzt und<br />
eine halbe Stunde am Siedepunkt gehalten.<br />
Dann lässt Thomas Armbruster die Flüssigkeit<br />
abkühlen und zwölf bis 36 Stunden<br />
ziehen, bevor sie zur Weiterverarbeitung<br />
an einen anderen Produktionsstandort in<br />
Frankreich gefahren wird und jene Kügelchen<br />
herauskommen, die Globuli heißen,<br />
in diesem Fall: Calmedoron.<br />
Hier, in der Halle von Thomas Armbruster,<br />
sind zwei Welten zu besichtigen:<br />
Der Biotechnologe arbeitet für Weleda, ein<br />
Unternehmen, das sich in der Tradition der<br />
Anthroposophie sieht. Rudolf Steiner, der<br />
Vater der Waldorfschulen, ergänzte einst<br />
Schulmedizin und Homöopathie um Spiritualität,<br />
um die Erforschung des menschlichen<br />
Geistes und der Gestirne. Aussaat<br />
und Ernte werden nach dieser Denkschule<br />
sogar auf die Mondphase abgestimmt. Weil<br />
aber die Nachfrage nach anthroposophischen<br />
Mitteln steigt und steigt, stößt die<br />
anthroposophische Medizin gerade auf die<br />
Gesetze der Arzneimittelindustrie, in der<br />
es um Masse, Effizienz und Zuverlässigkeit<br />
geht und weniger darum, wann wie<br />
der Mond scheint. In dieser Welt werden<br />
nicht nur gute Zuhörer und behutsame<br />
Gärtner gebraucht.<br />
Und deshalb ist Thomas Armbruster<br />
hier, 44, kurz geschorene Haare, Leiter<br />
Tinkturherstellung bei der Weleda AG,<br />
Weltmarktführer für anthroposophische<br />
Arzneimittel und Naturkosmetika. Armbruster<br />
muss die zwei Welten zusammenbringen,<br />
es ist die Quadratur der Kügelchen.<br />
Steinkrüge für den Baldrianbrei?<br />
Geht nun mal nicht bei den Mengen, also<br />
Edelstahlkessel, das verlangen auch die Industriestandards.<br />
Erhitzen des Breis ohne<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 101
| K A P I T A L | A R Z N E I M I T T E L<br />
FOTOS: THOMAS BERNHARDT (4), BASILE BORNAND/13 PHOTO (2) FÜR CICERO<br />
Kultur, Theorie, Heilung. Stefan von Löwensprung, Mediziner<br />
und Idealtypus des Anthroposophen, berät Weleda<br />
Menge, Umsatz, Gewinn. Thomas Armbruster, Biotechnologe,<br />
leitet die Herstellung von Tinkturen bei Weleda<br />
elektromagnetische Strahlen? Okay, man<br />
kann auch Dampf einsetzen. Armbruster<br />
sieht das alles ziemlich pragmatisch. Seine<br />
Lieblingspflanze ist die Ringelblume, weil<br />
Weleda die in großen Mengen erntet. „Und<br />
weil Menge mehr Umsatz und mehr Gewinn<br />
bedeutet.“ So ein Satz hört sich nicht<br />
besonders ganzheitlich an, vielleicht hat<br />
das damit zu tun, dass Armbruster früher<br />
bei den „Bösen“ gearbeitet hat, wie er sagt:<br />
einem Start-up für Genforschung.<br />
ABER ES GIBT HIER JA noch Menschen wie<br />
Stefan von Löwensprung. Von Löwensprung,<br />
46, eher schmächtig, ist so etwas<br />
wie der Idealtypus eines Anthroposophen<br />
und der Gegenentwurf zu Armbruster. Er<br />
ging auf die Waldorfschule, zum 14. Geburtstag<br />
wünschte er sich einen Besuch im<br />
Weleda-Erlebniszentrum. Schon vor seinem<br />
Medizinstudium wusste er, dass er danach<br />
eine anthroposophische Weiterbildung machen<br />
würde. Später arbeitete er in anthroposophischen<br />
Kliniken und Praxen, versuchte,<br />
mit Mistelpräparaten die Leben von<br />
Krebspatienten im Endstadium zu verlängern.<br />
Er sagt, einige wären früher gestorben,<br />
wären sie früher operiert worden.<br />
Heute ist von Löwensprung Mitautor<br />
des Handbuchs für Naturheilpraxis<br />
und eine Art Berater des Weleda-Konzerns.<br />
Er gehört der anthroposophischen<br />
Christengemeinschaft an, er kann minutenlang<br />
Rudolf Steiner zitieren, im Bücherschrank<br />
zu Hause hat er die Gesamtausgabe.<br />
Armbruster dagegen findet, dass man<br />
die 100 Jahre alten Steiner-Texte im Original<br />
kaum lesen kann. Aber im Kollegenkreis<br />
redeten sie manchmal über die Theorien,<br />
sagt er. Während im Hintergrund der<br />
Kessel vollläuft, spricht von Löwensprung<br />
leise, Armbruster laut.<br />
Weleda braucht beide. Es ist ein schmaler<br />
Grat zwischen dem individuellen Ansatz<br />
und der industriellen Produktion, zwischen<br />
Überzeugungen und einem Geschäft, das<br />
Kompromisse verlangt. <strong>Die</strong> Gesundheitsbranche<br />
boomt im alternden Deutschland<br />
Ein Weleda-Gärtner in<br />
Schwäbisch Gmünd trennt die<br />
Baldrianwurzeln vom Strang.<br />
Dann: Waschen, Trocknen,<br />
Zerkleinern. Im Kessel entsteht<br />
eine Tinktur. Später in<br />
Huningue im Elsass wird die<br />
Tinktur auf Globuli gespritzt<br />
102 <strong>Cicero</strong> 1.2013
fast von selbst. Und es wundert nicht, dass<br />
im allgemeinen Biotrend die alternative<br />
Medizin besonders profitiert.<br />
Es ist ein unübersichtlicher Markt von<br />
Anbietern entstanden, die vielfach weiter<br />
Probleme haben, die Wirksamkeit ihrer<br />
Produkte zu beweisen. Gekauft werden die<br />
Mittel so oder so: Homöopathische und<br />
anthroposophische Mittel machten im<br />
September 2012 zwar erst gut 1 Prozent<br />
vom Zwei-Milliarden-Umsatz der Apotheken<br />
aus. <strong>Die</strong> Umsätze wachsen aber zweistellig,<br />
während der Apothekenmarkt insgesamt<br />
stagniert. Um die Nachfrage zu<br />
stillen, müssen die Firmen industriell produzieren,<br />
auch wenn die Heilpflanzen noch<br />
so schonend angebaut werden.<br />
DIE LUFT ÜBER DEM ACKER ist kalt an diesem<br />
Morgen, den Himmel verhängt eine graue<br />
Wolkendecke. Das Gelände bei Schwäbisch<br />
Gmünd gehört zu Weledas größter Anbaufläche.<br />
Auf 22 Hektar wachsen 450 verschiedene<br />
Pflanzenarten, viele auf 50 Quadratmeter<br />
großen Beeten. Manche Beete<br />
werden mit Gestrüpp abgedunkelt, um<br />
Prozesse im menschlichen Darm nachzustellen.<br />
Pflanzen wie Johanniskraut werden<br />
mit Gold gedüngt, weil das das natürliche<br />
Sonnenmetall sei. Stefan von Löwensprung<br />
etwa ist ein regelrechter Fan des Goldes. Er<br />
rechnet vor, dass in einen 20-Liter-Malereimer<br />
400 Kilogramm Gold passen, und<br />
dass sich ein Gramm Gold zu einem Faden<br />
von einem Kilometer strecken lässt. Was für<br />
eine Dichte! Welche Elastizität! Das Gold<br />
passe einfach perfekt zum Herzen.<br />
An diesem Morgen werden die Baldrianwurzeln<br />
geerntet. Eine Maschine pflügt<br />
über den Acker, sie lockert den Boden,<br />
dann klauben Saisonkräfte die Wurzeln heraus.<br />
Wurzelbestandteile wirken nach der<br />
anthroposophischen Lehre in Richtung<br />
des zentralen Nervensystems und Baldrian<br />
wirkt beruhigend. Wenn sich im Herbst die<br />
Kräfte in die Wurzel ziehen, ist aus Sicht der<br />
Steiner-Schüler die beste Zeit zur Ernte. Solange<br />
nicht Vollmond ist, denn dann ernten<br />
Anthroposophen nicht.<br />
In der<br />
alternativen<br />
Medizin geht es<br />
um Individuen.<br />
In der Industrie<br />
geht es um<br />
Masse<br />
Der deutsche Arzt Christian Hahnemann<br />
hatte im 19. Jahrhundert die Homöopathie<br />
mit zwei Prinzipien begründet.<br />
Ähnliches soll mit Ähnlichem geheilt<br />
und die Mittelchen stark verdünnt werden.<br />
<strong>Die</strong> Homöopathen gehen davon aus,<br />
dass Substanzen, die bei einem gesunden<br />
Menschen bestimmte Symptome auslösen,<br />
dieselben bei Kranken lindern. So soll Kaffee<br />
ein Heilmittel gegen Schlaflosigkeit sein.<br />
Hahnemanns Konzept griff Rudolf Steiner<br />
Anfang des 20. Jahrhunderts auf.<br />
Aus der Idee ist ein Geschäft geworden.<br />
Weleda macht heute über 300 Millionen<br />
Euro Umsatz. Das klingt im Vergleich<br />
zu Pharmaunternehmen wie Bayer Health-<br />
Care Pharmaceuticals und Boehringer Ingelheim<br />
mit jeweils über zehn Milliarden<br />
Euro Umsatz fast bescheiden. Weleda führt<br />
aber mit 1400 Arzneimitteln wesentlich<br />
mehr Produkte als die Konkurrenz, die<br />
gern auf wenige Kassenschlager setzt.<br />
Weleda produziert bis heute auch für<br />
den Einzelfall. Doch oft wird Massenware<br />
hergestellt, wie bei den Baldrianwurzeln,<br />
die zu Calmedoron werden. <strong>Die</strong> Kügelchen<br />
sollen gegen Schlafstörungen helfen.<br />
Globuli sind die Klassiker unter den<br />
Mitteln, diese weißen Streukügelchen, die<br />
sich Kranke unter die Zunge schieben sollen.<br />
Viele Eltern verabreichen die Mittel<br />
ihren Kindern. <strong>Die</strong> Naturprodukte werden<br />
schon keinen Schaden anrichten – und<br />
wer weiß: Vielleicht helfen sie sogar. Es ist<br />
eine andere Denke, die nicht auf Beweise<br />
der Wirkung setzt, keine evidenzbasierte<br />
Medizin mit ihren klinischen Teststudien.<br />
In dieser Welt geht es um Individuen und<br />
die Ganzheit von Körper und Seele.<br />
EIN TAG NACH DER ERNTE. <strong>Die</strong> Wurzeln landen<br />
drüben in der Tinkturenherstellung, in<br />
Thomas Armbrusters Halle. Abgeschliffener<br />
grauer Boden, keine runden, geschwungenen<br />
Formen, dafür leistungsstarke<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 103
| K A P I T A L | A R Z N E I M I T T E L<br />
Deckenleuchten. Ganzheitlich? „Was habe<br />
ich davon, wenn ich stattdessen mit offener<br />
Flamme arbeite und mir alle zwei Tage die<br />
Bude abbrennt“, sagt Armbruster.<br />
Männer mit Haube und Mundschutz<br />
waschen und trocknen die 450 Kilogramm<br />
Wurzeln, die verlieren dabei 80 Prozent an<br />
Wasser. Sie zerkleinern und kippen sie in<br />
ein Fass. Blieben die Pflanzen zu lange an<br />
der Luft, würden sie braun werden wie aufgeschnittene<br />
Äpfel. Deswegen wird ein Extraktionsmittel<br />
darübergegeben: Ethanol,<br />
Bioethanol natürlich.<br />
Nachdem der Baldrianbrei zur Tinktur<br />
geworden ist, beginnt in der Industriehalle<br />
das, was Zweifler Hokuspokus nennen<br />
würden. <strong>Die</strong> Tinktur wird verdünnt, Homöopathen<br />
und Anthroposophen sagen:<br />
potenziert. Niedrige Verdünnung wirke<br />
auf den Stoffwechsel, glauben die Anthroposophen,<br />
hohe auf das Nervensystem.<br />
Abgefüllt in ein Flakonglas, legt ein<br />
Mitarbeiter die Tinktur in eine Schaukel<br />
aus Edelstahl. Je nach Vorgabe mischt er<br />
die Tinktur unterschiedlich oft hintereinander<br />
und schaukelt sie. Weleda schwingt<br />
die Schaukel in Form einer liegenden<br />
Acht, der homöopathische Marktführer,<br />
die Deutsche Homöopathie-Union, führt<br />
die Tinktur hoch und runter – zum Erdmittelpunkt.<br />
An die Schaukel dürfen nur<br />
Menschen, die sich spirituell dazu in der<br />
Lage sehen. Thomas Armbruster sagt, wenn<br />
ein Mitarbeiter einen schlechten Tag habe,<br />
solle er sich nicht an die Schaukel stellen.<br />
Er selbst macht das ohnehin nicht. „Ich<br />
könnte mich da nicht drauf einlassen und<br />
würde an meine Kinder denken oder an<br />
meine nächste Aufgabe.“<br />
DIE SUBSTANZEN WERDEN VERDÜNNT, so stark,<br />
dass die Wirkstoffe kaum nachweisbar sind.<br />
Es gibt viele Menschen, die das alles für<br />
ziemlichen Unsinn halten. Jürgen Windeler,<br />
Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit<br />
im Gesundheitswesen, nannte<br />
bereits kurz nach seinem Amtsantritt 2010<br />
Gold fürs Herz, Mistel gegen<br />
Tumore. Beweise? Fehlen. Kritiker<br />
sagen: „<strong>Die</strong> Homöopathie-Lüge“<br />
die Homöopathie ein „spekulatives, widerlegtes<br />
Konzept“. Im Herbst ist ein Buch erschienen,<br />
„<strong>Die</strong> Homöopathie-Lüge“ heißt<br />
es, darin beklagen die Medizinjournalisten<br />
Christian Weymayr und Nicole Heißmann,<br />
die Erfolge seien nicht standardisiert nachgewiesen<br />
worden. Bestenfalls seien es Placebo-Effekte.<br />
Sie sagen, wenn Krankenkassen<br />
Homöopathie anerkennen, müssten sie<br />
ebenso eine Pilgerfahrt nach Lourdes bezahlen.<br />
Viele Schulmediziner machten nur mit,<br />
weil es sich gut abrechnen lasse. <strong>Die</strong> Ziffer<br />
30 der Gebührenordnung gestattet den Ärzten<br />
eine homöopathische Erstberatung über<br />
eine Stunde mit 52,46 Euro.<br />
Stefan von Löwensprung kennt die<br />
Kritik, er widmet sich bei Weleda seit Jahren<br />
der Schulung von Ärzten. Er sieht sich<br />
nicht im Gegensatz zur Schulmedizin. Anthroposophische<br />
Ärzte hätten schließlich<br />
Medizin studiert, sagt er. Er will die Schulmedizin<br />
ergänzen. Dennoch kritisiert er sie.<br />
Normale Arzneimittel seien Antipräparate,<br />
die Pathologien nur unterdrückten.<br />
Homöopathische und anthroposophische<br />
Mittel dagegen würden dem Organismus<br />
die Möglichkeit bieten, dass er<br />
reagieren kann, und Selbstheilungskräfte<br />
fördern. Gold fürs Herz, Mistel gegen<br />
Tumore. Der Beweis fehlt gleichwohl:<br />
trotz Homöopathischem Arzneibuch,<br />
nach dem sie arbeiten, und der Zulassungsgenehmigung,<br />
der auch die Naturarzneimittel<br />
unterliegen. <strong>Die</strong> Wirkung der<br />
Arzneimittel soll vom einzelnen Patienten<br />
abhängen – von seiner Laune und dem sozialen<br />
Umfeld.<br />
Bei den Calmedoron-Kügelchen ist das<br />
ein bisschen anders. <strong>Die</strong> beruhigende Wirkung<br />
von Baldrian ist allseits bekannt. Und<br />
die Kügelchen werden am Fließband produziert.<br />
„Calmedoron ist nicht individuell“,<br />
sagt Stefan von Löwensprung. Für ihn<br />
kommt es auf die „innere Einstellung des<br />
Arztes an, wie er das verordnet“. So würde<br />
aus einem Massenprodukt am Ende doch<br />
ein „Kulturarzneimittel“.<br />
Auch wenn nach der anthroposophischen<br />
Lehre keine Materie ohne Geist besteht:<br />
<strong>Die</strong> Maschinen, die im Gewerbegebiet<br />
im französischen Huningue aus den<br />
Tinkturen aus Schwäbisch Gmünd ein Medizinprodukt<br />
machen, wissen von alldem<br />
vermutlich wenig. Huningue ist ein Ort<br />
im Dreiländereck neben Basel, auf der anderen<br />
Rheinseite liegt das deutsche Weil<br />
am Rhein.<br />
AM TAG, AN DEM DER BALDRIAN zur Ware<br />
wird, scheint draußen die Sonne. <strong>Die</strong> Baldriantinktur<br />
befindet sich jetzt in einem<br />
braunen Glasflakon. Als Gemisch mit anderen<br />
Tinkturen, die im Laufe des Jahres<br />
hergestellt werden: Hafer, Kaffee, Hopfen,<br />
Passionsblume, so weit alles klar, alles<br />
bio. Dann drückt die Produktionsleiterin<br />
Sandra Chiffaut einen Knopf, und die<br />
Tinktur wird über Schläuche in eine Maschine<br />
gepumpt, die aussieht wie eine Industriewaschmaschine.<br />
Oben füllt Chiffaut<br />
die weißen Zuckerkügelchen hinein, die<br />
aus vier Plastiksäcken à sieben Kilogramm<br />
kommen. <strong>Die</strong> Frau drückt „Vorgang 1“,<br />
die Maschine fährt hoch auf 58 Grad, die<br />
Trommel in der Maschine rollt an, innen<br />
spritzt die Pistole die Tinktur auf die Kügelchen.<br />
Spritzen, Trocknen, Spritzen,<br />
Trocknen, fünf Stunden und 20 Minuten<br />
lang – bis am Ende unten die Globuli hinauskullern,<br />
etwas bräunlicher als zuvor.<br />
Auf der Verpackung wird später „Calmedoron“<br />
stehen, zehn Gramm für rund fünf<br />
Euro. <strong>Die</strong> Leiterin sagt: „Bei kleinen Mengen<br />
kann man das manuell machen, aber<br />
bei den großen Mengen für den deutschen<br />
Markt geht das nur noch vollautomatisch.“<br />
Im Erdgeschoss arbeitet ein Apparat,<br />
ein Produktionsroboter, automatisch,<br />
akkurat. Er kippt die bespritzten Kügelchen<br />
in einen Trichter, sie rieseln in Fläschchen.<br />
Der Roboter verschließt sie, Deckel,<br />
Fläschchen, Deckel, Fläschchen, 20 in<br />
der Minute, 600 000 im Jahr. Am Ende<br />
drückt der Roboter die Auftragsnummer<br />
aufs Etikett: Charge 2101, Deutschland,<br />
12 000 Stück, alles passt.<br />
Jetzt könnte selbst der Vollmond nichts<br />
mehr kaputt machen.<br />
S TEFAN T ILLMANN<br />
ist Autor für Wirtschaftsthemen<br />
in Berlin<br />
FOTO: PRIVAT<br />
104 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Ich brauche Capital, weil ich<br />
am Kapitalmarkt nicht spielen,<br />
aber trotzdem gewinnen will.<br />
Wer etwas vorhat, braucht Capital.
| K A P I T A L | K O M M E N T A R<br />
Kulturschwindel<br />
Libor-Skandal? Deutsche Bank-Skandale? <strong>Die</strong> Verantwortlichen<br />
schwingen das große Wort – und schlagen sich in die Büsche<br />
V ON F RANK A . MEYER<br />
W<br />
AS FÜR EIN WORT: Verantwortung! Ein großes Wort, ein<br />
majestätisches Wort. Das Wort der Finanz-Majestäten:<br />
„Wir tragen die Verantwortung!“ Ein Wort, das<br />
noch den exorbitantesten Gehältern die Weihe solider Verantwortungsethik<br />
verlieh. Lächerlich dagegen die Gesinnungsethiker<br />
mit ihrem quengeligen Banker-Bashing.<br />
Was für ein Wort: Leistung! Ein Riesenwort, ein Wort für<br />
Manager-Giganten, die ergeben alle Lasten der Weltwirtschaft<br />
schultern, und zwar Tag wie Nacht, „Masters of the Universe“,<br />
die sie nun mal sind. Auch gegen diesen Wahn ist auf dem weiten<br />
Feld der Kritik am Casino-Kapitalismus offenbar nichts zu<br />
bestellen.<br />
Doch seit dem Crash der Lehman Brothers 2008 sind die<br />
beiden pompösen Begriffe nicht mehr so recht im Schwange.<br />
Prahlhans hat sich in die Büsche geschlagen.<br />
Und schon kursiert auf den Vorstandsetagen ein neues Wort:<br />
Kulturwandel! Es suggeriert: Wir bessern uns jetzt. Und dient<br />
der Resozialisierung von Crash-Tätern wie Ackermann, Fitschen<br />
oder Jain, um nur einmal die Verantwortungs- und Leistungsträger<br />
der Deutschen Bank zu nennen.<br />
Das neue Mantra Kulturwandel auf den Lippen, auch „neue<br />
Kultur“ genannt, tingeln die Boni-Banker von Symposium zu<br />
Podium zu Finanztagung. Eine neue Zeit bricht an. Alles wird<br />
gut, wenn nicht sogar noch besser.<br />
Gern wäre der Finanzausschuss des Bundestags kürzlich in<br />
den Genuss dieser Kulturrevolution gekommen. <strong>Die</strong> Parlamentarier<br />
luden Deutsche-Bank-Chef Anshu Jain zum Gespräch über<br />
die im Sommer aufgedeckte Manipulation des Libor-Bankzinssatzes,<br />
die dem Geldinstitut ja alles andere als fremd sein sollte.<br />
Doch der Verantwortungsträger leistete der Vorladung keine Folge;<br />
ebenso wenig Leistungsträger und Deutsche-Bank-Co-Chef Jürgen<br />
Fitschen. Stattdessen erschien Stephan Leithner, zuständig für<br />
Personal, Rechtsfragen und Europa, nicht zuständig allerdings für<br />
Deutschland.<br />
<strong>Die</strong> Libor-Vorwürfe betreffen das Investmentbanking der<br />
Deutschen Bank, für das jahrelang Jain als Chef der Abteilung<br />
Global Markets direktverantwortlich war – und mit deren Spekulationen<br />
er sein Anrecht auf horrende Boni geltend machte.<br />
Aus der Schweiz meldete sich unverzüglich Josef Ackermann<br />
zu Wort, Ex-Chef der Deutschen Bank, und kritisierte seinen<br />
Nachfolger: „Ich finde, dass der Chef hier auf die Bühne gehört.“<br />
Und: „Ich habe mich immer diesen Aufgaben gestellt.“<br />
Ach ja? War Mahner Ackermann nicht der Vorgesetzte<br />
von Jain in jener gar nicht allzu fernen Zeit, als die<br />
ILLUSTRATION: JAN RIECKHOFF<br />
106 <strong>Cicero</strong> 1.2013
FOTO: PRIVAT<br />
Libor-Manipulationen liefen? Ist nicht Ackermann verantwortlich<br />
für die Irrungen und Wirrungen der Deutschen Bank<br />
in den vergangenen zehn Jahren – sowie generell für deren<br />
Skandale?<br />
Unter dem Schweizer entwickelte sich das ehedem so stolze,<br />
konservative Institut rheinischer Geldkultur zu einer der größten<br />
Spekulantenbanken überhaupt. Ackermanns Monstrum<br />
steckte tief im Sumpf der US-Subprime-Krise, die sich nach<br />
2008 zur Weltfinanzkrise auswuchs. Wo immer gezockt wurde,<br />
wo immer gezockt wird, war die Deutsche Bank dabei, ist die<br />
Deutsche Bank dabei.<br />
Ja, der Chef gehört in Berlin auf die Bühne: kein anderer als<br />
Ackermann. Denn kein anderer hat in der jüngeren Geschichte<br />
die Macht der Deutschen Bank so sehr verkörpert wie der Milizoberst<br />
aus Mels im Kanton St. Gallen. Vor dessen Ära 2002 bis<br />
2012 amtierte der Vorstand der Bank noch als kollegiales Gremium<br />
mit einem Sprecher, einem Primus inter pares. Doch<br />
Ackermann reklamierte die ganze Macht für sich.<br />
Auch die ganze Verantwortung?<br />
Wenn der Chef vor den Finanzausschuss des Bundestags gehört,<br />
dann sollte Ackermann schleunigst den Flieger nach Berlin<br />
besteigen. Er gehört noch vor Anshu Jain zur Rede gestellt. Wenigstens<br />
das.<br />
Doch zur Rede gestellt werden die Verantwortlichen für den<br />
Endlosskandal der globalen Finanzwirtschaft derzeit lediglich<br />
von Journalisten, und zwar zur wortreichen Beschönigung. Man<br />
hofiert die Geldmächtigen wieder in den deutschen Redaktionen.<br />
Kaum ein Verlagssymposium zu Wirtschaftsfragen kommt<br />
noch ohne die Ehrenmänner der Geldkaste aus. Sie adeln erneut<br />
das Zeitungsgeschäft.<br />
Derweil fordern besorgte Strafrechtler immer ungeduldiger<br />
Konsequenzen für die Täter aus der Finanzwirtschaft. Auf einer<br />
Tagung der Bucerius Law School erklärte der Wirtschafts- und<br />
Strafrechtsprofessor Thomas Rönnau: „Es wäre fatal, würde in<br />
der Gesellschaft der Eindruck entstehen, die Finanzwirtschaft<br />
könne weitermachen wie bisher.“<br />
Es entsteht nicht nur der Eindruck – es ist so.<br />
Der prominente Hamburger Strafverteidiger Gerhard Strate<br />
sagt auch, weshalb: „Überwiegend zurückhaltende Staatsanwaltschaften<br />
und eine zahnlose Strafrechtswissenschaft haben ihren<br />
Anteil daran.“<br />
Kulturwandel? Offenbar nichts als eine weitere Worthülse auf<br />
dem rhetorischen Müllberg. Sie liegt dort gleich neben der Verantwortung,<br />
nicht weit von der Leistung, und rottet vor sich hin.<br />
Kulturwandel, Kulturschwindel.<br />
F RANK A . MEYER<br />
ist Journalist und Gastgeber der<br />
politischen Sendung „Vis-à-vis“ in 3sat<br />
Anzeige<br />
<strong>Die</strong><br />
Jubiläumsausgabe<br />
Jetzt am Kiosk!
| S A L O N<br />
HEUTE EIN KÖNIG<br />
Fast im Alleingang: Sabin Tambrea spielt die Hauptrolle in der Neuverfilmung des Lebens von Ludwig II<br />
VON IRENE BAZ INGER<br />
D<br />
ER „KINI“ IST SEIN SCHICKSAL: Sabin<br />
Tambrea sieht dem legendären<br />
König Ludwig II von Bayern<br />
selbst ohne Maske und Kostüm verblüffend<br />
ähnlich, ist genauso groß und leicht wie jener<br />
bei seinem Amtsantritt 1864. Und den<br />
schönen Künsten ist er ebenfalls kompromisslos<br />
ergeben. Kein Wunder, dass man in<br />
den Besetzungsbüros auf ihn aufmerksam<br />
wurde, als das Regie-Duo Peter Sehr und<br />
Marie Noëlle den Film „Ludwig II“ plante<br />
(Kinostart 26. Dezember). Aufgeregt war er<br />
bei den Castings schon, sagt Tambrea beim<br />
Gespräch in einem Berliner Lokal, „doch<br />
durch das, was ich zu diesem Zeitpunkt<br />
vom König wusste, vor allem über seine<br />
unendliche Liebe zur Kunst und sein Streben<br />
nach dem Unerreichbaren, hatte ich<br />
so ein stilles Einverständnis mit ihm. Dadurch<br />
fiel es mir nicht schwer, die Probeszenen<br />
einfach instinktiv aus mir heraus zu<br />
spielen. Da war nichts, was von mir sehr<br />
weit entfernt gewesen wäre.“<br />
Das merkt man dem fertigen Film auch<br />
fulminant an, den Tambrea in unglaublich<br />
souveräner Weise nahezu im Alleingang<br />
zwei Stunden lang trägt. Ein Jahr hat er<br />
sich auf diese Rolle vorbereitet, vier Monate<br />
Reitunterricht genommen und an Sekundärliteratur<br />
gelesen, was möglich war. In<br />
Konkurrenz zu O. W. Fischer (bei Helmut<br />
Käutner, 1955) und Helmut Berger (bei<br />
Luchino Visconti, 1972) begreift er sich allerdings<br />
nicht: „Wir haben uns auf andere<br />
Aspekte der Figur konzentriert und wollten –<br />
durch den Schnitt, die Art der Sprache und<br />
der Bewegungen – einen modernen Ludwig<br />
für neue Generationen kreieren.“<br />
Sabin Tambrea nimmt es gelassen, dass<br />
er in den nächsten Monaten, vielleicht sogar<br />
Jahren, mit dieser Rolle identifiziert<br />
werden wird. Er wirkt zurückhaltend, fast<br />
scheu, dabei aber sicher in dem, was er will.<br />
So musste er am Anfang die Absagen von<br />
mehreren Schauspielschulen verkraften –<br />
und ließ sich nicht beirren: „Ich dachte<br />
mir, dann hat die Prüfungskommission<br />
halt noch nicht gesehen, was in mir drinsteckt.“<br />
Voll Euphorie schaffte er es an die<br />
renommierte Hochschule für Schauspielkunst<br />
„Ernst Busch“, von wo ihn Claus<br />
Peymann 2009 gleich an sein Berliner Ensemble<br />
engagierte. Dass sich hierzulande<br />
„<strong>Die</strong> Musik ist die Grundessenz<br />
meines schauspielerischen Berufs“<br />
Sabin Tambrea<br />
nur rund 3 Prozent aller Darsteller von ihrem<br />
Beruf ernähren können, hat der hoch<br />
begabte Aufsteiger nicht vergessen.<br />
Einen Vorgeschmack auf die prekären<br />
Bedingungen in seinem Metier erfuhr er direkt<br />
im Anschluss an die Drehzeit zu „Ludwig<br />
II“. Nach der letzten Klappe musste<br />
er aufs Arbeitsamt, denn am Berliner Ensemble,<br />
wo er wegen des Filmes gekündigt<br />
hatte, war eine Weile nichts für ihn<br />
frei. <strong>Die</strong> Umstellung von den königlichen<br />
Märchenschlössern, in denen nachts gedreht<br />
wurde, wenn der letzte Tourist abgezogen<br />
und die erste Putzkolonne noch<br />
nicht eingetroffen war, zurück in Sabin<br />
Tambreas Berliner Leben, „in dem ich meinen<br />
Kühlschrank füllen und die anderen<br />
Dinge des Alltags bewältigen muss“, war<br />
nicht leicht. Auch psychisch traf ihn ein<br />
veritabler Schmerz, „schließlich lässt man<br />
die Figur, die man spielt, äußerst nahe an<br />
sich heran. Und dann muss man sie gehen<br />
lassen, und das tut schon weh.“<br />
Jetzt gehört er wieder zum Berliner Ensemble<br />
und kann unter der Regie von Katharina<br />
Thalbach in Shakespeares „Was ihr<br />
wollt“ selbst auf der Geige glänzen. Früher<br />
beherrschte er dieses Instrument respektive<br />
die Bratsche dermaßen gut, dass er diverse<br />
Preise beim Wettbewerb „Jugend musiziert“<br />
gewann. Aber irgendwann musste er aufgeben,<br />
weil er aus Angst vor den öffentlichen<br />
Auftritten in der Garderobe oft ohnmächtig<br />
wurde. Hingegen geigen seine Schwester<br />
und Eltern in verschiedenen deutschen<br />
Orchestern.<br />
<strong>Die</strong> Familie stammt aus Rumänien, wo<br />
Tambrea 1984 geboren wurde. Während<br />
einer Konzertreise blieb der Vater in Österreich,<br />
weshalb bei seinen Angehörigen<br />
daheim der Geheimdienst klingelte und Einzelheiten<br />
wissen wollte. Der Vater holte über<br />
das Familienzusammenführungsprogramm<br />
Frau und Kinder 1986 nach, Tambrea wuchs<br />
in Marl und Hagen auf. <strong>Die</strong> Musik ist die<br />
„Grundessenz meines schauspielerischen Berufs“,<br />
sagt er, sie hilft ihm, jede Rolle jenseits<br />
der sprachlichen Bedeutungsebene wie<br />
eine Partitur zu lesen, ihre Pausen, Rhythmen,<br />
Spannungsbögen zu erforschen. Neben<br />
Deutsch und Rumänisch nennt er die<br />
Musik seine dritte Sprache. Doch wie auch<br />
immer er sich ausdrückt, bisher ist ihm eigentlich<br />
alles gelungen – was natürlich seinen<br />
Preis hat. Als er etwa die Zusage für den<br />
Part des Königs Ludwig erhalten hatte, war<br />
das „einer der traurigsten Momente“ in seinem<br />
Leben: weil der Traum in Erfüllung gegangen<br />
und damit verloren war. Jetzt tut er<br />
sich nach neuen Träumen um und hofft, „im<br />
ständigen Wechselbad zwischen Sehnsucht<br />
und Erfüllung“, das ihn emotional charakterisiert,<br />
bald wieder ein Glück zu finden.<br />
Vielleicht ja in der Inszenierung von Robert<br />
Wilson im April am Berliner Ensemble mit<br />
der nächsten Aufgabe, die ihm wie auf den<br />
zartgliedrigen Leib geschneidert scheint: Peter<br />
Pan, der ewige Träumer. Angst? Nein, lächelt<br />
Sabin Tambrea, es wird wie stets bei<br />
ihm sein: „Ich steige einfach aufs Seil und<br />
gucke, wie weit ich komme.“<br />
IRENE BAZ INGER<br />
ist Theaterkritikerin. Sie schrieb<br />
Bücher über die Regisseurinnen<br />
Andrea Breth und Ruth Berghaus<br />
FOTOS: GÖTZ SCHLESER FÜR CICERO, MAX LAUTENSCHLÄGER (AUTORIN)<br />
108 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Seiltänzer auch ohne<br />
Seil: Sabin Tambrea<br />
vor herbstlicher<br />
Kulisse des Bahnhofs<br />
Friedrichstraße in Berlin<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 109
| S A L O N<br />
OHNE PATHOS KEIN LEBEN<br />
Krassimira Stoyanova ist die große Unbekannte der Opernwelt – im Verdi-Jahr zeigt sie ihr ganzes Können<br />
VON EVA GESINE BAUR<br />
D<br />
IE NEW YORKER OPERNFANS werden<br />
enttäuscht sein. Wenn sie im<br />
März des Verdi-Jahres 2013 im<br />
Internet nach Bildern, Plattenaufnahmen<br />
und Interviews mit der Frau suchen, die<br />
in sechs Aufführungen an der Met als Desdemona<br />
in Verdis Otello umjubelt wurde,<br />
werden sie nicht viel finden. Wenige CDs<br />
bei kleinen Labels, kaum Fotos, fast keine<br />
Interviews. Nur ein paar Kritiken, die sich<br />
alle ähnlich lesen – ob sie von einer Aufführung<br />
in der Londoner Covent Garden<br />
Opera, bei den Salzburger Festspielen oder<br />
in der Wiener Staatsoper handeln: Sie war<br />
die Königin des Abends, diejenige, die alle<br />
überstrahlte. Das wurde schon vor zehn,<br />
15 Jahren geschrieben über Krassimira<br />
Stoyanova. Aber ihr Gesicht kennt nach<br />
wie vor kaum einer. Was macht diese Frau<br />
falsch?<br />
Auf dem Flur in der Wiener Staatsoper<br />
sieht sie aus, als käme sie von einem Spaziergang<br />
auf dem Land. Ausgeruht, ungeschminkt,<br />
in stabilen Stiefeln und Wollmantel.<br />
Dabei hat Krassimira Stoyanova<br />
gerade eine vierstündige Probe hinter<br />
sich. Fotografiert werden will sie nicht. In<br />
den Augen ihrer jungen Kollegin Annette<br />
Dasch macht diese Frau alles richtig. „Ich<br />
bewundere große Sängerinnen, denen es<br />
gelingt, ganz unauffällig zu leben.“ Stoyanova<br />
gehört dazu. Alles Äußerliche der Karriereplanung<br />
sei ihr fremd, behauptete die<br />
Süddeutsche Zeitung. Was trieb sie dann<br />
an, Opernsängerin zu werden, nicht gerade<br />
ein Beruf für Schüchterne? „Der Zufall“,<br />
sagt sie. „Eigentlich wollte ich Geigerin<br />
werden.“ An der Musikhochschule<br />
im bulgarischen Plovdiv hatte sie drei Fächer<br />
studiert: Violine, Dirigieren und Gesang.<br />
Wie ihr Mann, ein Oboist, begann<br />
sie ihre Laufbahn als Orchestermusikerin.<br />
Als die beiden erfuhren, dass in Opava, einer<br />
tschechischen Kleinstadt, dringend<br />
Instrumentalisten gesucht würden, packte<br />
sie die Aufbruchsstimmung. Noch dringender<br />
suchte man in Opava allerdings<br />
jemanden, der die Violetta in Verdis La<br />
Traviata singen kann. Stoyanova sagte zu.<br />
Der Saal entpuppte sich als Club, in dem<br />
es keine Bühne gab und kein Orchester,<br />
nur ein Klavier. Dafür einen Ansager wie<br />
beim Boxkampf, der mit Geheul den Inhalt<br />
des nächsten Aktes ankündigte. Und während<br />
sich Violetta zwischen den Tischen<br />
ihrem Ende entgegenhustete, zechte das<br />
Publikum. „Es war schrecklich“, sagt sie,<br />
„aber für mich war es gut.“ Sonst hätte sie<br />
vielleicht nicht zu kämpfen gelernt. Gegen<br />
Dirigenten, die ihr einreden wollen, Arien<br />
von Mozart ohne jedes Vibrato zu singen –<br />
„eine Dummheit“. Oder Arien von Puccini<br />
in Tempi, die für ihr Empfinden nur für<br />
das Guinness-Buch der Rekorde taugen.<br />
Vor allem aber gegen Regisseure, die Verdi<br />
im Container transportieren wollen. „Ich<br />
hasse Inszenierungen, die Verdis Pathos<br />
kleinmachen. Ich kann nur mit Pathos leben.<br />
Ohne Pathos ist das Leben eine Behörde.<br />
Wir sind heute kastriert von großen<br />
Emotionen und fürchten sie, obwohl<br />
sie uns fehlen.“ Damit verstößt Krassimira<br />
Stoyanova gegen alle Gesetze des zeitgemäßen<br />
Marketings.<br />
Das ist ihr bewusst. Ein weiblicher<br />
Opernstar darf tätowiert und gepierct<br />
sein, darf sich das Haar grün färben und<br />
bei der Premierenfeier im Jogginganzug<br />
Bier aus der Flasche trinken. Darf auch<br />
dazu stehen, in Striptease-Lokale zu gehen<br />
wie Anna Netrebko. Nur uncool darf<br />
eine Opernsängerin, die heute etwas gelten<br />
will, nicht sein. Davon scheint Stoyanova<br />
nichts gehört zu haben. Befragt, was<br />
ihr an Puccini wichtig sei, schwärmt sie<br />
von „seiner Menschlichkeit, seiner Liebe,<br />
seinem Glauben an Gott“. Ihre Einspielung<br />
mit italienischen Arien heißt „I palpiti<br />
d’amor“, Herzklopfen der Liebe, und<br />
die ihr wichtigste bringt slawische Opernarien.<br />
Slawische Seele – coole Typen wissen<br />
da sofort Bescheid. Fügt sich ins Bild,<br />
dass Stoyanova Oper als „Gottesgeschenk“<br />
bezeichnet.<br />
Wenn Krassimira Stoyanova über Verdis<br />
Werke redet, hört sich das nicht kühler<br />
an. „Verdis Requiem“, sagt sie, „ist ein<br />
blutiges Gebet.“ Auch Verdis Opern erlebt<br />
sie als Rituale. Gewaltige, oft gewaltsame.<br />
Sie selbst möchte Teil davon werden. „Ich<br />
fühle mich wie jemand, der geopfert werden<br />
will.“ Sie macht eine Geste, als reiße<br />
sie sich das Gewand vorne auf. „Ich biete<br />
mich dar. Ich gebe mich preis. <strong>Die</strong> physische<br />
Macht von Verdis Musik entmachtet<br />
mich.“ Das ist hoffnungslos uncool.<br />
<strong>Die</strong> Kenner aber überzeugt sie durch<br />
vollendete Beherrschung der Stimme in<br />
jeder noch so extremen Situation. „Alle<br />
Kunst hat mit Rechnen und Berechnen<br />
zu tun. Am Anfang des Rollenstudiums<br />
steht die Analyse des Notentexts.“ Und wie<br />
verträgt sich das mit dem Pathos, wie mit<br />
der Lust an der Entmachtung? „Wir können<br />
doch alle so vieles gleichzeitig. Deshalb<br />
sind wir Menschen ideal geeignet für das<br />
Leben. Besser als jeder Computer.“<br />
Bei jeder der zwölf Verdi-Partien, die<br />
sie gesungen hat, und bei jeder neuen, die<br />
sie nun einstudiert, habe sie das Gefühl:<br />
„Das ist für mich geschrieben.“ Verdi war<br />
ein harter Rechner, der seinem Verleger<br />
Betrug nachwies, um Honorare feilschte –<br />
und als Komponist ein nüchterner Arbeiter.<br />
Zugleich stritt er für Sänger, die leidenschaftlich<br />
waren, und verabscheute alle,<br />
denen es nur darum ging, Töne „mit großer<br />
Kraft hervorzustoßen“. Ziel der Stoyanova:<br />
„Bei jeder Rolle mit Hirn und Herz zu erkunden,<br />
wo ihr Geheimnis liegt.“ Und wo<br />
liegt jenes der Stoyanova? Vielleicht in ihrem<br />
Rat an junge Sänger, keinen Druck<br />
auszuüben. Was die Stimme und was die<br />
Karriere angeht. Damit kommt man nicht<br />
in die Charts. Aber Verdi nahe.<br />
E VA G ESINE B AUR<br />
schreibt Bücher, die von Musik<br />
handeln. Soeben erschien unter<br />
ihrem Pseudonym Lea Singer der<br />
Roman „Verdis letzte Versuchung“<br />
FOTOS: JOHANNES IFKOVITS (LOCATION: HOTEL SACHER WIEN), PRIVAT (AUTORIN)<br />
110 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Cool geht anders: Krassimira<br />
Stoyanova setzt sich nur in Pose,<br />
wenn es unbedingt sein muss<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 111
| S A L O N | V E R D I & W A G N E R<br />
DIE SOUNDWERKER<br />
Im Jahr 2013 wird der 200. Geburtstag von Richard Wagner gefeiert – und der von<br />
Giuseppe Verdi. <strong>Die</strong> Rollen scheinen schon verteilt: Verdi als Latte-Macchiato-Komponist<br />
mit schmetternden Melodien, Wagner als deutschtümelnder Sinnsucher mit<br />
112 <strong>Cicero</strong> 1.2013
EUROPAS<br />
harmonischem Tiefgang. Doch die Geschichte zeigt, dass eine politische<br />
Vereinnahmung der beiden Jahrhundert-Künstler töricht ist. Denn keiner<br />
von ihnen hat je auf einen universellen, europäischen Geist verzichtet<br />
V ON AXEL B RÜGGEMA NN<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 113
| S A L O N | V E R D I & W A G N E R<br />
IM JANUAR 1901 rang Giuseppe Verdi<br />
in der Suite seines Mailänder Hotels<br />
mit dem Tod. Nach einer Gehirnblutung<br />
war er halbseitig gelähmt und<br />
fiel ins Koma. Journalisten hatten die<br />
Lobby zum Nachrichtenzentrum verwandelt<br />
und schickten täglich Gesundheitsbulletins<br />
über die Ticker. In Paris, München,<br />
St. Petersburg und Wien verfolgten die<br />
Menschen den Todeskampf. Am 27. Januar<br />
starb Verdi, und mehr als 200 000 Menschen<br />
nahmen am Trauerzug in<br />
Mailand teil. Es war die größte<br />
Massenversammlung in der Geschichte<br />
der Stadt. König Viktor<br />
Emanuel III rief eine dreitägige<br />
Staatstrauer aus. Der 17-jährige<br />
Benito Mussolini hielt eine ergreifende<br />
Trauerrede im Stadttheater<br />
von Forlimpopoli in Verdis Heimat,<br />
der Emilia-Romagna. Danach<br />
trat er, begleitet von Verdis<br />
Musik, den „Marsch auf Rom“ an<br />
und beerdigte das 19. Jahrhundert<br />
endgültig. Das Zeitalter der Extreme<br />
begann.<br />
18 Jahre vorher, am 13. Februar<br />
1883, glitt Richard Wagner<br />
im Palazzo Vendramin in Venedig<br />
die Taschenuhr aus der Hand.<br />
Eine Ruptur des Herzens. Er starb<br />
mit den profanen Worten: „Meine<br />
Uhr.“ Auch seine Beerdigung war<br />
ein europäisches Großereignis.<br />
Wagners Frau Cosima lag stundenlang<br />
weinend auf dem Leichnam.<br />
Am nächsten Tag trug sie das Barett<br />
ihres Mannes und beobachtete<br />
am Canale Grande, wie Richard<br />
Wagner seine letzte Reise in einem<br />
Bronze-Sarkophag auf einer<br />
schwarzen Gondel antrat. Ein italienisches<br />
Orchester spielte Siegfrieds Trauermarsch<br />
aus der „Götterdämmerung“. Der<br />
Leichnam wurde zunächst nach München<br />
gebracht, wo der längst lethargische Märchenkönig<br />
Ludwig II Abschied von seinem<br />
Freund nahm, bevor der Komponist im<br />
Garten seiner Bayreuther „Villa Wahnfried“<br />
neben seinem Hund begraben wurde. Cosima<br />
erhielt ein Kondolenzschreiben von<br />
Bismarck und Wilhelm II. Als der Kaiser<br />
1941 starb, befahl Wagner-Fan Adolf Hitler,<br />
dass die deutschen Volksempfänger Siegfrieds<br />
Tod spielen.<br />
Verdi und Wagner haben im 19. Jahrhundert<br />
gelebt, und das 19. Jahrhundert<br />
lebte in ihnen. Beide Komponisten haben<br />
den Soundtrack des nationalstaatlichen Europa<br />
geschrieben. Sie waren Kinder einer<br />
neuen Weltordnung, die nach ihrem Tod<br />
auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg zusteuerte.<br />
Ihre Musik besingt den Urmythos<br />
der Einheit aller Menschen und aller Nationen<br />
als Brüder Europas. Auch deshalb<br />
wird das kriselnde Europa der Ton-Titanen<br />
200 Jahre nach ihrer Geburt im Jahre<br />
1813 nun wieder gedenken. Galakonzerte<br />
„Egal, an welchem<br />
Ort in Europa ich bin,<br />
Verdi war schon da“<br />
Rolando Villazón<br />
in Riga, Bayreuth, Mailand, Dresden, Paris<br />
und Wien sind anberaumt. Kanzlerin<br />
Angela Merkel wird im Sommer Frank<br />
Castorfs „Ring“ bei den Bayreuther Festspielen<br />
besuchen und Italiens Staatspräsident<br />
Mario Monti eine Verdi-Gala in Mailand.<br />
Noch einmal wird die Politik die ganz<br />
große Oper anstimmen.<br />
DIE ROLLEN FÜR DAS JUBILÄUMSJAHR sind<br />
verteilt: Auf der einen Seite Verdi, der Latte-<br />
Macchiato-Komponist mit schwungvollen<br />
Melodien und schmetternder Italianità, auf<br />
der anderen der seelensuchende Wagner als<br />
deutschtümelnder Gesamtkunstwerkler.<br />
Verdi versus Wagner ist ein nationaler Showdown:<br />
Choco-Crossies-Reklame („Ach wie<br />
verführerisch!“ aus „Rigoletto“) gegen den<br />
Soundtrack von Apocalypse Now („Walkürenritt“).<br />
Melodie gegen Harmonie.<br />
Der Katholik Verdi gegen den Protestanten<br />
Wagner, der seine Musik in Bayreuth<br />
letztlich als Privatreligion inszenierte. Das<br />
kriselnde Schlageritalien Berlusconis gegen<br />
Angela Merkels europäische Vorherrschaft<br />
der Vernunft. Schon zu Lebzeiten<br />
haben die Komponisten Europa<br />
in einen ästhetischen Glaubenskrieg<br />
verwandelt, der selbst Monarchien<br />
spaltete: Während Österreichs<br />
Kaiser Franz Joseph Verdi<br />
allerhand Orden um den Hals<br />
hängte, schwärmte seine Frau Sissi<br />
für Wagners Seelenwelten.<br />
Wenn sich unsere Blicke nun<br />
wieder auf Verdi und Wagner richten,<br />
taugen nationale Stereotype<br />
allerdings nur wenig. <strong>Die</strong> Wirtschaftskrise<br />
und der Zerfall Europas<br />
in Nord und Süd, seine uferlose<br />
Ausweitung gen Osten, die<br />
aufkeimenden Neo-Nationalismen<br />
und das Ringen um Stabilität<br />
sind im 19. Jahrhundert ebenfalls<br />
angelegt. Für Merkel, Monti<br />
und alle anderen Europäer ist es<br />
hilfreich, in der Musik der Komponisten<br />
nicht das spaltende Nationale<br />
zu suchen, sondern das<br />
verbindende Europäische – denn<br />
beide haben sich zwar als Italiener<br />
beziehungsweise als Deutscher<br />
verstanden, aber als Europäer gelebt<br />
und musiziert. Beide haben<br />
das Ende Napoleons, die Vereinigung<br />
der Einzelstaaten, den Untergang<br />
der Monarchie und die<br />
Gründung einer neuen, europäischen Balance<br />
of Power miterlebt. Ihre Biografien<br />
sind die Geschichten des ständigen Wandels<br />
unseres Kontinents.<br />
Der Tenor Rolando Villazón ist gerade<br />
als Verdi-Botschafter unterwegs und sitzt in<br />
einem Wiener Café. Für ihn ist Verdi ein<br />
internationaler Menschenversteher: „Egal,<br />
an welchem Ort in Europa ich bin, Verdi<br />
war schon da. Hier in Wien, in Paris, wo<br />
ich wohne, und natürlich in Mailand – er<br />
war sogar in St. Petersburg. Von ihm zu lernen,<br />
heißt zu begreifen, dass seine Opern<br />
etwas in uns ansprechen, das größer ist als<br />
eine Nation. Es geht bei ihm – egal, ob er<br />
ILLUSTRATION: JAN RIECKHOFF (SEITEN 112 BIS 113); FOTO: DARGENT VINCENT/PICTURE ALLIANCE/ABACA<br />
114 <strong>Cicero</strong> 1.2013
FOTO: MAT HENNEK/DEUTSCHE GRAMMOPHON<br />
Könige auf die Bühne stellt oder Prostituierte<br />
– immer um eine aufgeladene Politik<br />
der Gefühle.“<br />
Ähnlich sieht es Christian Thielemann.<br />
Der wohl beste Wagner-Dirigent unserer<br />
Zeit sitzt in seinem Dresdener Dirigentenzimmer:<br />
„Natürlich bedient Wagner<br />
urdeutsche Sehnsüchte, die aufwühlende<br />
Harmonie statt die schmissige Melodie.<br />
Aber der eigentliche Spielort seiner Opern<br />
lässt sich nicht geografisch fassen. Wagner<br />
nannte ‚Tristan und Isolde‘<br />
eine ‚innere Handlung‘. Sie findet<br />
in den Köpfen seiner Charaktere<br />
statt. Das mag typisch deutsch<br />
sein – aber an diesem Ort, in der<br />
Nation der Seele, sind Franzosen,<br />
Italiener und Engländer ebenso zu<br />
Hause.“<br />
VERDI WURDE IN LE RONCOLE in<br />
Parma geboren, das von Napoleons<br />
Truppen besetzt war. Wagner<br />
im französisch belagerten Leipzig,<br />
wo – kurz nach seiner Geburt<br />
– eine halbe Million Soldaten<br />
aus über zwölf Ländern den<br />
Untergang Frankreichs eingeläutet<br />
haben. Beide wuchsen in einer<br />
Welt auf, die 1815 bei Walzer und<br />
Champagner am Grünen Tisch des<br />
Wiener Kongresses neu geordnet<br />
worden war. Österreich, Preußen,<br />
Russland und die neue französische<br />
Monarchie hatten zunächst<br />
kein Interesse an einer Einigung<br />
Italiens und Deutschlands. Italiens<br />
Norden, die Lombardei, Venedig,<br />
die Toskana, Salzburg und<br />
das Innviertel gingen an die Habsburger,<br />
in den südlichen Regionen,<br />
Neapel, Sardinien und Genua wurden<br />
die alten Dynastien wieder eingesetzt.<br />
Und auch Deutschland blieb zwischen Österreich,<br />
Preußen und zahlreichen Einzelstaaten<br />
geteilt. Eine wackelige Europäische<br />
Union, die bereits zerfiel, als Wagner und<br />
Verdi erste Erfolge feierten.<br />
<strong>Die</strong> beiden haben dem Protestbürgertum<br />
ihrer Zeit den Marsch geblasen. Sie haben<br />
die Emotionen als historische Größe<br />
begriffen und ihren Nationen eine Stimme<br />
für Europa gegeben. Chöre wie „Va, pensiero“<br />
aus „Nabucco“ oder die in Verträgen<br />
verstrickten Götter des „Ringes“ waren das<br />
Echo einer Bevölkerung, die von der Politik<br />
ausgeschlossen wurde.<br />
„Der eigentliche Spielort von<br />
Wagners Opern lässt sich<br />
geografisch nicht fassen“<br />
Christian Thielemann<br />
Italien und Deutschland saßen damals<br />
am Katzentisch Europas. Erst langsam entstanden<br />
nationale Identitäten. Wer Europa<br />
heute als Währungs-, Handels- oder politische<br />
Union versteht, muss begreifen,<br />
dass seine eigentliche Ordnung zunächst<br />
ein kultureller Prozess war. <strong>Die</strong> Italiener<br />
sprachen Anfang des 19. Jahrhunderts unterschiedliche<br />
Dialekte und dienten unterschiedlichen<br />
Herrschern. Höchstens<br />
die Opern Rossinis, Bellinis und Donizettis<br />
wurden als nationale Werke akzeptiert,<br />
mit denen sich ganz Italien identifizieren<br />
konnte. In Deutschland erweckten die Bücher<br />
der Gebrüder Grimm, die Opern Carl<br />
Maria von Webers und die Erinnerung an<br />
Mittelalter und Mythenwelten das nationale<br />
Bewusstsein. Erst aus dieser kulturellen<br />
Erweckung leitet sich der Anspruch auf<br />
eine politische Rolle der beiden Länder in<br />
Europa ab.<br />
Verdi und Wagner haben an die Geschichte<br />
und die Kultur ihrer Nationen<br />
appelliert. Sie haben schwarz-rot-goldene<br />
und grün-weiß-rote Töne geschrieben.<br />
Aber sie haben nie auf einen universellen,<br />
europäischen Geist verzichtet. Wagners<br />
Opern spielen nicht nur in Brabant und<br />
Nürnberg, sondern auch in England oder<br />
in der Mythenwelt. Verdi wählte Spanien,<br />
Ägypten oder Paris als Szenarien. Ihre Vorlagen<br />
fanden beide in der gesamteuropäischen<br />
Kulturgeschichte. Verdi bei Victor<br />
Hugo („Ernani“ und „Rigoletto“), Shakespeare<br />
(„Macbeth“ und „Otello“) und<br />
Schiller („I masnadieri“ und „Giovanna<br />
d’Arco“); auch Wagner ließ sich von<br />
Shakespeare, Schiller und Edward<br />
Bulwer-Lytton inspirieren.<br />
„DER NATIONALISMUS des 19. Jahrhunderts<br />
lässt sich nicht mit dem<br />
Nationalismus des 20. Jahrhunderts<br />
vergleichen – er ist die Perversion<br />
eines guten Gedankens“,<br />
sagt Thielemann. „Dass Hitler<br />
die Ouvertüre zu ‚Rienzi‘ auf<br />
Reichsparteitagen gespielt und<br />
die Bayreuther Festspiele zum nationalsozialistischen<br />
Wohnzimmer<br />
gemacht hat – all das kann man<br />
Richard Wagner nicht anlasten.“<br />
Und Villazón glaubt: „Dass Verdi<br />
den Menschen mit seiner Leidenschaft<br />
in den Vordergrund gestellt<br />
hat, macht ihn natürlich spannend<br />
für jeden Herrscher. Seine Musik<br />
ergreift uns, bewegt uns und stellt<br />
etwas mit uns an – aber die Geschichte<br />
hat gezeigt, dass sowohl<br />
die politische Okkupation Verdis<br />
als auch die von Wagner keinen<br />
Bestand hatten. Ihre Opern sind<br />
größer als jede Ideologie.“<br />
Weder Verdi noch Wagner haben<br />
nationalistische Machwerke<br />
oder tagespolitische Polit-Opern<br />
komponiert. Verdi hat mit „La<br />
battaglia di Legnano“ zwar den Sieg Italiens<br />
über Barbarossa gefeiert und damit<br />
ein Statement für den Risorgimento, die<br />
italienische Einheitsbewegung, abgegeben;<br />
Wagner hat in „Rienzi“ die Stimmung<br />
des Vormärzes aufgegriffen und in<br />
den „Meistersingern“ Deutschland über<br />
das welsche Frankreich erhoben. Aber beiden<br />
war – trotz unterschiedlicher musikalischer<br />
Mittel – eine andere Vision wichtiger:<br />
die Ausweitung des kulturellen Ausdrucks,<br />
die Verbindung von Schauspiel und Musik,<br />
von Geschichte und Gegenwart, von<br />
Kulisse, Malerei und Klang. Ihr Theater<br />
sollte bewegen. Das Publikum sollte zum<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 115
| S A L O N | V E R D I & W A G N E R<br />
Teil der Aufführung werden. Es ist kein Zufall,<br />
dass beide für den sozialistischen Theoretiker<br />
Giuseppe Mazzini schwärmten. Er<br />
verfasste – natürlich auf Französisch – eine<br />
„Philosophie der Musik“ und forderte die<br />
„Vereinigung der Jugend Europas“. Seine<br />
Grundidee war nicht nur der Nationalstaat,<br />
sondern eine uralte, europäische Philosophie<br />
des antiken Griechenlands: Kunst und<br />
Musik sollten Teil der Politik werden.<br />
Verdi nannte diese neue Form der Oper<br />
„Musikdrama“, Wagner bevorzugte das<br />
Wort „Gesamtkunstwerk“. Beide meinten<br />
die kulturelle, politische Verantwortung<br />
der Kunst – und forderten damit auch<br />
die ästhetische Verantwortung der Politik.<br />
Verdi und Wagner haben keine Musik-Politik<br />
im Sinne von Merkel, Monti oder<br />
Hollande gemacht. Sie waren eher Aktivisten<br />
von Attac, Occupy und Amnesty<br />
International.<br />
Schließlich waren selbst nationale Revolutionen<br />
im 19. Jahrhundert auch internationale<br />
Revolutionen. Der russische<br />
Freiheitskämpfer Michail Alexandrowitsch<br />
Bakunin, ein vollbärtiger Grantler, war einer<br />
dieser Terrorismus-Touristen. Er hatte<br />
in Russland gezündelt und tingelte von<br />
Prag über Polen nach Italien. In Dresden<br />
traf er auf Wagner und machte ihn zum<br />
Mitorganisator des schwarz-rot-goldenen<br />
Aufstands. <strong>Die</strong> europäischen Nationalrevolutionen<br />
waren Proteste gegen die Politik<br />
des Grünen Tisches vom Wiener Kongress.<br />
Italiener und Deutsche forderten<br />
neue Grenzen. Und wenn Europapolitiker<br />
heute von Griechenland-Hilfe, Spanien<br />
oder Italien reden, lohnt es sich, bei<br />
Wagner und Verdi nachzuhören: Sie wussten,<br />
dass sich Europa keine Völker „zweiter<br />
Klasse“ leisten konnte.<br />
„Man darf nicht vergessen, dass das<br />
Politische für Wagner oft privat begründet<br />
war“, sagt Christian Thielemann, „er<br />
hat Allianzen mit den Revolutionären des<br />
Vormärzes oder mit Königen wie Ludwig<br />
II geschmiedet, um sein eigentliches,<br />
persönliches Ziel voranzutreiben: das Gesamtkunstwerk.<br />
Und dieses Verständnis<br />
von Politik hat er auch in seinen Opern<br />
behauptet. Wotan scheitert nicht an einem<br />
politischen System. Er scheitert als Gott<br />
an seiner Zerrissenheit zwischen menschlichen<br />
Gefühlen und Macht.“ Ähnlich sieht<br />
es Rolando Villazón: „Verdis Kunst besteht<br />
darin, Machtpolitik auf private Emotionen<br />
zu reduzieren: Radames, Ernani und Otello<br />
sind Politiker, die als Menschen vor Konflikten<br />
stehen. Politik war für Verdi nicht,<br />
was wir heute als Politik begreifen. Es ging<br />
ihm nicht um Parteien und Regierungskoalitionen.<br />
Der Anfang aller Politik war für<br />
ihn der Umgang eines Menschen mit einem<br />
anderen.“ Kurz gesagt: Ein König, der<br />
seine Frau schlägt, kann kein Land regieren.<br />
UND SO IST ES KEIN ZUFALL, dass sich Wagners<br />
und Verdis Biografien dort trennen,<br />
wo sie privat werden. Wo zwei verschiedene<br />
Lebensumstände auf die gleiche Weltpolitik<br />
treffen. Wo jener „Weltgeist“ entstand,<br />
den die beiden bei Hegel kennengelernt haben<br />
und in ihre Opern holten. Verdi war<br />
ein erfolgreicher Aufsteiger aus kleinen<br />
Verhältnissen, seine Opern<br />
waren längst Bestseller, und<br />
er hatte allerhand zu verlieren.<br />
Also setzte er in Zeiten<br />
der Revolution seinen Zylinder<br />
auf und schloss realpolitische<br />
Kompromisse.<br />
Zwar besorgte auch er tödliche<br />
Gewehre für den Risorgimento,<br />
pflegte aber<br />
gleichzeitig weiter Kontakte<br />
zu Königshäusern in<br />
ganz Europa. Richard Wagner<br />
steckte derweil in einer privaten Schuldenfalle.<br />
Seine Verschwendungssucht überstieg<br />
das Kapellmeister-Gehalt in Dresden.<br />
Und während Verdi gemütlich durch die<br />
Pariser Wirren schlenderte, Zeitung las<br />
und Kaffee trank, hoffte Wagner, dass die<br />
Revolution seine privaten Probleme lösen<br />
würde. Er forderte unter Pseudonym die<br />
Abschaffung des Geldes, setzte sein Barett<br />
auf, stieg auf Gottfried Sempers Revolutions-Barrikaden,<br />
besorgte Handgranaten<br />
mit fataler Wirkung und floh schließlich<br />
gemeinsam mit Bakunin auf einer Kutsche<br />
aus der Stadt. Während der Profi-Revolutionär<br />
gefasst wurde, rettete sich Wagner<br />
ins Zürcher Exil.<br />
Nach den Aufständen erhoben beide<br />
die Provinz zum Zentrum ihrer Welt und<br />
verlegten die Revolution ins Private. Verdi<br />
hatte sich ein Landgut in Sant’ Agata gekauft.<br />
Wagner bezog die „Villa Rienzi“ in<br />
Zürich, die er sich von Franz Liszt und seinem<br />
Gönner Otto Wesendonck finanzieren<br />
ließ. Während der Italiener als komponierender<br />
Großbauer lebte, schrieb der<br />
Deutsche in parfümierter Seidenwäsche<br />
zunächst einmal kunstästhetische Traktate<br />
<strong>Die</strong> Oper im<br />
19. Jahrhundert<br />
funktioniert<br />
wie die<br />
Champions<br />
League<br />
und flirtete mit seiner Nachbarin Mathilde<br />
Wesendonck. Verdi holte derweil seine Geliebte,<br />
die Sängerin Giuseppina Strepponi,<br />
aufs Land. Wagners Affäre sorgte für die<br />
Trennung von Ehefrau Minna, und Verdis<br />
Liebschaft dafür, dass die Kirchenbank<br />
neben Giuseppina an Sonntagen leer blieb.<br />
Letztlich inspirierte Wagner und Verdi<br />
nicht die Politik, sondern das Private zu<br />
den größten musikalischen Revolutionen:<br />
Verdi schrieb – mit Blick auf Giuseppina<br />
– „La Traviata“, eine Oper über die<br />
wahre Liebe einer Lebedame. Wagner ließ<br />
sich von seinem Zürcher Techtelmechtel<br />
mit Mathilde zu „Tristan und Isolde“ inspirieren.<br />
Ein Epos über die Unmöglichkeit<br />
der irdischen Liebe. Für Christian Thielemann<br />
liegt hier die eigentliche<br />
Revolution. „Ich halte<br />
nichts davon zu wissen, ob<br />
Wagner Verdauungsstörungen<br />
hatte, um seinen ‚Tristan‘<br />
zu erklären. Mir geht es<br />
um die Musik. Und wenn<br />
wir über Revolutionen sprechen,<br />
müssen wir über den<br />
‚Tristan‘-Akkord reden! Hier,<br />
ausgerechnet in seiner intimsten<br />
Oper, hat Wagner<br />
den größten Affront hingelegt:<br />
Er hat das alte System von Dur und<br />
Moll aufgelöst und die Musiktheorie in<br />
eine neue Dimension katapultiert. Er hat<br />
den Klangkosmos so weit geöffnet, dass wir<br />
noch heute dastehen und staunen.“<br />
Von Verdi und Wagner zu lernen, bedeutet<br />
zu erkennen, dass das Private das<br />
Politische bestimmt. Und das Geld ein<br />
zentraler Teil des Privaten ist. Mehr noch:<br />
Wenn man Verdis und Wagners private<br />
Finanzsituation kennt, versteht man auch<br />
die Mechanismen der europäischen Währungsunion.<br />
Sowohl der sparsame Verdi als<br />
auch der verschwenderische Wagner wussten,<br />
dass sie sich gar keinen Nationalismus<br />
leisten konnten, wenn sie mit ihrer Kunst<br />
Geld verdienen wollten. Sie waren gezwungen,<br />
als europäische Weltbürger zu agieren.<br />
Ägypten zahlte Verdi eine astronomische<br />
Summe für „Aida“, und Wagner bot seinen<br />
„Tristan“ sogar in Brasilien an. <strong>Die</strong> Oper<br />
im 19. Jahrhundert funktionierte wie die<br />
Fußball-Champions-League; Ablösesummen<br />
und Marktwert kennen keine Grenzen.<br />
Verdi und Wagner kämpften um die<br />
gleichen Orte: Wien, München, St. Petersburg<br />
und vor allen Dingen: Paris!<br />
116 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Heute ist Europa ohne Berlin und Paris<br />
nicht zu denken, damals waren Wien<br />
und Paris die strategischen Zentren. Lange<br />
regierte der Italiener Gioachino Rossini an<br />
der Seine, dann der Deutsche Giacomo<br />
Meyerbeer. <strong>Die</strong> Könige hatten sich aus<br />
ihrer kulturellen Verantwortung zurückgezogen,<br />
und das Bürgertum bestimmte<br />
die Musik. Meyerbeer, der konvertierte<br />
Jude aus Tasdorf bei Berlin, schrieb gemeinsam<br />
mit seinem Librettisten Eugène<br />
Scribe populäre Ausstattungsopern. Paris<br />
erinnerte damals an das Berlin nach<br />
der Wende: Eine neue Stadt entstand,<br />
der Architekt Georges-Eugène Haussmann<br />
errichtete Markthallen, Bahnhöfe<br />
und – natürlich – Theater.<br />
Den ersten Angriff auf Meyerbeers Paris<br />
wagte Wagner. Aber er scheiterte und<br />
zog mit sarkastischen Grüßen von Heinrich<br />
Heine zurück in das „Kartoffelland“.<br />
Verdi plante seine Eroberung besser, nahm<br />
Meyerbeers Star-Librettisten unter Vertrag<br />
und wurde zum unangefochtenen Herrscher<br />
von Paris. Dabei kämpfte auch er<br />
mit heute fragwürdigen Mitteln. Von<br />
Wagner ist bekannt, dass er jüdische Zeitungen<br />
und Komponisten verantwortlich<br />
für sein Scheitern machte. Verdi selbst<br />
äußerte sich nie antisemitisch, das überließ<br />
er lieber seinem Verleger Léon Escudier.<br />
Der lästerte über die „Scharlatane“,<br />
die „mit einem Lächeln verzerrt vor Eifersucht“<br />
die Boulevards „verseuchten“.<br />
Auch diese dunkle Geschichte des internationalen<br />
Antisemitismus’ gehört (Verdis<br />
Preisung Jehovas am Ende von „Nabucco“<br />
zum Trotze) zur Gründung Europas im<br />
19. Jahrhundert.<br />
WAGNERS ZWEITER STURM auf Paris scheiterte<br />
ebenfalls. Sein „Tannhäuser“ floppte<br />
und wurde von Mitgliedern des reaktionären<br />
Jockey-Clubs sabotiert. „Allein daran<br />
sieht man, welche gesellschaftliche<br />
Wirkung die Musik haben kann“, sagt<br />
Christian Thielemann. „Plötzlich stritt<br />
Europa um Fortschritt oder Tradition.<br />
<strong>Die</strong> Musik hat eine Diskussion angezettelt,<br />
in der sich Paris, Mailand und Wien<br />
auch ästhetisch positionieren mussten.“ In<br />
den Salons wurde der Skandal der „Zukunftsmusik“<br />
debattiert, und Wagner, der<br />
Querulant, war plötzlich interessant. Auch,<br />
weil er zum Gegenentwurf Verdis stilisiert<br />
wurde. Dabei ging es nicht um Deutschland<br />
oder Italien, sondern um die Musik<br />
Anzeige<br />
<strong>Cicero</strong> empfiehlt:<br />
Unser Wein des Monats<br />
Tipp: Beim Kauf<br />
von 11 Flaschen<br />
erhalten Sie eine<br />
weitere gratis.<br />
Cabernet Franc Vin de Pays de la Cité de Carcassonne, 2011<br />
<strong>Die</strong>ser fruchtig-saftige Cabernet Franc reift zu 20 % in Barriques. Seine<br />
Aromen erinnern an Erdbeeren, Johannisbeerblätter, Blaubeeren, Rhabarber,<br />
Paprika und Tabak mit würzigen, zart süßlichen Noten. Ein Wein, der<br />
jetzt schon Spaß verspricht, aber noch viel Potenzial zeigt und durch Flaschenreifung<br />
noch deutlich gewinnen wird. <strong>Die</strong> Böden und das Klima um<br />
Carcassonne eignen sich besonders für den Anbau von Cabernet Franc.<br />
Preis je Flasche: 7,90 Euro, Bestellnr.: 930985<br />
Tipp: 12 Flaschen für nur 86,90 Euro, Bestellnr.: 931105<br />
(zzgl. Versandkostenpauschale von 7,95 Euro)<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
Telefon: 0800 282 20 04<br />
E-Mail: shop@cicero.de<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Online-Shop:<br />
www.cicero.de/wein
| S A L O N | V E R D I & W A G N E R<br />
als Systemfrage: Wie wollte Europa leben?<br />
Mit Sinn für Innovation oder mit Bewahrung<br />
des Alten?<br />
Jahrelang hatte Richard Wagner seinem<br />
Konkurrenten dessen fast spielerischen Erfolg<br />
geneidet, sich mit öffentlicher Kritik<br />
aber zurückgenommen. Und auch Verdi<br />
konnte sich Großmut leisten. Wagner<br />
schien keine Gefahr für ihn zu sein – eine<br />
intensive Beschäftigung mit ihm und seiner<br />
Musik schien nicht nötig. Wagners musiktheoretische<br />
Schriften lagen nach Verdis<br />
Tod noch immer mit ungeöffneten Seiten<br />
im Regal. Erst als die öffentliche Meinung<br />
kippte, Wagner als „fortschrittlicher Musiker“<br />
in Paris gefeiert wurde und Verdi sogar<br />
in Italien als rückständig galt, nahm er sich<br />
die Partitur des „Lohengrin“ vor und kommentierte<br />
einzelne Passagen. Nach Wagners<br />
Tod hat Verdi mit „Otello“ und „Falstaff“<br />
noch einmal eine Kraftanstrengung<br />
unternommen, um das Gesamtkunstwerk<br />
in seinem Sinne zu revolutionieren.<br />
Wagner und Verdi waren Titanen ihrer<br />
Zeit. Zu Mythen aber wurden sie erst<br />
nach ihrem Tod. Doch während Wagners<br />
Annektion durch Hitler heute allgegenwärtig<br />
ist, macht die Forschung einen Bogen<br />
um Verdis Vereinnahmung durch Mussolini.<br />
Schon als Kind schwärmte der „Duce“<br />
für den Komponisten, lernte Geige und betrieb<br />
auch nach der Trauerrede im Stadttheater<br />
von Forlimpopoli – nun vom Kommunisten<br />
zum Faschisten gewandelt – die<br />
Heroisierung des Komponisten: Zwischen<br />
1922 und 1943 erschienen über 20 faschistische<br />
Verdi-Biografien in Italien. Unter ihnen<br />
jene von Alessandro Luzio, der den<br />
Komponisten zum Vordenker des nationalistischen<br />
Italiens erhob. Vor jeder Verdi-<br />
Oper wurde die Faschisten-Hymne „Giovinezza“<br />
gesungen. Der Dirigent Arturo<br />
Toscanini war einer der wenigen, die das<br />
irritierte. Er brach mit Mussolini und dessen<br />
Italien und weigerte sich auch, in Bayreuth<br />
zu dirigieren, wo Winifred Wagner<br />
Hitler längst als „Onkel Wolf“ empfing.<br />
Während die Diktatoren Verdi und Wagner<br />
vereinnahmten, hielten Dirigenten wie<br />
Toscanini ihre eigentlichen Werte aufrecht,<br />
als sie deren Opern nun in New York dirigierten.<br />
Der Umgang mit den Komponisten<br />
im 20. Jahrhundert wurde zur Frage<br />
von Anstand und Moral.<br />
„Wie wir Verdi heute verstehen, sagt<br />
mehr über unsere Zeit aus als über das<br />
19. Jahrhundert“, sagt Rolando Villazón.<br />
„Das Besondere an der Oper ist, dass wir<br />
jeden Abend die gleichen Noten spielen –<br />
aber immer anders. Eine Partitur stellt uns<br />
jedes Mal vor die Aufgabe, eine Position zu<br />
beziehen. Musik ist eine Kunst mit zwei<br />
Schöpfungen. Eine hat in der Vergangenheit<br />
stattgefunden, eine zweite muss in der<br />
Gegenwart stattfinden. Und so sind die<br />
Partituren von Verdi ein historischer Fixpunkt.<br />
<strong>Die</strong> unterschiedlichen Interpretationen<br />
sind eine Möglichkeit, unsere Werte<br />
von Freiheit und Menschlichkeit zu überprüfen.<br />
Denn im Zentrum seiner Opern<br />
steht der Mensch mit seinen Emotionen –<br />
und der ist überzeitlich.“<br />
Auch Christian Thielemann hält die<br />
Musik lieber aus der Politik heraus: „Es ist<br />
doch Fakt, dass Wagners C-<br />
Dur immer gleich klingt –<br />
egal, ob Hitler in der Loge<br />
sitzt oder wir. Wir haben es<br />
mit einem kulturellen Erbe<br />
zu tun, das wir nur bewahren,<br />
wenn wir es spielen. Es<br />
ist unsere Verantwortung,<br />
Wagners Noten hörbar zu<br />
machen. Wie das Publikum<br />
auf die Musik reagiert, welche<br />
Aspekte es beschäftigt,<br />
und welche Konsequenzen<br />
es daraus zieht, steht auf einem ganz anderen<br />
Blatt. Das hat mehr mit unserer Zeit<br />
als mit der Musik zu tun. Unsere Zeit wird<br />
vergehen, Wagner aber wird bleiben.“<br />
HEUTE SIND DIE WERKE Wagners und Verdis<br />
Mythenschwämme. Sie haben den Ersten<br />
Weltkrieg, den Faschismus, den Kalten<br />
Krieg und das moderne Europa aufgesogen,<br />
wurden aus ihrer historischen Bedeutung<br />
herausgerissen und immer wieder in<br />
die Gegenwart geholt, annektiert, umgedeutet<br />
und zurückerobert. <strong>Die</strong> Phalanx der<br />
Staatschefs, unter denen die Komponisten<br />
dienen mussten, mutet absurd an: Könige<br />
stehen neben Diktatoren und Demokraten.<br />
Ludwig II erfüllte Wagners Opernträume,<br />
Bismarck erhob ihn zum Nationalkünstler,<br />
Hitler annektierte ihn als arischen Meister,<br />
und heute sucht Angela Merkel seine demokratischen<br />
Wurzeln und beschreitet den<br />
roten Teppich auf dem Grünen Hügel als<br />
Kultur-Catwalk der Bundesrepublik.<br />
So wie die Opern der beiden klingen,<br />
hört sich unsere Zeit an: Carusos Schmetterei<br />
auf dem Vorkriegsvulkan, Lauritz<br />
Melchiors Dreißiger-Jahre-Heldentum,<br />
Im Zentrum<br />
von Verdis<br />
Opern steht<br />
der Mensch<br />
mit seinen<br />
Emotionen<br />
Maria Callas’ Nachkriegs-Expressionismus,<br />
René Kollos Wirtschaftswunder-<br />
Glanz und Anna Netrebkos perfekte, moderne<br />
Pop-Oberfläche sind die Stimmen<br />
von Epochen. Bis heute zeigen Regisseure<br />
Verdi und Wagner gern als Revolutionäre<br />
bürgerlicher Konventionen. Türenschlagen<br />
und Gesellschaftsdebatten gehören zu jeder<br />
Inszenierung: Hans Neuenfels hat Aida<br />
1981 in Frankfurt als Putzfrau gezeigt, Peter<br />
Konwitschny das Autodafé aus „Don<br />
Carlos“ in Hamburg als Pausen-Divertissement<br />
mit Champagner inszeniert, und<br />
Calixto Bieito den „Trovatore“ zum Baracken-Flüchtlingsdrama<br />
stilisiert. Patrice<br />
Chéreau hat Wagners „Ring“-Götter vermenschlicht,<br />
Christoph Schlingensief reiste<br />
mit „Führerwein“ nach Bayreuth<br />
und suchte in Afrika<br />
nach Mythenwurzeln. Stefan<br />
Herheim hat seinen<br />
„Parsifal“ in der Villa Wahnfried<br />
unter dem Hakenkreuz<br />
angesiedelt, und Frank Castorf<br />
wird Wagner nun als<br />
Chefankläger der Ölmultis<br />
in Szene setzen.<br />
Oft sind von den Revolutionären<br />
des 19. Jahrhunderts<br />
heute nur noch Bühnenblut,<br />
Sängerschweiß und Regiesperma<br />
übrig. Auch, weil die Revolution im heutigen<br />
bürgerlichen Europa domestiziert<br />
ist. Weil der Skandal in die Kultur integriert<br />
wurde. Und: Weil Europa nach zwei<br />
Kriegen eine Balance gefunden, seine wirtschaftliche<br />
Abhängigkeit erkannt und seine<br />
gemeinsame Tradition entdeckt hat. Angela<br />
Merkel, Mario Monti und wir werden<br />
auch heute noch von Verdi und Wagner<br />
herausgefordert. Unser Blick auf sie<br />
bestimmt unseren Blick auf unsere Nationen<br />
und ihre Rolle in Europa. Ihre Opern<br />
zeigen uns, dass Politik mit dem Individuum<br />
beginnt, dass sie die souveräne Kulturnation<br />
braucht und eine Stabilität der<br />
einzelnen Staaten. Denn am Ende ist Nation<br />
keine Frage von nationaler Überheblichkeit,<br />
sondern von kultivierter europäischer<br />
Identifikation jedes Einzelnen.<br />
A XEL B RÜGGEMANN<br />
ist Journalist und Buchautor. Ende<br />
Januar erscheint von ihm „Genie<br />
und Wahn – <strong>Die</strong> Lebens geschichte<br />
des Richard Wagner“<br />
FOTO: PRIVAT<br />
118 <strong>Cicero</strong> 1.2013
<strong>Die</strong> Welt im Kopf<br />
NEU<br />
IM M AGAZIN FÜ R<br />
PSYCHOLOGIE UND<br />
HIRNFORSCHUNG<br />
• noch mehr praktische Ratschläge,<br />
die Sie persönlich weiterbringen<br />
• neue Rubriken:<br />
Kolumne von Dr. Eckart<br />
von Hirschhausen,<br />
Bild des Monats<br />
und Forscher im Profil<br />
• mehr Interviews und<br />
kompakte Artikel<br />
• weiterführende Literaturund<br />
Webtipps<br />
Bestellen Sie Ihr persönliches Gratis-Probeheft:<br />
www.gehirn-und-geist.de/couch<br />
gehirn-und-geist.de, service@spektrum.com, Tel. 06221 9126-743, Fax 06221 9126-751, Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, Slevogtstraße 3–5, 69126 Heidelberg
| S A L O N | M A N S I E H T N U R , W A S M A N S U C H T<br />
<strong>Die</strong> Kunst<br />
der freien Rede<br />
120 <strong>Cicero</strong> 1.2013
„Guten Abend, Herr <strong>Die</strong>kmann, ich rufe Sie an aus Kuwait, bin grad auf dem Weg zum Emir“: So beginnt die berühmtberüchtigte<br />
Sprachnachricht des damaligen Bundespräsidenten, die jetzt zum Kunstwerk geadelt wurde<br />
Der Berliner Maler Clemens von Wedel hat jene<br />
ominöse Botschaft, die der damalige Bundespräsident<br />
Christian Wulff in der Mailbox des Bild-Chefredakteurs<br />
hinterließ, auf sechs Leinwänden verewigt<br />
V ON B EAT WYSS<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 121
| S A L O N | M A N S I E H T N U R , W A S M A N S U C H T<br />
N<br />
E BIS IN IDEM, nicht zweimal für<br />
das Gleiche: Der Grundsatz aus<br />
dem Römischen Recht stehe als<br />
Motto über einer Bildbetrachtung, die,<br />
auf den ersten Blick, sich gegen Christian<br />
Wulff richtet. Nachtreten ist nicht nur<br />
unfair, es ist auch nicht rechtens.<br />
Aber haut denn Clemens von Wedel<br />
mit seinem Kunstwerk einfach nochmals<br />
in dieselbe Kerbe, wie schon die deutsche<br />
Presse im abgelaufenen Jahr? Der Künstler<br />
hat, Wort für Wort, in großen Lettern,<br />
die verhängnisvolle Mailbox-Nachricht<br />
des ehemaligen Bundespräsidenten an den<br />
Bild-Chefredakteur Kai <strong>Die</strong>kmann auf<br />
sechs große Bildtafeln gemalt. In seiner<br />
Botschaft hatte Wulff gebeten, die Zeitung<br />
solle die Veröffentlichung von Einzelheiten<br />
über einen Privatkredit (zumindest<br />
vorerst) unterlassen. <strong>Die</strong> Öffentlichkeit<br />
ist darüber inzwischen hinreichend informiert,<br />
es genüge hier die Erinnerung daran,<br />
dass jener Versuch präsidialer Beeinflussung<br />
vom 12. Dezember 2011 zu den<br />
belastenden Momenten gehörte, die das<br />
Staatsoberhaupt am 17. Februar 2012 zum<br />
Rücktritt bewogen.<br />
Der Vorwurf, dass Wulff mit dem<br />
Werk von Wedel noch einmal nachverurteilt<br />
wird, wäre dem Künstler dann zu<br />
machen, wenn Kunst und Journalismus<br />
das Gleiche wären. Gewiss können beide,<br />
Kunst und Presse, sich nur entfalten bei<br />
garantierter Meinungsfreiheit. Doch von<br />
dieser gemeinsamen Ebene an bohrt sich<br />
der Freiheitsbegriff in unterschiedliche<br />
Tiefen. <strong>Die</strong> Presse kämpft für die angewandte<br />
Freiheit öffentlicher Meinung. Sie<br />
verteidigt diese gegen Einflussnahme von<br />
jedweder politischen Couleur. Gründliche<br />
Information ist das bildende Fundament<br />
öffentlicher Meinung. Als vierte<br />
Gewalt ist die Presse mit ihrem Freiheitsbegriff<br />
eine staatstragende Institution.<br />
Künstlerische Freiheit hingegen bohrt<br />
sich in dunklere Zonen hinein, bis hinunter<br />
in das schwer Vermittelbare und Unzugängliche<br />
des machtlosen Subjekts. Kunst<br />
steht ein für das Recht des Individuums,<br />
in-dividuum, ungeteilte Person sein zu<br />
dürfen. Künstlertum vertritt die Figur des<br />
122 <strong>Cicero</strong> 1.2013
FOTOS: DANIEL BISKUP (SEITEN 120 BIS 124), ARTIAMO (AUTOR)<br />
Anderen, jenes Unteilbaren jenseits öffentlicher<br />
und veröffentlichter Meinung.<br />
Aus Kunstwerken spricht nicht Common<br />
Sense, welcher der Presse wohl ansteht,<br />
sondern Dissens. <strong>Die</strong> Politik der Kunst<br />
besteht darin, das Neinsagen zu üben und<br />
dessen Toleranz zu vermitteln. Als notwendige<br />
Kulturtechnik einer offenen Gesellschaft<br />
macht das Neinsagen-Können<br />
die angewandte Pressefreiheit erst möglich.<br />
Ihr Instrument ist das Schreiben, dazu<br />
da, gelesen werden zu können, so wie ein<br />
Bildkonsument auch ohne Kenntnis klassischer<br />
Poetik gern gerührt, erfreut und<br />
belehrt sein möchte. <strong>Die</strong>se Annehmlichkeit<br />
verschafft uns Wedel nicht. Denn<br />
hätte der Künstler den politisch brisanten<br />
Text nur gut leserlich aufbereitet, er hätte<br />
im Sinne der investigativen Presse gehandelt;<br />
das ist aber noch keine Kunst.<br />
Der Künstler macht Schrift und Malerei<br />
als Medien sichtbar, die sich durch Verfremdung<br />
gegenseitig stören. <strong>Die</strong> Lettern<br />
sind zu Wörtern zusammengefasst, die<br />
vor farblich wechselndem Grund einzeln<br />
skandiert sind, als würde jener Text, Wort<br />
für Wort, geschrien, gestammelt, buchstabiert.<br />
Das Werk wirkt als gestische Notation<br />
im Stil von Antonin Artaud, jenem<br />
mit Verrücktheit begnadeten und gequälten<br />
Schauspieler und Dichter. Er war<br />
ein Zeit- und Leidensgenosse von Adolf<br />
Wölfli, den Wedel seinen Lehrer nennt.<br />
Von diesem angeregt sind die bunten<br />
Wimmelbilder, die Text und Bild engmaschig<br />
miteinander verweben. Jahrzehntelang<br />
waren Artaud und Wölfli in Irrenhäusern<br />
interniert. Ihren Werken wird<br />
heute eine Wertschätzung zuteil, die den<br />
Schöpfern zu Lebzeiten verweigert war.<br />
„<strong>Die</strong> Würde des Menschen ist unantastbar“:<br />
Der erste Satz im Grundgesetz<br />
gilt für Artaud, für <strong>Die</strong>kmann, Wedel und<br />
Wölfli. Er gilt auch für den vor einem Jahr<br />
zurückgetretenen Bundespräsidenten.<br />
B E AT W Y S S<br />
ist einer der bekanntesten<br />
Kunsthistoriker des Landes.<br />
Er lehrt in Karlsruhe<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 123
| S A L O N | A L T E M U S I K<br />
DIE EWIGEN<br />
ZOMBIES<br />
Rock ’n’ Roll ist nicht tot, er riecht<br />
nur etwas streng: Von Led Zeppelin<br />
bis zu Neil Young beherrschen<br />
lauter Altvordere die Charts – aber<br />
der musikalische Manierismus<br />
hat seine Berechtigung<br />
VON A RNE WILLANDER<br />
E<br />
IN BLICK IN DIE CHARTS im Dezember<br />
2012: Led Zeppelin stehen<br />
ganz oben, dahinter die Rolling<br />
Stones, die vorher ganz oben<br />
standen, dann Joe Cocker und<br />
Rod Stewart. Im Buchhandel liegen Autobiografien<br />
von demselben Rod Stewart,<br />
von Neil Young und Pete Townshend –<br />
und ein dickleibiger Band mit sämtlichen<br />
Briefen, Telegrammen, Zetteln und Notizen<br />
von John Lennon, gekauft, ersteigert,<br />
geschnorrt und gesammelt von einem Authentizitätsfanatiker<br />
mit viel Zeit. Eben<br />
veröffentlicht wurden alle Vinyl-Schallplatten<br />
von The Who und den Beatles als<br />
originalgetreue Repliken, das Gesamtwerk<br />
von Johnny Cash im Schuber, die Platte<br />
„The Gift“ von The Jam aus dem Jahr 1982<br />
in einer Luxus-Edition. Und im März erscheint<br />
ein neues Album von Jimi Hendrix,<br />
aufgenommen 1968.<br />
Krise? Welche Krise? <strong>Die</strong> Plattenindustrie<br />
meldet erstmals seit der Jahrtausendwende<br />
leichte Gewinne, der Anteil<br />
von Schallplatten am Gesamtumsatz<br />
steigt, fast jedes Album wird in einer teuren<br />
Vinyl-Ausgabe aufgelegt. Während<br />
die Jugend die Tracks von Casting-Figuren<br />
aus Wolken herunterlädt, kaufen<br />
die Juvenilen von 1965 teure Plattenspieler<br />
und Lautsprecherboxen und hören<br />
neue Scheiben von Leonard Cohen,<br />
Neil Young und Donald Fagen. Und weil<br />
mit Konzerten heute mehr Geld verdient<br />
wird als mit CDs, befinden sich die Altvorderen<br />
auf einer Never Ending Tour:<br />
Bob Dylan natürlich, Bruce Springsteen,<br />
Donovan, Cliff Richard, die Beach Boys,<br />
Crosby, Stills & Nash, Leonard Cohen,<br />
Meat Loaf, The Cure. Und die Rolling<br />
Stones im 51. Jahr ihres Bestehens. Der<br />
Rock ’n’ Roll, hätte Frank Zappa gesagt,<br />
ist nicht tot – er riecht nur ein bisschen<br />
komisch.<br />
Das Lamento über die ewige Wiederkehr<br />
der Gleichen ist wohlfeil – denn wir<br />
laufen ja in einem Gemenge aus Sentimentalität,<br />
Neugier und Torschlusspanik immer<br />
wieder hin, wenn Neil Diamond singt<br />
oder Kris Kristofferson. Der Songschreiber<br />
Randy Newman, selbst 68 Jahre alt, konstatiert<br />
in seinem Song „I’m Dead (But I<br />
Don’t Know It)“: „Each record that I make<br />
is like a record that I made – just not as<br />
good.“ Bei Konzerten witzelt er, dass all die<br />
Bands noch unterwegs sind – und alle haben<br />
ihre Abschiedstourneen längst hinter<br />
sich: R. E. O. Speedwagon, Journey, Mötley<br />
Crüe, Chicago, die Scorpions. Nach den<br />
sechziger und siebziger Jahren wurden die<br />
Achtziger historisch-kritisch aufgearbeitet<br />
und zum „Kult“ reduziert, jetzt erscheinen<br />
die Neunziger als Fünf-CD-Box-Sets mit<br />
124 <strong>Cicero</strong> 1.2013
FOTOS: JIM DYSON/REDFERNS VIA GETTY IMAGES, PRIVAT (AUTOR)<br />
Bildband, Textbüchlein, Geleitwort und<br />
Aufnahmen aus der Werkstatt.<br />
Der englische Autor Simon Reynolds<br />
untersucht das Phänomen der nicht weichenden<br />
Vergangenheit in seinem Buch<br />
„Retromania“ und formuliert einige steile<br />
Thesen. In einer Überlegung setzt er die<br />
Popkultur parallel zum Finanzwesen: virtuelle<br />
Werte, windige Geschäfte, Handel<br />
mit immer neu verpackten Derivaten,<br />
steigende und fallende Kurse, Verlust des<br />
Überblicks – und irgendwann der Zusammenbruch<br />
des fragilen Systems. Doch der<br />
kühne Vergleich hinkt: Für die Popkultur<br />
hatte die letzte Stunde schon geschlagen,<br />
als CD-Brenner, MP3-Geräte und<br />
Tauschbörsen gegen Ende der neunziger<br />
Jahre das eben noch florierende Geschäft<br />
zunichtemachten. Im Jahr 2000 verkaufte<br />
die Gruppe N’Snyc in den USA zehn Millionen<br />
CDs. Seitdem erreichte kaum ein<br />
It’s only Rock ’n’ Roll<br />
(but I like it): <strong>Die</strong><br />
Rolling Stones geben<br />
sich auch ein halbes<br />
Jahrhundert nach ihrer<br />
Gründung noch viel<br />
Mühe auf der Bühne<br />
Album zwei Millionen Exemplare, bis die<br />
Sängerin Adele es im vergangenen Jahr auf<br />
mehr als fünf Millionen Einheiten brachte;<br />
Taylor Swift steht derzeit bei mehr als vier<br />
Millionen. Darunter sind freilich Downloads<br />
und Streams; aber es wird Geld<br />
verdient.<br />
Der beispiellose Aufstieg der Retro-<br />
Kunstfigur Lady Gaga zeigt, dass auch das<br />
Prinzip des Eklektizismus funktioniert. <strong>Die</strong><br />
Sex-Künstlerin Rihanna hat mittlerweile<br />
mehr Nummer-eins-Singles in den USA<br />
zu verzeichnen als Madonna und Whitney<br />
Houston, obwohl junge Menschen gar<br />
nicht wissen, was früher eine Single war.<br />
Zwar sind die Zeiten vorbei, da ein Songschreiber<br />
wie Jackson Browne sieben Millionen<br />
Stück von einem Album absetzen<br />
konnte, doch der globale Erfolg der schottischen<br />
Rumpel-Folk-Band Mumford &<br />
Sons belegt, dass es neue Retro-Phänomene<br />
gibt, die sich der Analyse entziehen: <strong>Die</strong><br />
gläubigen Musiker spielen herzzerreißend<br />
naive Weisen auf Waschbrett, Schlagzeug,<br />
Banjo und Flöte – in Stadien.<br />
Nach dem Triumph und Tod von Amy<br />
Winehouse wurden eine, zwei, viele Amys<br />
entdeckt – Retro-Soul war das Gebot der<br />
Stunde. Mit verhalltem Gesang und einer<br />
Bläser-Sektion im Stil der sechziger Jahre<br />
reproduzieren tüchtige Adepten den Sound<br />
der Supremes, der Ronettes, der Shirelles<br />
und Shangri-Las. Amy Winehouse war so<br />
gut und so verblüffend, weil sie die Songs<br />
auf den alten Platten kannte und internalisiert<br />
hatte – den Retro-Stil musste sie gegen<br />
ihre Plattenfirma durchsetzen. Heute singen<br />
die Mädchen bei „Deutschland sucht<br />
den Superstar“ den amerikanischen Soul<br />
der Sechziger.<br />
In der Kunst gibt es diese Rückbesinnung<br />
seit je – dort heißt sie Manierismus.<br />
Wir rekurrieren auf die alten Helden, weil<br />
wir das Authentische begehren, das gelebte<br />
Leben, die gemeinsame Geschichte,<br />
die Narben auf der Seele. Wir weinen bittere<br />
Zähren, wenn Donna Summer stirbt.<br />
Wir trauern um Robin Gibb. Wir legen<br />
alte Abba-Platten auf. Und in der Erinnerung<br />
wird das Konzert von R.E.M. immer<br />
besser. <strong>Die</strong> Rockmusik ist eine Nostalgieund<br />
Verklärungsmaschine, die uns zugleich<br />
eine ewige Gegenwart vorgaukelt und brutal<br />
daran gemahnt, dass die Einschläge näher<br />
kommen.<br />
Es spricht viel dafür, dass die Zukunft<br />
der Popmusik in der Gleichzeitigkeit liegen<br />
wird, im „Anything goes!“ Also dort,<br />
wo sie schon immer lag. Auch die nimmermüden<br />
Alten gehorchen nicht der billigen<br />
Etikettierung als „Vintage Rock“: Der<br />
ehemalige Schnulzensänger und Mädchenschwarm<br />
Scott Walker ist heute der konsequenteste<br />
Avantgardist, der enigmatische<br />
Hörspiele für ein seltsames Instrumentarium<br />
wie Schweinehälften und Krummsäbel<br />
komponiert. Auch dieser Sonderling<br />
plant, nach vier Jahrzehnten wieder<br />
auf Tournee zu gehen. Soll er nur! Wir rufen<br />
dann aber nach „The Sun Ain’t Gonna<br />
Shine Anymore“.<br />
ARNE WILLANDER<br />
ist stellvertretender Chefredakteur<br />
der deutschen Ausgabe des Musikmagazins<br />
„Rolling Stone“<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 125
| S A L O N | Z E I T E N W E N D E 1 9 1 3<br />
Berlin, Alexanderplatz<br />
im Jahr 1913: Der Puls<br />
der neuen Zeit macht sich<br />
auch an den öffentlichen<br />
Verkehrsmitteln bemerkbar<br />
126 <strong>Cicero</strong> 1.2013
DIE LETZTEN TAGE<br />
VOR DEM STURM<br />
1913 schließt sich das Tor zur Vergangenheit Alt-Europas und öffnet sich zugleich die Tür zu<br />
einer neuen Zeit – es ist das Jahr, in dem sich zwei Epochen in finaler Verdichtung berühren.<br />
Blicken wir darauf zurück, sehen wir ein Bild, das unserer heutigen Welt erstaunlich ähnelt<br />
VON KONSTANTIN S AKKAS<br />
FOTO: RUDOLF ALBERT/BPK IMAGES/STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN<br />
N<br />
OCH NIE IN DER GESCHICHTE hat sich die Welt in so kurzer<br />
Zeit so radikal verändert wie in den 100 Jahren<br />
zwischen 1913 und 2013. 1913 war das letzte Jahr des<br />
Ancien Régime: <strong>Die</strong> europäischen Großmächte waren,<br />
mit Ausnahme Frankreichs, monarchisch verfasst. Lediglich<br />
in England hatte das Parlament weitergehende Kompetenzen,<br />
aber selbst dort war das Königshaus einflussreich, wie sich<br />
in der Julikrise am Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 zeigte.<br />
<strong>Die</strong> Gesellschaft war, zumindest oberflächlich, vor allem noch<br />
ständisch gegliedert, noch immer bestimmte weitgehend die Geburt,<br />
ob man zu den privilegierten Kreisen aus Adel und Bürgertum<br />
zählte oder nicht. Unterbürgerlich – das waren 85 Prozent<br />
der Gesellschaft; die Eliten, insbesondere in Deutschland, rekrutierten<br />
sich aus einem Reservoir adliger und großbürgerlicher<br />
Familien, das sich zwar stetig, aber nur langsam erweiterte. <strong>Die</strong><br />
große Weltpolitik wurde von den fünf Großmächten England,<br />
Deutschland, Frankreich, Russland und Österreich-Ungarn bestimmt;<br />
die USA waren zwar damals schon, vor dem Deutschen<br />
Reich und Großbritannien, die Wirtschaftsmacht Nummer eins,<br />
pflegten aber ihre splendid isolation, die sie erst 1917, mit dem<br />
Eintritt in den Weltkrieg aufseiten der Entente, aufgeben sollten –<br />
dann aber, um im Handumdrehen die erste und lange Zeit einzige<br />
Supermacht der Welt zu werden.<br />
Asien spielte damals als Subjekt von Politik keine Rolle. Indien,<br />
heute eine kommende Weltmacht, war britische Kolonie,<br />
1911 hatte sich Georg V in einer bombastischen und sündhaft<br />
teuren Zeremonie zum Kaiser von Indien gekrönt. Japan machte<br />
seit dem 19. Jahrhundert ehrgeizige Versuche, in der Weltpolitik<br />
eine Rolle zu spielen, arbeitete sich aber vorerst an Russland ab,<br />
dem größten Staat der Erde, der, unterstützt durch die panslawistische<br />
Ideologie in Osteuropa, ein eurasisches Großreich ansteuerte,<br />
dessen innenpolitische Probleme aber dem Land keine Ruhe ließen<br />
und 1917 schließlich zur kommunistischen Revolution führten.<br />
Das kaiserliche China erwachte erst mit der Revolution 1911<br />
aus seinem jahrhundertelangen Dornröschenschlaf, und es sollte<br />
weitere 50 Jahre brauchen, bis es auf der Bühne der Weltpolitik<br />
als vollwertiger Player auftreten konnte; dennoch sprach man vorausahnend<br />
schon damals von der „gelben Gefahr“.<br />
In den europäischen Hauptstädten ahnte man, dass es mit<br />
der politischen Dominanz der Alten Welt bald vorbei sein würde.<br />
Nach außen freilich schien die alte Ordnung, die sich im 19. Jahrhundert<br />
vom Wiener Kongress 1815 über die bürgerlichen Revolutionen<br />
1848 bis zur deutschen Reichseinigung 1871 eingepegelt<br />
hatte, fest und unerschütterlich. „Ich führe euch herrlichen<br />
Zeiten entgegen“, hatte Deutschlands Kaiser Wilhelm II bei seinem<br />
Regierungsantritt 1888 verkündet, meinte damit aber eigentlich<br />
die „guten alten Zeiten“, von denen ganz Europa insgeheim<br />
hoffte, dass sie ewig dauern würden. Seit 1871 hatte zwischen<br />
den europäischen Mächten kein Krieg mehr stattgefunden; stattdessen<br />
Wirtschaftswachstum, langsame Öffnung der gesellschaftlichen<br />
Schranken, steigender Wohlstand auch für die klein- und<br />
unterbürgerlichen Schichten. Europa erlebte 1913 seine halkyonischen<br />
Tage.<br />
Andererseits ist 1913 ein vorweggenommenes 2013. <strong>Die</strong> Wirtschaft<br />
war damals international so sehr verflochten, wie es erst<br />
nach dem Ende des Kalten Krieges in den neunziger Jahren wieder<br />
der Fall sein sollte. <strong>Die</strong> weltweite familiäre und institutionelle<br />
Verflechtung vieler Industriellendynastien stammt aus eben<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 127
| S A L O N | Z E I T E N W E N D E 1 9 1 3<br />
Neue Verbindung: Das Telefon als moderne Kommunikationstechnik steht im Jahr 1913 nicht mehr<br />
nur Ämtern und Kontoren zur Verfügung, sondern erobert auch die privaten Haushalte<br />
jener Zeit; darin taten sie es den Monarchen gleich, deren Häuser<br />
untereinander heirateten und die durch dieses Konnubium<br />
die internationale Stabilität zu sichern schienen. <strong>Die</strong> ehemals<br />
stand- und rechtlosen Massen emanzipierten sich, die Arbeiterbewegung,<br />
1913 genau ein halbes Jahrhundert alt, hatte, anstatt<br />
blind gegen den Staat zu rebellieren, die Unterschicht behutsam<br />
an eben diesen Staat herangeführt, und der Erfolg der Sozialdemokratie<br />
bei der Reichstagswahl 1912 bewies eindrucksvoll, dass<br />
die Arbeiter zum Staat gehörten und Mitsprache bei der Leitung<br />
dieses Staates verlangten. Bismarcks Sozialgesetzgebung, in den<br />
1880er Jahren als Reaktion auf die erstarkende Sozialdemokratie<br />
begonnen, ebnete den Weg in den modernen Sozialstaat. Zum<br />
1. Januar 1900 war das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft getreten;<br />
es gilt noch heute.<br />
Vielleicht am deutlichsten werden die Gemeinsamkeiten von<br />
1913 und 2013 am Beispiel der technischen Entwicklung. 1913<br />
ist die Zeitscheide, der Dreh- und Angelpunkt in den 200 Jahren<br />
zwischen 1813, dem Jahr der Befreiungskriege, und 2013,<br />
dem Jahr der Eurokrise. 1813 schlief Europa noch den Schlaf der<br />
Gerechten; man heizte mit Holz, leuchtete mit Kerzen, reiste in<br />
der Postkutsche auf meistens schlecht oder gar nicht gepflasterten<br />
Straßen. Das Impfwesen stand ganz an seinem Anfang, Kindersterblichkeit<br />
und Unterernährung waren gang und gäbe. 1913<br />
dagegen war Europa von einem dichten Netz aus Eisenbahnlinien<br />
durchzogen, das Reisen mit dem Dampfzug war längst kein Privileg<br />
der Wohlhabenden mehr, in der Holzklasse saßen Arbeiter<br />
und einfache Soldaten auf dem Weg in ihre Garnison. 1813, nach<br />
der Völkerschlacht bei Leipzig, waren die siegreichen Monarchen<br />
zu Pferde in die eroberte Stadt eingeritten; 1913 ließ sich Kaiser<br />
Wilhelm II, ein Techniknarr wie alle großen Herren seiner Zeit,<br />
in der Mercedeslimousine chauffieren, auf dem Grill freilich nicht<br />
der Stern, sondern das Hohenzollernwappen.<br />
DIE MEDIZIN HATTE ungeheure Fortschritte gemacht, schon Rudolf<br />
Virchow hatte die erste erfolgreiche Herz-OP durchgeführt, Impfungen<br />
und eine immer professionellere Anästhesie verlängerten<br />
Jahr für Jahr die durchschnittliche Lebenserwartung. Der Tod im<br />
Wochenbett wurde seltener, es gab keine Epidemien mehr, und<br />
die Arbeiter verdienten zwar in der Regel immer noch schlecht,<br />
hatten aber wenigstens genug zu essen und konnten sich anständig<br />
kleiden. 1813 hatte man noch die Nachttöpfe in den Gassen<br />
ausgekippt, 1913 gab es großflächig funktionierende Kanalisationen<br />
und in immer mehr Wohnungen fließendes Wasser.<br />
Hungerperioden, die wie 1816, im „Jahr ohne Sommer“, noch<br />
ganz Europa heimgesucht hatten, gehörten nun der grauen Vorzeit<br />
an. Der europäische Mensch, der 1789 mit seiner Lebenswelt<br />
noch tief im Mittelalter gesteckt hatte, war 1913 in der Moderne<br />
angekommen.<br />
FOTO: SZ PHOTO/IMAGEBROKER<br />
128 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Motorkutsche: Kaiser Wilhelm II, ein Techniknarr wie alle großen Herrscher seiner Zeit, ließ sich in der Mercedeslimousine<br />
chauffieren; diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs<br />
FOTO: A. GROHS/PAUL THOMPSON/FPG/HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES<br />
Längst fuhr man in den Städten nicht mehr mit der Pferdedroschke,<br />
sondern mit der „Elektrischen“; überhaupt war Elektrizität<br />
die Technologie der Zukunft. Gaslaternen und Petroleumlampen<br />
verschwanden, bald erhellte elektrisches Licht die Straßen,<br />
Plätze und öffentlichen Gebäude. „Glühwürmchen, Glühwürmchen<br />
flimm’re“ – der Schlager von Paul Lincke tönte aus dem<br />
Grammofon in Tanzlokalen und Betrieben. Fotografie und Film<br />
waren die Medien der Zeit, und die Monarchen, allen voran der<br />
deutsche Kaiser, waren die ersten Medienstars. Überhaupt, die<br />
Medien: Wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch fleißig<br />
zensiert, so waren Zeitungen und Zeitschriften am Vorabend des<br />
Ersten Weltkriegs in der Unabhängigkeit angekommen. Zum<br />
ersten Mal in der europäischen Geschichte wurden Meinungen<br />
„gemacht“, Verleger waren nicht nur schwerreich und gehörten<br />
selbstverständlich zum Establishment, sondern konnten mit ihren<br />
Erzeugnissen Regierungen stürzen oder wenigstens – wie Maximilian<br />
Harden, der mit seiner „Zukunft“ 1906 die Eulenburg-Affäre<br />
auslöste und damit Kaiser Wilhelm II an den Rand der Abdankung<br />
brachte – in arge Bedrängnis versetzen. Das Analphabetentum<br />
war im Zuge der Industrialisierung so gut wie verschwunden,<br />
und so gab es zum ersten Mal wirklich so etwas wie eine öffentliche<br />
Meinung. Klassische Kabinettspolitik, wie Bismarck sie in seinen<br />
ersten Jahren als preußischer Ministerpräsident noch gemacht<br />
hatte, wurde da unmöglich. Auch deshalb geriet der Weltkrieg<br />
zum ersten modernen „Volkskrieg“: <strong>Die</strong> Massen waren informiert<br />
und wollten mitreden.<br />
Längst fuhr der reiche Landadel in Wien, Berlin und London<br />
im Sommer mit dem eigenen Automobil „auf die Länder“, die Industriellenfamilien<br />
von heute, ob Großkonzerne oder Mittelstand,<br />
legten vielfach in der Hochkonjunktur von 1900 das Fundament<br />
für ihren Reichtum. Das Geld, das heute die Welt regiert, ob in<br />
den USA oder in Europa, ist oft fünf oder sechs Generationen alt,<br />
seine Ursprünge liegen in jener Zeit des aggressiven Wirtschaftswachstums,<br />
zwischen 1815 und 1914 flankiert von einer Politik<br />
der „balance of power“ ohne größere kriegerische Zwischenfälle.<br />
Übrigens etablierte sich auch die Schweiz, um 1850 noch ein bitterarmes<br />
Land, als Nibelungenhort der Reichen und Mächtigen,<br />
die dort ihr Vermögen vor dem kommenden Gewitter in Sicherheit<br />
brachten; Österreichs schöne Kaiserin Elisabeth, die 1898 einem<br />
Mordanschlag zum Opfer fiel, war eine der Ersten, die in der<br />
Schweiz mit sicherem Instinkt ihre Millionen anlegte.<br />
Der Weltkrieg schließlich, der 1914 überraschend und zugleich<br />
von allen erwartet ausbrach, offenbarte vollends, dass man nicht<br />
mehr im 19. Jahrhundert lebte. Schon lange war das Telefon als<br />
erste Wahl in der Telekommunikation in den Ämtern und Kontoren,<br />
aber auch in den Häusern der Wohlhabenden angekommen.<br />
Im Krieg schlug dann die Stunde der drahtlosen Kommunikation.<br />
Wovon Leonardo da Vinci 400 Jahre zuvor geträumt<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 129
| S A L O N | Z E I T E N W E N D E 1 9 1 3<br />
FOTOS: CULTURE IMAGES/FAI, AKG IMAGES<br />
Künstlerische Avantgarde: Wassily Kandinsky (sitzend), Wegbereiter<br />
der Abstraktion, und Mitglieder der Gruppe „Blauer Reiter“<br />
hatte, war nun Realität: Man kämpfte nicht nur zu Wasser und<br />
zu Lande, sondern auch in der Luft und unter Wasser. Luft- und<br />
U-Boot-Waffe entschieden zwar nicht den Krieg, aber sie läuteten<br />
das Zeitalter der modernen Kriegstechnologien ein. Ihre kriegerische<br />
Nutzung wirkte, wie immer, als gewaltiger Katalysator auf<br />
die Entwicklung der Luftfahrt.<br />
Marcel Proust beschrieb in seinem Epos „Auf der Suche nach<br />
der verlorenen Zeit“ mit gruseliger Faszination die ersten deutschen<br />
Bombenangriffe auf Paris. <strong>Die</strong> Eröffnung des uneingeschränkten<br />
U-Boot-Kriegs durch das Deutsche Reich 1917 rief die USA auf<br />
den Plan und legte so eigentlich den Grundstein zur Weltmachtstellung,<br />
die Amerika, einmal aus seinem Isolationismus erwacht, in<br />
kürzester Zeit erringen sollte. Zugleich schuf er die Voraussetzung<br />
für die politische Entwicklung der kommenden 30 Jahre: Was den<br />
verbündeten Engländern und Franzosen auf den Schlachtfeldern<br />
zwischen Kanalküste und Schweizer Grenze in drei Jahren nicht<br />
gelungen war, schafften sie mit Hilfe der materiell himmelhoch<br />
überlegenen Amerikaner in sechs Monaten: Deutschland bat um<br />
Waffenstillstand, verlor seinen Kaiser und seine Landesfürsten und,<br />
wie sich zeigen sollte, seine innere Stabilität. <strong>Die</strong> Geburtsstunde<br />
des „Politikers“ Adolf Hitler hatte geschlagen.<br />
1913 ist das Jahr, in dem alte und neue Zeit einander in finaler<br />
Verdichtung berühren. Als am 24. Mai in der Reichshauptstadt<br />
Franz Marcs Gemälde „Der Turm der blauen Pferde“ stammt aus<br />
dem Jahr 1913 und wurde später als „entartet“ gebrandmarkt<br />
Berlin, die sich längst von der niedlichen biedermeierlichen Residenz<br />
zur Wirtschafts- und Kulturmetropole von internationalem<br />
Rang entwickelt hat, die Hochzeit der Kaisertochter Prinzessin<br />
Viktoria Luise mit dem braunschweigischen Thronprätendenten<br />
Prinz Ernst August von Hannover gefeiert wird, feiert sich zugleich<br />
das alte, monarchische Europa – es sollte die letzte glänzende Zusammenkunft<br />
der europäischen Fürsten sein, an ihrer Spitze Wilhelm<br />
II und seine beiden Cousins, König Georg V von England<br />
und Zar Nikolaus II von Russland. Anlässlich dieses Ereignisses<br />
entstand übrigens der erste Farbfilm und lieferte Bilder von Berlins<br />
festlich geschmücktem Prachtboulevard Unter den Linden,<br />
aufgesessenen Gardekürassieren in schimmernder Rüstung und<br />
mit schwarz-weißen Wimpelchen an ihren Paradelanzen. Auch da<br />
also eine Begegnung von Tradition und Moderne, genauso wie<br />
bei der Verkündung der Mobilmachung ein Jahr später: Mit altmodisch<br />
gesetzten Worten sprach der Kaiser, der den Krieg, genauso<br />
wie seine royalen Vettern, nicht wirklich gewollt hatte, zur<br />
Bevölkerung vor dem Berliner Stadtschloss: „Wir werden kämpfen<br />
bis zum letzten Atemzug von Mann und Ross“ – doch die Rede<br />
wurde mithilfe modernster Technik aufgezeichnet und ist als Tondokument<br />
bis heute überliefert. Und nicht mehr Rösser sollten<br />
im folgenden Krieg die Entscheidung bringen, sondern motorisierte<br />
Einheiten, Panzer und Giftgas.<br />
130 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Jetzt im Handel<br />
Das größte Wunder unserer Zeit:<br />
der Glaube daran.<br />
Weitere Themen<br />
Tiere im Bau<br />
Der Winterschlaf in Bildern.<br />
Berge im Nebel<br />
Mit Stefan Glowacz in den Wänden der Tepui.<br />
Russen im Eis<br />
Energie aus der Arktis.<br />
www.geo.de<br />
GEO. <strong>Die</strong> Welt mit anderen Augen sehen
WELT.DE/NEU<br />
<strong>Die</strong> Welt gehört denen,<br />
die schlau sind und<br />
nicht auf klug machen.
Z E I T E N W E N D E 1 9 1 3 | S A L O N |<br />
FOTO: PRIVAT<br />
Nach außen schien alles<br />
unerschütterlich. In den<br />
Hauptstädten aber ahnte<br />
man, dass es mit der<br />
Dominanz der Alten Welt<br />
bald vorbei sein würde<br />
So schließt sich 1913 das Tor zur Vergangenheit Alt-Europas<br />
und öffnet sich zugleich die Tür zu einer neuen Zeit, einer Zeit,<br />
wie es der Historiker Christian Graf von Krockow formulierte, die<br />
nicht mehr „Neuzeit“ ist, sondern eine neue, noch unbekannte<br />
und unbenannte Zeit. 1990 war nicht, wie Francis Fukuyama<br />
schrieb, das Ende der Geschichte, aber 1914 war der Abschluss<br />
der Neuzeit, die mit der Reformation und dem Einzug von Nationalstaat<br />
und Kapitalismus begonnen hatte – und gleichzeitig<br />
Beginn eines neuen Zeitalters, auf dessen Namen man sich wohl<br />
erst in den kommenden Generationen festlegen wird. Wenn wir<br />
Heutige auf 1913 schauen, so sehen wir ein Bild, das unserer Welt<br />
erstaunlich ähnelt, während die Jahrzehnte und Jahrhunderte davor<br />
verblassen, als gehörten sie zu einem anderen, längst vergangenen<br />
und vergessenen Strom in der Weltgeschichte.<br />
Doch die Gemeinsamkeiten zwischen heute und gestern reichen<br />
noch tiefer. 1913 ist das Abschlussjahr des „fin de siècle“, jener<br />
geistigen Strömung, die tief im 19. Jahrhundert, im früh modern<br />
gewordenen Paris erwachte und sich nach und nach über das<br />
ganze zivilisierte Europa ausbreitete. 1913 ist auch das eigentliche<br />
Geburtsjahr einer echten Weltliteratur: Oscar Wilde und Marcel<br />
Proust, Musil, Kafka und der junge Brecht, Schnitzler und Kraus,<br />
Rilke und Trakl, Stefan Zweig sowie, als melancholischer Nachklang,<br />
Joseph Roth – sie zusammen haben das neue Testament<br />
der mitteleuropäischen Literatur geschrieben, in einer Verdichtung<br />
von Stil, Ausdruck und philosophischem Gestus, die niemals<br />
wieder erreicht wurde und die die große Literatur bis in unsere<br />
Tage geprägt hat.<br />
DASSELBE GILT VON BILDENDER KUNST UND MUSIK. Der Expressionismus<br />
öffnete das Tor zu unserer heutigen Wahrnehmung von Kunst,<br />
die sich von der gefälligen Abbildung der Realität verabschiedet<br />
hat, um in die Tiefen der Seele zu steigen mit ihren Schlacken<br />
und ihrer unharmonischen Verbogenheit. Arnold Schönberg verabschiedete<br />
sich mit der Zwölftonmusik vom klassischen Ideal der<br />
Diatonik, wie es seit den Tagen Bachs bis zu Bruckner und Mahler<br />
unerschütterlich gegolten hatte. Wer immer vom 20. Jahrhundert<br />
spricht, bezieht sich auf 1913 und die Vorarbeiten, die damals<br />
die geistige Situation der Zeit prägten und eine Strömung lostraten,<br />
die noch heute, noch nach 100 Jahren, aktiv und mächtig ist.<br />
1913 ist das eigentliche Geburtsjahr der Moderne.<br />
Alles, was den europäischen Menschen von heute prägt und<br />
verstört – die ideologische Orientierungslosigkeit, das Gefühl von<br />
(wie es Hannah Arendt nannte) Weltlosigkeit, von absoluter Freiheit<br />
des Geistes, die aber eben zugleich völlige Halt- und Hilflosigkeit<br />
bedeutet, ist in jenem Schicksalsjahr 1913 angelegt. Unter<br />
ihrem Pionier Sigmund Freud, auf dessen Couch in Wien sich<br />
das halbe Großbürgertum „Kakaniens“ behandeln ließ, etablierte<br />
sich damals die Psychologie, die irrlichternde Wissenschaft von der<br />
menschlichen Seele, die sich bekanntlich keiner Wissenschaft erschließt,<br />
als Leitdisziplin der Moderne. <strong>Die</strong> Philosophie Friedrich<br />
Nietzsches, die keine Philosophie gewesen war, sondern ein einziger<br />
Hilfeschrei des erwachsen und damit standlos gewordenen<br />
modernen Menschen nach Orientierung und Halt, nach Glauben<br />
und Erlösung, beherrschte das europäische Denken in allen seinen<br />
Schattierungen und warf in seinen militanten, rassistischen Verhärtungen,<br />
die langsam, oben wie unten, in Mode kamen, erste<br />
dunkle Schatten. Und die Lehre von Karl Marx breitete sich mit<br />
unheimlicher Geschwindigkeit in der ganzen Welt aus, mit der<br />
Parole Schillers, die sie zur geschichtlichen Wirklichkeit erhob:<br />
„Zu was Besserem sind wir geboren!“<br />
Aber nicht in Europa zündete der bestrickende Gedanke<br />
von der Gleichheit aller Menschen, sondern in den Randmächten<br />
Russland und China – und genau diese Mächte sind es, die<br />
heute, nach 100-jährigem, strammem Aufstieg, nach etlichen Verwerfungen<br />
und ungeheuren Opfern, immer mehr den Ton in der<br />
Weltpolitik angeben. Gemeinsam mit dem Islam, der mit dem<br />
Zerbrechen des Osmanischen Reiches zu seinem geschichtlichen<br />
Selbstbewusstsein gelangte, das heute mit unheimlicher Macht<br />
seine Stimme erhebt. An diesem Zerbrechen aber, das in der Zeit<br />
Napoleons, 100 Jahre zuvor, seinen Anfang genommen hatte und<br />
dann schließlich auf dem Balkan seinen Kulminationspunkt erreichte,<br />
entzündete sich wiederum 1914 der Erste Weltkrieg – auch<br />
hier schließt sich der Kreis zwischen damals und heute, da der<br />
Orient durch die arabische Revolution endgültig das postkoloniale<br />
Zeitalter hinter sich lässt.<br />
<strong>Die</strong> Welt von 1913 war, wie der Heilige Augustinus<br />
1<strong>500</strong> Jahre zuvor, an einem anderen Epochenbruch, geschrieben<br />
hatte, „wie in einem Kelter“: Alles wurde infrage gestellt,<br />
alles durcheinandergewirbelt, Stabilität gab es nur noch äußerlich,<br />
in den wankenden Machtgebilden, die das 19. Jahrhundert<br />
hinterlassen hatte, die aber keinen wirklichen Halt mehr gaben,<br />
was die Eliten dieser Mächte am besten wussten. Der Sturm, der<br />
damals in den Höhlen hauste, um im Jahr des Kriegsausbruchs<br />
1914 loszubrechen, fegt auch heute noch durch die Welt, freilich<br />
mit anderer Richtung und mäßiger Geschwindigkeit. Doch die<br />
Ungewissheit von damals ist geblieben, mitsamt jenem brisanten,<br />
krisenhaften Gefühlscocktail aus Nervosität und Lethargie, aus<br />
Selbstbewusstsein und Angst, aus Aufklärung nach außen und<br />
Hilflosigkeit nach innen. Das abgeklärte Wissen um die Souveränität<br />
des Menschen in einer Weltgeschichte ohne göttliche<br />
Eingriffe, dieses Erbteil des 19. Jahrhunderts, haben wir bezahlt<br />
mit dem bangen Nichtwissen, wohin uns diese Geschichte führen<br />
wird – 1913 wie 2013.<br />
KONSTANTIN S AKKAS<br />
studierte Rechtswissenschaften, Philosophie und Geschichte.<br />
Als freier Autor schreibt er regelmäßig für <strong>Cicero</strong><br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 133
| S A L O N | B E N O T E T<br />
Eine Suite von<br />
Benjamin Britten<br />
Auch unser Kolumnist kennt Geschenkestress.<br />
Und erinnert sich an eine Anekdote des Jahrhundert-Cellisten<br />
Mstislaw Rostropowitsch<br />
V ON D ANIEL H O P E<br />
S<br />
OBALD DIE TAGE KÜRZER WERDEN, beginnt man sich über<br />
eine der großen Menschheitsfragen Gedanken zu machen:<br />
Was schenkt man bloß zu Weihnachten? Es gibt<br />
natürlich auch noch andere Welträtsel, die dringend gelöst werden<br />
müssten – „Wie war das mit dem Urknall?“ zum Beispiel. Aber<br />
kaum eine, die einen so beschäftigt. Erledigt man die Einkäufe<br />
bereits im Herbst und lässt sie gemütlich im Schrank verstauben?<br />
Oder gönnt man sich den Last-Minute-Stress am 24. Dezember?<br />
Spätestens Anfang des neuen Jahres, nachdem man die Festivitäten<br />
glimpflich überstanden hat, fragt man sich trotzdem, ob das<br />
eine oder andere Geschenk tatsächlich das richtige gewesen ist.<br />
Eine der schönsten Geschichten über das beinahe perfekte<br />
(Weihnachts-)Geschenk wurde mir vor Jahren vom legendären<br />
Cellisten Mstislaw Rostropowitsch gebeichtet. „Slava“, wie ihn<br />
fast die halbe Welt liebevoll nannte, gehörte nicht nur dank seines<br />
fulminaten Spiels, sondern auch aufgrund seiner ebenso fulminanten<br />
Persönlichkeit zu den inspirierendsten Menschen des<br />
20. Jahrhunderts. Bei seinem viel zu frühen Tod im Jahr 2007 hinterließ<br />
er eine riesige Lücke in der Musikwelt, die bisher niemand<br />
füllen konnte. Er war eng befreundet mit den größten Komponisten<br />
seiner Zeit, von Prokofjew und Schostakowitsch bis hin zu Leonard<br />
Bernstein und Witold Lutosławski, die allesamt Werke für<br />
ihn geschrieben haben. Fast jeder Musiker, mich eingeschlossen,<br />
hat ihn bewundert und geliebt. 1971 wurde vom sowjetischen<br />
Regime ein Ausreiseverbot über ihn verhängt, weil er den Literaturnobelpreisträger<br />
Alexander Solschenizyn bei sich zu Hause<br />
aufnahm. 1974 kehrte er der Sowjetunion den Rücken und setzte<br />
sich auf bewundenswerte Art und Weise für die Demokratie und<br />
die Menschenrechte ein. Seine Gagen ließ sich Rostropowitsch<br />
gern in bar auszahlen, und er hat des Öfteren eine Brieftasche dafür<br />
verlangt. Wenn er in Italien spielte, wurde er in Lire bezahlt –<br />
und eine Brieftasche reichte nicht aus. Ich habe mich oft gefragt,<br />
was er wohl mit den ganzen Brieftaschen gemacht hat.<br />
Einmal kam Slava spontan zu uns zu Besuch. Er konnte die<br />
tollsten Geschichten erzählen, und ich liebe es, solchen grandiosen<br />
Persönlichkeiten Anekdoten zu entlocken. Also öffnete ich<br />
eine Flasche Wodka und bat ihn, uns eine Geschichte zu erzählen.<br />
„Mein geliebter Danuschka“, sagte er, „du brauchst nie zu fragen.<br />
Slawitschka sagt doch immer Ja!“<br />
„Dann“, sagte ich, „erzähle uns bitte etwas über den Komponisten<br />
Benjamin Britten.“<br />
„Oh, mein Freund Ben“, antwortete Slava mit breitem Grinsen.<br />
„Ich erzähle dir, wie ich das beste Weihnachtsgeschenk meines<br />
Lebens bekam. Wir waren in Aldeburgh, Brittens Festival.<br />
Britten kam zu mir und sagte: Slava, wir haben gerade eine Nachricht<br />
vom Buckingham Palace bekommen. Lady Mary Frances Bowes-<br />
Lyon, die Schwester der Königinmutter, wird übermorgen hier sein.<br />
Sie kommt ins Konzert, und danach gibt es einen Empfang. Ich war<br />
ein einfacher russischer Junge, hatte noch nie ein Mitglied eines<br />
Königshauses kennengelernt und war sehr aufgeregt. Für mich,<br />
da sie die Schwester der Königinmutter war, war sie eine Prinzessin.<br />
Eine Prinzessin wie Tschaikowskis Dornröschen! Ich konnte<br />
die ganze Nacht nicht schlafen und überlegte, wie ich mich verhalten<br />
sollte, wenn ich sie kennenlernen würde. Sollte ich mich<br />
verbeugen, wenn ich vor sie trat? Ich kam auf eine fantastische<br />
Idee. Ich würde eine Pirouette machen! Ich übte es in meinem<br />
Zimmer. Am nächsten Tag kam ich wieder mit Britten zusammen<br />
und sagte: Ben, ich habe mir etwas überlegt. Ich werde der Prinzessin<br />
meine Hand geben und einen Ehrentanz machen.<br />
Darauf Britten: Was meinst du mit Ehrentanz?<br />
Ich: Ich werde es dir vorführen. Und ich führte es vor.<br />
Britten war entsetzt: Bist du wahnsinnig, das geht nicht!<br />
Ich: Doch, das mache ich. Ich werde zum ersten Mal eine richtige<br />
Prinzessin kennenlernen, und ich werde das machen.<br />
Britten: Nein, Slava, das geht nicht. Das wird ein Skandal.<br />
Britten sah, dass es mir ernst war und fragte: Was kann ich tun,<br />
damit du es nicht machst?<br />
Ich: Du kannst mir eine Suite für Solocello komponieren!<br />
Britten: Das ist doch lächerlich. Ich bin schließlich nicht Bach.<br />
Ich: Eine Suite für Solocello – oder ich mache diese Pirouette.<br />
Am nächsten Tag erschien Prinzessin Mary in Aldeburgh. <strong>Die</strong><br />
Hofdamen stellten mich vor: Your Royal Highness, das ist Mstislaw<br />
Rostropowitsch. Ich sank fast auf die Knie, sah noch einmal zu Britten<br />
und flüsterte: Ben, eine Suite für Solocello!“<br />
Weihnachten 1964 hat Rostropowitsch sie bekommen.<br />
D ANIEL H O P E ist Violinist von Weltrang. Sein Memoirenband<br />
„Familien stücke“ war ein Bestseller. Zuletzt erschienen sein Buch<br />
„Toi, toi, toi! – Pannen und Katastrophen in der Musik“ (Rowohlt)<br />
und die CD „Recomposed by Max Richter – Vivaldi, The four<br />
Seasons“ (Deutsche Grammophon). Er lebt in Wien<br />
ILLUSTRATION: ANJA STIEHLER/JUTTA FRICKE ILLUSTRATORS<br />
134 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Elegant durch das Jahr 2013<br />
Der <strong>Cicero</strong>-Kalender<br />
Der Original-<strong>Cicero</strong>-Kalender<br />
Mit praktischer Wochenansicht auf einer Doppelseite<br />
und herausnehmbarem Adressbuch. Begleitet<br />
von Karikaturen, bietet der Kalender viel Platz für<br />
Ihre Termine und Notizen. Im handlichen Din-A5-<br />
Format, mit stabiler Fadenheftung und wahlweise<br />
in rotem Surbalin- oder schwarzem Ledereinband<br />
erhältlich.<br />
Ja, ich möchte den <strong>Cicero</strong>-Kalender 2013 bestellen!<br />
Ex. in rotem Surbalin je 25 EUR*/19,95 EUR für Abonnenten Bestellnr.: 890649<br />
Ex. in schwarzem Leder je 69 EUR* Bestellnr.: 890650<br />
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Bestellung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax oder<br />
E-Mail) widerrufen. <strong>Die</strong> Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung<br />
des Widerrufs. <strong>Cicero</strong> ist eine Publikation der Ringier Publishing GmbH, Friedrichstraße 140, 10117 Berlin, Geschäftsführer Rudolf<br />
Spindler. *Preise zzgl. Versandkosten von 2,95 € im Inland, Angebot und Preise gelten im Inland, Auslandspreise auf Anfrage.<br />
Vorname<br />
Straße<br />
Name<br />
Hausnummer<br />
Jetzt direkt bestellen!<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice<br />
20080 Hamburg<br />
Telefon: 0800 282 20 04<br />
Telefax: 0800 77 88 790<br />
E-Mail: abo@cicero.de<br />
Shop: www.cicero.de/kalender<br />
PLZ<br />
Ort<br />
Telefon<br />
E-Mail<br />
Kontonummer BLZ Kreditinstitut<br />
Ich bin einverstanden, dass <strong>Cicero</strong> und die Ringier Publishing GmbH mich per Telefon oder E-Mail über interessante Angebote<br />
des Verlags informieren. Vorstehende Einwilligung kann durch das Senden einer E-Mail an abo@cicero.de oder postalisch an den<br />
<strong>Cicero</strong>-Leserservice, 20080 Hamburg, jederzeit widerrufen werden.<br />
Datum<br />
Unterschrift
DER FEINSCHMECKER GOURMET-SHOP<br />
Exklusive kulinarische<br />
Geschenkideen<br />
Jetzt das aktuelle DER FEINSCHMECKER GOURMET-SHOP Magazin<br />
kostenfrei bestellen unter 040 / 87 97 35 60 oder<br />
www.der-feinschmecker-shop.de
K Ü C H E N K A B I N E T T | S A L O N |<br />
ILLUSTRATION: THOMAS KUHLENBECK/JUTTA FRICKE ILLUSTRATORS; FOTO: ANTJE BERGHÄUSER<br />
Ende mit<br />
Schrecken<br />
<strong>Die</strong> Crème Brûlée verteidigt seit bereits mehr als<br />
20 Jahren ihren Titel als Nachtisch der Stunde.<br />
Aber jetzt kündigt sich eine Zeitenwende an<br />
V ON JULIUS G RÜTZ KE UND T HOMAS PLATT<br />
K<br />
EIN VERDIKT KANN SO VERNICHTEND SEIN wie die Bezeichnung<br />
eines kulturellen Phänomens als „Mode“. Das<br />
schmähende Etikett unterstellt, dass es sich nur um eine<br />
Laune handelt, die eine längere Aufmerksamkeit nicht verdient,<br />
weil sie ohnehin vergeht, ehe noch eine Theorie dazu entwickelt<br />
werden könnte. Dabei lassen sich gerade aus den wechselnden<br />
Moden wertvolle Erkenntnisse zur Verfassung von Epochen gewinnen.<br />
<strong>Die</strong> Speisekultur macht da keine Ausnahme.<br />
Besonders beim Dessert, das ja immer auch eine Belohnung<br />
darstellt für den fleißigen Esser, der seinen Hunger mit salzigen<br />
Speisen bereits besiegt hat, können sich kulinarische Neuheiten<br />
prägnant entwickeln. Zum Beispiel die Mousse au chocolat: Heute<br />
spielt dieses schwere und etwas eintönige Dessert kaum noch eine<br />
Rolle und fristet im Kühlregal ein Schattendasein. Aber in den<br />
siebziger Jahren hatte jeder, der etwas auf sich hielt, ein eigenes<br />
Rezept für die Schokoladenmousse. <strong>Die</strong> mit Ei und Sahne auf Volumen<br />
gebrachte Schaumspeise symbolisiert geradezu eine Zeit,<br />
die vom Rückzug in eine üppige Häuslichkeit geprägt war. <strong>Die</strong><br />
Grenzen des Wachstums schienen erreicht zu sein, der revolutionäre<br />
Aufbruch war in die Institutionen marschiert und hatte<br />
sich in behördlichen Planstellen verfestigt. Analog zur politischen<br />
Bewegungslosigkeit betäubte sich das Bürgertum zu orchestralen<br />
Klängen aus teuren Hi-Fi-Anlagen mit der Kalorienbombe, nach<br />
deren Verzehr man sich auf dem Schlafsofa zur Ruhe bettete.<br />
Nach dem Regierungswechsel der achtziger Jahre änderte sich<br />
nicht nur das politische Personal, sondern vor allem die Lebenshaltung:<br />
<strong>Die</strong> Menschen legten die Angst vor dem Ungewissen ab<br />
und tanzten der Zukunft mit dem Walkman entgegen. Als adäquate<br />
Süßspeise bereitete man eine Spezialität mit reichlich aufputschendem<br />
Kaffee zu. Das Tiramisu aus der verdickten Sahne<br />
Mascarpone mit Biskuit und viel Kakaopulver ist zwar nicht<br />
minder mächtig als die französische Schokoladenspeise, macht<br />
aber mit Espresso und Kaffeelikör Lust auf eine lange Nacht. Als<br />
Hinwendung zum deutschen Sehnsuchtsland Italien begleitete<br />
sie auch den Aufstieg der Toskanafraktion.<br />
Nach dem Mauerfall setzte wieder eine große Unsicherheit<br />
ein. <strong>Die</strong> bipolare Welt war Vergangenheit, eine neue Ordnung<br />
ließ auf sich warten. Beim Nachtisch wollte man da keine Experimente<br />
wagen. <strong>Die</strong> Crème Brûlée ist ein ganz simples Dessert,<br />
das keine Fragen aufwirft – nicht viel mehr als eine Vanillecreme,<br />
die mit einer frisch abgeflämmten Karamellschicht interessant gemacht<br />
wird. Der Kontrast zwischen dem heißen und krossen Zuckerbrand<br />
und der glatten, kalten Creme darunter macht nicht<br />
nur einen kulinarischen Reiz aus, er steht auch für ein Unterhaltungsbedürfnis,<br />
das die Berliner Republik kennzeichnet. Rückblickend<br />
klingt das Rezept wie ein gekochter Kommentar auf das<br />
Versprechen von Gerhard Schröder, er werde nicht alles anders,<br />
aber vieles besser machen als sein Vorgänger. <strong>Die</strong> zunehmende<br />
Vereinzelung der Ego-Gesellschaft findet in der Darreichungsform<br />
der Crème Brûlée ihre Entsprechung. Sie lässt sich nicht<br />
mehr in Schüsseln oder Lasagneformen zu einer Party mitbringen<br />
und dann mit Freunden teilen, sondern muss in einzelnen<br />
Portionen zubereitet und serviert werden.<br />
Seit dem Aufkommen der Crème Brûlée sind nun bereits mehr<br />
als 20 Jahre vergangen. Warum noch kein neuer Trend an ihre<br />
Stelle getreten ist, obwohl sie inzwischen längst als Geschmacksrichtung<br />
von Joghurt und Speiseeis existiert, erscheint zunächst<br />
rätselhaft. Bisher hatten sich die Moden seit dem Krieg alle zehn<br />
Jahre gewandelt – angefangen beim Wackelpudding der Fünfziger.<br />
Gut möglich, dass die lange Regentschaft der Crème Brûlée eine<br />
Rampe für eine große Umwälzung bildet. Am Horizont zeichnet<br />
sich bereits die neue Richtung ab. In der Avantgarde von Küchen<br />
und Kochlaboratorien werden immer häufiger Elemente aus der<br />
salzigen Küche in die Confiserie transponiert. Das passt zur Banken-<br />
und Rentenkrise: Das Dessert verliert seine Sonderstellung<br />
als Abschluss des Menüs und muss demnächst auch zur Sättigung<br />
beitragen. Wer seinen Ruhestand als Dessert des Arbeitslebens<br />
angesehen hat, wird am Schicksal des Nachtischs bald erkennen,<br />
wem die Stunde geschlagen hat.<br />
JULIUS G RÜTZ KE und T HOMAS PLATT<br />
sind Autoren und Gastronomiekritiker.<br />
Beide leben in Berlin<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 137
„Ich habe eine<br />
praktische Sammlung“:<br />
Als Direktor der Anna-<br />
Amalia-Bibliothek<br />
kann Michael Knoche<br />
in den eigenen vier<br />
Wänden auf kostbare<br />
Bücher verzichten<br />
138 <strong>Cicero</strong> 1.2013
B I B L I O T H E K S P O R T R Ä T | S A L O N |<br />
VOM GERUCH VERFÜHRT<br />
Wie Michael Knoche Direktor der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar wurde, ist eine Geschichte für<br />
sich – in seiner privaten Bücherwand residiert Homer aus Prinzip ganz oben auf der linken Seite<br />
V ON EVA GESINE BAUR<br />
FOTO: CHRISTOPH BUSSE FÜR CICERO<br />
H<br />
INEINZUKOMMEN IST NICHT LEICHT. Weder ins Innere der<br />
Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar noch in<br />
das ihres Direktors Michael Knoche dringt der Neugierige<br />
ungehindert vor. <strong>Die</strong> Katastrophe vor acht Jahren<br />
hat ihn wie sein Haus berühmt gemacht. Privatadresse<br />
geheim halten, schärft mir sein Büro ein. Und hinterher<br />
vernichten.<br />
Der Mann, der die Wohnungstür im Hochparterre einer Jahrhundertwendevilla<br />
öffnet, trägt freundliche Dezenz und einen Gesichtsausdruck,<br />
der so wenig über ihn zu verraten scheint wie die<br />
Wohnung. Sehr aufgeräumt wirkt beides. „Ich verfolge mit meiner<br />
Bibliothek hier zu Hause keine bibliophilen Interessen“, sagt Knoche.<br />
„Ich habe eine praktische Sammlung. Fürs Bibliophile habe<br />
ich ja die Bibliothek. Hier befindet sich nur das, was ich brauche.“<br />
Wäre er seinem Vater nachgeschlagen, Verwaltungsdirektor<br />
im Krankenhaus, bräuchte er fast gar nichts zwischen Buchdeckeln.<br />
Er geriet jedoch der Mutter nach. Sie war Krankenschwester<br />
und vererbte ihm nicht durch ihre Gene, sondern<br />
durch ihr Vorbild, was ihn prägt: die Leidenschaft fürs Lesen.<br />
Schon ihr Vater, sagt Knoche, war „ein Bücherverrückter. Von<br />
Thomas Mann kannte er jede Seite.“ Sein Beruf? „Arbeiter bei<br />
Krupp. Jahrgang 1898, überzeugter Kruppianer. In Essen gab<br />
es ja die Krupp’sche Lesehalle.“<br />
Wie sein Enkel, geboren im sauerländischen Werdohl, aufgewachsen<br />
in Leverkusen und Düsseldorf, vom Nutzer örtlicher<br />
Leihbibliotheken zum Direktor der berühmtesten Bibliothek<br />
Deutschlands wurde, hört sich an wie die Erfolgsgeschichte eines<br />
Blenders. Der promovierte Germanist war 39 und hatte vier Jahre<br />
als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Fachbuchverlag Springer<br />
in Heidelberg gearbeitet, als er in einer Fachzeitschrift an einer<br />
Stellenanzeige hängen blieb: „In der Zentralbibliothek der deutschen<br />
Klassik an den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten<br />
der klassischen deutschen Literatur in Weimar ist die Stelle<br />
eines Direktors neu zu besetzen.“ Gefordert waren „langjährige<br />
Erfahrungen“, und zwar „in Leitungsaufgaben“. Knoche, darin<br />
nicht einmal kurzjährig erfahren, bewarb sich trotzdem. Das Datum<br />
macht deutlich, mit welcher Bereitschaft zum Verzicht: Es<br />
geschah zwar nach dem Fall der Mauer, doch noch gehörte Weimar<br />
zur DDR. „Für mich bis dahin ein Polizeistaat, mit dem ich<br />
nichts zu tun haben wollte.“ Mit dem ihn auch nichts verband,<br />
weder familiäre Beziehungen noch Freundschaften. Aber er liebte<br />
die beschriebenen Wirklichkeiten aus dem anderen Teil Deutschlands,<br />
wie er sie aus Büchern kannte: aus der Prosa von Uwe Johnson<br />
und Christa Wolf und aus den Gedichten von Wulf Kirsten.<br />
Sie alle drei sind für einen Fremden schwer aufzufinden in der Bibliothek<br />
des Direktors. Privat sortiert er nämlich nicht alphabetisch,<br />
sondern chronologisch. Kirsten, Jahrgang 1934, wohnt ganz<br />
unten rechts. Als Antipode zu Homer, geschätzter Jahrgang 850<br />
vor unserer Zeitrechnung, der ganz oben links haust.<br />
Knoches Bewerbung ins Woher des Wulf Kirsten war zuerst<br />
liegen geblieben, wurde nach der Vereinigung jedoch rasch aufgegriffen<br />
und angenommen. Enthält seine Bibliothek einen Hinweis<br />
darauf, was oder wer ihn dazu trieb, für eine Vergütung, die<br />
nur 60 Prozent der westlichen betrug, in eine Stadt zu ziehen, die<br />
sich wie so viele damals kurz vor dem Zusammenbruch in den<br />
Umbruch gerettet hatte? Wo es, wie sich Knoche erinnert, kaum<br />
Mietwohnungen gab, aus den Schornsteinen schwefelgelber Rauch<br />
von Rotbraunkohle stieg, Abgasschwaden der Zweitaktmotoren<br />
den Himmel verdunkelten, und die Verkehrsverbindungen so wenig<br />
funktionierten wie die Telefonverbindungen?<br />
Einer vor allem hatte ihn verlockt. Einer, der nun so nah ist,<br />
aber nicht leicht erreichbar: Goethe steht so, dass Knoche nur mit<br />
der Leiter herankommt, Nachteil der frühen Geburt. „In dieser<br />
Hinsicht ist meine Ordnung dumm“, sagt er und blickt mit gerunzelter<br />
Stirn ins obere Regaldrittel. „Goethes Briefe könnte ich<br />
täglich lesen. Und seit ich Weimar kennengelernt habe, sind sie ein<br />
noch tieferes Erlebnis. Ich kenne jeden Stuhl, jeden Salon, jeden<br />
Weg, jede Treppe.“ Auch in den „Wahlverwandtschaften“ öffnen<br />
sich ihm ständig neue Fenster. „Sie sind ja nicht genau lokalisierbar,<br />
aber es steigen sofort Bilder auf, wenn man die Umgebung<br />
hier, wenn man Tiefurt und Großkochberg kennt.“ Vor allem aber<br />
steht Wilhelm Meister viel zu hoch. „Ich habe bei keinem Buch<br />
die Erfahrung gemacht, dass man es beim Wiederlesen derart unterschiedlich<br />
erleben kann, wie bei diesem.“ Knoche verstummt<br />
kurz und lächelt dann hinter einer Gedankenwolke hervor. „Goethe<br />
ist immer unglaublich frisch.“<br />
Anders das, was Bibliotheken ausdünsten. „Ein Whisky-Hersteller<br />
hat einmal das Bouquet seines Malt beschrieben als Anna-<br />
Amalia-Bibliotheksgeruch.“ Der Duft der alten Bücher hat für<br />
Knoche eine besondere Bedeutung. Mit 18 besuchte er einen<br />
Freund in Münster, der Jesuit werden wollte, und geriet in die<br />
dortige Klosterbibliothek. „Der Geruch, der mir in die Nase stieg,<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 139
| S A L O N | B I B L I O T H E K S P O R T R Ä T<br />
hat mich fasziniert.“ Und ihn verführt, Bibliothekar zu werden.<br />
„Ein Bücherparadies“ nennt Knoche diesen Ort seiner Bestimmung.<br />
Teilt er die Vision von Jorge Luis Borges, der gestand, er<br />
stelle sich das Paradies als Bibliothek vor?<br />
„Ach, das ist nicht besonders originell“, sagt er mit einem Zucken<br />
des Mundwinkels. Wenn er Besucher persönlich durch den<br />
Rokokosaal der Anna-Amalia-Bibliothek führt und sie ihm verschwörerisch<br />
zuflüstern: „Wissen Sie, wovon ich heimlich träume?“,<br />
sagt er: „Ja, das weiß ich: Sie wollen hier mal über Nacht eingeschlossen<br />
werden.“ Wie erklärt er sich das Phänomen, dass Bibliotheken<br />
und alte Bücher, in der Literatur wie in der Wirklichkeit,<br />
solches Interesse finden? „Ganz einfach: Im<br />
Zeichen digitaler Verfügbarkeit von Inhalten<br />
wächst die Magie der Originale“, sagt er trocken.<br />
Und liefert zwischen zwei Schlucken<br />
Tee den Satz ab, der die Unersetzbarkeit des<br />
Buches besser erfasst als tausendseitige Abhandlungen:<br />
„Wenn wir etwas über die Vergangenheit<br />
sagen wollen, müssen wir sie in<br />
ihren Produkten wahrnehmen.“<br />
Wertvoll werden für ihn Bücher durch<br />
die Verknüpfungen mit dem eigenen Leben.<br />
„Besonders viel wert sind mir solche, in die<br />
mir der Autor etwas reingeschrieben hat.“ Er<br />
zeigt mir Martin Mosebachs Roman „Das<br />
Beben“, Ingo Schulzes Roman „Neue Leben“<br />
und Gedichtbände, die ihm handschriftlich<br />
ausführlich gewidmet sind. Durs Grünbeins<br />
„Erklärte Nacht“ und Wulf Kirstens „Erdlebenbilder“.<br />
„Eigentlich komme ich vom Roman<br />
her, in dem man sich verlieren kann. Lyrik ist Übungssache.<br />
Man muss sehr viel Lyrik gelesen haben, um herauszufinden, was<br />
einen angeht.“<br />
Am 2. September 2004, um halb neun Uhr abends, rief ein<br />
Angestellter den Direktor zu Hause an. „<strong>Die</strong> Bibliothek brennt.<br />
Wollen Sie kommen?“ Was sich zum größten Bibliotheksbrand im<br />
Nachkriegsdeutschland ausweiten sollte, mehr als 50 000 Bücher<br />
umbrachte und mit 380 000 Litern Löschwasser weitere Zigtausende<br />
lebensgefährlich verletzte, forderte eine Qualität, die laut<br />
Knoche nicht ihn, sondern alle in seinem Beruf auszeichnet: „Bibliothekare<br />
sind cool.“ <strong>Die</strong> Feuerwehr sagte ihm, er habe mit seinen<br />
Leuten nur bis zehn Uhr Zeit für die Bergung. Dann müsse<br />
das Haus geräumt sein, weil voraussichtlich der Dachstuhl einbreche.<br />
„Ich habe mich wie ein Sanitäter gefühlt, der an die Unfallstelle<br />
gerufen wird und sieht: Überall ist jetzt Hilfe nötig. Aber ich<br />
muss mich entscheiden, wo sie am <strong>wichtigsten</strong> ist.“ Als er schließlich<br />
mit seiner Mannschaft vor dem brennenden Gebäude stand,<br />
rannte der Direktor nochmals zurück. „Ich hatte vergessen, den<br />
<strong>wichtigsten</strong> Schatz der Anna-Amalia-Bibliothek zu retten.“ Was er<br />
herausschleppte, waren zwei Bände mit Holzdeckeln, in schweres<br />
Rindsleder gebunden, aus dem Jahr 1534: die Lutherbibel. „Zu der<br />
habe ich eine sehr enge emotionale Beziehung.“ In seiner Hausbibliothek<br />
liegt der Nachdruck, 2002 bei Taschen erschienen. „<strong>Die</strong>se<br />
Rettung war für mich nicht mehr als eine Episode von vielen, von<br />
Hunderten, aber es ist mir lieb, dass sie an mir haftet.“ Dass er dafür<br />
nicht nur gefeiert wurde, sondern auch anonym verleumdet,<br />
selbst der Brandstifter gewesen zu sein, nimmt er achselzuckend<br />
Jugendliteratur ist auch vorhanden: Franz<br />
Seinsches „Blinkfeuer über der Ostsee“<br />
hin. „Mir war klar, dass man da Fantasie aller Art auf sich zieht.“<br />
Bibliothekare sind eben cool.<br />
„Wer während der Arbeit liest, ist verloren“, sagt Michael Knoche.<br />
Außerhalb ist das Sichverlieren erlaubt. In der Ausbildungszeit<br />
in Karlsruhe hatte er die Nächte durchgelesen. „Ich konnte mich<br />
kaum beruhigen nach all den Anregungen, die tagsüber auf mich<br />
einstürzten.“ Damit genügend Zeit für Lektüre bleibt, blendet<br />
Knoche Ablenkungen radikal aus und lebt ohne Fernsehen. Jede<br />
Art des Zappens ist ihm fremd, Drinbleiben in einer Geschichte<br />
ein Anliegen. Bei einem Buch, das er im Urlaub gelesen hat, erinnert<br />
er sich daran, ob er am Ort des Geschehens weilte, der so<br />
den Inhalt verdichtete, oder an einem ganz<br />
anderen Ort, wo sich das Buch stärker erweisen<br />
konnte als die Reize der schönsten Gegend.<br />
Fontanes „Vor dem Sturm“ war ein<br />
solches Buch, das über Meer und Sand und<br />
Schlösser siegte.<br />
Am Tag unseres Gesprächs noch fährt er<br />
nach Südtirol. Nun bekommen Heimito von<br />
Doderers „<strong>Die</strong> Dämonen“ die Chance, Michael<br />
Knoche den Wanderwegen abspenstig<br />
zu machen. Wenn sie mit ihm zurückkehren,<br />
werden sie trotz achtsamer Behandlung Spuren<br />
zeigen, und das findet er gut so. Besitzt er<br />
Werke wie die von Gottfried Keller in zwei<br />
Ausgaben, ist ihm die benutzte näher als die<br />
neue. Für Knoche sind Veränderungen die<br />
Indizien des Gelebten. Er meidet aus diesem<br />
Grund als Privatmann nicht nur E-Books, er<br />
meidet auch Klassentreffen. „Weil dann jeder<br />
einen als den Alten wiedererkennen will. Aber ich will nicht<br />
mehr der Alte sein. Ich möchte der Veränderte sein, als den ich<br />
mich erfahre.“ Für sein Gewordensein gibt er Weimar die Verantwortung.<br />
„Ich wäre als Lehrer in Südwürttemberg heute ein ganz<br />
anderer. Seit ich in Weimar bin, bin ich bei mir selber.“ Doch gehört<br />
zu dem Geisteshimmel dieser Stadt nicht auch die Hölle vor<br />
den Toren namens Buchenwald?<br />
Auf Knoches Schreibtisch liegt „Der SS-Staat“ von Eugen Kogon.<br />
Und daneben ein Buch über wissenschaftliche Bibliothekare<br />
im Nationalsozialismus. Er hat das Buch herausgegeben und daran<br />
mitgeschrieben. „Anfangs habe ich mich gefragt: Was sollen<br />
die schon verbrochen haben? Aber beim genauen Hinsehen zeigte<br />
sich: Es war ziemlich viel.“ Er senkt den Blick. Als er ihn hebt,<br />
sagt er: „Aber ich betrachte das nicht aus moralischer Sicht. Ich<br />
will die Mechanismen verstehen.“<br />
Bibliothekare sind cool. Es sei denn, sie dächten an Bücher,<br />
die ihnen fehlen. In vier Jahren dräut dem Direktor die Pensionierung.<br />
„Wenn ich nicht mehr im Amt bin, muss ich meine private<br />
Bibliothek gewaltig ausbauen.“ Er stöhnt leise. „Stellen Sie sich<br />
vor: Mir fehlt sogar der Don Quichotte. Und zu leben, ohne einen<br />
Don Quichotte in der Nähe, kann ich mir nicht vorstellen.“<br />
E VA G ESINE B AUR<br />
schreibt Bücher, die von Musik handeln. Soeben<br />
erschien unter ihrem Pseudonym Lea Singer der<br />
Roman „Verdis letzte Versuchung“<br />
FOTOS: CHRISTOPH BUSSE FÜR CICERO, PRIVAT (AUTORIN)<br />
140 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Ab 40 ist das<br />
Ende nah.<br />
unnötiger<br />
Selbstzweifel<br />
Jetzt<br />
im<br />
Handel
| S A L O N | D A S S C H W A R Z E S I N D D I E B U C H S T A B E N<br />
Recht haben,<br />
bis der Arzt kommt<br />
Tuvia Tenenbom, Ulrike Meinhof, Christoph Schlingensief:<br />
neue Bücher über den schaurigen Narzissmus der Deutschen<br />
D IE B ÜCHERKOLUMNE VON R OBIN D ETJ E<br />
T<br />
UVIA TENENBOM, Sohn einer<br />
deutsch-jüdisch-polnischen Familie<br />
und Gründer des „Jewish Theater<br />
of New York“, findet die Deutschen<br />
doof, und das auf sehr lustige Weise. Er ist<br />
durchs ganze Land gereist und hat Normalos<br />
und berühmte Menschen getroffen,<br />
Gutmenschen, Nazis und Türken, Komiker<br />
und Altbundeskanzler. Er hat einen<br />
sehr komischen, aber auch sehr traurigen<br />
Bericht darüber geschrieben, und dann<br />
wurde es richtig komisch: Der Rowohlt-<br />
Verlag, der diesen Bericht in Auftrag gegeben<br />
hatte, wollte ihn plötzlich nicht mehr<br />
haben. Es gab ein wenig Skandal, als „jüdischer<br />
Hysteriker“ soll der Autor in einem<br />
Verlagsgutachten betitelt worden sein (was<br />
angeblich nett gemeint war), und jetzt ist<br />
das Buch bei Suhrkamp erschienen. Und<br />
siehe, es war gut. (Tuvia Tenenbom: „Allein<br />
unter Deutschen“; aus dem Englischen<br />
von Michael Adrian; Suhrkamp, Berlin<br />
2012; 431 Seiten, 16,99 Euro; als E-Book<br />
14,99 Euro.)<br />
<strong>Die</strong> Deutschen, denen Tuvia Tenenbom<br />
begegnet ist, saufen unendlich viel<br />
Bier. Ihre Autofabriken sind Kirchen.<br />
Sie wollen immer Kuschelkonsens. Und<br />
sie wollen nicht zu genau über die Dinge<br />
nachdenken. Eine Meinung haben sie immer<br />
schon, Fakten stören sie nur. Besonders<br />
wenn es um Israel geht. Israel geht gar<br />
nicht. <strong>Die</strong> Deutschen wollen den Judenmord<br />
nämlich wiedergutmachen, indem sie<br />
die Palästinenser als die neuen guten Juden<br />
vor den Israelis schützen, den bösen alten<br />
Juden. <strong>Die</strong>ses Deutschland, das Tenenbom<br />
erlebt, hat keinen Kern. Eine Imagekampagne<br />
(„Völkisches Deutschland – Herrscher<br />
der Welt“) ist in die Hose gegangen<br />
und einfach durch eine andere ersetzt worden<br />
(„Braves Deutschland – Großer bunter<br />
Streichelzoo“). Aber wer dumme Fragen<br />
stellt, hört dieses Deutschland ganz leise<br />
„Wir können auch anders“ knurren.<br />
Am Ende gesteht Tenenbom: „Ich kann<br />
die Deutschen nicht lieben.“ Er hasst ihr<br />
Musterschülertum, ihren heimlichen oder<br />
offenen Antisemitismus, „ihr ständiges<br />
Bedürfnis, geliebt und beglückwünscht zu<br />
werden, und ihre vorgebliche Rechtschaffenheit“.<br />
Und schließt: „<strong>Die</strong> Deutschen,<br />
entschuldigen Sie die Verallgemeinerung,<br />
würden absolut alles dafür tun, gut auszusehen,<br />
schön rüberzukommen, klug zu wirken.<br />
Aber wer sind sie in Wirklichkeit? Sie<br />
sind das narzisstischste Volk auf Erden.“<br />
Er hat diesen Schluss sehr unterhaltsam<br />
belegt.<br />
***<br />
Kurzer Lesetipp für alle, die das Thema<br />
„Deutscher Narzissmus“ ins Ideologische<br />
vertiefen wollen: Ein schwedischer Roman<br />
über Ulrike Meinhof ist auf Deutsch erschienen.<br />
(Steve Sem-Sandberg: „Theres“; Roman,<br />
aus dem Schwedischen von Gisela Kosubek;<br />
Klett-Cotta, Stuttgart 2012; 391 Seiten,<br />
22,95 Euro; als E-Book 17,99 Euro.) Da<br />
ILLUSTRATION: CORNELIA VON SEIDLEIN<br />
142 <strong>Cicero</strong> 1.2013
FOTO: LOREDANA FRITSCH<br />
Anzeige<br />
wird das Quellenmaterial literarisch aufgeschüttelt<br />
und verwirrt, bis wir es verstehen.<br />
Da treten die Terroristin und ihr Verfolger<br />
Horst Herold im Grunde gegeneinander<br />
an wie King Kong und Godzilla in einem<br />
japanischen Monsterfilm – irrtümlich aufgetaut<br />
aus dem ewigen Eis des Hitlertums<br />
mit seinem ganzen Pathos und seiner klirrenden<br />
Gewalttätigkeit. Und beide haben<br />
sie gnadenlos recht. Und nur einer von beiden<br />
kann siegen. Und … es ist einfach zum<br />
Schaudern. Brrr!<br />
***<br />
Der vor etwas über zwei Jahren viel zu jung<br />
verstorbene Künstler Christoph Schlingensief<br />
hat den deutschen Narzissmus entweder<br />
auf unvergleichliche Weise verkörpert<br />
oder zum Ausdruck gebracht. Oder beides<br />
– man weiß es nicht recht. Ein neues<br />
Buch mit abgetippten Tonbanddiktaten,<br />
herausgegeben von seiner Witwe Aino Laberenz,<br />
erlaubt eine Wiederbegegnung mit<br />
dieser Unklarheit und dem leisen Unwohlsein,<br />
das sie erzeugt. <strong>Die</strong> Texte sind rührend<br />
wirr und wollen dabei immer auch Rührung<br />
erzeugen. Auch die Fotos sind rührend,<br />
besonders die Kinderbilder. (Christoph<br />
Schlingensief: „Ich weiß, ich war’s“;<br />
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2012; 304 Seiten,<br />
19,99 Euro; als E-Book 17,99 Euro.)<br />
Schlingensief horcht in sich hinein und<br />
spürt: Jede Empfindung ist augenblicklich<br />
heilig. Und jede Empfindung, die er<br />
in seinem Körper hat, sagt unbedingt etwas<br />
über die gesamte Gesellschaft aus. Sie<br />
muss es tun, blitzartig, sonst ist sie nicht zu<br />
ertragen. „Ich“ allein wäre zu schrecklich.<br />
Schlingen-„Ich“ muss sich blitzartig ausdehnen,<br />
eine narzisstisch-parasitäre Superexplosion.<br />
Erst dann herrscht Frieden auf<br />
Erden, also in „Ich“.<br />
Schlingensiefs letztes Kunstprojekt, das<br />
ohne ihn weitergeführt wird, das Operndorf<br />
in Afrika – ganz große Oper! Strahlende<br />
kleine schwarze Kinder, umstanden<br />
von strahlenden deutschen Sponsoren, alle<br />
beseelt von einem auf ganz deutsche Weise<br />
absoluten Bewusstsein, etwas total Gutes<br />
zu tun. Verzweifelt sucht man da nach einem<br />
Fitzelchen Ironie. In diesem Buch findet<br />
man es nicht. Schlingensief steht da<br />
wie die Domina, der man früher nach Mitternacht<br />
beim Zappen in der Telefonsexwerbung<br />
begegnet ist: „Ruf! Mich! An!“<br />
Nur dass er sagt: „Liebt! Mich! Jetzt!“ Und<br />
Tausende sind seinem Ruf gefolgt. Es ist<br />
unmöglich geworden, Schlingensief nicht<br />
zu lieben. Erst wenn diese Liebe nachlässt,<br />
wird man ihn wieder als Künstler betrachten<br />
können, dessen Gegenstand der deutsche<br />
Narzissmus war. Er muss raus aus der<br />
Kitsch-Falle, die er selbst mit aufgestellt<br />
hat. Bis dahin bleibt er der liebe Christoph,<br />
der Terrorist der Herzen. Der große<br />
Empfindungs-Diktator.<br />
***<br />
Und wo kommt dieser deutsche Narzissmus<br />
nun her? Das ist doch bestimmt die<br />
Jugend von heute, die ja nichts anderes<br />
kennt als unsere hohle Medienglitzerwelt,<br />
den Terror der Werbung mit ihrem Dauerversprechen<br />
der sofortigen Wunscherfüllung.<br />
Oder? Mitnichten. Wer die Ur-Narzisse<br />
der Deutschen sehen will, muss sich<br />
Leni Riefenstahls Film „Triumph des Willens“<br />
ansehen. Wie dieser kleine Mann mit<br />
dem Schnurrbart da auf- und abtigert. Wie<br />
der Volkswille ihn da aufs Podium drängt!<br />
Das ist er, auf ihn richtet sich der Neid aller,<br />
die es ins Rampenlicht drängt, bis heute. So<br />
möchte man auch einmal alle Scheinwerfer<br />
zwingen, sich auf einen selbst zu richten.<br />
Und dann – recht haben, bis der Arzt<br />
kommt!<br />
Wer sind wir? Sind wir wieder wer? War<br />
wieder wer sein zu wollen schon der Fehler?<br />
„Spiegel online“ meldet: Tenenbom<br />
hat recht! <strong>Die</strong> Deutschen sind antisemitisch!<br />
Außerdem: Spermienzahl der Franzosen<br />
sinkt! So hat jede Nation ihr Säckel<br />
zu tragen. Tenenbom selbst hat es übrigens<br />
nicht so mit Nationen. Ständig wechselt<br />
er auf seiner Deutschlandreise ganz nach<br />
Laune die Staats- und Religionszugehörigkeit<br />
und gibt sich mal als Araber, mal als<br />
Arier aus. Hinter dem Verwirrspiel steckt<br />
eine freiheitliche Utopie: Weg von der<br />
Scholle! Raus aus der Kirche! Mich aber<br />
sollt ihr trotzdem fortan zum Volk der Tuvianer<br />
zählen. Tuvia, unser Präsident und<br />
Gott, kann auch nerven. Und das ist gut<br />
so. Freiheit ist nämlich, wenn man den anderen<br />
die Freiheit lässt, einen zu nerven. So<br />
hat Karl Popper das mit der offenen Gesellschaft<br />
gemeint. Mit Narzissmus ist dann<br />
natürlich nicht mehr viel zu wollen.<br />
R OBIN D ETJ E<br />
lebt als Autor, Übersetzer und<br />
Performancekünstler in Berlin<br />
Internationale Messe<br />
für Klassische Moderne<br />
und Gegenwartskunst<br />
7. – 10. März 2013<br />
Messe Karlsruhe<br />
www.art-karlsruhe.de<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 143
144 <strong>Cicero</strong> 1.2013
D I E L E T Z T E N 2 4 S T U N D E N | S A L O N |<br />
Schön auf der hohen Note<br />
zusammenklappen<br />
Der Comedian Thomas Hermanns verbringt seinen letzten Tag in<br />
New York, besucht eine Broadway-Show – und eine Gospel-Messe<br />
FOTO: MAURICE WEISS/OSTKREUZ FÜR CICERO<br />
E<br />
S WIRD PRÄCHTIG! Ich werde mit<br />
Glanz und Gloria untergehen,<br />
auf keinen Fall deutsch und depressiv.<br />
Denn der Tod ist doch die größte<br />
Show. Also macht es euch nicht zu<br />
schwer und genießt die Party! Ich würde<br />
mir in New York eine Broadway-Show<br />
ansehen. Hauptsache groß, Hauptsache<br />
Spektakel. Mein Mann und ich fliegen<br />
also morgens los, mit der Zeitverschiebung<br />
landen wir rechtzeitig zum Brunch.<br />
Und ich würde alles essen, was ich in den<br />
USA am liebsten mag: Angefangen mit<br />
Eggs Benedict – die es in Deutschland zu<br />
Unrecht noch nicht oft genug gibt –, und<br />
zwar sofort! Guten amerikanischen Bohnenkaffee<br />
und Pancakes mit Ahornsirup<br />
und Blaubeeren.<br />
Noch heute widerstrebt es mir, Uptown<br />
zu wohnen, weil ich dann das Gefühl<br />
habe, ich müsste FDP beziehungsweise<br />
die Republikaner wählen. Deshalb<br />
ziehe ich zu den interessanten Leuten<br />
nach Downtown, miete mir kein Doppelzimmer,<br />
sondern gleich eine Suite im<br />
Crosby Street Hotel. Mein Geld kann<br />
ich jetzt ja raushauen. Es bleibt eh nichts<br />
übrig, und Vererbung ist Geschmackssache.<br />
Ich würde noch einmal in den<br />
Meat Market District wandern, wo ich<br />
Ende der achtziger Jahre gewohnt habe,<br />
14. Straße Ecke Hudson. Damals gab<br />
es hier nur transsexuelle Prostituierte,<br />
Er tanzte in der Girlreihe, sang<br />
mit Sister Sledge, und wenn er<br />
lacht, scheint sein Mund erst<br />
wieder irgendwo hinter den Ohren<br />
aufzuhören: Der deutsche Komiker<br />
T homas H ermanns, 49, gründete<br />
vor 20 Jahren den Quatsch Comedy<br />
Club und machte damit die Stand-up-<br />
Comedy in Deutschland salonfähig<br />
www.cicero.de/24stunden<br />
Fleischer – und mich. Ich bin zwar kein<br />
Nostalgiker, aber vor dem Tod wird doch<br />
jeder ein bisschen sentimental und denkt<br />
sich: „Hach, hier bin ich früher auch mal<br />
rumgesprungen.“<br />
Im Algonquin-Hotel in Midtown,<br />
dem berühmten Literatenhotel, in dem<br />
von Dorothy Parker bis Noel Coward alle<br />
meine Idole gewohnt haben, wird dann<br />
endlich der erste Martini des Tages getrunken.<br />
(Es müsste auch schon nach<br />
fünf sein.) In Manhattan schmeckt er irgendwie<br />
anders als bei uns, der klassische<br />
mit Gin, sehr stark, mit Oliven und<br />
Nüsschen. <strong>Die</strong> gehören ja zum Cocktail<br />
dazu. Um 20 Uhr ist Showtime, deshalb<br />
müssen wir jetzt noch schnell am Times<br />
Square einen Imbiss zu uns nehmen, und<br />
zwar kalte Sesamnudeln. Das klingt hässlich,<br />
ist aber köstlich! Und dann ist es<br />
Zeit für den Broadway. Wir brauchen etwas<br />
Opulenz zum Sterben. Am liebsten<br />
Radio City Music Hall, eine große Revue<br />
mit den Rockets, 100 Mädchen in einer<br />
Reihe, Tiere auf der Bühne – herrlich!<br />
Oder ein klassisches Musical wie Billy Elliot,<br />
für das Gefühl. Das wäre das Beste.<br />
Da heule ich jedes Mal.<br />
Danach geht man im Rainbow Room<br />
noch einmal an die Bar. Eine alte Jazz-<br />
Legende singt Cole Porter, und man betrinkt<br />
sich hemmungslos. Dann aber mit<br />
Champagner, Dom Perignon, so viel ich<br />
will. Ich bin ja eh gleich tot. Selber muss<br />
ich nicht mehr auf die Bühne, außer vielleicht,<br />
es würde Abba anrufen und sagen,<br />
sie tun sich extra für mein Ableben noch<br />
mal zusammen. Ein letztes „Thank you<br />
for the Music“, da sag ich nicht Nein. Im<br />
Central Park sehen wir dann die Sonne<br />
ein letztes Mal aufgehen, und dann ab<br />
nach Harlem in die Gospel-Messe. Wenn<br />
die großen schwarzen Frauen anheben,<br />
fällt schließlich der Hammer. Mit einem<br />
„I will follow him“ in den Sarg, schwer<br />
verkatert von Martini und Champagner.<br />
Schön auf der hohen Note zusammenklappen.<br />
Den Oscar hätte ich vorher<br />
noch gewinnen können, aber sonst …<br />
Aufgezeichnet von Sarah Maria Deckert<br />
1.2013 <strong>Cicero</strong> 145
C I C E R O | P O S T S C R I P T U M<br />
Das bürgerliche Elend<br />
V ON A LEXANDER M ARGUIER<br />
J<br />
ETZT GEHT DAS SCHON WIEDER LOS! Pünktlich zur Einstimmung<br />
auf das bevorstehende Wahljahr machen CDU<br />
und CSU mal wieder ihr Fass mit der „Bürgerlichkeit“<br />
auf. Besser gesagt: Sie machen es zu, denn es geht ja vor allem<br />
darum, dass sich niemand außer ihnen selbst an dem köstlichen<br />
Saft darin (er schmeckt in Wahrheit schon etwas ranzig) laben<br />
möge. Also vor allem nicht die Grünen. „Finger weg!“ „Haltet<br />
den <strong>Die</strong>b!“ „Da kann ja jeder kommen!“ So ungefähr klingen<br />
derzeit die alarmistisch-verzweifelten Hilferufe aus den Reihen<br />
der Unionsparteien. Aber was meinen sie eigentlich mit der<br />
viel beschworenen Bürgerlichkeit, die ihren eigenen Wählern<br />
so exklusiv vorbehalten sein soll wie der Abschlepp-Service für<br />
ADAC-Mitglieder? Schauen wir doch einfach genauer hin.<br />
Da wäre zum Beispiel CSU-Landesgruppenchefin Gerda<br />
Hasselfeldt, die in einem Interview mit der Welt eine mangelnde<br />
Bürgerlichkeit der Grünen daran festmacht, diese seien „stark<br />
nach links gerückt“ und planten eine „Umverteilungsorgie“. Das<br />
Argument mit dem Linksruck würden wir an Frau Hasselfeldts<br />
Stelle zwar noch einmal überdenken, bevor jemand aus dem heimischen<br />
Lager auf die Idee kommt, dumme Fragen zu stellen.<br />
Aber Orgien, so viel sehen wir ein, sind mit bürgerlichen Tischmanieren<br />
nur schwer in Einklang zu bringen. <strong>Die</strong> Grünen wären<br />
also gut beraten, ihre Umverteilung mit Messer, Gabel und in<br />
aufrechter Sitzhaltung zu vollziehen. Macht auch weniger Dreck.<br />
Ein deutlich vielschichtigeres Bild von Bürgerlichkeit zeichnete<br />
unlängst Christean Wagner in einem Meinungsbeitrag auf<br />
Spiegel online. Der Fraktionsvorsitzende der hessischen CDU<br />
konstatiert wie folgt: „Für eine bürgerlich-konservative Partei ist<br />
die Familie unverzichtbare Keimzelle des Staates. <strong>Die</strong>s schließt<br />
eine Unterstützung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften<br />
nicht aus, aber der Idealfall für die Mehrheit sind sie nicht.“<br />
Aha. Bedeutet das nun im Umkehrschluss, dass unbürgerlichprogressive<br />
Parteien auf die Familie als Keimzelle des Staates verzichten<br />
wollen, was wiederum eine Unterstützung von gleichgeschlechtlichen<br />
Paaren ausschließt, obwohl sie der Idealfall für die<br />
Mehrheit sind? Klingt irgendwie wenig plausibel und ziemlich<br />
kompliziert. Vielleicht wollte Herr Wagner ja einfach nur sagen,<br />
dass Schwule unser aller Mitleid verdient haben und zum Dank<br />
die Klappe halten sollen. Zumindest aus bürgerlicher Sicht.<br />
Der Bürger Wagner aus Hessen kennt sogar noch ein paar<br />
andere nichtbürgerliche Untugenden und zählt dazu eine, wie er<br />
schreibt, „bevormundende Weltsicht“ der Grünen. Es sind übrigens<br />
dieselben Grünen, denen der CDU-Mann wenige Zeilen<br />
später zum Vorwurf macht, sie wollten „das Tanzverbot am Karfreitag<br />
abschaffen“. Wer darin einen Widerspruch zu erkennen<br />
glaubt, liegt allerdings falsch. Denn Wagners Krypto-Bürgerlichkeit<br />
folgt der einfachen Regel, dass Bevormundung durchaus<br />
okay ist, solange sie nur von der Kirche ausgeht. Oder zumindest<br />
von einer Partei mit dem Buchstaben „C“ im Namen.<br />
Beklemmend an dieser albernen Bürgerlichkeitsdebatte, die<br />
CDU und CSU vor allem mit sich selbst führen, um sich ihres<br />
nicht mehr vorhandenen Markenkerns zu vergewissern, ist<br />
die Tatsache, dass darin von bürgerlicher Teilhabe am politischen<br />
Geschehen wenig bis gar nicht die Rede ist. Das selbst<br />
ernannte bürgerliche Lager soll sich den Grünen nicht anbiedern<br />
– aber was Partizipation betrifft, könnte ein Blick über<br />
den Tellerrand auch für die eigene Klientel wohltuender sein<br />
als der hilflose Versuch, die politische Konkurrenz wie unwürdige<br />
Nestbeschmutzer in die Ecke zu stellen. Sonst entsteht<br />
am Ende nämlich der Eindruck, die Bundeskanzlerin meine<br />
nur ein knappes Drittel der Bevölkerung, wenn sie ihre Neujahrsansprache<br />
mit dem Satz „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!“<br />
beginnt.<br />
A LEXANDER M ARGUIER<br />
ist stellvertretender Chefredakteur von <strong>Cicero</strong><br />
ILLUSTRATION: CHRISTOPH ABBREDERIS; FOTO: ANDREJ DALLMANN<br />
146 <strong>Cicero</strong> 1.2013
Jetzt<br />
im<br />
Handel.<br />
PAPST Karls rätselhafte Krönung in Rom<br />
BAUERN Schinderei für die fränkischen Herren<br />
AACHEN Entdeckungen in der einstigen Pracht-Residenz<br />
www.spiegel-geschichte.de
Hinter jedem großartigen Cappuccino<br />
verbirgt sich ein Geheimnis.<br />
Nur ein perfekter Espresso macht<br />
aus frischer Milch eine großartige<br />
Kaffeespezialität. Entdecken Sie mehr:<br />
www.nespresso.com/geheimnis