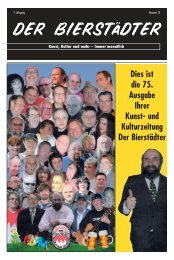Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 4<br />
<br />
VOM ABZEICHEN ZUM SAMMLEROBJEKT<br />
Von Wolfram Gittel<br />
Zinn ist ein weiches Material, das bei 232<br />
Grad Celsius schmilzt. Dadurch ist es sehr<br />
leicht zu handhaben. Kein Wunder, dass daraus<br />
schon sehr bald Teller und Trinkgefäße<br />
gefertigt wurden. Die ältesten erhaltenen<br />
Gegenstände aus Zinn sind etwa 2000 Jahre<br />
alt. Rasch fand es auch Eingang in den Pilgerbetrieb<br />
des Mittelalters. Mit ihm konnte<br />
man sehr leicht Pilgerabzeichen in großer<br />
Zahl herstellen. Zinn in Formen gegossen ergab<br />
Figuren von Heiligen und von Tieren.<br />
Es war vermutlich der Spieltrieb von<br />
Kindern, der letztlich die Zinnfigur zu dem<br />
machte, was sie heute ist. Denn mit den flachen<br />
Figuren konnte man trefflich spielen.<br />
Aus dem Jahre 1578 stammt die erste<br />
Erwähnung, dass Zinngießern erlaubt wurde,<br />
Kinderspielzeug herzustellen.<br />
Es waren allerdings zunächst die<br />
Sprösslinge des Adels, die in den Genuss dieser<br />
neuen Möglichkeiten kamen. Da vornehmlich<br />
Einzelstücke erstellt wurden, waren<br />
diese entsprechend teuer. Im 18. Jahrhundert<br />
setzte die Großproduktion von Zinnfiguren<br />
in sog. Offizinen ein. Schlicht gravierte<br />
Formen brachten steif wirkende Figuren<br />
hievor. Doch war das unerheblich. Wichtiger<br />
als Detailgenauigkeit war die Aktualität.<br />
Figuren für aktuelle politische Ereignisse herausgebracht,<br />
sicherten den Herstellern gute<br />
Geschäfte. So konnte es nicht ausbleiben,<br />
dass die Zinnfigur in der Zeit der napoleonischen<br />
Kriege einen wahren Boom erlebte.<br />
Man konnte mit den kleinen Soldaten zu<br />
Hause die Schlachten nachstellen.<br />
Zu den militärischen Motiven gesellten<br />
sich immer mehr auch zivile Figuren und Figurengruppen.<br />
So entstanden neben Weihnachtskrippen<br />
auch Miniaturbauernhöfe,<br />
oder verschiedene Alltagsszenerien. Die Zinnfigur<br />
erzählte immer mehr über das Leben<br />
überall auf der Welt.<br />
Einen wesentlichen Schritt auf dem Weg<br />
zur heutigen Zinnfigur machte um 1848 die<br />
Firma Heinrichsen aus Nürnberg. Sie produzierte<br />
ihre Zinnfiguren in einer Höhe von<br />
3 Zentimetern und grundsätzlich als Flachfigur.<br />
Denn neben den heute am weitest verbreiteten<br />
Flachfiguren gab es auch stets die<br />
Vollfiguren, die aber mit Abstand mehr Zinn<br />
verbrauchten und daher auch wesentlich<br />
kostspieliger waren. Verpackt waren die<br />
Normfiguren in Spanschachteln und wurden<br />
nach Gewicht verkauft. <strong>Der</strong> Inhalt der<br />
Schachteln wurde von den Firmen vorgegeben.<br />
Es waren also quasi „Wundertüten“.<br />
Keiner hat so genau gewusst, was da eigentlich<br />
drin war.<br />
Diese „Nürnberger Größe“ wurde 1924<br />
als internationale Norm anerkannt. In diesem<br />
Jahr wurde auch der Deutsche Zinnfigurensammlerbund<br />
„Klio“ gegründet. Denn seit<br />
Beginn des 20 Jahrhunderts rückte die kleine<br />
Figur immer mehr in das Interesse von<br />
Sammlern. Dies führte dazu, dass Detailgenauigkeit<br />
eine immer größere Rolle spielte.<br />
So muss bei Uniformen jeder Knopf an der<br />
richtigen Stelle sein. Jede Falte eines Kleides<br />
muss so fallen wie es der Realität entspricht.<br />
Das gilt in gleicher Weise für die Bemalung.<br />
Waren ursprünglich die Fabrik-Figuren sehr<br />
einfach coloriert, genügte das den Sammlern<br />
bald nicht mehr. Auch hier muss alles dem<br />
historischen Vorbild getreu sein. So wurden<br />
die kleinen Figuren zu Kostbarkeiten, die sich<br />
in jedem Wohnzimmerschrank gut machen.<br />
So klein eine Zinnfigur auch sein mag, so viel<br />
Kunstfertigkeit steckt darin. Vor der Figur<br />
steht der Entwurf. Er ist bereits ausschlaggebend<br />
für die Qualität des Endproduktes. Je<br />
feiner er gestaltet ist, desto hochwertiger<br />
wird die Figur. Die Zeichnung zeigt die Figur<br />
einmal von der Vorderseite und einmal von<br />
der Rückseite. Dann ist tage-, oft wochenlange<br />
Präzisionsarbeit angesagt. Die Form wird<br />
aus einem Schieferblock mittels Sticheln herausgearbeitet.<br />
Ein Block zeigt wieder die<br />
Vorderseite, der andere die Rückseite. Diese<br />
müssen so gestaltet sein, dass die Gravuren<br />
exakt aufeinander passen. Da das einfließende<br />
Zinn die vorhandene Luft vertreibt, werden,<br />
später leicht entfernbare, Gieß- und<br />
Ihre besondere Wirkung entfalten sie<br />
aber in „Dioramen“, kleinen Kulissen also, in<br />
den Szenen nachgebaut werden. Dioramen<br />
können die Größe einer kleinen Schachtel<br />
besitzen, oder, wie im Zinnfigurenmuseum<br />
auf der Plassenburg, bis 20 Quadratmeter<br />
Fläche einnehmen.<br />
EINE ZINNFIGUR ENTSTEHT<br />
Luftkanäle eingearbeitet. Sodann wird die<br />
Form zusammengesetzt. In einem Ofen wird<br />
das Zinn verflüssigt und mittels einer Kelle in<br />
die Form gegossen. Ist das Material erkaltet<br />
wird die Form, die Spannung steigt: „Wie<br />
wird das Resultat aussehen?“, auseinander<br />
genommen. Nachdem die Guss-Reste sorgfältig<br />
entfernt sind, kann die Figur bemalt werden.<br />
Nach der Grundierung folgt der eigentliche<br />
Farbauftrag, exakt und ebenfalls zeitintensiv,<br />
nach dem etwaigen Vorbild.<br />
Wie viel Arbeit in einem Diorama stecken<br />
kann, zeigt das größte Diorama auf der<br />
Plassenburg, mit mehr als 19 000 Figuren,<br />
alle auf die beschriebene Weise entstanden.<br />
WOG<br />
Im Gegensatz zu ihrer mittelalterlichen Vorgängerin,<br />
die der hl. Elisabeth und dem Leib<br />
Christi geweiht war, ist die Heilige Dreifaltigkeit<br />
der Patron der gegenwärtigen Schlosskirche.<br />
Nach der Zerstörung der Plassenburg im<br />
Bundesständischen Krieg erstand auch das<br />
Gotteshaus unter dem Markgrafen Georg<br />
Friedrich zu Brandenburg (* 1539 † 1603)<br />
wieder aus der Asche. Bald nach Baubeginn<br />
hatte Herzog Christoph von Württemberg<br />
1563 seinem Schwager Georg Friedrich den<br />
Baumeister Alberlin Tretsch, der damals den<br />
Bau des Alten Schlosses in Stuttgart leitete,<br />
nach Kulmbach geschickt. Dieser sollte die<br />
Baufortschritte auf der Plassenburg begutachten<br />
und nahm Einfluss auf die Planung der<br />
Kulmbachs STARKe Geschichte<br />
Ein Besuch in der Schlosskirche auf der Plassenburg<br />
Schlosskirche, die ebenso wie ihr Stuttgarter<br />
Vorbild, als Querhauskirche gebaut wurde.<br />
Das Raumkonzept mittelalterlicher Kirchen<br />
sah als Standort der Kanzel – also den<br />
Ort, wo Gottes Wort verkündet wurde – einen<br />
Wandabschnitt in der Mitte des Langhauses<br />
vor. Die evangelische Lehre und Liturgie stellt<br />
das Wort Gottes in den Mittelpunkt des<br />
Gottesdienstes. Deshalb wurde beim Konzept<br />
der Querhauskirche, das sich in der Kirche im<br />
Alten Schloss in Stuttgart zum ersten Mal<br />
angewendet findet, der Altar in unmittelbarer<br />
Nähe des traditionellen Kanzelstandortes aufgestellt.<br />
In Stuttgart wurde der Altar in einen<br />
an der Breitseite des Langhauses angebauten<br />
Chor gestellt. Auf der Plassenburg war dies<br />
aufgrund des Bauplatzes nicht möglich, weswegen<br />
der Altar ursprünglich an der Ostwand<br />
unter den Fenstern aufgestellt war.<br />
Spätestens 1569 war die Kirche im Rohbau<br />
fertig gestellt. 1574/75 ließ Markgraf<br />
Georg Friedrich den Kirchenraum noch einwölben.<br />
Es war ein großer, schlichter und<br />
saalartiger Kirchenraum mit einer einfachen,<br />
hohen und unbemalten Holzempore entstanden.<br />
<strong>Der</strong> an der Ostseite aufgestellte Altar<br />
sollte nach dem Willen des Fürsten aus<br />
einem großen Tafelbild bestehen, auf dem er<br />
zu Füßen eines Kruzifixes sich selbst und seinen<br />
Vater, Markgraf Georg den Frommen<br />
(* 1484 † 1543), kniend, in schwarzen<br />
Mänteln und mit zum Gebet erhobenen Händen<br />
dargestellt haben wollte.<br />
Einen ersten großen Umbau gab es<br />
schon rund 50 Jahre später unter dem Markgrafen<br />
Christian zu Brandenburg (* 1581<br />
† 1655). Wahrscheinlich wurde schon<br />
damals die Konzeption als Querhauskirche<br />
aufgegeben. <strong>Der</strong> Markgraf ließ unterhalb der<br />
alten Empore eine weitere Etage einziehen<br />
und beide Stockwerke mit der heute wieder<br />
sichtbaren Akanthunsmalerei auf grünem<br />
Grund bemalen. <strong>Der</strong> heutige Altar wird im<br />
wesentlichen Christians Hofbildhauer Abraham<br />
Graß (* ca. 1592 † 1633) zugeschrieben.<br />
Ursprünglich als Kanzelaltar erbaut, erhielt<br />
er seine heutige Gestalt in der Zuchthauszeit<br />
des 19. Jahrhunderts.<br />
Im 18. Jahrhundert wurde die Kirche<br />
barock überarbeitet. Die Emporen erhielten<br />
einen weißen Ölfarbenanstrich mit goldenen<br />
Leisten und „künstlichem Laubwerk". Auch<br />
wurden verschiedene „Kirchenstuhl-Beschläge“<br />
in die Emporen eingebaut. <strong>Der</strong> Kirchenstuhl<br />
des Festungskommandanten konnte sogar<br />
mit einem kleinen Ofen beheizt werden.<br />
Im 19. Jahrhundert wurde das Gotteshaus<br />
als Zuchthauskirche benutzt. Weil in<br />
der Plassenburg sowohl ein evangelischer als<br />
auch ein katholischer Zuchthausgeistlicher<br />
Dienst tat, musste die Kirche für Gottesdienste<br />
beider Konfessionen tauglich sein.<br />
Um 1860 wurde deshalb der alte Kanzelaltar<br />
in seine heutige Gestalt gebracht. Die<br />
heutige Orgel aus der Werkstatt des Bayreuther<br />
Orgelbauers Johann Wolf († 1911)<br />
stammt aus der Zeit um 1890. Sie hat 540<br />
Pfeifen und 9 Register.<br />
Zur alten Ausstattung der Kirche gehören<br />
auch die drei heute an der Ostwand des<br />
Raumes aufgehängten Gemälde. Sie werden<br />
dem Maler Johann Keil d. Ä. (gen. 1637 †<br />
vor 1668) zugeschrieben und stellen die<br />
„Anbetung der Hirten“, die „Bekehrung Pauli“<br />
und die „Abnehmung Christi vom Creutz“<br />
dar. Ein weiteres Bild, das ehemals in der<br />
Schlosskirche hing, ist seit 2002 im zweiten<br />
Markgrafenzimmer ausgestellt: Die „Allegorie<br />
der angefochtenen Seele".<br />
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die<br />
Kirche lange Zeit geschlossen. Die Orgel war<br />
während des Krieges ihrer Metallteile beraubt<br />
worden, dem Brennholzmangel im Flüchtlingslager<br />
Plassenburg hatte man teilweise<br />
mit dem Verfeuern des Kirchengestühls auszuhelfen<br />
versucht. Erst durch eine durchgreifende<br />
Restaurierung in den Jahren 1981 bis<br />
1985 war es möglich, die Schlosskirche in<br />
die Führungslinie durch die staatlichen Museen<br />
einzubinden. Bis 1993 fanden in den<br />
Sommermonaten auch regelmäßige Sonntags-Andachten<br />
in dem Gotteshaus statt.<br />
Heute ist sie vor allem eine beliebte Hochzeitskirche.<br />
Besonders erwähnenswert ist die gewölbte<br />
Decke. An den Gewölbekonsolen sind<br />
auf jeder Seite sechs Wappenschilder zu<br />
sehen, welche die Wappenfelder des damaligen<br />
Regenten darstellen. An der Mittelrippe<br />
sind die Symbole der damals bekannten sieben<br />
Planeten samt Sonne und Mond angebracht.<br />
An den beiden Schmalseiten des Kirchenschiffes<br />
schaut unterhalb des Gewölbescheitels<br />
das Antlitz des Markgrafen Georg<br />
Friedrich auf die Kirchenbesucher herab.<br />
Harald Stark<br />
Blick in die Schlosskirche<br />
Das Antlitz Markgraf Georg Friedrichs, des<br />
Bauherrn von Schloss und Kirche<br />
Die Bekehrung des Saulus. ein Werk des für Markgraf Christian in Bayreuth tätigen Malers Johann Keil<br />
d. Ä.<br />
Am Pfingstsonntag gibt es auf der Plassenburg eine Sonderführung in der Schlosskirche<br />
mit anschließender Pfingstandacht:<br />
So. 12.06. Pfingstsonntag 14.15 Uhr „Dies ist das Kirchlein so geweiht der Heiligen<br />
Dreifaltigkeit ..."<br />
Führung in der Schlosskirche der Plassenburg. Treffpunkt in der Schlosskirche.<br />
Im Anschluss Pfingst-Andacht mit Dekan Jürgen Zinck<br />
Ihr Inserat 4 Wochen im Internet: www.bierstaedter.de