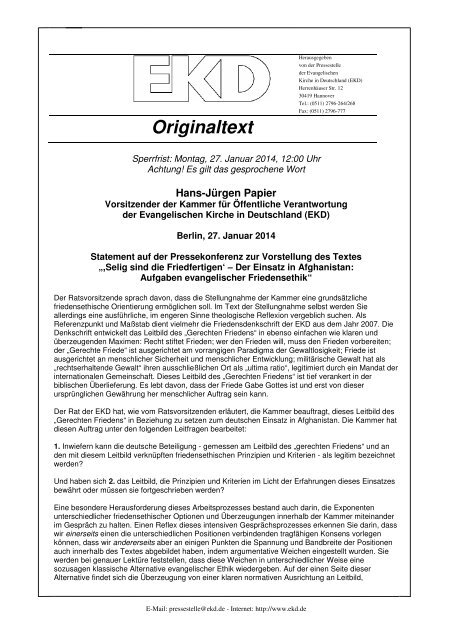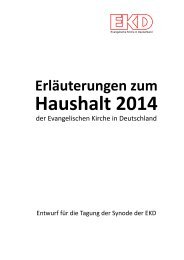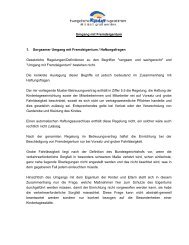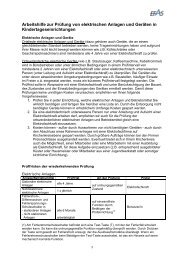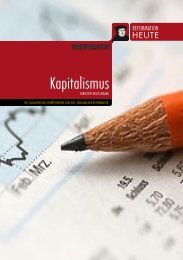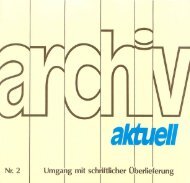Statement herunterladen (pdf) - Evangelische Kirche in Deutschland
Statement herunterladen (pdf) - Evangelische Kirche in Deutschland
Statement herunterladen (pdf) - Evangelische Kirche in Deutschland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Orig<strong>in</strong>altext<br />
Herausgegeben<br />
von der Pressestelle<br />
der <strong>Evangelische</strong>n<br />
<strong>Kirche</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> (EKD)<br />
Herrenhäuser Str. 12<br />
30419 Hannover<br />
Tel.: (0511) 2796-264/268<br />
Fax: (0511) 2796-777<br />
Sperrfrist: Montag, 27. Januar 2014, 12:00 Uhr<br />
Achtung! Es gilt das gesprochene Wort<br />
Hans-Jürgen Papier<br />
Vorsitzender der Kammer für Öffentliche Verantwortung<br />
der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Kirche</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> (EKD)<br />
Berl<strong>in</strong>, 27. Januar 2014<br />
<strong>Statement</strong> auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des Textes<br />
„,Selig s<strong>in</strong>d die Friedfertigen‘ – Der E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> Afghanistan:<br />
Aufgaben evangelischer Friedensethik“<br />
Der Ratsvorsitzende sprach davon, dass die Stellungnahme der Kammer e<strong>in</strong>e grundsätzliche<br />
friedensethische Orientierung ermöglichen soll. Im Text der Stellungnahme selbst werden Sie<br />
allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>e ausführliche, im engeren S<strong>in</strong>ne theologische Reflexion vergeblich suchen. Als<br />
Referenzpunkt und Maßstab dient vielmehr die Friedensdenkschrift der EKD aus dem Jahr 2007. Die<br />
Denkschrift entwickelt das Leitbild des „Gerechten Friedens“ <strong>in</strong> ebenso e<strong>in</strong>fachen wie klaren und<br />
überzeugenden Maximen: Recht stiftet Frieden; wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten;<br />
der „Gerechte Friede“ ist ausgerichtet am vorrangigen Paradigma der Gewaltlosigkeit; Friede ist<br />
ausgerichtet an menschlicher Sicherheit und menschlicher Entwicklung; militärische Gewalt hat als<br />
„rechtserhaltende Gewalt“ ihren ausschließlichen Ort als „ultima ratio“, legitimiert durch e<strong>in</strong> Mandat der<br />
<strong>in</strong>ternationalen Geme<strong>in</strong>schaft. Dieses Leitbild des „Gerechten Friedens“ ist tief verankert <strong>in</strong> der<br />
biblischen Überlieferung. Es lebt davon, dass der Friede Gabe Gottes ist und erst von dieser<br />
ursprünglichen Gewährung her menschlicher Auftrag se<strong>in</strong> kann.<br />
Der Rat der EKD hat, wie vom Ratsvorsitzenden erläutert, die Kammer beauftragt, dieses Leitbild des<br />
„Gerechten Friedens“ <strong>in</strong> Beziehung zu setzen zum deutschen E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> Afghanistan. Die Kammer hat<br />
diesen Auftrag unter den folgenden Leitfragen bearbeitet:<br />
1. Inwiefern kann die deutsche Beteiligung - gemessen am Leitbild des „gerechten Friedens“ und an<br />
den mit diesem Leitbild verknüpften friedensethischen Pr<strong>in</strong>zipien und Kriterien - als legitim bezeichnet<br />
werden?<br />
Und haben sich 2. das Leitbild, die Pr<strong>in</strong>zipien und Kriterien im Licht der Erfahrungen dieses E<strong>in</strong>satzes<br />
bewährt oder müssen sie fortgeschrieben werden?<br />
E<strong>in</strong>e besondere Herausforderung dieses Arbeitsprozesses bestand auch dar<strong>in</strong>, die Exponenten<br />
unterschiedlicher friedensethischer Optionen und Überzeugungen <strong>in</strong>nerhalb der Kammer mite<strong>in</strong>ander<br />
im Gespräch zu halten. E<strong>in</strong>en Reflex dieses <strong>in</strong>tensiven Gesprächsprozesses erkennen Sie dar<strong>in</strong>, dass<br />
wir e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong>en die unterschiedlichen Positionen verb<strong>in</strong>denden tragfähigen Konsens vorlegen<br />
können, dass wir andererseits aber an e<strong>in</strong>igen Punkten die Spannung und Bandbreite der Positionen<br />
auch <strong>in</strong>nerhalb des Textes abgebildet haben, <strong>in</strong>dem argumentative Weichen e<strong>in</strong>gestellt wurden. Sie<br />
werden bei genauer Lektüre feststellen, dass diese Weichen <strong>in</strong> unterschiedlicher Weise e<strong>in</strong>e<br />
sozusagen klassische Alternative evangelischer Ethik wiedergeben. Auf der e<strong>in</strong>en Seite dieser<br />
Alternative f<strong>in</strong>det sich die Überzeugung von e<strong>in</strong>er klaren normativen Ausrichtung an Leitbild,<br />
E-Mail: pressestelle@ekd.de - Internet: http://www.ekd.de
Pr<strong>in</strong>zipien und Kriterien, auf der anderen Seite die Option für e<strong>in</strong> stärker an der Situation und ihren<br />
komplexen Anforderungen orientiertes ethisches Urteil.<br />
Auf e<strong>in</strong>e detaillierte Wiedergabe der Inhalte des Textes muss ich an dieser Stelle verzichten und mich<br />
darauf beschränken, zum e<strong>in</strong>en den klaren Konsens der Kammer zu beschreiben und zum anderen<br />
die wesentlichen Weichenstellungen. Zum Abschluss werde ich kurz auf die <strong>in</strong> der Schlussbemerkung<br />
des Textes genannten Anregungen zur Weiterarbeit e<strong>in</strong>gehen.<br />
1. Zur Frage der Legitimität des E<strong>in</strong>satzes anhand der Kriterien der Friedensdenkschrift:<br />
Unstrittig ist, dass der ISAF-E<strong>in</strong>satz völkerrechtlich durch e<strong>in</strong>e UN-Mandatierung legitimiert ist und <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong> kollektives <strong>in</strong>ternationales System der Friedenssicherung e<strong>in</strong>gebunden ist.<br />
Strittig ist allerd<strong>in</strong>gs, ob diese Legitimität der Ausgangsentscheidung der UN ausreichend war, um alle<br />
Folgeentscheidungen zu tragen. E<strong>in</strong> Teil der Kammer urteilt hier sehr kritisch: Die ursprüngliche<br />
Mandatierung <strong>in</strong> der UN-Resolution 1368 argumentiert mit dem Selbstverteidigungsrecht des<br />
Angegriffenen. Diese Begründung könne nicht für 13 E<strong>in</strong>satzjahre aufrecht erhalten werden. Zudem<br />
seien wesentliche Prüfkriterien der Friedensdenkschrift nicht erfüllt gewesen. Gravierende Mängel<br />
habe es h<strong>in</strong>sichtlich der Konfliktprävention und Friedenskonsolidierung gegeben, ebenso <strong>in</strong> Bezug auf<br />
die E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der afghanischen Kräfte. E<strong>in</strong> anderer Teil der Kammer sieht die Legitimität des<br />
E<strong>in</strong>satzes als fortgesetzt gegeben an: besonders die unvorhersehbare Komplexität der<br />
E<strong>in</strong>satzsituation habe flexible Reaktionen nötig gemacht. Zudem sei <strong>Deutschland</strong> durch die<br />
Bündnissolidarität zu fortgesetzter Beteiligung verpflichtet gewesen.<br />
2. Zur Frage, ob und <strong>in</strong>wiefern sich das Leitbild des gerechten Friedens bewährt hat:<br />
Es herrscht grundsätzliche Übere<strong>in</strong>stimmung dar<strong>in</strong>, dass sich das Leitbild des gerechten Friedens<br />
unter den Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>es konkreten E<strong>in</strong>satzes bewährt hat. Weiterh<strong>in</strong> besteht Konsens dar<strong>in</strong>,<br />
dass der deutsche E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> Afghanistan sehr weitgehend darunter gelitten hat, dass e<strong>in</strong> konzises<br />
politisches Rahmenkonzept fehlt und von dieser Leerstelle her die angemessene Wahl von Umfang<br />
und Art der zum E<strong>in</strong>satz gebrachten Kräfte und Mittel schwierig war.<br />
Vom Leitbild des “Gerechten Friedens“ her ergeben sich aus dem Afghanistan-E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>ige<br />
grundsätzliche Anforderungen an humanitäre Interventionen:<br />
1. Militärische Mittel müssen an ihrem möglichen Beitrag für die politischen Ziele gemessen werden.<br />
Dazu bedarf es e<strong>in</strong>er politischen Gesamtstrategie unter Priorität der zivilen Mittel. Die Eigendynamik<br />
der militärischen Mittel muss politisch begrenzt werden.<br />
2. Entscheidender Teil e<strong>in</strong>er politischen Gesamtkonzeption e<strong>in</strong>es E<strong>in</strong>satzes s<strong>in</strong>d Exit-Strategien, die<br />
schon vom Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>es E<strong>in</strong>satzes an entwickelt werden müssen. Aktuell heißt dies auch:<br />
<strong>Deutschland</strong> trägt Verantwortung im Prozess des Abzugs, afghanische Partner etwa der Bundeswehr<br />
müssen schnell und unbürokratisch Unterstützung und ggf. Aufnahme <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> f<strong>in</strong>den.<br />
3. Die E<strong>in</strong>sicht bleibt: Nur Recht schafft Frieden. „Rechtserhaltende Gewalt“ im S<strong>in</strong>ne der Kriterien der<br />
Friedensdenkschrift muss auf den Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen ausgerichtet se<strong>in</strong>. Dies kann<br />
mit Aussicht auf Erfolg nur geschehen <strong>in</strong> Anknüpfung an lokale Rechtstraditionen und Institutionen,<br />
also unter Wahrung des Pr<strong>in</strong>zips der „local ownership“.<br />
4. Militäre<strong>in</strong>sätze müssen von Beg<strong>in</strong>n an durch Evaluation begleitet se<strong>in</strong>. Gegen die Eigendynamik<br />
und Zwangsläufigkeit militärischer Gewalt müssen E<strong>in</strong>sätze Gegenstand politischer Lernprozesse und<br />
Fehleranalyse se<strong>in</strong>.<br />
Gerade wenn wir diese Lernerfahrungen formulieren, kommen wir zu dem Schluss: Der „Gerechte<br />
Frieden“ ist mehr denn je als friedensethisches Leitbild bestätigt!<br />
Die friedenethische Reflexion wird und muss weitergehen. Ich nenne hier nur drei konkrete Aufgaben,<br />
wie sie auch am Schluss des Textes festgehalten s<strong>in</strong>d. Wir brauchen kirchliche, gesellschaftliche und<br />
politische Debatten über<br />
1. Umfassende zivile Mandatierungen von humanitären E<strong>in</strong>sätzen durch den Deutschen Bundestag.<br />
2. E<strong>in</strong>e Fortentwicklung des humanitären Völkerrechts, das nach se<strong>in</strong>er Konzentration auf<br />
Rechtsschranken für den E<strong>in</strong>satz von militärischer Gewalt (Fortentwicklung des ius ad bellum zum<br />
ius contra bellum), dem Recht <strong>in</strong> konkreten E<strong>in</strong>satzbed<strong>in</strong>gungen stärkere Aufmerksamkeit widmen<br />
muss (ius <strong>in</strong> bello).<br />
3. Die Entwicklung und den E<strong>in</strong>satz der „Drohnen“-Technologie.<br />
E-Mail: pressestelle@ekd.de - Internet: http://www.ekd.de