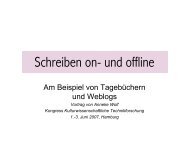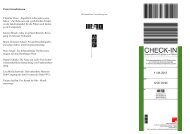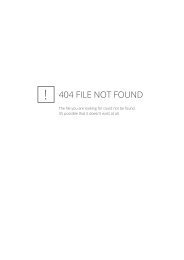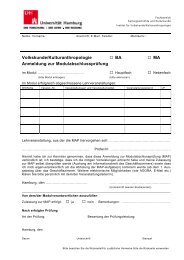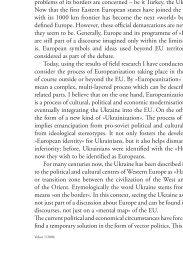Verlorener Raum Nordschleswig - Kultur.uni-hamburg.de
Verlorener Raum Nordschleswig - Kultur.uni-hamburg.de
Verlorener Raum Nordschleswig - Kultur.uni-hamburg.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
28 vokus<br />
bearbeiten.« 37 Deswegen regte er die Arbeit zum Schleswig-Holsteinischen Wörterbuch<br />
an und bezeichnete es dann als »ein Repertorium schleswig-holsteinischer Volkskun<strong>de</strong>«. 38<br />
Einer <strong>de</strong>r am häufigsten vertretenen Autoren in <strong>de</strong>r Zeitschrift Die Heimat war<br />
innerhalb <strong>de</strong>s Untersuchungszeitraumes Gustav Friedrich Meyer (1878–1945). 39 Meyer<br />
stand bereits früh in Kontakt mit Otto Mensing, durch <strong>de</strong>n er Anteil an <strong>de</strong>r Arbeit am<br />
Schleswig-Holsteinischen Wörterbuch nahm und in die volkskundliche Sammelarbeit<br />
eingeführt wur<strong>de</strong>.<br />
Als Schriftleiter Der Heimat von 1920 bis 1943 war Meyer <strong>de</strong>r bestimmen<strong>de</strong><br />
Akteur für die inhaltlichen Zielsetzungen nicht nur dieser Zeitschrift, son<strong>de</strong>rn auch<br />
für die in ihr vertretene Disziplin <strong>de</strong>r Volkskun<strong>de</strong>. Meyer war es auch, <strong>de</strong>r gezielt neue<br />
Zuträger und Sammler ansprach und motivierte, etwa Paul Selk (1903–1996) 40 und<br />
Bruno Ketelsen (1903–1945), 41 <strong>de</strong>nen sich als Lehrer dadurch soziale Aufstiegschancen<br />
anboten. Meyer wie<strong>de</strong>rum sorgte durch sie seinerseits dafür, dass das implizite<br />
Milieuwissen, welches er vertrat, nicht kritisch in Frage gestellt wur<strong>de</strong>.<br />
Eine wissenschaftliche Volkskun<strong>de</strong> war in <strong>de</strong>n 1920er Jahren in Schleswig-<br />
Holstein noch kein <strong>uni</strong>versitäres Fach, son<strong>de</strong>rn sie bestand innerhalb <strong>de</strong>r<br />
<strong>uni</strong>versitären Germanistik als ein Bereich, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Sprachwissenschaft zugeordnet war.<br />
Der Begriff ›Volkskun<strong>de</strong>‹ fin<strong>de</strong>t sich zum Beispiel in <strong>de</strong>r Zeitschrift Die Heimat neben<br />
<strong>de</strong>r Heimatforschung, <strong>de</strong>r Natur- und Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> sowie <strong>de</strong>r Sprachforschung;<br />
bei letzterer ging es insbeson<strong>de</strong>re um das Nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsche, als <strong>de</strong>r Sprache <strong>de</strong>r<br />
schleswig-holsteinischen Region.<br />
Den Großteil <strong>de</strong>r Veröffentlichungen in Der Heimat nehmen solche Texte ein,<br />
die sich <strong>de</strong>r Geschichte, <strong>de</strong>r <strong>Kultur</strong> und vor allem auch <strong>de</strong>r platt<strong>de</strong>utschen Sprache<br />
widmen. Darunter fin<strong>de</strong>n sich sowohl platt<strong>de</strong>utsche Liedtexte als auch Gedichte sowie<br />
Aufsätze, die <strong>de</strong>n Ursprung und die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utschen Sprache für die<br />
Region Schleswig-Holstein und <strong>Nordschleswig</strong> hervorheben. 42 Unter <strong>de</strong>n Kategorien<br />
›<strong>Kultur</strong>geschichte‹ und ›Volkskun<strong>de</strong>‹ wird eine Vielzahl von kulturellen Entäußerungen<br />
37<br />
38<br />
39<br />
40<br />
41<br />
42<br />
Ebd.<br />
Ebd.<br />
Gustav Friedrich Meyer war Mittelschullehrer und von 1936 bis 1945 beauftragter Dozent für Volkskun<strong>de</strong><br />
an <strong>de</strong>r Universität Kiel. Vgl. Silke Göttsch: Gustav Friedrich Meyer. In: Enzyklopädie <strong>de</strong>s Märchens, Bd. 9.<br />
Berlin/u. a. 1999, Sp. 617–619; Harm-Peer Zimmermann: Das Fach Volkskun<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r CAU im Zeichen<br />
<strong>de</strong>s Nationalsozialismus. Das Beispiel G. F. Meyer. In: TOP. Berichte <strong>de</strong>r Gesellschaft für Volkskun<strong>de</strong> in<br />
Schleswig-Holstein 5 (1995), S. 6–28.<br />
Zur Person Paul Selk vgl. Dieter Lohmeier: Vorwort. In: Dieter Lohmeier (Hg.): Paul Selk: Gesammelte<br />
Aufsätze zur Volkskun<strong>de</strong>. Hei<strong>de</strong> 1993, S. 9–14; Ulrich Wilkens: Paul Selk zum Ge<strong>de</strong>nken! In:<br />
Heimatverein <strong>de</strong>r Landschaft Angeln e.V. (Hg.): Paul Selk zu Ehren. Husum 2007, S. 8–10.<br />
Ketelsen, in Ton<strong>de</strong>rn geboren, arbeitete später als Lehrer in <strong>Nordschleswig</strong>, auf Alsen und in Mittelschleswig.<br />
Für Meyer war Ketelsen von großer Be<strong>de</strong>utung, weil er die platt<strong>de</strong>utschen, plattdänischen<br />
und auch die nordfriesischen Dialekte <strong>de</strong>r Grenzgebiete gut beherrschte.<br />
Z. B. Gustav Friedrich Meyer: Platt<strong>de</strong>utsch im Kampf um die Nordmark. In: Der Schleswig-Holsteiner<br />
5 (1924), S. 1–2; vgl. auch <strong>de</strong>rs.: Das Platt<strong>de</strong>utsche im schleswigschen Grenzkampf. In: Karl C. von Lösch<br />
(Hg.): Volk unter Völkern (= Bücher <strong>de</strong>s Deutschtums, 1). Breslau 1925, S. 103–107.