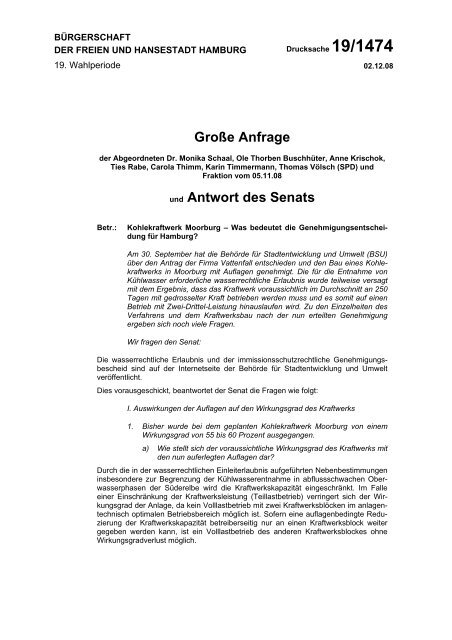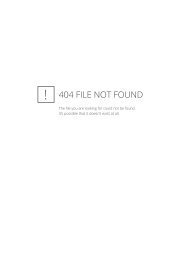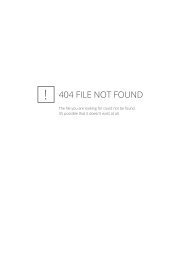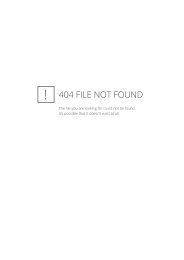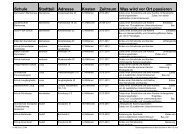Kohlekraftwerk Moorburg
Kohlekraftwerk Moorburg
Kohlekraftwerk Moorburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
BÜRGERSCHAFT<br />
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 19/1474<br />
19. Wahlperiode 02.12.08<br />
Große Anfrage<br />
der Abgeordneten Dr. Monika Schaal, Ole Thorben Buschhüter, Anne Krischok,<br />
Ties Rabe, Carola Thimm, Karin Timmermann, Thomas Völsch (SPD) und<br />
Fraktion vom 05.11.08<br />
und Antwort des Senats<br />
Betr.:<br />
<strong>Kohlekraftwerk</strong> <strong>Moorburg</strong> – Was bedeutet die Genehmigungsentscheidung<br />
für Hamburg?<br />
Am 30. September hat die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU)<br />
über den Antrag der Firma Vattenfall entschieden und den Bau eines <strong>Kohlekraftwerk</strong>s<br />
in <strong>Moorburg</strong> mit Auflagen genehmigt. Die für die Entnahme von<br />
Kühlwasser erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis wurde teilweise versagt<br />
mit dem Ergebnis, dass das Kraftwerk voraussichtlich im Durchschnitt an 250<br />
Tagen mit gedrosselter Kraft betrieben werden muss und es somit auf einen<br />
Betrieb mit Zwei-Drittel-Leistung hinauslaufen wird. Zu den Einzelheiten des<br />
Verfahrens und dem Kraftwerksbau nach der nun erteilten Genehmigung<br />
ergeben sich noch viele Fragen.<br />
Wir fragen den Senat:<br />
Die wasserrechtliche Erlaubnis und der immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbescheid<br />
sind auf der Internetseite der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt<br />
veröffentlicht.<br />
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:<br />
I. Auswirkungen der Auflagen auf den Wirkungsgrad des Kraftwerks<br />
1. Bisher wurde bei dem geplanten <strong>Kohlekraftwerk</strong> <strong>Moorburg</strong> von einem<br />
Wirkungsgrad von 55 bis 60 Prozent ausgegangen.<br />
a) Wie stellt sich der voraussichtliche Wirkungsgrad des Kraftwerks mit<br />
den nun auferlegten Auflagen dar?<br />
Durch die in der wasserrechtlichen Einleiterlaubnis aufgeführten Nebenbestimmungen<br />
insbesondere zur Begrenzung der Kühlwasserentnahme in abflussschwachen Oberwasserphasen<br />
der Süderelbe wird die Kraftwerkskapazität eingeschränkt. Im Falle<br />
einer Einschränkung der Kraftwerksleistung (Teillastbetrieb) verringert sich der Wirkungsgrad<br />
der Anlage, da kein Volllastbetrieb mit zwei Kraftwerksblöcken im anlagentechnisch<br />
optimalen Betriebsbereich möglich ist. Sofern eine auflagenbedingte Reduzierung<br />
der Kraftwerkskapazität betreiberseitig nur an einen Kraftwerksblock weiter<br />
gegeben werden kann, ist ein Volllastbetrieb des anderen Kraftwerksblockes ohne<br />
Wirkungsgradverlust möglich.
Drucksache 19/1474<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode<br />
b) In welcher Weise wirken sich die vorgesehenen Auflagen für den<br />
Betrieb des Kraftwerks auf die Fernwärmeauskoppelung aus?<br />
Die Anlage ist so konzipiert, dass auch bei einer auflagenbedingten Einblockfahrweise<br />
eine Fernwärmeauskopplung möglich ist.<br />
Nach dem heutigem Stand der hydrologischen Gewässerdaten ist darüber hinaus<br />
auch nicht zu erwarten, dass in den Wintermonaten durch eine auflagenbedingt eingeschränkte<br />
Kühlwasserentnahme der Betrieb des Kraftwerkes nur mit einer Einblockfahrweise<br />
möglich sein wird.<br />
c) Wie groß sind die beim Kraftwerk Tiefstack geplanten und umgesetzten<br />
Kapazitäten für die Fernwärmeversorgung und welche Rolle<br />
wird das Werk Tiefstack bei der künftigen Fernwärmeversorgung in<br />
Hamburg spielen?<br />
Vorhandene Fernwärmeerzeugungskapazitäten HKW Tiefstack:<br />
Grundlasterzeugung in KWK auf Steinkohlebasis 287 MW th<br />
Spitzenlasterzeugung auf Basis Gas/Öl (bivalent) 344 MW th<br />
Neue Fernwärmekapazität ab Anfang 2009:<br />
Mittellast GuD-Anlage auf KWK-Basis 145 MW th<br />
Summe<br />
776 MW th<br />
Die Rolle des HKW Tiefstack für die Fernwärmeversorgung bleibt zunächst unverändert.<br />
Es wird auch weiterhin zur Fernwärmebasisversorgung für Hamburg über den<br />
Oststrang eingesetzt. Szenarien für eine mittel- bis langfristige klimafreundliche, CO 2 -<br />
ärmere Wärmeversorgung werden von der zuständigen Behörde erarbeitet.<br />
2. Die BSU hat laut ihrer Pressemeldung vom 30.09.2008 Auflagen erteilt,<br />
nach denen die Leistung des Kraftwerks herunterzufahren ist, wenn der<br />
Abfluss der Süderelbe zu gering ist oder der Sauerstoffgehalt oder die<br />
Temperatur des Elbwassers bestimmte Werte unter- beziehungsweise<br />
überschreitet.<br />
a) Wie wird die Einhaltung dieser Auflagen im Einzelnen gewährleistet?<br />
Durch Berechnung des maßgeblichen Oberwasserabflusses (Q) über die kontinuierliche<br />
Messung des Wasserstandes am Pegel Neu Darchau (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung<br />
des Bundes - WSV) sowie die kontinuierliche Messung der Gewässertemperatur<br />
und des Sauerstoffgehalts im Gewässer (FHH-Gewässergütemessstellen und<br />
Betreibermessstellen) während der gesamten Laufzeit und zu jedem Betriebszeitpunkt<br />
des Kraftwerkes <strong>Moorburg</strong>. Die Messwerte werden automatisch digital aufgezeichnet,<br />
gespeichert und hinsichtlich der maßgeblichen Parameter ausgewertet (Auswerterechner)<br />
sowie per Datenfernübertragung an die zuständige Behörde übermittelt.<br />
b) Wann, wo, wie und durch wen genau soll die Einhaltung der Vorgaben<br />
kontrolliert werden?<br />
Die Einhaltung der Vorgaben wird über die gesamte Laufzeit und zu jedem Betriebszeitpunkt<br />
des Kraftwerkes <strong>Moorburg</strong> an den festgelegten Messorten durch kontinuierliche<br />
Messungen der relevanten Parameter überwacht und von der zuständigen<br />
Behörde als Überwachungsbehörde kontrolliert.<br />
II. Ausgleichsmaßnahmen<br />
In dem Bescheid für die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns wird auf Seite<br />
11 darauf hingewiesen, dass die öffentlich-rechtliche Zulassung für die in<br />
dem Landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehene Kompensationsmaßnahme<br />
im Vorland des Altengammer Hauptdeichs bis spätestens zum<br />
31.12.2008 zu beantragen sei. In der Sitzung des Umweltausschusses vom<br />
19.09.2008 erklärten die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter zu Protokoll<br />
erklären zu wollen, um was für eine Ausgleichsmaßnahme es sich han-<br />
2
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode Drucksache 19/1474<br />
deln würde. In der Protokollerklärung heißt es hierzu jedoch nur „Die Planung<br />
der Firma Vattenfall zum <strong>Kohlekraftwerk</strong> <strong>Moorburg</strong> sieht vor, Ausgleichs- und<br />
Ersatzmaßnahmen für die vom Bau und Betrieb des Kraftwerks ausgehenden<br />
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durchzuführen ...“<br />
1. Wir fragen daher erneut: Um was für eine Kompensationsmaßnahme<br />
handelt es sich konkret?<br />
Die Maßnahme im Altengammer Vorland beinhaltet auf einer Fläche von circa 16 ha<br />
eine großflächige Grünlandextensivierung, die Entwicklung eines Weichholzauwaldes,<br />
die Herrichtung von Süßwasserwatten und Röhrichten, die Anlage eines dauerhaft<br />
Wasser führenden Priels sowie die Herstellung eines naturnahen Kleingewässers.<br />
2. WeIche Ausgleichsmaßnahmen/Kompensationen werden neben der<br />
Fischtreppe in Geesthacht und der Kompensationsmaßnahme im Vorland<br />
des Altengammer Hauptdeichs noch vorausgesetzt?<br />
Neben der Maßnahme in Altengamme ist die Entwicklung von Trockenlebensräumen<br />
(Heide und Sandmagerrasen) auf einer Fläche von circa 4 ha auf dem ehemaligen<br />
Standortübungsplatz der Röttiger Kaserne bei der Fischbeker Heide festgesetzt worden.<br />
Außerdem sind Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen auf dem Kraftwerksgelände<br />
in <strong>Moorburg</strong> festgelegt worden. Hierbei handelt es sich um die Pflanzung von<br />
Bäumen und Sträuchern, um eine Deckwerksbegrünung am Ufer der Süderelbe sowie<br />
um Ansaaten auf unbebauten Flächen.<br />
III. Hinweisbeschluss<br />
Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht vertritt in seinem Hinweis-<br />
Beschluss vom 25. August 2008 die Auffassung, dass die von Vattenfall<br />
beantragte Fischtreppe als eine wirksame Ausgleichsmaßnahme anzusehen<br />
sei, soweit es um die Prüfung der Verträglichkeit mit den oberhalb der Staustufe<br />
gelegenen Schutzgebieten nach FFH-Recht geht. Die BSU erklärte in<br />
ihrer Pressemeldung vom 26.08.2008, der gerichtliche Hinweis habe keine<br />
Auswirkung auf die Frage des wasserrechtlichen Ermessens.<br />
Welche Bedeutung hatte der Hinweisbeschluss des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts<br />
vom 25. August 2008 im Einzelnen für den Ausgang des<br />
Genehmigungsverfahrens?<br />
Die zuständige Behörde war im Verfahren vor dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht<br />
(OVG) der Auffassung, dass die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis nicht<br />
erteilt werden könne, weil damit gegen die Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie der<br />
Europäischen Union verstoßen würde. Das OVG hatte diese Auffassung zurückgewiesen<br />
und in dem Hinweisbeschluss entschieden, dass das Kraftwerk unter der<br />
Bedingung des Baus einer Fischtreppe am Wehr Geesthacht nicht gegen die FFH-<br />
Richtlinie verstößt. Angesichts der somit zu erwartenden gerichtlichen Aufhebung<br />
eines anderslautenden Bescheides und daraus resultierender erheblicher Schadensersatzrisiken<br />
ist die zuständige Behörde der Rechtsauffassung des OVG gefolgt.<br />
IV. Feinstaub<br />
1. Ursprünglich war von einer jährlichen Feinstaubbelastung durch das<br />
Kraftwerk <strong>Moorburg</strong> von circa 400 Tonnen Feinstaub ausgegangen worden.<br />
a) Wie wird die jährliche Feinstaubbelastung durch das Kraftwerk entsprechend<br />
dem jetzigen Genehmigungsbescheid ausfallen?<br />
Für die Emissionen der beiden Kraftwerksblöcke wurden 10 mg Staub/m³ als Tagesmittelwert<br />
im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid festgelegt. Bei<br />
einem Abgasvolumenstrom von 2 x 2.241.303 Mio. m³/h und einer maximal jährlich<br />
3
Drucksache 19/1474<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode<br />
möglichen Betriebszeit von 8.760 h würden rechnerisch circa 393 t Staub pro Jahr<br />
emittiert werden. Hierbei wurde in der Immissionsprognose konservativ davon ausgegangen,<br />
dass es sich ausschließlich um Feinstaub handelt. Faktisch ist dies jedoch<br />
nicht der Fall.<br />
Bei einer aufgrund der Nebenbestimmung zur Kühlwassermengenentnahme in der<br />
wasserrechtlichen Einleiterlaubnis durchschnittlichen Einschränkung der Kraftwerkskapazität<br />
auf 67,5 Prozent ergeben sich rechnerisch noch maximal circa 265 t Staubemissionen<br />
pro Jahr, wenn der festgelegte Grenzwert von 10 mg Staub/m³ voll in<br />
Anspruch genommen werden würde.<br />
In der betrieblichen Praxis sind noch kleinere Staubfrachten pro Jahr zu erwarten<br />
(Unterschreitung des Emissionsgrenzwertes und geringere jährliche Betriebszeiten),<br />
als die konservativ in der Immissionsprognose zugrunde gelegten.<br />
b) Wie hoch werden die Jahresmittelwerte und Maximaiwerte von PM<br />
10 in den elb- und hafennahen Stadtteilen Finkenwerder, Wilhelmsburg,<br />
Veddel und <strong>Moorburg</strong> durch die Inbetriebnahme des jetzt<br />
genehmigten <strong>Kohlekraftwerk</strong>s (im Vergleich zu den Werten des<br />
Hamburger Durchschnitts) ausfallen?<br />
Bei den Messstationen Finkenwerder, Wilhelmsburg und Veddel schwankte der<br />
PM10-Jahresmittelwert in den letzten Jahren zwischen maximal 29 und minimal<br />
20 µg/m³.<br />
2. Welche Maßnahmen sollen zum Schutz der Hamburger Bevölkerung<br />
gegen die zusätzliche Belastung durch Feinstaub konkret unternommen<br />
werden?<br />
Im Rahmen der vorliegenden Immissionsprognose sind alle verfahrensrechtlich vorgeschriebenen<br />
Prüfschritte zur fachlichen Beurteilung der Luftbelastung durch Feinstaubemissionen<br />
infolge des Kraftwerksbetriebs zu dem Ergebnis gekommen, dass<br />
die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden und somit die<br />
immissionsschutzrechtliche Genehmigung ohne zusätzliche Maßnahmen erteilt werden<br />
musste.<br />
V. Beeinträchtigung durch die Baustelle<br />
Die Anwohner werden schon jetzt durch Lärmimmission und Baustellenverkehr<br />
bis weit in den Süderelberaum überproportional belastet.<br />
1. Wie, mit welchen Maßnahmen und Mitteln plant Senat und Fachbehörde<br />
eine Minimierung der Belastungen für die betroffenen Ortsteile während<br />
der Bauphase?<br />
Durch die auch für die Bauphase in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung<br />
festgelegten Auflagen und Bedingungen sind die rechtlich möglichen Beschränkungen<br />
ausgeschöpft.<br />
In der Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz sind auch Auflagen<br />
zur Minimierung der Beeinträchtigungen der Nachbarschaft während der Bauphase<br />
enthalten. Dies betrifft im Wesentlichen die Minderung von Staubemissionen und den<br />
Schutz gegen Baulärm. Am maßgeblichen Immissionsort – <strong>Moorburg</strong>er Elbdeich 129<br />
– ist tagsüber in der Zeit zwischen 7 und 20 Uhr ein Grenzwert von 60 dB(A) und in<br />
der Nacht von 45 dB(A) einzuhalten. Lärmintensive Arbeiten sind an Sonn- und Feiertagen<br />
nicht erlaubt.<br />
Zur Überprüfung dieser Werte ist die Einrichtung einer Dauermessstelle in der<br />
Genehmigung gefordert. Die bisherigen Einzelmessungen der Lärmimmissionen<br />
haben keine Überschreitungen ergeben.<br />
4
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode Drucksache 19/1474<br />
2. Auf welchen Wegen, in welchem Umfang und Zeitraum wird beziehungsweise<br />
soll zukünftig der Baustellen- und Zuliefererverkehr abgewickelt<br />
werden?<br />
In der Bauphase wird der Anlieferverkehr, der aus dem öffentlichen Verkehrsraum das<br />
Baufeld erreicht, ausschließlich über den <strong>Moorburg</strong>er Elbdeich über zwei getrennte<br />
Zufahrten auf das Baugelände geführt. Lkw-Fahrten durch den Ort <strong>Moorburg</strong> sind<br />
nicht vorgesehen und auch nicht zulässig. Durch die anhaltende Sperrung der Kattwykbrücke<br />
sind derzeit nur Anfahrten aus dem Süden über den <strong>Moorburg</strong>er Hauptdeich<br />
möglich.<br />
Während der Errichtung der einzelnen Betriebsanlagen bis zur geplanten Inbetriebnahme<br />
des Kraftwerkes in 2012 wird mit durchschnittlich 100 – 120 Lkw-Bewegungen<br />
täglich über den öffentlichen Verkehrsraum gerechnet. Diese Zahl wird sich in einzelnen<br />
Bauphasen kurzzeitig bis auf 200 Lkw-Bewegungen pro Tag erhöhen können<br />
(Transporte mit Erdmaterial, größere Betonierungsvorgänge und ähnliche).<br />
Für die auf der Baustelle Beschäftigten ist ein Buspendelverkehr eingerichtet, der bei<br />
Schichtwechsel die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sicherstellt.<br />
3. Sind vor dem Hintergrund der Beeinträchtigungen durch die Baustelle<br />
Informationsgespräche mit Betroffenen geplant? Und wenn ja, in welcher<br />
Form, in welchem Umfang, an welchem Ort und mit welcher Zeitschiene?<br />
Ja. Die zuständige Behörde hat am 28. November 2008 ein ausführliches Gespräch<br />
mit dem Interessenbündnis <strong>Moorburg</strong> vor Ort geführt. Neben anderen Themen wurden<br />
auch die Auswirkungen der Baustellenaktivitäten des Kraftwerksneubaus <strong>Moorburg</strong><br />
diskutiert.<br />
Für den Fortgang der Bauarbeiten wurde ein gegenseitiger Informations- und Meinungsaustausch<br />
vereinbart.<br />
4. Hat es in der bisherigen Bauphase aufgrund von Rammarbeiten auf der<br />
Baustelle des <strong>Kohlekraftwerk</strong>es, Beschwerden von betroffenen Anwohnern<br />
gegeben und wenn ja, welcher Art und in welchem Umfang?<br />
Ja. Es hat eine Lärmbeschwerde wegen der Rammarbeiten zur Herstellung der Kaianlagen<br />
gegeben. Lärmmessungen, die daraufhin bei laufenden Rammarbeiten von der<br />
zuständigen Behörde durchgeführt worden sind, ergaben keine Überschreitungen des<br />
Immissionsgrenzwertes in <strong>Moorburg</strong>.<br />
Die Rammarbeiten werden nur an Werktagen in der Zeit zwischen ca. 8 und 18 Uhr<br />
durchgeführt. Nachts und an Sonn- und Feiertagen sind lärmintensive Arbeiten nicht<br />
zulässig.<br />
VI. Wärmelastplan<br />
1. In der Sitzung des Umweltausschusses am 17.09.2008 erklärten die<br />
Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter auf die Frage, wann mit der<br />
Vorlage des bereits für den Sommer 2008 angekündigte Wärmelastplan<br />
zu rechen sei, dies hänge von der Beteiligung von Schleswig-Holstein<br />
und Niedersachsen ab. Einen festen Zeitplan habe sich die Flussgemeinschaft<br />
nicht auferlegt, da man sich nicht unter Zeitdruck setzen wolle<br />
(Bericht Drs. 19/1120).<br />
a) Wann rechnet der Senat – trotz dieser Ausführungen – mit der Vorlage<br />
des angekündigten Wärmelastplans?<br />
Der Senat hat sich hiermit nicht befasst.<br />
5
Drucksache 19/1474<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode<br />
b) Wann und wo wird beziehungsweise hat die angekündigte zweite<br />
Anhörung mit den betroffenen Industrieunternehmen stattfinden<br />
bzw. stattgefunden?<br />
Eine zweite Anhörung mit Industrieunternehmen beziehungsweise Naturschutzverbänden<br />
wurde nicht angekündigt und ist auch nicht geplant.<br />
Entfällt.<br />
c) Welche Punkte waren bisher besonders strittig und haben dazu<br />
geführt, dass eine zweite Anhörung durchgeführt wird?<br />
2. Wie sieht der neue Wärmelastplan aus, was sind die wichtigsten Eckpunkte?<br />
Die Eckpunkte des Wärmelastplan-Entwurfs haben sich gegenüber der ersten Version<br />
vom 13. August 2008 nicht verändert. Für Abwärme-Großemittenten (> 125 MW<br />
Wärmemenge für die Norder- und Süderelbe) gelten folgende Empfehlungen:<br />
• maximal zulässige Gewässertemperatur 28 C,<br />
• maximal zulässige Aufwärmspanne im Gewässer 3 K,<br />
• Mindestsauerstoffkonzentration im Gewässer 3 mg O 2 /l,<br />
• Zielwert der Sauerstoffkonzentration im Gewässer 6 mg O 2 /l.<br />
3. Welche Auswirkungen hat ein neuer Wärmelastplan auf den Bau des<br />
genehmigten <strong>Kohlekraftwerk</strong>s in <strong>Moorburg</strong>?<br />
Die Empfehlungen des Wärmelastplan-Entwurfs für Abwärme-Großemittenten sind in<br />
der wasserrechtlichen Erlaubnis für das im Bau befindliche <strong>Kohlekraftwerk</strong> in <strong>Moorburg</strong><br />
bereits berücksichtigt worden.<br />
4. Wie stellt sich das von der BSU für die Wasserentnahme aus der Süderelbe<br />
entwickelte allgemeine Bewirtschaftungsmodell im Einzelnen dar?<br />
Kühlwasser-Großentnehmer (> 5 m³/sec) dürfen zu jeder Zeit zusammen maximal ein<br />
Fünftel des aktuellen Oberwasserabflusses aus der Süderelbe für Kühlzwecke entnehmen,<br />
jedoch nicht mehr als die in der jeweiligen wasserrechtlichen Erlaubnis festgelegte,<br />
maximale Entnahmemenge.<br />
Bei Kühlwasser-Kleinentnehmern (
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode Drucksache 19/1474<br />
3. Wie bewertet der Senat die Wirtschaftlichkeit der Nachrüstung von <strong>Kohlekraftwerk</strong>en<br />
mit C0 2 -Abscheideanlagen?<br />
4. Ist eine Nachrüstung des <strong>Kohlekraftwerk</strong>s <strong>Moorburg</strong> durch das Post-<br />
Combustion-Verfahren geplant?<br />
a) Wenn ja, wann ist mit der Umsetzung zu rechnen?<br />
b) Bei welchem Preis für C0 2 ist eine solche Anlage wirtschaftlich?<br />
c) Wie viel zusätzlichen Brennstoff braucht eine Abscheideanlage?<br />
d) Welche Auswirkung hat die geplante C0 2 -Abscheideanlage auf den<br />
Wirkungsgrad des Kraftwerks <strong>Moorburg</strong>?<br />
Da sich die CCS-Technik zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch in der Phase der Forschung<br />
und Erprobung im Rahmen von Versuchs- und Pilotanlagen befindet, kann der<br />
Senat keine Aussagen zur großtechnischen Realisierbarkeit im realen Kraftwerksmaßstab<br />
in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht treffen, die über die<br />
Festlegungen hinaus gehen, die in der Vereinbarung zwischen dem Senat und der<br />
Firma Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG. sowie in dem immissionsschutzrechtlichen<br />
Genehmigungsbescheid fixiert worden sind (siehe auch Antwort zu VII. 9.).<br />
5. Hat die am Standort „Schwarze Pumpe“ erprobte Technik des Oxyfuel-<br />
Verfahrens für das Bauvorhaben in <strong>Moorburg</strong> irgendeine Bedeutung?<br />
a) Wenn ja, welche?<br />
b) Wenn nein, warum nicht?<br />
c) Warum kommt eine Nachrüstung mit dieser Technik nicht in<br />
Betracht?<br />
Die Zielstellung der Oxyfuel-Forschungsanlage ist der Test der CO 2 -Abscheidung in<br />
einem Braunkohlekraftwerk. Durch die Verbrennung von Braunkohlestaub und Steinkohle<br />
mit Sauerstoff soll ein Rauchgas mit hoher CO 2 -Konzentration (> 80 Prozent)<br />
erzeugt werden. Nach erfolgter Aufkonzentrierung des CO 2 im Abgas ist eine Reinigung,<br />
Verflüssigung und anschließende unterirdische Endlagerung vorgesehen.<br />
Bei diesem Verfahren handelt es sich noch nicht um eine erprobte Technologie.<br />
Bestehende Kraftwerke können nach jetzigem Kenntnisstand mit dieser Technologie<br />
nicht nachgerüstet werden.<br />
Ob und in welchem Ausmaß die zukünftigen Forschungsergebnisse des Oxyfuel-<br />
Verfahrens an einem Braunkohlestandort auf das Steinkohlekraftwerk <strong>Moorburg</strong> anlagen-<br />
und verfahrenstechnisch übertragbar sein werden, ist derzeit nicht abzusehen<br />
(siehe auch Antwort zu VII. 1.).<br />
Ja.<br />
6. Wird die Nachrüstung mit der C0 2 -Abscheidetechnik zusätzliche Flächen<br />
in Anspruch nehmen?<br />
Siehe Antwort zu VII.1.<br />
a) Falls ja, um welche Flächen in welcher Größe handelt es sich konkret?<br />
b) In welcher Weise ist dieser Flächenbedarf bisher berücksichtigt<br />
worden beziehungsweise inwiefern wird diesem Flächenbedarf<br />
Rechnung getragen werden?<br />
In der erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung ist ein zukünftiger Flächenbedarf<br />
berücksichtigt worden. Sofern eine CCS-Technik im großtechnischen<br />
Maßstab zukünftig zur Anwendung kommt, ist im Rahmen eines neuen, immissionsschutzrechtlichen<br />
Änderungsgenehmigungsverfahrens dem zusätzlichen Flächenbedarf<br />
durch entsprechende Grundstücks- beziehungsweise Flurstücksnachweise seitens<br />
der Firma Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG. als Antragstellerin Rechnung<br />
zu tragen (siehe Antwort zu VII. 9.).<br />
7
Drucksache 19/1474<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode<br />
7. Welche zusätzlichen Kosten werden der Firma Vattenfall voraussichtlich<br />
durch die Nachrüstung mit der CCS-Technik entstehen?<br />
8. Im Zusammenhang mit dem Neubau von <strong>Kohlekraftwerk</strong>en wird zunehmend<br />
der Begriff „CCS-Ready“ beziehungsweise „Capture-Ready“ diskutiert<br />
und verwandt. Mit der Bezeichnung „CCS-Ready“ beziehungsweise<br />
„Capture-Ready“ sollen Kraftwerke versehen werden, die auf die Nachrüstung<br />
mit der C0 2 -Abscheidetechnik in besonderer Weise vorbereitet<br />
sind. Auch wenn es sich hierbei noch nicht um einen gesetzlich<br />
geschützten beziehungsweise genau definierten Begriff handelt – wird<br />
das <strong>Kohlekraftwerk</strong> in <strong>Moorburg</strong> im Zeitpunkt seiner Inbetriebnahme die<br />
jetzt diskutierten Voraussetzungen für diese Bezeichnung erfüllen?<br />
Siehe Antwort zu VII.1.<br />
9. Eine C0 2 -Abscheidung wurde von der BSU mit der Genehmigung verordnet,<br />
obwohl die Umweltvereinbarung bereits Regelungen dazu getroffen<br />
hat.<br />
a) Wie sieht die Auflage zur Einrichtung einer C0 2 -Abscheideanlage<br />
aus?<br />
Siehe immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 30. September 2008, Seite 33.<br />
b) Was wird aus den „Strafgeldern“ in Höhe von drei Mal 3,5 Millionen<br />
Euro jährlich, geregelt in § 3 der Umweltvereinbarung vom<br />
14.11.2008, wenn die CCS-Anlage nicht oder nicht rechtzeitig<br />
gebaut wird?<br />
Nach der Vereinbarung steht der Betrag der Freien und Hansestadt Hamburg „zur<br />
Finanzierung zusätzlicher Klimaschutzmaßnahmen in Hamburg zur Verfügung“. Der<br />
Senat wird über konkrete daraus zu finanzierende Maßnahmen erst dann entscheiden,<br />
wenn sich die Zahlungspflicht wegen des Eintritts der dafür vorausgesetzten<br />
Versäumnisse der Firma Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG. realisieren sollte.<br />
c) Wie und durch wen wird nun der Zeitpunkt des Einbaus einer<br />
Abscheideanlage bestimmt?<br />
Siehe immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 30. September 2008, Seite 33.<br />
d) Die Firma Vattenfall behauptet, dass die Umweltvereinbarung nun<br />
keine Gültigkeit mehr hat. Ist die Umsetzung des Vertrages zwischen<br />
der Freien und Hansestadt Hamburg und der Firma Vattenfall<br />
gegebenenfalls von der Stadt einklagbar?<br />
e) Welche Bedeutung kommt der Umweltvereinbarung aus dem<br />
November 2007 noch zu, nachdem nun die Genehmigung unter<br />
Auflagen erteilt worden ist? Inwiefern und mit welchen konkreten<br />
Auswirkungen behalten welche Regelungen der Umweltvereinbarungen<br />
noch ihre Gültigkeit?<br />
Der Senat hat sich hiermit nicht befasst.<br />
10. Wie soll der Transport des C0 2 nach der Abscheidung erfolgen (gegebenenfalls<br />
per Schiff oder Pipeline oder auf andere Weise) und wo könnte<br />
das C0 2 voraussichtlich gelagert werden?<br />
Siehe Antwort zu VII. 1.<br />
11. Wann müssten für Bau Betrieb der Abscheideanlage die rechtlichen<br />
Voraussetzungen auf Bundesebene vorliegen?<br />
Die rechtlichen Voraussetzungen müssen spätestens zum Zeitpunkt der Erteilung der<br />
erforderlichen Zulassungen vorliegen.<br />
8
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode Drucksache 19/1474<br />
a) Wie weit ist der Gesetzgebungsprozess?<br />
b) Wie sieht der voraussichtliche Zeitplan aus?<br />
Die EU-Kommission hat einen Entwurf für eine Richtlinie vorgelegt, die den Rechtsrahmen<br />
im Bereich CCS festlegt. Eine Verabschiedung wird im Lauf des nächsten<br />
Jahres erwartet. Ein Gesetzgebungsprozess auf Bundesebene ist bisher nicht eingeleitet<br />
worden.<br />
c) In welcher Form wird der künftige Zertifikathandel in die rechtlichen<br />
Voraussetzungen für den Betrieb von Abscheideanlagen einbezogen?<br />
Hierzu liegen noch keine Entwürfe vor.<br />
VIII. Einschränkung von industriellen Anrainern<br />
1. In der Schriftlichen Kleinen Anfrage 19/862 vom 12.08.2008 heißt es, bei<br />
einer Erteilung der Genehmigung für das Kraftwerk in <strong>Moorburg</strong> „könnte<br />
es standortabhängig zu einer Einschränkung in der Ausübung der jeweiligen<br />
wasserrechtlichen Erlaubnis kommen.“<br />
a) Welche Unternehmen wären hiervon betroffen?<br />
Als mögliche Betroffene mit relevanten Kühlwasserentnahmemengen sind die in der<br />
Antwort zur Drs. 19/862 aufgeführten Firmen zu nennen.<br />
b) Welche konkreten Einschränkungen sind zu erwarten?<br />
Die möglichen Einschränkungen könnten darin bestehen, dass infolge der großen<br />
Kühlwassereinleitungsmenge beziehungsweise emittierten Wärmemenge des Kraftwerkes<br />
<strong>Moorburg</strong> im Sommerbetrieb die Gewässertemperatur und damit die Entnahmetemperatur<br />
des Kühlwassers für alle Kühlwassernutzer in Abhängigkeit von deren<br />
Standort erhöht wird (siehe Drs. 19/862). Somit würde die physikalische Kühlleistung<br />
bei gleicher Entnahmemenge für alle industriellen Anrainer an der Süderelbe – auch<br />
für das Kraftwerk <strong>Moorburg</strong> selbst – standortbezogen sinken. Zum Ausgleich der<br />
geringeren Kühlleistung pro Volumeneinheit bei höherer Gewässertemperatur müsste<br />
bei ansonsten gleichbleibenden Betriebsparametern eine entsprechend größere<br />
Kühlwassermenge im Rahmen der in den jeweiligen wasserrechtlichen Erlaubnissen<br />
der Anrainer genehmigten, maximal zulässigen Entnahmemengen aus der Süderelbe<br />
entnommen werden.<br />
2. Inwieweit ist die Nähe des im Bau befindlichen Kraftwerks zum Klärwerksverbund<br />
Köhlbrandhöft/Dradenau in Zusammenhang mit einer<br />
Gewässererwärmung und einer möglichen Beschleunigung von Sauerstoff-Zehrungsprozessen<br />
beachtet worden?<br />
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Genehmigungsverfahren Kraftwerk<br />
<strong>Moorburg</strong> wurde die Frage von beschleunigten Sauerstoff-Zehrungsprozessen in der<br />
Süderelbe durch das Zusammentreffen von kraftwerksbedingt erwärmten Wasser,<br />
welches zusätzlich durch die Abwässer der Kläranlage Köhlbrandhöft/Dradenau mit<br />
Bakterien angereichert wird, erörtert. Nach Aussage des Fachgutachters (DHI, Syke)<br />
haben die eingeleiteten Bakterien keinen messbaren Einfluss auf die Sauerstoff-<br />
Zehrungsraten in der Süderelbe. Dieser Auffassung ist die Zulassungsbehörde in der<br />
Beurteilung der gewässerökologischen Auswirkungen in der rechtlichen Würdigung<br />
der wasserrechtlichen Erlaubnis für das Kraftwerk <strong>Moorburg</strong> gefolgt (siehe auch Drs.<br />
19/862).<br />
3. Geht der Senat davon aus beziehungsweise ist der Senat in der Vergangenheit<br />
davon ausgegangen, dass wasserrechtliche Erlaubnisse vorhandener<br />
Einleiter zugunsten von Vattenfall/<strong>Moorburg</strong> eingeschränkt<br />
werden müssen?<br />
Der Senat hat sich hiermit nicht befasst.<br />
9
Drucksache 19/1474<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode<br />
4. Könnte in Zukunft die Ansiedlung von neuen Industrieunternehmen im<br />
Hafen nicht genehmigt werden, weil die Einleitmengen der Firma Vattenfall<br />
das für die Elbe/Umwelt verträgliche Maximum bereits ausreizen?<br />
Nein. Die maßgeblichen Grundsätze der zukünftigen Kühlwassermengenplanung für<br />
die Hamburgische Tideelbe sind im Hinblick auf die zukünftige Ansiedlung von neuen<br />
Industrieunternehmen unter Nummer 11.2.4 „Einführung des Elements „Nutzungsreserve<br />
– administrative Reaktionsschwelle“ (Seite 49) in der rechtlichen Würdigung der<br />
erteilten wasserrechtlichen Erlaubnis für das Kraftwerk <strong>Moorburg</strong> ausführlich dargestellt.<br />
IX. Kühltürme<br />
1. Trifft es zu, dass im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens zwischen der<br />
Firma Vattenfall und der Freien und Hansestadt Hamburg geprüft beziehungsweise<br />
diskutiert worden ist, ob die erforderliche Kühlung – statt<br />
durch Entnahme von Elbwasser – auch durch einen oder mehrere Kühltürme<br />
erfolgen könnte? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?<br />
Die zuständige Behörde hat gegenüber der Firma Vattenfall Europe Generation AG &<br />
Co. KG. die Auffassung vertreten, dass aus stadt- und landschaftsbildgestalterischen<br />
Gesichtspunkten der Bau eines Kühlturms mit circa 208 m Höhe und circa 150 m<br />
Basisdurchmesser beziehungsweise alternativ der Bau von zwei Kühltürmen mit<br />
jeweils circa 175 m Höhe und circa 121 m Basisdurchmesser unverträglich für das<br />
Stadtbild wäre.<br />
Zur Begründung wurde eine einschneidend negative Veränderung der Blicksituation<br />
vom nördlichen Elbufer (große Baukörperausmaße im Hintergrund der Köhlbrandbrücke)<br />
sowie die zusätzliche optische Wirkung der Abgasfahne, die je nach Wettersituation<br />
(temperatur- und windbeeinflusst) als weiß-graue Wasserdampfwolke sichtbar<br />
wäre, angeführt.<br />
2. Ist innerhalb des Genehmigungsverfahrens auch geprüft worden, ob die<br />
erforderliche Kühlung – statt durch Entnahme von Elbwasser – auch<br />
durch einen oder mehrere Kühltürme erfolgen könnte? Wenn ja, mit welchem<br />
Ergebnis?<br />
Siehe Drs. 19/862.<br />
3. Sollte die Firma Vattenfall nunmehr beabsichtigen, die Kühlung durch<br />
den Einsatz von Kühltürmen durchzuführen, wie wäre dies verfahrensrechtlich<br />
umzusetzen? Nach welcher Rechtsgrundlage wäre ein entsprechender<br />
Antrag zu stellen und nach welchen Vorschriften wäre das Verfahren<br />
zu beurteilen?<br />
Der Senat beantwortet hypothetische Fragen grundsätzlich nicht.<br />
X. Das Genehmigungsverfahren<br />
1. Wie war der Stand des immissionsschutzrechtlichen und des wasserrechtlichen<br />
Genehmigungsverfahrens<br />
Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren und das wasserrechtliche<br />
Erlaubnisverfahren waren nach § 10 Absatz 5 BImSchG und § 95 Absatz 2 Hamburgisches<br />
Wassergesetz (HWaG) so durchzuführen, dass eine vollständige Koordinierung<br />
der Verfahren und der Inhalts- und Nebenbestimmungen in den Entscheidungen stattfand.<br />
Da das Vorhaben insgesamt der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterliegt und<br />
immissionsschutz- und wasserrechtliche Entscheidung rechtlich miteinander verknüpft<br />
sind, konnte eine immissionsschutzrechtliche Entscheidung erst dann erfolgen, wenn<br />
auch die entscheidungserheblichen wasserrechtlichen Belange einschließlich der<br />
FFH-Verträglichkeit des beantragten Vorhabens in ihrer Gesamtheit abschließend<br />
geprüft worden waren. Dies begründet sich auch aus § 1a der 9. BImSchV, der unter<br />
anderem die Prüfung der bedeutsamen Auswirkungen einer UVP-pflichtigen Anlage<br />
auf die Belange des Naturschutzes vorschreibt.<br />
10
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode Drucksache 19/1474<br />
Dies ist insbesondere auch dadurch begründet, dass die im landschaftspflegerischen<br />
Begleitplan dargestellten Auswirkungen und deren Ausgleich beziehungsweise Ersatz<br />
nicht den einzelnen Vorhaben zugeordnet worden ist, sondern eine Gesamtschau<br />
vorgenommen wurde.<br />
Grundlage einer abschließenden fachlichen und rechtlichen Prüfung der Genehmigungs-<br />
und Erlaubnisvoraussetzungen war eine vollständig vorliegende UVP. In deren<br />
abschließender Beurteilung erfolgte separat für die immissionsschutzrechtlichen<br />
Aspekte, die im Rahmen des BImSchG-Genehmigungsverfahrens geprüft wurden und<br />
für die wasserrechtlichen Aspekte, die im eigenständigen wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren<br />
entsprechend den Maßgaben des Wasserrechts beurteilt wurden, auch<br />
die Einbeziehung der jeweiligen in Zusammenhang stehenden FFH-Verträglichkeitsprüfungen.<br />
Die UVP war Voraussetzung und fachlicher Maßstab für die zu treffenden Entscheidungen<br />
über die gestellten Genehmigungs- beziehungsweise Erlaubnisanträge.<br />
Dies vorausgeschickt, werden die Fragen wie folgt beantwortet:<br />
a) Ende 2007<br />
Die Zulassung vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG wurde am 14. November<br />
2007 erteilt.<br />
Das Gutachten der DHI Wasser & Umwelt GmbH „Sauerstoffbilanz der Tideelbe“ wurde<br />
am 4. Dezember 2007 als nachträgliche Antragsunterlage vorgelegt. Im Rahmen<br />
des wasserrechtlichen Zulassungsverfahrens musste das Gutachten öffentlich ausgelegt<br />
werden.<br />
Die externe Vergabe der UVP wurde vorbereitet.<br />
b) Ende Februar 2008 und<br />
Die erste Fristverlängerung zur Entscheidung über den immissionsschutzrechtlichen<br />
Genehmigungsantrag nach § 10 Absatz 6a Satz 2 BImSchG war erfolgt (neue Frist bis<br />
zum 10. März 2008).<br />
Am 26. Februar 2008 endete die Einwendungsfrist für die vom 29. Januar bis 11. Februar<br />
2008 durchgeführte zweite öffentliche Auslegung des nachgelieferten DHI-<br />
Gutachtens und weiterer Unterlagen im Wasserrechtsverfahren. Insgesamt gingen<br />
sieben Einwendungen fristgerecht ein, die inhaltlich zu bearbeiten waren.<br />
Die Erarbeitung der UVP war inzwischen an die Firma Probiotec GmbH vergeben<br />
worden.<br />
c) Ende März 2008?<br />
Die zweite Fristverlängerung zur Entscheidung über den immissionsschutzrechtlichen<br />
Genehmigungsantrag nach § 10 Absatz 6a Satz 2 BImSchG war erfolgt (neue Frist bis<br />
zum 10. Juni 2008).<br />
Die abschließende Stellungnahme der Antragstellerin zu den sieben Einwendungen<br />
der zweiten öffentlichen Auslegung vom 29. Januar bis 11. Februar 2008 stand im<br />
Wasserrechtsverfahren noch aus.<br />
Die Erarbeitung der UVP war noch nicht abgeschlossen.<br />
2. Noch im Umweltausschuss am 24. Januar 2008 (TOP: Volkspetition<br />
<strong>Moorburg</strong>) erklärten die Vertreterinnen der Firma Vattenfall und der<br />
Umweltbehörde (Seite 64 des Protokolls), dass die Genehmigung für<br />
das Kraftwerk im März 2008 erteilt werde. Es sei keine weitere Fristverlängerung<br />
geplant. In der Pressemeldung vom 4. Juni 2008 hat die BSU<br />
erklärt, es seien noch wichtige Fragen für die Genehmigungsentscheidungen<br />
ungeklärt. Insbesondere hätten noch Unterlagen der Firma Vattenfall<br />
zur Kühlwasser-Anlage gefehlt.<br />
a) War dieser Umstand im Januar 2008 der Behörde nicht bekannt?<br />
11
Drucksache 19/1474<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode<br />
b) Was machte die Behörde im Januar 2008 so sicher, dass die<br />
Genehmigung (sowohl die wasserrechtliche als auch die endgültige<br />
bundesimmissionsschutzrechtliche Genehmigung) erteilt werden<br />
würde?<br />
Die im Umweltausschuss am 24. Januar 2008 anwesenden Vertreterinnen der<br />
zuständigen Behörde haben darauf hingewiesen, dass „nach dem gegenwärtigen<br />
Erkenntnisstand davon ausgegangen wird, dass in dieser Frist (Ende März 2008) die<br />
notwendigen Anforderungen, die nach dem BImSchG erforderlich sind, abgeprüft sind<br />
und dass eine Genehmigung erteilt werden kann.“ Sie haben nicht erklärt, dass „die<br />
Genehmigung für das Kraftwerk im März 2008 erteilt werde.“<br />
Ebenso wurde von der zuständigen Behörde laut Protokoll vorher deutlich darauf hingewiesen,<br />
dass „es diese Frist nur im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren<br />
gibt, aber nicht im wasserrechtlichen Verfahren.“ Wegen der verfahrensrechtlich<br />
notwendigen Koordinierung der beiden Verfahren (siehe Antwort zu X. 1) beziehen<br />
sich diese Ausführungen auf die isolierte Prüfung der immissionsschutzrechtlichen<br />
Genehmigungsvoraussetzungen, die nur einen Teil des gesamten Prüfumfangs<br />
im durchzuführenden Verwaltungsverfahren beschreibt.<br />
Zum Zeitpunkt der Umweltausschusssitzung standen die Ergebnisse der noch vom<br />
29. Januar bis 11. Februar 2008 durchzuführenden, zweiten öffentlichen Auslegung<br />
des nachgelieferten DHI-Gutachtens im Wasserrechtsverfahren aus (siehe Antwort zu<br />
X. 1. b)). Eine definitive Festlegung eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungstermins<br />
war deshalb schon aus verfahrenstechnischen Gründen in der Sitzung<br />
des Umweltausschusses seitens der zuständigen Behörde nicht möglich. Dies ist laut<br />
Protokoll auch nicht erfolgt, sondern es wurden nur Aussagen zum geplanten beziehungsweise<br />
angestrebten Verfahrensverlauf getätigt.<br />
Im Ergebnis der zweiten öffentlichen Auslegung des nachgelieferten DHI-Gutachtens<br />
und weiterer Unterlagen gingen insgesamt sieben Einwendungen – teilweise sehr<br />
umfänglich – fristgerecht ein, die mit Stellungnahmen seitens der Antragstellerin vom<br />
19. März 2008 und 4. April 2008 abschließend inhaltlich bearbeitet wurden. Seitens<br />
der Genehmigungsbehörde waren aber noch darüber hinaus diverse Detailfragen<br />
offen, die dann im weiteren Verlauf des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens geklärt<br />
worden sind.<br />
Der in der Presseerklärung vom 4. Juni 2008 verwendete Begriff der „Kühlwasser-<br />
Anlage“ bezeichnet das Einleitbauwerk der Kühlwassereinleitung in den Restarm der<br />
Alten Süderelbe, das in seiner Ausführung zur verbesserten Sauerstoffanreicherung<br />
des eingeleiteten Kühlwassers entsprechend einem behördlichen Gutachten noch<br />
baulich optimiert werden musste. Hierzu waren überarbeitete und prüffähige Ausführungsunterlagen<br />
seitens der Antragstellerin nachzureichen (siehe Drs. 19/576 sowie<br />
Drs. 19/862).<br />
c) Welche genauen Ereignisse/Fakten haben dann dazu geführt, dass<br />
sich die Prüfung in dem bekannten Umfang verzögert hat?<br />
Siehe Drs. 19/19, 19/135 und 19/576.<br />
3. In einer Stellungnahme der BSU vom 31.08.2007 erklärten Mitarbeiter<br />
der BSU, dass die Genehmigung des Kraftwerks in <strong>Moorburg</strong> nur unter<br />
sehr umfangreichen Auflagen möglich wäre. Welche genauen Fakten/Erkenntnisse<br />
haben dazu geführt, dass die BSU nur 2 Prozent<br />
Monate später, am 14.11.2007, den Bescheid für die Zulassung des vorzeitigen<br />
Beginns der Errichtung nach § 8a BlmSchG erlassen hat, in<br />
dem es auf Seite 10 heißt „nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand in<br />
diesem Verfahren stehen weder der Erteilung der wasserrechtlichen<br />
Erlaubnis für die Entnahme und Einleitung von Kühlwasser noch der<br />
Erteilung der wasserrechtlichen Plangenehmigung erforderlichenfalls<br />
auch unter Einschränkungen und Auflagen Hindernisse entgegen, die<br />
nicht bis zur Betriebsaufnahme überwunden werden könnten“?<br />
Es handelt sich bei der Zulassung vorzeitigen Beginns um eine verfahrensrechtliche<br />
Prognose über den Ausgang der Zulassungsverfahren dahingehend, dass abzuschät-<br />
12
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode Drucksache 19/1474<br />
zen war, ob alle bis dahin noch bestehenden Genehmigungshindernisse durch Auflagen<br />
beseitigt beziehungsweise überwunden werden können. Da Auflagen auch dergestalt<br />
formuliert werden können, dass sie zu Einschränkungen der Betriebsweise des<br />
beantragten Kraftwerkes führen, wo dies fachlich und rechtlich zum Schutz der<br />
Umwelt geboten ist, war die zuständige Behörde zum Zeitpunkt der Erteilung der<br />
Zulassung vorzeitigen Beginns der Auffassung, dass die Erteilung der beantragten<br />
Zulassungen grundsätzlich möglich sein würde.<br />
4. Laut der Senatsantworten aus den Drs. 19/241 und 19/398 hat die<br />
Behörde sich im Genehmigungsverfahren externen Rat geholt.<br />
a) Wann wurde der Auftrag an die Kanzlei Weissleder & Ewer erteilt?<br />
b) Wie lautete der Auftrag an die Kanzlei Weissleder & Ewer?<br />
c) Wann wurde die Expertise vorgelegt?<br />
Der Auftrag an die Rechtsanwaltssozietät Weissleder & Ewer wurde mit Vertrag vom<br />
25./29. Mai 2008, ergänzt am 16. Juni 2008, erteilt. Auftragsgegenstand war eine<br />
umfassende Beratung und die gerichtliche Vertretung im Rahmen der Untätigkeitsklage<br />
der Firma Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG.<br />
Anders als ursprünglich beabsichtigt, wurde kein bis zu einem bestimmten Zeitpunkt<br />
vorzulegendes Gutachten in Auftrag gegeben. Die Beratung erfolgte dementsprechend<br />
verfahrensbezogen. Auftragsgemäß hat die Rechtsanwaltssozietät Weissleder<br />
& Ewer deshalb bezogen auf den jeweiligen Stand der Zulassungsverfahren beziehungsweise<br />
des Rechtsstreits mit der Firma Vattenfall Europe Generation AG & Co.<br />
KG. zahlreiche Berichte zu verschiedenen rechtlichen Fragen vorgelegt und war auch<br />
im Übrigen beratend in die Erarbeitung einzelner Schritte sowie der Entscheidungen<br />
eng mit eingebunden; dabei erfolgte die Beratung auch mündlich.<br />
d) Welche Handlungsoptionen hat die Kanzlei aufgezeigt?<br />
Im Rahmen der oben beschriebenen Beratung hat die Anwaltssozietät zu unterschiedlichen<br />
Fragen der Handlungsoptionen Versagung, unbeschränkte Erteilung sowie Art<br />
und Umfang von Nebenbestimmungen für den Fall einer eingeschränkten Zulassung<br />
Stellung genommen und Bewertungen abgegeben.<br />
e) In der Antwort zu 19/398 wurden alle vorgelegten Gutachten aufgeführt.<br />
Hat die Kanzlei W & E die Gutachten einer Prüfung unterzogen?<br />
Ja. Im Rahmen der Beauftragung (siehe Antwort zu X. 4. a) bis 4. c)) sind einzelne<br />
Fachgutachten hinsichtlich eventueller Ergänzungsbedürftigkeit im Hinblick auf den<br />
Vortrag gegenüber den Verwaltungsgerichten überprüft worden.<br />
Nein.<br />
Entfällt.<br />
f) Wurden die Gutachten neu bewertet? Wenn ja, welche mit welchem<br />
Ergebnis?<br />
g) Bei welchen Gutachten ergeben sich neue Ergebnisse? Wie lauten<br />
sie?<br />
h) Welche neue Richtung hat das Genehmigungsverfahren durch die<br />
Neubewertung vorliegender Gutachten erhalten?<br />
13
Drucksache 19/1474<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode<br />
Nein.<br />
XI. Verträge und Absprachen<br />
Die Firma Vattenfall erklärte in ihrer ersten Reaktion auf die Genehmigung<br />
des Kraftwerks am 30. September 2008 man werde „prüfen, inwieweit die<br />
Bestimmungen und Nebenbestimmungen der erteilten Genehmigung mit<br />
dem Ende 2007 mit der Stadt Hamburg geschlossenen Vertrag in Einklang<br />
stehen.“<br />
1. Hat es neben der am 14.11.2007 vorgestellten „Umweltvereinbarung“<br />
zwischen der Firma Vattenfall und der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
und dem in Drs. 19/113 erwähnten Vertrag vom 27. April/3. Mai 2007<br />
über die naturschutzrechtlichen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen für<br />
die sich aus dem Vorhaben ergebenen Beeinträchtigungen weitere Verträge<br />
oder Absprachen gegeben, aus denen sich eine Verpflichtung zur<br />
Erteilung der Genehmigung herleiten ließe? Wenn ja, welche?<br />
2. Trifft es zu, dass sich aus der sogenannten Umweltvereinbarung vom<br />
14.11.2007 keine rechtlich verbindlichen Pflichten für die Vertragsparteien<br />
begründen lassen?<br />
3. Welche Bedeutung kommt der sogenannten Umweltvereinbarung vom<br />
14.11.2007 im Zusammenhang mit der nunmehr erteilten Genehmigung<br />
zu?<br />
Siehe Antworten zu VII. 9. d) und 9. e).<br />
4. Wie lautet der genaue Wortlaut des Vertrages vom 27. April/3. Mai 2007<br />
über die naturschutzrechtlichen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen für<br />
die sich aus dem Kraftwerkvorhaben ergebenen Beeinträchtigungen?<br />
Der Wortlaut des Vertrages und seiner Ergänzung vom 9./11. Juni 2008 ist in der<br />
Anlage wiedergegeben. Der Inhalt der Anlagen zu diesen beiden Verträgen ergibt sich<br />
aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan.<br />
a) Welche Auswirkungen hat beziehungsweise hatte dieser Vertrag auf<br />
den Ausgang des Genehmigungsverfahrens?<br />
Der Vertrag hat keine Auswirkungen auf die Frage der Genehmigungsfähigkeit. Er<br />
dient der Bewältigung der aus den naturschutzrechtlichen Eingriffen und Beeinträchtigungen<br />
resultierenden Rechtsfolgen, indem diese nicht losgelöst voneinander in den<br />
einzelnen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren, sondern einheitlich und konfliktfrei<br />
bewältigt werden sollen.<br />
b) Welche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Einzelnen sind<br />
Gegenstand dieses Vertrages?<br />
Gegenstand dieses Vertrages und seiner Ergänzung vom 9./11. Juni 2008 (siehe<br />
nachfolgend Antwort zu XI.4. d) bb) sind die oben in Abschnitt II genannten Kompensationsmaßnahmen.<br />
Siehe Antwort zu XI. 4. a).<br />
c) Welche Rechte und Pflichten ergeben sich für die Stadt und die<br />
Firma Vattenfall aus diesem Vertrag konkret?<br />
d) Laut Senatsantwort in Drs. 19/113 soll dieser Vertrag gegebenenfalls<br />
fortgeschrieben werden. Bis wann gilt dieser Vertrag?<br />
Die in Drs. 19/113 angesprochene Fortschreibung bezog sich nicht auf eine zeitliche,<br />
sondern auf eine inhaltliche Ergänzung des Vertrages. Eine Befristung enthält der<br />
Vertrag nicht.<br />
aa) Wovon ist die Entscheidung der Fortschreibung abhängig?<br />
Eine inhaltliche Ergänzung des Vertrages war abhängig von der Realisierbarkeit einer<br />
vorgesehenen Kompensationsmaßnahme (siehe Antwort zu XI. 4. d) bb)).<br />
14
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode Drucksache 19/1474<br />
bb) Wurde der Vertrag bereits fortgeschrieben oder wird eine Fortschreibung<br />
erfolgen? Wenn ja, mit welchem Inhalt? Wenn nein,<br />
warum nicht?<br />
Der Vertrag wurde am 9./11. Juni 2008 ergänzt um eine Änderung zu den als Kompensation<br />
herzurichtenden Trockenlebensräumen. Die im Vertrag vom 27. April/3. Mai<br />
2007 enthaltenen Maßnahmen zur Herrichtung von Trockenlebensräumen im Bereich<br />
der Besenhorster Sandberge erwiesen sich aus Gründen der Verfügbarkeit der erforderlichen<br />
Flächen sowie aufgrund praktischer Umsetzungsschwierigkeiten als problematisch.<br />
In der Vertragsergänzung wird geregelt, dass stattdessen fachlich und praktisch<br />
deutlich besser geeignete Maßnahmen zur Herrichtung und Entwicklung von<br />
Trockenlebensräumen auf dem ehemaligen Standortübungsplatz der Röttiger Kaserne<br />
umgesetzt werden. Die Finanzierung erfolgt durch die Firma Vattenfall Europe Generation<br />
AG & Co. KG. Die Ausführung der Maßnahmen erfolgt im Zusammenhang mit<br />
weiteren städtischen Naturschutzmaßnahmen durch die zuständige Behörde.<br />
15
Drucksache 19/1474<br />
Zwischen<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode<br />
Anlage<br />
der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
vertreten<br />
durch die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt<br />
- Amt für Natur- und Ressourcenschutz -<br />
- Abteilung Naturschutz - nachfolgend: Naturschutzamt<br />
und<br />
der Fa. Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG. nachfolgend: Vattenfall<br />
wird folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen:<br />
1. Vertragszweck<br />
Vattenfall beabsichtigt, am Standort des ehemaligen Kraftwerks <strong>Moorburg</strong><br />
ein neues Kraftwerk zu errichten. Für die Durchführung der für die<br />
Errichtung des neuen Kraftwerkes notwendigen Maßnahmen sind<br />
mehrere öffentlich-rechtliche Zulassungen und Genehmigungen erforderlich.<br />
Weiterhin sind diese Maßnahmen mit Eingriffen in Natur und<br />
Landschaft (§ 9 HmbNatSchG), der Entfernung von geschützten Bäumen<br />
(Baumschutzverordnung), der Beeinträchtigung von geschützten<br />
Arten (§ 42 BNatSchG) und der Zerstörung von gesetzlich geschützten<br />
Biotopen (§ 28 HmbNatSchG) verbunden.<br />
Die aus diesen naturschutzrechtlichen Eingriffen und Beeinträchtigungen<br />
resultierenden Rechtsfolgen sollen nicht losgelöst voneinander in<br />
den einzelnen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren, sondern<br />
einheitlich und konfliktfrei bewältigt werden. Zu diesem Zweck vereinbaren<br />
die Vertragsparteien eine einheitliche Naturschutzmaßnahme<br />
als alle Eingriffe und Beeinträchtigungen umfassende Kompensationsmaßnahme.<br />
Mit Umsetzung dieser Kompensationsmaßnahme<br />
durch Vattenfall gelten alle zugelassenen und genehmigten natur-<br />
16
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode Drucksache 19/1474<br />
schutzrechtlichen Eingriffe und Beeinträchtigungen, die mit der Durchführung<br />
der für die Errichtung des neuen Kraftwerks notwendigen<br />
Maßnahmen verbunden sind, als ausgeglichen. In den einzelnen Zulassungen<br />
und Genehmigungen soll die in diesem Vertrag vereinbarte<br />
Kompensationsmaßnahme als Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahme<br />
festgesetzt werden.<br />
Etwaige Maßnahmen zur Minimierung nachteiliger Auswirkungen im<br />
Hinblick auf die Verträglichkeit der Kühlwasserentnahme bzw. -<br />
einleitung des Kraftwerkes <strong>Moorburg</strong> mit den Erhaltungszielen für die<br />
FFH- Gebiete im Unterlauf und Oberlauf der Elbe sind nicht Gegenstand<br />
dieser Vereinbarung.<br />
2. Art und Umfang der Kompensationsmaßnahme für das Kraftwerk<br />
<strong>Moorburg</strong><br />
2.1 Vattenfall verpflichtet sich, die in der<br />
Anlage<br />
näher beschriebene Kompensationsmaßnahme in vollem Umfang umzusetzen.<br />
2.2 Das Naturschutzamt bestätigt auf Grundlage der in der Anlage dargestellten<br />
Informationen, dass die in der Anlage näher beschriebene<br />
Kompensationsmaßnahme auch in zeitlicher Hinsicht geeignet ist, die<br />
mit der Errichtung des Kraftwerks <strong>Moorburg</strong> verbundenen, in Ziffer 1<br />
genannten und in der Anlage näher beschriebenen naturschutzrechtlichen<br />
Eingriffe und Beeinträchtigungen nach Art und Umfang vollständig<br />
zu kompensieren.<br />
3. Verfahrensrechtliche Verknüpfung<br />
Soweit das Naturschutzamt selbst zuständige Behörde für die Erteilung<br />
von Zulassungen und Genehmigungen im Zusammenhang mit<br />
der Errichtung des Kraftwerks ist, wird das Naturschutzamt die in der<br />
Anlage näher beschriebene Maßnahme als Kompensationsmaßnahme<br />
festsetzen. Für den Fall, dass eine andere Dienststelle der FHH zuständig<br />
für die Erteilung von Zulassungen und Genehmigungen ist, sichert<br />
das Naturschutzamt zu, das erforderliche Einvernehmen nach §<br />
10 Abs. 1 HmbNatSchG zur Festsetzung der in der Anlage näher be-<br />
17
Drucksache 19/1474<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode<br />
schriebenen Maßnahme als naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme<br />
zu erteilen.<br />
4. Ausführungsplanung, Fristen<br />
4.1. Die Umsetzung der in der Anlage näher beschriebenen Kompensationsmaßnahme<br />
bedarf in wesentlichen Teilen einer wasserrechtlichen<br />
Zulassung nach § 31 WHG. Die hierfür erforderliche Genehmigungsplanung<br />
ist von einem qualifizierten Büro zu erstellen und mit der Behörde<br />
für Stadtentwicklung und Umwelt / NR 32 abzustimmen. Der Antrag<br />
auf Zulassung nach § 31 WHG ist unverzüglich, d.h. parallel zum<br />
BImSchG - Genehmigungsverfahren zu stellen.<br />
4.2 Vattenfall ist verpflichtet, die in der Anlage dargestellte Kompensationsmaßnahme<br />
unverzüglich nach Bestandskraft der wasserrechtlichen<br />
Zulassung nach § 31 WHG umzusetzen. Vattenfall ist berechtigt, auch<br />
vor Bestandskraft der wasserrechtlichen Zulassung mit der Umsetzung<br />
zu beginnen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen.<br />
4.3 Spätestens 3 Monate nach Fertigstellung der Arbeiten zur Umsetzung<br />
der in der der Anlage näher beschriebenen Maßnahme ist bei der Zulassungsbehörde<br />
und der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt /<br />
NR 32 die Abnahme der Maßnahme zu beantragen, bei der die ordnungsgemäße<br />
Durchführung der Arbeiten nachzuweisen ist. Alternativ<br />
zur Maßnahmenabnahme kann der Zulassungsbehörde und der Behörde<br />
für Stadtentwicklung und Umwelt / NR 32 eine Bestätigung des<br />
mit der Durchführungsplanung beauftragten Fachbüros der vorgelegt<br />
werden, in der die einwandfreie Durchführung der Kompensationsmaßnahmen<br />
bestätigt wird.<br />
4.4. Die in der Anlage näher beschriebene Kompensationsmaßnahme ist<br />
durch Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zu<br />
Gunsten. der Freien und Hansestadt Hamburg im jeweiligen Grundbuch<br />
dauerhaft zu sichern.<br />
5. Wirksamwerden<br />
Für den Fall, dass die Zulassungs- und Genehmigungsentscheidungen<br />
für die Durchführung der für die Errichtung des neuen Kraftwerkes<br />
notwendigen Maßnahmen nicht innerhalb von drei Jahren ab Abschluss<br />
dieses Vertrages bestandskräftig werden, sind beide Vertragsparteien<br />
berechtigt, von diesem Vertrage zurückzutreten. Ein Rück-<br />
18
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode Drucksache 19/1474<br />
trittsrecht besteht nicht, soweit Zulassungs- und Genehmigungsentscheidungen<br />
über kompensationspflichtige naturschutzrechtliche Eingriffe<br />
und Beeinträchtigungen gemäß Ziffer 1 bereits vollzogen worden<br />
sind und die Kompensationsmaßnahme gem. Ziffer 2 in Bezug auf diese<br />
Eingriffe und Beeinträchtigungen bereits umgesetzt worden ist. Eine<br />
Schadenersatzpflicht oder eine Verpflichtung zum Ersatz vergeblicher<br />
Aufwendungen ist ausgeschlossen.<br />
6. Kündigung<br />
Vattenfall ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn das Kraftwerk<br />
<strong>Moorburg</strong> nicht errichtet wird.<br />
7. Schlussbestimmung<br />
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar<br />
sein oder werden, oder sollte in diesem Vertrag ein für seine<br />
Durchführung regelungsbedürftiger Punkt nicht geregelt sein, so wird<br />
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages dadurch<br />
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung<br />
oder zur Ausfüllung des Vertrages gilt das als vereinbart,<br />
was gemäß Vertragszweck in rechtlich zulässiger Weise der unwirksamen<br />
oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt oder<br />
die Beteiligten zur Regelung des regelungsbedürftigen Punktes vereinbart<br />
hätten.<br />
Hamburg, den 27.04.2007<br />
19
Drucksache 19/1474<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode<br />
Zwischen<br />
der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
vertreten<br />
durch die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt<br />
- Amt für Natur- und Ressourcenschutz -<br />
- Abteilung Naturschutz - nachfolgend: Naturschutzamt<br />
und<br />
Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG<br />
nachfolgend: Vattenfall<br />
wird nachfolgende Modifizierung zum öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 03.<br />
Mai 2007 vereinbart:<br />
1. Vorbemerkung<br />
Vattenfall ist verpflichtet, für die Beseitigung von Trocken- und Halbtrockenrasen<br />
(2,54 ha) auf dem ehemaligen Betriebsgeländes des Kraftwerks<br />
<strong>Moorburg</strong> Kompensationsmaßnahmen herzustellen und diese<br />
dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Die Beseitigung von Trockenund<br />
Halbtrockenrasen wurde mit Genehmigungsbescheid der Behörde<br />
für Stadtentwicklung und Umwelt vom 16.05.2007 zugelassen und ist<br />
bereits im Rahmen der Kampfmittelsondierung und –räumung sowie<br />
der Altlastensanierung erfolgt. Nach den Vorgaben des zwischen den<br />
Vertragsparteien geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages vom<br />
03.05.2007 ist vorgesehen, den Ausgleich für den Verlust des Trocken-<br />
und Halbtrockenrasens in den Besenhorster Sandbergen umzusetzen.<br />
Es hat sich aber in der weiteren Planung dieser Maßnahme<br />
20
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode Drucksache 19/1474<br />
gezeigt, dass deren Realisierung mit erheblichen Schwierigkeiten im<br />
Hinblick auf die Akzeptanz durch die Nachbarschaft und die Gewährleistung<br />
der dauerhaften Pflege und Unterhaltung verbunden wäre.<br />
Daher soll eine andere Maßnahme als Ausgleich für den Verlust des<br />
Trocken- und Halbtrockenrasens umgesetzt werden.<br />
2. Kompensation für die Entfernung des Trocken- und Halbtrockenrasen<br />
auf dem ehemaligen Betriebsgelände des Kraftwerks <strong>Moorburg</strong><br />
2.1. Vattenfall verpflichtet sich, die in der<br />
Anlage 1<br />
näher beschriebene Kompensationsmaßnahmen im Bereich des e-<br />
hemaligen Truppenübungsplatzes der Röttiger Kaserne umzusetzen<br />
und diese dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Die Verpflichtung, eine<br />
Kompensationsmaßnahme in den Besenhorster Sandbergen zu realisieren,<br />
entfällt.<br />
2.2. Das Naturschutzamt ist mit der Durchführung von Kompensationsmaßnahmen<br />
für die Beseitigung des Trocken- und Halbtrockenrasens<br />
auf dem im Eigentum des Naturschutzamtes stehenden Grundstück im<br />
Bereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes der Röttiger Kaserne<br />
einverstanden.<br />
2.3. Das Naturschutzamt wird die Kompensationsmaßnahmen im Bereich<br />
des ehemaligen Truppenübungsplatzes der Röttiger Kaserne für Vattenfall<br />
herstellen, dauerhaft pflegen und umsetzen.<br />
21
Drucksache 19/1474<br />
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode<br />
2. Kosten<br />
2.1. Vattenfall erstattet dem Naturschutzamt anteilig für eine Fläche von 3,8<br />
ha die Grunderwerbskosten für das Grundstück im Bereich des ehemaligen<br />
Truppenübungsplatzes der Röttiger Kaserne in Höhe von<br />
23.940 €.<br />
2.2 Das Naturschutzamt erhält für die Herstellung der Kompensationsmaßnahmen<br />
sowie deren dauerhaften Pflege und Erhaltung einschließlich<br />
der entstehenden Verwaltungskosten von Vattenfall einen<br />
kapitalisierten Betrag in Höhe von<br />
244.000 €<br />
Die Berechnung des Betrages ergibt aus der diesem Vertrag beigefügten<br />
Anlage 2<br />
Mit Zahlung der Beträge na Ziffer 2.1 und Ziffer 2.2 sind sämtliche Ansprüche<br />
aus dieser Vereinbarung abgegolten. Sollte das Naturschutzamt<br />
seinen Verpflichtungen aus Ziffer 2.3 nicht nachkommen, hat Vattenfall<br />
einen Anspruch auf Rückzahlung des gemäß Ziffer 2.1 an das<br />
Naturschutzamt gezahlten Betrages.<br />
3. Zahlung und Fristen<br />
3.1. Das Naturschutzamt wird Vattenfall die Bankverbindung und das Kassenzeichen<br />
für die Zahlung des Betrages nach § 2 in einer gesonderten<br />
Zahlungsaufforderung mitteilen. Die Zahlung durch Vattenfall erfolgt<br />
spätestens 4 Wochen nach Erhalt der Zahlungsaufforderung.<br />
3.2. Das Naturschutzamt beginnt nach Vertragsschluss mit der Ausführungsplanung<br />
für die Kompensationsmaßnahmen und wird die Herstellung<br />
der Maßnahme voraussichtlich bis<br />
zum 15. März 2009<br />
abschließen.<br />
4. Im Übrigen bleibt der öffentlich-rechtliche Vertrag vom 03. Mai 2007<br />
unberührt.<br />
22