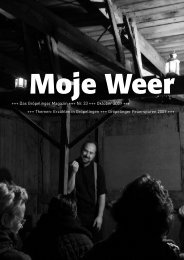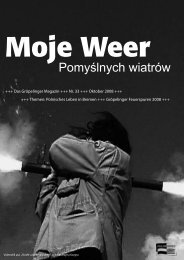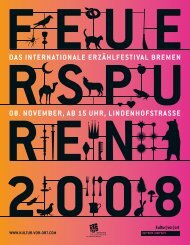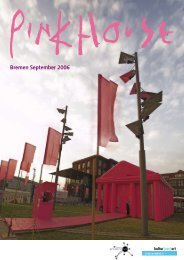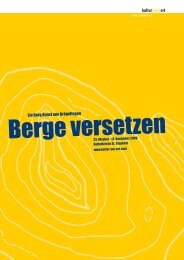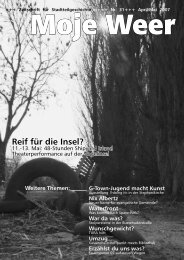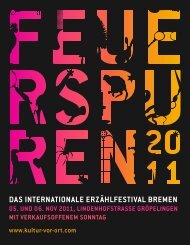Download | PDF - Kultur Vor Ort e.V.
Download | PDF - Kultur Vor Ort e.V.
Download | PDF - Kultur Vor Ort e.V.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
30 31<br />
Ich wollte jedoch – und das nur weil meine deutschen<br />
Freunde ins Gymnasium gehen wollten – das Gymnasium<br />
besuchen und habe meine Eltern auch selber davon überzeugt.<br />
Dann ging ich aufs Gymnasium und habe anschließend<br />
mein Abitur und danach mein Studium absolviert.<br />
Hätte ich die Realschule besucht, hätte ich vielleicht<br />
eine Lehre gemacht und nicht studiert. Ich denke, dass auch<br />
viele Lehrkräfte zu wenig über die Möglichkeiten überhaupt<br />
aufgeklärt haben.<br />
Heutzutage sehen wir ja, dass die dritte Generation an<br />
Migranten höhere Abschlüsse erlangen, was sehr positiv zu<br />
beurteilen ist. Das ist aber auch nur dadurch entstanden,<br />
dass die zweite Generation das System kennengelernt hat<br />
und dementsprechend die Chancen ihrer Kinder fördert.<br />
Ein besonders schwieriges Problem scheint zu sein, wenn<br />
Kinder dringend Förderung brauchen. Viele Migranten<br />
lehnen das ab. Warum wird diese Hilfe nicht angenommen?<br />
Ich habe während meiner Schullaufbahn keine Förderangebote<br />
– zu meiner Zeit gab es nur wenige – wahrgenommen.<br />
Heute denke ich, dass es durchaus sinnvoll gewesen wäre,<br />
diese wahrzunehmen. Es hätte mir sicherlich einiges<br />
erleichtert.<br />
Hier sollte angesetzt werden und mehr Aufklärungsarbeit<br />
in den Migrantenverbänden geleistet werden. Ich denke,<br />
dass viele Familien immer noch keinen Nutzen in solchen<br />
Förderangeboten sehen. Diese Angebote, wenn sie denn<br />
kostenpflichtig sind, können leider von einigen Familien<br />
nicht wahrgenommen werden. Die Angebote sollten nicht<br />
kostenpflichtig sein. Wenn diese Angebote nachmittags<br />
stattfinden, kollidiert es meist mit dem konsularischen<br />
Türkischunterricht. So war es zumindest bei mir der Fall.<br />
Hier muss wieder das Bildungssystem der türkischen<br />
Sprache eine größere Bedeutung beimessen. Die Familien<br />
möchten nicht, dass ihre Kinder der türkischen Sprache<br />
nicht mächtig sind. Deshalb wollen Sie, dass ihre Kinder<br />
sowohl die deutsche als auch die türkische Sprache gut<br />
beherrschen und schicken dementsprechend ihre Kinder in<br />
diesen Unterricht. Würde Türkisch jedoch regulär im<br />
Unterricht erteilt, hätten wir das Problem nicht und die<br />
Kinder würden keiner Doppelbelastung ausgesetzt werden.<br />
Einige Schulen fühlen sich insbesondere von den Moscheen<br />
wenig unterstützt. Dabei könnten doch die Moscheen<br />
ihren Einfluss nutzen, um die Probleme im Bildungsbereich<br />
besser zu lösen. Wie sehen Sie die Rolle der Moscheen?<br />
Was können Moscheen tun, um die Bildungschancen für<br />
Migrantenkinder zu verbessern?<br />
Die Aufgaben der Moscheen sind vielfältig und wichtig. Sie<br />
haben Recht, wenn Sie behaupten, die Moscheen könnten<br />
diese Brückenfunktion wahrnehmen und in der Lösung des<br />
Problems eine große Rolle spielen.<br />
Sprachcafe Deutsch<br />
Ungezwungen Deutsch sprechen in gemütlicher Atmosphäre – das ist<br />
das Ziel des im vergangenen Jahr erstmals eingerichteten „Sprachcafé<br />
Deutsch“ im café brand in Gröpelingen. Sprachcafés sind Konversationsnachmittage,<br />
an denen Menschen mit guten bis sehr guten deutschen<br />
Sprachkenntnissen bzw. Muttersprachler und Menschen, die mindestens<br />
Grund kenntnisse in der deutschen Sprache besitzen, aber wenig<br />
Gelegenheit haben diese anzuwenden, teilnehmen.<br />
Sprachcafé-Nachmittage sind keine reinen Sprachkurse, sie sollen vor<br />
allem dazu dienen, das Kennenlernen und den Austausch zwischen<br />
Menschen im Stadtteil zu fördern und dabei die Deutschkenntnisse der<br />
TeilnehmerInnen weiterzuentwickeln.<br />
Das Sprachcafé findet unter der Leitung der Moderatorin Ruken Aytas<br />
statt, die mit großer Sensibilität durch die Veranstaltung führt und verschiedene<br />
Gesprächsthemen einbringt, wie z.B. Familie, Zweisprachigkeit<br />
bei Kindern, Freizeit, Sport. Auch die bisher für die Dauer der Gesprächszeit<br />
angebotene Kinderbetreuung gehört zum Konzept.<br />
Die Pilotphase von November 2008 bis März diesen Jahres wurde vom<br />
Stadtteilbeirat Gröpelingen finanziell unterstützt. Das Ergebnis war so<br />
ermutigend, dass sich die Bremer Volkshochschule West jetzt zur Fortführung<br />
des Projektes entschlossen hat. Einmal im Monat soll es dieses<br />
Angebot künftig geben. Initiatorinnen sind Susanne Nolte von der Bremer<br />
Volkshochschule West und Ulrike Pala aus dem <strong>Ort</strong>samt West, die<br />
sich über das steigende Interesse des Projektes freuen. Ihre Einschätzung:<br />
„Wer dieses Angebot wahrnimmt, muss auch Vertrauen in das Projekt<br />
und die Menschen haben, die es durchführen. Dieses Vertrauen ist in<br />
den bisherigen Veranstaltungen gewachsen und bildet eine gute Basis<br />
für die Fortsetzung des Sprachcafé“.<br />
Susanne Nolte<br />
Weitere Informationen erhalten Sie unter 361-82 08 (VHS) oder<br />
361-84 70 (<strong>Ort</strong>samt West).<br />
Jedoch gibt es eine Tatsache, die leider immer wieder<br />
ausgeblendet wird: Die Arbeit in den Moscheen findet<br />
ausschließlich ehrenamtlich statt. Erwerbstätige <strong>Vor</strong>standsmitglieder<br />
versuchen nach ihrer regulären Arbeit den<br />
Moscheebetrieb aufrecht zu erhalten. Die Moscheen<br />
finanzieren sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen,<br />
die gerade mal die Kosten jeder Gemeinde<br />
abdecken.<br />
Gleichzeitig erleben wir, dass gerade die Jugendlichen, die<br />
in der Moschee sind und diese auch regelmäßig besuchen,<br />
die ethischen Werte mitnehmen und höhere Abschlüsse<br />
erlangen als gleichaltrige Migranten, die die Angebote der<br />
Moschee nicht nutzen.<br />
Es wird in den Moscheen – ihren Möglichkeiten entsprechend<br />
– viel getan. Da diese Arbeit jedoch ausschließlich<br />
ehrenamtlich stattfindet, stößt sie an ihre Grenzen.<br />
Hier muss wieder die Politik eingreifen und die Moscheen<br />
OECD Studie<br />
unterstützen. Seit vielen Jahrzehnten wird die Arbeit ohne<br />
jegliche Unterstützung der Politik fortgesetzt. Nun ist es an<br />
der Zeit, die Moscheen und die islamischen Dachverbände<br />
zu unterstützen, um die Probleme, die Sie ansprechen, zu<br />
bewältigen.<br />
Die Politik sollte dazu auf Bundes- und Landesebene<br />
Staatsverträge mit den Dachverbänden unterzeichnen, die<br />
eine <strong>Vor</strong>stufe auf dem Weg zur „Körperschaft des öffentlichen<br />
Rechts“ darstellen. Somit könnten die Gemeinden<br />
viel mehr leisten und genau zur Lösung dieser Probleme<br />
beitragen.<br />
Viele sehen in mangelnden Deutschkenntnissen eine<br />
Ursache der Probleme für Migrantenkinder im deutschen<br />
Schulsystem. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die<br />
Sprache?<br />
Die fehlenden Deutschkenntnisse sind mit Sicherheit ein<br />
Hindernis auf dem Weg zu einem erfolgreichem Schulabschluss.<br />
Hier kann ich nur wieder auf das eben genannte<br />
Defizit in der sprachlichen Förderung zu sprechen kommen.<br />
Auch bei gleichen Bildungsabschlüssen sind Nachkommen der Migranten benachteiligt<br />
Nachkommen von Einwanderern haben in Deutschland und Österreich<br />
deutlich schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als junge<br />
Menschen mit zumindest einem im Inland geborenen Elternteil.<br />
Dies gilt auch, wenn sie das gleiche Bildungsniveau erreichen. In<br />
der Schweiz gelingt die Arbeitsmarktintegration der sogenannten<br />
„zweiten Generation“ dagegen vergleichsweise gut. Zu diesem Ergebnis<br />
kommt eine Vergleichsstudie zur Arbeitsmarktintegration<br />
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung<br />
(OECD), die im Oktober 2009 in Paris vorgestellt wurde.<br />
Zum ersten Mal liegen mit dieser Studie Vergleichszahlen für 16<br />
OECD-Länder zur Arbeitsmarktintegration der im Inland geborenen<br />
Nachkommen von Migranten vor. Die Daten sind ein wichtiger<br />
Indikator für den Integrationserfolg, da sowohl die Nachkommen<br />
von Migranten als auch die Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund<br />
(schließt auch Personen mit nur einem im Ausland geborenen<br />
Elternteil ein) ihre gesamte Sozialisation und Ausbildung im<br />
gleichen Land erhalten haben. Die Studie ist Teil eines gemeinsamen<br />
Projektes von OECD und Europäischer Kommission und wurde<br />
Anfang Oktober in Brüssel unter Fachleuten diskutiert.<br />
Geringqualifizierte unter Migrantenkindern deutlich<br />
überrepräsentiert<br />
In Deutschland ist unter den 20 bis 29-Jährigen mit Migrationshintergrund<br />
der Anteil der Geringqualifizierten ohne Abitur oder abgeschlossene<br />
Berufsausbildung doppelt so hoch wie in der gleichen<br />
Altersgruppe ohne Migrationshintergrund, in Österreich sogar dreimal<br />
so hoch. Auch bei den PISA-Studien zeigt sich ein ähnliches Bild:<br />
Die Migranten werden in ihrer Herkunftssprache nicht<br />
unterstützt. Wir sehen leider gerade auch in Bremen, dass<br />
die türkische Sprache aus den Lehrplänen gestrichen und in<br />
den Schulen nicht mehr angeboten wird. Das ist eine<br />
gravierende Fehlentwicklung. Wissenschaftliche Studien<br />
belegen, dass Kinder, die ihre eigene Herkunftssprache gut<br />
beherrschen, auch die deutsche, bzw. die Sprache des<br />
Landes, in dem sie leben, besser verstehen und lernen<br />
können. Die Sprache ist das wichtigste Element auf dem<br />
Weg zu einem erfolgreichen Abschluss. Deshalb sollte die<br />
Herkunftssprache gefördert werden, damit das Problem<br />
keines mehr ist.<<br />
Der vergleichsweise hohe Anteil an Geringqualifizierten bei den 20-<br />
bis 29-Jährigen mit Migrationshintergrund korrespondiert in<br />
Deutschland und Österreich mit großen Defiziten, die Jugendliche<br />
mit Migrationshintergrund in ihren schulischen Leistungen aufweisen.<br />
Hochqualifizierte Einwandererkinder werden diskriminiert<br />
Besonders bemerkenswert ist aber ein weiteres Ergebnis der Studie:<br />
Auch bei gleichem Bildungsstand haben junge Erwachsene mit<br />
Migrationshintergrund deutlich geringere Beschäftigungschancen<br />
als die Vergleichsgruppe ohne im Ausland geborene Eltern.<br />
So haben in Deutschland 90 Prozent der 20 bis 29-jährigen hochqualifizierten<br />
Männer ohne Migrationshintergrund einen Arbeitsplatz.<br />
Bei der vergleichbaren Gruppe mit Migrationshintergrund<br />
sind es dagegen nur 81 Prozent.<br />
Je besser sich die Kinder der Einwanderer qualifizieren, je höhere<br />
Bildungsabschlüsse sie erreichen, desto weniger Chancen haben<br />
sie, einen angemessenen Beruf ausüben zu können. „Dieser Befund<br />
überrascht, da beide Gruppen ihre Bildungsabschlüsse in der<br />
Regel im Inland erworben haben. Eine Erklärung könnte sein, dass<br />
in Deutschland und Österreich auf dem Arbeitsmarkt die Erwartung<br />
vorherrscht, dass Migranten und deren Nachkommen eher<br />
gering qualifiziert sind. Bildungserfolge von Migranten und deren<br />
Nachkommen werden entsprechend noch nicht ausreichen honoriert“,<br />
sagte OECD-Migrationsexperte Thomas Liebig.<br />
www.oecd.org/document/63/0,3343,de_34968570_35008930_4388025<br />
5_1_1_1_1,00.html