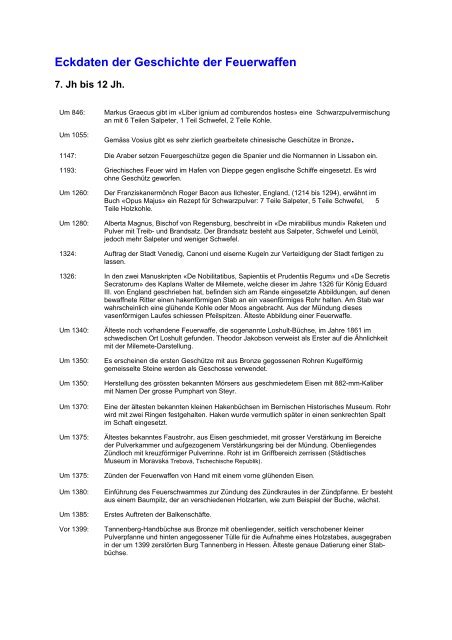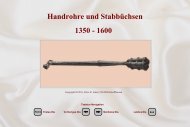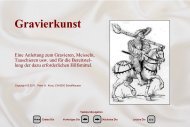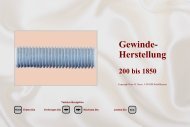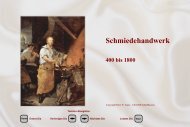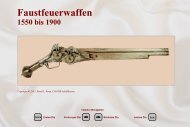Eckdaten der Geschichte der Feuerwaffen - feuerwaffen.ch
Eckdaten der Geschichte der Feuerwaffen - feuerwaffen.ch
Eckdaten der Geschichte der Feuerwaffen - feuerwaffen.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Eckdaten</strong> <strong>der</strong> <strong>Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te</strong> <strong>der</strong> <strong>Feuerwaffen</strong><br />
7. Jh bis 12 Jh.<br />
Um 846: Markus Graecus gibt im «Liber ignium ad comburendos hostes» eine S<strong>ch</strong>warzpulvermis<strong>ch</strong>ung<br />
an mit 6 Teilen Salpeter, 1 Teil S<strong>ch</strong>wefel, 2 Teile Kohle.<br />
Um 1055:<br />
Gemäss Vosius gibt es sehr zierli<strong>ch</strong> gearbeitete <strong>ch</strong>inesis<strong>ch</strong>e Ges<strong>ch</strong>ütze in Bronze.<br />
1147: Die Araber setzen Feuerges<strong>ch</strong>ütze gegen die Spanier und die Normannen in Lissabon ein.<br />
1193: Grie<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>es Feuer wird im Hafen von Dieppe gegen englis<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>iffe eingesetzt. Es wird<br />
ohne Ges<strong>ch</strong>ütz geworfen.<br />
Um 1260: Der Franziskanermön<strong>ch</strong> Roger Bacon aus Il<strong>ch</strong>ester, England, (1214 bis 1294), erwähnt im<br />
Bu<strong>ch</strong> «Opus Majus» ein Rezept für S<strong>ch</strong>warzpulver: 7 Teile Salpeter, 5 Teile S<strong>ch</strong>wefel, 5<br />
Teile Holzkohle.<br />
Um 1280: Alberta Magnus, Bis<strong>ch</strong>of von Regensburg, bes<strong>ch</strong>reibt in «De mirabilibus mundi» Raketen und<br />
Pulver mit Treib- und Brandsatz. Der Brandsatz besteht aus Salpeter, S<strong>ch</strong>wefel und Leinöl,<br />
jedo<strong>ch</strong> mehr Salpeter und weniger S<strong>ch</strong>wefel.<br />
1324: Auftrag <strong>der</strong> Stadt Venedig, Canoni und eiserne Kugeln zur Verteidigung <strong>der</strong> Stadt fertigen zu<br />
lassen.<br />
1326: In den zwei Manuskripten «De Nobilitatibus, Sapientiis et Prudentiis Regum» und «De Secretis<br />
Secratorum» des Kaplans Walter de Milemete, wel<strong>ch</strong>e dieser im Jahre 1326 für König Eduard<br />
III. von England ges<strong>ch</strong>rieben hat, befinden si<strong>ch</strong> am Rande eingesetzte Abbildungen, auf denen<br />
bewaffnete Ritter einen hakenförmigen Stab an ein vasenförmiges Rohr halten. Am Stab war<br />
wahrs<strong>ch</strong>einli<strong>ch</strong> eine glühende Kohle o<strong>der</strong> Moos angebra<strong>ch</strong>t. Aus <strong>der</strong> Mündung dieses<br />
vasenförmigen Laufes s<strong>ch</strong>iessen Pfeilspitzen. Älteste Abbildung einer Feuerwaffe.<br />
Um 1340: Älteste no<strong>ch</strong> vorhandene Feuerwaffe, die sogenannte Loshult-Bü<strong>ch</strong>se, im Jahre 1861 im<br />
s<strong>ch</strong>wedis<strong>ch</strong>en Ort Loshult gefunden. Theodor Jakobson verweist als Erster auf die Ähnli<strong>ch</strong>keit<br />
mit <strong>der</strong> Milemete-Darstellung.<br />
Um 1350: Es ers<strong>ch</strong>einen die ersten Ges<strong>ch</strong>ütze mit aus Bronze gegossenen Rohren Kugelförmig<br />
gemeisselte Steine werden als Ges<strong>ch</strong>osse verwendet.<br />
Um 1350: Herstellung des grössten bekannten Mörsers aus ges<strong>ch</strong>miedetem Eisen mit 882-mm-Kaliber<br />
mit Namen Der grosse Pumphart von Steyr.<br />
Um 1370: Eine <strong>der</strong> ältesten bekannten kleinen Hakenbü<strong>ch</strong>sen im Bernis<strong>ch</strong>en Historis<strong>ch</strong>es Museum. Rohr<br />
wird mit zwei Ringen festgehalten. Haken wurde vermutli<strong>ch</strong> später in einen senkre<strong>ch</strong>ten Spalt<br />
im S<strong>ch</strong>aft eingesetzt.<br />
Um 1375: Ältestes bekanntes Faustrohr, aus Eisen ges<strong>ch</strong>miedet, mit grosser Verstärkung im Berei<strong>ch</strong>e<br />
<strong>der</strong> Pulverkammer und aufgezogenem Verstärkungsring bei <strong>der</strong> Mündung. Obenliegendes<br />
Zündlo<strong>ch</strong> mit kreuzförmiger Pulverrinne. Rohr ist im Griffberei<strong>ch</strong> zerrissen (Städtis<strong>ch</strong>es<br />
Museum in Moravská Trebová, Ts<strong>ch</strong>e<strong>ch</strong>is<strong>ch</strong>e Republik).<br />
Um 1375: Zünden <strong>der</strong> <strong>Feuerwaffen</strong> von Hand mit einem vorne glühenden Eisen.<br />
Um 1380: Einführung des Feuers<strong>ch</strong>wammes zur Zündung des Zündkrautes in <strong>der</strong> Zündpfanne. Er besteht<br />
aus einem Baumpilz, <strong>der</strong> an vers<strong>ch</strong>iedenen Holzarten, wie zum Beispiel <strong>der</strong> Bu<strong>ch</strong>e, wä<strong>ch</strong>st.<br />
Um 1385: Erstes Auftreten <strong>der</strong> Balkens<strong>ch</strong>äfte.<br />
Vor 1399: Tannenberg-Handbü<strong>ch</strong>se aus Bronze mit obenliegen<strong>der</strong>, seitli<strong>ch</strong> vers<strong>ch</strong>obener kleiner<br />
Pulverpfanne und hinten angegossener Tülle für die Aufnahme eines Holzstabes, ausgegraben<br />
in <strong>der</strong> um 1399 zerstörten Burg Tannenberg in Hessen. Älteste genaue Datierung einer Stabbü<strong>ch</strong>se.
13. Jh.<br />
1408: Brauns<strong>ch</strong>weig hat ein Ges<strong>ch</strong>ütz, die «Faule Metze», wel<strong>ch</strong>es 300-Pfund-Steine s<strong>ch</strong>iesst.<br />
Um 1420: Erfindung <strong>der</strong> Lunte: Fingerdicker Hanfstrick, mit Bleizucker gebeizt, mit Fähigkeit zu langem<br />
Glimmen.<br />
Um 1420: Erfinden des Körnens des S<strong>ch</strong>warzpulvers für einen glei<strong>ch</strong>mässigeren Abbrand.<br />
Um 1425: Einführung <strong>der</strong> Hakenbü<strong>ch</strong>se, au<strong>ch</strong> Arquebus o<strong>der</strong> Reisbü<strong>ch</strong>se genannt. Sie besitzt ein grösseres<br />
Kaliber und ein längeres Rohr als die Handbü<strong>ch</strong>se sowie einen Haken zur Aufnahme des<br />
Rückstosses an <strong>der</strong> Mauer einer Befestigung o<strong>der</strong> Burg.<br />
Um 1430: Mehrs<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>tig ges<strong>ch</strong>miedetes Eisenrohr: Frühe Handbü<strong>ch</strong>se mit übereinan<strong>der</strong>ges<strong>ch</strong>miedeten,<br />
aus Stäben gefertigten Rohren mit insgesamt a<strong>ch</strong>t im glühenden Zustand aufgezogenen<br />
Verstärkungsringen (wurde im Tiber bei Rom gefunden und befindet si<strong>ch</strong> heute im Bernis<strong>ch</strong>en<br />
Historis<strong>ch</strong>en Museum).<br />
Um 1435: Stangenbü<strong>ch</strong>se aus Bronze mit ursprüngli<strong>ch</strong>er Stange, im Jahre 1871 im Kuris<strong>ch</strong>en Haff<br />
ausgegraben. Das Zündlo<strong>ch</strong> auf <strong>der</strong> Oberseite des Oktogonallaufes kann dur<strong>ch</strong> einen drehbaren<br />
Deckel abgedeckt werden. Im Ei<strong>ch</strong>ens<strong>ch</strong>aft befindet si<strong>ch</strong> eine Längsbohrung zur Aufnahme<br />
eines hölzernen Ladestockes.<br />
Um 1450: Erste Luntens<strong>ch</strong>lösser mit Abzugsstange. Das Luntens<strong>ch</strong>loss besitzt einen Hahn, den<br />
sogenannten Dra<strong>ch</strong>en o<strong>der</strong> die sogenannte Serpentine. In dessen oberes Ende wird die Lunte<br />
mit einer S<strong>ch</strong>raube festgeklemmt. Mit <strong>der</strong> Abzugstange wird die Lunte langsam auf die Pulverpfanne<br />
gesenkt.<br />
Um 1450: Einführung von Orgelges<strong>ch</strong>ützen mit bis zu 40 Rohren auf zweirädrigem Karren. Die<br />
Abfeuerung erfolgt einzeln von Hand mit Lunte o<strong>der</strong> gesamthaft über eine gemeinsame<br />
Pulverpfanne.<br />
Um 1460: Einsatz spannenlanger Rohre, genannt Scopizus, mit Luntens<strong>ch</strong>loss bei den italienis<strong>ch</strong>en<br />
lei<strong>ch</strong>ten Reitern. Abfeuerung ab Pferd mit vor<strong>der</strong>er, gabelförmiger, am Sattel befestigter Stütze.<br />
Um 1460: Ers<strong>ch</strong>einen <strong>der</strong> ersten Zielvorri<strong>ch</strong>tungen in <strong>der</strong> Form eines Kornes.<br />
1461: Erste Erwähnung eines Pfannendeckels in Nie<strong>der</strong>s<strong>ch</strong>riften von Nürnberg.<br />
1464: Das wohl grösste Kanonenrohr mit einem Bronzelauf von 5 Metern Länge, einem Kaliber von<br />
66 cm und einem Gewi<strong>ch</strong>t 18¾ Tonnen, das sogenannte Dardanellenges<strong>ch</strong>ütz, wird von<br />
Mohammed II., dem Türken, bei <strong>der</strong> Belagerung von Konstantinopel vor dessen Mauern hergestellt.<br />
13 Ges<strong>ch</strong>ütze wurden dabei erfolgrei<strong>ch</strong> für die Belagerung eingesetzt, wobei eines<br />
zersprang. Die Pulverkammer ist über ein Gewinde mit einem Gewindedur<strong>ch</strong>messer von<br />
ungefähr 60 cm ans<strong>ch</strong>raubbar. Kugelgewi<strong>ch</strong>t 720 Pfund.<br />
Um 1490: Leonardo da Vinci ma<strong>ch</strong>t Entwürfe für ein Rads<strong>ch</strong>loss mit S<strong>ch</strong>raubenfe<strong>der</strong> und ein Reibstabs<strong>ch</strong>loss.<br />
Es ist ungewiss, ob es si<strong>ch</strong> um ein Gerät zum Entfa<strong>ch</strong>en von Feuer o<strong>der</strong> um ein<br />
S<strong>ch</strong>loss für <strong>Feuerwaffen</strong> handelt.<br />
Um 1490: Einführung <strong>der</strong> S<strong>ch</strong>lagfe<strong>der</strong> mit Knopfs<strong>ch</strong>ussauslösung beim Luntens<strong>ch</strong>loss.<br />
Um 1490: Erste Anwendung <strong>der</strong> sogenannte S<strong>ch</strong>wanzs<strong>ch</strong>raube mit Aussengewinde für den Abs<strong>ch</strong>luss<br />
des Laufes bei <strong>der</strong> Pulverkammer.
14. Jh.<br />
Um 1500: Erfindung des Kalibersystems, beruhend auf dem Verhältnis des Bohrungsdur<strong>ch</strong>messers zum<br />
Steingewi<strong>ch</strong>t <strong>der</strong> Kugel dur<strong>ch</strong> den Vikar <strong>der</strong> St.-Sebalds-Kir<strong>ch</strong>e, Georg Hartmann,<br />
(1489–1564).<br />
Um 1500: Älteste no<strong>ch</strong> erhaltene Handbü<strong>ch</strong>se mit funkenbilden<strong>der</strong> Zündvorri<strong>ch</strong>tung. Sie ist unter <strong>der</strong><br />
Bezei<strong>ch</strong>nung Mön<strong>ch</strong>sbü<strong>ch</strong>se bekannt und befindet si<strong>ch</strong> in <strong>der</strong> Rüstkammer Dresden.<br />
Um 1500: Erstes Ers<strong>ch</strong>einen <strong>der</strong> Laufzüge.<br />
Um 1500: Aufkommen des Röhrenvisiers.<br />
Um 1515: Erste Anwendung des Rads<strong>ch</strong>losses, vermutli<strong>ch</strong> in Nürnberg.<br />
Um 1520: Aufkommen des stiftförmigen Abzuges.<br />
Um 1520: Einsatz von Bandeliers mit Pulverportionen, Kugelsack und Krautflas<strong>ch</strong>e dur<strong>ch</strong> die Musketiere.<br />
Um 1536: In <strong>der</strong> S<strong>ch</strong>la<strong>ch</strong>t vor Arles werden Handgranaten von Soldaten geworfen.<br />
1537: Tartaglia bes<strong>ch</strong>reibt in seiner S<strong>ch</strong>rift «Della nuova Scienca» unter an<strong>der</strong>em: «Dass die Flugbahn<br />
kreisbogenförmig und ni<strong>ch</strong>t wie bis anhin angenommen, geradlinig ist und wenn das<br />
Pulver verbrannt ist, ehe die Kugel das Rohr verlassen hat, ist die Seele zu lang, wird ein Teil<br />
des Pulvers unverbrannt heraus geworfen, ist sie zu kurz.»<br />
Um 1540: Ers<strong>ch</strong>einen von Hinterla<strong>der</strong>handrohren mit herausnehmbarer Kammer und seitli<strong>ch</strong>em<br />
S<strong>ch</strong>arniervers<strong>ch</strong>luss.<br />
Um 1540: Erstes Ers<strong>ch</strong>einen von Revolver- o<strong>der</strong> Wen<strong>der</strong>system an <strong>Feuerwaffen</strong> mit Steins<strong>ch</strong>lössern.<br />
Um 1540: Herausbilden des Wangens<strong>ch</strong>aftes.<br />
Um 1550: Aufkommen von Papierpatronen, enthaltend Bleikugel und S<strong>ch</strong>warzpulver.<br />
Um 1550: Erfindung des S<strong>ch</strong>napphahns<strong>ch</strong>losses.<br />
Um 1550: Einsatz von Rads<strong>ch</strong>losskarabinern und -pistolen bei <strong>der</strong> Reiterei.<br />
Um 1550: Aufkommen von Bockpistolen mit zwei übereinan<strong>der</strong>liegenden Läufen.<br />
Um 1560: Erstes Ers<strong>ch</strong>einen <strong>der</strong> holländis<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>napphahns<strong>ch</strong>lösser an Bü<strong>ch</strong>sen. Sie besitzen eine<br />
innenliegende Me<strong>ch</strong>anik, einen wegs<strong>ch</strong>wenkbaren Feuerstahl und einen wegs<strong>ch</strong>iebbaren<br />
Pfannendeckel.<br />
Um 1560: Das sogenannte Petrinel, ein Gewehr mit na<strong>ch</strong> unten gebogenem Kolben für das Aufsetzen auf<br />
<strong>der</strong> Brust, wird vorwiegend bei <strong>der</strong> Reiterei eingesetzt.<br />
Um 1560: Erste Läufe mit spiralförmigen Zügen werden, vermutli<strong>ch</strong> in Nürnberg, gefertigt.<br />
1564: Bes<strong>ch</strong>uss- und S<strong>ch</strong>aumarke in Suhl, Thüringen, eingeführt.<br />
1566: Frühe Erwähnung von Tromblons, das heisst einer Waffe mit einer trompetenförmigen<br />
Erweiterung bei <strong>der</strong> Mündung im Fronsperger Kriegsbu<strong>ch</strong>.<br />
Um 1570: Erster Einsatz von Steins<strong>ch</strong>lössern in <strong>der</strong> Form des spanis<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>napps<strong>ch</strong>losses im<br />
spanis<strong>ch</strong>en Heer. Die Funkenerzeugung erfolgt dur<strong>ch</strong> das S<strong>ch</strong>lagen eines S<strong>ch</strong>wefelkieses auf<br />
dem Feuerstahl, wel<strong>ch</strong>er zuglei<strong>ch</strong> die Pfanne vers<strong>ch</strong>liesst. Der Me<strong>ch</strong>anismus ist an <strong>der</strong><br />
S<strong>ch</strong>lossaussenseite.<br />
Um 1580: Erfindung des Altdeuts<strong>ch</strong>en Ste<strong>ch</strong>ers.<br />
Um 1580: Handfeuerwaffe mit 10 hintereinan<strong>der</strong>liegenden Ladungen im Lauf wird ausprobiert.<br />
Um 1580: In Süddeuts<strong>ch</strong>land werden sogenannte Nürnberger S<strong>ch</strong>napphahns<strong>ch</strong>lösser bei Jagdwaffen<br />
und Pistolen in geringen Mengen eingesetzt. Sie werden jedo<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> Rads<strong>ch</strong>lösser und später<br />
dur<strong>ch</strong> Flints<strong>ch</strong>lösser verdrängt.
Um 1580: Handfeuerwaffe mit Luntens<strong>ch</strong>loss und von Hand zu drehen<strong>der</strong> Ladungstrommel.<br />
Um 1589: Erster Einsatz von Reitergewehren, genannt Carabine, in grösseren Mengen im französis<strong>ch</strong>en<br />
Heer.<br />
Um 1590: Drehlinge mit Rads<strong>ch</strong>loss werden in Deuts<strong>ch</strong>land hergestellt.<br />
Um 1590: Erste Herstellung von sehr dünnen und langen Läufen dur<strong>ch</strong> indis<strong>ch</strong>e und arabis<strong>ch</strong>e<br />
Bü<strong>ch</strong>senma<strong>ch</strong>er. Wegen <strong>der</strong> hohen Treffsi<strong>ch</strong>erheit dieser Läufe finden diese Bü<strong>ch</strong>sen eine<br />
grosse Verbreitung vor allem bei den Beduinen. Sie besitzen meist einen sehr stark abgebogenen,<br />
fla<strong>ch</strong>gedrückten Kolben mit Elfenbein und Silbereinlegearbeiten und sind in ihrer<br />
frühesten Zeit mit S<strong>ch</strong>napphahns<strong>ch</strong>lössern ausgerüstet.<br />
Um 1590: Aufkommen des skandinavis<strong>ch</strong>en S<strong>ch</strong>napphahns<strong>ch</strong>losses.<br />
Um 1590: Herstellung von Läufen mit Haarzügen dur<strong>ch</strong> den Augsburger Augustin Kutter.<br />
1597: Ältestes erhaltenes, datiertes S<strong>ch</strong>napphahn-Revolvergewehr mit Trommel für a<strong>ch</strong>t S<strong>ch</strong>uss,<br />
Nürnberg.
15. Jh.<br />
Um 1600: Windbü<strong>ch</strong>sen mit komprimierter Luft als Treibmittel im Druckbehälter werden vereinzelt<br />
eingesetzt.<br />
Um 1609: Damba<strong>ch</strong> setzt mit Bleikugeln gefüllte Granaten ein.<br />
Vor 1615: Angebli<strong>ch</strong>e Erfindung des Batterie- o<strong>der</strong> Flints<strong>ch</strong>losses von Martin le Bourgeois aus Lisieux in<br />
<strong>der</strong> Normandie.<br />
Um 1626: Einführung von Le<strong>der</strong>kanonen in <strong>der</strong> s<strong>ch</strong>wedis<strong>ch</strong>en Armee dur<strong>ch</strong> den englis<strong>ch</strong>en Baron Robert<br />
Scott. Sie werden 1631, da sie si<strong>ch</strong> in <strong>der</strong> S<strong>ch</strong>la<strong>ch</strong>t bei Leipzig s<strong>ch</strong>le<strong>ch</strong>t bewähren, wie<strong>der</strong><br />
abges<strong>ch</strong>afft.<br />
Um 1620: Verbreitung <strong>der</strong> Ts<strong>ch</strong>inke, einer lei<strong>ch</strong>ten Rads<strong>ch</strong>lossbü<strong>ch</strong>se.<br />
Um 1630: Beginn Ablösung des S<strong>ch</strong>wefelkieses, Pyrit, für die Reibzündung dur<strong>ch</strong> den Flint, au<strong>ch</strong><br />
Feuerstein o<strong>der</strong> französis<strong>ch</strong>: Silex genannt, für die S<strong>ch</strong>lagzündung.<br />
Um 1630: Erste Anwendung des Batterie-, Flint- o<strong>der</strong> Steins<strong>ch</strong>losses in Frankrei<strong>ch</strong>.<br />
Um 1630: Ältestes bekanntes Steins<strong>ch</strong>loss-Repetiergewehr von Caspar Kalthof, England, mit sogenanntem<br />
Vers<strong>ch</strong>luss mit Vertikalzylin<strong>der</strong>.<br />
Um 1640: Erste Anfertigung von Bajonett zum Aufstecken auf Gewehre in Bayonne, Frankrei<strong>ch</strong>.<br />
1668: Holst erfindet kleinen Mörser, den man später Coehorn nennt. Es werden mehrere Rohre<br />
parallel o<strong>der</strong> hintereinan<strong>der</strong> auf ein Brett gesetzt und glei<strong>ch</strong>zeitig gezündet.<br />
1673: Qualitätsmarke: In Liège, Belgien, tritt Reglement in Kraft, dass «alle Lütti<strong>ch</strong>er-Waffen zur<br />
Si<strong>ch</strong>erheit des Rufes <strong>der</strong> Stadt einer städtis<strong>ch</strong>en Kontrolle zu unterwerfen, dur<strong>ch</strong> einen<br />
vereidigten Probiermeister zu erproben und mit Stempel zu versehen sind.»<br />
1690: Einführung <strong>der</strong> Infanteriepatrone in Frankrei<strong>ch</strong>. Das Eins<strong>ch</strong>ütten von Pulver auf die Pulverpfanne<br />
ges<strong>ch</strong>ieht no<strong>ch</strong> mit dem Pulverhorn.
16. Jh.<br />
1717: Als erstes Land übernimmt Frankrei<strong>ch</strong> die Steins<strong>ch</strong>lossmuskete M. 1717 zur Ausrüstung <strong>der</strong><br />
gesamten Streitkräfte.<br />
1718: Einführung eiserner Ladestöcke, einer Erfindung von Leopold von Dassau, in <strong>der</strong> preussis<strong>ch</strong>en<br />
Infanterie.<br />
Um 1720: Aufkommen – vermutli<strong>ch</strong> in Frankrei<strong>ch</strong> – <strong>der</strong> Hakens<strong>ch</strong>wanzs<strong>ch</strong>raube für das Einhaken des<br />
Laufendes in die S<strong>ch</strong>wanzs<strong>ch</strong>raube. Das ermögli<strong>ch</strong>t einen s<strong>ch</strong>nellen Laufwe<strong>ch</strong>sel.<br />
1738: Einführung einheitli<strong>ch</strong>er Patronen dur<strong>ch</strong> Ludwig XV. in Frankrei<strong>ch</strong>.<br />
1763: Einführung <strong>der</strong> ersten französis<strong>ch</strong>en Steins<strong>ch</strong>loss-Kavalleriepistole, M. 1763 , basierend auf<br />
<strong>der</strong> Charlesville-Muskete. Verkleinertes Musketens<strong>ch</strong>loss.<br />
1779: Patentierung einer Militär-Repetierwindbü<strong>ch</strong>se dur<strong>ch</strong> Bartholomäus Girandoni.<br />
1780: Hy<strong>der</strong> Ali setzt in Indien Raketenwerfer gegen den englis<strong>ch</strong>e General Munro ein.<br />
1780: Mathias Wisshofer entwickelt Handfeuerwaffe mit elektris<strong>ch</strong>er Zündung.<br />
1786: Claude Louis Berthollet entdeckt das Knallsilber, ein gefährli<strong>ch</strong>es Explosionsgemis<strong>ch</strong>, wel<strong>ch</strong>es<br />
dur<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>lag gezündet wird.<br />
1796: Das für die S<strong>ch</strong>lagzündung geeignete Knallquecksilbers wird von dem Englän<strong>der</strong> Charles<br />
Eduard Howard erfunden.
17. Jh.<br />
1802: Samuel Johannes Pauly, S<strong>ch</strong>weizer Bü<strong>ch</strong>sema<strong>ch</strong>er in Paris, lässt als Erster eine Metallpatrone<br />
patentieren.<br />
1803: Erste Versu<strong>ch</strong>e mit sogenannten Granatkartäts<strong>ch</strong>en vom Erfin<strong>der</strong>, dem englis<strong>ch</strong>en Oberst<br />
Shrapnel (1761–1842). Sie enthalten nebst Sprengladung au<strong>ch</strong> Bleikugeln und werden<br />
Shrapnels o<strong>der</strong> auf deuts<strong>ch</strong> S<strong>ch</strong>rapnells genannt.<br />
1804: Erste Experimente in England mit einer Kriegsrakete dur<strong>ch</strong> die Admiralität in Wollri<strong>ch</strong>.<br />
1807: Der s<strong>ch</strong>ottis<strong>ch</strong>e Pastor Alexan<strong>der</strong> Forsyth erhält Patent für den Vorgänger des Perkussionss<strong>ch</strong>losses,<br />
das sogenannte <strong>ch</strong>emis<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>loss, Flakons<strong>ch</strong>loss o<strong>der</strong> Forsyth-S<strong>ch</strong>loss. Für die<br />
S<strong>ch</strong>lagzündung verwendet er Knallquecksilber.<br />
1808: Der S<strong>ch</strong>weizer Johannes Samuel Pauly erhält in Frankrei<strong>ch</strong> das Patent für das Perkussionss<strong>ch</strong>loss.<br />
1814: Erfindung des Zündhüt<strong>ch</strong>ens in London von dem Bü<strong>ch</strong>senma<strong>ch</strong>er J. Shaw (umstritten).<br />
1816: J. Manton benutzt Zündzylin<strong>der</strong> mit je einer Knallperle und einem Zündstift. Die Zündzylin<strong>der</strong><br />
werden auf Vorrat vorbereitet. Beim Laden steckt <strong>der</strong> S<strong>ch</strong>ütze den Zündzylin<strong>der</strong> in eine<br />
Aushöhlung des Hahnkopfes. Wegen erfolgrei<strong>ch</strong>er Klage von Forsyth wird die Produktion<br />
dieser Waffen gestoppt.<br />
1818: Erfindung des Perkussionszündhüt<strong>ch</strong>en von dem Solothurner Joseph Egg in England.<br />
Mis<strong>ch</strong>ung: 10 Teile Jagdpulver und 5 Teile <strong>ch</strong>lorsaures Kali.<br />
1824: Der Englän<strong>der</strong> Perkins konstruiert ein Dampfges<strong>ch</strong>ütz. Kadenz 240 Kugeln pro Minute . Das<br />
Problem liegt beim Mits<strong>ch</strong>leppen des Dampferzeugungsgerätes und dessen Bedienung.<br />
1826: Erfindung eines Magazins<strong>ch</strong>losses für 60 bis 100 Zündhüt<strong>ch</strong>en von dem Mathematiker Paazig<br />
in Dresden.<br />
1831: Einsatz des Ges<strong>ch</strong>ützes Mortier Monster mit 22-Zoll-Kaliber bei <strong>der</strong> Belagerung von Antwerpen.<br />
Die Pulverkammer enthält 30 Pfund S<strong>ch</strong>warzpulver. Die Bombe wiegt 900 Pfund und<br />
geladen 1000 Pfund. Das Ges<strong>ch</strong>ütz wiegt 14 000 Pfund. Der S<strong>ch</strong>uss kostet 500 Franken.<br />
1835: Entwicklung des ersten Zündnadelgewehres dur<strong>ch</strong> Johann Nikolaus Dreyse aus Sömmerda bei<br />
Erfurt (Beginn <strong>der</strong> Entwicklung um 1826).<br />
1835: Der belgis<strong>ch</strong>e Oberst Bohrmann stellt einen Zeitzün<strong>der</strong> her: «Shrapnel-Zün<strong>der</strong>, wel<strong>ch</strong>er eine<br />
ri<strong>ch</strong>tige Regulierung <strong>der</strong> Brennzeit gestattet.»<br />
1835: Herstellung von Papierhülsenpatrone mit Messingkopf für Kipplaufhinterla<strong>der</strong> dur<strong>ch</strong> den<br />
Bü<strong>ch</strong>senma<strong>ch</strong>er C. Lefau<strong>ch</strong>eux, Paris.<br />
1836: Nickolaus von Dreyse kombiniert das Zündnadelsystem mit dem Hinterla<strong>der</strong>vers<strong>ch</strong>luss.<br />
1838: Die meisten Waffenfabriken führen Transformationen von Steins<strong>ch</strong>lossgewehren zu Perkussionsgewehren<br />
dur<strong>ch</strong> das Aufbohren des Zündlo<strong>ch</strong>es, das Anbringen eines Gewindes und das<br />
Hineins<strong>ch</strong>rauben eines Pistonshalters dur<strong>ch</strong>.<br />
1841: 60 000 Stück <strong>der</strong> Dreyse-Zündnadelgewehre liefert von Dreyse an die preussis<strong>ch</strong>e Armee.<br />
1845: Der amerikanis<strong>ch</strong>e Zahnarzt E. Maynard erhält Patent für Zündkapselstreifen zum Einsatz bei<br />
Perkussionswaffen. Beim Spannen des Hahnes wird <strong>der</strong> Zündkapselstreifen automatis<strong>ch</strong> über<br />
den Zündnippel weiterges<strong>ch</strong>oben.<br />
1846: Erfindung <strong>der</strong> S<strong>ch</strong>iessbaumwolle von den Professoren S<strong>ch</strong>önbein in Basel und Bött<strong>ch</strong>er in<br />
Frankfurt. Gereinigte, trockene Baumwolle bringt man für eine Viertelstunde in ein Bad von 100<br />
Gewi<strong>ch</strong>tsteilen Salpetersäure und 79 Gewi<strong>ch</strong>tsteilen S<strong>ch</strong>wefelsäure. Dann wird sie ausgedrückt,<br />
gepresst und gewässert, bis blaues Lackmuspapier ni<strong>ch</strong>t mehr rötet. S<strong>ch</strong>iessbaumwolle<br />
soll ideal für Ges<strong>ch</strong>ütze sein.<br />
1846: C. Lefau<strong>ch</strong>eux, Bü<strong>ch</strong>senma<strong>ch</strong>er von Paris, erhält Patent für Einheitspatrone mit seitli<strong>ch</strong>em<br />
Stiftzün<strong>der</strong>.
1848: Claude Etienne Minié entwickelt ein Expansionsges<strong>ch</strong>oss, genannt Minié-Expansionspitzges<strong>ch</strong>oss.<br />
1849: L. N. A. Flobert, Paris, lässt ein metallenes Zündhüt<strong>ch</strong>en mit eingesetzter Kugel und Randzündung<br />
patentieren. Das Flobert-Ges<strong>ch</strong>oss ist für den Privatgebrau<strong>ch</strong> für Flobert-Gewehre<br />
und -Pistolen über eine lange Periode sehr populär.<br />
1860: Tyler Henry erhält Patent für Repetierer mit Röhrenmagazin, später als Henry Rifle bekannt.<br />
1861: Die erste Serie <strong>der</strong> Magazinrepetierer <strong>der</strong> neuen Generation wird von C. M. Spencer an<br />
Fö<strong>der</strong>ierte in Amerika geliefert.<br />
1864: Konstruktion von Klappvers<strong>ch</strong>luss mit Zentralfeuerzündung für den Umbau von Vor<strong>der</strong>la<strong>der</strong>-<br />
Perkussionsgewehren in Hinterla<strong>der</strong> von J. Sni<strong>der</strong>, Amerika.<br />
1869: Als erstes Land führt die S<strong>ch</strong>weiz ein Repetiergewehr, M. 1868 ein. Seine Konstruktion beruht<br />
auf dem System Vetterli. Es besitzt ein Röhrenmagazin im Vor<strong>der</strong>s<strong>ch</strong>aft. Verbesserte Modelle<br />
folgen 1871, 1878 und 1886.<br />
1871: Einführung des Mausergewehres mit Zylin<strong>der</strong>vers<strong>ch</strong>luss in Deuts<strong>ch</strong>land.<br />
1886: Herstellung von Nitrozellulosepulver in Veille, Frankrei<strong>ch</strong>.<br />
1887: Das rau<strong>ch</strong>arme Pulver, au<strong>ch</strong> Rottweiler <strong>ch</strong>emis<strong>ch</strong>es Pulver genannt, wird vom preussis<strong>ch</strong>en<br />
Kriegsministerium übernommen und in Spandau weiter verbessert.<br />
1889: Paul Mauser entwickelt ein Mehrladegewehr mit drehbarem Zylin<strong>der</strong>vers<strong>ch</strong>luss. Der Lauf ist<br />
dur<strong>ch</strong> einen Stahlmantel ges<strong>ch</strong>ützt. Das feste Magazin liegt im Mittels<strong>ch</strong>aft. Kaliber 7,65 mm.