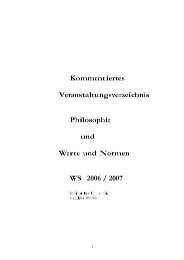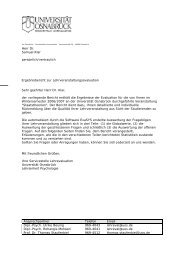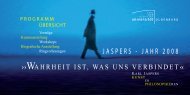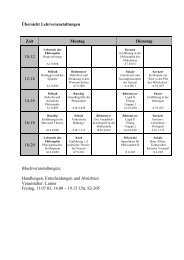KOMMUNIKATIVES
KOMMUNIKATIVES
KOMMUNIKATIVES
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Was sind lhkutiorräre Atf?<br />
Es ist ewas merkwurdig, dass Searle das Verstehen {das heißt hier Erkennen)<br />
nicht als perlokiirioniir betrachtet. Laut Ausriri (1962, 101) sind Einfliisse auf die<br />
GeFihle, Gedanken und Handlungen der Zuhö:er perlokutionäre Wirkungen;<br />
und wenn ich jemanden dazu brinp, erwas zu erkennen, dann nehme ich damit<br />
doch Einfluss auf seine Gedanken. Wichtiger ist jedoch, dass SearIe (1984, 211-<br />
214) selbst den eigenen Verstehens-Ansatz später hosiert hat. Was ist mit Selbstgesprächen<br />
(@. Alston 2000, 44f.)? Kann man nicht illokutionäre Akte ausfuhren,<br />
auch wenn man genau weiß, dass niemand sonst zugegen ist, der einem seine Aufmerksamkeit<br />
schenkt' h so einem FaiI wird der Sprecher nicht beabsichcgen,<br />
dass eine andere Person erkennt, was für eine Handlung er vollzieht; und dass er<br />
sich selbst zu dieser Erkenntnis bringen will. kling reichlich absurd.<br />
Mit einem ähnlichen Problem hat auch der Vorschlag von Bach und Harnish<br />
(1979, Abschn. 1 .l, 1.3) zu kampfen. Ihre grundlegende Idee ist, dass zumindest:<br />
eine Tcilklassc der Illokutionen aus ÄuIkrungen besteht, in denen nicht mehr<br />
gernxht wird, als jeweils charakteristische Einsteliungen auszudrücken. Jemand<br />
behauptet etwa gcnaii dmn, dxs p, wenn er dic Gbcrzeugung, dass p, ausdriickt<br />
sowie die Absicht. einen Höter davon zu überzeugen, dass p. Dass eine EinsteIlung<br />
ausgedrückt wird, impliziert nicht, dass der Sprecher sie hat. ,&usdrüchn"<br />
heillt bei Bach und Harnish vielmehr (schon sehr kompliziert und dennoch nur<br />
grob): Der Sprecher beabsichtigt, den Ilorer dazu zu bringen, dass er die Äukrung<br />
als cilicn Grund für die Annahme betrachtet, der Sprecher habe die Einstellungen<br />
- und m-ar soll er dies deswegen tun, weil er erkennt, dass der Sprecher<br />
genau dies beabsichtigt<br />
Das scheint auf illokutionäre Akte irn Selbstgespräch ebenso wenig zuzutreffen<br />
wie Searles Verstehensabsicht. Der Sprecher will da doch weder eine andcte<br />
Person noch sich selbst zu der genannten Erkenntnis bringen. Hinzu kommt, dass<br />
die von Bach und Harnish geforderre fibsicht so komplex ist, dass es fragiich wird,<br />
ob kleine Kinder sie haben können. Wer möchte ihnen abe: absprechen, illokutionäre<br />
Akte zu vollziehen?<br />
Auf'grund der Probleme, die er auch für xinc eigne Theorie aus Speech Atts<br />
sieht, hat Searle (1986, Abschri. ;lVj sich von Intentionen, die an jemanden gerichte;<br />
sind, verabschiedet und stattdessen so genannte Rcpra$eritaliottsabsirhen ciiigefuht,<br />
die nur die Äußerung betreffen. Was man beabsichtig, wenn man eine<br />
illokutionärc Handlung ausführt, ist, dass die ÄuRening die Welt in einer bestirnmtcn<br />
Weise repräsennert. Anders gesagt: Man will der Außtrung gewisse Erfüllunpbedingungen<br />
verleihen. Bei Assettiven (Behauptungen, \70rschligen, .. .)<br />
mir dem Inhalt, dass p, beabsichtigt man z.B., dass die Äukrung genau dann wahr<br />
Aber auch das funktioniert nicht. Wenn ich mit .l3 ist eine PrimzahlK genau<br />
das behaupten wil, was der Satz besagt, dann beabsicniilige ich nicht, der ~ ußerun~<br />
die entsprechenden Wahrheitsbedingungen zu verleihen. Ich seke vielmehr vorm:.<br />
dass sich diese Wahrheirsbedinpngen aus der Bedeutung des Satzes ergeben.<br />
AuRcrdern bleibt vollkommen unklar, was man zu tun kitte, urn aus Repräscntationsabsichten<br />
hinreichende Bedingungen für dit zushbrigeri Illokutionea zu