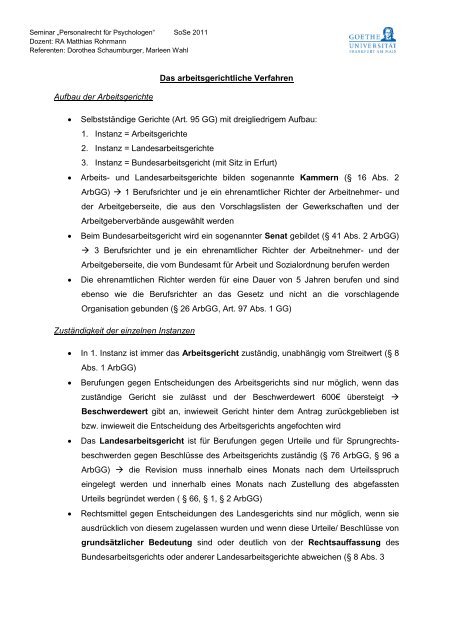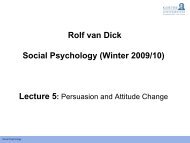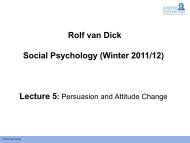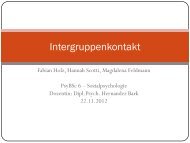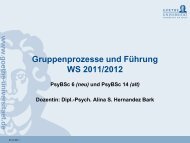Das arbeitsgerichtliche Verfahren Aufbau der Arbeitsgerichte ...
Das arbeitsgerichtliche Verfahren Aufbau der Arbeitsgerichte ...
Das arbeitsgerichtliche Verfahren Aufbau der Arbeitsgerichte ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seminar „Personalrecht für Psychologen“ SoSe 2011<br />
Dozent: RA Matthias Rohrmann<br />
Referenten: Dorothea Schaumburger, Marleen Wahl<br />
<strong>Das</strong> <strong>arbeitsgerichtliche</strong> <strong>Verfahren</strong><br />
<strong>Aufbau</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgerichte</strong><br />
Selbstständige Gerichte (Art. 95 GG) mit dreigliedrigem <strong>Aufbau</strong>:<br />
1. Instanz = <strong>Arbeitsgerichte</strong><br />
2. Instanz = Landesarbeitsgerichte<br />
3. Instanz = Bundesarbeitsgericht (mit Sitz in Erfurt)<br />
Arbeits- und Landesarbeitsgerichte bilden sogenannte Kammern (§ 16 Abs. 2<br />
ArbGG) 1 Berufsrichter und je ein ehrenamtlicher Richter <strong>der</strong> Arbeitnehmer- und<br />
<strong>der</strong> Arbeitgeberseite, die aus den Vorschlagslisten <strong>der</strong> Gewerkschaften und <strong>der</strong><br />
Arbeitgeberverbände ausgewählt werden<br />
Beim Bundesarbeitsgericht wird ein sogenannter Senat gebildet (§ 41 Abs. 2 ArbGG)<br />
3 Berufsrichter und je ein ehrenamtlicher Richter <strong>der</strong> Arbeitnehmer- und <strong>der</strong><br />
Arbeitgeberseite, die vom Bundesamt für Arbeit und Sozialordnung berufen werden<br />
Die ehrenamtlichen Richter werden für eine Dauer von 5 Jahren berufen und sind<br />
ebenso wie die Berufsrichter an das Gesetz und nicht an die vorschlagende<br />
Organisation gebunden (§ 26 ArbGG, Art. 97 Abs. 1 GG)<br />
Zuständigkeit <strong>der</strong> einzelnen Instanzen<br />
In 1. Instanz ist immer das Arbeitsgericht zuständig, unabhängig vom Streitwert (§ 8<br />
Abs. 1 ArbGG)<br />
Berufungen gegen Entscheidungen des Arbeitsgerichts sind nur möglich, wenn das<br />
zuständige Gericht sie zulässt und <strong>der</strong> Beschwerdewert 600€ übersteigt <br />
Beschwerdewert gibt an, inwieweit Gericht hinter dem Antrag zurückgeblieben ist<br />
bzw. inwieweit die Entscheidung des Arbeitsgerichts angefochten wird<br />
<strong>Das</strong> Landesarbeitsgericht ist für Berufungen gegen Urteile und für Sprungrechtsbeschwerden<br />
gegen Beschlüsse des Arbeitsgerichts zuständig (§ 76 ArbGG, § 96 a<br />
ArbGG) die Revision muss innerhalb eines Monats nach dem Urteilsspruch<br />
eingelegt werden und innerhalb eines Monats nach Zustellung des abgefassten<br />
Urteils begründet werden ( § 66, § 1, § 2 ArbGG)<br />
Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Landesgerichts sind nur möglich, wenn sie<br />
ausdrücklich von diesem zugelassen wurden und wenn diese Urteile/ Beschlüsse von<br />
grundsätzlicher Bedeutung sind o<strong>der</strong> deutlich von <strong>der</strong> Rechtsauffassung des<br />
Bundesarbeitsgerichts o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>er Landesarbeitsgerichte abweichen (§ 8 Abs. 3
Seminar „Personalrecht für Psychologen“ SoSe 2011<br />
Dozent: RA Matthias Rohrmann<br />
Referenten: Dorothea Schaumburger, Marleen Wahl<br />
ArbGG, § 76 ArbGG, § 96 a ArbGG) das Bundesarbeitsgericht überprüft dann<br />
die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts in rechtlicher Hinsicht<br />
Sachliche und örtliche Zuständigkeit<br />
<br />
<br />
Sachliche Zuständigkeit über § 2, § 2a ArbGG festgesetzt alle Konflikte zwischen<br />
Arbeitnehmer/ Betriebsrat/ Gewerkschaften und Arbeitgeber/ Arbeitgeberverbänden<br />
als arbeitsrechtlicher Gegenstand<br />
Örtliche Zuständigkeit (= welches Arbeitsgericht angerufen werden muss) über die<br />
Zivile Prozessordnung (§ 46 II 1 ArbGG) geregelt<br />
Ort maßgeblich, an dem <strong>der</strong> Arbeitnehmer seine geschuldete Arbeitsleistung<br />
tatsächlich erbringt<br />
Arbeitgeber kann an seinem Wohnsitz/ Geschäftssitz verklagt werden (§ 13, § 17<br />
ZPO)<br />
Arbeitnehmer kann aber auch bei dem Arbeitsgericht Klage einreichen, in dessen<br />
Bezirk eine gewerbliche Nie<strong>der</strong>lassung o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Betriebssitz zu finden ist (§ 21, §<br />
29 ZPO)<br />
<strong>Verfahren</strong>sarten<br />
<br />
Grundsätzlich werden 2 <strong>Verfahren</strong>sarten unterschieden:<br />
1. Urteilsverfahren = bei Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitsgeber<br />
<strong>Verfahren</strong> schließt mit einem Urteil ab<br />
Bsp.: Kündigungsschutzklage<br />
2. Beschlussverfahren = Streitigkeiten zwischen Betriebsrat/ Gewerkschaften und<br />
Arbeitgeber/ Arbeitgeberverbänden <strong>Verfahren</strong> schließt durch einen Beschluss<br />
ab<br />
Klagearten<br />
<br />
<br />
<br />
Leistungsklage = eine <strong>der</strong> Parteien soll dazu verpflichtet werden, eine bestimmte<br />
Leistung zu erbringen<br />
o Bsp.: Schadensersatz, Urlaubausspruch, ausstehen<strong>der</strong> Lohn<br />
Feststellungsklage = befasst sich meistens mit dem Kündigungsschutz es soll<br />
festgestellt werden, ob eine Kündigung rechtmäßig war o<strong>der</strong> nicht<br />
Verhandlung von einstweiligen Verfügungen
Seminar „Personalrecht für Psychologen“ SoSe 2011<br />
Dozent: RA Matthias Rohrmann<br />
Referenten: Dorothea Schaumburger, Marleen Wahl<br />
<strong>Verfahren</strong>sablauf vor dem Arbeitsgericht<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Klageerhebung als erster Schritt entwe<strong>der</strong> schriftlich durch Einreichen eines<br />
Klageschriftsatzes o<strong>der</strong> mündlich, in dem Klage bei Geschäftsstelle zu Protokoll<br />
gebracht wird<br />
Klage wird registriert und dem Geschäftsplan entsprechende einer Kammer zugeteilt<br />
Zustellung, Terminbestimmung und Ladung als zweiter Schritt Berufsrichter prüft,<br />
ob es sich tatsächlich um eine Klage handelt, sorgt für die Zustellung <strong>der</strong> Klage,<br />
bestimmt einen Termin zur Güteverhandlung und lädt beteiligte Parteien<br />
Güteverhandlung als nächster Schritt Ziel, den Rechtsstreit einvernehmlich zu<br />
beenden: Klagerücknahme, Anerkenntnisurteil, Prozessvergleich, Verzichtsurteil o<strong>der</strong><br />
Erledigterklärung (erscheint keine <strong>der</strong> beteiligten Parteien, ruht das <strong>Verfahren</strong> und die<br />
Klage gilt nach einer Dauer von 6 Monaten als zurückgenommen (§ 54 V ArbGG))<br />
Wenn keine Einigung möglich, kommt es zur streitigen Verhandlung (Beisitzer, also<br />
die ehrenamtlichen Richter werden vorab mit dem Streitstoff vertraut gemacht,<br />
Zeugen geladen, Fristen gesetzt etc.) Ziel ist wie<strong>der</strong>um, das Finden einer gütlichen<br />
Einigung sollte diese scheitern spricht <strong>der</strong> vorsitzende Richter nach eingehen<strong>der</strong><br />
geheimer Beratung mit den beiden Beisitzern das Urteil<br />
Kündigungsschutzverfahren<br />
<br />
<br />
<br />
Nach Erhalt <strong>der</strong> schriftlichen Kündigung 3-Wochen-Frist, um die Kündigung<br />
anzufechten und eine Kündigungsschutzklage zu erheben, vorausgesetzt, dass man<br />
mehr als 6 Monate bei dem betreffenden Arbeitgeber beschäftigt war wenn 3-<br />
Wochen-Frist versäumt, wird Kündigung wirksam und Arbeitnehmer verliert fast alle<br />
Chancen vor Gericht, es sei denn er war trotz Anwendung aller nach Lage <strong>der</strong><br />
Umstände zuzumutenden Sorgfalt an rechtzeitiger Klageeinreichung verhin<strong>der</strong>t<br />
Bsp.: Urlaub, Krankenhausaufenthalt<br />
Bei rechtzeitiger Klageeinreichung kommt es nach 2 bis 8 Wochen zu einem<br />
Gütetermin Versuch einvernehmliche Lösung zu finden, was häufig mit einem<br />
Vergleich endet = Akzeptieren <strong>der</strong> Kündigung bei Erhalt einer Abfindung (§ 10 KSchG<br />
im Durchschnitt ein halbes Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr)<br />
Findet sich keine Einigung folgt die streitige Verhandlung, wobei Arbeitgeber<br />
beweisen muss, dass tatsächlich Kündigungsgründe vorhanden sind (§ 1 Abs. 2 Satz<br />
4 KSchG)
Seminar „Personalrecht für Psychologen“ SoSe 2011<br />
Dozent: RA Matthias Rohrmann<br />
Referenten: Dorothea Schaumburger, Marleen Wahl<br />
Literatur<br />
• Beck-Texte im dtv (2011). Arbeitsgesetze (Seite 759-803). München: Deutscher Taschenbuch Verlag<br />
• Däubler, W. (2010). Arbeitsrecht. Ratgeber für Beruf, Praxis und Studium (Kapitel 25, Kapitel 14, Seite<br />
341-347). Frankfurt am Main: Bund- Verlag<br />
• Marschollek, G. (2011). Arbeitsrecht (Seite 77-81). Münster: Alpmann und Schmidt Verlag<br />
• Preis, U. (2009). Arbeitsrecht. Praxis-Lehrbuch zum Kollektivarbeitsrecht (<strong>Aufbau</strong> <strong>der</strong><br />
Arbeitsgerichtsbarkeit). Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt<br />
• Then, A. , Gerhard, D. & Waldenfels, A. (2009). Arbeitsrecht: sytematische Darstellung mit Übersichten,<br />
Fallbeispielen und allen wichtigen Entscheidungen auf CD-ROM (Seite 338-343, 358, 361-362 ).<br />
Stuttgart: Boorberg Verlag