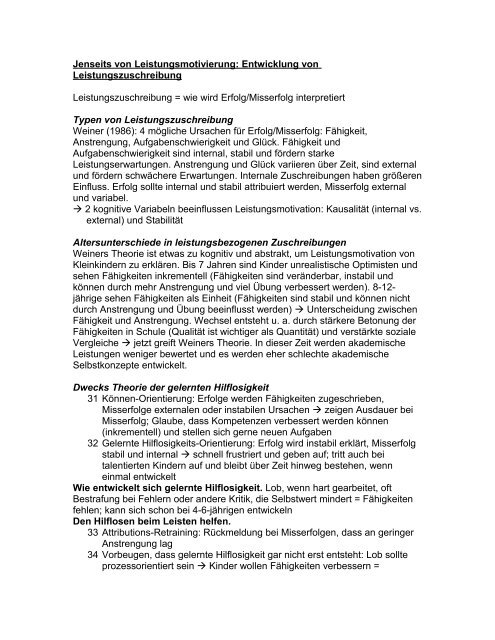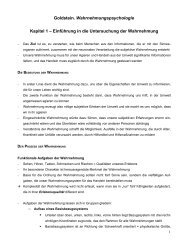Shaffer Kap. 12: Developement of the self and social cognition
Shaffer Kap. 12: Developement of the self and social cognition
Shaffer Kap. 12: Developement of the self and social cognition
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Jenseits von Leistungsmotivierung: Entwicklung von<br />
Leistungszuschreibung<br />
Leistungszuschreibung = wie wird Erfolg/Misserfolg interpretiert<br />
Typen von Leistungszuschreibung<br />
Weiner (1986): 4 mögliche Ursachen für Erfolg/Misserfolg: Fähigkeit,<br />
Anstrengung, Aufgabenschwierigkeit und Glück. Fähigkeit und<br />
Aufgabenschwierigkeit sind internal, stabil und fördern starke<br />
Leistungserwartungen. Anstrengung und Glück variieren über Zeit, sind external<br />
und fördern schwächere Erwartungen. Internale Zuschreibungen haben größeren<br />
Einfluss. Erfolg sollte internal und stabil attribuiert werden, Misserfolg external<br />
und variabel.<br />
2 kognitive Variabeln beeinflussen Leistungsmotivation: Kausalität (internal vs.<br />
external) und Stabilität<br />
Altersunterschiede in leistungsbezogenen Zuschreibungen<br />
Weiners Theorie ist etwas zu kognitiv und abstrakt, um Leistungsmotivation von<br />
Kleinkindern zu erklären. Bis 7 Jahren sind Kinder unrealistische Optimisten und<br />
sehen Fähigkeiten inkrementell (Fähigkeiten sind veränderbar, instabil und<br />
können durch mehr Anstrengung und viel Übung verbessert werden). 8-<strong>12</strong>-<br />
jährige sehen Fähigkeiten als Einheit (Fähigkeiten sind stabil und können nicht<br />
durch Anstrengung und Übung beeinflusst werden) Unterscheidung zwischen<br />
Fähigkeit und Anstrengung. Wechsel entsteht u. a. durch stärkere Betonung der<br />
Fähigkeiten in Schule (Qualität ist wichtiger als Quantität) und verstärkte soziale<br />
Vergleiche jetzt greift Weiners Theorie. In dieser Zeit werden akademische<br />
Leistungen weniger bewertet und es werden eher schlechte akademische<br />
Selbstkonzepte entwickelt.<br />
Dwecks Theorie der gelernten Hilflosigkeit<br />
31 Können-Orientierung: Erfolge werden Fähigkeiten zugeschrieben,<br />
Misserfolge externalen oder instabilen Ursachen zeigen Ausdauer bei<br />
Misserfolg; Glaube, dass Kompetenzen verbessert werden können<br />
(inkrementell) und stellen sich gerne neuen Aufgaben<br />
32 Gelernte Hilflosigkeits-Orientierung: Erfolg wird instabil erklärt, Misserfolg<br />
stabil und internal schnell frustriert und geben auf; tritt auch bei<br />
talentierten Kindern auf und bleibt über Zeit hinweg bestehen, wenn<br />
einmal entwickelt<br />
Wie entwickelt sich gelernte Hilflosigkeit. Lob, wenn hart gearbeitet, <strong>of</strong>t<br />
Bestrafung bei Fehlern oder <strong>and</strong>ere Kritik, die Selbstwert mindert = Fähigkeiten<br />
fehlen; kann sich schon bei 4-6-jährigen entwickeln<br />
Den Hilflosen beim Leisten helfen.<br />
33 Attributions-Retraining: Rückmeldung bei Misserfolgen, dass an geringer<br />
Anstrengung lag<br />
34 Vorbeugen, dass gelernte Hilflosigkeit gar nicht erst entsteht: Lob sollte<br />
prozessorientiert sein Kinder wollen Fähigkeiten verbessern =