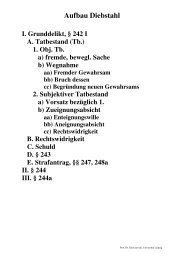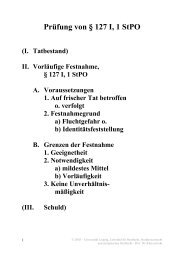Aristoteles in Stichworten
Aristoteles in Stichworten
Aristoteles in Stichworten
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Rph II 6<br />
WS 05/06<br />
Prof. Dr. D. Klesczewski<br />
der Leidenschaft - doch so, während der Beherrschte weiß, daß se<strong>in</strong> Begehren verwerflich ist,<br />
und ihm daher - unter dem E<strong>in</strong>fluß der reflektierenden Kraft - nicht Folge leistet.“ NE VII. 2.<br />
24. „Nun kann man fragen, wie jemand e<strong>in</strong> richtiges Urteil haben und doch e<strong>in</strong> unbeherrschtes<br />
Leben führen könne. Nun, bei klarer Erkenntnis, so sagen manche, sei dies unmöglich, denn es<br />
sei unfaßbar, so me<strong>in</strong>te Sokrates, daß klare Erkenntnis Im Menschen se<strong>in</strong> und dann doch etwas<br />
anderes die Oberhand über sie gew<strong>in</strong>nen … könne. (…) Nun, diese Theorie widerspricht ganz<br />
augensche<strong>in</strong>lich den Erfahrungstatsachen … (…) Nun, (1) unsere erste Frage muß lauten:<br />
handelt der Unbeherrschte wissentlich oder nicht, und <strong>in</strong> welchem S<strong>in</strong>ne wissentlich? Aber (a)<br />
wir verstehen ja den Begriff »Wissen« <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em doppelten S<strong>in</strong>n: wer es hat, aber nicht<br />
gebraucht, wie auch wer es gebraucht, wird als wissend bezeichnet -und so wird doch e<strong>in</strong><br />
Unterschied se<strong>in</strong>, ob jemand, wenn er das Ungehörige tut, e<strong>in</strong> Wissen hat, es aber nicht wirksam<br />
werden läßt, oder ob er es hat und auch wirksam werden läßt. Denn letzteres ersche<strong>in</strong>t<br />
unbegreiflich, nicht aber das erstere: wenn er also handelt, ohne das Wissen wirksam werden zu<br />
lassen. (b) Ferner: es gibt zwei Arten von Vordersatz (Obersatz und Untersatz). Nun kann es<br />
ohne weiteres geschehen, daß jemand beide gegenwärtig hat und doch entgegen se<strong>in</strong>em Wissen<br />
handelt: <strong>in</strong>dem er wohl von dem allgeme<strong>in</strong>en (dem Obersatz) Gebrauch macht, nicht aber von<br />
dem besonderen (dem Untersatz). Gegenstand des Handelns ist ja jeweils das letztlich<br />
E<strong>in</strong>zelgegebene. Aber auch beim Allgeme<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>d zwei Arten zu unterscheiden: das e<strong>in</strong>e<br />
betrifft die handelnde Person, das andere die Sache. Zum Beispiel »Trockene Nahrung ist gut<br />
für jeden Menschen« und »Ich b<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Mensch«, oder »Diese so beschaffene Nahrung ist<br />
trocken«. Indes, ob »diese bestimmte Nahrung e<strong>in</strong>e solche Beschaffenheit hat« - davon hat der<br />
Unbeherrschte entweder ke<strong>in</strong>e Kenntnis oder er läßt sie nicht wirksam werden. Es muß also<br />
zunächst, diesen verschiedenen Formen der Vordersätze entsprechend, e<strong>in</strong>en beträchtlichen<br />
Unterschied (<strong>in</strong> den Arten des Wissens) geben, weshalb es nicht unverständlich ersche<strong>in</strong>t, wenn<br />
der Unbeherrschte <strong>in</strong> dem e<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n »weiß«, während es ganz merkwürdig wäre, wenn er e<strong>in</strong><br />
Wissen <strong>in</strong> dem anderen S<strong>in</strong>n hätte. (c) Und ferner besteht für die Menschen außer den schon<br />
genannten noch e<strong>in</strong>e weitere Art und Weise Wissen zu haben. Denn In Fällen, wo jemand e<strong>in</strong><br />
Wissen hat, es aber nicht gebraucht, sehen wir, daß dieses »Haben« e<strong>in</strong>en ganz anderen S<strong>in</strong>n<br />
hat: es ist <strong>in</strong> gewissem S<strong>in</strong>n e<strong>in</strong> »Haben« und zugleich e<strong>in</strong> »Nicht-haben«. Beispiel: der<br />
Schlafende, der Wahns<strong>in</strong>nige und der Betrunkene. Gerade <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Zustande aber<br />
bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> der Tat die Menschen, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Leben der Leidenschaft versunken s<strong>in</strong>d. (d)<br />
Weiterh<strong>in</strong> aber läßt sich die Ursache (der Unbeherrschtheit) auch <strong>in</strong> ihren natürlich-seelischen<br />
Gegebenheiten betrachten, und zwar so: es gibt e<strong>in</strong>erseits die Me<strong>in</strong>ung, die auf das Allgeme<strong>in</strong>e<br />
geht, und andererseits die, welche das E<strong>in</strong>zelgegebene umfaßt - wo bereits die<br />
S<strong>in</strong>neswahrnehmung <strong>in</strong> ihre Rechte tritt. Wenn sich aus beiden Formen der Me<strong>in</strong>ung e<strong>in</strong>e<br />
e<strong>in</strong>zige ergibt, so muß die Seele <strong>in</strong> dem e<strong>in</strong>en Fall (bei theoretischem Verhalten) notwendig das<br />
zustande gekommene Ergebnis bejahen, dagegen <strong>in</strong> dem anderen Fall, wo die Me<strong>in</strong>ung auf das<br />
Handeln zielte es augenblicklich <strong>in</strong> die Tat umsetzen. Wenn z.B. gilt: »Von allem Süßen muß<br />
man kosten«, und wenn gilt »Dies hier - als E<strong>in</strong>zelgegenstand - ist süß«, so muß, wer dazu <strong>in</strong><br />
der Lage und nicht geh<strong>in</strong>dert ist, dies gleichzeitig auch <strong>in</strong> die Tat umsetzen. Wenn sich nun <strong>in</strong><br />
unserem Inneren die auf das Allgeme<strong>in</strong>e gehende Me<strong>in</strong>ung f<strong>in</strong>det, welche uns h<strong>in</strong>dern möchte<br />
vom Süßen zu kosten, und wenn daneben e<strong>in</strong>e zweite Me<strong>in</strong>ung ist: »Alles Süße ist angenehm« -<br />
mit dem Untersatz »dies hier ist süß« - und diese zweite Me<strong>in</strong>ung wirksam wird: und wenn<br />
außerdem <strong>in</strong> unserem Inneren gerade e<strong>in</strong>e Begierde ist -, so fordert die e<strong>in</strong>e Me<strong>in</strong>ung von uns<br />
dies zu meiden, während die Begierde, die ja die Kraft hat, jedes unserer Organe zu bewegen,<br />
uns treibt. So ist das Ergebnis: man gerät <strong>in</strong> das unbeherrschte Verhalten unter der Wirkung,<br />
wenn man so will, e<strong>in</strong>es überlegenden Elementes - und e<strong>in</strong>er Me<strong>in</strong>ung. Und zwar steht diese<br />
Me<strong>in</strong>ung nicht an sich - denn es ist die Begierde, die den wahren Gegensatz bildet, nicht die<br />
Me<strong>in</strong>ung -, sondern nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er akzidentellen Weise im Gegensatz zur richtigen Planung. Der<br />
letzte Vordersatz e<strong>in</strong>es Schlußverfahrens hat als Inhalt e<strong>in</strong>e »Me<strong>in</strong>ung« über das s<strong>in</strong>nlich<br />
Wahrnehmbare und gibt zugleich unserem Handeln Anstoß und Richtung. Somit hat jemand,<br />
wenn er <strong>in</strong> der Leidenschaft befangen ist, diese »Me<strong>in</strong>ung« überhaupt nicht <strong>in</strong> sich, oder er<br />
»hat« sie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Form, <strong>in</strong> der dieses »Haben« nicht, wie oben gesagt, e<strong>in</strong> Wissen bedeutet,<br />
sondern nur e<strong>in</strong> Sprechen, wie wenn e<strong>in</strong> Betrunkener Empedokles rezitiert. Und da das letzte<br />
Glied des Schlusses nichts Allgeme<strong>in</strong>es aussagt und nicht <strong>in</strong> ähnlicher Weise <strong>in</strong> den Bereich