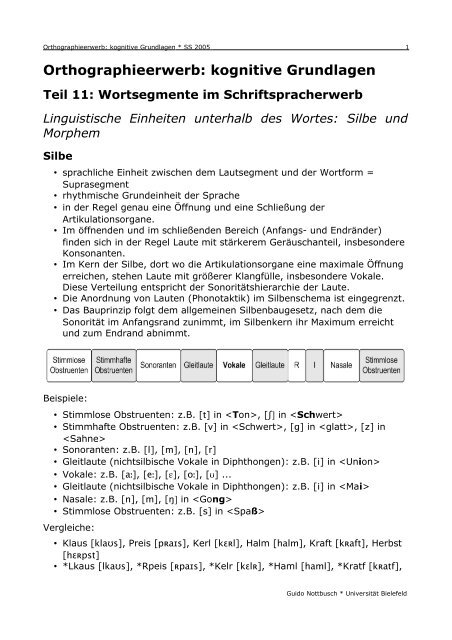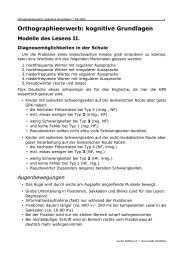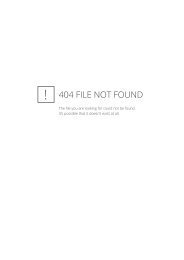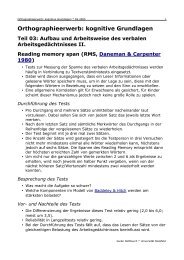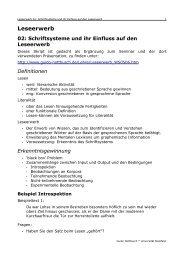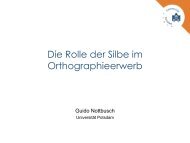Orthographieerwerb: kognitive Grundlagen Teil 11 - Guido Nottbusch
Orthographieerwerb: kognitive Grundlagen Teil 11 - Guido Nottbusch
Orthographieerwerb: kognitive Grundlagen Teil 11 - Guido Nottbusch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />
2005<br />
<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong><br />
<strong>Teil</strong> <strong>11</strong>: Wortsegmente im Schriftspracherwerb<br />
Linguistische Einheiten unterhalb des Wortes: Silbe und<br />
Morphem<br />
Silbe<br />
• sprachliche Einheit zwischen dem Lautsegment und der Wortform =<br />
Suprasegment<br />
• rhythmische Grundeinheit der Sprache<br />
• in der Regel genau eine Öffnung und eine Schließung der<br />
Artikulationsorgane.<br />
• Im öffnenden und im schließenden Bereich (Anfangs- und Endränder)<br />
finden sich in der Regel Laute mit stärkerem Geräuschanteil, insbesondere<br />
Konsonanten.<br />
• Im Kern der Silbe, dort wo die Artikulationsorgane eine maximale Öffnung<br />
erreichen, stehen Laute mit größerer Klangfülle, insbesondere Vokale.<br />
Diese Verteilung entspricht der Sonoritätshierarchie der Laute.<br />
• Die Anordnung von Lauten (Phonotaktik) im Silbenschema ist eingegrenzt.<br />
• Das Bauprinzip folgt dem allgemeinen Silbenbaugesetz, nach dem die<br />
Sonorität im Anfangsrand zunimmt, im Silbenkern ihr Maximum erreicht<br />
und zum Endrand abnimmt.<br />
Beispiele:<br />
• Stimmlose Obstruenten: z.B. [t] in , [ʃ] in <br />
• Stimmhafte Obstruenten: z.B. [v] in , [g] in , [z] in<br />
<br />
• Sonoranten: z.B. [l], [m], [n], [r]<br />
• Gleitlaute (nichtsilbische Vokale in Diphthongen): z.B. [i] in <br />
• Vokale: z.B. [aù], [eù], [E], [où], [U] ...<br />
• Gleitlaute (nichtsilbische Vokale in Diphthongen): z.B. [i] in <br />
• Nasale: z.B. [n], [m], [ŋ] in <br />
• Stimmlose Obstruenten: z.B. [s] in <br />
Vergleiche:<br />
• Klaus [klaʊs], Preis [pʀaɪs], Kerl [kɛʀl], Halm [halm], Kraft [kʀaft], Herbst<br />
[hɛʀpst]<br />
• *Lkaus [lkaʊs], *Rpeis [ʀpaɪs], *Kelr [kɛlʀ], *Haml [haml], *Kratf [kʀatf],<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />
1
<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />
2005<br />
(Bote des) ?Herbsts? [hɛʀpsts]<br />
Silbentypologie<br />
Silbentypen<br />
• Betonte (prominente) Silbe<br />
• unbetonte Silbe (nicht reduziert)<br />
• Reduktionssilbe<br />
Silbenauslaut<br />
• Offene Silbe<br />
• geschlossene Silbe<br />
• geschlossene Silbe als Silbengelenk<br />
Ein Silbengelenk ist ein einzelner Konsonant zwischen einem betonten, ungespannten Vokal<br />
und einem unbetonten Vokal. Der Konsonant gehört zu beiden Silben, er ist ambisyllabisch:<br />
Silbenende der ersten und Silbenanfang der zweiten Silbe sind identisch.<br />
Aufbau der Silbe<br />
• Anfangsrand (Onset)<br />
• Silbenkern (Nukleus)<br />
• Silbenendrand (Coda)<br />
• Reim (Nukleus + Coda)<br />
Länge des Silbenkerns<br />
• lang und gespannt<br />
• kurz und ungespannt<br />
Betonungsmuster deutscher Silben<br />
Im Deutschen gibt es relativ wenige, besonders charakteristische<br />
Betonungsmuster. Das Grundmuster ist die Abfolge einer betonten und einer<br />
unbetonten Silbe; daneben gibt es aber auch noch andere Muster<br />
• Betonte (prominente) Silbe<br />
• unbetonte Silbe (nicht reduziert)<br />
• Reduktionssilbe<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />
2
<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />
2005<br />
Typen prominenter Silben<br />
Anschluss an den<br />
Vokal<br />
lose<br />
fest<br />
a vs. � -> vorne, rund vs. hinten<br />
Endrand der Silbe<br />
offen geschlossen<br />
��ùt� ��ùst�<br />
�at� �ast�<br />
Fügen Sie in die Tabelle ein: /��ù��/, /����/, /��ù�s�t/,<br />
/���t/<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />
3
<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />
2005<br />
Typen reduzierter Silben (werden in der Orthographie immer mit Vokalzeichen (meist ) dargestellt)<br />
Silbengrenzen<br />
• phonotaktische Silbengrenzen<br />
• Prinzip der Onsetmaximierung: Treten zwischen zwei Silbenkernen<br />
mehrere Konsonanten auf, so werden alle Konsonanten, die zusammen<br />
einen harmonischen Anfangsrand bilden, zur zweiten Silbe gezählt.<br />
• graphotaktische Silbengrenzen<br />
• Ein-Graphem-Regel<br />
• morphologische Bestimmung<br />
• konsonantisch anlautende Suffixe: z.B. ~heit, ~keit = Silbengrenze<br />
• * vokalisch anlautende Suffixe: z.B. ~ung ≠ Silbengrenze; aber <<br />
Bebauung><br />
• Präfixe<br />
Morphem<br />
• die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten<br />
• Unterscheidung in Grundmorphem, Wortbildungsmorphem und<br />
Flexionsmorphem<br />
• GM: Träger der lexikalischen Bedeutung, auch freie Morpheme -><br />
können alleine stehen<br />
• WbM: treten nur in Verbindung mit einem GM auf und können diese in<br />
eine andere Wortart transformieren (z.B. Dumm-heit)<br />
• FM: gebundene Morpheme, dienen der Anpassung des Wortes an seine<br />
syntaktische Umgebung<br />
• Fugenelement: meist realisiert als , , (vgl.<br />
, , .<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />
4
<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />
2005<br />
Aufgabe<br />
Segmentieren Sie die folgenden Wörter in Silben in Morpheme:<br />
• <br />
• <br />
• <br />
• <br />
Segmentierungen beim Lesen<br />
Experiment: Segmentierungen<br />
Die Silbe als Einheit zwischen dem Graphem und dem Wort beim Lesen<br />
• Zusätzlich zu den beiden aus dem Zwei-Wege-Modell bekannten Wegen<br />
zur Worterkennung (GPK vs. lexikalisch) scheint es noch einen<br />
Zwischenweg zu geben, bei dem längere Wörter in Silben zerlegt werden.<br />
• Evidenz z.B. aus Leseversuchen, bei denen die Buchstaben einzeln<br />
nacheinander auf einem Bildschirm dargeboten werden (z.B. Mewhort &<br />
Campbell, 1981): Bei direkter Folge der Darbietungen ohne Verzögerungen<br />
können die Wörter gut gelesen werden. Jedoch nimmt die Genauigkeit der<br />
Wiedergabe mit größer werdenden zeitlichen Abständen der Darbietungen<br />
stark ab.<br />
• Leseanfänger und fortgeschrittene Leser nutzen Einheiten<br />
unterschiedlicher Größe für das Dekodieren der phonologischen<br />
Information.<br />
• Vor allem schwache Leser bleiben bei der Graphem-Phonem-Konversions-<br />
Strategie 'hängen'.<br />
• Die Nutzung der silbischen Lese-Strategie hat einen Zeitvorteil.<br />
• Das Zusammenschleifen einzelner Phoneme zu einem Wort verbraucht<br />
mehr Gedächtnisspeicher.<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />
5
<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />
2005<br />
Verbesserung der Leseleistung im Niederländischen durch<br />
Silbentraining (Wentink et al., 1997)<br />
• Da schwache Leser die orthographische Struktur der Wörter weniger<br />
nutzen als gute Leser gleichen Alters, liegt es nahe anzunehmen, dass ein<br />
Training der Fähigkeit Wörter in Silben zu teilen und diese als Einheit<br />
wahrzunehmen die Leseleistung der schwachen Leser verbessern könnte.<br />
Design der Trainingsstudie<br />
• 55 schwache Leser im Alter von 8 bis 12 Jahren nahmen an der Studie teil.<br />
28 bildeten die Trainingsgruppe, 27 die Kontrollgruppe.<br />
• Angewandt wurde ein Prätest-Training-Posttest Design.<br />
• Zum Training wurden Pseudowörter mit 3, 5 oder 7 Graphemen, bzw. mit<br />
1, 2 oder 3 Silben konstruiert. So konnten beide Größen (Anzahl der<br />
Grapheme, Anzahl der Silben) kontrolliert werden.<br />
• Das Training wurde zwei mal wöchentlich ca. 30 Minuten über einen<br />
Zeitraum von acht Wochen durchgeführt.<br />
• Auf einem Bildschirm wurden die Pseudowörter mit hervorgehobenen<br />
Silben präsentiert (z.B.: taupoereel).<br />
• Die Darbietungszeit sollte so kurz sein, dass die Kinder dazu animiert<br />
werden, die Silben als Einheit wahrzunehmen. (Für ein Zusammenschleifen<br />
der einzelnen Phoneme war nicht genügend Zeit vorhanden.)<br />
• Die Dauer wurde für jedes Kind nach jedem dritten Wort so angepasst,<br />
dass ca. 67% der Wörter gelesen werden konnten.<br />
Methode<br />
• die Reaktionszeiten richtiger Antworten bei Pseudowörtern mit gleicher<br />
Silbenanzahl aber unterschiedlicher Graphemanzahl,<br />
• die RZ bei Pseudowörtern mit gleicher Graphemanzahl aber<br />
unterschiedlicher Silbenanzahl,<br />
• der Trainingseffekt auf die Leseleistung.<br />
Ergebnisse<br />
• Die Latenzen nahmen mit dem Training ab.<br />
• Die Performance bei Lesetests mit unbekannten Pseudowörtern und echten<br />
Wörtern unterschied sich signifikant vor und nach dem Training (ca. 400<br />
ms für Wörter, ca. 1000 ms für Pseudowörter). (Die Kontrollgruppe hatte<br />
sich in der gleichen Zeit ohne Training nicht verbessert.)<br />
• Je mehr Grapheme ein Pseudowort hatte, desto länger war die Latenz<br />
(konsistent über alle Trainingseinheiten).<br />
• Je mehr Silben ein Pseudowort hatte (unabhängig von der Anzahl der<br />
Grapheme), desto länger war die Latenz.<br />
• Das Lesen von komplexeren Silben (z.B. mit einer CCVCC-Struktur) konnte<br />
stärker verbessert werden als das von einfacheren Silben (z.B. mit CVC-<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />
6
<strong>Orthographieerwerb</strong>: <strong>kognitive</strong> <strong>Grundlagen</strong> * SS<br />
2005<br />
Struktur).<br />
Schriftlichkeit und Mündlichkeit<br />
• Geschwindigkeit des Outputs<br />
• Flaschenhals<br />
• mentaler Zwischenspeicher<br />
• (gesprochene) 'Worte sind Schall und Rauch'<br />
• externer Speicher (Schreibmedium)<br />
• Das Schreiben ist indirekte (zeitlich 'zerdehnte') Kommunikation.<br />
• Der Schreibakt findet meist unbeobachtet statt, nur das Endprodukt<br />
gelangt zum Empfänger.<br />
• Darüber hinaus ergeben sich die Möglichkeiten der nonverbalen<br />
Kommunikation: Gesten, Mimik usw.<br />
• Hieraus ergibt sich, dass gesprochene Sprache weniger genau sein<br />
muss: Je nach Kontext können mehr oder weniger Elemente vereinfacht<br />
oder weggelassen werden.<br />
• Die Schrift muss alle Strukturen abbilden. In ihr müssen alle Elemente<br />
gegliedert sein. Für die Abbildung muss es Regeln geben, z.B. für<br />
Kürze/Länge von Vokalen.<br />
• Deshalb scheint eine Segmentierung - wie z.B. die Prosodie beim<br />
Sprechen oder der Takt in der Musik - beim eigentlichen Schreiben nicht<br />
unbedingt notwendig zu sein.<br />
Literatur<br />
Mewhort, D. J. K., & Campbell, A. J. (1981). Toward a model of skilled reading:<br />
An analysis of performance in tachistoscopic tasks. In E. MacKinnon & T.<br />
C. Waller (Eds.), Reading Research: Advances in Theory and Practice. Vol.<br />
3. New York: Academic Press.<br />
Wentink, H. W., Van Bon, Wim H.J., & Schreuder, R. (1997). Training of poor<br />
readers' phonological decoding skills: Evidence for syllable-bound<br />
processing. Reading and writing, 9, 163-192.<br />
<strong>Guido</strong> <strong>Nottbusch</strong> * Universität Bielefeld<br />
7