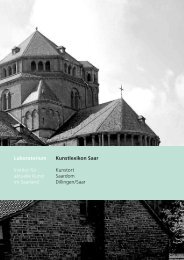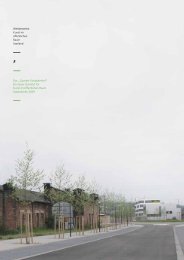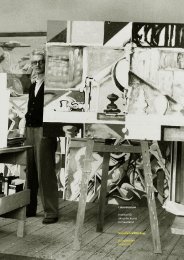Download - Galerie St. Johann
Download - Galerie St. Johann
Download - Galerie St. Johann
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
museale<br />
Die Sparda-Bank-<strong>St</strong>iftung<br />
zu Gast im Ludwig Museum<br />
Koblenz<br />
Ausstellungsreihe<br />
in Zusammenarbeit mit<br />
Landesmuseum Mainz<br />
Saarlandmuseum Saarbrücken<br />
Pfalzgalerie Kaiserslautern<br />
Ludwig Museum Koblenz<br />
<strong>St</strong>adtmuseum Simeonstift Trier<br />
Willhelm-Hack-Museum Ludwigshafen<br />
11<br />
Ludwig Museum Koblenz<br />
Bernar Venet
Inhalt<br />
5<br />
7<br />
15<br />
35<br />
43<br />
46<br />
Vorwort<br />
Hans-Jürgen Lüchtenborg<br />
museale 11<br />
Die Skulptur Deux Arcs à 5<br />
von Bernar Venet<br />
Beate Reifenscheid<br />
Bernar Venet – Logik, Wahrheit<br />
und Schönheit der Mathematik<br />
Beate Reifenscheid<br />
Bernar Venet – Formeln des Irregulären<br />
Peter Joch<br />
Biografie, Bibliografie<br />
Museumskontakte
Vorwort<br />
Im Mai 2003 erschien der Katalog zur<br />
ersten museale der Sparda-Bank und<br />
nun sind wir schon bei der museale 11<br />
angekommen. Die museale ist eine<br />
Kooperation der <strong>St</strong>iftung Kunst, Kultur<br />
und Soziales der Sparda-Bank Südwest eG<br />
mit sechs wichtigen Kunstmuseen in<br />
Rheinland-Pfalz und im Saarland. Unsere<br />
<strong>St</strong>iftung unterstützt dabei jährlich eines<br />
der beteiligten Museen beim Ankauf<br />
eines Kunstobjekts für die jeweilige<br />
Sammlung.<br />
Prof. Jo Enzweiler hat die Idee zur museale<br />
gemeinsam mit uns entwickelt und<br />
betreut das Projekt seit nunmehr acht<br />
Jahren für uns. Dafür gilt ihm unser<br />
großer Dank.<br />
Mit der museale 11 kann sich das<br />
Ludwig Museum in Koblenz einen<br />
lang gehegten Wunsch erfüllen: den<br />
Ankauf einer großen Außenskulptur<br />
des Künstlers Bernar Venet. Wir wünschen<br />
uns, dass dieses neue Wahrzeichen<br />
des Museums viele Koblenzer Bürgerinnen<br />
und Bürger neugierig machen und dazu<br />
anregen wird, „ihrem“ Museum mal<br />
wieder einen Besuch abzustatten.<br />
Sonntags gemütlich mit der ganzen<br />
Familie eine Ausstellung anschauen oder<br />
auch mal die Mittagspause nutzen, um<br />
beim Betrachten der Kunst den Kopf<br />
wieder frei zu bekommen, sich inspirieren<br />
zu lassen und mit anderen über die<br />
Kunst ins Gespräch zu kommen – für<br />
individuellen Kunstgenuss gibt es viele<br />
Möglichkeiten.<br />
Ich wünsche Ihnen Ihre ganz persönlichen<br />
angenehmen Kunst-Momente im<br />
Ludwig Museum und viel Freude und<br />
Anregungen mit der museale 11.<br />
Hans-Jürgen Lüchtenborg,<br />
Vorstandsvorsitzender<br />
der Sparda-Bank Südwest eG,<br />
im April 2011<br />
5
3 Arcs à 4<br />
Präsentation während<br />
der Venet-Ausstellung<br />
im Ludwig Museum<br />
Koblenz, 2002<br />
6
museale 11:<br />
Die Skulptur<br />
224,5° Arcs x 5 et 225° Arcs x 5<br />
von Bernar Venet<br />
Beate Reifenscheid<br />
2003 wurde der Grundstein für die<br />
Kooperation der Sparda-Bank Südwest<br />
eG mit sechs Museen in Rheinland-Pfalz<br />
und im Saarland mit der museale 01<br />
gelegt. Dabei stellten sich die Museen<br />
zunächst gemeinsam in den Schalterräumen<br />
der Sparda-Bank in Mainz vor.<br />
Der Ausstellung folgten seitdem jährlich<br />
im Herbst EinzeIausstellungen.<br />
2007 präsentierte sich das Ludwig<br />
Museum Koblenz mit der museale 06<br />
„Edition MAT und die Nouveaux Réalistes“<br />
in Mainz. <strong>St</strong>att „Museen zu Gast bei der<br />
Sparda-Bank Südwest eG“ heißt es seit<br />
2008 „Die Sparda-Bank-<strong>St</strong>iftung zu Gast<br />
in den Kunstmuseen in Rheinland-Pfalz<br />
und im Saarland.“ Die <strong>St</strong>iftung Kunst,<br />
Kultur und Soziales der Sparda-Bank Südwest<br />
eG unterstützt in dieser zweiten<br />
Runde der museale jährlich eines der beteiligten<br />
Museen mit dem Ankauf eines<br />
Kunstobjekts für die jeweilige Sammlung.<br />
Dem Museum Ludwig hat die Sparda-<br />
Bank-<strong>St</strong>iftung mit der museale 11 den<br />
Ankauf des Werkes „224,5° Arcs x 5<br />
et 225° Arcs x 5“ von Bernar Venet<br />
ermöglicht.<br />
Darüber hinaus haben auch die Kulturstiftung<br />
der Länder und die Ludwig<br />
<strong>St</strong>iftung den Ankauf unterstützt.<br />
Die monumentale Skulptur, die Bernar<br />
Venet 2007 schuf, steht im Zusammenhang<br />
mit seiner Erschließung der Welt in<br />
mathematischen Kontexten und abstrakten<br />
Zeichencodes. Bereits im Frühwerk<br />
des wohl bedeutendsten französischen<br />
wie auch international renommierten<br />
Konzeptkünstlers findet sich eine deutliche<br />
Affinität zu abstrakten Erklärungsmodellen.<br />
Die großformatige Zeichnung<br />
„Numerical solution for flux component<br />
in potential flow“ von 1967/68, die Peter<br />
Ludwig wenig später in New York erwarb,<br />
bezeichnet den Auftakt innerhalb<br />
seines Frühwerks und zählt heute zu den<br />
herausragenden Werken des Sammlungsbestands<br />
im Ludwig Museum. Bereits<br />
Mitte der 1970er Jahre beginnt Bernar<br />
Venet auf der formalen Basis von Linie<br />
und Kreis sein skulpturales Vokabular<br />
zu entwickeln.<br />
Der Kreis bildet dabei eine der entscheidendsten<br />
Grundformen. 1984 entstehen<br />
die ersten „Arc“-Skulpturen, die Venet<br />
jeweils präzise aus dem Vollrund berechnet.<br />
Aus der Parallelisierung von angeschnittenen<br />
Bögen entwickelt er eine je<br />
unterschiedliche <strong>St</strong>affellungen der Enden<br />
und zugleich eine größere Dynamisierung<br />
im Gesamteindruck der Skulptur. Venet<br />
nutzt ab 1997 gerne eine Folge von vier<br />
oder fünf Parallellinien und kombiniert<br />
diese häufig zu ganzen Skulpturenensembles.<br />
Im Doppel von zwei Skulpturen<br />
schafft Venet somit eine Dialogisierung<br />
der Formen, die nicht nur mehr Masse<br />
demonstrieren, sondern auch den Raum<br />
entschiedener akzentuieren.<br />
Am Deutschen Eck, in unmittelbarer<br />
Nachbarschaft zum Ludwig Museum und<br />
der historischen Mauer des Deutschen<br />
Eck wird Bernar Venets Skulptur sicherlich<br />
zu einem neuen Wahrzeichen der<br />
<strong>St</strong>adt Koblenz und des neu gestalteten<br />
Museumsufers. Sie markiert zugleich<br />
einen der bedeutendsten Skulpturenankäufe<br />
in Rheinland-Pfalz.<br />
Die Übergabe der Skulptur an die <strong>St</strong>adt<br />
Koblenz wird begleitet von einer Präsentation<br />
aktueller, teils großformatiger<br />
Zeichnungen.<br />
7
2 Arcs à 5<br />
Ansicht am<br />
„Deutschen Eck“<br />
während der<br />
Venet-Ausstellung im<br />
Ludwig Museum<br />
Koblenz, 2002<br />
8
Bernar Venet<br />
Werke
Seite 12/13<br />
„The S Matrix Element“<br />
Museo Brasileiro da<br />
Escultura, Sao Paolo,<br />
Brasilien, 2001<br />
Numerical solution<br />
for flux component<br />
in potential flow<br />
1967/68<br />
110 x 335 cm<br />
Ludwig Museum,<br />
Koblenz, Leihgabe<br />
Sammlung Ludwig<br />
14
Bernar Venet – Logik, Wahrheit<br />
und Schönheit der Mathematik<br />
Beate Reifenscheid<br />
Als wir im Ludwig Museum gemeinsam<br />
mit Bernar Venet seine Ausstellung für<br />
den Sommer 2002 vorbereiteten, bestand<br />
zumindest anfangs die Idee, zahlreiche<br />
seiner größeren sowie kleineren<br />
Skulpturen zu zeigen und eventuell noch<br />
ein paar neuere Zeichnungen hinzuzunehmen.<br />
Ausgangspunkt sollte jedoch,<br />
so fand ich, jene Zeichnung von Bernar<br />
Venet sein, die schon seit der Gründung<br />
des Ludwig Museums zu dessen Bestand<br />
zählt. Tatsächlich hat sie dann die Konzeption<br />
der Ausstellung bestimmt, wurde<br />
zum Nukleus einer umfassenden Darstellung<br />
mathematischer Formeln, wie sie in<br />
dieser <strong>St</strong>ringenz nirgends zuvor so umfassend<br />
und mit all ihrer Radikalität präsentiert<br />
worden sind und schließlich zu<br />
seinen großformatigen Wandzeichnungen<br />
führten, die Venet erstmals im Ludwig<br />
Museum so extensiv experimentell<br />
auslotete. Die ausgewählten Skulpturen<br />
fanden dann nicht im Innen-, sondern<br />
ausschließlich im angrenzenden Gartenbereich<br />
des Ludwig Museums ihre Präsentation.<br />
Vor allem die dreiteilige Arcs-<br />
Skulptur war monumental. Sie stand in<br />
unmittelbarer Beziehung zu den Zeichnungen<br />
und Wandarbeiten, die Venet im<br />
Ludwig Museum realisiert hatte.<br />
Die als Ausgangspunkt gewählte Zeichnung<br />
stellt eine lange, scheinbar sehr<br />
ausführliche Erläuterung zur theoretischen<br />
Physik dar, die Bernar Venet bei<br />
seinen umfänglichen Recherchen und bei<br />
seinen Zusammenkünften mit dem Astrophysiker<br />
Jack Ullman an der Columbia<br />
University, New York, in dieser Zeit gewonnen<br />
hat. Er nimmt zwischen 1967<br />
und 1970 dessen Vorträge auf Band auf.<br />
„Mit dem Tonbandgerät, das er auf einen<br />
für Skulpturen vorgesehenen Sockel<br />
stellt, und Diaprojektionen von den im<br />
Vortrag diskutierten mathematischen<br />
Formeln, stellt er diese Einheit von Formeln<br />
und Inhalt wieder her. 1<br />
15
Ausstellungsansicht<br />
2002<br />
Ludwig Museum<br />
Koblenz<br />
16
Wall paintings,<br />
2002<br />
Ludwig Museum<br />
Koblenz<br />
17
Figure 241<br />
Représentation<br />
graphique de la<br />
fonction y=-x2/4<br />
1966<br />
Acryl auf Leinwand<br />
146 x 121 cm<br />
Sammlung Musée<br />
National d’Art Moderne,<br />
Centre Georges Pompidou,<br />
Paris<br />
20
Neben dem astrophysikalischen Kontext,<br />
in dem die Zeichnung entsteht, ist vor<br />
allem bemerkenswert, dass sie nichts Anderes<br />
als genau diesen komplexen Erklärungsmodus<br />
wiedergibt, ohne dass<br />
Bernar Venet künstlerisch etwas verändert<br />
oder hinzugefügt hätte. Das, was er<br />
abbildete, war eins zu eins das, was ihm<br />
die Wissenschaftler offeriert hatten. Das<br />
war ein völlig neuer, radikaler Ansatz innerhalb<br />
der Kunst, der sich bereits im<br />
Frühwerk von Venet deutlich abzeichnete.<br />
So wiesen vor allem seine tubes bereits<br />
jene unmittelbare Realitätsreferenz<br />
auf, die sie ununterscheidbar werden<br />
lässt gegenüber den in der Technik oder<br />
im <strong>St</strong>raßenbau genutzten Modellen. Ihre<br />
Vorzeichnungen gleichen ihrerseits den<br />
Modellzeichnungen von Architekten oder<br />
Bauingenieuren und wirken nur in zweiter<br />
Sehinstanz als ästhetisches Konstrukt.<br />
Die Korrelation von Skulptur und dem<br />
aus der technischen Objektwelt überführten<br />
Produkt scheint in eins zu fließen.<br />
Dies geschieht jedoch nur scheinbar, so<br />
wie auch seine Zeichnungen eben nicht<br />
nur als abgeschriebene Formeln aus<br />
Mathematik- oder Physikbüchern dieser<br />
Welt funktionieren sollen. Schon die<br />
Zeichnung „Nummerical solution for flux<br />
component in potential flow“ meint nicht<br />
die schriftliche Kopie einer bereits vorhandenen,<br />
errechneten, hoch komplexen Formel,<br />
sondern übersetzt diese bereits von<br />
Anfang an in ein „Bild”. Sie verbleibt zwar<br />
auf technischem Zeichenpapier, sucht sich<br />
aber bereits ein Format, das in der Mathematik<br />
nicht zwangsläufig als üblich zu bezeichnen<br />
ist (110 x 335 cm), überzieht das<br />
sensible Zeichenpapier mit einer Schutzfolie<br />
und lässt eine Rahmung (im Sinne<br />
eines klassischen Bilderrahmens) zu. Bei<br />
letzterem ist nicht mehr zu klären, ob<br />
dieser schon bei der Präsentation in der<br />
<strong>Galerie</strong> in New York, wo Peter Ludwig sie<br />
dann sah und auf Anraten von Venet<br />
auch erwarb, bereits so ästhetisch aufbereitet<br />
war. Dessen ungeachtet diente sie<br />
als ein Kunstobjekt an der Wand, genau<br />
so wie ein Bild an einer Wand inszeniert<br />
wird. Venets Werke suchen bei aller Affinität<br />
zur Mathematik, zur Physik oder zur<br />
Astronomie vor allem nach deren Wahrnehmung<br />
auf der Ebene der Kunst, die<br />
sich allein über die Gesetze der Ästhetik<br />
und deren Wahrnehmungsstrategien<br />
sinnlich veranschaulichen und erklären<br />
lassen. Dies ist entscheidend, weil nur so<br />
die Betrachtung der abstrakten Formel<br />
zugleich auch in ihrer sinnlichen Qualität<br />
– durchaus für Jedermann, selbst für den<br />
nicht versierten Laien – gelingt. In einem<br />
sehr instruktiven Beitrag des Mathematikprofessors<br />
Karl Heinrich Hofmann,<br />
schreibt dieser von dem – umgekehrt –<br />
auch für Mathematiker faszinierenden<br />
ästhetischen Reiz, der von den großformatigen<br />
Zeichnungen – insbesondere<br />
von Venets späteren Wandzeichnungen –<br />
ausgeht: „Naturally, as mathemeticians<br />
we are particularly interested in that very<br />
recent portion of his work which appears to<br />
link very closely with mathematics in the<br />
souls of trained art critics. But professional<br />
mathematicians should not be led astray by<br />
the professional art commentators. We as<br />
mathemeticians are in an excellent position<br />
to appreciate and experience straightforwardly<br />
conceptual art as well as its intrinsic<br />
quality.” 2<br />
Der normale Betrachter von Bernar Venets<br />
Werken ist aber selten mathematisch<br />
derart geschult, um sich an dem mathematisch<br />
korrelativen Konstrukt, welches<br />
eine Formel in Bezug auf die Realität ausdrückt,<br />
zu orientieren oder gar ihren<br />
Wahrheitsgehalt überprüfen zu können.<br />
Vielmehr wird er sich rein an dem ästhetischen<br />
Reiz begeistern können. Dieser<br />
funktioniert aber ebenfalls nicht mit den<br />
gebräuchlichen Begriffen, schon gar<br />
nicht dann, wenn der Betrachter sich einer<br />
für ihn ungewohnten Komplexität<br />
konfrontiert sieht und diese höchstens<br />
ahnt, nicht aber inhaltlich begreift.<br />
21
Seite 19/20<br />
Ausstellungsansicht<br />
Arcs 1977-1979<br />
ARCO Center for Visual<br />
Arts, Los Angeles,<br />
California<br />
Position de deux arcs<br />
35,5° et 123,5°<br />
1976<br />
Acryl auf Leinwand<br />
240 x 480 cm<br />
24
Venet arbeitet hier bewusst mit dem<br />
Überraschungseffekt: Durch das unvermutete<br />
Auftauchen seiner mathematischen<br />
Formeln, seiner spätestens ab<br />
2000 großformatig werdenden monochrom<br />
hinterlegten Zeichenformeln an<br />
den Wänden sowie schließlich seiner Arc-<br />
Skulpturen, denen ihrerseits mathematische<br />
Berechnungen zugrundeliegen, was<br />
durch Gradzahlen auch äußerlich markiert<br />
ist. All diese Werke spielen auch mit<br />
der Irritation. Nur durch sie gerät der<br />
Blick des Betrachters ins <strong>St</strong>ocken, zögert,<br />
schaut erneut hin und vertieft sich in die<br />
Arbeit. Irritation entsteht nach Venet deshalb,<br />
weil etwas <strong>St</strong>örendes in die Kunst<br />
integriert wird: „There is only one way to<br />
make art advance: to put existing art into<br />
the wrong.“ 3 Wenn man dies als Grundzug<br />
von Venets Arbeit versteht, eröffnen<br />
die Werke zugleich auch einen neuen Zugang,<br />
der aber dennoch nie ohne die<br />
klassischen ästhetischen Maßstäbe denkbar<br />
ist. Schlüssig mag dies für einen Mathematiker<br />
gerade deshalb sein, weil, wie<br />
Hofmann darlegt, Venet vornehmlich<br />
kommutative Diagramme einsetzt, die<br />
ihrerseits eine oder mehrere Gleichungen<br />
repräsentieren. Homologische Algebra<br />
sowie einige theoretische Kategorien innerhalb<br />
der Mathematik brachten gerade<br />
im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts<br />
anschauliche Modelle hervor. Sie basieren<br />
letztlich auf keiner anderen Funktion<br />
als dies durch die Schrift ihrerseits erreicht<br />
wird. Wenn man in diesem Zusammenhang<br />
Venets Ausspruch ernst nimmt,<br />
dass er keine Mathematik als Kunst deklariert,<br />
sondern, das was er ausdrückt<br />
auch darstellt, bleibt dennoch zu fragen,<br />
wohin seine mathematischen Formeln<br />
und Gleichungen (aus der Sicht des<br />
Künstlers) tendieren. Interessanterweise<br />
manifestiert sich dies für den Mathematiker<br />
Hofmann sowohl in der Authentizität<br />
als auch in dem nahezu pathetisch klingenden<br />
Begriff der Wahrheit 4 , die ihrerseits<br />
bereits in der mathematischen<br />
Gleichung begründet liegt. Diese bezieht<br />
er explizit auf Venets Adaption von Diagrammen<br />
– ungeachtet ihrer Größe oder<br />
farbigen Hinterlegung der Wandfläche.<br />
Folgerichtig schließt er analog zu Venets<br />
eigener Auffassung damit, dass die von<br />
Venet gezeigten mathematischen Formeln<br />
nicht nur in sich logisch und damit<br />
auch wahr sind, sondern, dass sie auch<br />
dann wahr sind und bleiben, wenn sie in<br />
einem anderen Kontext (und vor einem<br />
anderen Hintergrund) präsentiert werden.<br />
Sie bleiben – ungeachtet ob sie Mathematik<br />
oder Kunst sind – wahr.<br />
Authentizität und Wahrheit sind zwei<br />
Begriffe, die in der Kunst jenseits aller<br />
modischen <strong>St</strong>römungen ungebrochene<br />
Bedeutung behalten. Radikale Positionen<br />
wie sie das Werk von Bernar Venet verkörpern,<br />
haben maßgeblich dazu beigetragen,<br />
diese Unbedingtheit und den<br />
Glauben an das Absolute in den Mittelpunkt<br />
zu stellen. Jenseits der schon in der<br />
Antike durch Aristoteles begründeten<br />
Tradition der Metaphysik und der im Mittelalter<br />
durch Thomas von Aquin formulierten<br />
onthologischen Korrespondenztheorie<br />
der Wahrheit („adaequatio rei et<br />
intellectus Übereinstimmung der Sache<br />
mit dem Verstand“) ist wohl insbesondere<br />
Ludwig Wittgensteins logischer Empirismus<br />
für die Nachvollziehbarkeit der<br />
dargestellten Objekte und mathematischen<br />
Formeln Venets und ihrem Anspruch<br />
auf Logik und Wahhaftigkeit hilfreich.<br />
„Im Tractatus Logico-Philosophicus“ geht<br />
Wittgenstein zunächst davon aus, dass<br />
wir uns Bilder von der Wirklichkeit machen.<br />
Sie sind ein „Modell der Wirklichkeit“<br />
(2.12). Bilder drücken sich in Gedanken<br />
aus, deren Gestalt „der sinnvolle<br />
Satz“ darstellt (4). Wittgenstein definiert<br />
die Wirklichkeit als „die Gesamtheit der<br />
Tatsachen“ (1.1). Tatsachen sind bestehende<br />
Sachverhalte, die von bloßen,<br />
25
Position of Four Right<br />
Angels, 1979<br />
Graphit auf Holz<br />
Höhe 240 cm<br />
Museum Küppersmühle<br />
Duisburg, 2007<br />
nicht bestehenden Sachverhalten zu unterscheiden<br />
sind (2.04–2.06). Sie bestehen<br />
aus Gegenständen oder Dingen und<br />
der Verbindung zwischen ihnen (2.01).<br />
Auch der Satz ist eine Tatsache (3.14).<br />
Eine Tatsache wird zum Bild durch die<br />
„Form der Abbildung“, die sie mit dem<br />
Abgebildeten gemeinsam hat. Wittgenstein<br />
versucht dies an folgendem Beispiel<br />
deutlich zu machen: „Die Grammophonplatte,<br />
der musikalische Gedanke, die<br />
Notenschrift, die Schallwellen, stehen alle<br />
in jener abbildenden Beziehung zueinander,<br />
die zwischen Sprache und Welt besteht.“<br />
(Ludwig Wittgenstein: Tractatus<br />
Logico-Philosophicus. 4.014.). Ebenso<br />
wie die Notenschrift ein Bild der durch sie<br />
dargestellten Musik ist, stellt der Satz<br />
„ein Bild der Wirklichkeit“ dar (4.021).<br />
Ein Satz besteht aus Namen und den Beziehungen<br />
zwischen ihnen. Er ist wahr,<br />
wenn die in ihm enthaltenen Namen auf<br />
reale Gegenstände referieren und die Beziehung<br />
zwischen den Namen der zwischen<br />
den referierten Gegenständen entspricht.“<br />
5 Umgekehrt stellt eine Formel<br />
eine Beziehung her zu dem komplexen<br />
Gedanken, der sich als Realität in ihr<br />
spiegelt. Venet greift mit seinen Werken<br />
in diesen dialogischen Prozess der Wahrheit<br />
ein und manifestiert in seiner Kunst<br />
nichts Anderes als diese Realitäts- und<br />
Wahrheitsbezogenheit.<br />
Was wiederum verbindet die Zeichnung<br />
oder Wandmalerei mit der Skulptur?<br />
Wie bereits dargelegt nutzt Venet mathematische<br />
Formeln, um in seinen Zeichnungen<br />
nichts Anderes auszudrücken als<br />
genau das, was er zeigt. Er möchte bewusst<br />
keinen Interpretationsspielraum<br />
lassen und bleibt damit auch dem Anspruch<br />
auf Wahrheit und Authentizität<br />
treu. Insofern entspricht es der Logik,<br />
dass nach der funktional ausgerichteten<br />
Zeichnung unmittelbar auch die Skulptur<br />
aus ihr abgeleitet ist.<br />
26
Position of 3 Arcs<br />
of 243.5 °, 1979<br />
Graphit auf Holz<br />
Höhe 240 cm<br />
Museum Küppersmühle,<br />
Duisburg, 2007<br />
27
217,5° Arc x 28<br />
2008<br />
Cortenstahl<br />
440 x 500 x 672 cm<br />
Installationsansicht<br />
Atelier Venet, Le Muy<br />
28
Bernar beschreibt anschaulich in einem<br />
2008 geführten Interview mit Walter<br />
Smerling: „The arcs have their origin in the<br />
Représentation graphique de la fonction y<br />
= - x2 (Graphical representation of the<br />
function y = - x2) (1966). I grew conscious<br />
of the fact that the line had become<br />
a central element in my work in 1976<br />
when creating these large-format paintings<br />
- which are characterised by angles<br />
(broken lines), arcs (curved lines) and<br />
chords (straight lines). This exhibition features<br />
excellent examples of this. Furthermore,<br />
we are exhibiting wall reliefs which<br />
represent a logical development of the<br />
canvas works. It was during this time in<br />
1979 that I was struck by the idea of adding<br />
to these three variations – the<br />
straight line, the curved line and the broken<br />
line – the indeterminate line or ligne<br />
indéterminée. It is called this because it<br />
liberates itself from the geometrical constraints<br />
and consequently can no longer<br />
be determined mathematically. The subsequent<br />
focus on sculptures came about<br />
almost inexorably because I realised that<br />
they enabled me to represent my ideas,<br />
both visually and conceptually, even more<br />
convincingly. The larger dimensions of<br />
these works and their presentation in<br />
public spaces contributed to their wider<br />
acceptance because as a result they had<br />
become more accessible.“ 6<br />
Die Linie ist eine der Konstanten in Venets<br />
Werk, ganz gleich, ob sie gerade gezogen<br />
ist, oder ob sie sich „unbestimmt“<br />
und offen windet. Das Eine ist das Kalkulierbare,<br />
das Andere suggeriert mehr Offenheit<br />
und bleibt unberechenbar. Der<br />
„Arc“ entwickelt sich aus der geraden<br />
Linie, nur auf das Kreisrund bezogen und<br />
basiert auf mathematischen Grundlagen.<br />
Durch seine Öffnung bleibt er unvollkommen,<br />
strebt aber immer nach Ergänzung,<br />
nach dem zum Rund geschlossenen<br />
Kreis. Dabei bleibt er im Prozess des<br />
Dynamischen, wird niemals statisch und,<br />
gerade in der vierfachen oder fünffachen<br />
Parallelisierung seiner Bogenform und<br />
den damit verbundenen unterschiedlichen<br />
Endungen, umso offener und lebendiger.<br />
Nahezu tänzerisch verhalten sie<br />
sich zu dem Raum, in dem sie sich befinden.<br />
Trotz aller Monumentalität und<br />
Schwere gewinnen sie etwas Leichtes<br />
und lassen etwas Neues zu: Es ist die Eleganz<br />
und Schönheit, die ein Unbestimmtes,<br />
ein nicht letztes Endgültiges verkörpert.<br />
Es ist der Gedanke an die Freiheit.<br />
Anmerkungen<br />
1 Vgl.: Von Arman bis Andy Warhol.Die Meisterwerke<br />
des Ludwig Museum, Freiburg 2009, 129.<br />
2 Karl Heinrich Hofmann, Commutative Diagrams in<br />
the Fine Arts, in: Notice of the AMS, Volume 49,<br />
Number 6, June/July 2002, S. 665.<br />
3 Ebenda, S. 665, zitiert nach: Bernar Venet,<br />
Apoétiques 1967-1998, Musée d‘Art Moderne et<br />
Contemporain (MAMCO), Genève 1999, o.S.<br />
4 Ebenda, S. 667: „We concede, as mathematicians,<br />
that he attains an uncontested degree of authenticity<br />
by copying material from its scholarly environment<br />
without modifying or adulterating it, and<br />
thus maintains what we call “truth”.”<br />
5 Ludwig Wittgenstein, Logisch-philosophische Abhandlung,<br />
Tractatus logico-philosophicus, Kritische<br />
Edition, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998<br />
6 Bernar Venet, in: Fragen an den Künstler, Gespräch<br />
mit Walter Smerling, in: Bernar Venet, System und<br />
Zufall, Ausst.Kat., Museum Küppersmühle für<br />
Moderne Kunst, Duisburg 2007, S.62<br />
30
Sans titre<br />
3 arcs<br />
Privatsammlung,<br />
Eygalières<br />
31
Tas de charbon<br />
Charcoral Pile<br />
1963<br />
Installation im Musée<br />
d'Art moderne et d'Art<br />
contemporain Nizza<br />
34
Bernar Venet –<br />
Formeln des Irregulären<br />
Peter Joch<br />
Bernar Venet präsentiert in seinem Œuvre<br />
ein vielschichtiges Spiel mit den Kategorien<br />
‚kalkuliert’ und ,unbestimmt’, inszeniert<br />
einen Schwebezustand zwischen<br />
Rationalität und Zufall. In einigen seiner<br />
Werkblöcke scheint er zeichentheoretische<br />
Grundgedanken der – intellektuellen<br />
- Concept Art zu umspielen und in<br />
eine neue Materialsprache zu übersetzen.<br />
Auf vielen seiner stählernen „Bögen“<br />
und „Winkel“ sind Maßangaben zu<br />
lesen, die sich wie eine Konstruktionsanweisung<br />
für die jeweilige Plastik verstehen<br />
lassen. Ein Titel wie etwa „233,5·"<br />
definiert das Kreissegment eines "Bogens",<br />
zusätzliche Angaben wie beispielsweise<br />
„x 5“ charakterisieren ein ,mehrstimmiges'<br />
Ensemble geometrischer Grundelemente.<br />
Die eingelassenen Zahlen erinnern<br />
an Angaben, wie sie in genormte<br />
Bauteile oder Werkzeuge geprägt werden,<br />
suggerieren ein System funktionstüchtiger<br />
Elemente.<br />
Durch die systematisierten Kürzel konfrontiert<br />
Venet eine Basis-Information<br />
mit der künstlerischen Ausführung, stellt<br />
also zwei – miteinander gekoppelte –<br />
Zeichensprachen einander gegenüber.<br />
Er greift damit auf einen Themenkreis<br />
zurück, der ihn bereits in den sechziger<br />
Jahren beschäftigte. Zu dieser Zelt stellte<br />
er beispielsweise die technische Entwurfsskizze<br />
für ein Bakelitrohr aus und<br />
postulierte - ganz im Sinne der Concept<br />
Art - eine prinzipielle Gleichheit von Information<br />
und Objekt. Gerade Venets<br />
Opposition von Zeichen, die als Zahl und<br />
Metall verschiedenen Codes entstammen,<br />
aber ,denselben’ Gegenstand zu<br />
verkörpern scheinen, lässt sieh unmittelbar<br />
mit der Tradition der Konzeptkunst in<br />
Verbindung bringen.<br />
35
Erinnert sei etwa an Joseph Kosuth, der<br />
Alltagsgegenstände, beispielsweise einen<br />
<strong>St</strong>uhl, auf verschiedenen Zeichenebenen<br />
– in Gestalt von Gegenstand, Wort, Fotografie<br />
etc. – ,durchspielte’.<br />
In seine ,Gleichungssysteme’, in seine<br />
strenge konzeptuelle Urgeometrie, die<br />
eine Kongruenz von Information und<br />
Objekt vorgibt, bindet Venet Elemente<br />
von Verschiebung, Verstörung, Verunklärung<br />
ein. So komponiert er Ensembles<br />
aus „Bögen“, die gegeneinander versetzt<br />
sind, erzeugt Felder mit räumlichen Verspannungen,<br />
Lockerungen, Verdichtungen<br />
und dynamischen Wechseln. Die<br />
Verdrehungen der einzelnen „Bögen" –<br />
so schreibt Venet – folgen keiner mathematischen<br />
Regel, sind vielmehr Ergebnis<br />
von Zufall und spontanem Austarieren<br />
mit der Hand. In diesem <strong>St</strong>adium des Entstehungsprozesses<br />
wird die Kongruenz<br />
von Bezeichnung und Objekt aufgelöst.<br />
Die Ensembles von Spannungslinien im<br />
Raum entziehen sich der direkten Beschreibbarkeit,<br />
lassen sich nicht auf eine<br />
eindimensionale Konstruktionsanweisung<br />
zurückführen. Zum einen erzeugen sie<br />
mit ihren ,rhythmisiert’ gegeneinander<br />
verschobenen Elementen für den sich im<br />
Raum bewegenden Betrachter den Eindruck<br />
einer Abfolge von Materie und<br />
Transparenz. Zum anderen führen sie in<br />
den Zusammenhang des ,Konzeptuellen’<br />
wieder die Handschrift des Künstlers ein,<br />
der scheinbar überpersönliche Kürzel<br />
nutzt, um sein persönliches Augenmaß zu<br />
materialisieren.<br />
Mit seinen Ensembles gegeneinander versetzter<br />
Bögen als Versuchsanordnungen<br />
untersucht Venet das Thema bildhauerischer<br />
Proportion und die Verbindung<br />
von Urgeometrie und künstlerischer<br />
Individualität. So erobert sich der Künstler<br />
die genormte Geometrie, überführt<br />
die funktional wirkenden Maßangaben<br />
in autarke Raumwelten, die nur ihren<br />
eigenen Gesetzen unterworfen sind.<br />
Eine Vervielfältigung erfährt dieses Prinzip<br />
der ‚Versetzung’ bei den an Plätze erinnernden<br />
Plastiken. Hier erscheinen Bündel<br />
gegeneinander verdrehter Bögen, die<br />
wiederum gegeneinander verdreht sind.<br />
Venet interpretiert mit diesen ,Versammlungen’<br />
einen von Alberto Giacometti<br />
entwickelten Gedanken neu: Benutzte<br />
Giacometti „Plätze“, um in surrealistischer<br />
Manier Verweise auf menschliche<br />
Grundgrößen wie Geschlecht oder Sinnesorgane<br />
zu kombinieren, so überlässt<br />
es Venet vollständig dem Betrachter, Proportionen<br />
und Positionen mit Bedeutungen<br />
zu versehen und die Kluft zwischen<br />
geometrischem Konzept und lebendiger<br />
Plastik zu ergründen. Die Platz-Plastiken<br />
zeigen vielfach eine wie organisch gewachsen<br />
wirkende ,Architektur', sind,<br />
wie die einzelnen aus „Arcs“ gebildeten<br />
Figuren, dem Zufall verpflichtet.<br />
Diese Grundgröße seines bildhauerischen<br />
Werks bringt Venet auch wortwörtlich<br />
zur Anschauung: Mehrfach schafft er<br />
Plastiken, die wie auseinander gefallene<br />
Bündel von Mikado-<strong>St</strong>äben wirken, also<br />
an das Spiel erinnern, das eine kalkulierte,<br />
sorgsame Auseinandersetzung mit dem<br />
Zufall erfordert.<br />
Die Maxime des Unberechenbaren bestimmt<br />
vollständig die Werkreihe der<br />
"Indeterminate Lines". Die unregelmäßigen<br />
,Linien’ zeigen Brüche, Verwerfungen,<br />
Verknotungen, lassen sich nur mühsam<br />
optisch ,entflechten’, bilden gerade bei<br />
den Raum füllenden Installationen ineinander<br />
verhakte stählerne Knäuel, die jede klare<br />
Raumordnung unterlaufen. Die „Indeterminate<br />
Lines“ betonen durch ihre vitale<br />
Unregelmäßigkeit den Materialcharakter<br />
der Arbeiten. So erscheinen etwa die aus<br />
,unbestimmten Linien’ aufgebauten Spiralen<br />
weniger als Zeichen für Unendlichkeit<br />
denn als lebende Substanz, mit der der<br />
Künstler, so Venet, „kämpft".<br />
Die sich jedem geometrischen Raster widersetzenden<br />
Plastiken erzählen von ihrer<br />
Entstehung. Venet passt sie jeweils den<br />
verschiedenen Raumsituationen an,<br />
behandelt sie als flexibles, organisches<br />
System, das, so der Künstler in einem<br />
Eigenkommentar, die „Energie atomischer<br />
Massen“ verkörpert.<br />
Die Zeichnungen Venets greifen diese<br />
Prinzipien unmittelbar auf. Sie bestehen<br />
aus Kraftlinien, die sich zu Objekten verdichten,<br />
dynamische Verläufe bilden,<br />
Verwischungen zeigen. So konservieren<br />
sie, wie die “Indeterminate Lines“ Spuren<br />
des Entstehungsprozesses, betonen<br />
durch den fleckigen, durchgearbeiteten<br />
Grund ihren Charakter als Materie.<br />
In seinem Œuvre greift Bernar Venet auf<br />
genormte Elemente zurück, um sie<br />
schrittweise zu verlebendigen, benutzt er<br />
das präzise Berechnete als Ausgangspunkt<br />
für das Unkalkulierbare. Damit<br />
schreibt er der Kunst die Rolle zu, die<br />
Welt der Normen zu durchbrechen und<br />
standardisierten Elementen eine Identität<br />
zu verleihen. Aus Ansätzen der Concept<br />
Art entwickelt Venet eine Kunst, die dem<br />
Leben des Materials entstammt.<br />
Bernar Venet erzeugt offene Systeme,<br />
flexible Verbünde, die den Umraum einbeziehen.<br />
Die „Arcs“ beispielsweise sind<br />
offen, sie strahlen in den Raum. Der Betrachter<br />
ist versucht, sie optisch zum Vollkreis<br />
zu ergänzen, die Lücke mit Imagination<br />
zu füllen. Venets Skulpturen ziehen<br />
den Betrachter in ihr Kraftfeld, entwickeln<br />
Energie, indem sie die Leere nutzen.<br />
Diese kreative Paradoxie tritt neben<br />
den Gegensatz von berechnet und ,unbestimmt’,<br />
der seit den frühen Jahren das<br />
CEuvre charakterisiert. Vielleicht erklären<br />
gerade diese Oppositionen den Bann der<br />
Werke von Bernar Venet.<br />
36
Zeichnungen<br />
Kohle auf Papier<br />
Museum Küppersmühle<br />
für Moderne Kunst<br />
Duisburg, 2007<br />
37
Accident<br />
Performance<br />
Museum Küppersmühle<br />
für Moderne Kunst<br />
Duisburg, 2007<br />
38
Seite 30/31<br />
Arcs<br />
Installation im Arsenale Novisssimo<br />
während der Biennale Venedig<br />
2009<br />
Bernar Venet<br />
42
Bernard Venet<br />
1941<br />
Geboren am 20. April in Château-Arnoux,<br />
Haute-Provence, Frankreich<br />
1979<br />
<strong>St</strong>ipendium des „National Endowment of the<br />
Arts“, Washington, DC<br />
1958<br />
<strong>St</strong>udium an der Ècole Municipale d’Art de la<br />
ville de Nice, Villa Thiole<br />
1959<br />
Bühnenbildner an der Opéra de Nice<br />
1964<br />
Teilnahme am „Salon comparaison“,<br />
Museum der Modernen Kunst, Paris<br />
1966<br />
Kreiert ein Ballett, „Graduation“, das auf einer<br />
vertikalen Ebene getanzt wird.<br />
Es entstehen neue Werke, die auf dem<br />
Gebrauch von mathematischen Diagrammen<br />
basieren.<br />
1971<br />
Bernar Venet beschließt, seine künstlerische<br />
Tätigkeit einzustellen und konzentriert sich<br />
auf kunsttheoretische Fragen.<br />
1974<br />
Unterrichtet “Kunst und Kunsttheorie”<br />
an der Sorbonne, Paris<br />
Vertritt Frankreich bei der XIII. São Paulo<br />
Biennale, Brasilien<br />
1976<br />
Beginnt wieder, künstlerische Werke zu<br />
schaffen<br />
1984<br />
Seine Skulpturen werden im Atelier Marioni<br />
angefertigt, einer Gießerei in den Vogesen,<br />
Frankreich.<br />
1988<br />
Jean-Louis Martinoty beauftragt Bernar Venet<br />
das Ballet „Graduation“ (konzipiert 1966) an<br />
der Opéra in Paris zu inszenieren. Der Künstler<br />
ist verantwortlich für Musik, Choreographie,<br />
Bühnenbild und Kostüme.<br />
„Design Award“ für seine Skulptur vor dem<br />
World Trade Center in Norfolk, Virginia<br />
1989<br />
„Grand Prix des Arts de la Ville de Paris“<br />
1991<br />
Kreiert mehrere musikalische Kompositionen<br />
u.a. „Sound and Resonance“ im <strong>St</strong>udio<br />
Miraval, Var, Frankreich<br />
Veröffentlichung von zwei CDs bei Circé-Paris,<br />
Gravier/Goudron, 1963, und Acier roulé E 24-2,<br />
1990<br />
1993<br />
Teilnahme am „Festival du film d’Artiste“<br />
in Montreal, Canada mit seinen Film „Rolled<br />
<strong>St</strong>eel XC-10“<br />
Retrospektive im Musée d’Art Contemporain<br />
de Nice und im Wilhelm Hack Museum, Ludwigshafen<br />
1977<br />
Teilnahme an der documenta VI, Kassel<br />
1978<br />
Teilnahme an der Ausstellung „From nature to<br />
Art. From Art toNature“ bei der Biennale von<br />
Venedig, Italien<br />
1994<br />
Jacques Chirac lädt Venet ein, zwölf seiner<br />
Skulpturen der Serie „Indeterminate Line“ auf<br />
dem Champ de Mars auszustellen. Diese Ausstellung<br />
ist der Beginn einer Welttournee seiner<br />
Skulpturen.<br />
43
1996<br />
Verleihung des Ordens „Commandeur dans<br />
l’ordre des Arts et Lettres” des Kulturministeriums<br />
von Frankreich. Präsentation des Films<br />
Lines, unter der Regie von Thierry Spitzer, der<br />
das gesamte Oeuvre des Künstlers behandelt.<br />
Ausstellung von 10 Skulpturen in Brüssel und<br />
im Rheingarten, Köln<br />
1997<br />
Zieht in ein <strong>St</strong>udio in Chelsea, New York City.<br />
Beginnt eine neue Serie von Skulpturen, „Arcs<br />
x 4 und Arcs x 5“<br />
Mitglied der Europäischen Akademie der<br />
Wissenschaften und Künste, Salzburg, Österreich<br />
1998<br />
Reise nach China. Einladung durch den Bürgermeister<br />
von Shanghaizur Teilnahme am<br />
„Shanghai International Sculpture Symposium“<br />
teilzunehmen<br />
1999<br />
Errichtung der Skulptur „4 Arcs de 235,5“<br />
in Köln, anlässlich des G-8 Gipfels<br />
Veröffentlicht die dritte Version des Films “Tarmacadam“<br />
(von 1963) bei Arkadin Productions.<br />
Ausstellung im „Musée d’Art Moderne et<br />
Contemporain“ in Genf<br />
Veröffentlicht ein Sammelwerk seiner Gedichte,<br />
„Apoétiques“ 1967-1998<br />
2000<br />
Ausstellung der Wandgemälde „Major Equations“:<br />
Kunstmuseum Rio de Janeiro; Saõ Paulo,<br />
Brasilien; Centre d‘Art Contemporain<br />
Georges Pompidou in Cajarc, Frankreich,<br />
und im MAMCO in Genf.<br />
Publikationen: „Bernar Venet 1961-1970“,<br />
Monographie über den jungen Künstler von<br />
Robert Morgan; „Sursaturation“, Aufsätze über<br />
die Möglichkeiten in der Literatur; „Bernar<br />
Venet: Sculptures & Reliefs“, von Arnauld Pierre;<br />
„La Conversion du regard“, mit Texten und<br />
Interviews von 1975-2000; „Global Diagonals“.<br />
2001, Katalog zu einem Projekt mit geraden<br />
Linien von 100 m Länge, die die 5 Kontinente<br />
virtuell verbinden.<br />
2001<br />
Begleitend zu den Ausstellungen in der <strong>Galerie</strong><br />
Rabouan Moussion und dem SMART (Salon<br />
du mobilier et de l'objet design), beide in Paris<br />
veröffentlicht Éditions Assouline „Furniture“,<br />
mit einem Text von Claude Lorent<br />
Dichterlesung mit Robert Morgan in der<br />
White Box in New York<br />
Einweihung der Kapelle Saint-Jean in seinem<br />
Geburtsort Château-Arnoux. Die Kirchenfenster<br />
sowie die Möbel wurden von Bernar<br />
Venet entworfen.<br />
<strong>Galerie</strong> Jérôme de Noirmont in Paris stellt die<br />
neue Serie von „Equation“-Gemälden aus<br />
2002<br />
Ein Performance Abend im Centre Georges<br />
Pompidou, Paris, Frankreich baut Gedichte,<br />
Film und Musik des Künstlers mit ein.<br />
<strong>St</strong>ellt „Indeterminate Line“ Skulpturen in der<br />
<strong>Galerie</strong> Academia in Salzburg, Österreich, und<br />
in der Robert Miller Gallery in New York aus.<br />
<strong>St</strong>ellt seine Serie der Wandgemälde im Ludwig<br />
Museum, Koblenz, Deutschland aus.<br />
Monographie von Thomas McEvilley über das<br />
Gesamtwerk des Künstlers - auf Französisch<br />
und Deutsch, und ein Jahr später auch auf<br />
Englisch.<br />
<strong>St</strong>ellt „Equation“ und „Saturation“ Gemälde<br />
bei Anthony Grant, Inc., New York aus.<br />
Wanderausstellung der Skulpturen erreicht die<br />
Vereinigten <strong>St</strong>aaten. Der Fields Sculpture Park<br />
des Omi International Art Center in New York<br />
<strong>St</strong>ate zeigt eine Ausstellung mit zwölf Skulpturen<br />
des Künstlers, welche sich mit dem Thema<br />
„Linie“ beschäftigen. Die Ausstellung wird im<br />
November in das Atlantic Center for the Arts<br />
in Florida gezeigt.<br />
2003<br />
Siebzehn Einzelausstellungen, einschließlich<br />
einer Retrospektive seiner frühen Werke von<br />
1961-1963 im Hôtel des Arts, Toulon, Frankreich,<br />
und „Autoportrait“ im Musée d’Art<br />
moderne et d’Art contemporain (MAMAC) in<br />
Nizza, Frankreich<br />
<strong>St</strong>ellt „Saturation“ Gemälde in Frankreich,<br />
Kalifornien und bei der Art Basel Miami aus<br />
Der Verlag L’Yeuse, Paris publiziert das<br />
erste Buch über die „Equation“ Gemälde, von<br />
Donald Kuspit<br />
Wanderausstellung der Skulpturen erreicht<br />
Europa: Nizza, Frankreich; <strong>St</strong>adt Luxembourg;<br />
Bad Homburg; Schloss Herberstein, Österreich;<br />
Jardin des Tuileries, Paris<br />
2004<br />
Einzelausstellungen in New York City, u.a.<br />
Robert Miller Gallery sowie von drei großen<br />
Skulpturen auf der Park Avenue<br />
Veröffentlichung von „Art: A Matter of<br />
Context“, ein Buch über die Schriften des<br />
Künstlers und seine Interviews aus den Jahren<br />
1975-2003<br />
Wanderausstellung der Skulpturen erreicht<br />
Lüttich, Belgien; Miami, Florida; Denver,<br />
Colorado<br />
Ein Jahr wichtiger Ankäufe durch die Sammlung<br />
Bosch in <strong>St</strong>uttgart, Deutschland;<br />
AGF, Paris, Frankreich und das Colorado Convention<br />
Center, in Denver.<br />
Retrospektive der „Arcs“ ausgestellt im Musée<br />
Sainte-Croix in Poitiers, Frankreich.<br />
2005<br />
Am 1. Januar wird der Künstler mit dem Titel<br />
„Chevalier de la Légion d’honneur” geehrt,<br />
die höchste Ehrung Frankreichs<br />
Seine Skulpturen bereisen weiterhin Europa<br />
und Nordamerika, mit Ausstellungen in<br />
Boulogne-Billancourt und Cergy-Pontoise in<br />
Frankreich; in der <strong>Galerie</strong> Guy Pieters Knokkele<br />
Zoute, Belgien; der Evo Gallery in New<br />
Mexico; und der Carrie Secrist in Chicago,<br />
Illinois<br />
44
2006<br />
Erhält den „Robert Jacobsen Preis“ für Skulpturen<br />
von der Würth <strong>St</strong>iftung in Deutschland.<br />
Von der Jury des Kulturministeriums in Paris<br />
beauftragt, die Decke des „Palais Cambon“,<br />
des Rechnungshofes in Paris, zu bemalen<br />
2007<br />
Einweihung des Deckengemäldes „Saturation“<br />
im „Palais Cambon“ in Paris durch den Präsidenten<br />
Jacques Chirac.<br />
Drei retrospektive Ausstellungen: im National<br />
Museum of Contemporary Art, Seoul, Südkorea;<br />
im Busan Museum of Modern Art in<br />
Busan, Südkorea; und im Museum Küppersmühle<br />
in Duisburg.<br />
Ausstellung der Skulpturen in Bordeaux und<br />
Metz<br />
Einweihung einer Skluptur von der 25 m<br />
„2 Arcs de 135.5° et 100.5°“, Metro in<br />
Toulouse<br />
2008<br />
Sotheby's lädt zum ersten Mal nur einen<br />
Künstler – Bernar Venet – ein, sein Werk im<br />
Isleworth Country Club zu zeigen.<br />
Von Januar bis April 2008 zeigen etwa 25<br />
monumentale Skulpturen die Arbeit der letzten<br />
zwei Jahrzehnte<br />
Die <strong>St</strong>adt San Diego zeigt im Herbst ein<br />
Dutzend seiner Skulpturen in Kalifornien<br />
2009<br />
L'Espace de l'Art Concret in Mouans-Sartoux<br />
zeigt die erste öffentliche Ausstellung mit<br />
Werken der Venet Family Collection.<br />
Das „Arsenale Novissimo“ stellt ihm 1200 m 2<br />
auf der 53. Biennale von Venedig zur Verfügung,<br />
um vier neue monumentale Skulpturen<br />
auszustellen.<br />
Eine Übersicht seiner Gemälde und Skulpturen<br />
wird in der Kunsthalle Darmstadt gezeigt,<br />
anschließend im Palais des Beaux Arts (BOZAR)<br />
in Brüssel, ergänzt durch eine Ausstellung<br />
neuer „Shaped Canvases" in der <strong>Galerie</strong> Guy<br />
Pieters in Knokke-Heist, Belgien.<br />
2010<br />
Das IVAM in Valencia zeigt eine Retrospektive<br />
der konzeptionellen Werke Venets sowie<br />
einen Gesamtüberblick all seiner Gemälde,<br />
kuratiert von Barbara Rose.<br />
Die texanisch-französische Allianz der Künste<br />
und die McClain Gallery lassen zehn große<br />
Skulpturen von Venet im Hermann Park aufstellen<br />
Anlässlich des 150. Jubiläums der Zugehörigkeit<br />
der <strong>St</strong>adt Nizza zu Frankreich weiht<br />
Nicolas Sarkozy eine monumentale Skulptur<br />
auf der Promenade des Anglais ein.<br />
Zwei Ankäufe in Seoul, Korea für Dongkuk<br />
<strong>St</strong>eel Mill und Hannam The Hill<br />
2011<br />
Retrospektive der Gemälde im Seoul Museum<br />
of Art, Südkorea<br />
Große Einzelausstellung im Château de Versailles,<br />
und eine weitere im Château de Marly<br />
in Frankreich<br />
Biennale sowie Ausstellung im Musée des Beaux-Arts,<br />
<strong>St</strong>adt Valenciennes, Frankreich<br />
Ankauf einer Skulptur (Deux arcs à 5) für das<br />
Ludwig Museum, Koblenz, durch die Sparda-<br />
Bank Südwest eG, die Kulturstiftung der Länder<br />
sowie die Peter und Irene Ludwig <strong>St</strong>iftung<br />
Wanderausstellung der Skulpturen wird in<br />
Frankfurt, Deutschland sowie der Poppy &<br />
Pierre Salinger <strong>St</strong>iftung in Frankreich gezeigt<br />
Bernar Venet<br />
45
Museumskontakte<br />
Ludwig Museum im Deutschherrenhaus<br />
Danziger Freiheit 1<br />
56068 Koblenz<br />
Tel.: 0261- 304040<br />
Fax: 0261-3040413<br />
www.ludwigmuseum.org<br />
mail: info@ludwigmuseum.org<br />
Lage:<br />
Unmittelbar am Deutschen Eck,<br />
am Zusammenfluss von Rhein und Mosel<br />
Nähe der Altstadt<br />
Vom Bahnhof aus mit der Buslinie 1 erreichbar<br />
A 3, Autobahndreieck Dernbach,<br />
Richtung Trier auf der A 48:<br />
Abfahrt Koblenz Nord / Richtung Deutsches Eck<br />
A 61 Abfahrt: Waldesch<br />
Richtung Koblenz Innenstadt / Deutsches Eck<br />
Öffnungszeiten<br />
Während der BUGA 2011<br />
Sonntag – Samstag 9:00 – 18:00 Uhr<br />
ab dem 30.10.2011:<br />
Dienstag – Samstag 10:30 – 17:00 Uhr<br />
Sonn- und Feiertags 11:00 – 18:00 Uhr<br />
Führungen<br />
Mittwochs 16 Uhr<br />
Sonn- und Feiertags 15 Uhr<br />
Gruppen auf Anfrage und nach Voranmeldung,<br />
max. 25 Personen<br />
Programme für Schulklassen (nach Absprache<br />
mit der Museumspädagogik)<br />
Ausstellungsprogramm<br />
Das Ludwig Museum organisiert zahlreiche<br />
Wechselausstellungen zu aktuellen Themen<br />
der Kunst. Dabei stehen sowohl monographische<br />
Ausstellungen im Vordergrund, die sich<br />
im weitesten Sinne mit der Sammlung Ludwig<br />
vornehmlich französischen Künstlern im<br />
Koblenzer Ludwig Museum verbinden als auch<br />
auf den internationalen Kontext der Ludwig<br />
<strong>St</strong>iftung in Aachen. Weitreichende Kontakte in<br />
Europa, den USA, Südamerika, Russland, den<br />
Vereinigten Emiraten und China vergrößern<br />
das Spektrum der Ausstellungen und der<br />
damit verknüpften Aktivitäten des Ludwig<br />
Museums. Darüber hinaus entwickeln sich<br />
Konzepte mit jungen Künstlern, denen das<br />
Ludwig Museum ebenfalls einmal pro Jahr ein<br />
eigenes Forum bietet.<br />
Museumspädagogik<br />
Die Museumspädagogische Abteilung unter<br />
der Leitung von Ute Hofmann-Gill bietet ein<br />
jeweils auf die wechselnden Ausstellungen abgestimmtes<br />
Programm an, das sich nicht nur<br />
an Kinder und Jugendliche, sondern auch an<br />
Erwachsene richtet. Ein wesentlicher Aspekt<br />
der pädagogischen Arbeit im Ludwig Museum<br />
besteht darin, nicht nur theoretisches Wissen<br />
über Kunst und Künstler zu vermitteln, sondern<br />
auch zu eigener kreativer Auseinandersetzung<br />
mit der Kunst anzuregen. Dementsprechend<br />
stehen Rallyes, Workshops, Gestaltungskurse,<br />
Diskussionsrunden und natürlich<br />
auch traditionelle Ausstellungs-Führungen auf<br />
dem Programm. Einbezogen sind auch die<br />
Grenzüberschreitungen von Kunst und Musik<br />
(mit ausgewiesenen Pädagogen der Musik),<br />
Tanz und Kunst sowie Kunst und Literatur.<br />
Die schulspezifischen Angebote sind am<br />
aktuellen Lehrplan des Faches Bildende Kunst<br />
orientiert.<br />
Anmeldungen bei Ute Hofmann-Gill:<br />
0261-3040415 oder 3040412.<br />
Freunde des Mittelrhein Museums<br />
und des Ludwig Museums, e.V.<br />
Werden Sie aktiv im Koblenzer Kulturleben!<br />
Der Verein der Freunde bietet das entsprechende<br />
Forum, um Kunst, Kultur- und <strong>St</strong>adtgeschichte<br />
spannend zu erleben. Durch<br />
seine mehr als 350 Mitglieder unterstützt der<br />
Verein der Freunde die beiden städtischen<br />
Museen Koblenz, das Mittelrhein-Museum<br />
und das Ludwig Museum im Deutschherrenhaus,<br />
das sich der Gegenwartskunst Frankreichs<br />
verpflichtet. Mitglieder haben freien<br />
Eintritt zu allen Ausstellungen und werden<br />
über das überaus interessante und vielfältige<br />
Programm beider Museen gezielt informiert.<br />
Reisen zu anderen Ausstellungszielen sowie<br />
zahlreichen Sonderaktivitäten bereichern das<br />
Spektrum der Möglichkeiten und die Attraktiviät<br />
des Vereins.<br />
46
Das Ludwig Museum am Deutschen Eck in Koblenz<br />
47
Impressum<br />
Herausgeber: Jo Enzweiler<br />
Sparda-Bank Südwest eG<br />
Redaktion<br />
Babette Kuhn, Beate Reifenscheid<br />
Englische Übersetzung:<br />
Sofia zu Sayn-Wittgenstein.Sayn<br />
Sekretariat Ludwig Museum:<br />
Monique Franke<br />
Bildnachweis:<br />
Axel Ronnisch S. 6, 8, 9<br />
Museum Ludwig Koblenz S. 14<br />
Koblenz-Touristik S. 47<br />
Alle übrigen Abbildungen<br />
Atelier Bernar Venet, New York<br />
und Le Muy<br />
© Künstler, Autoren,<br />
Ludwig Museum Koblenz<br />
VG Bild-Kunst, Bonn 2011<br />
Auflage: 1.200<br />
Druck: Krüger Druck+Verlag GmbH,<br />
Dillingen<br />
Verlag: <strong>St</strong>. <strong>Johann</strong>, Saarbrücken<br />
ISBN: 3-938070-56-0<br />
Saarbrücken 2011<br />
Verlag <strong>St</strong>. <strong>Johann</strong><br />
Beethovenstraße 31<br />
66111 Saarbrücken<br />
Fon: (0681) 33473<br />
Fax: (0681) 30547<br />
www.galerie-st-johann.de