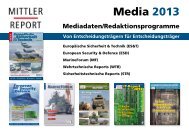Umschau - Europäische Sicherheit & Technik
Umschau - Europäische Sicherheit & Technik
Umschau - Europäische Sicherheit & Technik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Inhalt<br />
Seite 42 Seite 90<br />
Führungsunterstützungskommando<br />
Das neue Fähigkeitskommando der Streitkräftebasis<br />
wurde zum Jahresbeginn aufgestellt.<br />
<br />
SICHERHEIT & POLITIK<br />
10 Dialog über Grenzen hinweg<br />
Henning Bartels<br />
ES&T Spezial:<br />
Münchner <strong>Sicherheit</strong>skonferenz<br />
2013<br />
11 „Europäer und Amerikaner können sich<br />
aufeinander verlassen“<br />
Thomas de Maizière<br />
14 Die Euro-Krise und die Zukunft der EU<br />
Tatjana Vogt<br />
15 Die amerikanische Öl- und Gas-Bonanza<br />
Angelika Schweiger<br />
16 Abenddiskussion zu Syrien<br />
Katarina Hanusova und Christoph Schwarz<br />
19 „Europa ist der Eckpfeiler unseres<br />
internationalen Engagements“<br />
Joseph R. Biden<br />
23 „Schulterklopfen und Komplimente allein<br />
reichen nicht“<br />
Katarina Hanusova und Christoph Schwarz<br />
25 Reform statt Revolution<br />
Angelika Schweiger und Daniel Furth<br />
25 <strong>Sicherheit</strong> im Cyber-Raum<br />
Christine Hegenbart<br />
26 Versöhnung, Wandel und Zusammenarbeit<br />
Katarina Hanusova<br />
26 Teilen fällt schwer<br />
Daniel Furth<br />
27 Responsibility to Protect (R2P) – Die neue<br />
Norm der Schutzverantwortung<br />
Tatjana Vogt<br />
28 Brent Scowcroft erhält Ewald-von-Kleist-Preis<br />
Daniel Furth<br />
29 Depeschen auf 140 Zeichen? Wie Twitter die<br />
Diplomatie verändert<br />
Angelika Schweiger<br />
Scharfschützen<br />
Sichere Treffer auf weite Distanz sind eine Frage der Ausrüstung<br />
wie auch der Einsatzkonzepte und der Ausbildung.<br />
30 Ehud Barak offen für kritische Fragen<br />
Angelika Schweiger und Tatjana Vogt<br />
31 Hohe Hürden für Verhandlungsfortschritte<br />
Katarina Hanusova und Christoph Schwarz<br />
32 Angst vor dem brodelnden Vulkan<br />
Daniel Furth und Christine Hegenbart<br />
33 Dialog mit Paukenschlag<br />
Ernst Hebeker<br />
35 Eine Konferenz mit vielen wichtigen Themen<br />
Rolf Clement<br />
<br />
BUNDESWEHR & STREITKRÄFTE INTERNATIONAL<br />
38 Die Artillerie des neuen Heeres<br />
Dietmar Klos<br />
42 Das Führungsunterstützungskommando der<br />
Bundeswehr<br />
Heinrich Steiner<br />
46 Das Zukunftsfeld „Flugkörperabwehr“<br />
Justus S. Kruse<br />
54 „Niemand kann in die Zukunft sehen. Daher<br />
muss man vorbereitet sein!“<br />
Interview mit Markus Gygax, Korpskommandant a.D.<br />
56 Korvetten kommen in Fahrt<br />
Dieter Stockfisch<br />
59 Die zukünftige Luft/Boden-Bewaffnung der<br />
Royal Air Force<br />
Dorothee Frank<br />
<br />
RÜSTUNG & TECHNOLOGIE<br />
60 Aufgaben und Einrichtungen der WTD 81<br />
Autorenteam WTD 81<br />
64 „Die Leistungsfähigkeit der Waffensysteme<br />
im Einsatz gewährleisten“<br />
Interview mit Rainer Krug, Direktor der WTD 81<br />
4 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · März 2013
Seite 111<br />
Seite 117<br />
Cyber-<strong>Sicherheit</strong><br />
Welchen Bedrohungen sind Unternehmen und Behörden<br />
ausgesetzt – und wie können sie sich schützen?<br />
Türkischer Sonderweg<br />
Die Außenpolitik in der Ära Erdogan nährt Zweifel an<br />
der Verlässlichkeit des NATO-Partners.<br />
66 Technologische Trends im Marineschiffbau<br />
Peter Hauschildt<br />
70 Geschützte Transportfahrzeuge<br />
Gerhard Heiming und Michael Horst<br />
76 RAM Block 2<br />
Frank Weise<br />
80 Aktiver Gehörschutz als Kampfkraftmultiplikator<br />
Jan-Phillipp Weisswange<br />
82 Renaissance der Marinegeschütze<br />
Dieter Stockfisch<br />
90 Wirkung auf größere Distanzen<br />
Jan-Phillipp Weisswange<br />
<br />
WIRTSCHAFT & INDUSTRIE<br />
98 Der Markt für OPV und kleine Kampfschiffe<br />
Ted Hooton<br />
106 „SVFuA auf der Zielgeraden zur Serie“<br />
Interview mit Manfred Fleischmann, Vorsitzender der<br />
Geschäftsführung der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG<br />
<br />
ÄUSSERE & ZIVILE SICHERHEIT<br />
111 Bedrohungen aus dem Internet<br />
Risiken und Schutzmaßnahmen für Unternehmen<br />
und Behörden<br />
Marko Rogge<br />
115 Stromausfall durch virenverseuchte Kontrollsysteme<br />
Dorothee Frank<br />
117 Das „System Erdogan“ und seine Außenpolitik<br />
Walter Schilling<br />
120 Bundeswehr und Innere <strong>Sicherheit</strong> – die endlose<br />
Geschichte<br />
Bernd Walter<br />
123 Entscheidungen in Lateinamerika<br />
Ingo Ossendorff<br />
<br />
RUBRIKEN<br />
3 Kommentar<br />
6 <strong>Umschau</strong><br />
34 Impressum<br />
37 Berliner Prisma<br />
52 Interessengemeinschaft Deutsche Luftwaffe e.V.<br />
86 Informationen – Nachrichten – Neuigkeiten aus aller Welt<br />
94 IT News & Trends<br />
95 Typenblatt<br />
97 Fraunhofer INT: Neue Technologien<br />
104 Blick nach Amerika<br />
108 Unternehmen & Personen<br />
110 Nachrichten aus Brüssel<br />
126 Gesellschaft für Wehr- und <strong>Sicherheit</strong>spolitik<br />
128 Bücher<br />
130 Gastkommentar<br />
„Seit einiger Zeit gibt es ein großes Interesse an einem umfassenden<br />
transatlantischen Handels- und Investitionsabkommen. Es ist nicht<br />
so, dass nie jemand auf die Idee gekommen wäre, vielmehr gab es<br />
immer wieder Probleme wie Verordnungen und Standards, die uns<br />
trennten. Die Frage lautet jetzt, ob der politische Wille vorhanden<br />
ist, diese langjährigen Meinungsverschiedenheiten auszuräumen.<br />
Und wenn ja, dann sollten wir eine transatlantische Partnerschaft<br />
anstreben“<br />
Joseph R. Biden: Europa ist der Eckpfeiler unseres internationalen<br />
Engagements, Seite 19
Kommentar<br />
Nordkorea provoziert die Welt<br />
Mit dem neuen Atomtest provoziert der neue<br />
Machthaber in Nordkorea, Kim Jong-un, die<br />
Welt. Es ist der dritte Atomtest nach 2006 und<br />
2009, die unter dem Vater Kim Il-sung stattfanden.<br />
Und es ist die dritte Provokation unter dem<br />
neuen Diktator innerhalb eines Jahres, nachdem<br />
bereits im April und Dezember letzen Jahres<br />
zwei Langstreckenraketen getestet wurden. Kim<br />
Jong-un provoziert damit bewusst den Nachbarn<br />
in Seoul und die USA, aber natürlich auch alle<br />
anderen Staaten. Wer nun glaubt, dass diese<br />
Provokationen unberechenbar erfolgen, verkennt<br />
die nordkoreanische Politik. Der neue Atomtest<br />
kam mit Ankündigung, denn die Propaganda-Attacken<br />
aus Pjöngjang gegenüber den USA in den<br />
letzen Wochen waren unüberhörbar, nachdem<br />
US-Präsident Barack Obama die stärkere Hinwendung<br />
der amerikanischen Politik in den asiatischpazifischen<br />
Raum angekündigt hatte. Auch der<br />
Amtsantritt der neuen Präsidentin Südkoreas,<br />
Park Geun Hye, bot eine passende und günstige<br />
Gelegenheit, den verhassten Nachbarn im Süden<br />
herauszufordern und zu ärgern.<br />
Kim Jong-un demonstriert damit im eigenen<br />
Lande, dass er die Macht in allen Bereichen<br />
übernommen hat, auch in der Atomrüstung.<br />
Seine Art gleicht damit der provozierenden Art<br />
seines Vaters und seines Großvaters. Doch auf<br />
diese Weise hatten die nordkoreanischen Diktatoren<br />
es immer wieder geschafft, aus einer Position<br />
der Stärke heraus, den USA Wirtschaftsund<br />
Nahrungsmittelhilfe abzuringen. Denn<br />
die nordkoreanische Bevölkerung leidet seit<br />
Jahrzehnten massiv unter der Diktatur des Kim-<br />
Klans. Das alles konnten sich die Machthaber in<br />
Nordkorea immer nur erlauben, weil sie sich der<br />
Unterstützung Chinas sicher waren. Nach jeder<br />
neuen Provokation lief alles immer nach dem<br />
gleiche Schema ab. Die Aktionen Nordkoreas<br />
wurden vom UN-<strong>Sicherheit</strong>srat gerügt und nach<br />
zögerlicher Zustimmung Chinas auch in UN-<br />
Resolutionen mit immer neuen und schärferen<br />
Sanktionen verurteilt. Stillschweigend wurde<br />
dann von China die Versorgung Nordkoreas<br />
gesichert und auch die Waffengeschäfte geduldet.<br />
Damit liefen die Sanktionen stets ins Leere.<br />
90 Prozent der nordkoreanischen Öleinfuhren<br />
laufen über China. Nordkorea erhielt vor allem<br />
Erdöl und Nahrungsmittel, China Erze und Kohle.<br />
Peking wollte vor allem verhindern, dass es<br />
zu Unruhen oder gar einem Kollaps des Regimes<br />
aufgrund wirtschaftlicher Not kommen könnte<br />
und dies Flüchtlinsströme an seiner Nordostgrenze<br />
auslösen könnte.<br />
Doch nach dem neuesten Atomtest hat sich die<br />
gesamte Situation wohl zum Nachteil Nordkoreas<br />
verändert. Im UN-<strong>Sicherheit</strong>srat stimmte<br />
China überraschend schnell einer Verurteilung<br />
zu, die USA sicherten Südkorea die volle Unterstützung<br />
zu, auch des US-Nuklearschutzes,<br />
und versprachen, Seoul bei der Verstärkung<br />
seines Raketenabwehrschirms zu unterstützen.<br />
In China selber wächst die Kritik und auch<br />
Ungeduld, da die Regierung offensichtlich zu<br />
nachsichtig mit den Machthabern in Nordkorea<br />
umgeht. Chinas Außenministerium hatte<br />
den neuen Atomtest „entschieden verurteilt“,<br />
rief aber alle Staaten auf, „einen kühlen Kopf<br />
zu bewahren und auf dem Verhandlungsweg<br />
nach Lösungen zu suchen“, ohne aber wie<br />
sonst üblich den Zusatz zu machen, „Peking<br />
wird sich dafür einsetzen“.<br />
Gerade auch der neue Atomtest hat eine neue<br />
Qualität, da es Nordkorea wohl gelungen ist,<br />
die Bombe bei gleich bleibender Sprengkraft<br />
zu verkleinern. Damit wäre die Voraussetzung<br />
für die Ausstattung einer Langstreckenrakete<br />
mit einer nuklearen Nutzlast gegeben. Damit<br />
würde es Nordkorea auch möglich sein, einige<br />
seiner mit konventioneller Munition ausgestatteten<br />
Raketenwerfer und Kurzstreckenraketen,<br />
die an der Grenze zu Südkorea stationiert sind,<br />
auszurüsten. Die Gefahr an der Grenze würde<br />
sich entscheidend erhöhen. Über eine weitere<br />
Gefahr muss in diesem Zusammenhang auch<br />
gesprochen werden. Nordkorea hat bisher eng<br />
mit dem Iran zusammengearbeitet. Inwieweit<br />
eine Weitergabe von Informationen oder gar<br />
der Verkauf von Materialien an den Iran zur<br />
Produktion einer Nuklearwaffe geschehen ist,<br />
bleibt offen.<br />
Nordkorea scheint jedoch den Ernst der Situation<br />
noch nicht erkannt zu haben, denn in<br />
einer schriftlichen Erklärung des nordkoreanischen<br />
Außenministeriums hieß es, dass man<br />
noch mehr Tests unternehmen werde, wenn<br />
die USA mit Strafaktionen auf den jüngsten<br />
Atomtest antworten sollten. Dieser sei eine<br />
„Selbstschutzmaßnahme“ gegen die USA, denn<br />
immerhin seien in Südkorea immer noch 25.000<br />
US-Soldaten stationiert, die man als Bedrohung<br />
betrachte. Die Führung in Pjöngjang scheint vor<br />
allem die USA zu testen, inwieweit sie bereit<br />
sind, militärisch oder politisch einzugreifen. Man<br />
will die USA und jetzt auch China zwingen, sich<br />
deutlich zu erklären und letztlich Nordkorea als<br />
Atomstaat zu akzeptieren.<br />
Henning Bartels<br />
März 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
3
<strong>Umschau</strong><br />
Musterzulassung<br />
Trakkabeam A800 für die<br />
EC135 ergänzt<br />
Die ESG Elektroniksystem- und Logistik-<br />
GmbH hat von der EASA ein STC (Ergänzung<br />
zur Musterzulassung) für die Integration<br />
des Trakkabeam A800 Suchscheinwerfer-Systems<br />
in den EC135-Hubschrauber<br />
erhalten. Das STC umfasst verschiedene<br />
Konfigurationen des Systems, um<br />
Kunden eine Auswahl zu geben, wie der<br />
Suchscheinwerfer eingebaut oder gesteuert<br />
werden soll. Das System kann vom Piloten<br />
oder Copiloten über ein Bediengerät in<br />
(Foto: ESG)<br />
der Mittelkonsole des Hubschraubers oder<br />
über 4-Wege-Schalter am Kollektiv-Hebel<br />
gesteuert werden. Falls in der Mittelkonsole<br />
kein Platz vorhanden ist oder die Bedienung<br />
durch ein Besatzungsmitglied in<br />
der Kabine erfolgen soll, kann auch ein<br />
Hand-Bediengerät verwendet werden.<br />
Das STC der ESG beinhaltet außerdem<br />
eine Laser Pointer-Option sowie Schnittstellen,<br />
um das Trakka-A800-System mit<br />
allen marktgängigen elektro-optischen<br />
Kamerasystemen zu koppeln. Den Mustereinbau<br />
und die Flugversuche führte die<br />
ESG gemeinsam mit der Polizeihubschrauberstaffel<br />
des Landes Brandenburg durch.<br />
Die ersten Auslieferungen unter dem neuen<br />
STC haben bereits im Dezember 2012<br />
begonnen.<br />
(wb)<br />
Sensorausstattungen für<br />
Waffenstationen<br />
Für die weitere Ausstattung der Bundeswehr<br />
mit Waffenstationen liefert Rheinmetall<br />
700 Lafetten-adaptierbare Zielsysteme<br />
(LAZ). Für leichte Waffenstationen ist<br />
G5 ist Kandidat für M113-Nachfolge in Dänemark<br />
Die dänische Beschaffungsbehörde (Danish Defence Acquisition and Logistics Organization,<br />
DALO) hat fünf Wettbewerbsfahrzeuge für den Ersatz der überalterten<br />
M113 ausgewählt. In einem interessanten Wettbewerb treten drei Ketten- und<br />
zwei Radfahrzeuge ab April 2013 zur technischen Erprobung an: Der CV90 Armadillo<br />
(BAE Systems Hägglunds), der geschützte Missionsmodulträger (Protected<br />
Mission Module Carrier, PMMC) G5 (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, FFG)<br />
und der ASCOD 2 (General Dynamics European Land Systems, GDELS) sowie die<br />
8x8-Radfahrzeuge VBCi (Nexter) und Mowag Piranha V (GDELS). Unter den Kettenfahrzeugen<br />
ist der PMMC G5 aus Flensburg die einzige Neukonstruktion. Mit maximal<br />
25 Tonnen Gesamtgewicht bietet er 14,5 m³ geschützten Innenraum, der mit<br />
austauschbaren Missionsmodulen optimal und schnell an verschiedene Aufgaben<br />
angepasst werden kann. Das moderne und kompakte MTU/ZF-Diesel-Powerpack<br />
mit 410 kW erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 72 km/h bei einer Reichweite<br />
von rund 600 km. Dänemark will im Zeitraum 2015 bis 2022 mindestens 206 und<br />
optional bis zu 450 M113 ersetzen. Die dänischen Streitkräfte verfügen über mehr<br />
als 700 M113, von denen FFG in den letzten 15 Jahren für rund 250 Fahrzeuge mit<br />
MTU/ZF-Antrieb und Diehl-Ketten die Lebensdauer verlängert hat. (gwh)<br />
das LAZ 200 vorgesehen, von denen 418<br />
Stück bestellt worden sind. 275 LAZ 400L<br />
dienen der Ausrüstung schwerer Waffenstationen.<br />
Die Sensoreinheiten stellen<br />
das zentrale Element der elektronischen<br />
Feuerleitung an den Waffenstationen dar<br />
und ermöglichen erst eine wirkungsvolle<br />
Zielerkennung, Zielverfolgung und -bekämpfung.<br />
Die kompakten LAZ 200/400L<br />
stellen jeweils eine Sensoreinheit dar, die<br />
aus einem Wärmebildgerät besteht, einer<br />
hochauflösenden CCD-Tagsichtkamera<br />
und – im Falle des Typs 400L – einem<br />
augensicheren Laser-Entfernungsmesser.<br />
Das LAZ 400L verfügt über ein gekühltes<br />
Wärmebildgerät mit gesteigerter Leistungsfähigkeit<br />
im Nachtsichtbereich. Bestandteil<br />
des Lieferumfangs sind auch entsprechende<br />
Bedien- und Anzeigegeräte,<br />
die eine weitere wesentliche Komponente<br />
des Gesamtsystems Waffenstation sind.<br />
LAZ Gerätesätze haben sich bisher schon<br />
bei der Bundeswehr auf zahlreichen Fahrzeugen<br />
wie Fuchs, Boxer, Yak oder Dingo<br />
im Einsatz bewährt.<br />
(gwh)<br />
Marineradar TRS-4D von<br />
Cassidian<br />
Die Fregatten der Klasse 125 der Deutschen<br />
Marine werden mit dem neu entwickelten<br />
Radar TRS-4D von Cassidian ausgerüstet<br />
(Foto: Rheinmetall)<br />
(Foto: FFG)<br />
(Grafik: Arge F125)<br />
und erhalten damit weltweit einzigartige<br />
Aufklärungs- und Überwachungsfähigkeiten.<br />
Das Radar ist schneller und präziser als<br />
konventionelle Radare und kann für ein<br />
breites Zielspektrum eingesetzt werden.<br />
Es nutzt die Vorteile von zahlreichen unabhängigen<br />
Strahlen auf Grundlage der<br />
ASEA-Technologie (Active Electronically<br />
Scanned Array). Das ergibt eine weltweit<br />
unübertroffene Detektionsleistung. Kernelement<br />
der ASEA-Technologie ist eine<br />
Vielzahl an Sende- und Empfangsmodulen<br />
von Cassidian, die auf der neuesten<br />
6 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · März 2013
Galliumnitrid-Technologie (GaN) basieren.<br />
Das neue Radarsystem wird in einer Variante<br />
mit vier feststehenden Antennenfeldern<br />
auf den Fregatten Klasse 125 zum<br />
Einsatz kommen. Die Lieferung des ersten<br />
TRS-4D für das Typschiff BADEN-WÜRT-<br />
TEMBERG der Fregatten Klasse 125 ist im<br />
August 2013 vorgesehen.<br />
(ds)<br />
(Foto: Rheinmetall)<br />
Ausbildung mit Zetros<br />
Die seit Ende 2012 zulaufenden Geschützten<br />
Transportfahrzeuge (GTF)<br />
Zetros werden ebenso wie ihre Besatzungen<br />
auf den Einsatz in Afghanistan<br />
(Foto: Bundeswehr)<br />
vorbereitet. Im Kraftfahrausbildungszentrum<br />
Mechernich lernen die Kraftfahrer<br />
die Leistungsfähigkeit der neuen<br />
Lastkraftwagen kennen. Die meisten von<br />
ihnen sitzen zum ersten Mal hinter einer<br />
Haube in einem Lkw und erfahren das<br />
sichere Gefühl einer geschützten Kabine,<br />
in der sie vor Beschuss mit Handwaffen,<br />
Artillerie-Splittern, Ansprengungen mit<br />
Minen und IED sowie vor Panzerabwehrgranaten<br />
geschützt sind. Durch die von<br />
der Beladung wenig beeinflusste gleich<br />
bleibende Lastverteilung und das Automatikgetriebe<br />
steht die hohe Zugkraft<br />
des 240 kW-Dieselmotors vor allem im<br />
Gelände ständig zur Verfügung. Pflege<br />
und Wartung vor und nach der Fahrt gestalten<br />
sich einfach, weil der Motorraum<br />
über die Fronthaube zugängig ist, ohne<br />
die Kabine zu kippen. Die Motorhaube<br />
kann für Scheibenreinigung und zur<br />
Montage der ferngesteuerten Waffenanlage<br />
(FLW) betreten werden. In wenigen<br />
Wochen werden die ersten Zetros nach<br />
Afghanistan verladen. Die Bundeswehr<br />
hat insgesamt 110 Zetros bestellt, die bis<br />
2014 ausgeliefert werden. (gwh)<br />
Kampfmittelaufklärung mit dem TPz Fuchs KAI<br />
Rheinmetall liefert der Bundeswehr ab November 2013 sieben Transportpanzer<br />
(TPz) Fuchs in der neuen Variante „Kampfmittelaufklärung und -identifizierung<br />
(KAI)“. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 37 Millionen Euro. Die Fahrzeuge<br />
ergänzen das „Route Clearance System“ der deutschen Streitkräfte zur Aufklärung<br />
und Beseitigung von Sprengfallen (Improvised Explosive Devices, IED) unter Panzerschutz,<br />
von dem erste Komponenten seit Ende 2012 in Afghanistan im Einsatz sind.<br />
Zunächst werden die TPz zur Version A8 mit dem bekannt hohen Minen- und<br />
IED-Schutz umgebaut. Optional lässt sich das aktive Abstandsschutzsystem Active<br />
Defence System (ADS) einrüsten. Für die Kampfmittelaufklärung und -identifizierung<br />
erhalten die TPz Fuchs einen mehrgliedrigen, hochpräzisen Manipulatorarm mit über<br />
zehn Meter Arbeitsreichweite und hoher Tragkraft. Dieser ermöglicht es den Kampfmittelabwehrkräften,<br />
aus dem TPz Fuchs KAI heraus verdächtige Stellen abstandsfähig<br />
zu untersuchen und Kampfmittel sowie Sprengfallen präzise aufzuklären und<br />
zu identifizieren. Mit einer an den Manipulatorarm adaptierbaren Rettungsplattform<br />
können im Bedarfsfall Personen und Material aus einem Gefahrenbereich evakuiert<br />
werden. Der TPz Fuchs KAI ergänzt den schweren Kampfmittelräumzug der Bundeswehr<br />
und soll Gefahrenstellen aufklären, die vom Route Clearance System nicht<br />
erreicht werden. Weiterhin soll der TPz Fuchs KAI ein vom Kampfmittelräumzug unabhängig<br />
operierendes Kampfmittelaufklärungssystem sein, das Konvoi-begleitend<br />
Gefahrenstellen („Hot-Spots“) aufklärt.<br />
(gwh)<br />
piert, das eine Vielzahl einsatzrelevanter<br />
Funktionen in einem handgehaltenen<br />
System vereint und für die anschließende<br />
Serienfertigung geeignet ist. Basis ist das<br />
optronische Aufklärungssystem NYXUS<br />
BIRD, das Jenoptik im Sommer letzten<br />
Jahres erfolgreich am Markt eingeführt<br />
hat und das bereits viele der geforderten<br />
Parameter erfolgreich vereint. Das NY-<br />
XUS BIRD ist bis dato das leichteste mul-<br />
(Foto: Jenoptik)<br />
Beobachtungssystem für<br />
U.S. Marine Corps<br />
Jenoptik entwickelt für das U.S. Marine<br />
Corps (USMC) für eine Million Euro ein<br />
Beobachtungssystem (Common Laser<br />
Range Finder Integrated Capability, CL-<br />
RF IC). In einem 19-monatigen Entwicklungs-<br />
und Erprobungsprozess gemeinsam<br />
mit dem USMC wird ein Beobachtungs-<br />
und Zielerfassungssystem konzitifunktionale<br />
Beobachtungsgerät, das<br />
Glasoptik, Wärmebildgerät, Entfernungsmesser,<br />
GPS und digitalen Kompass in<br />
einer äußerst kompakten Lösung zusammenführt.<br />
Zur Beobachtung bei Tag und<br />
Nacht steht dem Anwender neben dem<br />
rein optisch aufgebauten Glaskanal mit<br />
siebenfacher Vergrößerung und Strichplatte<br />
auch ein Infrarotkanal zur Verfügung.<br />
(gwh)<br />
Modernisierung der<br />
<strong>Technik</strong>erausbildung<br />
Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik<br />
und Nutzung der Bundeswehr<br />
hat Cassidian den Auftrag für die Lieferung<br />
eines neuen Maintenance System<br />
Trainers (MST) für die Ausbildung des<br />
März 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
7
<strong>Umschau</strong><br />
technischen Eurofighter-Personals der<br />
Luftwaffe erteilt. Der MST basiert auf der<br />
Produktfamilie der „Virtual Maintenance<br />
Trainer“ und umfasst die Erweiterung<br />
bereits vorhandener Ausbildungsmittel<br />
durch u.a. ein zusätzliches Eurofighter<br />
Cockpit und reale Bedienelemente sowie<br />
Entwicklung einer neuen Software, die<br />
die Ausbildung von <strong>Technik</strong>ern im Bereich<br />
der Wartung und Instandhaltung deutlich<br />
verbessert. Gleichzeitig werden die Modifikationen<br />
der Tranche 2 des Eurofighters<br />
berücksichtigt und die Vorraussetzungen<br />
geschaffen, eine vereinfachte Anpassung<br />
an Tranche 3 zu ermöglichen. Als Individual-<br />
oder Klassenverbandsausbildung<br />
konzipiert, werden neben den Wartungsabläufen<br />
eingehende Systemkenntnisse<br />
zur Fehleranalyse und Störbehebung vermittelt.<br />
(ur)<br />
(Foto: Cassidian)<br />
Über 17.000 Einsätze für<br />
Zivilschutzhubschrauber im<br />
Jahr 2012<br />
Die 16 Zivilschutzhubschrauber „Christoph“<br />
des Bundesministeriums des Innern<br />
flogen 2012 17.381 Einsätze. Insgesamt<br />
kamen die auf zwölf Luftrettungsstationen<br />
verteilten charakteristischen<br />
orangenen Maschinen auf 5.399 Flugstunden<br />
und 4.562 Patiententransporte.<br />
Am häufigsten hob 2012 „Christoph<br />
29“ in Hamburg ab. Er ist laut Statistik<br />
mit 1.941 Einsätzen erneut Spitzenreiter<br />
unter den Luftrettungsstationen, gefolgt<br />
von „Christoph 13“ (Bielefeld), der 1.781-<br />
mal ausrückte. Zum Vergleich: 2009 flog<br />
„Christoph 29“ 2.404 Einsätze, 2011<br />
waren es 1.986. Die höchste Steigerung<br />
hinsichtlich der jährlichen Einsatzzahl liegt<br />
beim Frankfurter „Christoph 2“, der im<br />
(Foto: Eurocopter)<br />
vergangenen Jahr 195-mal mehr ausrückte<br />
als 2011 (2012: 1.422 Einsätze, 2011:<br />
1.227) Die meisten Patienten transportierte<br />
2012 „Christoph 17“ (Kempten),<br />
nämlich 753. Mit 743 Patiententransporten<br />
folgt „Christoph 2“. Die Zivilschutz-<br />
Hubschrauber gehören zum Ausstattungspotenzial,<br />
das der Bund den Ländern<br />
für den Katastrophen- und Zivilschutz zur<br />
Verfügung stellt. Sie werden vom Bundesamt<br />
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe<br />
betrieben und von Piloten<br />
der Bundespolizei geflogen. Die Träger der<br />
jeweiligen Station stellt die medizinische<br />
Besatzung.<br />
(ww)<br />
Gasturbinen für die<br />
Fregatten 125<br />
MTU Friedrichshafen rüstet die im Bau befindlichen<br />
Fregatten Klasse 125 mit Gasturbinen<br />
LM2500 aus. Die LM2500 für die<br />
vierte Fregatte wird im Februar 2014 geliefert.<br />
Diese Fregatte soll 2015 vom Stapel<br />
(Foto: MTU)<br />
Sanitätsfahrzeuge Boxer in Afghanistan<br />
Die ersten von insgesamt sechs Geschützten Transportkraftfahrzeugen (GTK) Boxer<br />
in der Variante „schweres geschütztes Sanitätsfahrzeug“ (sgSanKfz A1) sind nach<br />
Afghanistan verlegt worden. Damit verfügen die Sanitäter bei ihren Rettungsaufgaben<br />
über den gleichen Schutz wie die Kampftruppe und können in einem größeren<br />
Lagespektrum eingesetzt werden. In dem Fahrzeug kümmern sich ein Arzt und<br />
ein Rettungssanitäter um die Verletzten, für die bis zu drei Plätze für liegend und<br />
bis zu sieben Plätze für sitzend transportierbare Verletzte genutzt werden können.<br />
Die hochmoderne Sanitätsausstattung besteht u.a. aus Beatmungsgeräten, Pulsoxymeter,<br />
Defibrillatoren, Spritzenpumpen und Patientenüberwachungsmonitoren.<br />
Im Notfall können auf der Mittelliege kleine chirurgische Eingriffe vorgenommen<br />
werden. Zur Ausstattung mit modernen Führungs- und Kommunikationsmitteln<br />
gehören auch TETRA-Funkgeräte und eine Satellitenkommunikationsanlage. (gwh)<br />
(Foto: Bundeswehr)<br />
laufen und 2017 von der Deutschen Marine<br />
in Dienst gestellt werden. Die LM2500 ist<br />
eine Industriegasturbine von General Electric.<br />
Seit 1981 wird sie bei der MTU Aero<br />
Engines instand gehalten. Die LM2500 besitzt<br />
einen Gaserzeuger mit einem Rotor<br />
und eine aerodynamisch gekoppelte Nutzturbine.<br />
Sie besteht aus einem 16-stufigen<br />
Verdichter, einer Ringbrennkammer, einer<br />
zweistufigen Hochdruckturbine und der<br />
Nutzturbine mit hohem Wirkungsgrad.<br />
Sie ist die am weitesten verbreitete Gasturbine<br />
in der Leistungsklasse von 20 bis<br />
25 MW. MTU rüstet alle vier Fregatten mit<br />
der CODELAG (Combined Diesel-Electric<br />
and Gasturbine)-Antriebsanlage aus, dazu<br />
gehören neben der LM2500 zwei Elektromotoren<br />
und vier Dieselgeneratoren. (ds)<br />
Wärmebildgerät Attica für<br />
Leopard 2<br />
Attica heißt das neue Wärmebildgerät für<br />
das Kommandantenperiskop im Kampfpanzer<br />
Leopard 2 der Bundeswehr; es<br />
kommt von Cassidian Optronics, der früheren<br />
Carl Zeiss Optronics GmbH. Nach umfangreichen<br />
Erprobungen hat das Bundesamt<br />
für Ausrüstung, Informationstechnik<br />
und Nutzung der Bundeswehr dem Unternehmen<br />
einen Auftrag über die Lieferung<br />
8 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · März 2013
(Foto: Cassidian)<br />
von Attica-Geräten im Wert von knapp.<br />
7 Mio. Euro erteilt. Das Wärmebildgerät<br />
der dritten Generation, das bereits für den<br />
Schützenpanzer Puma ausgewählt wurde,<br />
wird somit Standard im Kommandantenperiskop<br />
Peri R17, das ebenfalls von Cassidian<br />
Optronics stammt. Der Einsatz des<br />
Attica-Wärmebildgeräts durch den Panzerkommandanten<br />
ermöglicht eine wesentlich<br />
bessere Zielerfassung und verbessert so<br />
auch den Schutz der Besatzung. Der Kommandant<br />
ist mit dem Peri R17 in der Lage,<br />
markierte Ziele bei Tag und Nacht an den<br />
Richtschützen zu übergeben, um anschließend<br />
sofort weitere Ziele zu erfassen. Die<br />
Zielerfassung kann so von der Zielbekämpfung<br />
getrennt werden, was eine schnellere<br />
Reaktion ermöglicht.<br />
(wb)<br />
Wartungshalle für An-124-100 in Leipzig<br />
Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich und der Präsident der Volga-Dnepr<br />
Gruppe, Alexey Isaikin, haben auf dem Flughafengelände in Leipzig eine 8.500 m²<br />
große und 30 m hohe Wartungshalle in Betrieb genommen. Die Flughafengesellschaft<br />
hat die Halle für 17,7 Mio. Euro errichtet und für 30 Jahre an Volga-Dnepr<br />
vermietet. Dort werden in Zukunft die Großraumtransporter An-124-100 gewartet<br />
und instandgesetzt, mit denen seit 2006 im Rahmen von SALIS im Auftrag der NATO<br />
militärische Transporte z.B. nach Afghanistan durchgeführt werden. Aufgrund des<br />
langfristigen Transportbedarfs für schwere und großvolumige Güter steht für Volga<br />
Dnepr die Beschaffung neuen Fluggeräts im Raum. Es gibt bereits Konzepte für eine<br />
Antonow An-124-111VD mit 30 Tonnen mehr Tragkraft, für die ein Bedarf von 60<br />
Maschinen in den nächsten zwanzig Jahren besteht. Die modulare Bauweise mit<br />
Baugruppen auch von z.B. Boeing und General Electric könnte dazu führen, dass<br />
die Endmontage in Leipzig erfolgt.<br />
(gwh)<br />
(Foto: Eurocopter)<br />
Vor zehn Jahren: Jungfernflug des ersten Serien-Eurofighters<br />
(Foto: Cassidian)<br />
Am 13. Februar 2003 erfolgte der Jungfernflug des ersten<br />
Serien-Eurofighters in Manching. Da es sich um die Trainerversion<br />
(GT 001) handelte, wurde der Überprüfungsflug von<br />
zwei Testpiloten (EADS – heute Cassidian – und WTD 61)<br />
durchgeführt. Ein besonderer Tag, denn knapp neun Jahre<br />
nach dem Erstflug des Prototypen DA1 am 27. März 1994<br />
in Manching, konnte nun die Serienproduktion und Auslieferung<br />
an die Einsatzverbände der vier Nationen beginnen.<br />
Dabei musste sich die Luftwaffe noch ein Jahr gedulden,<br />
denn die ersten sieben Eurofighter wurden am 26. April 2004<br />
an das Jagdgeschwader 73 „Steinhoff“ in Laage ausgeliefert<br />
und vier Tage später durch den Inspekteur der Luftwaffe<br />
offiziell in den Dienst gestellt. In wenigen Wochen wird der<br />
hundertste Eurofighter an die Luftwaffe übergeben, so dass<br />
sich damit nahezu 360 Eurofighter bei den inzwischen fünf<br />
Nutzernationen im Einsatz befinden.<br />
(ur)<br />
März 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
9
SICHERHEIT & POLITIK <br />
Eine Konferenz mit vielen<br />
wichtigen Themen Rolf Clement<br />
Die Münchner <strong>Sicherheit</strong>skonferenz<br />
hat mehrere Funktionen, und im Jahr<br />
2013 ist sie dieser multifunktionalen<br />
Rolle mehr gerecht geworden als in den<br />
vergangenen Jahren. Die erste, traditionelle<br />
Funktion ist die der offenen sicherheitspolitischen<br />
Debatte. Diese Rolle hat in den<br />
letzten Jahres etwas gelitten. Immer stärker<br />
waren die Diskussionsrunden von hochkarätigen<br />
Politikern besetzt, für die nach ihren<br />
Statements nur noch eine kurze Fragerunde<br />
zur Verfügung stand. Eine wirkliche Diskussion<br />
kam nicht auf. Höhepunkt dieser<br />
Entwicklung war im vergangenen Jahr die<br />
Syrien-Diskussion. Damals ging es während<br />
der Münchner Tage darum, im UN-<strong>Sicherheit</strong>srat<br />
eine Resolution gegen die Gewalt in<br />
dem Land zu verabschieden. Russland legte<br />
sich quer. In den Wandelgängen des Hotels<br />
Bayerischer Hof in München eilten hektisch<br />
Diplomaten herum, um in ständiger Verbindung<br />
nach New York zu retten, was noch<br />
zu retten war. Deutschlands Außenminister<br />
Westerwelle drängte am Pressestand immer<br />
wieder Russland, in New York einzulenken.<br />
Die damalige US-Außenministerin<br />
Clinton kramte die Diktion aus dem Kalten<br />
Krieg heraus, um den Druck zu erhöhen.<br />
Russlands Amtsinhaber Lawrow schwieg<br />
mit seinem Pokerface. Auch nach der Abstimmung<br />
in New York und dem Scheitern<br />
der Resolution wurde weiter gepoltert, aber<br />
nicht im Saal, sondern vor der Tür, wo die<br />
Fernsehkameras aufgebaut waren. Im Saal<br />
ging es diplomatisch freundlich zu.<br />
Das war früher anders. Die legendäre<br />
Diskussion zwischen dem damaligen<br />
deutschen Außenminister Fischer und US-<br />
Verteidigungsminister Rumsfeld über den<br />
Irak-Krieg war damals ein Höhepunkt der<br />
Konferenz, dessen Strahlkraft für diejenigen,<br />
die es miterlebt haben, bis heute nicht<br />
verschwunden ist. 2013 kam es wieder zu<br />
einigen sehr deutlichen Diskussionen, einmal<br />
diskret, einmal offen.<br />
Ein Vertreter der französischen Regierung<br />
zählte in der Nachtsitzung am Freitag jene<br />
Staaten auf, die Frankreich in Mali helfen.<br />
Deutschland fehlte dabei. Dies war sofort in<br />
Autor<br />
Rolf Clement ist Mitglied der Chefredaktion<br />
Deutschlandfunk und<br />
Sonderkorrespondent für <strong>Sicherheit</strong>spolitik.<br />
Blick in den Konferenzsaal am Samstagvormittag während der Rede von<br />
Bundesaußenminister Guido Westerwelle<br />
den Wandelgängen ein Thema, zu sehr legt<br />
vor allem die Bundesregierung Wert darauf,<br />
dass sie die Mali-Operation politisch und in<br />
engem Umfang auch militärisch nutzte. So<br />
griff ein Tagungsteilnehmer die Diskussion<br />
wieder auf, als Außenminister Westerwelle<br />
im Podium saß. Deutschland unterstütze die<br />
afrikanischen Streitkräfte mit Transportflugzeugen,<br />
beteilige sich an der Ausbildungsmission<br />
der EU für afrikanische Soldaten,<br />
später kam die Zusage medizinischer Unterstützung<br />
für die EU-Mission (wieder für die<br />
afrikanischen Streitkräfte) hinzu. Lediglich<br />
die bisher nur angekündigte Bereitschaft,<br />
französische Flugzeuge aufzutanken,<br />
komme direkt Frankreich zu. Was also sei<br />
die deutsche Unterstützung? Ein sichtlich<br />
genervter deutscher Außenminister antwortete,<br />
die afrikanischen Soldaten sollten<br />
doch möglichst schnell ausgebildet werden<br />
und die Mission dort selbst übernehmen,<br />
und das entlaste doch die französischen<br />
Streitkräfte. Westerwelle machte nicht den<br />
Eindruck, dass er seine Äußerung so richtig<br />
überzeugend fand.<br />
Offener Streit<br />
Zu einem richtigen öffentlichen Disput<br />
forderte der Vorsitzende des Auswärtigen<br />
Ausschusses des Bundestages, der CDU-<br />
Abgeordnete Ruprecht Polenz, den iranischen<br />
Außenminister heraus. Ihm hielt er<br />
das Verhalten des Iran in den letzten Jahren<br />
vor. Er wies ihm klar nach, dass und wo der<br />
Iran die Zusammenarbeit mit internationalen<br />
Organisationen verweigert habe. So<br />
(Foto: MSC/Wüst)<br />
Der iranische Außenminister Ali Akbar<br />
Salehi musste sich deutliche Kritik zu<br />
seinen Ausführungen gefallen lassen<br />
werde das Misstrauen aufgebaut, das die<br />
Staatengemeinschaft gegenüber dem Iran<br />
habe.<br />
Zuvor hatte US-Vizepräsident Joe Biden<br />
dem Iran direkte Gespräche zwischen dem<br />
Iran und der Obama-Administration angeboten,<br />
wenn diese auf der Basis ehrlicher<br />
Information und mit dem Ziel einer belastbaren<br />
Vereinbarung getroffen werde. In<br />
der Diskussion mit Polenz ging der iranische<br />
Außenminister auf dieses Angebot ein. Er<br />
erklärte sich dazu bereit, wehrte sich aber<br />
dagegen, dass internationale Vereinbarungen<br />
nicht eingehalten worden waren. Da<br />
wäre es nun gut gewesen, wenn auch ein<br />
Vertreter der Internationalen Atomenergiebehörde<br />
dabei gesessen hätte. Aber auch<br />
so war dies eine sehr kontroverse Debatte,<br />
so, wie es eigentlich der Konferenzidee<br />
entsprach.<br />
(Foto: MSC/Scheller)<br />
März 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
35
US-Senator John McCain (3.v.li.) nutzte die Münchner <strong>Sicherheit</strong>skonferenz<br />
für eine Pressekonferenz außerhalb des Programms<br />
Und solche Diskussionen wirken dann auch<br />
noch nach: Tage später hat sich der höchste<br />
Religionsführer des Iran, Chamenei, eingeschaltet<br />
und Gespräche mit den USA verboten.<br />
Selten sind die Meinungsunterschiede<br />
in der Führung des Iran in einer wichtigen<br />
Frage so offen zu Tage getreten, womit der<br />
Spielraum für politisches Handeln erweitert<br />
wurde.<br />
Nun hat dieser Disput einen strukturellen<br />
Hintergrund gehabt. Zum einen sprach da<br />
ein Abgeordneter des Bundestages, also<br />
kein Regierungsmitglied mit dem iranischen<br />
Außenminister. Parlamentarier können freier<br />
reden als Minister und Regierungsvertreter.<br />
Eigentlich war ja die Konferenz in München<br />
gerade dafür geschaffen worden, dass<br />
man offen untereinander spricht. Aber die<br />
Minister, die da mit vorbereiteten Stellungnahmen<br />
ankommen, reden als Funktionsträger,<br />
während Parlamentarier schon mal<br />
offener sind. Das könnte eine Arbeitsteilung<br />
werden, die man auch bewusst nutzt. Dafür<br />
wäre es nötig, mehr Abgeordnete in die<br />
Podien zu holen.<br />
Aber es kam bei dieser Konferenz noch etwas<br />
anderes hinzu: Ruprecht Polenz steht<br />
für eine beachtliche Gruppe profilierter Außen-<br />
und <strong>Sicherheit</strong>spolitiker, die für den<br />
in diesem Jahr zu wählenden Bundestag<br />
nicht mehr kandidieren. Sie haben die letzte<br />
<strong>Sicherheit</strong>skonferenz in offizieller Mission<br />
hinter sich gebracht. Manch einer, der keine<br />
Ambitionen mehr hat, spricht dann auch<br />
offener. Dennoch: Man sollte bei der Auswahl<br />
von Rednern vielleicht darauf achten,<br />
dass man verstärkt auf solche setzt, die ein<br />
offenes, kritisches Wort pflegen und die<br />
durch kontroverse Beiträge die Diskussionen<br />
voranbringen.<br />
Neue Themen aufgeriffen<br />
Die zweite Rolle ist die, neue Themen aufzugreifen.<br />
Immer wieder versucht Wolfgang<br />
Ischinger, der Chef der Konferenz,<br />
zusätzliche Themen aufzugreifen. Dabei<br />
braucht man gelegentlich längeren Atem.<br />
So starten manche Themen erst nach einiger<br />
Zeit durch. In den vergangenen Jahren<br />
hat sich die Münchner Konferenz mit der<br />
Bedrohung durch Cyber-Angriffe beschäf-<br />
tigt. Der Vorstandsvorsitzende der Telekom,<br />
René Obermann, stellte auf dem Podium<br />
dieser Konferenz fest, dass vor Jahresfrist<br />
dieses Thema nicht sonderlich viele Interessenten<br />
in den Saal gelockt hätte. In diesem<br />
Jahr war der Saal, in dem diese Arbeitsgruppe<br />
tagte, brechend voll. Dass Bewusstsein<br />
für die Wichtigkeit dieses Themas steigt<br />
immer weiter, wenn man hört, dass täglich<br />
Angriffe aus dem Netz stattfinden, dass<br />
man also in diesem Bereich durchaus Handlungsbedarf<br />
sieht. Die <strong>Sicherheit</strong>skonferenz<br />
hat zu diesem Thema im vergangenen Jahr<br />
eine Sonderveranstaltung in Bonn bei der<br />
Telekom durchgeführt, eine jener Konferenzen,<br />
die mittlerweile unter der Überschrift<br />
der <strong>Sicherheit</strong>skonferenz stattfinden, aber<br />
unter Ausschluss der interessierten (oder<br />
berichtenden) Öffentlichkeit. Das also bewährt<br />
sich.<br />
Jedoch führt das dazu, dass die Veranstaltung<br />
in München sehr befrachtet – um nicht<br />
überfrachtet zu sagen – ist. In diesem Jahr<br />
gab es Nachtsitzung nach den offiziellen<br />
Empfängen und Essen. Es gab parallel laufende<br />
Arbeitsgruppen mit der Folge, dass<br />
man einen kompletten Überblick über das,<br />
was dort stattfindet, nicht mehr bekommen<br />
kann. Das Programm der Tagung wird<br />
so zum Angebot, aus dem man sich die Rosinen<br />
herauspicken kann, die einem schmecken.<br />
Dann ist es keine homogene Tagung<br />
mehr, dann hat jeder, der kommt, einen anderen<br />
Eindruck, andere Erfahrungen. Das<br />
sollte vielleicht auch überdacht werden.<br />
Dritte Funktion der Münchner <strong>Sicherheit</strong>skonferenz<br />
ist es, den Rahmen für viele Kontakte<br />
zu bilden. Ein Dutzend Staats- und Regierungschefs,<br />
rund fünf Dutzend Minister<br />
und ungezählte Parlamentarier aus vielen<br />
Ländern reisen in München an. Da ist die<br />
Treppe hinaus zu jenen Räumen, in denen<br />
die bilateralen Gespräche stattfinden, ständig<br />
bevölkert. Ein deutscher Staatssekretär<br />
holte während der Tagung im Gespräch<br />
tief Luft: Im 30-Minuten-Takt habe er sogenannte<br />
„Bilaterals“, wobei er für die Vertreter<br />
kleinerer Staaten zuständig sei.<br />
Da kann am Rande der Tagung auch ein<br />
Minister eines recht kleinen Landes in der<br />
Pause am Stehtisch mit Kaffee den US-Vizepräsidenten<br />
Biden ansprechen und tref-<br />
(Foto: MSC/Wüst)<br />
fen – wenn dieser nicht gerade ein schon<br />
verabredetes Gespräch in der oberen Etage<br />
führt. Jedenfalls sind die Vernetzung, das<br />
persönliche Kennenlernen vielleicht das<br />
zentrale Element, das diese Konferenz auch<br />
2013 wieder für Politiker, Wissenschaftler,<br />
Soldaten und Journalisten so wichtig gemacht<br />
hat.<br />
Wichtige Funktion erfüllt<br />
Alle drei Funktionen hat die Konferenz<br />
2013 gut erfüllt, besser als ihre Vorgängerinnen.<br />
Offenheit sollte ein wichtiges<br />
Kriterium sein. Für die Diskussionskultur<br />
wäre es auch hilfreich, wenn die Politiker<br />
etwas länger für Fragen zur Verfügung<br />
stünden. Wenn drei interessante Politiker<br />
im Podium sitzen, das knapp 90 Minuten<br />
dauert, um ein Beispiel zu nennen, dann<br />
bleibt wenig Zeit, mit kritischen Fragen<br />
die Positionen zu hinterfragen und zu<br />
diskutieren. Das wäre aber für 2014 aus<br />
deutscher Sicht recht bedeutsam. 2014<br />
ist das Jahr, in dem eine neue Bundesregierung,<br />
wie immer sie aussehen mag,<br />
ihre außen- und sicherheitspolitische Visitenkarte<br />
abgeben müsste. In diesem Jahr<br />
hat dies, in noch recht schwachen Schritten,<br />
US-Vizepräsident Joe Biden gemacht.<br />
Die mittlerweile von US-Präsident Obama<br />
angekündigten Verhandlungen über eine<br />
euro-atlantische Freihandelszone hat er<br />
schon angedeutet. Sicher wäre es da auch<br />
besser gewesen, dass die Regierungserklärung<br />
von Obama schon erfolgt gewesen<br />
wäre. Aber die US-Regierung kann<br />
sich in ihren Planungen naturgemäß nicht<br />
an dieser Konferenz in München orientieren.<br />
Aber 2014 wäre es der richtige Zeitpunkt<br />
und der richtige Ort, eine solche<br />
Visitenkarte auszustellen.<br />
Denn unabhängig davon, wer dann regiert,<br />
müssen einige Fragen beantwortet werden,<br />
die dieses Jahr nur angetippt wurden: Wie<br />
hält es Deutschland mit der Unterstützung<br />
von Verbündeten wie Frankreich über politische<br />
Erklärungen und weiches Engagement<br />
hinaus? Wie stark bringt sich Deutschland<br />
wirklich in eine europäische <strong>Sicherheit</strong>spolitik<br />
ein? Machen wir irgendwann einmal<br />
Ernst mit „pooling und sharing“? Das sind<br />
einige Fragen, die sich der neuen Regierung<br />
stellen werden.<br />
Und dann feiert die <strong>Sicherheit</strong>skonferenz<br />
Jubiläum: Die nächste ist die 50. Es wäre<br />
nicht Wolfgang Ischinger, würde er daraus<br />
nicht eine Feierstunde machen, die<br />
die <strong>Sicherheit</strong>skonferenz mit ihrer Tradition<br />
auch verdient hat. Man wird sehen, wen<br />
Botschafter Wolfgang Ischinger dafür gewinnen<br />
kann. Aber neben der Feier sollten<br />
gerade 2014 auch die bisherigen Funktionen<br />
wieder gut bedient werden. <br />
36 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · März 2013
BUNDESWEHR & STREITKRÄFTE INTERNATIONAL<br />
Das Führungsunterstützungskommando<br />
der Bundeswehr<br />
Heinrich Steiner<br />
In seinem Buch „Die Fernmeldetruppe des Heeres in der Bundeswehr“ von 1978 beschreibt Brigadegeneral<br />
a.D. Emil Hoffmann die Vorgänge um die „Studie zur Neugliederung des FmWesens in der Bw<br />
vom Juli 1959“: „Leitgedanke der Studie war, gleiche „Fernmeldetätigkeiten“ bundeswehrgemeinsam und<br />
teilstreitkraftgebunden wahrzunehmen. … Da eine Einigung oder ein Kompromiss zwischen den Teilstreitkräften<br />
nicht zu erzielen war, verzichtete Fü B VI auf die weitere Verfolgung dieser Idee und legte die Studie<br />
auch nicht dem Generalinspekteur oder dem Minister zur Entscheidung vor; …“.<br />
Über 50 Jahre später ist diese gute<br />
und richtige Idee mit dem Führungsunterstützungskommando<br />
der Bundeswehr (FüUstgKdoBw) nun in die<br />
Tat umgesetzt worden. Mit dieser neuen<br />
Struktur besteht jetzt die große Chance,<br />
Führungsunterstützung (FüUstg) noch professioneller<br />
und effizienter zu gestalten, als<br />
dies in der Vergangenheit möglich war. Die<br />
konsequente Ausrichtung der Leistungserbringung<br />
des FüUstgKdoBw auf die Erfordernisse<br />
des Einsatzes in einem meist<br />
multinationalen Umfeld muss dabei der<br />
Maßstab sein.<br />
Dieser Artikel erläutert die besondere Rolle<br />
des FüUstgKdoBw, welches zum 1. Januar<br />
2013 aufgestellt wurde.<br />
Fähigkeitskommandos der<br />
Streitkräftebasis<br />
Autor<br />
Brigadegeneral Dipl.-Ing. Heinrich<br />
Steiner ist Kommandeur des Führungsunterstützungskommandos<br />
der<br />
Bundeswehr.<br />
Bw/SK-gemeinsam, multinational<br />
Bereitstellung einsatzfähiger FüUstg-Kräfte<br />
Truppensteller und Zertifizierungsinstanz<br />
Sicherstellen der FüUstg für Einsätze & Übungen<br />
Supply Manager IT-SysBw<br />
Übergreifende Betriebsverantwortung für das IT-SysBw<br />
Supply Manager IT-SysBw (erweiterte Sichtweise)<br />
Bereitstellung wesentlicher IT-Services<br />
zentraler IT-Serviceprovider IT-SysBw<br />
Weiterentwicklung der FüUstg Bundeswehr als Gesamtaufgabe<br />
„Fachamt“ FüUstgBw<br />
Aufgaben und Rollen des Führungsunterstützungskommandos der Bw<br />
In den „Leitlinien zur Neuausrichtung der<br />
Bundeswehr“ von 2012 werden Aufgaben<br />
und Rolle der Fähigkeitskommandos der<br />
Streitkräftebasis (SKB) wie folgt festgelegt:<br />
„In den Fähigkeitskommandos und Zentren<br />
der Aufgabenbereiche (z.B. Logistik, Führungsunterstützung,<br />
Militärisches Nachrichtenwesen<br />
etc.) werden Einsatzkräfte,<br />
Steuerungselemente, im Inland abrufbare<br />
Expertise und Fähigkeiten für den Einsatz,<br />
die Ausbildung und deren Weiterentwicklung<br />
unter einer einheitlichen fachlichen<br />
und truppendienstlichen Verantwortung<br />
zusammengeführt. Die Fähigkeitskommandos<br />
und Zentren der SKB sind für die<br />
jeweils übertragene bundeswehr- und<br />
streitkräfteübergreifende Aufgabe … der<br />
Träger der fachlichen Kompetenz und zentraler<br />
Verantwortlicher für deren organisationsbereichsübergreifende<br />
Wahrnehmung.<br />
In dieser Funktion arbeiten die Fähigkeitskommandos<br />
und Zentren über das Kommando<br />
SKB (Kdo SKB) dem BMVg zu und<br />
wirken mit den Führungskommandos der<br />
MilOrgBer, dem EinsFüKdoBw sowie den<br />
Ämtern/Kommandobehörden der Ressourcenbereiche/Organisationsbereiche<br />
und anderer Ressorts zusammen.“<br />
Der Generalinspekteur der Bundeswehr<br />
hat in seiner Ansprache bei der letzten<br />
Bundeswehrtagung am 23. Oktober 2012<br />
in Strausberg deutlich gemacht, dass die<br />
Neuausrichtung der Bundeswehr nicht<br />
einseitig dominiert werden darf durch die<br />
Erfahrungen aus zurückliegenden und gegenwärtigen<br />
Einsätzen, sondern im Kern<br />
bestimmt wird durch die zukünftig wahrscheinlicheren<br />
Konfliktformen, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit<br />
sowie ihre besonderen<br />
Herausforderungen zu Lande, zur<br />
See, in der Luft und im Informationsraum.<br />
Der Generalsinspekteur führte dazu weiter<br />
aus: „Die Klammer bildet der Verbund von<br />
Führung, Aufklärung, Wirkung und Unterstützung<br />
so, dass alle Fähigkeitsdomänen<br />
auch im Verbund komplementärer multinationaler<br />
Leistungserbringung wirken<br />
können und Deutschland auch in der Rolle<br />
als Rahmennation jene „Plug Ins“ bietet,<br />
an die unsere Verbündeten andocken können.“<br />
Das FüUstgKdoBw wird als Fähigkeitskommando<br />
in der Streitkräftebasis künftig genau<br />
solche „Plug Ins“ als Bw-gemeinsame<br />
Fähigkeiten bereitstellen.<br />
Die Aufgabe Führungsunterstützung<br />
Kernaufgabe der FüUstg ist die Unterstützung<br />
der Führungsfähigkeit der Bundeswehr<br />
durch den Einsatz und den Betrieb<br />
von Informations- und Kommunikationstechnik<br />
(IT). Führungsunterstützungskräfte<br />
(FüUstgKr) der SKB sind immer dann die<br />
militärischen Kompetenzträger, wenn es<br />
(Grafiken: Bundeswehr)<br />
42 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · März 2013
BUNDESWEHR & STREITKRÄFTE INTERNATIONAL <br />
Betrieb und das Management krisenhafter<br />
Entwicklungen unerlässlich. Ein zentrales<br />
Ressourcenmanagement für den Einsatz<br />
verfügbarer Kräfte, Mittel und Einrichtungen<br />
sowie das Management von IT-Services<br />
müssen aus einer Hand erfolgen. Nicht<br />
zuletzt vor diesem Hintergrund wird durch<br />
das FüUstgKdoBw ein zentrales Risikomanagement<br />
für das IT-SysBw konzeptionell<br />
entwickelt und schrittweise implementiert.<br />
Damit wird den vielfältigen Bedrohungen –<br />
die nicht immer in der Informationstechnik<br />
begründet sein müssen, denn Ausfälle des<br />
IT-SysBw können u.a. auch durch Stromausfälle,<br />
physische Zerstörungen von Infrastruktur<br />
oder auch durch die nicht Verfügbarkeit<br />
von IT-Services von kommerziellen<br />
IT-Serviceprovidern verursacht werden –<br />
wirkungsvoll begegnet.<br />
In streitkräftegemeinsamen (joint) und<br />
multinationalen (combined) Einsätzen<br />
vernetzt die FüUstg alle Kräfte, Mittel und<br />
Einrichtungen der Bundeswehr durch einen<br />
in der Regel multinationalen Informationsund<br />
Kommunikationsverbund. FüUstgKr<br />
planen, richten ein, betreiben und überwachen<br />
das Netz und stellen zentrale IT-<br />
Services (Core Services) für alle Kräfte und<br />
Einrichtungen im Einsatzgebiet bereit. Der<br />
verantwortliche Führer vor Ort hat mit Blick<br />
auf die FüUstg einen zentralen Ansprechpartner<br />
für den Einsatz der gesamten IT in<br />
seinem Verantwortungsbereich. Der Leiter<br />
des Führungsgrundgebietes 6 ist der zentrale<br />
Berater des jeweiligen Kommandeurs<br />
in allen Fragen des Einsatzes von IT.<br />
In Afghanistan sind die Elemente der<br />
FüUstgBw integraler Bestandteil eines modernen,<br />
multinationalen Netzwerkverbundes.<br />
Sie stellen die Plattform für die vielfälum<br />
den Einsatz von IT zur Sicherstellung<br />
der Führungsfähigkeit für die Einsatz- und<br />
Operationsführung von Streitkräften geht.<br />
Der Einsatz von IT ist heute unverzichtbar<br />
für den Einsatz von Streitkräften. Um die<br />
Fähigkeiten der Bundeswehr zur Wirkung<br />
bringen zu können, werden alle Elemente<br />
des Verbundes Aufklärung-Führung-Wirkung-Unterstützung<br />
durch IT miteinander<br />
vernetzt.<br />
Wie in der Wirtschaft und in der öffentlichen<br />
Verwaltung haben auch in der<br />
Bundeswehr die IT-Vernetzung und die<br />
Nutzung von komplexen IT-Services – von<br />
der Gewährleistung der Einsatz- und Operationsführung<br />
bis hin zur Unterstützung<br />
in Deutschland (Basis Inland) – ein nie gekanntes<br />
Maß angenommen. Ein Blick auf<br />
große kommerzielle IT-Serviceprovider<br />
zeigt, wie hoch der personelle, organisatorische<br />
und technische Aufwand ist, um<br />
IT-Dienstleistungen dem Kunden in verlässlicher<br />
Qualität zur Verfügung zu stellen.<br />
Die Leitlinien zur Neuausrichtung der Bundeswehr<br />
geben vor, dass sich alle Elemente<br />
der Bundeswehr auf den Einsatz der Streitkräfte<br />
auszurichten und diesen zu unterstützen<br />
haben. Auf dieses Ziel sind alle<br />
Prozesse zu optimieren. Das kann wirksam<br />
und wirtschaftlich nur durch einen zielgerichteten<br />
und zentral geführten Betrieb der<br />
Informations- und Kommunikationstechnik<br />
in der Bundeswehr gelingen. Auch der<br />
„Lebensweg“ der entsprechenden IT-Services<br />
– Entwicklung, Beschaffung, Einsatz,<br />
Nutzung und Verwertung – muss zentralen<br />
Grundsätzen folgen und auch zentral<br />
gesteuert werden. Auch in diesem Bereich<br />
wird das FüUstgKdoBw künftig eine<br />
zentrale Rolle wahrnehmen. Wesentliche<br />
Grundsätze werden u.a. durch das Konzept<br />
„IT-Servicemanagement IT-SysBw“<br />
beschrieben, das sich zurzeit in der Erarbeitung<br />
befindet.<br />
Ohne eine funktionsfähige FüUstg ist die<br />
Einsatz- und Operationsführung in keinem<br />
Bereich der Bundeswehr ohne Einschränkungen<br />
möglich (Enabler-Funktion). Der<br />
Ausfall des gesamten Übertragungsnetzes<br />
oder auch nur von Teilen desselben,<br />
gestörte IT-Services, beispielsweise das<br />
Fehlen einer gesicherten Kommunikationsanbindung<br />
oder einer notwendigen<br />
Lageinformation, kann sehr schnell zur Gefährdung<br />
einer laufenden Operation führen,<br />
im Extremfall Gefahr für Leib und Leben<br />
der eingesetzten Soldaten bedeuten.<br />
Die Vorfälle in Estland, die Verteilung von<br />
Schadsoftware wie Stuxnet oder Conficker<br />
haben gezeigt, welchen Gefahren vernetzte<br />
Systeme ausgesetzt sind. In einem vernetzten<br />
Gesamtsystem wie dem IT-System<br />
der Bundeswehr (IT-SysBw) ist eine zentral<br />
verantwortliche Instanz für den laufenden<br />
Stabsquartier<br />
Stabsquartier<br />
BetrZ BetrZIT-SysBw<br />
S1<br />
S2<br />
S3<br />
S4<br />
S6<br />
Controlling Controlling<br />
Risk- Risk-und IT-Sec- IT-Sec-<br />
Management<br />
Management<br />
SKE<br />
SKE<br />
Kdr BtrbZ IT-SysBw<br />
Stv Kdr & ChdSt<br />
Das Betriebszentrum IT-SysBw (BITS)<br />
Serviceentwicklung<br />
& QualitätsMgmt<br />
QualitätsMgmt<br />
TDL<br />
TDL<br />
Risikomanagement<br />
Risikomanagement<br />
IT-<strong>Sicherheit</strong>smangement<br />
IT-<strong>Sicherheit</strong>smangement<br />
IT-Servicemanagement<br />
IT-Servicemanagement<br />
Architektur,<br />
Architektur,<br />
Konfigurations-<br />
Konfigurations-<br />
&<br />
Wissensmgmt<br />
Wissensmgmt<br />
Validierung<br />
Validierung<br />
&<br />
TestRefSysteme<br />
TestRefSysteme<br />
ÜbZNOC<br />
ÜbZNOC<br />
Frequenzmanagement<br />
Frequenzmanagement<br />
tigen Anwendungen und Dienste für die<br />
Einsatz- und Operationsführung zur Verfügung,<br />
einschließlich der militärischen und<br />
zivilen Unterstützungskräfte. FüUstgKr des<br />
FüUstgKdoBw nehmen bei allen Einsätzen<br />
die zentrale Verantwortung bei Einrichtung<br />
und Betrieb der im Einsatzgebiet befindlichen<br />
Elemente des IT-SysBw ein.<br />
Sie stellen sicher, dass nationale, multinationale<br />
und kommerzielle IT-Services zur<br />
richtigen Zeit am richtigen Ort in der geforderten<br />
Qualität zur Verfügung gestellt<br />
werden. Nicht in jedem Fall sind FüUstgKr<br />
selbst für die Erbringung eines IT-Service<br />
in der Rolle eines IT-Serviceproviders verantwortlich.<br />
Die Bereitstellung von Softwareprodukten<br />
wie SASPF, von IT-Services<br />
des Militärischen Nachrichtenwesens oder<br />
auch die Bereitstellung von IT-Services aus<br />
dem Afghanistan Mission Network sind<br />
Beispiele für externe militärische oder kommerzielle<br />
IT-Serviceprovider.<br />
Die zentrale Koordinierung für die Verfügbarkeit<br />
dieser Services erfolgt durch<br />
FüUstgKr im Einsatz sowie zentrale Steuerungseinrichtungen<br />
und Elemente in<br />
Deutschland (IT-Basis Inland). Im Einsatz<br />
können zukünftig die maßgeblichen Führungspositionen<br />
der FüUstg durchhaltefähig<br />
durch Kräfte des FüUstgKdoBw gestellt<br />
werden. In der neuen Struktur des<br />
Kommandobereichs wird dies durch die<br />
sechs Führungsunterstützungsbataillone<br />
und entsprechende Führungspositionen<br />
im Kommandostab, im Betriebszentrum<br />
IT-SysBw und an der Führungsunterstützungsschule<br />
der Bundeswehr sichergestellt.<br />
Darüber hinaus können weitere Führungsaufgaben<br />
auf der Ein-Sterne-Ebene in einem<br />
multinationalen Stab künftig aus der neuen<br />
Planung, Steuerung<br />
und Realisierung<br />
IPR IPR & Changemanagement<br />
Changemanagement<br />
IT-Systeme<br />
IT-Systeme<br />
Informationsübertragung<br />
Informationsübertragung<br />
Informationsverarbeitung<br />
Informationsverarbeitung<br />
Servicebetrieb<br />
Support<br />
Support<br />
NOC<br />
NOC<br />
März 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
43
BUNDESWEHR & STREITKRÄFTE INTERNATIONAL<br />
XX<br />
FüUstgKdoBw<br />
Gerolstein<br />
281<br />
Kastellaun<br />
282<br />
Dillingen<br />
292<br />
Murnau<br />
293<br />
Storkow<br />
381<br />
Erfurt<br />
383<br />
Wesel<br />
1. NSB<br />
Bonn<br />
Zielstruktur FüUstgKdoBw<br />
BtrbZ<br />
IT-SysBw<br />
FüUstgS<br />
Bw<br />
Kommandostruktur heraus gestellt werden.<br />
Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan<br />
und die besondere Rolle der Bundeswehr<br />
als regionale Führungsnation im Norden<br />
des Landes zeigen die Bandbreite des Einsatzes<br />
und Betriebs von IT im Einsatz auf.<br />
Aus diesen Erfahrungen können wesentliche<br />
Grundsätze für die zukünftige Ausgestaltung<br />
der FüUstg abgeleitet werden.<br />
Dabei ist klar, dass der Einsatz in Afghanistan<br />
nicht alleiniger Maßstab für alle künftig<br />
denkbaren Einsätze sein kann.<br />
Das Kommando<br />
Das zentrale Element der Bundeswehr zur<br />
Sicherstellung von Fähigkeiten der FüUstg<br />
ist das FüUstgKdoBw. Es ist der Träger der<br />
fachlichen Kompetenz der FüUstgBw. Planung,<br />
Betrieb und die Überwachung von<br />
IT-Leistungen im IT-SysBw, der Einsatz von<br />
Kräften und Mitteln der FüUstg sowie die<br />
zentralen Aufgaben Weiterentwicklung<br />
und Ausbildung für die FüUstgKr der Bundeswehr<br />
werden zentral in diesem neuen<br />
Fähigkeitskommando gebündelt.<br />
Aufgaben, Aufbau und Struktur folgen<br />
konsequent den Zielen der Neuausrichtung<br />
der Bundeswehr. Der Kommandobereich<br />
ist Haupttruppensteller für die Auftragserfüllung<br />
der FüUstg im Einsatz. Ihm wurde<br />
als einem Fähigkeitskommando der SKB<br />
eine besondere Verantwortung für den<br />
Einsatz der entsprechenden Kräfte, Mittel<br />
und Einrichtungen sowie den Betrieb des<br />
IT-SysBw als Ganzes übertragen. In seiner<br />
Rolle als „Supply Manager IT-SysBw“ trägt<br />
der Kommandeur des Kommandos die<br />
zentrale Verantwortung für Einsätze und<br />
Rheinbach<br />
Pöcking<br />
Rheinbach<br />
Gerolstein<br />
Wesel<br />
Bonn<br />
Kastellaun<br />
Abstimmung mit dem IT-Direktor selbstverständliche<br />
und gelebte Praxis. Im Integrierten<br />
Planungsprozess handelt das Kommando<br />
als der zentrale Kompetenzträger<br />
„Führungsunterstützung Bundeswehr“.<br />
Damit werden grundsätzlich alle Initiativen<br />
zum Thema FüUstg für das PlgABw fachlich<br />
und konzeptionell durch das FüUstg-<br />
KdoBw bewertet. Priorisierungen werden<br />
hierbei in Abstimmung mit dem Kdo SKB<br />
und den beteiligten Organisationsbereichen<br />
festzulegen sein.<br />
Parallel zur Aufstellung des Kommandos<br />
erfolgte die Aufstellung des Betriebszentrums<br />
IT-System der Bundeswehr (BITS)<br />
als eigenständige Dienststelle am Standort<br />
Rheinbach, geführt durch einen Kommandeur<br />
im Dienstgrad eines Brigadegenerals<br />
bzw. Flottillenadmirals. Das BITS<br />
erfährt einen signifikanten quantitativen<br />
und qualitativen Aufwuchs, um seiner<br />
Aufgabe als Gesamtverantwortlicher für<br />
die zentrale Betriebsführung des IT-SysBw<br />
gerecht zu werden. Aus dem neuen „Network<br />
Operations Centre Basis Inland“<br />
(NOC B.I.) des BITS wird der Betrieb des<br />
IT-SysBw rund um die Uhr überwacht. Die<br />
Fertigstellung des NOC B.I. in räumlicher<br />
Nähe zum Betriebskompetenzzentrum<br />
der BWI in Rheinbach ermöglicht die Nutzung<br />
von Synergien und eine enge Abstimmung<br />
mit der BWI.<br />
Die Überführung der drei unterstellten<br />
Führungsunterstützungsregimenter mit<br />
ihren elf Bataillonen und des NATO Signal<br />
Battalion in Wesel in die Zielstruktur erfolgt<br />
schrittweise bis 2015. Die Zielstruktur umfasst<br />
noch sechs Führungsunterstützungseinsatzgleiche<br />
Verpflichtungen gegenüber<br />
dem Einsatzführungskommando der<br />
Bundeswehr als dem „zentralen Demand<br />
Manager IT-SysBw“. Durch das Kommando<br />
werden die Fähigkeiten der Führungsunterstützung<br />
bereits im Planungsprozess für<br />
Einsätze koordiniert und „tailored to the<br />
mis-sion“ für das jeweilige Einsatzkontingent<br />
zusammengestellt.<br />
Für Übungen und andere Verpflichtungen<br />
können neben dem Eins-<br />
FüKdoBw auch die Kommandos der Organisationsbereiche<br />
der Bundeswehr IT-<br />
Dienstleistungen anfordern und somit<br />
ebenfalls als Demand Manager auftreten.<br />
Das FüUstgKdoBw ist in dieser Rolle weisungsbefugt<br />
gegenüber allen militärischen<br />
und kommerziellen IT-Serviceprovidern, die<br />
ihre IT-Services über das IT-SysBw bereitstellen.<br />
Es trägt die Gesamtverantwortung<br />
für deren Bereitstellung und zuverlässigen<br />
Betrieb.<br />
Das Kommando wurde zum 1. Januar 2013<br />
aufgestellt. Der Stab mit seinen vier Abteilungen<br />
wird in der Zielunterbringung auf<br />
der Hardthöhe in Bonn stationiert sein.<br />
Aufgrund der Vielzahl organisatorischer<br />
und infrastruktureller Maßnahmen sind<br />
jedoch Zwischenunterbringungen erforderlich.<br />
Eine Zusammenführung aller Abteilungen<br />
in Bonn ist bis 2015 vorgesehen.<br />
An der Spitze des Kommandos steht ein<br />
Zwei-Sterne-General, der über den Inspekteur<br />
der Streitkräftebasis dem Generalinspekteur<br />
der Bundeswehr für den Betrieb<br />
des IT-SysBw und damit für die Sicherstellung<br />
der Führungsfähigkeit der Streitkräfte<br />
in den Einsatzgebieten verantwortlich ist.<br />
Die Fähigkeiten der FüUstg sind neben den<br />
Storkow<br />
Erfurt<br />
Dillingen<br />
Pöcking<br />
Murnau<br />
Festlegungen zur Führungsorganisation,<br />
zu den Führungsverfahren und des Informationsmanagements<br />
wesentliche<br />
Säule zur Gewährleistung<br />
der Führungsfähigkeit von<br />
Streitkräften.<br />
Das Kommando ist jedoch<br />
weit mehr als nur<br />
der für Einsatz und Betrieb<br />
des IT-SysBw Verantwortliche.<br />
Es bündelt<br />
die Interessen der Führungsunterstützung<br />
der<br />
Streitkräfte, ist Zukunftsgestalter<br />
der FüUstg und<br />
über das Planungsamt der<br />
Bundeswehr (PlgABw) wichtigster<br />
Ansprechpartner für<br />
das Bundesamt für Ausrüstung,<br />
Informationstechnik<br />
und Nutzung<br />
der Bundeswehr mit<br />
Blick auf die Weiterentwicklung<br />
des IT-SysBw. In<br />
diesem Zusammenhang ist<br />
eine enge Zusammenarbeit und<br />
44 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · März 2013
BUNDESWEHR & STREITKRÄFTE INTERNATIONAL <br />
bataillone und das neue 1st NATO Signal<br />
Battalion. Besondere Herausforderung bei<br />
der Gestaltung des Übergangs in die neuen<br />
Strukturen ist höchstmögliche Planungssicherheit<br />
für das Personal bei zeitgleicher<br />
Sicherstellung der Einsatzverpflichtungen.<br />
Gerade in dieser wichtigen Phase der Umstrukturierung<br />
soll durch eine frühzeitige<br />
Personalplanung dem Prinzip „first come<br />
– first serve“ entgegengewirkt werden.<br />
Dem Personal in den Regimentern und Bataillonen<br />
soll frühzeitig ein Höchstmaß an<br />
persönlicher <strong>Sicherheit</strong> gegeben werden.<br />
Die Führungsunterstützungsschule der<br />
Bundeswehr (FüUstgSBw) verbleibt bis auf<br />
Weiteres in Feldafing und auf dem Lechfeld<br />
mit Zielstationierungen in Pöcking und<br />
Lechfeld. Die Schule wird mit Ausnahme<br />
des aufzulösenden Bereichs Weiterentwicklung<br />
in die neue Struktur überführt.<br />
Die FüUstgSBw leistet unter schwierigen<br />
Rahmenbedingungen ausgezeichnete Arbeit.<br />
Schnell und flexibel hat sie die militärfachliche<br />
Ausbildung an neue Systeme und<br />
Technologien angepasst. Sie wird rasch davon<br />
profitieren, dass mit der neuen Struktur<br />
der FüUstg viele Schnittstellen im Bereich<br />
der Ausbildung abgebaut werden können<br />
und die Ausbildung des IT-Fachpersonals<br />
der Bundeswehr jetzt zentral durch das<br />
FüUstgKdoBw gesteuert, weiterentwickelt<br />
und verantwortet wird. Die FüUstgSBw ist<br />
auch in der neuen Struktur für die lehrgangsgebundene<br />
militärfachliche Regenerationsaus-<br />
und Weiterbildung des FüUstgund<br />
IT-Fachpersonals verantwortlich.<br />
Die Aufbauphase des Kommandostabes<br />
wird bis Mitte 2013 abgeschlossen sein. Ab<br />
1. Juli 2013 soll mit der Final Operational<br />
Capability die volle Leistungsfähigkeit des<br />
Kommandos erreicht werden.<br />
Der Kommandostab wird mit vier Abteilungen<br />
neu strukturiert. Organisation und<br />
Binnenstruktur folgen einem für die Bundeswehr<br />
neuen Ansatz, der jetzt in der<br />
Praxis umgesetzt werden muss.<br />
Rollenverständnis<br />
Das FüUstgKdoBw hat seine Rolle als zentraler<br />
Kompetenzträger für die Aufgabe<br />
FüUstgBw angenommen und wird sich aktiv<br />
in die Verfahren des Ausrüstungs- und<br />
Nutzungsprozesses (CPM nov.), in die Zukunftsentwicklung<br />
der Bundeswehr sowie<br />
das Fähigkeitsmanagement und die Prozesse<br />
der Einsatzvorbereitung einbringen. Das<br />
FüUstgKdoBw wird entscheidenden Anteil<br />
an der Weiterentwicklung der Führungsunterstützung<br />
haben. Es wird die Forderungen<br />
an die FüUstg aus Sicht der Streitkräfte<br />
bündeln. Eine Aufgabe, die in der neuen<br />
Struktur insbesondere in der Rolle „Supply<br />
Manager IT-SysBw“ wahrgenommen<br />
Pers<br />
SprDst<br />
SASPF<br />
MilSich<br />
TrPsych*<br />
LSO**<br />
Führung<br />
Log<br />
Verw<br />
FüUstg<br />
RB<br />
UstgPers<br />
GleiB<br />
CON<br />
* Wahrnehmungsdienstposten<br />
** Wahrnehmungsdienstposten,<br />
Dienstleistung im KdoSKB<br />
Ausb/Org<br />
Stab FüUstgKdoBw<br />
Weiterentwicklung<br />
Grdlg<br />
FüUstgBw<br />
Grdlg<br />
IT-SysBw<br />
Grdlg<br />
RessMgmt<br />
Kommandeur<br />
wird. Die Unterstützung von Joint- und<br />
Combined-Einsätzen ist hier der Maßstab.<br />
Die Optimierung des Gesamtsystems wird<br />
in den neuen Prozessen für die FüUstg Priorität<br />
haben.<br />
In der SKB wird die fachliche Kompetenz für<br />
die FüUstg der Bundeswehr konzentriert. In<br />
den militärischen Organisationsbereichen<br />
verbleiben nur diejenigen Elemente, die<br />
für den Betrieb und die Weiterentwicklung<br />
organisationsbereichs- und aufgabenspezifischer<br />
IT-Services erforderlich sind. Das<br />
FüUstgKdoBw wird die Prozesse gemeinsam<br />
mit diesen Bereichen weiter optimieren.<br />
Für schnelles Reagieren in krisenhaften<br />
Situationen wird es eindeutige betriebliche<br />
Prozesse und klar definierte Zuständigkeiten<br />
geben.<br />
Auch bei den Überlegungen zu einer Folgelösung<br />
des IT-Projekts HERKULES bringt<br />
sich das FüUstgKdoBw ein. Es bewertet<br />
aus Sicht des Supply Managers IT-SysBw,<br />
des für die Weiterentwicklung<br />
Verantwortlichen<br />
und des Gesamtverantwortlichen<br />
für den Betrieb,<br />
die einzelnen Modelle<br />
für eine Folgelösung.<br />
Für das<br />
BMVg wird es die<br />
Sicht der Streitkräfte<br />
– übrigens nicht<br />
nur für dieses Projekt<br />
– bündeln und,<br />
wo immer möglich,<br />
einvernehmlich abstimmen.<br />
Das FüUstgKdoBw<br />
ist aufgestellt. Die<br />
Zusammenführung<br />
von Aufgabe, Verantwortung<br />
und<br />
Kompetenz für<br />
ChdSt<br />
Einsatz<br />
StvKdr<br />
StQ<br />
Einsatzplanung<br />
& -auswertung<br />
Einsatzsteuerung<br />
Einsatzbefähigung<br />
Ausbildung<br />
FüUstgBw<br />
WE SKgem<br />
Ausb FüUstgBw<br />
FZ/FFSt<br />
IT-AusbBw<br />
RessMgmt<br />
Ausb FüUstgBw<br />
den Einsatz und Betrieb des IT-Systems der<br />
Bundeswehr wird damit konsequent fortgeführt.<br />
Der Erfolg wird entscheidend von<br />
der Verfügbarkeit qualifizierten Personals<br />
und der Bereitstellung der erforderlichen<br />
Ressourcen für die Weiterentwicklung der<br />
materiellen Fähigkeiten abhängen.<br />
Satellitenkommunikation für die weitreichende<br />
Anbindung, verschlüsselte Funkund<br />
Kommunikationsnetze für die unterste<br />
taktische Ebene, Werkzeuge für ein professionelles<br />
IT-Servicemanagement oder<br />
die Harmonisierung der Führungsinformationssysteme<br />
mit Core Services aus der NA-<br />
TO sind nur einige Beispiele für Aktivitäten,<br />
die unmittelbar anstehen.<br />
Das FüUstgKdoBw ist auf seine vielfältigen<br />
Aufgaben gut vorbereitet. Es kommt nun<br />
darauf an, den innovativen Ansatz der Fähigkeitskommandos<br />
in der Bundeswehr<br />
mit Leben zu füllen und ihn auf allen Ebenen<br />
zu unterstützen.
RÜSTUNG & TECHNOLOGIE<br />
Wirkung auf größere Distanzen<br />
Jan-Phillipp Weisswange<br />
(Foto: U.S. Army)<br />
Sichere Treffer auf weite Distanz sind nicht nur eine Frage der Waffen,<br />
Munition, Optik und Optronik, sondern auch der Einsatzkonzepte und<br />
vor allem der Ausbildung.<br />
Im Sommer 2012 ging ein Rauschen durch<br />
den deutschen Blätterwald: Der Bundesrechnungshof<br />
beklagte Mängel bei der<br />
Wirksamkeit der Bundeswehr-Handwaffen.<br />
Es gäbe kein Konzept und mitunter<br />
würden untaugliche Gewehre beschafft.<br />
Insbesondere die Treffsicherheit sowie die<br />
Wirkung im Ziel auf längere Distanzen jenseits<br />
der 300 Meter seien unzureichend.<br />
Bei genauerer Betrachtung wärmte die<br />
Bonner Behörde mit den spitzen Bleistiften<br />
lediglich die in der NATO seit den 1960er<br />
Jahren geführte Debatte über die Wirksamkeit<br />
ihres jüngeren Standardkalibers<br />
5,56 x 45 mm (alias .223 Remington) gegenüber<br />
ihrem älteren 7,62 x 51 mm (.308<br />
Winchester) auf. Aber immerhin forderten<br />
nun selbst Oppositionspolitiker medieneffektiv,<br />
den deutschen Soldaten wirksamere<br />
Handwaffen auszugeben. Das ist sicherlich<br />
zu begrüßen, denn im Feuergefecht geht<br />
Wirkung vor Deckung. Doch die Wirksamkeit<br />
des Einzelschützen auf längere Distanzen<br />
ist in erster Linie eine Frage der Einsatzkonzepte<br />
sowie vor allem der Ausbildung.<br />
Heutige Handwaffenkonzepte müssen die<br />
Wechselwirkungen zwischen <strong>Technik</strong>, Taktik<br />
und Training berücksichtigen.<br />
Spezialisierungsstufen der<br />
Schützen<br />
Grob lassen sich drei unterschiedliche Spezialisierungsstufen<br />
für den gezielten Einzelschuss<br />
auf weite Distanzen unterscheiden:<br />
der Sturmgewehrschütze, der Zielfernrohrschütze<br />
und der Scharfschütze.<br />
Das Sturmgewehr bildet die Standardbewaffnung<br />
auf dem Gefechtsfeld. Eine<br />
gründliche Ausbildung vorausgesetzt, kann<br />
der Sturmgewehrschütze mit gezielten Einzelschüssen<br />
auf 300 Meter und mehr treffen<br />
– entgegen aller Unkenrufe auch mit<br />
dem G36 und das auch noch nach mehreren<br />
Magazinen! Gemäß innovativer Schießausbildungskonzepte<br />
– etwa bei der schweizerischen<br />
Schießschule NDS entstandenen<br />
„Sniping 4th Generation (S4G)“ – kann er<br />
sogar auf noch höhere Distanzen wirken.<br />
Als Richtgröße sollte dabei der „infanteristische<br />
Halbkilometer“ gelten, den US-Major<br />
Thomas P. Ehrhart in seiner 2009 erschienenen<br />
Schrift „Increasing Small Arms Lethality<br />
in Afghanistan – Taking back the Infantry<br />
Half Kilometer“ gefordert hatte. „Schwere<br />
Sturmgewehre“ in größeren Kalibern versprechen<br />
hier natürlich bessere Wirkung.<br />
Das in den USA erdachte Konzept des<br />
„Squad Designated Marksman“ (SDM)<br />
hat sich inzwischen in vielen NATO-Streitkräften<br />
durchgesetzt. Dieser „Zielfernrohrschütze<br />
der Infanteriegruppe“ führt<br />
ein zumeist modifiziertes Standardgewehr<br />
samt einfachem Zielfernrohr („Designated<br />
Marksman Rifle, DMR). Ein kurzer Lehrgang<br />
vermittelt die erforderlichen Fertigkeiten,<br />
auf Entfernungen jenseits der 300<br />
Meter zu treffen. Die Einsatzreichweite<br />
liegt bei 600 bis 800 Metern.<br />
Der heutige Scharfschütze (sniper) stellt<br />
schließlich die höchste Spezialisierung dar.<br />
Er durchläuft deutlich gründlichere und längere<br />
Ausbildungen, operiert weitgehend<br />
eigenständig, führt meist ein Präzisions-<br />
Repetiergewehr und dazu deutlich höherwertige<br />
Optik, Optronik und Funkausstattung<br />
mit sich und hat einen ebenfalls als<br />
Scharfschützen ausgebildeten Beobachter<br />
(Spotter) bei sich. Je nach Bewaffnung<br />
kann ein Scharfschützentrupp auf bis zu<br />
rund 1.800 Meter wirken. Und höhere Distanzen<br />
sind verbrieft. Der U.S. Navy SEAL<br />
Chris Kyle erzielte im Irak-Einsatz seinen<br />
weitesten Treffer auf 1.920 Meter, und der<br />
britische Corporal of Horse Craig Harrison<br />
schaltete im November 2009 in der afghanischen<br />
Provinz Helmand auf 2.475 Meter<br />
zwei feindliche MG-Schützen aus.<br />
Sturmgewehre<br />
Squad Designated Marksman mit M14 Enhanced Battle Rifle<br />
Nahezu alle NATO-Staaten halten weiter<br />
am Sturmgewehr in 5,56 x 45 mm fest.<br />
Die Gründe hierfür liegen vor allem in der<br />
Gewichtsersparnis. Die macht sich sowohl<br />
beim Einzelschützen (mehr Munition am<br />
Mann) als auch beim Nachschub für ganze<br />
Einsatzkontingente (mehr Patronen bei<br />
gleichem Gewicht und Transportraum)<br />
bemerkbar. Zudem entwickelt das kleinere<br />
Kaliber weniger Rückstoß, was sich positiv<br />
auf die Trefferergebnisse auswirkt. Gute<br />
Trefferergebnisse lassen sich freilich durch<br />
entsprechende Ausbildung und Inübunghaltung<br />
auch mit 7,62 x 51 mm bewerkstel-<br />
90 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · März 2013
RÜSTUNG & TECHNOLOGIE <br />
leer zwischen fünf und sieben Kilogramm.<br />
Großbritannien beschaffte ab Anfang 2010<br />
im Einsatzbedingten Sofortbedarf ebenfalls<br />
einen halbautomatischen Selbstlader<br />
in 7,62 x 51 mm. Das vom US-Hersteller<br />
Lewis Machine & Tool Company (LMT)<br />
hergestellte L129A1 verfügt über einen<br />
Matchlauf und Zweistufen-Druckpunktabzug<br />
sowie eine sechsfach vergrößernde<br />
Trijicon-Zieloptik ACOG 6 x 38.<br />
In der Bundeswehr erfolgte die Wiedergeburt<br />
des ZF-Schützen um 2008. Ausgangspunkt<br />
bildeten DMR-Truppenlösungen auf<br />
Basis des G3. Nach einem kurzen, aber<br />
turbulenten Ausschreibungsverfahren beligen.<br />
Diese Munition verschießen „schwere<br />
Sturmgewehre“ – etwa das beim U.S.<br />
Special Operations Command als MK-17<br />
geführte FN SCAR-Heavy oder das Heckler<br />
& Koch HK417, das u. a. in Frankreich,<br />
Großbritannien, Norwegen und bei der<br />
Bundeswehr (G27) zum Einsatz kommt.<br />
Die Modularität moderner Sturmgewehrfamilien<br />
etwa aus den Häusern Bushmaster/<br />
Remington (Adaptive Combat Rifle, ACR),<br />
Colt (LE901 Multikalibersystem), FB Radom<br />
(Modulowy System Broni Strzeleckiej,<br />
MSBS), FN Herstal (Special Operations<br />
Command Combat Assault Rifle, SCAR)<br />
oder Heckler & Koch (HK416/417-Familie)<br />
erleichtern entsprechende Ergänzungen<br />
des infanteristischen Werkzeugkastens.<br />
Zielfernrohrgewehre<br />
Anders als das „schwere Sturmgewehr“<br />
trägt das Zielfernrohr (ZF)-Gewehr oder<br />
„Designated Marksman Rifle“ ein ZF. Es ist<br />
auch auf das Kaliber 7,62 x 51 mm, aber<br />
meist nur auf Einzelfeuer ausgelegt.<br />
Zwischen 2000 und 2004 entstanden bei<br />
U.S. Army und U.S. Marine Corps verschiedene<br />
Modelle solcher Waffen. Diese „Enhanced<br />
Battle Rifles“ (EBR) basieren auf der<br />
ehemaligen Standardwaffe M14. Mit ZF<br />
wiegen diese M14 EBR je nach Ausführung<br />
Polnisches modulares Sturmgewehrkonzept MSBS<br />
schaffte die Bundeswehr dann das Heckler<br />
& Koch DMR762-MR als ZF-Selbstladegewehr.<br />
Das kam als G28 in die Truppe und<br />
befindet sich seit Mai 2012 im ISAF-Einsatz.<br />
Zum G28 gehört ein umfangreiches Zubehör,<br />
darunter das eigens entwickelte<br />
Schmidt & Bender ZF 3-20x50-G28 sowie<br />
ein Aimpoint Micro T1 als „Huckepack-Lösung“<br />
für schnelles Richten und den Kampf<br />
im Nahbereich. Mit der eigens entwickelten<br />
Munition 7,62 mm x 51 DMR gewährleistet<br />
die Waffe eine deutlich bessere Präzision<br />
– Zielsetzung 1,5 Winkelminuten (Minute<br />
of Angle, MOA; entspricht einem Streukreis<br />
von rund 45 mm auf 100 Meter). Und<br />
(Foto: Jan-P. Weisswange)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Designed for mission
(Foto: Jan-P. Weisswange)<br />
Waffenfamilie: G28 in Standard- und Patrouillenausführung sowie<br />
HK417k BW in der Konfiguration G27k mit Granatwerfermodul<br />
FN stellte Ende 2011 seine SCAR-H Precision<br />
Rifle vor. Sie verfügt über einen 508 mm<br />
langen, freischwingenden, verchromten<br />
und schwereren Matchlauf. Zu den weiteren<br />
Merkmalen zählen die durchgängige längere<br />
Picatinny-Schiene auf der Gehäuseoberseite,<br />
die die aneinandergereihte Montage<br />
von Zielfernrohr und Nachtsichtvorsätzen<br />
erlaubt. Weiterhin hat die SCAR-H PR ein<br />
Druckpunktabzugsmodul mit Matchabzug.<br />
FN garantiert ein Trefferbild von einer Winkelminute<br />
auf 100 Meter, was einem Streukreis<br />
von 29,08 mm entspricht.<br />
Die halbautomatischen DMR- und Scharfschützenwaffen<br />
lösen freilich die Repetiergewehre<br />
nicht völlig ab. So haben die<br />
britischen Streitkräfte weiterhin ihre Repetiergewehre<br />
L96 und L115 aus der Accuracy<br />
International Arctic Warfare Magnum-<br />
Modellreihe im Einsatz. Die Bundeswehr<br />
hält am G22 aus gleichem Hause fest. Und<br />
die U.S. Army führte beispielsweise eine<br />
M24E1 Enhanced Sniper Rifle (verbesserte<br />
Scharfschützenbüchse) im Kaliber .300<br />
Winchester Magnum (7,62 x 67 mm) ein.<br />
Die erhielt inzwischen die Bezeichnung<br />
XM2010. Standardmäßig trägt sie ein Leupold-Zielfernrohr<br />
6,5–20×50Mark 4.<br />
Inzwischen setzt sich immer mehr das<br />
Kaliber .338 Lapua Magnum alias 8,6 x<br />
70 mm als Scharfschützenstandard durch,<br />
da es ausgezeichnete Präzision und Wirkung<br />
auf Reichweiten von bis zu 1.600<br />
Metern bietet. So sucht das U.S. Special<br />
selbst mit der Standardpatrone DM11 sind<br />
auf 300 Meter Kopf- und auf 600 Meter<br />
Manntreffer problemlos möglich.<br />
HK bietet für sein G28 einen „Ergänzungssatz<br />
Schalldämpfer“ sowie einen „Ergänzungssatz<br />
Patrouille“ an. Letzterer besteht<br />
aus kurzem Handschutz, ZF Schmidt &<br />
Bender 1-8x24-G28 PMII Short Dot, Trageriemen<br />
sowie einer schlanken Schulterstütze.<br />
Damit erweist sich das G28 als<br />
leichter und führiger. Denn die ursprüngliche<br />
Konfiguration spielt durch ihre hochwertige<br />
Ausstattung, aber auch durch ihr<br />
Gewicht schon eher in der Liga halbautomatischer<br />
Scharfschützengewehre.<br />
Scharfschützengewehre<br />
Solche „Semi Automatic Sniper Systems<br />
(SASS)“ setzen die US-Streitkräfte bereits<br />
seit den frühen 1990er Jahren ein. Ab 2005<br />
lief das Knights Armament M110 SASS zu.<br />
Das halbautomatische Selbstladegewehr<br />
im Kaliber 7,62 x 51 mm soll bei der U.S.<br />
Army die auf dem Repetiergewehr Remington<br />
700 basierende M24 und bei dem<br />
U.S. Marine Corps die ebenfalls auf der Remington<br />
700 basierende M40 ergänzen<br />
und ältere EBR ablösen.<br />
92 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
McMillan ALIAS in der CS5-Version (Concealed Subsonic/Supersonic Suppressed<br />
Sniper System) mit integriertem Schalldämpfer in .308<br />
Die Munitionsfrage<br />
Aus militärischer Sicht beschränkt sich die Frage nach leistungsfähiger Munition weitgehend<br />
auf die Wahl geeigneter Kaliber. Im Gegensatz zum polizeilichen Präzisionsschützen<br />
bestehen für den militärischen Anwender nämlich größere Einschränkungen<br />
bei der Munitionsauswahl. Denn nach herrschender Auslegung des Kriegsvölkerrechts<br />
darf er lediglich Vollmantelmunition einsetzen.<br />
Zielfernrohr-Selbstladegewehre verfügen meist über das klassische NATO-Kaliber 7,62<br />
x 51 mm. Bei den Scharfschützengewehren setzt sich mehr und mehr das Kaliber .338<br />
Lapua Magnum (8,6 x 70 mm, Anfangsgeschwindigkeit 915 m/sec, Reichweite bis<br />
1.600 m) durch. Standard-Sturmgewehre verschießen derzeit mit Masse das Kaliber<br />
5,56 x 45 mm. Als Alternative zu schweren Varianten in 7,62 x 51 mm gelten sogenannte<br />
Mittelkaliber. Viele US-Hersteller scheinen sich auf die Patrone .300 Blackout<br />
(7,62 x 35 mm) einzuschießen. Deutscherseits könnte man durchaus einen Faden der<br />
kriegserfahrenen Bundeswehr-Gründerväter aufgreifen und die Patrone 7,92 x 33 mm<br />
des Sturmgewehrs 44 zur Diskussion stellen. Aber die NATO-Standardisierung einer<br />
Mittelkaliberpatrone oder gar ein Kaliberwechsel lassen sich derzeit nicht absehen.<br />
Zumal dieser Munitionstyp aus den derzeit populären kurzläufigeren Sturmgewehren<br />
kaum mehr Wirkung bringen dürfte, als die derzeit meistgenutzte 5,56 x 45 mm-<br />
Patronen.<br />
(Foto: Jan-P. Weisswange)
RÜSTUNG & TECHNOLOGIE <br />
Operations Command<br />
derzeit ein<br />
Scharfschützen-<br />
Repetiergewehr<br />
in diesem Kaliber.<br />
Unter den Bewerbern<br />
für dieses „Precision Sniper<br />
Rifle (PSR)“-Projekt finden sich klangvolle<br />
Namen: Accuracy International (AX338),<br />
Armalite (AR-30), Ashbury (ASW338), Barrett<br />
(MRAD), Beretta (Sako TRG M10), FNH<br />
(Foto: FN Herstal)<br />
FN SCAR-H Tactical<br />
Precision Rifle<br />
99 mm) zum Einsatz. Als Halbautomat hat<br />
sich dabei das Barrett M82 durchgesetzt.<br />
Und bei den Repetierern sind in der NATO<br />
das Accuracy International AW50 sowie<br />
das PGM Hecate in Nutzung.<br />
(Foto: Jan-P. Weisswange)<br />
Sako TRG M-10 in .308 (o.) und .338 Lapua Magnum<br />
USA (Ballista, ein Unique Alpine), PGM<br />
(PGM338), Remington (Modular Sniper<br />
Rifle) oder SIG Sauer (Blaser Tactical 2).<br />
Viele Hersteller setzen bei ihren Scharfschützenwaffen<br />
gleich auf modulare Systeme, die<br />
sich in Minutenschnelle auf drei verschiedene<br />
Kaliber umrüsten lassen: .338 Lapua Magnum,<br />
.300 Winchester Magnum und .308<br />
Winchester. Das folgt<br />
sowohl einsatztaktischen<br />
als auch haushalterischen Gründen. So<br />
kann der Operator einerseits seine Waffe<br />
von einem Präzisionsgewehr für hohe<br />
Reichweiten in eine kürzere Variante für den<br />
Orts- und Häuserkampf umrüsten. Weiterhin<br />
lässt sich aufgrund der Modularität die<br />
Waffe für das Training mit der kostengünstigen<br />
.308 nutzen, während der Schütze im<br />
Einsatz die größeren, aber teureren Kaliber<br />
verschießen kann, auch wenn er hierfür<br />
natürlich andere ballistische Berechnungstabellen<br />
braucht. Für noch größere Reichweiten<br />
kommt das Kaliber .50 BMG (12,7 x<br />
Fazit<br />
Der kurze Überblick zeigt, dass es für die<br />
treffsichere Wirkung auf größere Distanzen<br />
etliche Optionen für einen zweckmäßigen<br />
Waffenmix gibt. Dieser sollte um schwere<br />
Sturmgewehre ergänzt werden.<br />
Es kommt daher vor allem auf die Ausbildung<br />
an. Bei aller Begeisterung für das<br />
(völlig zu Recht trainierte) Nahbereichsschießen<br />
dürfen klassische Schießfertigkeiten<br />
wie der gezielte Einzelschuss auf hohe<br />
Distanzen und weitere Tugenden wie Feuerdisziplin<br />
nicht in Vergessenheit geraten.<br />
Selbst die Standortschießanlagen mit ihren<br />
300-Meter-Bahnen bieten Gelegenheit,<br />
sich diesbezüglich in Übung zu halten. Dabei<br />
gilt: Nicht jeder Soldat muss ein Scharfschütze<br />
sein, aber ein guter Schütze, der<br />
mindestens seine Standardwaffen auf Distanzen<br />
von bis zu 500 Metern treffsicher<br />
einsetzen kann.<br />
<br />
Wenn es darauf ankommt.<br />
Auf unsere Munition ist Verlass.<br />
Unsere hochpräzisen Produkte<br />
ermöglichen eine wirk same<br />
Bekämpfung von unterschiedlichen<br />
Zielen in verschiedenen<br />
Situationen.<br />
Ihr Können verbunden mit unserer<br />
Munition ist unschlagbar!<br />
Besuchen Sie uns an der<br />
IWA & OutdoorClassics<br />
in Nürnberg, 8.–11. März 2013,<br />
Halle 7, Stand 117.<br />
RUAG Ammotec AG<br />
sales.ammotec@ruag.com<br />
www.ruag.com
Unternehmen & Personen<br />
genua mbh stärkt IT-Kompetenz<br />
Die genua mbh hat sich auf IT-<strong>Sicherheit</strong>slösungen<br />
spezialisiert. Das Unternehmen<br />
entwickelt Firewalls zum Schutz von Netzwerken,<br />
Lösungen zur verschlüsselten Datenübertragung<br />
via Internet, mobile Security-Lösungen<br />
sowie Fernwartungssysteme<br />
für Maschinenanlagen. Dabei geht es um<br />
IT-Lösungen mit hohen <strong>Sicherheit</strong>sanforderungen<br />
für die Industrie, Behörden und<br />
Bundeswehr. Die Firewalls genugate und<br />
genuscreen sind vom Bundesamt für <strong>Sicherheit</strong><br />
in der Informationstechnik in der<br />
anspruchsvollen Stufe EAL 4+ zertifiziert,<br />
und die genugate ist wegen des unüberwindbaren<br />
Selbstschutzes zusätzlich als<br />
Highly Resistant eingestuft – als einzige<br />
Firewall weltweit. Diese Leistungen sind nur<br />
durch eine gute Betriebskultur zu erreichen.<br />
Das Unternehmen hat im Wettbewerb<br />
„Beste Arbeitgeber in der IT 2013“ unter<br />
87 IT-Firmen den 10. Platz erzielt. „Starre<br />
Hierarchiegrenzen würden die schnelle Umsetzung<br />
guter Ideen bremsen. Wir setzen<br />
dagegen auf Teamarbeit in kleinen Gruppen<br />
mit kurzen Entscheidungswegen, damit sich<br />
alle Kollegen einbringen und Verantwortung<br />
übernehmen können“, bekräftigte Dr.<br />
Michaela Harlander, Geschäftsführerin der<br />
genua mbh.<br />
(ds)<br />
HIL fährt mit BwFuhrparkService<br />
Die BwFuhrparkService GmbH hat den<br />
Auftrag als Mobilitätsdienstleister für über<br />
350 Fahrzeuge der HIL Heeresinstandsetzungslogistik<br />
erhalten. BwFuhrparkService<br />
stellt neben Transportern auch alle Pkw und<br />
Flurförderzeuge. Weiterhin übernimmt die<br />
Gesellschaft viele Bestandsfahrzeuge der<br />
HIL GmbH in das Datenmanagement, darunter<br />
weitere Flurförderzeuge, Transporter<br />
und teilmilitarisierte Lkw. Anfang Dezember<br />
wurden die ersten neuen Fahrzeuge an<br />
die HIL übergeben.<br />
(gwh)<br />
Diehl-Flugkörper in Indien<br />
Auf der Aero India 2013 in Bangalore (6.<br />
bis 10. Februar) präsentierte Diehl Defence<br />
eine Auswahl aus seinem Programm moderner<br />
Flugkörper, die u.a. den Bedarf der<br />
indischen Luftwaffe decken könnte. Dazu<br />
gehören IRIS-T, einer der modernsten<br />
Luft/Luft-Lenkflugkörper, mit dem Kampfflugzeuge<br />
in zehn Nationen ausgestattet<br />
werden, der Seezielflugkörper RBS15 Mk3,<br />
der in die deutsche und polnische Marine<br />
eingeführt und auch als Luft/Schiff-Version<br />
für moderne Kampfflugzeuge angeboten<br />
wird, sowie die HOchleistungs-Spreng-<br />
BOmbe HOSBO, als Prototyp eines modularen<br />
Gleitflugkörpersystems zur Bekämpfung<br />
stationärer und mobiler Boden- und<br />
Seeziele mit skalierbarer Wirkung, GPS/<br />
INS-Lenkung und elektro-optische Sensoren<br />
für hohe Präzision.<br />
(gwh)<br />
Rolls-Royce Jahresergebnisse<br />
Im Geschäftsjahr 2012 stiegen der<br />
Auftragsbestand um vier Prozent, der<br />
operative Umsatz um acht und der<br />
operative Gewinn um 24 Prozent. 2012<br />
konnte eine Rekordzahl an Antriebssystemen<br />
u.a. für Großraumflugzeuge<br />
und Marineschiffe ausgeliefert werden.<br />
Im Geschäftsbereich „Militärische<br />
Luftfahrt“ wurde die STOL-Variante<br />
(Short Take Off and Vertical Landing)<br />
des Joint Strike Fighters F-35B beim U.S.<br />
Marine Corps in Betrieb genommen,<br />
die Auslieferung an das britische Verteidigungsministerium<br />
ist angelaufen.<br />
Im Geschäftsbereich „Schiffstechnik“<br />
wurden Gasturbinenausrüstungen zur<br />
Energieerzeugung und für den Antrieb<br />
der Littoral Combat Ships der U.S. Navy<br />
und der britischen Flugzeugträger der<br />
QUEEN ELIZABETH-Klasse ausgeliefert.<br />
Für das Geschäftsjahr 2013 erwartet<br />
Rolls Royce in den Geschäftsbereichen<br />
„Zivile Luftfahrt“ und „Militärische<br />
Luftfahrt“ ein moderates Wachstum.<br />
Auch in der Schiffstechnik werden<br />
2013 Steigerungsraten erwartet. (ds)<br />
Eurocopter auf Wachstumskurs<br />
Eurocopter konnte im letzten Jahr mit einer Steigerung von 15 Prozent einen Rekordumsatz<br />
von insgesamt 6,3 Milliarden Euro verzeichnen. Der Auftragseingang<br />
des vergangenen Jahres markierte mit Nettobestellungen im Wert von 5,4 Milliarden<br />
Euro den dritten Anstieg in Folge seit dem Jahr 2010. Zu den Meilensteinen<br />
gehörten u.a. die Auslieferung der ersten NH90 TTH an die französischen und<br />
belgischen Heeresstreitkräfte sowie der UH Tiger in ASGARD-Konfiguration an die<br />
Bundeswehr, die anschließend nach Afghanistan verlegt wurden. Die Bundeswehr<br />
erhielt darüber hinaus den NH90 TTH in der Konfiguration zur luftmedizinischen<br />
Evakuierung und die ersten leistungsgesteigerten CH-53GA. Für das Jahr 2013<br />
plant Eurocopter einen Auslieferungsanstieg um über 15 Prozent mit hohen Auslieferungsraten<br />
u.a. für den Transporthubschrauber NH90 und den Kampfhubschrauber<br />
Tiger. Außerdem soll das Support- und Servicegeschäft mit Wartung,<br />
Instandhaltung und Schulung vorangetrieben werden.<br />
(co)<br />
Netzwerk „UAS-Senso“<br />
EurA Consult in Aachen hat das Innovationsnetzwerk<br />
„UAS-Senso“ für die Entwicklung<br />
von Multisensor- und Missionsmanagement<br />
Systemen für unbemannte<br />
Flugsysteme für zivile UAS-Anwendungen<br />
gestartet. Im Rahmen von UAS-Senso sollen<br />
Innovationen auf dem Gebiet der Entwicklung<br />
spezialisierter Multisensor- und Missionsmanagementsysteme<br />
für Unmanned<br />
Aircraft Systems (UAS) und deren Einsatz in<br />
zivilen Bereichen entwickelt und wirtschaftlich<br />
weiter verwertet werden. (gwh)<br />
US-Verteidigungshaushalt unterzeichnet<br />
US-Präsident Barack Obama hat den „National<br />
Defense Authorization Act” mit seiner<br />
Unterschrift in Kraft gesetzt und damit<br />
Haushaltsmittel in Höhe von 633 Milliarden<br />
Dollar (475 Milliarden Euro) für das Pentagon<br />
freigegeben. 527,5 Milliarden Dollar<br />
sind für das Base Budget vorgesehen, mit<br />
dem der Grundbetrieb finanziert wird. Für<br />
Übersee-Einsätze stehen 88,5 Milliarden<br />
Dollar zur Verfügung und 17,8 Milliarden<br />
Dollar für Programme der Nationalen <strong>Sicherheit</strong><br />
in den Bereichen Energie und<br />
Nuklear-Einrichtungen. Damit ist u.a. der<br />
Einsatz in Afghanistan für ein weiteres Jahr<br />
gesichert. Wie sich etwaige Haushaltsrisiken<br />
in naher Zukunft auf den Etat auswirken,<br />
wurde nicht mitgeteilt. (gwh)<br />
Förderung für Bauhaus Luftfahrt<br />
Bauhaus Luftfahrt erhält ab Januar 2013<br />
eine institutionelle Förderung vom Bayerischen<br />
Wirtschaftsministerium in Höhe von<br />
1,5 Mio. Euro jährlich. Bislang wurde die<br />
Münchner Forschungseinrichtung auf Basis<br />
einer Projektförderung vom Freistaat unterstützt.<br />
„Das Bauhaus Luftfahrt hat sich<br />
seit seiner Gründung im Jahre 2005 zu einer<br />
hochangesehenen Institution auf dem<br />
Gebiet der Luftfahrtforschung entwickelt<br />
und leistet damit einen aktiven Beitrag, um<br />
die Vorreiterrolle Bayerns in der Luftfahrt<br />
zu sichern“, erklärte Bayerns Wirtschaftsminister<br />
Martin Zeil.<br />
(pp)<br />
IT-Infrastruktur für NATO-Hauptquartiere<br />
Cassidian hat die IT-Infrastruktur an den<br />
NATO-Standorten Brunssum (NL), Heidelberg,<br />
Ramstein und Wesel für insgesamt<br />
3.000 Nutzer geliefert und schlüsselfertig<br />
installiert. Auftraggeber war die Bundesrepublik<br />
Deutschland, die die Beschaffung<br />
im Auftrag der NATO durchführte.<br />
Die abschließende Systemabnahme erfolgte<br />
durch das BAAINBw. Die vorhandene<br />
Netzwerkinfrastruktur wurde mit<br />
gleichzeitiger Erhöhung der Kapazität<br />
und Bandbreite modernisiert. Server-Infrastruktur<br />
in Blade-Technologie, Speicherund<br />
Sicherungssystemen der neuesten<br />
Generation und Virtualisierung kennzeich-
Astrium mit weiterer Ariane-<br />
Entwicklung beauftragt<br />
Astrium, die Raumfahrtsparte der EADS,<br />
hat von der europäischen Weltraumorganisation<br />
ESA Verträge in Höhe von 108 Mio.<br />
Euro für die Entwicklung der Trägerrakenen<br />
das neue Netzwerk. Hinzu kam die<br />
Bereitstellung von Systemkomponenten<br />
wie Workstations, Laptops und Drucker<br />
sowie der Aufbau eines sicheren Druckersystems<br />
(Secure Printing). (gwh)<br />
Tochtergesellschaft in Österreich<br />
gegründet<br />
Die auf Produkte und Dienstleistungen im<br />
<strong>Sicherheit</strong>ssektor spezialisierte BSW SE-<br />
CURITY AG eröffnete zum 1. Januar 2013<br />
eine Tochtergesellschaft in Hermagor/Kärnten<br />
in Österreich. Die Geschäftsaktivitäten<br />
wurden bereits aufgenommen und für die<br />
Marktbedürfnisse vor Ort ein spezifisches<br />
Produktesortiment zusammengestellt. Dazu<br />
gehören Lösungen im Zusammenhang<br />
mit mechanischen und elektronischen<br />
Fluchtweg-, Brand- und Alarmsicherungen<br />
gepaart mit vernetzten Zutrittskontrollsystemen<br />
für Objekte. BSW SECURITY wird in<br />
absehbarer Zeit auch ihr Produktesortiment<br />
für die Nachbarländer aufbauen und vom<br />
Standort Hermagor aus vertreiben. (wb)<br />
P+S Werften nehmen Betrieb<br />
wieder auf<br />
Der Schiffbau auf den insolventen P+S<br />
Werften geht weiter. Während die Produktion<br />
der Peene-Werft in Wolgast, die mit<br />
Wirkung zum 1. Mai 2013 an die Lürssen-<br />
Gruppe verkauft wurde, durchgehend fortgeführt<br />
wurde, hat auch die Volkswerft in<br />
Stralsund am 21. Januar 2013 den Betrieb<br />
wieder aufgenommen. Das auf der Peene-<br />
Werft für Schwedens Küstenwache gebaute<br />
Küstenwachschiff soll Anfang März<br />
2013 abgeliefert werden. Auch das zweite<br />
Küstenwachschiff liegt im Zeitplan und soll<br />
Ende März 2013 übergeben werden. Die<br />
P+S Werften haben in der Vergangenheit<br />
immer auch Aufträge für Schiffe und Boote<br />
der Deutschen Marine erhalten. (ds)<br />
<strong>Sicherheit</strong>skonferenz mit<br />
TETRA geschützt<br />
Für die Münchener <strong>Sicherheit</strong>skonferenz<br />
wurde das TETRA-Funknetz der<br />
Stadt München an die erhöhten <strong>Sicherheit</strong>sanforderungen<br />
und den größeren<br />
Bandbreitenbedarf angepasst.<br />
Dafür wurde eine Cassidian Basisstation<br />
TB3c der Stadtwerke München für<br />
das <strong>Sicherheit</strong>s- und Konferenzpersonal<br />
sowie für logistische Unterstützungsleistungen<br />
eingesetztes Personal<br />
der Bundeswehr installiert und an das<br />
bestehende TETRA-Netz angeschlossen.<br />
Für die besondere <strong>Sicherheit</strong>sstufe<br />
wurden zusätzliche Authentifizierung<br />
und Luftschnittstellen-Verschlüsselung<br />
realisiert. Damit wurde über<br />
dieses Netz während der gesamten<br />
Veranstaltung sichere Kommunikation<br />
gewährleistet. Als Endgeräte für das<br />
<strong>Sicherheit</strong>spersonal stellten die Stadtwerke<br />
München erstmals die neuen,<br />
weltweit kleinsten und leichtesten TE-<br />
TRA-Funkgeräte TH1n von Cassidian<br />
zur Verfügung, die sich insbesondere<br />
für verdeckte Einsätze eignen. (gwh)<br />
halten und durch das BMVg verwaltet.<br />
Im Rahmen der Materialerhaltungsverantwortung<br />
für ausgewählte Landgeräte<br />
der Bundeswehr stellt die HIL GmbH die<br />
Instandsetzungsplanung, -steuerung und<br />
-durchführung für gegenwärtig ca. 7.000<br />
Geräte sicher.<br />
(gwh)<br />
IR-<strong>Technik</strong> von Sofradir<br />
Sofradir, das Joint Venture von Thales und<br />
Sagem Defense Sécurité, übernimmt von<br />
den Mutterkonzernen die IR-Detektorentwicklung<br />
und -Fertigungsstätten mit<br />
Infrarot-Technologien, die ursprünglich für<br />
eigene interne Zwecke entwickelt wurden.<br />
Hierzu gehören Indiumantimonid- (InSb-)-<br />
Verfahren, QWIP-<strong>Technik</strong> (Quantum Well<br />
Infrared Photodetector) als auch InGaAs-<br />
Verfahren (Indiumgalliumarsenid). Sofradir<br />
war bisher auf gekühlte MCT-Infrarotsensoren<br />
aus Quecksilber-Cadmium-Tellurid<br />
(HgCdTe) spezialisiert. Mit den neu übergebenen<br />
Technologien wird Sofradir zu einem<br />
der wenigen Hersteller, die alle Verfahren<br />
gekühlter und ungekühlter Detektoren für<br />
das gesamte IR-Spektrum abdecken. (gwh)<br />
HIL setzt weiter Landsysteme<br />
instand<br />
Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen<br />
der HIL Heeresinstandsetzungslogistik<br />
GmbH und der Bundeswehr wird zunächst<br />
bis Ende 2014 fortgesetzt. Eine entsprechende<br />
Verlängerung des Leistungsvertrags<br />
aus 2005 wurde am 30. Januar 2013<br />
vom Vizepräsidenten des Bundesamtes für<br />
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung<br />
der Bundeswehr, Thomas Wardecki,<br />
und den Geschäftsführern der Gesellschaft,<br />
Winfried Zimmer und Jürgen Simon,<br />
unterzeichnet. Im Vorfeld der Vertragsverlängerung<br />
hatten sich die Industriepartner<br />
aus der Gesellschaft zurückgezogen. Die<br />
Gesellschaftsanteile der HIL GmbH werden<br />
seit dem 11. Januar 2013 zu 100 Prozent<br />
von der Bundesrepublik Deutschland geten<br />
Ariane 6 und Ariane 5 ME erhalten. Im<br />
Rahmen dieser Aufträge wird Astrium die<br />
ersten Entwurfs- und Machbarkeitsstudien<br />
für die künftige Ariane 6 erstellen. Die auf<br />
sechs Monate angelegte Studie soll vor Anlauf<br />
der industriellen Entwicklung das Konzept,<br />
die Architektur und die wesentlichen<br />
Eigenschaften der Rakete festschreiben,<br />
deren Grundzüge bereits festgelegt wurden.<br />
Ariane 6 soll eine modular konfigurierbare<br />
Rakete zur Beförderung von 3 bis 6,5 t<br />
Nutzlast in den geostationären Orbit werden<br />
und dabei einen Kostenrahmen von 70<br />
Mio. Euro pro Start bei gleicher <strong>Sicherheit</strong><br />
wie Ariane 5 einhalten. Ariane 5 ME (Midlife<br />
Evolution) ist eine modernisierte Ariane<br />
5 mit 20 Prozent höherer Nutzlast. (pp)<br />
Technologiemanagement bei<br />
Rolls-Royce ausgezeichnet<br />
Rolls-Royce, globaler Anbieter von Antriebssystemen,<br />
wurde vom Fraunhofer Institut<br />
für Produktionstechnologie (IPT) als eines<br />
der im Technologiemanagement besten<br />
Unternehmen in Europa ausgezeichnet.<br />
Die feierliche Verleihung des „Successfull<br />
Practice Award“ fand am 30. Januar 2013 in<br />
Vaals in der Nähe von Aachen statt. Als Unternehmen,<br />
das in den vergangenen zehn<br />
Jahren mehr als 7,5 Mrd. Pfund (rd. 8,77<br />
Mrd. Euro) in Forschung und Entwicklung<br />
investiert hat, wurde Rolls-Royce besonders<br />
für seine langfristige Herangehensweise an<br />
die Technologieentwicklung gewürdigt. Bei<br />
dem Unternehmen wurde nicht nur eine<br />
Kultur der Offenheit festgestellt, die Innovationen<br />
fördert, sondern auch die Fähigkeit,<br />
Ressourcen zu erkennen und in erfolgreiche<br />
Technologien zu kanalisieren. (pp)<br />
Europäischer Infanterist<br />
der Zukunft<br />
Die EDA hat ein Studienprogramm zur Untersuchung<br />
der vorhandenen europäischen<br />
Infanteristen-Systeme in Auftrag gegeben.<br />
Die vier Hauptthemen sind dabei: Aufklärung,<br />
Energieversorgung, Menschliche<br />
Faktoren und Überlebensfähigkeit. Die<br />
Studie will nun in diesen Themenfeldern<br />
sowohl einen Sachstandsbericht erarbeiten<br />
als auch Projekte und zukünftige Programme<br />
auf ihre mögliche Wirksamkeit<br />
und Integrationsfähigkeiten untersuchen.<br />
Ziel ist die Erstellung eines Leitfadens für<br />
künftige (eventuell gesamteuropäische)<br />
Infanteristen-Systeme. Mittelfristig sollen<br />
aus dieser Studie auch Technologieempfehlungen<br />
für die gesamten europäischen<br />
Streitkräfte entstehen.Noch bis<br />
zum 12. April dieses Jahres läuft die Ausschreibung,<br />
an der sich Unternehmen aus<br />
diesen acht europäischen Staaten bewerben<br />
können.<br />
(df)<br />
März 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
109
ÄUSSERE & ZIVILE SICHERHEIT <br />
Stromausfall durch virenverseuchte<br />
Kontrollsysteme<br />
Dorothee Frank<br />
Die wichtigsten Elemente des täglichen Lebens, allen voran Strom und Wasser, sind gleichzeitig – aus<br />
Sicht der IT-<strong>Sicherheit</strong> betrachtet – die verwundbarsten Infrastrukturen. In den USA zeigten aktuell zwei<br />
Beispiele, wie wenig Bedeutung die Betreiber von Kraftwerken dem sicheren Umgang mit ihren Systemen<br />
beimessen.<br />
Als die Software für Kraftwerke entstand,<br />
lag die Informationstechnik<br />
noch in den Kinderschuhen. Dementsprechend<br />
ging man von Insellösungen<br />
aus. Jedes Kraftwerk für sich, ohne Verbindung<br />
zur Außenwelt, dieses System schien<br />
ein Garant für die Abwehr von Malware<br />
– also schädlicher Software wie Trojaner<br />
oder Würmer – zu sein.<br />
und dennoch fand sich eine reiche Vielfalt<br />
an Malware selbst in kritischen Systemen.<br />
Der erste Fall wurde bekannt, als der Mitarbeiter<br />
des Kraftwerks, der regelmäßig mit<br />
einem USB-Stick ein Back-Up der Kontrollsysteme<br />
durchführte, kurzzeitige Unterbrechungen<br />
des Systems feststellte. Darauf hin<br />
bat der Mitarbeiter die IT-Abteilung, den<br />
USB-Stick zu untersuchen. Sobald der Stick<br />
(Foto: Travis Thurston)<br />
Das Kraftwerk scheint ein entnetztes Bollwerk auch gegen Malware zu sein, aber schon ein einziger USB-Stick<br />
kann das Gesamtsystem ausfallen lassen<br />
Als zweiter <strong>Sicherheit</strong>sfaktor galt die Spezialsoftware.<br />
Denn wie viele Hacker oder<br />
Scriptkiddies kannten sich schon mit den<br />
entsprechenden Computersprachen aus.<br />
Also einerseits kaum vorhandenes für einen<br />
Angriff notwendiges Know-how, auf<br />
der anderen Seite keine Verbindung zur<br />
Außenwelt. Sicherer konnte ein System<br />
kaum sein, so der Glaube.<br />
Dieser Glaube hält sich – zumindest in<br />
Deutschland – noch heute. Als wichtigstes<br />
<strong>Sicherheit</strong>smerkmal der Kraftwerke<br />
wird weiterhin die Isolation der Systeme<br />
genannt. So fordern bekannte politische<br />
Größen, aber auch die Leiter von Stadtwerken,<br />
vor allen Dingen die Entnetzung der<br />
Wasser- und Stromversorgung. Mit dieser<br />
Abschottung sollen dann alle Gefahren<br />
beseitigt sein.<br />
Die USA haben allerdings andere Erfahrungen<br />
gemacht und aus früheren Fällen<br />
gelernt. Im U.S. Department of Homeland<br />
Security gibt es das „Industrial Control Systems<br />
Cyber Emergency Response Team”<br />
(ICS-CERT), dessen Mitarbeiter Spezialisten<br />
für Industriesysteme und die entsprechende<br />
Software sind. Denn nicht nur die<br />
Angreifer müssen erst einmal die Sprachen<br />
beherrschen, auch die helfenden IT-Fachkräfte<br />
gibt es nur in sehr begrenzter Zahl.<br />
Malware in kritischen<br />
Systemen<br />
In zwei aktuellen Fällen berichtet das ICS-<br />
CERT Team von Infektionen bei Stromversorgern.<br />
Beide Kraftwerke waren entnetzt<br />
mit dem Computer, der über eine aktuelle<br />
Antiviren-Software verfügte, verbunden<br />
wurde, meldete das System mindestens<br />
drei Infektionen.<br />
An dieser Stelle tauchen schon die ersten<br />
IT-<strong>Sicherheit</strong>slücken auf. Denn wieso<br />
kann ein normaler Mitarbeiter mit einem<br />
normalen USB-Stick auf kritische Systeme<br />
zugreifen. Sollte dies nicht in den Händen<br />
von Admins liegen. Und wieso fanden<br />
keine regelmäßigen Untersuchungen wenigstens<br />
des Sticks statt. Es schien auch<br />
keine <strong>Sicherheit</strong>slösung für den Computer<br />
zu bestehen, auf dem der Mitarbeiter die<br />
März 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
115
ÄUSSERE & ZIVILE SICHERHEIT<br />
(Foto: Adam Kliczek/Wikipedia)<br />
Ohne IT fließt auch bei einem der größten Bauwerke der Erde, dem<br />
Hoover-Damm, nicht mehr viel Strom<br />
Updates auf den Stick lud, sonst hätte dieser<br />
bei solch alter Malware bereits Alarm<br />
gegeben. Und mittlerweile existieren sogar<br />
Virenschutzlösungen für Industrieanlagen,<br />
die Sicherung des gesamten Systems ist also<br />
keine Unmöglichkeit mehr.<br />
Bei zwei Infektionen handelte es sich um<br />
normale Malware, die angesichts der Spezialsoftware<br />
der Systeme kaum Schaden anrichten<br />
konnte. Die dritte Meldung betraf<br />
allerdings „known sophisticated Malware“,<br />
so der Bericht des ICS-CERT. Es handelte<br />
sich also um eine bekannte Schadsoftware<br />
– in die engere Auswahl käme hier Stuxnet<br />
– die für Industrieanlagen entwickelt<br />
wurde. Da Stuxnet allerdings nicht gerade<br />
neu ist, hätte ein Virenschutz ihn erkannt<br />
und geblockt. Der Wurm hätte den Stick<br />
gar nicht erst infizieren dürfen.<br />
Säuberung auf eigene Gefahr<br />
Als das ICS-CERT-Team vor Ort eintraf,<br />
musste es sich erst einmal einen Überblick<br />
verschaffen. Mehrere Maschinen hatten<br />
wahrscheinlich Kontakt zu dem infizierten<br />
Stick gehabt. Alle diese Maschinen wurden<br />
untersucht und die Drives einer Tiefenanalyse<br />
unterzogen. Es gab bereits beim ersten<br />
Augenschein Anzeichen für die Infektion<br />
von zwei technischen Workstations mit<br />
dem Spezialvirus. Bei beiden Anlagen handelte<br />
es sich um für den Betrieb unentbehrliche<br />
Elemente.<br />
Die Detailanalyse zeigte nicht nur die tatsächliche<br />
Infektion dieser kritischen Systeme,<br />
sondern auch das Nicht-Vorhandensein<br />
eines weiteren Back-Ups. Die Säuberung<br />
musste also unter größter Vorsicht erfolgen,<br />
denn jeder Fehler hätte den Ausfall<br />
der Kontrollsysteme ohne die Möglichkeit<br />
einer Rückspiegelung nach sich gezogen.<br />
Die Fachkräfte des ICS-CERT-Teams zogen<br />
darauf hin den Hersteller des Kontrollsystems<br />
hinzu, um gemeinsam nach einer den<br />
Betrieb nicht gefährdenden Möglichkeit zu<br />
suchen. Nach der erfolgreichen Säuberung<br />
der Systeme ging es – wiederum gemeinsam<br />
mit dem Hersteller – um die Installation<br />
eines Virenschutzes.<br />
„Obwohl die Implementierung von Virenschutzlösungen<br />
in die Umgebung von<br />
Kontrollsystemen eine gewisse Herausforderung<br />
darstellt, wäre sie effektiv bei der<br />
Abwehr sowohl der normalen als auch der<br />
sophisticated Malware gewesen“, so die<br />
Mitarbeiter des ICS-CERT beim Abschlussbericht.<br />
Genau hier liegt allerdings das<br />
Problem: Die meisten Kraftwerksbetreiber<br />
haben nicht die Möglichkeiten, diese Herausforderung<br />
bei der Implementierung mit<br />
eigenen Kräften zu meistern. Und dieses<br />
Problem ist nicht auf die USA beschränkt,<br />
auch die deutschen häufig im Kommunalbesitz<br />
befindlichen oder als ÖPP organisierten<br />
Stadtwerke wären dazu nicht in<br />
der Lage.<br />
Jeder Stick ist willkommen<br />
Im zweiten Fall eines amerikanischen<br />
Stromversorgers wirkte sich die Infektion<br />
vom Kontrollsystem der Turbinen auf mindestens<br />
zehn weitere Elemente des Steuerungsnetzwerks<br />
aus. Als Virenträger ermittelte<br />
das ICS-CERT-Team auch hier einen<br />
USB-Stick und mangelnde <strong>Sicherheit</strong>svorschriften.<br />
Der <strong>Technik</strong>er eines Drittanbieters<br />
hatte mit einem Upgrade auch gleich<br />
die Malware mit installiert. Wieso der Stick<br />
ohne vorherige Virenprüfung an das System<br />
angeschlossen werden durfte ist kaum<br />
verständlich. Die Infektion führte zum dreiwöchigen<br />
Ausfall der Systeme und somit<br />
auch des gesamten Kraftwerks. Angesichts<br />
der hohen Auslastung aller Stromerzeuger<br />
ließ sich die Versorgung der Bevölkerung<br />
zu den Spitzenzeiten nicht mehr vollständig<br />
gewährleisten.<br />
Das ICS-CERT fordert aufgrund der bisherigen<br />
Erfahrungen die Einführung von<br />
IT-<strong>Sicherheit</strong>sstandards und besonders<br />
strenge Vorschriften für den Umgang mit<br />
allen Speichermedien, die von außen in<br />
das System eingebracht werden. Laut den<br />
Ergebnissen einer ersten Befragung des<br />
ICS-CERT gibt es allein in den USA rund<br />
7.200 solcher Devices, die sowohl regelmäßigen<br />
Kontakt mit den Steuerungssystemen<br />
als auch mit dem Internet haben.<br />
Wenigstens diese Devices, bei denen es<br />
sich meistens um USB-Sticks handelt, sollten<br />
vor jedem Einbringen in das System<br />
einer Untersuchung unterzogen werden,<br />
fordert das ICS-CERT. Auch durch die<br />
Installation von Updates mittels nur einmal<br />
beschreibbaren Speichermedien, also<br />
CDs oder DVDs, ließe sich der Schutz der<br />
IT-Systeme deutlich erhöhen. Die Implementierung<br />
eines Virenschutzes für das<br />
Gesamtsystem sei zwar ebenfalls wünschenswert,<br />
aber hier erkennen die Fachkräfte<br />
des CERTs durchaus die Grenzen<br />
des auch für sie Möglichen.<br />
Beide Beispiele – und das ICS-CERT könnte<br />
noch viele mehr nennen – zeigen deutlich,<br />
dass der frühere Glaube an die <strong>Sicherheit</strong><br />
der Kraftwerke nicht mehr gilt. Die Malware-Schreiber<br />
beherrschen mittlerweile<br />
auch die Sprachen der Spezialsysteme und<br />
es existieren entsprechende Bedrohungen.<br />
Die Entnetzung ist wiederum zwar ein an<br />
sich guter Gedanke, der allerdings nicht mit<br />
der Realität übereinstimmt.<br />
Angriffsziele Strom<br />
und Wasser<br />
Im Jahr 2012 versorgte das ICS-CERT insgesamt<br />
198 IT-Störungen in Industrieanlagen.<br />
In 41 Prozent der Fälle handelte es sich um<br />
Anlagen aus dem energieerzeugenden<br />
Bereich. An zweiter Stelle kamen mit 15<br />
Prozent bereits Anlagen aus dem Wasser-<br />
Sektor. Gerade die beiden wichtigsten Infrastrukturen,<br />
Strom und Wasser, waren<br />
also in den USA auch am häufigsten von<br />
IT-<strong>Sicherheit</strong>svorfällen betroffen. Da die<br />
Anlagen in den USA weder wesentlich älter<br />
sind noch über andere IT-Systeme oder<br />
„unbedarftere“ Mitarbeiter verfügen als<br />
die deutschen, ist die Grundtendenz durchaus<br />
übertragbar. Ebenso wie die Forderungen<br />
des ICS-CERT nach einem verbesserten<br />
<strong>Sicherheit</strong>sbewusstsein gerade im Umgang<br />
mit mobile Devices.<br />
<br />
116 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · März 2013