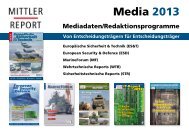Umschau - Europäische Sicherheit & Technik
Umschau - Europäische Sicherheit & Technik
Umschau - Europäische Sicherheit & Technik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Inhalt<br />
Seite 22<br />
Neuausrichtung des Heeres<br />
Wie geht es mit der Umsetzung der Reform weiter?<br />
Der Inspekteur des Heeres im Interview.<br />
� SICHERHEIT & POLITIK<br />
10 Transatlantische Beziehungen in schwieriger Zeit<br />
Andreas M. Rauch<br />
13 „Umfassend – Vernetzt – Strategisch“<br />
Interview mit Botschafter Dr. Hans-Dieter Heumann,<br />
Präsident der Bundesakademie für <strong>Sicherheit</strong>spolitik (BAKS)<br />
16 Tag der Veteranen: Die Diskussion behutsam führen<br />
Rolf Clement<br />
� BUNDESWEHR & STREITKRÄFTE INTERNATIONAL<br />
18 „Wofür Streitkräfte?“<br />
Omid Nouripour MdB<br />
22 „Richtschnur für die Neuausrichtung ist der Erfolg<br />
im Einsatz“<br />
Interview mit Generalleutnant Werner Freers,<br />
Inspekteur des Heeres<br />
28 Das Ausbildungs- und Schutzbataillon:<br />
Träger des Auftrags „Partnering“<br />
Jan Tilmann und Jochen Quitzau<br />
32 Air Surface Integration<br />
Ulrich Rapreger<br />
34 Feuerunterstützung im ISAF-Einsatz<br />
Dietmar Klos<br />
39 Zwei Nationen – ein Auftrag<br />
Deutsch-Niederländische Ausbildungskooperation<br />
Panzerhaubitze 2000<br />
Kai Menne<br />
40 Feldjäger und Öffentliche <strong>Sicherheit</strong><br />
Hans-Werner Wesch<br />
43 Heimat ganz nah:<br />
20 Jahre Feldpost im Einsatz<br />
Andreas Hügel<br />
4 <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · Juni 2012<br />
Seite 58<br />
Raketenartillerie<br />
Die Weiterentwicklung des Systems zu hoher Präzision<br />
und größerer Reichweite ist ein Paradigmenwechsel.<br />
47 Führungssystem der Marine<br />
Hannes Schroeder-Lanz<br />
52 Interesse an <strong>Technik</strong> wecken<br />
Neue Wege der National Flight Academy Pensacola<br />
Georg Mader<br />
� RÜSTUNG & TECHNOLOGIE<br />
55 Neuer Ausrüstungs- und Nutzungsprozess schafft<br />
klare Verantwortlichkeiten<br />
Interview mit Konteradmiral Wolfgang Bremer,<br />
Stellv. Abteilungsleiter AIN im BMVg<br />
58 Raketenartillerie im Wandel<br />
Thomas Weßling und Alexander Goeres<br />
62 Einsatzgruppenversorger<br />
Dieter Stockfisch<br />
66 Die Klasse 216: U-Boote für den weltweiten Einsatz<br />
Peter Hauschildt und Sven Kohsiek<br />
71 Wirkmittel der Wahl – Granaten als Vielzweckeffektoren<br />
Jan-Phillipp Weisswange<br />
76 Nachträgliche Härtung ungeschützter Container<br />
Marco Retsch<br />
78 Modulare Krankenpflegestation<br />
Gerhard Heiming
Seite 66<br />
Weltweiter Einsatz<br />
An U-Boote stellen sich neue Anforderungen.<br />
Die neue Klasse 216 könnte eine Antwort sein.<br />
80 Modularität im Marineschiffbau<br />
Dieter Stockfisch<br />
88 Galileo – das <strong>Europäische</strong> Satellitennavigationssystem<br />
Sven Kühberger<br />
� WIRTSCHAFT & INDUSTRIE<br />
95 EU-Vergaberecht<br />
Neuerungen für den Beschaffungsprozess<br />
Heiko Piesbergen<br />
97 „Der Predator B erfüllt die Forderungen<br />
der Luftwaffe“<br />
Interview mit Dipl.-Ing. Alexander Müller, Geschäftsführer<br />
von RUAG Aerospace Services GmbH<br />
100 Verteidigung und Öffentliche <strong>Sicherheit</strong><br />
Vorschau auf die Eurosatory 2012<br />
Gerhard Heiming und Eike Rhein<br />
103 Die Welt dreidimensional<br />
Lothar Schulz<br />
105 Rettungs- und <strong>Sicherheit</strong>stechnologie und Sensorik<br />
Hans Joachim Wagner<br />
112 Atemsauerstoff – Weltmarktführer B/E Aerospace<br />
Peter Preylowski<br />
Seite 117<br />
Bosnien-Herzegowina<br />
Instabil und eingeschränkt souverän: Die Probleme des<br />
Landes sind immer noch ungelöst.<br />
� ÄUSSERE & ZIVILE SICHERHEIT<br />
115 Muskelspiele im Pazifik<br />
Helmut Michelis<br />
117 Bosnien-Herzegowina<br />
Anne Schulz und Jörg Jacobs<br />
� RUBRIKEN<br />
3 Kommentar<br />
6 <strong>Umschau</strong><br />
70 Fraunhofer INT: Neue Technologien<br />
83 IT News & Trends<br />
84 Informationen – Nachrichten – Neuigkeiten aus aller Welt<br />
93 Typenblatt<br />
99 Impressum<br />
108 Blick nach Amerika<br />
110 Unternehmen & Personen<br />
119 Nachrichten aus Brüssel<br />
120 Clausewitz-Gesellschaft<br />
124 Gesellschaft für Wehr- und <strong>Sicherheit</strong>spolitik<br />
128 Bücher<br />
130 Gastkommentar<br />
„Deutschland wird immer häufiger als unzuverlässiger Partner wahrgenommen; viel<br />
außenpolitisches Potenzial bleibt schlicht ungenutzt. Auch sind nationale Alleingänge<br />
bei der Planung und Reform von Verteidigungsstrukturen zwar keine deutsche Eigenart,<br />
verstärken aber zusehends die Schwierigkeit, sich auf europäischer Ebene noch abstimmen<br />
und koordinieren zu können.“<br />
Omid Nouripour MdB, „Wozu Streitkräfte?“, Seite 18<br />
Juni 2012 · <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
5
Kommentar<br />
NATO-Gipfel im Schatten<br />
der Wirtschaftskrise<br />
Die Erwartungen, die sich an den NATO-Gipfel<br />
von Chicago richteten, waren so gering, dass<br />
nicht befürchtet werden musste, irgend jemanden<br />
durch seine Ergebnisse zu enttäuschen.<br />
Für die Allianz ist dies kein Makel. Ihre Relevanz<br />
entscheidet sich im Alltag der Einsätze und der<br />
Arbeit ihrer Institutionen – und nicht daran, ob<br />
bei Zusammenkünften der Staats- und Regierungschefs<br />
im Scheinwerferlicht der Medien<br />
spektakuläre Entscheidungen verkündet werden.<br />
Hier ist das Vertrauenskapital der NATO nämlich<br />
per se längst abgeschmolzen. Zu oft wurden in<br />
der Vergangenheit auf Gipfeltreffen große Worte<br />
in den Mund genommen, denen nur kleine<br />
Taten folgten. Zu oft gab man vor, sich zu neuen<br />
Weichenstellungen durchgerungen zu haben,<br />
die letztlich als altbekannt gelten durften. Zu oft<br />
wurde Einmütigkeit in Prinzipien beschworen,<br />
um sich dann vor konkreten Problemen wieder<br />
in Differenzen zu verlieren.<br />
Auch der Gipfel von Chicago fällt nicht aus diesem<br />
Rahmen. So wurde zwar der Auftakt der<br />
ersten Betriebsphase des Raketenabwehrschirms<br />
verkündet, den aufzubauen sich die NATO in ihrem<br />
vor zwei Jahren beschlossenen strategischen<br />
Konzept vorgenommen hatte. Viel mehr als ein<br />
symbolischer Schritt ist dies aber nicht. Die nicht<br />
unerhebliche Frage, welche technischen Lösungen<br />
und finanziellen Mittel die Europäer beisteuern<br />
werden, ist weiter offen. Ungeklärt ist auch,<br />
wie russische Bedenken ausgeräumt werden<br />
können oder ob Moskau gar in das Vorhaben<br />
mit einbezogen werden sollte.<br />
Mehr als Symbolpolitik ist sicherlich die Vertragsunterzeichnung<br />
für die Beschaffung des<br />
Aufklärungssystems Alliance Ground Surveillance<br />
(AGS), die am Rande des Gipfels durch die<br />
NATO-Agentur NAGSMA und den industriellen<br />
Hauptauftragnehmer vorgenommen wurde.<br />
AGS schließt eine Fähigkeitslücke, die der Libyen-<br />
Einsatz vor Augen führte, und entspricht den<br />
Intentionen von „smart defence“. Abgesehen<br />
davon, dass „pooling and sharing“ sowieso keine<br />
wirklich neue Maxime der NATO ist, reichen<br />
die Anstöße zu AGS allerdings in das Jahr 1989<br />
zurück. So erfreulich es sein mag, dass immerhin<br />
13 Nationen an diesem Vorhaben beteiligt sind,<br />
stimmt zugleich die Tatsache nachdenklich, dass<br />
15 NATO-Mitglieder abseits stehen. Die Tendenz,<br />
als Trittbrettfahrer direkt oder indirekt von Fähigkeiten<br />
zu profitieren, zu denen andere ihre Beiträge<br />
leisten, dürfte angesichts der bündnisweiten<br />
Haushaltsengpässe eher zu- als abnehmen.<br />
Schwer fällt es jedoch, das deklaratorische Festhalten<br />
an der Entscheidung über den Abschluss<br />
der derzeitigen Afghanistan-Mission zum Ende<br />
des Jahres 2014 als Erfolg zu betrachten. Die<br />
vermeintliche Einmütigkeit wird durch den Alleingang<br />
des neuen französischen Staatspräsidenten<br />
überschattet, der ein Wahlkampfversprechen zu<br />
erfüllen hat und seine Kampftruppen bereits in<br />
diesem Jahr abziehen will. Schönreden bewährte<br />
sich hier wieder einmal als eine wichtige Bündnistugend:<br />
Die französischen Truppen seien ja in<br />
befriedetem Gebiet eingesetzt, ihr Abzug daher<br />
militärisch folgenlos. Diese Logik werden nun<br />
auch andere Regierungen für sich in Anspruch<br />
nehmen können, zumal, wenn Wahlen ins Haus<br />
stehen. Eine geordnete Beendigung des ISAF-<br />
Einsatzes droht in Gefahr zu geraten, wenn das<br />
Beispiel François Hollandes Schule macht.<br />
Der karge Ertrag des Gipfels von Chicago entspricht<br />
den Rahmenbedingungen, die seinen<br />
Teilnehmern aktuell vorgegeben sind. Auf der<br />
Agenda der europäischen NATO-Partner kann<br />
die <strong>Sicherheit</strong>spolitik derzeit keinen prominenten<br />
Platz beanspruchen. Ihre Aufmerksamkeit ist<br />
durch eine Schulden- und in den meisten Staaten<br />
zugleich Wirtschaftskrise absorbiert, von der<br />
sie befürchten, dass diese über den Euro hinaus<br />
auch den Integrationsprozess insgesamt beschädigen<br />
könnte. Da sie ihre globale Rolle aus ihrer<br />
Wirtschaftsleistung und weniger aus sicherheitspolitischen<br />
oder gar militärischen Ambitionen<br />
ableiten, werden sie Abstriche an den Fähigkeiten<br />
ihrer Streitkräfte ohne Wimpernzucken<br />
tolerieren, sofern dies die Haushaltssanierung<br />
erfordert.<br />
Die USA wiederum stehen nicht nur vor ähnlichen<br />
Haushalts- und Wachstumsproblemen,<br />
sondern zugleich im Präsidentschaftswahlkampf.<br />
Barack Obama muss um seine Wiederwahl<br />
fürchten, und er ist mit Vorwürfen seines Herausforderers<br />
Mitt Romney konfrontiert, durch<br />
die von ihm geplanten Einschnitte im Verteidigungsetat<br />
die globale Führungsrolle seines Landes<br />
zu unterminieren. Da die <strong>Sicherheit</strong>spolitik in<br />
den USA, anders als in Europa, auch nach dem<br />
Ende des Kalten Krieges nichts an Relevanz verloren<br />
hat, muss er hierzu Antworten präsentieren.<br />
Eine hat er durch den NATO-Gipfel von Chicago<br />
anschaulich zu machen versucht: Die Europäer<br />
sollen mehr Verantwortung für ihre <strong>Sicherheit</strong><br />
übernehmen und dadurch die USA entlasten.<br />
Auch dieser Wunsch wird jedoch nicht zum<br />
ersten Mal formuliert, er ist fast so alt wie das<br />
Bündnis selbst. Warum sollten die Europäer ihn<br />
ausgerechnet jetzt, inmitten einer Wirtschaftskrise<br />
von historischen Dimensionen, erfüllen?<br />
Peter Boßdorf<br />
Juni 2012 · <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
3
(Foto: Raytheon Anschütz)<br />
Standpunkt<br />
<strong>Umschau</strong><br />
(Foto: P+S Werften)<br />
� Küstenwachschiff für Schweden<br />
Am 8. März 2012 wurde auf der P+S Werften GmbH in Wolgast das zweite von<br />
vier Küstenwachschiffen für die schwedische Küstenwache getauft. Das ca. 52 m<br />
lange und 10 m breite Mehrzweck-KBV 032 (Kustbevakningen Vessel) soll ein breites<br />
Aufgabenspektrum abdecken: Kontrolle des Schiffsverkehrs im Küstengebiet,<br />
Grenzsicherung, Zolldienst, Brandbekämpfung im Hafen und auf See, Such- und<br />
Rettungsdienst (SAR), Fischerei- und Umweltschutz. Die Küstenwachschiffe sind<br />
für eine Lebensdauer von 30 Jahren konstruiert. Die Schiffe sollen ganzjährig in der<br />
Ostsee, im Bottnischen Meerbusen, im Skagerrak und Kattegatt und auch in den<br />
schwedischen Seen Vänern und Malären auch unter Winterbedingungen (bis zu<br />
-25°C) operieren können. (ds)<br />
� Typzulassung<br />
Synapsis Bridge Control, die neue Generation<br />
der Integrierten Brücke von Raytheon<br />
Anschütz, hat weltweit als erstes System<br />
die Typzulassung nach dem Performance<br />
Standards für Integrierte Navigationssys-<br />
teme (INS) der IMO erlangt. Das Zertifikat<br />
wurde vom Germanischen Lloyd ausgehändigt.<br />
Die INS Performance Standards<br />
gelten für alle Neubauten ab Januar 2011,<br />
die mit INS ausgerüstet werden. Ein INS<br />
integriert die Aufgaben der einzelnen Navigationssysteme<br />
wie Kollisionsverhütung,<br />
Routenplanung, Routenüberwachung,<br />
Navigationsdatenkontrolle, Statusüberwachung<br />
und Alarm-Management auf<br />
Multifunktionsdisplays. Kernelement von<br />
Synapsis Bridge Control sind die Multifunktionsdisplays,<br />
mit denen Einzelarbeitsplätze<br />
wie Radar, Elektronische Seekarten oder<br />
Conning ersetzt werden können. (ds)<br />
6 <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · Juni 2012<br />
� Übungsmast für Segelvorausbildung<br />
Die Marineschule Mürwik hat als neues<br />
Ausbildungsmittel einen Übungsmast für<br />
die Segelvorausbildung der Offizieranwärter<br />
(OA) der Marine aufgestellt. Damit sol-<br />
len die OA zielgerichtet auf ihre Seemännische<br />
Basisausbildung auf dem Segelschulschiff<br />
GORCH FOCK vorbereitet werden.<br />
Der Übungsmast ist ein etwas verkleinerter<br />
Nachbau des 45 Meter hohen Originals auf<br />
dem Segelschulschiff. Ziel der Ausbildung<br />
ist, die OA frühzeitig an die Höhe und die<br />
Arbeitsbedingungen auf dem Schulschiff<br />
zu gewöhnen. (ds)<br />
� MASS für Südkorea<br />
Südkoreas vier neue Landungsschiffe (Landing<br />
Ship Tank) der LST-II-Klasse werden<br />
pro Schiff mit zwei MASS (Multi Ammunition<br />
Softkill Systems)-Werfern von Rheinmetall<br />
ausgerüstet. Die MASS-Täuschkörper-<br />
(Foto: PIZ/Mar)<br />
Wurfanlage gehört inzwischen zur Standard-Ausrüstung<br />
in der südkoreanischen<br />
Marine. Seit der MASS-Auslieferung im<br />
Jahre 2002 haben weltweit elf Nationen<br />
das System in ihren Marinen eingeführt.<br />
MASS verschießt Täuschkörper im Spektralbereich<br />
Radar, IR, UV und Laser, um<br />
angreifende Seeziel-Flugkörper vom Schiff<br />
abzulenken. (ds)<br />
� Zweites Patrouillenboot<br />
Kürzlich hat Lettlands Marine das zweite Patrouillenboot<br />
CESIS der SKRUNDRA-Klasse<br />
von der deutschen Schiffswerft Abeking<br />
& Rasmussen (A & R) übernommen und in<br />
Dienst gestellt. Insgesamt erhält die lettische<br />
Marine fünf Patrouillenboote. Die SKRUND-<br />
RA u. CESIS wurden bei A & R gebaut, die<br />
folgenden drei Boote werden mit A & R-<br />
Unterstützung bei der Riga Shipyards in<br />
Lettland bis 2014 gebaut. Die 26 m langen<br />
Boote verdrängen 125 t und besitzen einen<br />
Doppelrumpf (Small Waterplane Area Twin<br />
Hull, SWATH), wodurch sie stabiler und ruhiger<br />
bei Seegang operieren können. An Bord<br />
können kurzfristig Missionsmodule (Minenabwehr,<br />
Tauchereinsätze, Unterwasseraufklärung)<br />
eingerüstet werden. Besatzung:<br />
8 Personen; Antrieb: Diesel-elektrisch; Geschwindigkeit:<br />
20 kn. (ds)<br />
� „Train as you fight“<br />
Rheinmetall liefert seit über 35 Jahren Simulations-<br />
und Ausbildungssysteme an<br />
Streitkräfte weltweit und entwickelt diese<br />
stetig weiter. Einen Ausschnitt aus seinem<br />
Simulationsproduktportfolio stellte das<br />
wehrtechnische Systemhaus vom 22. bis<br />
(Foto: Rheinmetall)<br />
(Foto: T. Lerdo)
(Foto: Rheinmetall)<br />
(Foto: ATLAS ELEKTRONIC)<br />
zum 24. Mai 2012 in London auf der Simulationsmesse<br />
ITEC aus. Der generische<br />
Medium-Fidelity Demonstrator für Schießen<br />
und Gefecht (DESUG) demonstrierte<br />
eindrucksvoll die Fähigkeiten von Rheinme-<br />
tall zur Ausbildung von Kampf- oder Schützenpanzerbesatzungen.<br />
Die Sitzplätze von<br />
Kommandant und Richtschütze im Kampfraum<br />
eines Leopard 2 A6 werden sowohl<br />
mittels Originalbauteilen – etwa Richtgriffe<br />
oder Bediengeräte – als auch durch originalgetreu<br />
nachgebildete interaktive Touchpanels<br />
ausgestattet. Ebenfalls zeigte Rheinmetall<br />
ein detailgetreues Modell des mobilen<br />
taktischen Trainingssystems Advanced<br />
Network Trainer (ANTares). ANTares – hier<br />
im Bild – bietet über die reine Besatzungsausbildung<br />
(Crew-Coordination-Training)<br />
hinaus auch die taktische Missionsvorbereitung<br />
kompletter Einsatzkontingente –<br />
selbst im Einsatzland. (wb)<br />
� Neuer Reichweitenrekord<br />
ATLAS ELEKTRONIK hat die Reichweite<br />
seiner Torpedos massiv erhöht und einen<br />
neuen Reichweiten-Rekord für Torpedos<br />
aufgestellt. Bei einem Testschießen im März<br />
2012 erreichte der Schwergewichtstorpedo<br />
SeaHake mod4 ER (Extended Range)<br />
eine Reichweite von über 140 Kilometern.<br />
SeaHake mod 4 ist eine Weiterentwicklung<br />
des in der Deutsche Marine eingeführten<br />
Schwergewichtstorpedos DM 2 A4, der<br />
auch von den Marinen der Türkei, Pakistans<br />
und Spaniens genutzt wird. Durch Ausnutzung<br />
seiner einzigartigen Antriebs- und<br />
Batterietechnologie war es möglich, die<br />
üblichen Maximalreichweiten moderner<br />
Schwergewichtstorpedos auf dem Weltmarkt<br />
um deutlich mehr als 50 Prozent zu<br />
übertreffen. Die neue Version des SeaHake<br />
mod4 ist auch mit einer neuen Navigations-<br />
(Foto: HDW)<br />
und Kommunikationstechnologie ausgestattet,<br />
die eine äußerst präzise Navigation<br />
und die Kontrolle des Torpedos über die<br />
gesamte Distanz ermöglicht. Der SeaHake<br />
mod4 ER kann sowohl von seegehenden<br />
Plattformen als auch von speziellen landgestützten<br />
Plattformen genutzt werden. Die<br />
Seeversuche haben in Kooperation mit der<br />
Wehrtechnischen Dienststelle für Schiffe<br />
und Marinewaffen, Maritime Technologie<br />
und Forschung (WTD 71) in der Eckernförder<br />
Bucht stattgefunden. (wb)<br />
� Viertes U-Boot an Israel<br />
Die Howaldtswerke-Deutsche Werft haben<br />
nach erfolgreicher Seeerprobung<br />
durch das Werk das vierte U-Boot der<br />
Dolphin-Klasse an Israel übergeben. Das<br />
„Super-Dolphin“ gilt mit 68 Metern Länge<br />
als das längste nach dem 2. Weltkrieg in<br />
Deutschland produzierte U-Boot. Die INS<br />
TANIN wird unter israelischer Federführung<br />
weitere Tests in See durchführen und 2013<br />
mit dem Schwesterschiff RAHAV in die israelische<br />
Marine integriert. Im April hatten<br />
Israel und Deutschland den Bauauftrag für<br />
das sechste U-Boot der Dolphin-Klasse unterzeichnet,<br />
dessen Auslieferung für 2017<br />
geplant ist. Als Hauptauftragnehmer ist<br />
HDW verantwortlich für Entwicklung, Konstruktion<br />
und Integration der U-Boote und<br />
der modernen Kampfsysteme, mit denen<br />
die U-Boote ausgestattet sind. (gwh)<br />
� Mit Lance-Turm getestet<br />
Bereits auf der Eurosatory 2010 konnte das<br />
hochmobile Radfahrzeug vom Typ Boxer<br />
einem breiten Publikum als Konzeptstudie<br />
mit einem Prototyp des Mittelkaliberturms<br />
Lance vorgestellt werden. Diese Konzeptstudie<br />
wurde jetzt erfolgreich weiterentwickelt<br />
und voll funktionsfähig aufgebaut.<br />
Dabei wurden in enger Zusammenarbeit<br />
der Rheinmetall MAN Military Vehicles<br />
(RMMV) und dem Rheinmetall Landsysteme<br />
(RLS) in Augsburg und der RLS in<br />
Kiel ein Lance-Serienturm sowie ein Boxer-<br />
Serienmodul und ein modifiziertes Serien-<br />
Missionsmodul zusammengeführt und im<br />
� Neue Trinkwasseraufbereitungsanlagen für THW<br />
Stellvertretend wurde Anfang Mai auf der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-,<br />
Abfall- und Rohstoffwirtschaft von Veolia Water Solutions & Technologies die erste<br />
der insgesamt acht Anlagen vom Typ Berkefeld UF-15 übergeben. „Mit dieser<br />
mobilen Ultrafiltrationsanlage entspricht das THW den Anforderungen in der Katastrophenvorsorge<br />
in Deutschland“, so THW-Präsident Albrecht Broemme. „Jede<br />
unserer neuen Trinkwasseraufbereitungsanlagen ist in der Lage, das Trinkwasser<br />
für rund 20.000 Menschen täglich bereit zu stellen“. Bewährte Verfahrenstechnik,<br />
effiziente Filtration und ein modularer Aufbau – diese Eigenschaften zeichnen die<br />
Trinkwasser-Aufbereitungsanlage (TWA) des Typs UF-15 aus. Damit wird Schmutzwasser<br />
aller Art in sauberes Trinkwasser umgewandelt – und das mit einer Leistung<br />
von 15.000 Litern in der Stunde. Durch den modularen Aufbau ist die Anlage jederzeit<br />
transportfähig und überall in Deutschland einsetzbar. In den mobilen Labors für<br />
Wasseranalysen wird die Qualität des Trinkwassers laufend überprüft. (wb)<br />
Juni 2012 · <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
(Foto: THW)<br />
7
(Foto: Rheinmetall)<br />
(Foto: Heiming)<br />
<strong>Umschau</strong><br />
Rheinmetall Defence-Erprobungszentrum<br />
Unterlüß getestet, sodass die Realisierung<br />
der Studie verifiziert werden konnte. So-<br />
wohl in der fahrdynamischen Präsentation<br />
als auch in der Schießvorführung konnten<br />
das gepanzerte Transportfahrzeug Boxer<br />
und der Lance-Turm ihre Leistungsfähigkeit<br />
unter Beweis stellen und eindrucksvoll<br />
überzeugen. (wb)<br />
� Dingo 2 bei IAVC<br />
Das einzige Fahrzeug aus Deutschland bei<br />
der International Armoured Vehicle Conference<br />
in Farnborough war ein Dingo 2 PRV<br />
(Protected Reconnaissance Vehicle), der vom<br />
luxemburgischen Heer bei der ISAF-Mission<br />
in Afghanistan eingesetzt wird. Die 2010 an<br />
Luxemburg ausgelieferten Fahrzeuge sind<br />
mit Kommunikations- und Aufklärungssystemen<br />
von Thales Belgien ausgerüstet. Die<br />
Funkverbindung mit Nachbarfahrzeugen<br />
und in Führungssysteme hinein wird mit<br />
PR4G- und TRC 3700 HF-Funkgeräten sichergestellt.<br />
Für die Lageaufklärung dienen<br />
ein auf vier Meter Höhe ausfahrbarer Mast<br />
(Margot 5000) mit Wärmebildgerät, CCD-<br />
Kamera und Laser-Entfernungsmesser sowie<br />
Laserwarner rundum. Mit dem „Open<br />
Information Communication System” von<br />
Thales werden die Systeme untereinander<br />
verbunden. (gwh)<br />
� Betriebsfähig<br />
Die ersten beiden von Astrium gebauten<br />
Galileo-IOV-Satelliten sind voll funktionsfähig<br />
und nehmen ihren Betrieb in der Erdumlaufbahn<br />
auf. Nach ihrem Start mit einer<br />
Sojus-Trägerrakete am 21. Oktober 2011<br />
haben die Satelliten eine Reihe von In-Orbit-<br />
Tests erfolgreich bestanden und sind jetzt<br />
weltraumtauglich. Mit der Inbetriebnahme<br />
der Satelliten hat Astrium einen weiteren<br />
8 <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · Juni 2012<br />
(Grafik: Astrium)<br />
� A400M in der Helmut-Schmidt-Universität<br />
Die Helmut-Schmidt-Universität (HSU), in der in Hamburg Offizieranwärter der Bundeswehr<br />
akademisch ausgebildet werden, hat von Airbus Military einen ausgedienten<br />
Vorserienrumpf des zukünftigen Transportflugzeugs A400M zu Forschungszwecken<br />
erhalten. Der Transport des Bauteils vom Airbus-Werk in Bremen zum<br />
Campus der HSU erfolgte im Transportverbund in der Luft, zu Wasser und zu Lande.<br />
Dem Flug nach Hamburg mit einem Beluga-Transportflugzeug folgte der Transport<br />
elbaufwärts mit einer Transportschute. Für die letzten Kilometer kam ein Tieflader<br />
zum Einsatz.<br />
Das 32 Meter lange, 6 Meter breite und etwa 12 Tonnen schwere Bauteil dient als<br />
Forschungsplattform für den Lehrstuhl für Mechatronik (Prof. Dr.-Ing. Delf Sachau),<br />
der schon in der Vergangenheit mit Airbus im A400M-Programm erfolgreich zusammen<br />
gearbeitet hat. An dem Original-Flugzeugrumpf als Testlabor sollen unter<br />
anderem aktive und passive Konzepte zur Lärmreduzierung weiterentwickelt werden.<br />
Von der künftigen Nutzung profitieren beide Partner. Airbus stellt den Rumpf<br />
zur Verfügung, die HSU ist für Betrieb, Ausbau und Instandhaltung verantwortlich.<br />
Beide haben die Möglichkeit, gemeinsam oder mit externen Partnern an dem Rumpf<br />
zu forschen. (gwh)<br />
wichtigen Meilenstein erreicht. Die beiden<br />
Astrium-Satelliten in der Erdumlaufbahn<br />
werden bei der Entwicklung aller weiteren,<br />
in Europa gebauten Galileo-Satelliten als<br />
Vorlage dienen. Wenn die IOV-Satelliten 3<br />
und 4 im Sommer 2012 wie geplant starten,<br />
schafft Astrium die Basis zum kompletten<br />
Aufbau des hochleistungsfähigen<br />
Galileo-Systems. Galileo ist Europas globales<br />
Satellitennavigationssystem unter ziviler<br />
Kontrolle, das weltweit zuverlässige und<br />
hochpräzise Daten zur Positionsbestimmung<br />
bereitstellen wird. (gwh)<br />
� Ortungsfähigkeit<br />
Cassidian hat die Hochleistungsfähigkeit<br />
ihres neu entwickelten Küstenradars<br />
SPEXER 2000 Coastal in einer groß angelegten<br />
Feldversuchskampagne mit realisti-<br />
(Foto: Stefan Reichart)<br />
schen Szenarien unter Beweis gestellt. Bei<br />
anspruchsvollen Tests in Frankreich, Südafrika<br />
und im Nahen Osten demonstrierte<br />
das Radar außerordentliche Ortungsfähigkeiten<br />
unter schwierigsten Küsten-, Gelände-<br />
und Wetterbedingungen. Bei sehr<br />
schwerem Seegang und auf Entfernungen<br />
von bis zu 11 NM (20 km) ortete das Radar<br />
zuverlässig kleine und sich schnell be-<br />
wegende Ziele, sogar einzelne Fußgänger<br />
am Strand. Das SPEXER 2000 Coastal mit<br />
elektronischer Strahlschwenkung (AESA-<br />
Technologie) kann zwei oder mehr konventionelle<br />
Radare ersetzen. Das kompakte<br />
Gerät kann von zwei Personen getragen<br />
werden, so dass auch kurzzeitige Installationen<br />
auf einem Dreibein möglich sind. Das<br />
(Foto: Cassidian
(Foto: ATLAS ELEKTRONIK)<br />
(Foto: Cassidian)<br />
neue Gerät gehört zur Familie der SPEXER-<br />
<strong>Sicherheit</strong>sradare, die verschiedene Sensoren<br />
umfasst, von denen jeder einzelne für<br />
spezifische Anwendungen auf dem Gebiet<br />
der Grenz-, Infrastruktur-, Perimeter- und<br />
Küstenüberwachung optimiert ist. Eine<br />
speziell für die Grenzüberwachung ausgelegte<br />
Version, SPEXER 2000, ist derzeit für<br />
ein großes Grenzüberwachungsprogramm<br />
im Nahen Osten in Produktion; eine militärische<br />
Version wurde für das deutsche Heer<br />
entwickelt. (gwh)<br />
� Seafox für U.S. Navy<br />
Im Rahmen von einsatzbedingtem Sofortbedarf<br />
liefert ATLAS ELEKTRONIK über<br />
seine US-Gesellschaft Atlas North America<br />
das Minenbekämpfungssystem Seafox<br />
an die U.S. Navy. Die Seafox dienen der<br />
Ausstattung von Minenabwehrschiffen der<br />
AVENGER-Klasse und ergänzen die schon<br />
bestellten Seafox für den Einsatz aus den<br />
MH-53 Sea Dragon Hubschraubern. (gwh)<br />
� Slimline-TETRA-Funkgerät<br />
Beim TETRA World Congress in Dubai<br />
präsentierte Cassidian sein neues Slimline-<br />
TETRA-Funkgerät TH1n – das erste einer<br />
völlig neuen Klasse von TETRA-Funkgeräten<br />
im Taschenformat. Auch durch sein<br />
hochwertiges, elegantes Design mit Metallic-Oberfläche<br />
und handfreundlich geformten<br />
gummierten Seitenteilen hebt es<br />
sich von konventionellen PMR-Funkgeräten<br />
(Professional Mobile Radio) ab. Gleichzeitig<br />
verfügt das TH1n über das in Vorgän-<br />
gergeräten von Cassidian bewährte große,<br />
lichtstarke Farbdisplay. Deutliche und<br />
laute Sprachübertragung, Schutzart IP65,<br />
Ausgangsleistung von 1,8 Watt, Repeater-<br />
Funktion (für Direkt Modus) sind weitere<br />
Merkmale des TH1N. Dank innovativer<br />
Batterietechnologie sind die Nutzungszeiten<br />
trotz schlanker Bauweise mit jedem<br />
anderen marktüblichen TETRA-Funkgerät<br />
vergleichbar. (gwh)<br />
� Virtueller Sandkasten<br />
Auf der AFCEA-Fachausstellung in Bad<br />
Godesberg stellte Cassidian einen Virtuellen<br />
Sandkasten (Virtual Rock Drill, VRD)<br />
erstmals der Öffentlichkeit vor. Mit dem<br />
ca. 2 x 2 m großen Virtuellen Sandkasten<br />
werden die bewährten militärischen Ausbildungsmethoden<br />
im Geländesandkasten<br />
um die technischen Möglichkeiten computergestützter<br />
Schulungsformen erweitert.<br />
Ausbilder können auf bewährte Methodik<br />
und Didaktik zurückgreifen, während beispielsweise<br />
die Spielekonsolen nachempfundenen<br />
Gamepads darauf abzielen, den<br />
ohnehin meist Gaming erfahrenen Auszubildenden<br />
ein vertrautes Ausbildungsumfeld<br />
zu bieten. Basierend auf der amerikanischen<br />
Rock Drill Methode, bei der die<br />
Auszubildenden aktiv das zuvor im Un-<br />
(Foto: EMPL)<br />
terricht Erlernte in einem Geländemodell<br />
vorführen und so bei Bedarf unmittelbar<br />
korrigiert werden können, schafft Cassidian<br />
eine Plattform, die weit über bisherige<br />
Ausbildungsmöglichkeiten hinausgeht,<br />
ohne Einfachheit und Schnelligkeit aufzugeben.<br />
Der Ausbilder benötigt nur wenige<br />
Minuten Einarbeitungszeit und kann sich<br />
während des Unterrichts voll auf die Ausbildung<br />
konzentrieren. Die ausbildungsunterstützenden<br />
Funktionen sind schnell und<br />
einfach abrufbar und sofort verfügbar. Die<br />
Austauschbarkeit der Szenarien und Darsteller<br />
ermöglicht eine abwechslungsreiche<br />
Ausbildung, die weit über die bisher praktizierte<br />
Methode am Geländesandkasten<br />
hinausgeht. (gwh)<br />
� Schwerkranfahrzeuge für Bulgarien<br />
Die bulgarischen Streitkräfte haben von EMPL zwei Schwerkranfahrzeuge erhalten.<br />
Trägerfahrzeug ist der geländegängige Actros 8x8 von Mercedes-Benz. Der Kranaufbau<br />
ist speziell für das Versetzen von vollbeladenen 20 ft. ISO-Containern (vom<br />
Eisenbahntransport auf Sattelauflieger für den Straßentransport) nach dem Anforderungsprofil<br />
des bulgarischen Verteidigungsministeriums konzipiert. Die vier für<br />
den Kranbetrieb notwendigen hydraulischen Stützen sind schwenkbar angeordnet,<br />
um die Geländegängigkeit in keiner Weise einzuschränken. Am Kran befindet sich<br />
eine Winde, die mittels sechsfacher Umlenkung bis zu 20 Tonnen heben kann. Der<br />
mitgelieferte Hubbalken sowie die Hebeketten werden mittels eines intelligenten<br />
Verstauungskonzepts hinten auf der Ladefläche verlastet. Der Kran entspricht dem<br />
neuesten <strong>Europäische</strong>n Standard EN 12999:2011, womit die Hubkapazität des Krans<br />
in Abhängigkeit von der Stützbeinausladung reduziert und dem Kunden maximale<br />
<strong>Sicherheit</strong> geboten wird. (gwh)<br />
Juni 2012 · <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
(Foto: Heiming)<br />
9
� BUNDESWEHR & STREITKRÄFTE INTERNATIONAL<br />
„Richtschnur für die Neuausrichtung<br />
ist der Erfolg im Einsatz“<br />
ES&T: Herr General, die<br />
Grobstruktur des Heeres<br />
liegt im Wesentlichen<br />
fest. Wie konnten die<br />
geforderten Kernfähigkeiten<br />
der Teilstreitkraft<br />
(TSK) Heer abgebildet<br />
werden? Was kennzeichnet<br />
die neue Struktur des<br />
Heeres im Besonderen?<br />
Freers: Die neue Struktur<br />
des Heeres setzt den<br />
Schwerpunkt auf die<br />
Stärkung der Basisstrukturen<br />
mit starken und kohärenten<br />
Verbänden für<br />
den Einsatz. Die Kernfähigkeit „Kampf“<br />
steht dabei im Fokus. Sie setzt den Maßstab<br />
für die Einsatzbereitschaft des Heeres<br />
im Rahmen der Neuausrichtung. Zentrale<br />
Elemente der Grobstruktur sind in sich ausbildungs-<br />
und übungsfähige Brigaden, die<br />
Einsatzkontingente für das gesamte Aufgaben-<br />
und Intensitätsspektrum stellen können.<br />
Die neue Brigade verfügt zukünftig<br />
bei verstärkter infanteristischer Befähigung<br />
über das volle Spektrum an Kampftruppen<br />
und organische, starke Aufklärungs-,<br />
Pionier- und Versorgungskräfte. Sie ist<br />
damit das wesentliche Manöverelement,<br />
stark genug, um flexibel und modular die<br />
Aufgabenvielfalt des Heeres abdecken zu<br />
können und klein genug zur Gewährleistung<br />
von Kohäsion und Zusammenhalt der<br />
Einsatzkräfte. Die Kohäsion der Kräfte wird<br />
zusätzlich unterstützt durch weitestgehend<br />
zusammenhängende Stationierungsräume<br />
der Brigaden sowie einsatzorientierte Ausbildungs-<br />
und Übungsverbünde. Durch klare<br />
Schwerpunktsetzung ist es gelungen, in<br />
einem kleineren Heer die Anzahl der Kompanien<br />
der Kampftruppe zu erhöhen.<br />
ES&T: Das Heer soll auch zukünftig vergleichbar<br />
leistungsstark bleiben. Wie haben<br />
Sie das bei den Umfangsreduzierungen<br />
und den knappen Haushaltsmitteln<br />
geschafft? Muss das Heer zukünftig auf<br />
Fähigkeiten verzichten?<br />
Freers: Die Reform verschafft uns die Möglichkeit,<br />
durch Verkleinerung gewonnene<br />
Spielräume in die Optimierung des Fähigkeitsprofils<br />
des Heeres sowie in Attraktivität<br />
zu investieren. Das neue Konzept der „Ein-<br />
22 <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · Juni 2012<br />
(Foto: BMVg)<br />
satzorientiertenAusrüstungsplanung<br />
Heer“ stellt<br />
einen wichtigen<br />
Schritt in diesem<br />
Zusammenhang<br />
dar. Damit kann<br />
bei den gegebenenfinanzplanerischenMöglichkeiten<br />
eine spürbare<br />
Modernisierung<br />
im Fähigkeitsprofil<br />
des Heeres hin<br />
zur Verbesserung<br />
der Einsatzfähigkeit<br />
gelingen. Dieser Neuansatz sieht eine<br />
Abkehr von der Vollausstattung und eine<br />
Reduzierung des Großgeräts auf rund<br />
70 bis 80 Prozent vor und wird durch die<br />
Einführung einer bedarfsorientierten Ausrüstungsplanung<br />
und eines dynamischen<br />
Verfügbarkeitsmanagements tragfähig. Im<br />
Ergebnis wird so für Einsatz, Einsatzvorbereitung,<br />
nationale Krisenvorsorge sowie<br />
Führeraus- und -fortbildung und für Ausbildungsvorhaben<br />
im Bataillonsrahmen eine<br />
Vollausstattung ermöglicht – und dies trotz<br />
verringerter Stückzahlen. Daneben werden<br />
auch Fähigkeitstransfers zwischen den militärischen<br />
Organisationsbereichen zur Optimierung<br />
der Einsatzfähigkeit der Streit-<br />
Interview mit dem Inspekteur des Heeres<br />
Generalleutnant Werner Freers<br />
Soldaten im Feuergefecht in Afghanistan<br />
kräfte durchgeführt. Für das Heer hat dies<br />
zur Folge, dass der taktisch-operative Lufttransport<br />
(CH-53) zur Luftwaffe wechseln<br />
wird. Die Zusammenführung der Aufgaben<br />
Flugabwehr und Luftverteidigung mit<br />
ganzheitlicher Aufgabenwahrnehmung<br />
durch die Luftwaffe ist bereits erfolgt. Der<br />
taktische Lufttransport (NH90) wird zukünftig<br />
durch das Heer sichergestellt. Die<br />
Fähigkeiten C-IED und Kampfmittelbeseitigung<br />
werden von der Streitkräftebasis<br />
(SKB) in die Verantwortung des Heeres<br />
übertragen. Zukünftig zeichnet die SKB für<br />
den Bereich ABC-Abwehr und den Weitverkehr<br />
verantwortlich. Damit erzielen wir<br />
Synergien – durch verbesserte Fähigkeiten<br />
und Kohäsion sowie reduzierte Aufwände.<br />
ES&T: Konnten besonders die in den Einsätzen<br />
gemachten Erfahrungen in der<br />
neuen Struktur des Heeres personell und<br />
materiell sicher abgebildet werden?<br />
Freers: Richtschnur für die Neuausrichtung<br />
des Heeres ist der Erfolg im Einsatz. Die<br />
Neuausrichtung setzt den Schwerpunkt<br />
daher konsequent auf die Stärkung der<br />
Grundstrukturen zugunsten der im Einsatz<br />
geforderten Kräfte sowie auf Kohäsion und<br />
Modularität. Die Einteilung in verschiedene<br />
Kräftekategorien (Einsatzkräfte, Stabilisierungskräfte,<br />
Unterstützungskräfte) hat<br />
sich in der Realität unserer Einsätze nicht<br />
(Fotos: Bundeswehr)
Sichere Kommunikation<br />
für eine effektive Mission.<br />
Das Heer trägt eine besondere Verantwortung bei der Bewältigung<br />
friedensschaffender und -erhaltender Maßnahmen. Kommunikationslösungen<br />
für das Heer müssen die Einsatzanforderungen daher<br />
optimal unterstützen, also interoperabel sein und die höchstmögliche<br />
Datenrate realisieren. Im Festfrequenz- wie im Frequenzsprungbetrieb,<br />
unverschlüsselt und verschlüsselt. Mit dem ¸M3AR bietet<br />
Rohde & Schwarz Heeresfliegern eine zuverlässige Gerätefamilie,<br />
die höchsten Ansprüchen gerecht wird.<br />
www.rohde-schwarz.com/ad/armycom<br />
Besuchen Sie uns auf der<br />
Eurosatory in Paris<br />
Halle 6 / German pavilion<br />
Foto: Bundeswehr/Rott
� BUNDESWEHR & STREITKRÄFTE INTERNATIONAL<br />
Das Gepanzerte Transport-Kraftfahrzeug Boxer im Afghanistaneinsatz<br />
bewährt und wird daher für die Streitkräfte<br />
insgesamt aufgegeben. Das Heer verfügt<br />
hingegen zukünftig über eine einsatzorientierte<br />
und sehr ausgewogene und damit<br />
für wechselnde Forderungen der Zukunft<br />
robustere Kräftestruktur sowie mehr<br />
Kampftruppe. Für spezifische Aufgaben im<br />
Einsatz, wie beispielsweise die Gestellung<br />
von Mentoren und Ausbildern zur Unterstützung<br />
fremder Streitkräfte (z.B. Operational<br />
Mentoring and Liaison Teams) sowie<br />
Personal für multinationale Hauptquartiere,<br />
verfügt das Heer nun bereits in der Grundstruktur<br />
über entsprechende Kräfte. Dies<br />
erhöht die Durchhaltefähigkeit, spiegelt<br />
konsequent die Erfordernisse<br />
des Einsatzes<br />
wider und entlastet<br />
die Truppenstrukturen<br />
von den derzeit umfänglichenPersonalabstellungen.<br />
ES&T: Welche Herausforderungen<br />
sehen<br />
Sie in der zeitgleichen<br />
Umgliederung des<br />
Heeres und den laufenden<br />
Einsätzen?<br />
Freers: Alle Verantwortlichen<br />
werden<br />
sich um beides, die<br />
Sicherstellung der Einsätze<br />
und den Umbau,<br />
kümmern, dabei vor<br />
allem auch um die uns<br />
anvertrauten Menschen und um deren konkrete<br />
Zukunft in diesem Umbau, denn wir<br />
brauchen unsere Soldatinnen und Soldaten<br />
für den Erfolg im Einsatz wie für den Erfolg<br />
der Reform. Wir setzen auf die bewährten<br />
Verfahren der ganzheitlichen Personalsteuerung<br />
und der Steuerkopforganisation.<br />
Damit können wir die Umstrukturierung<br />
und die ungebrochene Sicherstellung der<br />
Einsätze sowie die Funktionalität des Heeres<br />
„Unsere Soldatinnen<br />
und Soldaten sind ausnahmslos<br />
Freiwillige. Sie<br />
entscheiden sich unter<br />
mehreren alternativen<br />
Angeboten für uns. Wir<br />
müssen sie – gerade auch<br />
in der ersten Phase ihrer<br />
Dienstzeit – überzeugen,<br />
dass ihre Entscheidung<br />
für uns die richtige Entscheidung<br />
war.“<br />
24 <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · Juni 2012<br />
mit den berechtigten persönlichen Anliegen<br />
der Betroffenen harmonisieren. Gründlichkeit<br />
der Planung und Durchführung ist<br />
dabei die wesentliche Voraussetzung, um<br />
das Vertrauen der Truppe und jedes Einzelnen<br />
zu erhalten. Ein Bataillon, das im Einsatz<br />
steht oder sich darauf vorbereitet, wird<br />
nicht verlegt oder aufgelöst.<br />
ES&T: Wie geht es mit der Umsetzung der<br />
Neuausrichtung des Heeres weiter? Wo<br />
setzen Sie Schwerpunkte?<br />
Freers: Der Führungsstab des Heeres ist am<br />
1. April 2012 in den Stab Inspekteur Heer<br />
überführt worden und damit zwar zurzeit<br />
noch Teil des BMVg,<br />
jedoch keine ministerielle<br />
Instanz mehr.<br />
Startpunkt für die Aufstellung<br />
des Kommandos<br />
Heer (Kdo H) ist<br />
der 1. Oktober 2012.<br />
Absicht ist es, das neue<br />
Kommando unter Heranziehung<br />
des Heeresführungskommandos,<br />
von Teilen des Heeresamtes<br />
(HA) sowie meines<br />
Stabes im Zeitraum<br />
1. Oktober 2012 bis 31.<br />
März 2013 in der neuen<br />
Binnenstruktur auch<br />
personell aufzustellen.<br />
Ab 1. Juli 2012 wird<br />
ein Vorkommando des<br />
Kdo H in Strausberg<br />
eingesetzt. Ich selbst werde ab 1. Oktober<br />
dieses Jahres dort meinen ersten Dienstsitz<br />
einrichten. Das Kdo H wird im IV. Quartal<br />
2013 aus der Zwischenstationierung nach<br />
Strausberg umziehen und dann dort mit allen<br />
seinen Anteilen in der Zielstruktur sein.<br />
Ab Frühjahr 2013 wird das heutige HA beginnen,<br />
zum Amt für Heeresentwicklung<br />
und zum Ausbildungskommando umzugliedern.<br />
Der Kern des Heeres soll unter Berücksichtigung<br />
der laufenden Einsatzverpflichtungen<br />
im Zeitraum 2014 bis Anfang 2016 umgegliedert<br />
werden.<br />
Den Abschluss bilden die Ausbildungseinrichtungen,<br />
um so die Ausbildung des<br />
Heeres auch in der schwierigen Phase der<br />
Umgliederung der Truppe bruchfrei sicherstellen<br />
zu können.<br />
Die Schwerpunkte bei der Umsetzung der<br />
Neuausrichtung im Heer möchte ich wie<br />
folgt charakterisieren:<br />
� Die Durchführung der Strukturmaßnahmen<br />
ist vor allem sehr eng mit den<br />
Einsatzverpflichtungen des betroffenen<br />
Truppenteils abzustimmen.<br />
� Die Umgliederung geschieht über die<br />
Führungsebenen von oben nach unten,<br />
beginnend mit dem Kdo H.<br />
� Gleichzeitig – und das ist eine Verpflichtung<br />
– werden die berechtigten persönlichen<br />
Interessen unserer Soldatinnen<br />
und Soldaten umfassend berücksichtigt.<br />
ES&T: Sieht die TSK Heer – auch nach<br />
Aussetzung der Wehrpflicht – besondere<br />
Herausforderungen bei der Nachwuchsgewinnung?<br />
Freers: Nachwuchsgewinnung ist immer<br />
eine Herausforderung und eine strategische<br />
Aufgabe der Bundeswehr.<br />
Insgesamt sind die Streitkräfte vor dem Hintergrund<br />
des demografischen Wandels mit<br />
dem Studium für die Offiziere, der Meisterausbildung<br />
für die Feldwebel des allgemeinen<br />
Fachdienstes, der Gesellenausbildung<br />
für die Unteroffiziere des allgemeinen Fachdienstes<br />
sowie dem umfangreichen Paket<br />
an Maßnahmen des Berufsförderungsdienstes<br />
– künftig auch für unsere längerdienenden<br />
Mannschaften – sehr gut und<br />
attraktiv aufgestellt.<br />
Es kommt nun nach Aussetzung der allgemeinen<br />
Wehrpflicht ganz besonders darauf<br />
an, qualifiziertes und motiviertes Personal<br />
– im Heer bei der internen Personalgewinnung<br />
vor allen Dingen aus dem Potenzial<br />
der Freiwillig Wehrdienstleistenden (FWD)<br />
und der Mannschaften als Zeitsoldaten –<br />
frühzeitig zu identifizieren und qualifiziert<br />
zu beraten, um es längerfristig an das Heer<br />
zu binden. Hier sind die Vorgesetzten aller<br />
Ebenen gefordert.<br />
Die Bewerberzahlen zeigen, dass das „Dienen<br />
im Heer“ attraktiv ist. Jetzt gilt es, vor<br />
dem Hintergrund des demografischen<br />
Wandels und der haushalterischen Möglichkeiten<br />
das beste Personal zu gewinnen,<br />
zu überzeugen und zu halten.<br />
Wir müssen uns alle klar darüber sein:<br />
Unsere Soldatinnen und Soldaten sind<br />
ausnahmslos Freiwillige. Sie entscheiden<br />
sich unter mehreren alternativen Angeboten<br />
für uns. Wir müssen sie – gerade<br />
auch in der ersten Phase ihrer Dienstzeit
– überzeugen, dass ihre Entscheidung für<br />
uns die richtige Entscheidung war. Das<br />
betrifft unseren Einsatz für sie, unser Auftreten<br />
und unseren Umgangston, unsere<br />
Zuwendung, die Güte der Ausbildung<br />
und der Führung, die Perspektiven, die<br />
wir ihnen bieten, die Rücksichtnahme<br />
auf ihre Familien und Lebensentwürfe,<br />
den gemeinsamen Stolz, unserem Lande<br />
zu dienen, die Bewährung im Einsatz als<br />
Grundlage unseres Berufsbildes und unserer<br />
Profession.<br />
ES&T: Welche Prioritäten setzen Sie bei<br />
den wesentlichen Rüstungsprojekten für<br />
das Heer?<br />
Freers: Bei knapper werdenden Ressourcen<br />
kommt es mehr denn je darauf an, die<br />
Ausrüstungsplanung an den Erfordernissen<br />
der künftigen Einsätze auszurichten. Im<br />
vergangenen Jahr hat das Heer in Verbindung<br />
mit den strukturellen Überlegungen<br />
zur Neuausrichtung der Bundeswehr die<br />
„Einsatzorientierte Ausrüstungsplanung“<br />
konzipiert. Ziel ist es, den materiellen Anspruch<br />
an ein modernes Einsatzheer mit<br />
den absehbar begrenzten finanziellen Rahmenbedingungen<br />
in Einklang zu bringen.<br />
In der Konsequenz bedeutet dies, dass<br />
es bei der Priorisierung zukünftiger Ausrüstung<br />
auf die konsequente Ausrichtung<br />
auf den vom Heer abgeforderten<br />
BUNDESWEHR & STREITKRÄFTE INTERNATIONAL �<br />
Der Schützenpanzer Puma, das Kampffahrzeug für die Infanterie, soll ab<br />
Mitte 2012 in die Truppe geliefert werden<br />
flexibleren Beitrag ankommt. Dieser Beitrag<br />
erfordert eine neue Ausgewogenheit,<br />
die im Kern drei wesentliche Kriterien<br />
erfüllt:<br />
� Durchsetzungsfähigkeit im gesamten<br />
Aufgaben- und Intensitätsspektrum,<br />
� schnelle Reaktionsfähigkeit,<br />
� Durchhaltefähigkeit, und zwar in einer<br />
neuen Qualität so abgestuft, dass wir<br />
den absehbaren Einsatzbedürfnissen<br />
Rechnung tragen.<br />
Daneben sind drei weitere Forderungen<br />
von zentraler Bedeutung für die Priorisierung<br />
von Rüstungsprojekten:<br />
� Hohe Präzision, um der Situation angepasst<br />
agieren zu können. Das Hauptaugenmerk<br />
liegt in diesem Bereich<br />
auf der Entwicklung und Beschaffung<br />
abstandsfähiger und sehr zielgenauer<br />
Wirkmittel.<br />
� Hoher Schutzfaktor, denn Soldaten der<br />
Landstreitkräfte sind immer „mitten-<br />
High-End Technologie für die Verteidigungstechnik<br />
Die Jenoptik Sparte Verteidigung & Zivile Systeme steht für ganzheitliche Systemlösungen in den Bereichen:<br />
� Energiesysteme,<br />
� Optische Informationssysteme und Sensoren,<br />
� Stabilisierungssysteme sowie<br />
� Radome und Composites.<br />
Besuchen Sie uns auf der Eurosatory in Paris,<br />
11.-15. Juni 2012, Halle 6, Stand G689.<br />
JENOPTIK Verteidigung & Zivile Systeme<br />
www.jenoptik.com/vzs<br />
Foto: KMW GmbH
(Foto: PIZ EinsFüKdo)<br />
� BUNDESWEHR & STREITKRÄFTE INTERNATIONAL<br />
drin“, sei es im Gefecht als auch mit den<br />
Menschen in einem Einsatzland. Hoher<br />
Grad von Vernetzung im System von<br />
Aufklärung, Führung und Wirkung, um<br />
die vielfältigen Teilfähigkeiten des Heeres<br />
im erforderlichen Verbund einsetzen<br />
zu können.<br />
Lassen Sie mich hier noch den Aspekt der<br />
internationalen Kooperation ansprechen.<br />
Diese ist über die Erfordernisse der Interoperabilität<br />
im Einsatz hinaus auch deswegen<br />
richtig, weil wir gemeinsam Kosten<br />
reduzieren und Effizienzgewinne erzielen<br />
können. Die Intensivierung der Kooperation<br />
mit internationalen Partnern bei Beschaffung<br />
und Betrieb von Produkten stellt eine<br />
Möglichkeit dar, begrenzte Ressourcen effizient<br />
zu verwenden und bietet die Chance<br />
für Synergien bei der Ausbildungsgestaltung<br />
und dem Aufbau der Logistik. Dabei können<br />
wir auf die bewährte Partnerschaft mit befreundeten<br />
Nationen bauen. Das Heer versteht<br />
sich als ein Treiber dieser sinnhaften<br />
Kooperation, von der alle Beteiligten Nutzen<br />
haben. Dann ist Kooperation „smart“.<br />
ES&T: Der Ausrüstungs- und Nutzungsprozess<br />
der Bundeswehr wird neu geregelt.<br />
Welche Auswirkungen auf den Bedarfsträger<br />
Heer erwarten Sie von den geplanten<br />
Neuordnungen des Rüstungsbereichs und<br />
wie bringt das Heer seine Vorstellungen<br />
und Forderungen zukünftig ein?<br />
Freers: Im neuen Ausrüstungs- und Nutzungsprozess<br />
wird dem zukünftigen Präsidenten<br />
des Bundesamtes für Ausrüstung,<br />
Informationstechnik und Nutzung<br />
der Bundeswehr (BAAINBw) die alleinige<br />
Materialverantwortung für die Einsatzreife<br />
26 <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · Juni 2012<br />
Der Unterstützungshubschrauber Tiger im scharfen Schuss<br />
übertragen. Die Fachabteilung Ausrüstung,<br />
Informationstechnik und Nutzung (AIN)<br />
im BMVg wird darüber die Fachaufsicht<br />
führen. Dies bedeutet, dass auch die Nutzungssteuerung<br />
zukünftig im BAAINBw<br />
wahrgenommen wird und dort die Nutzungsleiter<br />
abgebildet sein werden.<br />
Das Heer wird weiterhin die Kompetenz<br />
für landbasierte Operationen behalten und<br />
weiterentwickeln. Im Amt für Heeresentwicklung<br />
wird dazu über alle Truppengat-<br />
tungen hinweg die Weiterentwicklungsexpertise<br />
gebündelt.<br />
Aus Sicht des Heeres ergibt sich vorbehaltlich<br />
der noch abzuschließenden Abstimmung<br />
in den Bereichen Customer Product<br />
Management und Integrierter Planungsprozess<br />
folgendes Lagebild:<br />
Das Planungsamt wird als „Arbeitsmuskel“<br />
der Abteilung Planung im BMVg die streit-<br />
kräftegemeinsame Fähigkeitslage führen,<br />
die Ressourcenaufteilung vorbereiten und<br />
ein Fähigkeitscontrolling durchführen. Das<br />
Planungsamt wird zudem die inhaltliche<br />
Ausgestaltung der streitkräftegemeinsamen<br />
Weiterentwicklung vorgeben. Der jeweiligen<br />
Teilstreitkraft wird die organisationsbereichsspezifische<br />
Weiterentwicklung<br />
übertragen. Initiativen und Forderungen<br />
der Organisationsbereiche werden über alle<br />
Planungskategorien (Ausbildung, Perso-<br />
Eine Staublandung gehört in Afghanistan zur Tagesordnung und stellt die Besatzungen der CH-53 GS vor<br />
größte Herausforderungen; verständliche Kommandos und Ansagen beim Landevorgang sind dabei die<br />
Lebensversicherung<br />
nal, Infrastruktur, Organisation und Betrieb)<br />
im Planungsamt gesammelt, bewertet und<br />
der Abteilung Planung zur Entscheidung<br />
vorgelegt. Als einziger Ansprechpartner<br />
bezüglich der verbindlichen Formulierung<br />
von Forderungen, z.B. Fähigkeitslücken,<br />
-überhänge oder Produktverbesserungen,<br />
wird der Bereich Planung auftreten. Bei<br />
größeren Projekten wird ein integriertes
Projektteam (IPT) gebildet, in dem das Heer integriert sein wird.<br />
Das Heer wird bereits in der Analysephase zum Schließen von<br />
materiellen Fähigkeitslücken über die IPT aus dem Amt für<br />
Heeresentwicklung entsprechende Expertise bzw. Forderungen<br />
bedarfsgeregelt in den Prozess einbringen. Das Heer wird<br />
zukünftig die Betriebs- und Versorgungsverantwortung für die<br />
Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft des genutzten Materials<br />
wahrnehmen. Das alles bedeutet eine signifikante Veränderung,<br />
sowohl bei Verantwortung und Zuständigkeit als auch bei Prozessen<br />
und Organisation.<br />
Wir befinden uns im Rahmen der neuen Planungs- und Beschaffungsprozesse<br />
im engen Zusammenwirken aller Beteiligten.<br />
Dabei bringen wir unsere Erfahrungen als Nutzer des Materials<br />
ein – aus Ausbildung, Übung und aus dem Einsatz, aber selbstverständlich<br />
auch aus eigenen konzeptionellen Überlegungen.<br />
Das Heer hat die Veränderungen stets mitgetragen und Beiträge<br />
dazu geleistet. Am Ende ist es der Träger der Einsätze, der am<br />
meisten von einer schnellen und verlässlichen Beschaffung von<br />
modernem Gerät profitiert.<br />
ES&T: Welche Ziele haben Sie sich in Ihrer Funktion im Kdo H<br />
gesetzt; gibt es besondere Herausforderungen, z. B. für die Zeit<br />
nach Afghanistan?<br />
Freers: Zunächst einmal gilt es, die Einsatzbereitschaft des<br />
Kommandos Heer herzustellen – den Weg der Umgliederung<br />
und Aufstellung der zukünftigen Spitzenorganisation<br />
des Heeres habe ich bereits skizziert. Lassen Sie mich ganz<br />
deutlich sagen: Die Aufstellung dieses Kommandos und das<br />
Herstellen der Führungsfähigkeit wird eine sehr komplexe Aufgabe.<br />
Wir bündeln Funktionen und Expertise aus mehr als<br />
zwei Standorten (Bonn und Koblenz, teilweise auch aus Köln)<br />
an einem neuen – in Strausberg. Zusätzlich knüpfen wir an<br />
neue Prozesse und Verfahren unserer übergeordneten Führung<br />
an, also an das derzeit im Übergang befindliche BMVg,<br />
dazu stimmen wir uns in neu auszurichtenden Verfahren mit<br />
unseren „Nachbar-Kommandos und -Ämtern“ ab. Weiterhin<br />
gilt es, die anschließende Umstrukturierung des nachgeordneten<br />
Bereichs des Heeres zu steuern und zu realisieren. All<br />
dies wird eine Herkulesaufgabe sein, bei der größte Sorgfalt<br />
erforderlich ist – zu Einem darf das nicht führen, dass wir die<br />
Einsätze und die Bedürfnisse unserer Einsatztruppe aus dem<br />
Blick verlieren. Hier liegt weiter der Schwerpunkt. Wir werden<br />
als größter Truppensteller die laufenden Einsätze auch<br />
zukünftig ohne Abstriche sicherstellen – gerade der Einsatz in<br />
Afghanistan wird uns hier in den kommenden Jahren weiterhin<br />
sehr fordern. Aber auch für die Einsätze vom Balkan über<br />
Nordafrika bis hin zu den einsatzgleichen Verpflichtungen gilt<br />
dasselbe.<br />
Eine große Herausforderung wird es sein, uns auf die möglichen<br />
Einsätze in der Zukunft auszurichten. Wir werden uns wieder<br />
verstärkt auf eine breit angelegte Ausbildung im gesamten Spektrum<br />
möglicher Einsätze konzentrieren – die neue Struktur wird<br />
die Chance dafür geben. Genau darauf haben wir unsere neue<br />
Struktur angelegt und genau dies müssen wir jetzt auch in allen<br />
Bereichen konsequent umsetzen. Das Heer ist kein Afghanistan-<br />
Heer und es wird auch kein solches werden. Wir lernen aus den<br />
laufenden Einsätzen, aber unser Handeln muss ein breiteres Fähigkeitsspektrum<br />
erfassen, als es im Afghanistan-Einsatz gefordert<br />
ist. Hier wird neben den aktuellen Einsätzen der künftige<br />
Schwerpunkt unserer Arbeit im Kommando Heer liegen, um das<br />
verlässlich bereitzustellen, was von uns gefordert ist: Expertise als<br />
Träger der Landoperationen im gesamten Spektrum und höchste<br />
Professionalität für alle Einsätze der Zukunft.<br />
Die Fragen stellte Michael Horst.<br />
��������������������������<br />
�������������������������������������������������������<br />
������ ������� ���� ����� ���������� �������������� ����� �����<br />
���� ������������ ������������ ������ ������� �����������<br />
���������� �������� ���� ������ ���� ����������������������<br />
���������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������<br />
�������������������<br />
������������������� �������������������<br />
����������������
(Foto: PIZ/M)<br />
� RÜSTUNG & TECHNOLOGIE<br />
Einsatzgruppenversorger<br />
Die größten Schiffe der Marine Dieter Stockfisch<br />
EGV FRANKFURT AM MAIN versorgt<br />
die Fregatte HESSEN<br />
Die drei Einsatzgruppenversorger (EGV) der Klasse 702, die BERLIN, FRANKFURT AM MAIN und BONN, sind<br />
die größten Schiffe der Deutschen Marine. Ihre zentrale Aufgabe ist die weltweite logistische Versorgung/<br />
Unterstützung von Booten und Schiffen der Marine im Rahmen der Konfliktverhütung und Krisenbewältigung<br />
sowie bei humanitären Einsätzen. Als „Arbeitspferde“ der Flotte, die ständig im Einsatz sind, sind sie<br />
unverzichtbar geworden. In Kanada steht der EGV neben einem kanadischen Entwurf auf der „Short List“<br />
zum Erwerb zweier Joint Support Ships für die kanadische Marine.<br />
Mit den Einsatzgruppenversorgern<br />
hat die Deutsche Marine im<br />
Rahmen der Konfliktverhütung<br />
und Krisenbewältigung einschließlich des<br />
Kampfes gegen den internationalen Terrorismus<br />
die Fähigkeit zur weit reichenden<br />
(weltweiten) logistischen und sanitätsdienstlichen<br />
Einsatzunterstützung erhalten.<br />
Durch ihre Unterstützungsleistungen<br />
wird die Seeausdauer der Einsatzverbände<br />
auf 45 Seetage ausgedehnt.<br />
Aufgaben<br />
Die Aufgaben der geräumigen und für umfassende<br />
Lagerhaltung ausgelegten EGV<br />
bestehen in der unmittelbaren Versorgung<br />
und Unterstützung der Einsatzverbände<br />
der Marine in ihren weltweiten Einsätzen in<br />
See. Im Detail zählen zu den Versorgungsleistungen<br />
der EGV für Einsatzverbände:<br />
Betriebsstoffe für Schiffe und Hubschrauber,<br />
Verpflegung, Frischwasser, Marketenderwaren,<br />
Munition, Versorgungsgüter<br />
62 <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · Juni 2012<br />
aller Art und Sanitätsmaterial. Hinzu kommen<br />
Unterbringung sowie Betrieb und<br />
Wartung von zwei Hubschraubern (Typ Sea<br />
King), Entsorgung der Einsatzgruppe von<br />
Abwasser, Müll, Altöl oder Munitionsleergut,<br />
schneller Transport von Material- und<br />
Ersatzteilen sowie Personen, Transport und<br />
Betrieb von 78 Containern (20 Fuß) bzw. 24<br />
Containern (40 Fuß).<br />
MERZ<br />
Eine herausragende Ausrüstung bzw. Fähigkeit<br />
der EGV bildet das Marineeinsatzrettungszentrum<br />
(MERZ). Es besteht aus 26<br />
Spezialcontainern (20 Fuß), die als Behandlungs-,<br />
Labor- sowie einem Pflegebereich<br />
für 42 Verwundete ausgeworfen und miteinander<br />
verbunden sind. Im Hubschrauberhangar<br />
besteht die Aufnahmekapazität<br />
für weitere ca. 100 Leichtverwundete. Zur<br />
präklinischen Versorgung zählen u.a. notfallmedizinische,<br />
intensivmedizinische, internistische<br />
und zahnärztliche Behandlung<br />
Transport- /Beladungskapazität<br />
Dieselkraftstoff: 8.900 m³<br />
Flugkraftstoff: 600 m³<br />
Schmieröle: 110 m³<br />
Frischwasser: 1.330 m³<br />
20-Fuß-Container: 78 (inkl. MERZ)<br />
Munition: 260 t<br />
Kühl-/Tiefkühlwaren: 125 t<br />
Proviant: 100 t<br />
Sonstige Versorgungsgüter: 100 t<br />
und Versorgung einschließlich lebensrettender<br />
Maßnahmen. Die notfallmedizinische<br />
Kapazität entspricht der eines Kreiskrankenhauses.<br />
Kern des MERZ bilden zwei<br />
Operationsräume, in denen zwei Operationsteams<br />
gleichzeitig arbeiten können.<br />
Zudem gibt es einen Röntgenbereich, eine<br />
Intensivstation, Zahnlaborräume, eine<br />
Apotheke sowie eine Sterilisationsanlage.
Der neue EGV BONN am Tag seiner Taufe an der Ausrüstungspier in Emden<br />
Schiffstechnische Daten<br />
Die EGV sind als Doppelhüllenschiffe konzipiert<br />
und erfüllen damit die neuesten<br />
Vorschriften zur Verhinderung der Meeresverschmutzung<br />
u.a. mit Öl bei Kollisionen<br />
oder Strandungen. Zur Kostenreduzierung<br />
Hauptdaten<br />
Länge: 173,70 m<br />
Breite: 24,00 m<br />
Tiefgang: 7,40 m<br />
Verdrängung: 20.240 t<br />
Dieselmotoren: 2 x 5.280 kW<br />
Geschwindigkeit: 20 kn<br />
Stammbesatzung: 151<br />
Max. Besatzung: 239<br />
Bewaffnung:<br />
4 x Marineleichtgeschütz 27 mm<br />
4 x Schw. Maschinengewehr 12,7 mm<br />
2 x Fliegerfaust<br />
2 x RAM (vorgesehen)<br />
2 x Hubschrauber (Sea King)<br />
wurde beim Bau weitgehend auf Erfahrungen<br />
und technische Lösungen aus dem Bau<br />
von Handelsschiffen bei den beteiligten<br />
Werften zurückgegriffen. Zur Ausrüstung<br />
gehören: 4 Motorrettungs- und 2 Bereitschaftsboote,<br />
eine Pinasse sowie 2 Bordkräne<br />
mit je 24 t Nutzlast.<br />
Taufe der BONN<br />
Am 17.April 2012 wurde in Anwesenheit<br />
des Verteidigungsministers Thomas de<br />
Maizière der dritte EGV, die BONN, in Emden<br />
getauft. Es ist das 2. Los EGV der Klasse<br />
702. Damit setzt sich die Erfolgsgeschichte<br />
der EGV fort. Dabei stellt die BONN keinen<br />
reinen Nachbau ihrer Schwesterschiffe dar.<br />
Die gesammelten Einsatzerfahrungen mit<br />
den beiden Schiffen BERLIN und FRANK-<br />
FURT AM MAIN sowie das stetig gewachsene<br />
Aufgabenspektrum der Deutschen<br />
Marine und die Anpassung der Anlagen<br />
und Systeme an den neuesten Stand der<br />
<strong>Technik</strong> haben bei der BONN zu zahlreichen<br />
Modifikationen geführt:<br />
� Ein neues Konzept für die Antriebsanlage<br />
(neue Fahrmotoren mit 2 x 7.200<br />
kW) mit einer 33-prozentigen höheren<br />
Antriebsleistung und deutlich geringerem<br />
Kraftstoffverbrauch,<br />
� zusätzlicher Raum für die Einschiffung<br />
eines internationalen Führungsstabes<br />
wie z.B. einer Command Task Group<br />
zur Lageführung einschließlich entsprechender<br />
Kommunikationsanlagen,<br />
� Integration eines Hubschrauberleitsystems<br />
zur sicheren Führung von Bordhubschraubern<br />
auch unter schwierigen<br />
Wetterbedingungen,<br />
� Integration einer Multisensorplattform<br />
(MSP 600 TV- und Wärmebildkameras)<br />
zur 360°-Rundumüberwachung des<br />
Schiffes zum Eigenschutz.<br />
Wie seine Schwesterschiffe ist auch der<br />
dritte EGV weit mehr als ein einfacher Versorger<br />
oder bloßer Doppelhüllentanker.<br />
Die BONN ist vor allem eine Antwort auf<br />
die gestiegenen Anforderungen der Deutschen<br />
Marine u.a. im Zusammenhang mit<br />
weltweiten internationalen Einsätzen wie<br />
beispielsweise der Operation „Atalanta“,<br />
UN-Einsätze wie UNIFIL oder humanitäre<br />
(Foto: PIZ/M)<br />
RÜSTUNG & TECHNOLOGIE �<br />
Der Minister bei der Taufrede<br />
Missionen wie bei der Tsunami-Katastrophe<br />
in Indonesien.<br />
Durch den Zusammenschluss von vier<br />
Werften zu einer Arbeitsgemeinschaft<br />
(ARGE) und eine detaillierte Arbeitsteilung<br />
war es gelungen, die BONN in kurzer<br />
Bauzeit zu fertigen. Zur ARGE gehörten<br />
neben der ThyssenKrupp Marine Systems<br />
AG die Fr. Lürssen Werft, die Flensburger<br />
Schiffbau-Gesellschaft und die P + S<br />
Werften GmbH. Die BONN wird im Juli<br />
2012 ihre technischen Erprobungen in<br />
See durchführen und soll Ende September<br />
2012 abgeliefert werden.<br />
Der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral<br />
Axel Schimpf, hob in seiner Taufrede die<br />
Bedeutung des dritten Einsatzgruppenversorgers<br />
BONN für die Deutsche Marine<br />
hervor: „Der Einsatzgruppenversorger<br />
BONN ist das dritte Schiff der Klasse 702.<br />
Die BONN und ihre zwei Schwesterschiffe<br />
stehen für eine konsequente Einsatzorientierung<br />
unserer Streitkräfte. Mit diesem<br />
Vergleich zwischen den Einsatzgruppenversorgern des ersten Loses mit<br />
dem EGV des zweiten Loses, der BONN<br />
Schiff erhalten wir ein modernes und zukunftsfähiges<br />
maritimes Einsatzmittel,<br />
das uns viele Möglichkeiten des Handelns<br />
eröffnet – auch und gerade für streitkräftegemeinsame<br />
und internationale Einsätze<br />
und Verpflichtungen.“ �<br />
Juni 2012 · <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
63<br />
(Grafik: ARGE EGV)<br />
(Foto: R. Metzner)
(Grafiken: ESA/P.Carril)<br />
� RÜSTUNG & TECHNOLOGIE<br />
Galileo<br />
Das <strong>Europäische</strong> Satellitennavigationssystem Sven Kühberger<br />
Darstellung des IOV-Launch<br />
Der erfolgreiche Start der ersten beiden operationellen Galileo-Satelliten am 21. Oktober 2011 ist für das<br />
europäische Satellitennavigationssystem ein sehr bedeutendes Ereignis gewesen. An Bord der russischen<br />
Sojus-Rakete wurden die beiden Satelliten von dem Weltraumhafen Kourou in Französisch-Guayana in<br />
eine Höhe von über 23.000 km befördert. Der Vollausbau des Systems soll im Jahr 2020 mit einer Anzahl<br />
von 30 Satelliten erreicht werden und seine Dienste weltweit zur Verfügung stellen.<br />
Das eigenständige europäische Satellitennavigationsprogramm<br />
Galileo<br />
wird von der <strong>Europäische</strong>n Union<br />
(EU) und der <strong>Europäische</strong>n Weltraumbehörde<br />
(ESA) durchgeführt. Die europäischen<br />
Staaten erhoffen sich mit diesem<br />
Großvorhaben, einen großen Anteil auf<br />
dem globalen Markt der Satellitennavigation<br />
sichern zu können. Schätzungen zufolge<br />
wird im Jahr 2020 das Weltmarktvolumen<br />
an Satellitennavigationsanwendungen<br />
ca. 240 Milliarden Euro betragen. Die<br />
erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts hat<br />
für den Wirtschaftsraum der EU positive<br />
wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen.<br />
Dies führt unter anderem zu<br />
einem Zuwachs an Arbeitsplätzen, einem<br />
höheren Marktanteil in dieser Branche und<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. (FH) Sven Kühberger ist<br />
Sachbearbeiter Satellitennavigation<br />
bei der WTD 81 – Geschäftsfeld<br />
Navigation.<br />
88 <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · Juni 2012<br />
einem weiteren Wissensaufbau auf dem<br />
Gebiet der Weltraumtechnologie. Diese<br />
nachhaltige Entwicklung wird in dem EU-<br />
Wirtschaftsprogramm „Europa 2020“ wie<br />
folgt zum Ausdruck gebracht:<br />
„Europa 2020 ist die Wachstumsstrategie<br />
der EU für das kommende Jahrzehnt. In<br />
einer Welt, die sich immer weiter entwickelt,<br />
wünschen wir uns eine intelligente,<br />
nachhaltige und integrative Wirtschaft für<br />
Europa. Diese drei Prioritäten, die sich gegenseitig<br />
verstärken, dürften der EU und<br />
den Mitgliedstaaten helfen, ein hohes Maß<br />
an Beschäftigung, Produktivität und sozialem<br />
Zusammenhalt zu erreichen.<br />
Dieser Wunsch findet seinen konkreten<br />
Ausdruck in den ehrgeizigen Zielen, die die<br />
Union in den fünf Bereichen Beschäftigung,<br />
Innovation, Bildung, soziale Integration und<br />
Klima/Energie bis 2020 verwirklicht sehen<br />
will. Jeder Mitgliedstaat hat für jeden dieser<br />
Bereiche seine eigenen nationalen Ziele<br />
festgelegt. Ferner wird diese Strategie durch<br />
konkrete Maßnahmen auf der Ebene der EU<br />
und der Mitgliedstaaten untermauert.“<br />
Kosten und Roadmap<br />
Zu Beginn wurden die Gesamtkosten für<br />
das Projekt Galileo auf 3,4 Milliarden Euro<br />
geschätzt. Durch steigende Kosten musste<br />
diese Zahl im Laufe der Jahre jedoch angepasst<br />
werden. Laut Angaben der <strong>Europäische</strong>n<br />
Kommission wird aktuell von 7 Milliarden<br />
Euro Gesamtkosten als Obergrenze<br />
für Galileo und EGNOS (European Geostationary<br />
Navigation Overlay Service) ausgegangen.<br />
Die Betriebskosten für Galileo und<br />
das Erweiterungssystem EGNOS werden<br />
mit 800 Millionen Euro jährlich beziffert.<br />
Das notwendige Budget für den Aufbau<br />
und den Betrieb der beiden Systeme ist für<br />
die Jahre 2014 bis 2020 im Haushalt der EU<br />
verankert.<br />
Das Galileo-Programm wird in mehreren<br />
Stufen realisiert. Derzeit wird die Phase der<br />
In-Orbit-Validation (IOV) durchlaufen, die<br />
bis 2014 andauert. Bereits in den Anfängen<br />
des Programms, in den Jahren 2005<br />
bis 2008, wurden die Testsatelliten GIO-<br />
VE-A und GIOVE-B in die Erdumlaufbahn
Darstellung eines Galileo-Satelliten<br />
gebracht. Diese dienten zur Qualifizierung<br />
und Validierung der kritischen Systemkomponenten<br />
(Atomuhren) und zur Sicherung<br />
des Frequenzbereichs für das europäische<br />
System. In der Phase, der „Initial Operational<br />
Capability (IOC)“, welche von 2014 bis 2016<br />
geplant ist, werden sich bereits 18 Satelliten<br />
im Orbit befinden und die Galileo-Dienste<br />
Open Service (OS), Search and Rescue (SAR)<br />
und Public Regulated Service (PRS) für erste<br />
Anwendungen zur Verfügung stellen. Während<br />
der Bau der ersten vier IOV-Satelliten<br />
von der EADS Tochtergesellschaft Astrium<br />
realisiert wurde, werden die restlichen 14<br />
IOC-Satelliten von dem Bremer Technologie-<br />
und Raumfahrtkonzern OHB hergestellt.<br />
Anfang 2012 erhielt das Bremer Unternehmen<br />
OHB den Zuschlag für weitere acht<br />
Satelliten. Der Vollausbau des Systems soll<br />
in der letzten Stufe, der so genannten „Full<br />
Operational Capability“ mit 30 Satelliten (27<br />
für den operationellen Betrieb und drei als<br />
Reserve) und allen Diensten, bis 2020 fertig<br />
gestellt werden.<br />
Satellitennamen<br />
Die Namensgebung der Satelliten erfolgte<br />
durch einen EU-weiten Zeichenwettbewerb<br />
bis Ende 2011. An dem Wettbewerb<br />
konnte jedes Kind, welches in einem der 27<br />
EU Mitgliedstaaten lebt und in den Jahren<br />
2000, 2001 oder 2002 geboren wurde,<br />
teilnehmen. Jeder Gewinner erhielt ein Zertifikat<br />
und eine Trophäe, welche den nach<br />
ihm benannten Galileo-Satelliten zeigt. Die<br />
Gewinner für die ersten beiden Satelliten,<br />
welche im Oktober 2011 starteten, wurden<br />
bereits bekannt gegeben. Sie lauten Natalia<br />
(Bulgarien) und Thijs (Belgien).<br />
Globaler Stand<br />
Im operationellen Betrieb befinden sich derzeit<br />
zwei globale Navigationssatellitensysteme<br />
(engl. Global Navigation Satellite System,<br />
GNSS): Das amerikanische NAVSTAR<br />
GPS (Navigation System with Timing and<br />
Ranging Global Positioning System) sowie<br />
das russische GLONASS (Globalnaja Nawigazionnaja<br />
Sputnikowaja Sistema). Ne-<br />
ben diesen bereits verfügbaren Systemen<br />
werden aktuell das europäische Galileo<br />
und das chinesische COMPASS/Beidou-2<br />
(Compass Navigation Satellite System) aufgebaut.<br />
Galileo wird als rein ziviles System<br />
aufgebaut und betrieben. Die Möglichkeit<br />
zur militärischen Nutzung des Systems wird<br />
dabei jedoch nicht ausgeschlossen.<br />
Funktionsweise<br />
Alle Satellitennavigationssysteme beruhen<br />
auf dem Prinzip der Einweg-Laufzeitmessung.<br />
Dabei ist es für die dreidimensionale<br />
Positionsbestimmung notwendig, die Signale<br />
von drei Satelliten zu empfangen<br />
und deren Laufzeit auszuwerten. Für diese<br />
Auswertung müssen Empfänger und Satelliten<br />
über dieselbe Systemzeit verfügen.<br />
Durch die Integration von hochgenauen<br />
Atomuhren in die Satelliten wurde hier das<br />
notwendige Zeitnormal realisiert. Für eine<br />
kostengünstige Empfängerentwicklung<br />
wurde jedoch auf eine genaue Zeitbasis<br />
im Navigationsempfänger verzichtet und<br />
die Zeit als vierte Unbekannte angenommen.<br />
Somit ergibt sich ein System mit vier<br />
Unbekannten (x, y, z, t), was zur Folge hat,<br />
dass die genaue Positionsbestimmung nur<br />
mit vier Satelliten möglich ist. Die Navigationsnachricht<br />
der einzelnen Satelliten<br />
besitzt eine genau definierte Struktur und<br />
enthält Informationen, aus denen der<br />
Empfänger die gewünschte PVT-Lösung<br />
(Position, Velocity und Time) berechnen<br />
kann. Dazu zählen die genaue Systemzeit,<br />
die Ephemeriden (eigene Bahndaten) und<br />
der Almanach (grobe Bahndaten der anderen<br />
Satelliten).<br />
Systemarchitektur<br />
Die Architektur eines jeden Satellitennavigationssystems<br />
umfasst drei Bereiche:<br />
� ��� Bodensegment ist für die Kontrolle<br />
des Gesamtbetriebs zuständig und<br />
stellt somit den reibungslosen Betrieb des<br />
Systems sicher. Um diese Herausforderung<br />
meistern zu können, ist eine umfangreiche<br />
Infrastruktur in Form einer Hauptkontrollstation<br />
sowie mehreren Monitor- und<br />
RÜSTUNG & TECHNOLOGIE �<br />
Bodensendestationen erforderlich. Durch<br />
diese kontinuierliche Überwachung des<br />
Gesamtsystems und der laufenden Korrektur<br />
der Bahnparameter wird die einwandfreie<br />
Funktion, hohe Verfügbarkeit<br />
und hohe Genauigkeit der Positionsbestimmung<br />
eines GNSS gewährleistet. Eine<br />
weitere Herausforderung besteht in der<br />
Synchronisation der Satellitenuhr auf die<br />
exakte Systemzeit. Ein Abweichen von<br />
einer Mikrosekunde würde bereits einen<br />
Positionsfehler von 300 m nach sich ziehen<br />
und somit eine genaue Positionsbestimmung<br />
in Frage stellen. Anhand der gewonnenen<br />
Korrekturdaten wird die Navigationsnachricht<br />
angepasst und über eine<br />
Sendestation an die Satelliten geschickt.<br />
� ��� Raumsegment umfasst die Satelliten,<br />
welche in einer Höhe von rund 20.000<br />
km die Erde umkreisen und die Signale zur<br />
Positions- und Zeitbestimmung abstrahlen.<br />
Diese Erdtrabanten besitzen eine durchschnittliche<br />
Lebensdauer von 10 bis 15<br />
Jahren. Der notwendige Ersatz von alten<br />
Satelliten wird zugleich zur Modernisierung<br />
und Erweiterung des Systems durch<br />
eine weiterentwickelte Satellitentechnologie<br />
und neue Signalstrukturen genutzt.<br />
Dadurch ist es möglich, zukünftig weitere<br />
Dienste und neue Funktionen anbieten zu<br />
können.<br />
� ��� ����������� ����������� ����� �����litennavigationssystems<br />
ist das Nutzersegment.<br />
Dieses setzt sich aus der Vielfalt der<br />
GNSS-Empfänger aus dem militärischen<br />
und zivilen Bereich für eine unzählige Bandbreite<br />
an Anwendungen zusammen. Die<br />
Navigationsempfänger haben die Aufgabe,<br />
die PVT-Lösung zu bestimmen und diese<br />
zur Positionierung, Navigation oder als Zeitreferenz<br />
zur Verfügung zu stellen.<br />
Ergänzungssysteme<br />
Zur Unterstützung von Satellitennavigationssystemen<br />
werden einige Zusatzsysteme<br />
angeboten. Mit diesen ist es möglich,<br />
die Positionsgenauigkeit der Endgeräte<br />
zu verbessern. EGNOS ist ein solches Ergänzungssystem.<br />
Mit dessen Hilfe soll<br />
die Positionsgenauigkeit von GPS im europäischen<br />
Raum erhöht werden und für<br />
kritische Anwendungen eine Integritätsmeldung<br />
zur Verfügung stellen. Unter Integrität<br />
versteht man bei der Satellitennavigation<br />
die Fähigkeit, dem Nutzer einen<br />
Vertrauenswert über die empfangenen<br />
Navigationsdaten mitzuteilen. Mit einfachen<br />
Worten bedeutet dies, den Bediener<br />
eines GNSS-Empfängers rechtzeitig zu<br />
informieren, falls dieser die vom System<br />
gelieferten fehlerhaften Informationen<br />
nicht zur Bestimmung einer PVT-Lösung<br />
verwenden soll. Da EGNOS vollständig<br />
Juni 2012 · <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
89
� RÜSTUNG & TECHNOLOGIE<br />
kompatibel zu Galileo ist, können zukünftig<br />
auch diese Anwender von dem Mehrwert<br />
profitieren.<br />
Hauptmerkmale, Aufbau<br />
und Architektur<br />
Zu den Hauptmerkmalen des europäischen<br />
Systems werden die folgenden Eigenschaften<br />
gezählt:<br />
� Unabhängigkeit: Galileo wird als eigenständiges<br />
System aufgebaut.<br />
� Verfügbarkeit: Galileo wird weltweit<br />
empfangbare Dienste bereitstellen.<br />
� Interoperabilität: Galileo wird zusammen<br />
mit anderen Systemen (GPS) nutzbar<br />
sein.<br />
� Genauigkeit: Hohe Positions- und Zeitgenauigkeit<br />
durch neueste Technologie.<br />
� Integrität: Fähigkeit zur Aussendung<br />
einer Integritätsnachricht (Umsetzung<br />
noch offen).<br />
� Dienstorientiert: Galileo bietet für jede<br />
Anwendung den richtigen Dienst an<br />
(offen, kommerziell, sicherheitskritisch,<br />
reguliert).<br />
Damit diese Merkmale realisiert werden<br />
können, ist eine sehr komplexe Infrastruktur<br />
und Systemarchitektur notwendig. Die<br />
beiden gleichberechtigten Galileo-Kontrollzentren<br />
(Galileo Ground Control Center,<br />
GCC) befinden sich in Oberpfaffenhofen/<br />
Deutschland und in Fucino/Italien und sind<br />
für die Überwachung und Steuerung des<br />
Gesamtsystems zuständig. Bei dieser Aufgabe<br />
werden sie von global verteilten Bodenstationen<br />
unterstützt.<br />
Geplante Galileo-Dienste<br />
Dienst Beschreibung<br />
Offener Dienst<br />
Open Service – OS<br />
Kommerzieller Dienst<br />
Commercial Service – CS<br />
Sicherer Dienst<br />
Safety of Life – SoL<br />
Staatlicher/regulierter Dienst<br />
Public Regulated Service – PRS<br />
Such- und Rettungsdienst<br />
Search and Rescue – SAR<br />
Für die Nationen, die sich für die Nutzung<br />
des öffentlich regulierten Dienstes (Public<br />
Regulated Service, PRS) entscheiden, gibt<br />
es die Vorgabe, eine eigene PRS-Behörde<br />
(Competent PRS Authority, CPA) aufzu-<br />
90 <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · Juni 2012<br />
bauen. Die CPA muss sicherstellen, dass<br />
die Zugangsregelung und Mindeststandards<br />
der EU eingehalten werden. Das<br />
Galileo Security Monitoring Centre dient<br />
dabei als Schnittstelle zwischen Nutzerstaaten,<br />
Organen der EU und den Kontrollstationen.<br />
Die Galileo-Satelliten zählen mit einer Primärleistung<br />
von 1.500 W, ihren Abmessungen<br />
von 2,7 m x 1,2 m x 1,1 m und einer<br />
Masse von 680 kg zu den Minisatelliten.<br />
Neben den Standardsystemen zur Bahn-<br />
und Lagekontrolle besitzen die Satelliten<br />
einen Laser-Reflektor zur Unterstützung<br />
der Bestimmung der Umlaufbahnen mit<br />
Hilfe eines Laserentfernungsmessers. Die<br />
Nutzlast stellt sich aus den Atomuhren, den<br />
Komponenten zur Erstellung der Navigationsnachricht,<br />
dem Endverstärker und der<br />
L-Band Antenne zusammen.<br />
Galileo soll in seinem voll ausgebauten Zustand<br />
fünf Dienste zur Verfügung stellen.<br />
Diese Dienste werden für den gezielten Einsatzbereich<br />
Zusatzinformationen oder spezielle<br />
Eigenschaften, wie eine Verschlüsselung<br />
oder robuste Signalstruktur, besitzen.<br />
PRS/Militär/Bundeswehr<br />
Der Public Regulated Service wird ab<br />
2016 mit 18 Satelliten einen operationellen<br />
Erstbetrieb ermöglichen und somit<br />
für hoheitliche Aufgaben (Polizei, Zoll,<br />
Rettungskräfte und Militär) zur Verfügung<br />
stehen. Damit der regulierte Dienst<br />
diesen Anforderungen gerecht wird, ist<br />
neben den technischen auch eine Reihe<br />
Freier und kostenloser Dienst für Massenmarktanwendungen zur<br />
einfachen PVT-Bestimmung. (z. B. Auto-Navigationsgerät)<br />
Kostenpflichtiger und verschlüsselter Dienst mit höherer Genauigkeit<br />
und Mehrwert in Form von zusätzlichen Funktionen für den professionellen<br />
Einsatz. (z. B. Transportunternehmen, Landwirtschaft)<br />
Beinhaltet eine Integritätsmeldung für sicherheitskritische<br />
Anwendungen (z. B. See-, Luft-, Schienenverkehr)<br />
Robuster und verschlüsselter Dienst mit kontinuierlicher Verfügbarkeit<br />
(Polizei, Militär, hoheitliche Aufgaben)<br />
Ermöglicht in Kombination mit anderen Systemen die Ortung von<br />
Notsendern und stellt einen annähernd echtzeitfähigen Rückkanal<br />
für Such- und Rettungseinsätze zur Verfügung. (z. B. Berg-/Wasserwacht,<br />
Sport und Freizeit)<br />
von organisatorischen Maßnahmen notwendig.<br />
Darunter zählt vor allem die Regelung<br />
des Zugangs (Access Rules) zu diesem<br />
Dienst, welcher in dem EU-Beschluss<br />
Nr. 1104/2011/EU eindeutig festgelegt<br />
ist. Neben dieser Zugangsregelung wird<br />
es außerdem Vorgaben zur Verwaltung,<br />
Herstellung und Nutzung von PRS-Geräten<br />
geben, wobei hier ebenfalls auf die<br />
einzuhaltenden Mindeststandards (Common<br />
Minimum Standards, CMS) verwiesen<br />
wird. Dieses Dokument befindet sich<br />
derzeit in der Entstehung und soll Richtlinien<br />
zum Erreichen eines gemeinsamen<br />
<strong>Sicherheit</strong>sstandards vorgeben.<br />
Über ein Abkommen (Memorandum of<br />
Understanding, MoU) mit den USA ist es<br />
dem Militär einiger Staaten, darunter auch<br />
den deutschen Streitkräften möglich, den<br />
militärischen GPS-Dienst (P/Y-Kode) zu<br />
nutzen. Für die Bundeswehr stellt die Navigation<br />
eine Kernfähigkeit dar und zählt als<br />
Grundvoraussetzung für die Fähigkeit der<br />
Vernetzten Operationsführung. Um die Einsatzfähigkeit<br />
der Streitkräfte im Rahmen von<br />
nationalen und internationalen Einsätzen sicherzustellen,<br />
ist die Verfügbarkeit und der<br />
Schutz von Positions- und Zeitinformationen<br />
zu gewährleisten. Für diese Gewährleistung<br />
ist es notwendig, Schutzmechanismen und<br />
Rückfallpositionen zu entwickeln und zur<br />
Verfügung zu stellen. Der PRS würde hier als<br />
zweiter verschlüsselter Dienst einen erheblichen<br />
Mehrwert bringen. Die Kombination<br />
des kryptierten GPS- und Galileo-Dienstes<br />
in einen so genannten Multi-GNSS-Empfänger<br />
würde den Schutz vor Störungen<br />
bedeutend erhöhen. Neben einer erhöhten<br />
Verfügbarkeit durch eine größere Anzahl an<br />
Satelliten ist auch der Empfang der Navigationsnachricht<br />
auf einer weiteren Frequenz<br />
ein entscheidender Vorteil. Damit jedoch<br />
auch bei Ausfall der GPS- bzw. Galileo-<br />
Komponente die Fähigkeit der Navigation<br />
für bedeutende Systeme erhalten bleibt, ist<br />
es zweckmäßig, einen störunempfindlichen<br />
Navigationssensor in Form einer Inertialanlage<br />
mitzuführen. Die Integration einer störunterdrückenden<br />
Arrayantenne (Controlled<br />
Reception Pattern Antenna, CRPA) stellt eine<br />
weitere Maßnahme zur Härtung des GNSS-<br />
Empfängers dar. Die Sicherstellung der eigenen<br />
Navigationsfähigkeit wird im Rahmen<br />
der Teilkonzeption „Navigation (Positionsbestimmung,<br />
Navigation und Zeitfestlegung)<br />
in der Bundeswehr“ gefordert.<br />
Das Geschäftsfeld Navigation (GF 430)<br />
der Wehrtechnischen Dienststelle für Informationstechnologie<br />
und Elektronik<br />
(WTD 81) in Greding ist für die technische<br />
Expertise und fachliche Beratung im Bereich<br />
der Land- und Satellitennavigation<br />
in der Bundeswehr zuständig. Zu diesem<br />
Aufgabenspektrum zählt die Beschaffung,<br />
Qualifizierung und Betreuung von<br />
Navigationsanlagen im Landbereich sowie<br />
von Satellitennavigationsempfängern. Die<br />
Bereitstellung von militärischen GPS-Empfängern,<br />
die nur von den USA beschafft
(Foto: ESA)<br />
Galileo FOC-Satelliten<br />
Galileo In-Orbit-Testing-Centre in Redu/Belgien<br />
werden können, wird dabei über das Verfahren<br />
Foreign Military Sales abgewickelt.<br />
Die Navigationssysteme werden darüber<br />
hinaus während der Nutzungsdauer betreut<br />
und bis zur Aussonderung begleitet.<br />
Neben der Betreuung und Bearbeitung<br />
von Vorhaben der Forschung und Technologie<br />
werden auch Untersuchungen zu<br />
Navigation Warfare (NAVWAR) durchgeführt.<br />
Unter NAVWAR werden operationelle<br />
Maßnahmen zusammengefasst, welche<br />
die Verfügbarkeit und den Schutz der<br />
eigenen Navigationsfähigkeit sicherstellen<br />
und die des Gegners unterbinden. Ein weiteres<br />
Tätigkeitsfeld ist das Vertreten der<br />
Interessen der Bundeswehr auf nationaler<br />
und internationaler Ebene. Hier setzt sich<br />
die WTD 81 in Zusammenarbeit mit der Industrie,<br />
den Ministerien und Institutionen<br />
dafür ein, die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr<br />
aufrechtzuerhalten und für zukünftige<br />
Anforderungen gerüstet zu sein. Durch<br />
das Mitwirken in den Gremien der NATO,<br />
der <strong>Europäische</strong> Kommission sowie bilateralen<br />
internationalen Gesprächen werden<br />
die im globalen Rahmen vereinbarten und<br />
abgestimmten Entscheidungen mitgestaltet.<br />
Nur so ist es möglich, frühzeitig nationale<br />
Anforderungen und Vorgaben einfließen<br />
zu lassen. Die WTD 81 vertritt dabei<br />
den Gedanken der Interoperabilität und<br />
Kompatibilität der Systeme. Dies ist sehr<br />
eng mit der Abstimmung und Standardisierung<br />
von Formfaktoren, Schnittstellen<br />
und Prozessen verbunden. Dadurch soll<br />
ein einheitliches Agieren bei streitkräfteübergreifenden<br />
und multinationalen Einsätzen<br />
ermöglicht und eine solide Basis für<br />
zukünftige Navigationssysteme und kombinierte<br />
Empfänger geschaffen werden. In<br />
NATO-Gruppen, die sich mit Satellitennavigation<br />
beschäftigen, werden unter anderem<br />
die Verlängerung und Anpassung<br />
des MoU zur Nutzung des militärischen<br />
GPS diskutiert. Hier vertritt die WTD 81<br />
maßgeblich die Nutzerinteressen. Die Arbeitsgruppen<br />
der <strong>Europäische</strong>n Kommission<br />
befassen sich unter anderem mit dem<br />
kryptierten Dienst von Galileo und stellen<br />
eine Schnittstelle zu den Mitgliedstaaten<br />
VORSTOSS IN NEUE DIMENSIONEN<br />
RÜSTUNG & TECHNOLOGIE �<br />
dar. Unter der Leitung der GSA (European<br />
GNSS Agency) werden in diesen Gruppen<br />
Themen mit folgendem Inhalt bearbeitet:<br />
� Sichere Umsetzung und der Betrieb des<br />
PRS in den potenziellen Nutzerstaaten,<br />
� Signalstruktur sowie die Interoperabilität<br />
und Kompatibilität mit anderen<br />
GNSS-Systemen,<br />
� Begleitung von EU-Studien im Rahmen<br />
des verschlüsselten Dienstes.<br />
Die Vertreter der WTD 81 sind hier in Zusammenarbeit<br />
mit dem Bundesamt für<br />
<strong>Sicherheit</strong> in der Informationstechnologie<br />
bei der Erstellung und Anpassung von<br />
Dokumenten beteiligt. Ein Fokus dieser<br />
gemeinsamen Arbeit ist die Ausarbeitung<br />
von Mindeststandards.<br />
Schlüsselsystem<br />
des 21. Jahrunderts<br />
Die im ursprünglichen Sinne für das Militär<br />
entwickelte Satellitennavigation hat durch<br />
die Öffnung der USA für den zivilen Bereich<br />
in den letzten Jahren enormen Zuwachs<br />
erfahren. Die Positionierung, Navigation<br />
und Zeitsynchronisation mit GPS hat in<br />
fast allen Branchen Einzug erhalten und ist<br />
aus zahlreichen Anwendungen nicht mehr<br />
wegzudenken. In der heutigen Welt ist es<br />
kaum mehr vorstellbar, ohne diese GNSS-<br />
Systeme auszukommen.<br />
Mit Galileo hat sich die EU vor die große<br />
Herausforderung gestellt, ein eigenständiges<br />
und unabhängiges Satellitennavigationssystem<br />
aufzubauen und zu betreiben.<br />
Mit dieser Schlüsseltechnologie des<br />
21. Jahrhunderts sollen den Bürgerinnen<br />
und Bürgern der EU weltweit Daten zur<br />
genaueren Positionsbestimmung zur Verfügung<br />
stehen und soll die Kernfähigkeit<br />
in der Weltraumtechnologie ausgebaut<br />
werden. �<br />
Die OHB System AG ist ein deutsches, mittelständisches<br />
Raumfahrt-Systemhaus und<br />
Tochterunternehmen der europäischen<br />
Raumfahrt- und Technologiegruppe OHB AG.<br />
Bei der OHB System AG entstehen low- und<br />
medium Earth orbiting, sowie geostationäre<br />
Kleinsatelliten für Navigation, Kommunikation,<br />
Erdbeobachtung und Wissenschaft, Spitzentechnologien<br />
für die bemannte Raumfahrt,<br />
Konzepte und Studien für die Erforschung<br />
unseres Sonnensystems sowie Aufklärungssatelliten<br />
und Instrumente zur breitbandigen<br />
Funkübertragung von Bildaufklärungsdaten<br />
für mehr <strong>Sicherheit</strong> und bessere Aufklärung.<br />
www.ohb-system.de
Unternehmen & Personen<br />
RUAG 2011 mit verbessertem<br />
Ergebnis<br />
Der Schweizer Technologiekonzern RUAG<br />
verbesserte 2011 sein EBIT um 10 Millionen<br />
Euro auf 92 Millionen Euro bei nahezu<br />
unverändertem Umsatz in Höhe von 1,5<br />
Milliarden Euro. Je etwa die Hälfte des<br />
Umsatzes wird mit militärischen bzw. zivilen<br />
Anwendungen erzielt. Die Schweizer<br />
Armee als größter Einzelkunde von RUAG<br />
trug 37 Prozent zum Umsatz bei. Im Inland<br />
machte RUAG 47 Prozent seines Umsatzes.<br />
42 Prozent kommen aus dem europäischen<br />
und 11 Prozent aus dem übrigen Ausland.<br />
Bei unverändertem Auftragseingang in<br />
Höhe von 1,5 Milliarden Euro nahm der<br />
Auftragsbestand um zehn Prozent auf 1,2<br />
Milliarden Euro ab. Insgesamt blickt RUAG<br />
zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr.<br />
(gwh)<br />
EADS: Gute Ergebnisse<br />
Vor allem dank der anhaltend starken<br />
Wachstumsdynamik im zivilen Geschäft<br />
startete EADS gut in das Jahr 2012 und<br />
verzeichnete im ersten Quartal eine solide<br />
Finanz- und Ertragslage. Die Lage auf den<br />
westlichen Verteidigungsmärkten bleibt<br />
erwartungsgemäß angespannt. Die Impulse<br />
im Regierungs- und institutionellen Geschäft<br />
von EADS waren im ersten Quartal<br />
jedoch vielversprechend. In den ersten drei<br />
Monaten belief sich der Auftragseingang<br />
auf 12,0 Mrd. Euro. Ende März lag der Auf-<br />
Christoph Müller Head of<br />
Communications<br />
Mit Wirkung vom 1. Juni 2012 wird<br />
Christoph Müller den Posten des Head<br />
of Communications für Eurocopter<br />
Deutschland einnehmen. Grund für<br />
die Einrichtung dieser<br />
neuen Position<br />
war der Wunsch<br />
nach einer lokalen<br />
Stärkung der Kommunikation<br />
für EurocopterDeutschland<br />
und den deutschen<br />
Markt. Vor<br />
Übernahme dieser Stelle war der<br />
37-Jährige von 2004 an als Head<br />
of Corporate Communications and<br />
Strategy für die Krauss-Maffei Wegmann<br />
GmbH & Co. KG tätig. Darüber<br />
hinaus hatte Christoph Müller als Sprecher<br />
von Eurocopter Deutschland und<br />
Mitglied des Konzept- und Studienteams<br />
der vormaligen Verteidigungssparte<br />
von EADS verschiedene Funktionen<br />
inne. (wb)<br />
(Foto: Eurocopter)<br />
110 <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · Juni 2012<br />
Rheinmetall stellt frühzeitig Weichen für Nachfolge<br />
Der Aufsichtsrat der Rheinmetall AG hat Mitte Mai frühzeitig die personelle Kontinuität<br />
an der Spitze des Rheinmetall-Konzerns gesichert und damit die Grundlage<br />
für eine erfolgreiche Fortsetzung der Strategie des profitablen Wachstums bei<br />
Rheinmetall gelegt. Klaus Eberhardt (64) wird mit seinem Eintritt in den Ruhestand<br />
Anfang 2013 planmäßig den Vorsitz im Vorstandsgremium der Rheinmetall AG an<br />
Armin Papperger (49) übergeben. Dort vertritt Armin Papperger bereits seit Anfang<br />
2012 den Unternehmensbereich Defence. Ebenfalls mit Beginn des Jahres 2013 wird<br />
Dr. Herbert Müller (59) auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand von Rheinmetall<br />
ausscheiden und sein Amt als CFO des Konzerns an Helmut P. Merch (56) übergeben.<br />
Helmut P. Merch, der heute als Finanzvorstand für den Unternehmensbereich<br />
Defence Verantwortung trägt, wird mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in den Vorstand<br />
der Rheinmetall AG berufen. Klaus Eberhardt, der den Rheinmetall-Konzern seit 13<br />
Jahren als Vorstandsvorsitzender führt, und Dr. Herbert Müller, der im Vorstand seit<br />
Anfang 2000 für das Finanzressort zuständig ist, werden dem Unternehmen weiter<br />
verbunden bleiben. Klaus Eberhardt behält den Vorsitz im Aufsichtsrat der KSPG AG,<br />
der Automotive-Sparte des Rheinmetall-Konzerns. (wb)<br />
tragsbestand von EADS bei 526,2 Mrd. Euro.<br />
Der Konzern erwirtschaftete einen Umsatz<br />
von 11,4 Mrd. Euro. Das EBIT (Gewinn<br />
vor Zinsen, Steuern, Wertminderungen, Abschreibungen<br />
und außerordentlichen Posten)<br />
vor Einmaleffekten von rund 0,5 Mrd.<br />
Euro. profitierte von guten Ergebnissen bei<br />
Airbus, Eurocopter und Astrium; die Cassidian-Ergebnisse<br />
blieben stabil. Das berichtigte<br />
EBIT belief sich auf 0,3 Mrd. Euro. Die Nettoliquidität<br />
lag bei 10,7 Mrd. Euro. und blieb<br />
somit weiterhin auf einem robusten Niveau.<br />
In den ersten drei Monaten dieses Jahres<br />
stieg der Umsatz von EADS um 16 Prozent<br />
auf 11,4 Mrd. Euro. (I/2011: 9,9 Mrd. Euro.)<br />
mit günstigeren Phaseneffekten als im<br />
Vorjahresquartal. Das Umsatzwachstum<br />
wurde vor allem durch höhere Aktivitäten<br />
in allen Divisionen angekurbelt. Der Umsatz<br />
im Verteidigungsgeschäft wuchs um 18<br />
Prozent. Die Auslieferungszahlen blieben<br />
auf hohem Niveau, mit 131 Flugzeugen bei<br />
Airbus Commercial, 72 Hubschraubern bei<br />
Eurocopter und dem 47. erfolgreichen Start<br />
einer Ariane-5-Rakete in Folge. (wb)<br />
Vertrag über Definitionsphase<br />
unterzeichnet<br />
Die OHB System AG, ein Unternehmen der<br />
europäischen Raumfahrt- und Technologiegruppe<br />
OHB AG, ist Anfang Mai vom<br />
Raumfahrtmanagement des Deutschen<br />
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit<br />
der Systemführerschaft einer nationalen Telekommunikationsmission<br />
„Heinrich Hertz“<br />
und der Entwicklung des dazu gehörigen<br />
Satelliten beauftragt worden. Der Vertrag<br />
hat ein Volumen von rund elf Millionen<br />
Euro und umfasst die Arbeiten für die Vordefinition<br />
aller Missionselemente. Mit dem<br />
Programmauftakt begann die 15-monatige<br />
Vertragslaufzeit. Die Ergebnisse dieser<br />
Definitionsphase dienen als Basis für den<br />
anschließenden Bau und Test des Satelliten,<br />
der separat beauftragt wird und 2016 im Orbit<br />
seinen Betrieb aufnehmen soll. „Heinrich<br />
Hertz“ dient der Überprüfung neuartiger<br />
Technologien der Satellitenkommunikation<br />
unter realen Einsatzbedingungen und damit<br />
der Sicherstellung nationaler Systemkompetenz<br />
bei geostationären Kommunikationssatelliten.<br />
(wb)<br />
Neuer Leiter Schifffahrt<br />
Mit Wirkung zum 1. Mai 2012 hat Jörg<br />
Kaufmann die Leitung der Abteilung<br />
Schifffahrt des Bundesamtes für Seeschifffahrt<br />
und Hydrographie<br />
(BSH) übernommen. Er<br />
folgte Christoph Brockmann,<br />
der Vizepräsident<br />
der maritimen Behörde<br />
wird. Das BSH ist Partner<br />
für Schifffahrt, Umweltschutz<br />
und Meeresnutzung,<br />
der Seeschifffahrt und maritime<br />
Wirtschaft; das BSH unterstützt <strong>Sicherheit</strong><br />
und Umweltschutz, stärkt die nachhaltige<br />
Meeresnutzung, fördert die Kontinuität<br />
von Messungen und gibt kompetente<br />
Auskunft über den Zustand von Nord- und<br />
Ostsee. Das BSH mit Dienstsitz in Hamburg<br />
und Rostock ist eine Bundesbehörde im<br />
Geschäftsbereich des Bundesministers für<br />
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. (ds)<br />
Kabinenbeleuchtung für<br />
KC-46-Tankfugzeug<br />
Diehl Aerospace hat von Boeing den Auftrag<br />
für die Entwicklung und Herstellung<br />
der Innenbeleuchtung für das KC-46-Tankerprogramm<br />
gewonnen. Die U.S. Air<br />
Force hat das KC-46-Programm von Boeing<br />
als Ersatz für 179 der aktuell fliegenden<br />
KC-135-Tanker ausgewählt. Die KC-46 basiert<br />
auf dem bewährten Verkehrsflugzeug<br />
Boeing 767-200ER und wird ein Tankflugzeug<br />
sein, das für mehrere Einsatzzwecke<br />
(Foto: BSH)
(Foto: MBDA)<br />
genutzt werden kann. Der Innenraum ist<br />
für drei Besatzungsmitglieder sowie weitere<br />
zwölf Personen an Bord ausgelegt.<br />
2011 hatte das Pentagon nach einem zehn<br />
Jahre dauernden Wettbewerbs- und Vergabeprozess<br />
Boeing mit Entwicklung und<br />
Lieferung der Tankflugzeuge beauftragt.<br />
Das von Airbus auf Basis des Airbus A330<br />
MRTT angebotene KC-45-Design war im<br />
Vergabeverfahren nicht erfolgreich. (gwh)<br />
Cassidian CyberSecurity<br />
EADS Cassidian hat die Gründung eines<br />
neuen Unternehmens mit dem Namen<br />
„Cassidian CyberSecurity“ bekanntgegeben.<br />
Das Unternehmen wird sich speziell<br />
auf den rasch wachsenden Markt für Cyber<br />
Security in Europa und dem Nahen Osten<br />
konzentrieren mit anfänglichem Schwerpunkt<br />
auf Deutschland, Großbritannien<br />
und Frankreich. Unter dem CEO Hervé<br />
Guillou wird die Cyber Security-Expertise<br />
des gesamten EADS-Konzerns zu einem<br />
spezialisierten Anbieter auf diesem Markt<br />
gebündelt. Um angemessen auf spezifische<br />
nationale Anforderungen in Deutschland,<br />
Großbritannien und Frankreich reagieren<br />
zu können, werden die geschäftlichen<br />
Aktivitäten von Cassidian CyberSecurity<br />
zunächst auf drei selbstständige nationale<br />
Gesellschaften unter dem Dach einer globalen<br />
Cyber Security-Organisation verteilt.<br />
Das Produkt- und Serviceportfolio von<br />
Cassidian CyberSecurity basiert auf drei<br />
Säulen mit Cyber Defence & Professional<br />
Services für Dienstleistungen, Trusted In-<br />
frastructure für Technologien und Secure<br />
Mobility für Dienstleistungen und Endgeräte.<br />
In der Aufbauphase bildet Cassidian<br />
CyberSecurity in einem Cyber-Trainingszentrum<br />
Nachwuchskräfte für diesen Bereich<br />
aus, um der steigenden Nachfrage nach<br />
qualifizierten Cyber Security-Experten gerecht<br />
zu werden. (gwh)<br />
Joint Venture für Panzermunition<br />
Rheinmetall Defence und das US-Unternehmen<br />
General Dynamics Ordnance and<br />
Tactical Systems (GD-OTS), eine Geschäftseinheit<br />
von General Dynamics, lassen ihre<br />
MBDA-Deutschland in Schrobenhausen<br />
Der deutsche Anteil des Technologiekonzerns MBDA hat den Umzug nach Schrobenhausen<br />
abgeschlossen. An dem modernsten Standort für Luftverteidigungs- und<br />
Lenkflugkörpersysteme in Deutschland sind von MBDA die Bereiche Konzeption,<br />
Entwicklung, Produktion, Testgelände, Logistik und Verwaltung schrittweise an einem<br />
Ort zusammengeführt<br />
worden. Parallel<br />
dazu fand eine Erweiterung<br />
und Modernisierung<br />
des neuen Standortes<br />
statt. Am Hauptsitz des<br />
Konzerns arbeiten nun<br />
1.000 Mitarbeiter, überwiegend<br />
Ingenieure und<br />
<strong>Technik</strong>er. Schrobenhausen<br />
hat damit einen<br />
Wandel von der Produktionsstätte<br />
zur Denkfabrik<br />
des Unternehmens erfahren. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Schaffung<br />
des in Deutschland einmaligen Kompetenzzentrums auf 60 Millionen Euro.<br />
Darüber hinaus betreibt MBDA seit 2011 im nahegelegenen Freinhausen eine Erprobungsstätte<br />
für Luftverteidigungssysteme. Mit den beiden Standorten will der<br />
Konzern seine Spitzenposition im Bereich Luftverteidigungs- und Flugabwehrsysteme<br />
ausbauen. (Eike Rhein)<br />
Future Soldier Expo in Prag<br />
Die 10. Internationale Future Soldier-Ausstellung<br />
wird auch in diesem Jahr wieder<br />
zahlreiche Aussteller und Besucher nach<br />
Prag locken, wenn die Messetore des<br />
Prager Letnany Exhibition Centre vom 17.<br />
bis 19. Oktober geöffnet werden. 2010<br />
informierten sich über 7.000 Besucher auf<br />
rund 135 Ausstellerständen aus 25 Nationen<br />
über Neuigkeiten und Verbesserungen<br />
im Bereich Ausrüstung der Soldaten,<br />
Cyber Security, Kommunikation, Schutz<br />
kritischer Infrastruktur, Schutz der Truppe<br />
sowie dem gesamten Umfeld der militärischen Technologien. Neben der Ausstellung,<br />
die im Zweijahresrhythmus stattfindet, wird sich die begleitende Konferenz unter Federführung<br />
von AFCEA Europa mit Cyber Security als Schwerpunkt beschäftigen. Darüber<br />
hinaus findet im Rahmen der Ausstellung die Jahrestagung der Vereinigung der<br />
<strong>Europäische</strong>n Militärpresse (EMPA) statt, der Journalisten aus 27 europäischen Staaten<br />
angehören. Weitere Informationen unter www.natoexhibition.org. (wb)<br />
(Foto: FSEC)<br />
langjährige und erfolgreiche Kooperation<br />
im Bereich der Panzermunition in einer<br />
Joint Venture-Gesellschaft münden. In der<br />
neuen Defense Munitions International<br />
(DMI) mit Sitz in den USA wird weiterhin<br />
bewährte und neue 120-mm-Wucht- und<br />
Mehrzweckmunition für den amerikanischen<br />
und internationalen Kampfpanzermunitionsmarkt<br />
entwickelt und vertrieben.<br />
Insbesondere die Zusammenarbeit bei<br />
uranfreien hochmodernen Wolframgeschossen<br />
und die Weiterentwicklung der<br />
jüngst vorgestellten programmierbaren<br />
Panzermunition DM 11 soll vorangetrieben<br />
werden. (Eike Rhein)<br />
Neuer Vertriebsvorstand<br />
bei Tognum<br />
Dr. Michael Haidinger<br />
ist ab 1. Juli 2012 neues<br />
Vorstandsmitglied<br />
für Vertrieb bei der<br />
Tognum AG. Er folgt<br />
in dieser Funktion auf<br />
Peter Kneipp, der Ende<br />
Februar 2012 im gegenseitigenEinvernehmen<br />
aus dem Vorstand<br />
ausgeschieden ist. Dr.<br />
Haidinger ist zurzeit Geschäftsführer von<br />
Rolls-Royce Deutschland und Mitglied<br />
des Aufsichtsrats der Tognum AG. Beide<br />
Funktionen wird er spätestens mit seinem<br />
Amtsantritt als neuer Vertriebsvorstand<br />
niederlegen. Mit seiner Berufung zum neuen<br />
Tognum-Vorstandsmitglied übernimmt<br />
er die bisher vom Tognum-Vorstandsvorsitzenden<br />
Joachim Coers kommissarisch geführten<br />
Business Units Engines und Onsite<br />
Energy sowie das weltweite Distribution-<br />
und Servicegeschäft. (wb)<br />
Juni 2012 · <strong>Europäische</strong> <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
111<br />
(Foto: Tognum)