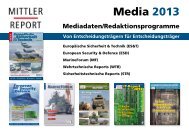Unternehmen & Personen - Europäische Sicherheit & Technik
Unternehmen & Personen - Europäische Sicherheit & Technik
Unternehmen & Personen - Europäische Sicherheit & Technik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Inhalt<br />
Seite 31 Seite 34<br />
ABC-Abwehrkommando<br />
Die Verantwortung für die ABC-Abwehr und die<br />
ABC-Abwehrkräfte liegt erstmals in einer Hand.<br />
Gefechtsübungszentrum Heer<br />
Das Betreibermodell hat sich bewährt. Was soll das<br />
Ausbildungszentrum in Zukunft leisten können<br />
<br />
SICHERHEIT & POLITIK<br />
10 Die Mali-Krise und Europa<br />
Spiegelbild der Handlungsfähigkeit der GASP und der GSVP<br />
Joachim Spatz MdB<br />
13 Frühwarnsystem der inneren <strong>Sicherheit</strong>:<br />
Das Bundesamt für Verfassungsschutz<br />
Dieter Klocke<br />
18 Bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr<br />
Stellungnahme der Verteidigungspolitischen Sprecher<br />
der im Bundestag vertretenen Parteien<br />
20 Umstrittener Kampfdrohneneinsatz der USA<br />
Sidney E. Dean<br />
28 Die Allianz nicht schleichend auseinander<br />
entwickeln<br />
Rolf Clement<br />
30 Deutsche <strong>Sicherheit</strong>spolitik aus französischer Sicht<br />
Das Schönhauser Forum der BAKS<br />
Eduard Gloeckner<br />
<br />
BUNDESWEHR & STREITKRÄFTE INTERNATIONAL<br />
31 Verantwortung in einer Hand:<br />
ABC-Abwehr der Bundeswehr<br />
Henry Neumann<br />
34 Gefechtsübungszentrum Heer<br />
Erfolgreiche Einrichtung mit industrieller Betriebsunterstützung<br />
Lothar Schulz und Detlef H. Keller<br />
40 „Wir haben die einzigartige Gelegenheit, Fehler<br />
der Vergangenheit mit anderen Systemen zu<br />
vermeiden“<br />
Interview mit Generalmajor Pascal Valentin, Kommandeur<br />
European Air Transport Command (EATC), Eindhoven (NL)<br />
44 Das Marinefliegerkommando<br />
Rainer Kümpel<br />
49 Veränderungsmanagement in der<br />
Streitkräftebasis<br />
René Schüren<br />
<br />
RÜSTUNG & TECHNOLOGIE<br />
53 Erstflug des A400M-Serienflugzeugs<br />
Ulrich Rapreger<br />
55 Das Zentrum für Informationstechnik<br />
der Bundeswehr<br />
Aufgaben und Fähigkeiten<br />
Autorenteam IT-ZentrumBw<br />
61 Gladius für die Infanterie der Zukunft<br />
Gerhard Heiming<br />
62 Sachstand Fregatte Klasse 125<br />
Dieter Stockfisch<br />
66 Das LCS-Programm der U.S. Navy<br />
Beteiligung deutscher <strong>Unternehmen</strong><br />
Dieter Stockfisch<br />
71 Lagebild-Demonstrator Arbeitsplatz:<br />
„Maritime Security“<br />
Rainer Duus<br />
78 „Die BMD-Fähigkeit ist vorhanden,<br />
es gibt sie hier und heute”<br />
Interview mit Dr. George Mavko, Director European<br />
Missile Defence, Raytheon Missile Systems<br />
81 MG-Familie „FN Minimi“<br />
Jan-Phillipp Weisswange<br />
85 Multi Link-Fähigkeit U212A<br />
Achim Hänsch<br />
4 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · April 2013
Seite 45<br />
Seite 111<br />
Marineflieger<br />
Die Zusammenlegung aller fliegenden Systeme<br />
der Marine an einem Standort ist vollzogen.<br />
Raketenabwehr im Pazifik<br />
Streben die USA in Fernost eine Einhegung oder<br />
eine Einbindung Chinas an<br />
<br />
WIRTSCHAFT & INDUSTRIE<br />
91 „Wir müssen uns verstärkt global engagieren<br />
und neue Wachstumsfelder erschließen“<br />
Interview mit Bernhard Gerwert, CEO Cassidian<br />
96 CeBIT 2013:<br />
Von Big Data bis zum (kleinen) Smartphone<br />
Dorothee Frank<br />
97 Das Smartphone für die Kanzlerin<br />
Dorothee Frank<br />
98 „Spione wollen unentdeckt bleiben –<br />
in der realen Welt wie im Cyber-Raum“<br />
Interview mit Hans-Peter Bauer,<br />
Vice President Central Europe von McAfee<br />
<br />
ÄUSSERE & ZIVILE SICHERHEIT<br />
102 Neue Perspektiven für Somalia<br />
Dustin Dehez<br />
105 Netanjahus Pyrrhussieg<br />
Usahma Felix Darrah<br />
108 Tunesien in der Krise<br />
Ein politischer Mord löst Schockwellen aus<br />
Martin Pabst<br />
111 Raketenabwehr im Pazifik<br />
Instrument zur Einhegung oder Einbindung Chinas<br />
Michael Paul<br />
114 Syrienkrise und Bürgerkrieg<br />
Multiple Kollisionen von Interessen<br />
Klaus Olshausen<br />
<br />
RUBRIKEN<br />
3 Kommentar<br />
6 Umschau<br />
23 Berliner Prisma<br />
48 Standpunkt<br />
69 Typenblatt<br />
74 Informationen – Nachrichten – Neuigkeiten aus aller Welt<br />
88 Blick nach Amerika<br />
90 IT News & Trends<br />
93 <strong>Unternehmen</strong> & <strong>Personen</strong><br />
101 Nachrichten aus Brüssel<br />
109 Impressum<br />
118 Gesellschaft für Wehr- und <strong>Sicherheit</strong>spolitik<br />
120 Bücher<br />
122 Gastkommentar<br />
„Mali ist eines der ärmsten Länder der Erde. Die Analysen und Bedrohungsszenarien<br />
waren seit langem bekannt, die Menschenrechtsverletzungen<br />
und Rechtsbrüche sowohl im Süden wie auch im Norden<br />
des Landes lückenlos dokumentiert. Trotzdem konnte man sich in den<br />
Hauptstädten der EU offensichtlich nicht frühzeitig zu einem gemeinsamen<br />
Vorgehen durchringen. Stattdessen wurde so lange über potentielle<br />
Unterstützungsleistungen und Strategien diskutiert, bis sich jenes<br />
Land zum Handeln entschlossen hat, dessen nationale Interessen durch<br />
den Vormarsch der Rebellen am meisten betroffen waren.“<br />
Joachim Spatz: Die Mali-Krise und Europa, Seite 10
Kommentar<br />
Mehr Verantwortung,<br />
weniger Führung<br />
Auf seinem Antrittsbesuch in Berlin hat der<br />
neue amerikanische Außenminister John Kerry<br />
Deutschland eine herausragende Führungsrolle<br />
in Europa und in den transatlantischen Beziehungen<br />
attestiert. Das Lob von prominenter<br />
Seite stärkt das Image der Bundeskanzlerin als<br />
kühler und souveräner Krisenmanagerin, das im<br />
bevorstehenden Wahlkampf eine Rolle spielen,<br />
wenn nicht gar den Ausschlag geben dürfte.<br />
Dennoch kann es in Berlin nur mit vorsichtiger<br />
Zurückhaltung zur Kenntnis genommen<br />
werden. Was von unabhängiger Warte aus<br />
betrachtet als Führung erscheint, wird von den<br />
Betroffenen, die sie zu spüren bekommen,<br />
nämlich eher als Diktat empfunden. Jene Regierungen<br />
der Euro-Zone, die trotz schrumpfender<br />
Wirtschaftsleistung und wachsender Arbeitslosigkeit<br />
dank deutscher Beharrlichkeit ein rigides<br />
Sparprogramm umzusetzen haben, stoßen<br />
auf massiven innenpolitischen Widerstand. In<br />
manchen Ländern, allen voran Griechenland<br />
und Italien, gehören dabei Ressentiments gegen<br />
Berlin und die Bundeskanzlerin unterdessen zum<br />
Standardrepertoire der öffentlichen Debatte.<br />
Auch in deutschen Medien sind herabwürdigende<br />
Klischeevorstellungen insbesondere über die<br />
südlichen EU-Partnerländer wieder en vogue.<br />
Die friedensstiftende und den Zusammenhalt<br />
stärkende Rolle des Euro hatte man sich ursprünglich<br />
sicher anders vorgestellt.<br />
Der Versuchung, eine Führungsrolle zu spielen,<br />
ist die Bundesrepublik dabei nicht zum ersten<br />
Mal ausgesetzt. So hatte etwa George W. H.<br />
Bush 1989 kurz nach dem Antritt seiner Präsidentschaft<br />
die vage Idee einer „Partnerschaft<br />
in der Führung“ in die Welt gesetzt. Helmut<br />
Kohl ließ sich darauf nicht ernsthaft ein, da er<br />
wusste, dass dies den Prinzipien der europäischen<br />
Integration widersprach und die deutschen<br />
Möglichkeiten bei weitem überforderte.<br />
Die Zukunft der durch die Wiedervereinigung<br />
noch stärker gewordenen Bundesrepublik sah<br />
er statt dessen in außenpolitischer Mäßigung<br />
und einer engeren Einbindung in internationale<br />
Strukturen, allen voran jene der EU. Das Motiv<br />
für diese Politik mag ein rückwärts gewandtes<br />
gewesen sein. Es ist hinlänglich bekannt, dass<br />
Helmut Kohl wie schon Konrad Adenauer die<br />
Frage bewegte, welche Lehren Deutschland aus<br />
zwei verheerenden Weltkriegen zu ziehen hätte.<br />
Dennoch war seine Einschätzung, dass die Europäer<br />
der Bundesrepublik keine Führungsrolle<br />
zubilligen können und eine solche ihr qua ihres<br />
eben doch nur sehr eingeschränkten Potenzials<br />
auch gar nicht zustünde, realistisch. Mehr noch<br />
als damals kann sie heute, da die EU seither<br />
zahlreiche neue Mitglieder gewonnen hat,<br />
Gültigkeit beanspruchen.<br />
Es ist richtig, dass die deutsche Wirtschaft zu<br />
jenen in Europa zählt, die sich in der Finanzund<br />
Schuldenkrise bislang am besten behauptet<br />
haben. Diese Sonderstellung ist jedoch nur<br />
eine relative, und sie legitimiert nicht dazu, sich<br />
zum Schulmeister aufzuspielen. Die ökonomische<br />
Stabilität der Bundesrepublik ist nicht auf<br />
die Prinzipien von Fiskaldisziplin, Deregulierung<br />
und Privatisierung zurückzuführen, die man<br />
hierzulande in der Vergangenheit auch nur<br />
halbherzig befolgt hat, nun aber als Patentrezepte<br />
für die Krisenstaaten der Euro-Zone<br />
ausgibt. Es gibt kein deutsches Modell, das sich<br />
die anderen europäischen Länder zum Vorbild<br />
nehmen müssten, und noch weniger gibt es<br />
einen Königsweg zu einer vertieften Integration<br />
der EU, den sie sich von Berlin vorschreiben<br />
ließen. Wo Deutschland die Initiative ergreift,<br />
könnte daher sehr schnell genau das Gegenteil<br />
dessen erreicht werden, was man sich eigentlich<br />
vorgenommen hat.<br />
Mehr Realismus und mehr Fingerspitzengefühl<br />
ist auf dem Feld der <strong>Sicherheit</strong>s- und Verteidigungspolitik<br />
zu beobachten. Hier spricht Berlin<br />
von wachsender Verantwortung, die Deutschland<br />
zu tragen bereit ist. Einen Führungsanspruch<br />
wird daraus niemand ableiten können.<br />
Die militärischen Ressourcen, die die neu<br />
ausgerichtete Bundeswehr für internationale<br />
Einsätze zur Verfügung stellen kann, sind keineswegs<br />
zu vernachlässigen, aber eben auch<br />
nicht überbordend. Da die Streitkräfte der<br />
europäischen Partnerstaaten derzeit noch weit<br />
größere Einschnitte erleben, ist zwar damit zu<br />
rechnen, dass Deutschland mehr noch als in<br />
der Vergangenheit zur Übernahme von Verantwortung<br />
gedrängt wird. Die neuen Einsätze<br />
in der Türkei und in Westafrika können dafür<br />
als Vorboten gelten. Das militärische Gewicht<br />
der Bundesrepublik ist aber zu gering, als dass<br />
sie in der proklamierten Bündelung militärischer<br />
Fähigkeiten in Europa ein bestimmender<br />
Faktor werden könnte und sollte. Auch in der<br />
sicherheitspolitischen Willensbildung in Europa<br />
spielt Berlin bestenfalls die zweite Geige. Diese<br />
Rolle ist nicht zu beklagen, sondern dem deutschen<br />
Potenzial gemäß. Es wäre im Interesse<br />
Europas eher zu wünschen, dass die Bundesrepublik<br />
auch auf dem Gebiet der Finanz- und<br />
Wirtschaftspolitik mehr auf Verantwortung<br />
und weniger auf Führung setzt.<br />
Peter Boßdorf<br />
April 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
3
Umschau<br />
(Fotos: Thales)<br />
Gladius mit Thales-<br />
Komponenten<br />
Thales Deutschland liefert 310 Nachsichtbrillen<br />
vom Typ Lucie II D und 16 IR-Module<br />
sowie 300 UHF-Funkgeräte vom Typ SOLAR<br />
400 EG-E für die ersten 30 Infanteriesysteme<br />
„Gladius“, die unter dem Arbeitsbegriff<br />
„Infanterist der Zukunft – Erweitertes<br />
System“ (IdZ-ES) entwickelt wurden. Der<br />
Auftrag hat ein Volumen von rund 7,5 Mio.<br />
Euro und beinhaltet neben der logistischen<br />
Dokumentation und Ausbildung auch die<br />
Option auf ein zweites Los über 600 Brillen,<br />
192 IR-Module sowie 600 Funkgeräte. Die<br />
für den IdZ-ES von Thales neu entwickelte<br />
Brille Lucie II D hat neben einer optischen<br />
Leistungssteigerung des Nachtsichtanteils<br />
gegenüber dem Basismodell ein auf OLED-<br />
Technologie basierendes Daten- und Videodisplay<br />
integriert. Das UHF-Gruppenfunkgerät<br />
SOLAR 400EG-E ist das Herzstück der<br />
Kommunikationsausstattung bei Gladius.<br />
Sein integrierter, leistungsfähiger Kommunikationsprozessor<br />
ist voll IP-fähig und<br />
stellt mit insgesamt drei Schnittstellen die<br />
Verbindung zum Kernrechner am Rücken<br />
des Soldaten, im aufgesessenen Betrieb<br />
die Verbindung zum Fahrzeug und beim<br />
Gruppenführer die Verbindung zum VHF-<br />
Führungsfunkgerät her.<br />
(gwh)<br />
Für deutsches BOS-Digitalfunknetz<br />
zertifiziert<br />
Die für den Einsatz im deutschen BOS-Digitalfunknetz<br />
vorgesehenen TETRA-Funkgeräte<br />
von Cassidian haben alle Interoperabilitätsprüfungen<br />
erfolgreich bestanden und<br />
sind durch die Bundesanstalt für den Digitalfunk<br />
der Behörden und Organisationen<br />
mit <strong>Sicherheit</strong>saufgaben (BDBOS) zertifiziert<br />
worden. Damit können nun die TETRA-<br />
Korvette ERFURT in Dienst gestellt<br />
Am 28. Februar 2013 wurde die Korvette ERFURT als vierte von fünf Korvetten der<br />
Klasse K130 in Warnemünde im Beisein von Staatssekretär Rüdiger Wolf in Dienst<br />
gestellt. Mit den Korvetten erweitert die Deutsche Marine bzw. Bundeswehr ihre<br />
Fähigkeit zur weltweiten Krisenreaktion in küstennahen Seegebieten und Randmeeren.<br />
Der neueste Typ der Marine stellt einen Quantensprung in der Technologie dar.<br />
Insbesondere die hohe computergestützte Automatisierung mit mehreren redundanten<br />
Systemen sucht weltweit ihresgleichen. Dadurch kann die 88,80 m lange<br />
und 1.840 t große Korvette mit einer relativ kleinen Besatzung von nur 58 <strong>Personen</strong><br />
betrieben werden. Die Korvetten sind mit dem modernen weitreichenden schweren<br />
Flugkörper RBS15 Mk3 zur Bekämpfung von See- und Landzielen ausgerüstet. Damit<br />
besitzen die Schiffe ein beachtliches Durchsetzungsvermögen gegen ein weitgefasstes<br />
Bedrohungsspektrum.<br />
(ds)<br />
(Foto: PIZ/Mar)<br />
Modelle THR9, THR9 Ex und<br />
THR9i von Cassidian auch<br />
im deutschen Digitalfunknetzwerk<br />
betrieben werden.<br />
Das BOS-Digitalfunknetz<br />
ist mit gleichzeitig 500.000<br />
Nutzern das weltweit größte<br />
Funknetz, das auf dem TE-<br />
TRA-Standard basiert. Rund<br />
4.500 Basisstationen sowie<br />
64 Kernnetzstandorte stellen<br />
die behördenübergreifende<br />
Kommunikation sowohl im täglichen<br />
Einsatz als auch bei Großlagen sicher. (gwh)<br />
Abhörsichere mobile<br />
Kommunikation<br />
Die Secusmart GmbH hat auf der CeBIT<br />
2013 ihre neueste IT-Entwicklung für hochsichere<br />
Kommunikation, den Abhörschutz<br />
SecuSUITE, vorgestellt. SecuSUITE ist die<br />
Weiterentwicklung der abhörsicheren<br />
BSI-zertifizierten SecuVOICE-Lösung, mit<br />
der u.a. die Bundeskanzlerin und die deutschen<br />
Bundesministerien seit 2009 telefonieren.<br />
Für die <strong>Sicherheit</strong> sorgt dabei die<br />
Secusmart Security Card. Mit SecuSUITE<br />
kann jeder Nutzer auf nur einem Smartphone<br />
zwischen dem dienstlichen sicheren<br />
Bereich und dem privaten Bereich abhörsicher<br />
hin- und herschalten. Weltweit erstmals<br />
ist damit ein kombinierter Abhör- und<br />
Spionageschutz möglich; gesichert werden<br />
Sprache, SMS, E-Mails, gespeicherte Daten,<br />
persönliche Notizen sowie das Surfen<br />
im Internet.<br />
(ds)<br />
U-Boote für Kolumbien<br />
Die Kieler Werft ThyssenKrupp Marine<br />
Systems GmbH tropikalisiert die von der<br />
Deutschen Marine nach über 30 Jahren<br />
Dienstzeit außer Dienst gestellten U-<br />
(Foto: Bundeswehr)<br />
(Foto: Cassidian)<br />
Boote U 23 und U 24 (s. Foto) der Klasse<br />
206A. Die von Kolumbien gekauften und<br />
auf die Namen INTREPIDO und INDO-<br />
MABLE umgetauften, 40 m langen und<br />
500 t großen U-Boote sollen künftig vor<br />
den Küsten Südamerikas operieren. Kolumbien<br />
will die U-Boote zur Sicherung<br />
seiner Seegrenzen und Ausschließlichen<br />
Wirtschaftszone und zur Drogenbekämpfung<br />
auf See einsetzen.<br />
(ds)<br />
6 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · April 2013
(Foto: bbk)<br />
(Foto Cassidian)<br />
(Foto: FLIR)<br />
Portable Wärmebildkameras<br />
Feuerwehrleute können erheblich von<br />
Wärmebildkameras profitieren, denn mit<br />
ihrer Hilfe kann man durch Rauch hindurch<br />
sehen. Dadurch sind sie in der Lage, Menschen<br />
in einem mit Rauch gefüllten Raum<br />
aufzuspüren. Wärmebildkameras unterstützen<br />
die Feuerwehr auch dabei, den<br />
Weg in immer stärker mit Rauch verschleierten<br />
Bereichen zu finden und/oder sich in<br />
Arealen zu orientieren, die bereits gelöscht<br />
sind, aber in denen die Sicht noch durch<br />
Rauch eingeschränkt ist. Dank der Temperaturmessfunktion<br />
können Einsatzkräfte<br />
sehen, ob ein Feuer hinter einer Wand<br />
brennt. Dieses Wissen hilft ihnen dabei,<br />
gefährliche Raumexplosionen zu vermeiden.<br />
Dafür bietet der Wärmebildkamerahersteller<br />
FLIR jetzt die FLIR K40 (240x180<br />
Pixel Auflösung) und FLIR K50 (320x240<br />
Pixel) mit ihrem großen und lichtstarken<br />
4“-Display. Sie überstehen einen Sturz<br />
aus 2 m Höhe auf einen Betonboden, sind<br />
wasserbeständig gemäß IP67, einfach zu<br />
bedienen (auch mit Handschuhen) und<br />
vollständig einsatzfähig bis +85 °C. (wb)<br />
TETRA-Pager für BOS-Netz<br />
Cassidian hat den ersten Auftrag für Paging-Dienste<br />
im neuen deutschen Digitalfunknetz<br />
der Behörden und Organisationen<br />
mit <strong>Sicherheit</strong>saufgaben (BOSNet)<br />
erhalten. Mehr als 50.000 Berufs- und<br />
freiwillige Feuerwehrleute sowie weitere<br />
Rettungs- und Hilfskräfte in Hessen werden<br />
ab Ende 2014 mit dem neuen TETRA-Pager<br />
ausgestattet. Dieser ermöglicht im Gegen-<br />
Hochmoderne Sanitäts-Gerätewagen für die MTF<br />
Das thüringische Innenministerium hat Ende Februar sieben neue Gerätewagen Sanität<br />
für seine Medizinische Task Force (MTF) erhalten. Der Bund ergänzt mit diesem<br />
Konzept im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Zivilschutzes<br />
den Katastrophenschutz der Länder vor allem im Bereich „Großanfall von Verletzten“.<br />
Die Helferinnen und Helfer der besonderen Verstärkungseinheit sind mit dem<br />
neuen Gerät in der Lage, direkt am Katastrophenort einen Behandlungsplatz für<br />
eine erste Notfallversorgung einzurichten. Als Trägerfahrzeug dient ein MAN TGL<br />
10.220 4x2 BB, der Spezialaufbau stammt von der Wietmarscher Ambulanz- und<br />
Sonderfahrzeuge GmbH. Mit einem Gesamtwert von 154.000 Euro sind die Fahrzeuge,<br />
in denen sechs <strong>Personen</strong> Besatzung Platz finden, für einen solchen Ernstfall<br />
bestmöglich ausgestattet. Zur Ausstattung gehören unter anderem Stromerzeuger,<br />
Zelte, Heizungen, Absperrmaterial, Werkzeuge, Tragen, Defibrillatoren, Beatmungsgeräte,<br />
Verbandmaterial und eine Grundausstattung mit Medikamenten. (ww)<br />
satz zu analogen Pagern die sichere bidirektionale<br />
Kommunikation zwischen Leitstelle<br />
und Einsatzkräften. Nach Alarmierung<br />
kann der Nutzer eine direkte Rückmeldung<br />
zu seiner Verfügbarkeit geben. Diese neue<br />
Art der Alarmierung ermöglicht ein verbessertes<br />
Einsatzkräfte-Management. Zu<br />
den Endgeräten wird Cassidian außerdem<br />
sein intelligentes Terminalmanagement-<br />
Tool Taqto liefern, über das die BOS ihre<br />
im Einsatz befindlichen Geräte und deren<br />
Parameterkonfigurationen erfassen können.<br />
Taqto unterstützt zudem Remote-Updates<br />
der Pager-Firmware über gesicherte<br />
Internet-Verbindungen und erleichtert damit<br />
die Verwaltung der Pager im Einsatz<br />
erheblich.<br />
(ww)<br />
Elektromobilität bei der<br />
Bundeswehr<br />
Die BwFuhrparkService GmbH hat zwei<br />
Opel Ampera – Hybridfahrzeuge – für den<br />
Betrieb in der Bundeswehr übernommen.<br />
Im Rahmen von Pilotvorhaben untersucht<br />
die Bundeswehr Möglichkeiten zur Reduzierung<br />
der Schadstoffemissionen und<br />
des Treibstoffverbrauchs im allgemeinen<br />
Fahrbetrieb durch die Nutzung alternativer<br />
Antriebe. Mit den jetzt übernommenen<br />
Ampera sollen in Bonn und Berlin die Praktikabilität<br />
für den allgemeinen Fahrbetrieb,<br />
die Akzeptanz durch die Nutzer und die<br />
tatsächlichen Betriebskosten ermittelt werden.<br />
Im Opel Ampera versorgt ein Lithium-<br />
Ionen-Akku mit 16 kWh Kapazität den 111<br />
kW starken Elektromotor mit Energie. Je<br />
nach Fahrstil und Einsatzbedingungen können<br />
im Durchschnitt 40 bis 80 Kilometer im<br />
reinen Batteriebetrieb emissionsfrei zurückgelegt<br />
werden.<br />
(eb)<br />
Leistungsgesteigerte<br />
40-mm-Munition für Italien<br />
Rheinmetall liefert für rund 8,7 Millionen<br />
Euro 50.000 leistungsgesteigerte Gefechtspatronen<br />
im Kaliber 40 mm x 53 an<br />
die italienischen Streitkräfte. Italien ist da-<br />
(Foto: BwFPS)<br />
April 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
7
Umschau<br />
(Foto: Rheinmetall)<br />
mit bereits der dritte NATO-Mitgliedstaat,<br />
der seine Armee mit dieser Munition ausstattet.<br />
Das Auftragsvolumen beläuft sich<br />
auf Die für automatische Granatwerfer leistungsgesteigerte<br />
40mm x 53 High Velocity<br />
High Explosive Dual Purpose Insensitive<br />
Munition Electronic Self Destruct (HV HEDP<br />
IM ESD) zeichnet sich durch hohe Präzision<br />
und Wirksamkeit gegen halbharte und<br />
leicht gepanzerte Ziele aus, sie kann über<br />
80 mm Panzerstahl durchschlagen und hat<br />
eine Reichweite von 2.200 Metern. Durch<br />
einen elektronischen Selbstzerstörungsmechanismus<br />
wird eine Gefährdung durch<br />
Blindgänger minimiert.<br />
(wb)<br />
Drohnen von Cassidian<br />
Cassidian hat die Zieldarstellungsdrohne<br />
Nummer 1.000 am Standort Friedrichshafen<br />
produziert. Die Drohne des Typs DT 45<br />
ist für die Deutsche Marine bestimmt. Seit<br />
2002 baut Cassidian Zieldarstellungsdrohnen,<br />
die mit unterschiedlichsten Sensoren<br />
und Sendern ausgerüstet werden können.<br />
Mit Infrarot oder Radarstrahlern simulieren<br />
sie beispielsweise Bedrohungen durch<br />
feindliche Flugzeug- oder Raketenangriffe.<br />
Die Bundeswehr übt mit Zieldarstellungsdrohnen<br />
auf den Übungsschießplätzen in<br />
Todendorf-Putlos an der Ostsee, in Südafrika<br />
und auf Kreta. Auch Streitkräfte aus<br />
dem Mittleren Osten, aus Kanada, Südafrika<br />
und Asien nutzen die Zieldarstellung von<br />
Diehl erhält Auftrag aus Schweden<br />
Die schwedische Beschaffungsbehörde Defence Material Administration und Diehl<br />
Defence haben einen Vertrag über die Lieferung Boden/Luft-Lenkflugkörpern (SAM)<br />
für die schwedischen Streitkräfte unterzeichnet. Die neuen Luftverteidigungssysteme<br />
umfassen den IRIS-T-Lenkflugkörper, die Abschussvorrichtung und das Feuerleitsystem.<br />
IRIS-T SLM basiert auf der Entwicklung des Boden/Luft-Lenkflugkörpers<br />
IRIS-T SL für die taktische Luftverteidigung der Bundeswehr. Nach der Stationierung<br />
erlaubt das System vollständigen automatischen Betrieb rund um die Uhr.<br />
Das schwedische Heer wird die Luftverteidigungssysteme gemeinsam mit einem<br />
neuen Einsatzführungssystem sowie modernisierter Sensorik von Saab betreiben.<br />
Die Auslieferung der ersten IRIS-T SLS-Systeme soll im Jahr 2016 beginnen. Als<br />
Partner im europäischen Flugkörperprogramm hat Schweden bereits den Luft/Luft-<br />
Lenkflugkörper IRIS-T für sein Gripen-Kampfflugzeug eingeführt.<br />
(wb)<br />
(Foto: Diehl)<br />
Cassidian. Über die Herstellung der Drohnen<br />
hinaus bietet Cassidian weltweit einen<br />
kompletten Service an, der die Erstellung<br />
der taktischen Szenarien, die Drohnen, deren<br />
Verschuss sowie die Trefferauswertung<br />
umfasst.<br />
(pp)<br />
Restaurierung der H-21<br />
In der Werft des Militärhistorischen Museums<br />
auf dem Flugplatz Berlin-Gatow (Luftwaffenmuseum)<br />
ist mit der Restaurierung<br />
eines Hubschraubers des Musters Piasecki/<br />
Vertol/Boeing H-21C „Workhorse“ begonnen<br />
worden. Der Hubschrauber entstand<br />
1951 bei Piasecki und flog am 11. April<br />
1952 zum ersten Mal. Der einmotorige<br />
(Kolbentriebwerk) Hubschrauber mit Tandemrotoren<br />
konnte in dem durchgehenden<br />
Rumpf 22 Soldaten aufnehmen. Die<br />
Bundeswehr beschaffte 32 H-21C, die ab<br />
Mai 1957 zuliefen. Eine der Hauptaufgaben<br />
der H-21C, die wegen ihrer Rumpfform<br />
auch „fliegende Banane“ genannt<br />
wurde, war die Vergleichserprobung mit<br />
der Sikorsky H-34G. Die H-34G wurde Sieger,<br />
und es wurden für alle Teilstreitkräfte<br />
insgesamt 191 Exemplare beschafft. (pp)<br />
U-Boot der DOLPHIN-mod<br />
Klasse<br />
Das für Israel bestimmte U-Boot INS RA-<br />
HAV der DOLPHIN-mod-Klasse, das bei<br />
(Foto: Cassidian)<br />
(Foto: Michael Nitz)<br />
(Foto: Luftwaffenmuseum)<br />
ThyssenKrupp Marine Systems/Howaldtswerke-Deutsche<br />
Werft gebaut wird, hat<br />
8 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · April 2013
kürzlich die überdachte Bauhalle verlassen<br />
und an der Ausrüstungspier festgemacht.<br />
Dort beginnen die ersten Hafentests und<br />
der Einbau von Geräten und Ausrüstung.<br />
Das mit Außenluft unabhängigem Brennstoffzellenantrieb<br />
ausgerüstete ca. 2.300 t<br />
große konventionelle U-Boot besitzt zehn<br />
Torpedorohre; aus den größeren Rohren<br />
können auch Spezialkräfte mit Ausrüstung<br />
oder auch Unmanned Underwater Vehicles<br />
u.a zur Minenabwehr ausgebracht und eingesetzt<br />
werden.<br />
(ds)<br />
Einsatzsystem der F124<br />
wird modernisiert<br />
ATLAS ELEKTRONIK und Thales Deutschland<br />
sind vom Bundesamt für Ausrüstung,<br />
Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr<br />
(BAAINBw) beauftragt, das Einsatzsystem<br />
der deutschen Fregatten der<br />
Klasse F124 zu modernisieren. Das aus den<br />
beiden <strong>Unternehmen</strong> bestehende Konsortium<br />
„HW Regeneration CDS F124“ wird<br />
bis 2017 die Hardware des Combat Direction<br />
System (CDS, entspricht Führungs- und<br />
Waffeneinsatzsystem) erneuern sowie die<br />
Software anpassen und modernisieren. Da<br />
die Entwicklung im Bereich kommerzieller<br />
Hard- und Software mit hoher Geschwindigkeit<br />
voranschreitet, ist der Austausch<br />
erforderlich. Der Auftrag umfasst die drei<br />
Fregatten SACHSEN, HAMBURG und HES-<br />
SEN sowie das Erprobungs- und Ausbildungszentrum<br />
(EZ/AZ) in Wilhelmshaven<br />
und die Reference Maintainer and Training<br />
Site (RMTS) in Den Helder. Die Schiffe sollen<br />
zur Umrüstung nicht aus dem Dienst<br />
genommen werden müssen. (wb)<br />
(Foto: Bundeswehr)<br />
100. Eurofighter an die Luftwaffe<br />
Am 28. Februar 2013 hat Cassidian in Manching<br />
im militärischen Luftfahrtzentrum, u.a.<br />
Endfertigung deutscher Eurofighter, den<br />
100. Eurofighter mit der Kennung 31+00 an<br />
die Luftwaffe übergeben. Symbolisch händigte<br />
hierzu Bernhard Gerwert, CEO von<br />
Cassidian, Generalleutnant Karl Müllner,<br />
Inspekteur der Luftwaffe, einen Sicherungsstift<br />
des Hauptfahrwerks aus. Während in<br />
den vorhergegangenen Reden Gerbert auf<br />
den Stellenwert dieses Hochtechnologieproduktes<br />
für Europa verwies, hob Müllner die zukünftige Bedeutung des mehrrollenfähigen<br />
Kampfflugzeugs für die Schlagkraft der Luftwaffe heraus. Das bedachte<br />
Konzept der Luftwaffe bei der Ausbildung der Flugzeugführer und <strong>Technik</strong>er sowie<br />
die graduelle Erweiterung des Einsatzspektrums des Eurofighters haben sich bewährt.<br />
Dies beweist die Tatsache, dass erstmalig in der Luftwaffengeschichte nach<br />
Einführung eines Kampfflugzeugs 30.000 Flugstunden unfallfrei mit einem neuen<br />
Muster geflogen wurden.<br />
(ur)<br />
Spyware MiniDuke<br />
MiniDuke heißt die neueste Spyware, die<br />
es anscheinend vor allen Dingen auf Regierungsbehörden<br />
und -mitarbeiter abgesehen<br />
hat. Hierfür nutzte der Trojaner unter<br />
anderem ein PDF mit dem Titel „Ukraine’s<br />
NATO Membership Action Plan (MAP)<br />
Debates“, das aus dem „Center for Peace,<br />
Conversion and Foreign Policy of Ukraine“<br />
stammen soll. Somit ist nicht nur die Malware<br />
selber sehr ausgefeilt, so ist sie beispielsweise<br />
nur 20 KB groß, sondern auch<br />
die Verbreitung geschieht gezielt mit speziellem<br />
Content auf sehr hohem Niveau.<br />
Ein Trick, der anscheinend erfolgreich war.<br />
Denn die Analyse von Kaspersky Lab ergab,<br />
dass eine Reihe hochrangiger Zielpersonen<br />
von MiniDuke angegriffen wurde.<br />
Diese <strong>Personen</strong> gehören Regierungsstellen<br />
in Belgien, Irland, Portugal, Rumänien, der<br />
Tschechischen Republik und der Ukraine<br />
an. Darüber hinaus seien in den USA ein<br />
Forschungsinstitut, zwei Thinktanks und<br />
ein Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich<br />
ebenso betroffen wie eine bekannte<br />
Forschungseinrichtung in Ungarn. „Der<br />
Backdoor-Trojaner MiniDuke ist hochspezialisiert<br />
und in der maschinennahen<br />
Sprache Assembler geschrieben. Daher ist<br />
er mit nur 20 KB sehr klein“, erklärt Eugene<br />
Kaspersky, Gründer und CEO von<br />
Kaspersky Lab. „Es ist die Kombination<br />
von klassischer Virenprogrammierung mit<br />
neuesten Exploit-Technologien sowie raffinierten<br />
Social-Engineering-Tricks, die diese<br />
in Bezug auf hochrangige Zielpersonen so<br />
gefährlich macht.“<br />
(df)<br />
„Sense & Avoid“-Sensor<br />
mit LIDAR<br />
EMT entwickelt in enger Kooperation mit<br />
dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnologie<br />
und Nutzung der Bundeswehr<br />
und dem Ingenieurbüro Spies einen<br />
sogenannten „Sense & Avoid“-Sensor der<br />
zweiten Generation mit LIDAR-Technologie<br />
(Light detection and ranging) für das<br />
taktische unbemannte Fluggerät LUNA.<br />
(Foto: EMT)<br />
(Fotos: Cassidian)<br />
Mit der LIDAR-Technologie können Luftfahrzeuge<br />
erkannt werden, die selbst nicht<br />
mit Transpondern ausgestattet sind. Der<br />
„Sense & Avoid“-Sensor wird dazu dienen,<br />
anderen in der Nähe befindlichen Luftverkehr<br />
zu erkennen und diesem gegebenenfalls<br />
automatisch auszuweichen. Mit der<br />
ergänzenden Kombination von aktivem<br />
LIDAR und dem bereits seit 2012 eingebauten<br />
Automatic Dependent Surveillance-<br />
Broadcast (ADS-B)-Transponder, der LUNA<br />
für die Flugsicherung sichtbar macht, wird<br />
die Flugsicherheit nochmals sehr deutlich<br />
gesteigert. Das modulare LUNA-System<br />
ist bereits seit dem Jahr 2000 im Einsatz<br />
und besteht aus mehreren Luftfahrzeugen/<br />
Plattformmodulen (LUNA, MUSECO und<br />
LUNA NG). Alle können zur Erhöhung der<br />
Flugsicherheit mit Transponder und LIDAR<br />
ausgestattet werden.<br />
(gwh)<br />
April 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
9
SICHERHEIT & POLITIK<br />
Bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr<br />
Henning Bartels<br />
Deutschland erwägt zum Schutz seiner Soldaten die Anschaffung auch bewaffneter Drohnen. Gegen reine Aufklärungsdrohnen<br />
wie die vom Typ „Heron“ bestehen keine Bedenken. Die Debatten, die jetzt mit besonderer<br />
Intensität in Deutschland angefangen werden, drehen sich um bewaffnete Drohnen. Dabei geht es nicht nur<br />
um die militärisch-taktischen Eigenschaften von Drohnen, sondern besonders um die moralischen, sittlichen<br />
und völkerrechtlichen Probleme, die sich aus dem Einsatz ergeben können. Im Zentrum der Diskussion steht<br />
dabei das Argument, dass die Schwelle zum Töten umso niedriger sei, je weiter weg sich die Menschen befänden,<br />
die die Waffen bedienen. Dabei spielt die Diskussion, die sich in den USA aus dem Einsatz von Kampfdrohnen<br />
gegen Terroristen in Afghanistan oder Pakistan entwickelt hat, auch bei uns eine nicht unerhebliche Rolle.<br />
ES&T hat die Verteidigungspolitischen Sprecher der im Bundestag vertretenen Parteien um eine Stellungnahme<br />
zum Thema Drohnen gebeten. Ergänzend dazu berichtet Sidney E. Dean über die US-Debatte zum Einsatz<br />
von Kampfdrohnen.<br />
Mittelfristig eine notwendige<br />
Maßnahme<br />
Ernst-Reinhard Beck MdB,<br />
Verteidigungspolitischer Sprecher<br />
der CDU/CSU-Fraktion<br />
Unsere deutschen Soldaten können mit<br />
Hilfe von Drohnen bereits heute schnell<br />
und zielgerichtet Informationen erhalten.<br />
Das ermöglicht in vielen Fällen eine bessere<br />
und umfangreichere Beurteilung der Situation<br />
vor Ort. Die Drohnen tragen damit<br />
massiv zum Schutz unserer Soldaten bei.<br />
Bei vorausschauender Planung zukünftiger<br />
Einsatzszenarien muss selbstverständlich<br />
auch die Beschaffung bewaffneter<br />
Drohnen in Betracht gezogen werden.<br />
Beim Einsatz von<br />
Drohnen als Waffensystem<br />
gelten für uns<br />
die gleichen völkerrechtlichen<br />
Grundlagen,<br />
wie für den<br />
Einsatz aller Waffen.<br />
Einen Einsatz bewaffneter<br />
Drohnen ohne<br />
Bundestagsmandat<br />
ist verfassungsrechtlich<br />
nicht möglich.<br />
Wichtig ist, dass der<br />
Einsatz bewaffneter<br />
Drohnen die Schwelle zur Gewaltanwendung<br />
nicht herabsetzt. Wenn wir unsere<br />
Soldaten durch die Einführung eines solchen<br />
Waffensystems aber einer geringeren<br />
Gefahr aussetzen, bin ich für die Beschaffung.<br />
Der Schutz unserer Soldaten hat<br />
an dieser Stelle für mich oberste Priorität.<br />
Ich bin der Überzeugung, dass die europäische<br />
wehrtechnische Industrie in Zusam-<br />
menarbeit mit den Streitkräften in der Lage<br />
ist, eine für unsere Ansprüche zugeschnittene<br />
Lösung zu entwickeln. Die Beschaffung<br />
von bewaffneten Drohnen sehe ich mittelfristig<br />
als notwendige Maßnahme, um<br />
die Bundeswehr auf dem aktuellen Stand<br />
der <strong>Technik</strong> zu halten. Darüber hinaus ist<br />
es eine sicherheits- und bündnispolitische<br />
Entscheidung, der wir uns stellen müssen,<br />
um unserer internationalen Verantwortung<br />
gerecht zu werden.<br />
Substantielle Antworten<br />
werden erwartet<br />
Elke Hoff MdB,<br />
<strong>Sicherheit</strong>spolitische Sprecherin<br />
der FDP-Fraktion<br />
Eine mögliche Beschaffung von bewaffneten<br />
unbemannten fliegenden Systemen,<br />
sogenannten Drohnen, stand in den vergangenen<br />
Wochen sowohl im Parlament<br />
als auch in den Medien auf der Tagesordnung.<br />
Wegen des Auslaufens des Leasingvertrags<br />
für den Heron 1 zum Ende des<br />
Jahres 2014 muss zeitnah über eine Nachfolge<br />
entschieden werden, damit aus Sicht<br />
der Bundeswehr für diesen Bereich keine<br />
Fähigkeitslücke entsteht. Gerade vor dem<br />
Hintergrund der Dringlichkeit einer anstehenden<br />
Entscheidung halte ich eine klare<br />
und nachvollziehbare sicherheitspolitische<br />
Begründung für die Beschaffung von bewaffneten<br />
Drohnen für zwingend geboten.<br />
Die Frage, für welche Einsätze der Bundeswehr<br />
bewaffnete Drohnen in Zukunft auf<br />
der Grundlage unserer Verfassung genutzt<br />
werden sollen, muss gerade wegen der<br />
kontroversen Debatte über gezielte Tötungen<br />
durch andere Staaten im Kampf gegen<br />
den internationalen<br />
Terrorismus beantwortet<br />
werden.<br />
Alleine die Begründung<br />
„Deutschland<br />
darf technologisch<br />
den Anschluss nicht<br />
verlieren“ reicht dafür<br />
zunächst nicht<br />
aus, da es sich bei<br />
der anstehenden<br />
Entscheidung um<br />
eine Kauflösung<br />
und nicht um die<br />
Entwicklung eines eigenen deutsch-europäischen<br />
Systems handelt. Außerdem sollte<br />
dargelegt werden, was die Beschaffung von<br />
bewaffneten Drohnen konzeptionell für den<br />
Einsatz bereits vorhandener fliegender Plattformen<br />
sowie für die Beschaffung neuer<br />
Varianten bereits eingeführter Systeme, wie<br />
z.B. die 3. Tranche des Eurofighters, bedeutet.<br />
Sollte in absehbarer Zukunft auch die<br />
Entscheidung für eine eigene europäische<br />
Entwicklung fallen, müssen schon heute<br />
die bisher nicht vorhandene Zulassung von<br />
schweren unbemannten Luftfahrzeugen für<br />
den Betrieb im zivilen gesamteuropäischen<br />
Luftraum geklärt sein, damit dies überhaupt<br />
Sinn macht. Außerdem sollte auch das breite<br />
Spektrum ziviler Nutzungsmöglichkeiten<br />
beispielsweise zum Aufspüren von Umweltschäden<br />
oder der Überwachung von<br />
Energie-Infrastruktur dargestellt werden.<br />
Die FDP-Bundestagsfraktion verschließt sich<br />
keinesfalls der Einführung dieser neuen und<br />
für den Schutz unserer Soldaten sinnvollen<br />
Technologie, allerdings sollten die vorhandenen<br />
Fragen vorher substanziell beantwortet<br />
werden.<br />
18 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · April 2013
SICHERHEIT & POLITIK <br />
„Kein schlichtes ja/nein“<br />
Rainer Arnold MdB,<br />
Verteidigungspolitischer Sprecher<br />
der SPD-Bundestagsfraktion<br />
Unbemannten Flugzeugen – zivil und militärisch<br />
– gehört die Zukunft. Sie sind verhältnismäßig<br />
preiswert, brauchen weder<br />
fliegendes Personal noch Eigenschutz. Das<br />
Vorhaben der Bundesregierung allerdings,<br />
jetzt bewaffnete Drohnen zu beschaffen,<br />
macht politisch keinen Sinn. Die Bundeswehr<br />
hat weder eine aktuelle Fähigkeitslücke<br />
noch verfügt die Luftwaffe über ein<br />
Konzept, in welchen Szenarien Drohnen<br />
notwendig sind und wie sie eingesetzt<br />
werden sollen. Es gibt derzeit in Europa<br />
nicht einmal Regularien, wie Drohnen in<br />
den Luftraum integriert werden können.<br />
Bevor über die Anschaffung solcher Systeme<br />
entschieden wird, brauchen wir vielmehr<br />
eine gesellschaftspolitische Debatte<br />
darüber ob, wann und wie wir bewaffnete<br />
Drohnen einsetzen wollen. Hier stehen<br />
völkerrechtliche und ethische Fragen im<br />
Vordergrund. Die illegalen Drohnenangriffe<br />
der USA in Jemen und in Pakistan<br />
verdeutlichen die Notwendigkeit, solche<br />
Einsätze einzugrenzen, ob im Völkerrecht<br />
oder durch Instrumente der Rüstungskontrolle.<br />
Die Gefahr, dass am Ende dieser technologischen<br />
Entwicklung automatisierte Systeme<br />
stehen, die vom Schreibtisch aus auf<br />
bestimmte Merkmale hin programmiert<br />
werden, sehe ich mit großer Besorgnis. Zu<br />
dieser Debatte gehört deshalb eine klare<br />
völkerrechtliche Ächtung von vollautomatisierten<br />
Systemen.<br />
Wir müssen uns aber auch fragen, ob der<br />
Einsatz von Drohnen nicht die Schwelle für<br />
Auslandseinsätze von Parlamenten und Regierungen<br />
senkt. Werden eigene Soldaten<br />
gar nicht gefährdet, verändert dies auch die<br />
Kriegführung der Militärs – möglicherweise<br />
wird rascher über einen tödlichen Einsatz<br />
entschieden.<br />
Sollte sich am Ende dieser Debatte erweisen,<br />
dass bewaffnete oder waffenfähige<br />
Drohnen einen wichtigen und angemessenen<br />
Beitrag zu einer umfassenden<br />
<strong>Sicherheit</strong>s- und<br />
Verteidigungspolitik<br />
darstellen, muss<br />
immer noch eine<br />
gezielte Kooperation<br />
zwischen Großbritannien,<br />
Frankreich<br />
und Deutschland zur<br />
Entwicklung dieser<br />
Systeme eingeleitet<br />
werden. Ein Kauf<br />
von der Stange auf<br />
dem amerikanischen<br />
Markt würde den Weg für eine mögliche<br />
europäische Lösung erschweren, wenn<br />
nicht gar verbauen. Solange kann die<br />
Bundeswehr die bislang geleasten Aufklärungssysteme<br />
Heron weiterverwenden.<br />
Weil Frankreich über die gleichen Systeme<br />
verfügt, ist eine europäische Kooperation<br />
zwischen Deutschland und Frankreich bei<br />
der Entwicklung von Drohnen auch später<br />
immer noch möglich. Das würde auch industriepolitisch<br />
Sinn machen.<br />
Erforderliche Debatte<br />
Omid Nouripour MdB,<br />
Sprecher für <strong>Sicherheit</strong>spolitik der<br />
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen<br />
Bewaffnete Drohnen werden heute sehr<br />
häufig von den USA für extra-legale gezielte<br />
Tötungen eingesetzt. Dies lehnen<br />
wir grundlegend ab. Wir erwarten von<br />
der Bundesregierung, dass sie sich für<br />
eine internationale Ächtung solcher Einsätze<br />
engagiert. Gleichzeitig muss sie<br />
sich dafür einsetzen, dass internationale<br />
Regularien für die Einsätze unbemannter<br />
Systeme präzisiert und gestärkt werden.<br />
Verteidigungsminister de Maizière spricht<br />
sich für die baldige Anschaffung von bewaffneten<br />
Drohnen auch für die Bundeswehr<br />
aus. Bereits im März sollen hierzu<br />
erste Entscheidungen fallen. Dieses Vorgehen<br />
ist falsch und nicht verantwortbar.<br />
Noch immer sind viele Fragen bezüglich der<br />
Anschaffung von Drohnen ungeklärt: Wie<br />
verändert ihr Einsatz die Hemmschwelle<br />
der Kriegsführung Welche Auswirkungen<br />
hat er auf die Art und Weise der Kriegführung<br />
insgesamt Was passiert, wenn<br />
künftige Systeme nicht nur unbemannt,<br />
sondern auch autonom agieren Hierzu<br />
ist eine umfassende gesellschaftliche<br />
Debatte erforderlich, um alle rechtlichen<br />
und ethischen Fragen zum Einsatz solcher<br />
Systeme zu diskutieren, anstatt blind technologischen<br />
Entwicklungen zu folgen.<br />
Noch im letzten Jahr hatte auch Verteidigungsminister<br />
de Maiziere eine breite öffentliche<br />
Debatte angeregt, doch nun will<br />
er innerhalb kürzester Zeit Fakten schaffen.<br />
Ein solches Vorgehen ist unglaubwür-<br />
dig, und es wird den möglichen Folgen<br />
und Risiken dieser neuen Technologien<br />
nicht gerecht. Daher lehnen wir die derzeitigen<br />
Beschaffungspläne der Bundesregierung<br />
für Kampfdrohnen ab.<br />
Kampfdrohnen:<br />
Unangenehme Fragen<br />
Paul Schäfer MdB,<br />
Verteidigungspolitischer Sprecher<br />
der Fraktion DIE LINKE<br />
Bereits Mitte des vergangenen<br />
Jahres hatte<br />
Verteidigungsminister<br />
Thomas de Maizière eine<br />
Debatte um die Beschaffung<br />
von Kampfdrohnen<br />
angekündigt. Dass<br />
sie nun ernsthaft geführt<br />
wird, ist allerdings<br />
nicht sein Verdienst:<br />
Auf die Tagesordnung<br />
des Parlaments kam die<br />
Angelegenheit auf Antrag<br />
der Fraktion DIE<br />
LINKE – weil die Antwort der Bundesregierung<br />
auf eine Kleine Anfrage sich<br />
liest, als sei der Kauf bereits beschlossene<br />
Sache. Transparenz geht anders.<br />
Die Zurückhaltung hat Gründe, denn mit<br />
dem Thema Kampfdrohnen sind unangenehme<br />
Fragen verbunden. So werden sie<br />
für die Landesverteidigung nicht benötigt,<br />
vielmehr sind sie ein klassisches Instrument,<br />
um in weit entfernten Guerillakriegen mit<br />
technologischer Überlegenheit aufzutrumpfen.<br />
Soll die Bundeswehr am Grundgesetz<br />
vorbei zur Aufstandsbekämpfungsarmee<br />
umgebaut werden Auch ethische<br />
Fragen brechen auf, etwa die nach zivilen<br />
Opfern (für den Drohnenkrieg der USA<br />
in Pakistan sind mehrere Hundert belegt)<br />
und nach der Legitimität gezielter Tötungen,<br />
die ja nicht einfach die Alternative<br />
zu Flächenbombardements sind, sondern<br />
die rechtlich hochproblematische Exekution<br />
eines Todesurteils, das ohne Gerichtsverfahren<br />
gefällt wurde. Und schließlich<br />
gibt es völkerrechtliche Probleme, Stichwort<br />
Unverletzlichkeit des Luftraums.<br />
Das alles lässt sich nicht so lapidar abbügeln,<br />
wie der Minister es tut. Vor allem<br />
aber ist nicht die Frage, ob irgendwann alle<br />
Drohnen haben oder alle außer der Bundeswehr.<br />
Von Atomwaffensperrvertrag bis<br />
Streubomben- und Landminenkonvention<br />
reichen die Beispiele, die zeigen, dass internationale<br />
Einigkeit und nationale Entwicklungs-<br />
und Produktionsverbote Wirkung<br />
entfalten können. Hier, und nicht beim<br />
angeblich alternativlosen Laufen mit der<br />
Masse, liegt die Aufgabe der Bundesregierung.<br />
<br />
April 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
19
RÜSTUNG & TECHNOLOGIE <br />
Erstflug des A400M-Serienflugzeugs<br />
(Foto: U. Rapreger)<br />
Ulrich Rapreger<br />
Drei Jahre und drei Monate nachdem<br />
der Prototype MSN01 des Transportflugzeugs<br />
A400M seinen Jungfernflug<br />
absolvierte hatte, hob am 6. März 2013<br />
das erste Serienflugzeug (MSN07) in Sevilla<br />
zum Testflug ab. Nach Abschluss weiterer<br />
Prüfflüge durch das Flight Test Centre<br />
in Sevilla wird das Flugzeug offiziell an die<br />
französische Luftwaffe übergeben. Deren<br />
Testpiloten führen dann drei bis vier Abnahmeflüge<br />
in Sevilla durch und verlegen<br />
anschließend die Maschine nach Orléans-<br />
Bricy. Voraussetzung für die Übergabe an<br />
Frankreich ist die bereits erteilte volle zivile<br />
Musterzulassung (Type Certification, TC)<br />
durch die European Aviation Safety Agency<br />
(EASA) und die in Kürze erwartete militätische<br />
Zulassung (Initial Operating Clerance,<br />
IOC) durch das Certification and Qualification<br />
Committee (CQC), das sich aus<br />
Vertretern der Nationen und der OCCAR<br />
zusammenstezt.<br />
Programmstand<br />
Erstes Serienflugzeug A400M (MSN07) für Frankreich beim nahezu sechsstündigen<br />
Testflug<br />
Testprogramm<br />
Seit dem Erstflug im Dezember 2009 wurden<br />
mit den fünf Testflugzeugen (MSN01<br />
bis 04 und 06) bei über 1.600 Flügen ca.<br />
4.750 Stunden geflogen. Von Zwischenfällen<br />
mit den Triebwerken abgesehen hat die<br />
A400M im Verlauf der Testflüge eine hohe<br />
Standfestigkeit bewiesen.<br />
Bezogen auf alle fünf Prototypen der<br />
A400M liegt der Schwerpunkt des Erprobungsprogramms<br />
jetzt u.a. bei der Erweiterung<br />
des klimatischen Einsatzbereichs, Tests<br />
der militärischen Kommunikationsanlage<br />
sowie der passiven/aktiven Selbstschutzeinrichtungen,<br />
Ermittlung der Radarrückstrahlfläche,<br />
Be- und Entladen unterschiedlichster<br />
konnten an der MSN5001 bei der IABG<br />
in Dresden abgeschlossen werden. Mit<br />
Abschluss der dynamischen Tests wird die<br />
geplante Lebensdauer um das 2,5-fache<br />
überschritten worden sein.<br />
Produktion/Auslieferung<br />
In den Docks der Final Assembly Line in<br />
Sevilla befinden sich zurzeit MSN08 bis<br />
MSN12. Bis Ende 2014 sollen insgesamt<br />
14 A400M an vier Nationen, einschließlich<br />
Deutschland, ausgeliefert werden. Die militärische<br />
Freigabe wird von der Initial Operating<br />
Clearance (MSN07 bis 09) bis zur Standard<br />
Operating Clearance (SOC) 1 (MSN10<br />
bis 20) aufwachsen. Alle Transporter werden<br />
fortlaufend teilweise in Sevilla und<br />
hauptsächlich bei den Nationen auf den<br />
jeweils gültigen SOC-Stand nachgerüstet.<br />
Alle voll integrierten militärischen Fähigkeiten<br />
(SOC 3) werden 2019 voraussichtlich<br />
ab der MSN120 erreicht werden. Ab 2016<br />
wird die Produktionsrate so hochgefahren,<br />
dass jährlich bis zu 28 Transporter zur Auslieferung<br />
kommen können.<br />
(Foto: Airbus Military)<br />
Am „Loadmaster Workstation Trainer” erhalten die Ladungsmeister<br />
eine umfangreiche Ausbildung u.a. zum punktgenauen Absetzen von<br />
Personal und Material<br />
Während bislang das Testprogramm und<br />
die Aufnahme der Serienproduktion im<br />
Mittelpunkt standen, rücken die angelaufenen<br />
vorbereitenden Maßnahmen in den<br />
Fokus. Dazu zählen die Übergabeverfahren<br />
der Serienmaschinen an den Nutzer, Ausbildung<br />
von Besatzungen sowie <strong>Technik</strong>ern<br />
und auf Seiten der Nationen Infrastrukturmaßnahmen,<br />
Instandhaltungsverträge sowie<br />
Ersatzteilbevorratung.<br />
Fracht, Absetzen von Personal und Material<br />
sowie erweiterte Luftbetankung.<br />
Weit über die Hälfte der vorgesehenen<br />
25.000 dynamischen Belastungszyklen<br />
Ausbildung<br />
Für die Grundlagenausbildung wurde in<br />
Sevilla das International Training Centre<br />
(ITC) errichtet. Auf 12.000 m² verteilen sich<br />
sechs Simulatoreinheiten, 22 Ausbildungsräume<br />
und diverse Ausbildungseinrichtungen,<br />
die durch die EASA eine Zertifizierung<br />
erhalten haben. Grundsätzlich bietet das<br />
ITC den Nationen die Möglichkeit, die komplette<br />
Ausbildung in Sevilla durchzuführen.<br />
Frankreich, Großbritannien und Deutschland<br />
haben sich jedoch für die Einrichtung<br />
von eigenen „National Training Centres<br />
(NTC)“ in Orléans, Brize Norton und Wunstorf<br />
(Lufttransportgeschwader 62, LTG<br />
62) entschlossen und greifen nur in der<br />
April 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
53
RÜSTUNG & TECHNOLOGIE<br />
(Graphiken: mawibo-media media)<br />
Bereits im Produktionsprozess mit Auslieferung in:<br />
Land 2013 2014 2015<br />
MSN07/08/10<br />
Anfangsphase auf das ITC zurück. Großbritannien<br />
hat bereits im März 2013 für eine<br />
Laufzeit von 18 Jahren mit „A400M Training<br />
Services Ltd” (Airbus Military/Thales UK) einen<br />
Vertrag über die Ausbildung von Besatzungen<br />
und <strong>Technik</strong>ern in Brize Norton<br />
abgeschlossen.<br />
Installiert oder im Zulauf sind beim ITC und<br />
den NTC Computer Based Training (CBT),<br />
Cockpit Maintenance Operations System<br />
(CMOS), Loadmaster Workstation Trainer<br />
(LMWST), Full Flight Simulator (FFS), Flat<br />
Panel Flight Training Device (FPFTD) und<br />
Cargo Hold Trainer-Enhanced (CHT-E).<br />
Zurzeit befinden sich im ITC 18 <strong>Technik</strong>er<br />
sowie fünf Ladungsmeister in der theoretischen<br />
und praktischen Ausbildung. Da der<br />
A400M Full Flight Simulator in Sevilla noch<br />
kurz vor der Endabnahme steht, erhalten<br />
MSN11/12/14/15/19<br />
MSN09 MSN13 MSN23/27/28<br />
MSN16/17/20<br />
MSN18<br />
MSN21/24/25/26<br />
MSN29*<br />
MSN22<br />
Summe 4 10 9** (21***)<br />
*<br />
**<br />
***<br />
Militärische<br />
Freigabe<br />
IOC*<br />
SOC** 1<br />
SOC 1.5<br />
SOC 2.0<br />
SOC 2.5<br />
SOC 3<br />
*<br />
**<br />
***<br />
Deutschland erhält 2015 insgesamt fünf A400M<br />
Die Teilefertigung ist bereits bis MSN29 angelaufen<br />
13 weitere A400M (MSN30 bis 42) sind 2015 für eine Auslieferung geplant<br />
Voll integrierte Fähigkeiten ab Lfz Jahr<br />
Transport von Truppen, Fahrzeugen,<br />
militärischen Paletten bis zur garantierten<br />
Nutzlast von 32 Tonnen***<br />
Absetzen aus der Luft (eingeschränkt),<br />
Selbstschutz (eingeschränkt)<br />
Absetzen aus der Luft, Selbstschutz, Luftbetankung<br />
(eingeschränkt)<br />
Erweitertes taktisches Einsatzspektrum,<br />
zusätzliche Leistungssteigerungen<br />
Volles Luftbetankungsspektrum,<br />
Such- & Rettungsdienst<br />
MSN07 2013<br />
MSN10 2013<br />
MSN21 2015<br />
MSN45 2016<br />
~ MSN90 2017<br />
Tiefflug<br />
~ MSN120 2019<br />
Initial Operating Clearance<br />
Standard Operating Clearance<br />
Neben der garantierten Nutzlast von 32 Tonnen können vom Nutzer zusätzlich 5 Tonnen<br />
in Form von nationaler Zusatzausrüstung (z.B. Verzurrmaterial, erweiterte Selbstschutzsysteme)<br />
mitgeführt werden, so dass die Gesamtnutzlast 37 Tonnen beträgt<br />
vier Flugzeugführer der französischen Luftwaffe<br />
eine Einweisung auf dem A380-Simulator<br />
in Toulouse.<br />
Trotz aller perfekten Vorbereitung am Boden<br />
müssen natürlich für die Musterberechtigung<br />
der Besatzungen ein bis zwei<br />
Ausbildungsflüge durchgeführt werden.<br />
Für diese ist die MSN6 vorgesehen, die mit<br />
nahezu Serienstandard ausgestattet ist.<br />
Logistik<br />
Zur Einführung und Aufnahme des Flugbetriebs<br />
gehören fliegerische und technische<br />
Handbücher sowie Checklisten, die nahezu<br />
vollständig erstellt sind. Sie sind die Voraussetzung<br />
für die Aufnahme des Flugbetriebs<br />
sowie Wartung/Instandhaltung der ersten<br />
A400M bei der französischen Luftwaffe.<br />
Weiter befinden sich gemäß „A400M<br />
Launch Contract“ Bodendienstgeräte und<br />
technische Überwachungs-/Betriebssysteme<br />
(z.B. Helpdesk) im Zulauf. Die ersten Ersatzteilpakete<br />
sind in Orléans eingelagert.<br />
Für die Aufnahme des Flugbetriebs hat<br />
Frankreich im März 2013 einen Vertrag<br />
über einen Initial „In-Service Support (ISS)“<br />
für die Dauer von 18 Monaten abgeschlossen.<br />
Dieser beinhaltet industrielle Wartungs-/<br />
Instandhaltungsunterstützung und<br />
Ersatzteilmanagement durch Airbus Military<br />
in Orléans sowie einen werksseitigen<br />
Informationsdienst bei der Störbehebung.<br />
Für den Zeitraum danach hat Airbus Military<br />
im November 2012 Frankreich und<br />
Großbritannien ein Angebot über einen<br />
langfristigen binationalen ISS vorgelegt,<br />
über den in der zweiten Hälfte dieses Jahres<br />
entschieden werden soll.<br />
Luftwaffe<br />
Im Rahmen des Testprogramms haben sich<br />
neben Testpiloten der Wehrtechnischen<br />
Dienststelle 61 einige Piloten der Transportgeschwader<br />
bereits von dem Leistungsvermögen<br />
und der leichten Handhabbarkeit<br />
der A400M überzeugen können. Nur ein<br />
kleiner Kern der Piloten wird bis zum Jahr<br />
2014 die Musterberechtigung erhalten.<br />
Dafür beginnen ab Herbst 2013 die ersten<br />
Ausbildungsabschnitte für Piloten, <strong>Technik</strong>er<br />
und Ladungsmeister am Airbus Military<br />
International Training Center (ITC) in Sevilla.<br />
Dieses Personal ist dann primär für die weitere<br />
Verwendung als „Kader-Personal“ im<br />
NTC beim LTG 62 vorgesehen.<br />
In Wunstorf laufen umfangreiche Maßnahmen<br />
zum Bau von Hallen, einem Lehrsaalgebäude<br />
für das NTC und einem Simulatorgebäude.<br />
Während die Infrastruktur<br />
deutlich Formen annimmt, sind Fragen des<br />
Betriebs des NTC, der personellen Ausstattung<br />
sowie der Ausgestaltung des Lehrbetriebs<br />
noch nicht endgültig entschieden.<br />
Ebenfalls noch nicht geregelt ist der langfristige<br />
„In-Service Support“. Eine entsprechende<br />
Ausschreibung hierfür – zumindest<br />
für eine befristete Anfangsabdeckung von<br />
einigen Jahren – befindet sich in Vorbereitung.<br />
Die offen stehende Option einer<br />
Beteiligung am französisch-britischen<br />
ISS-Vertrag mit Airbus Military wird vom<br />
größten A400M-Kunden jedoch nach wie<br />
vor nicht verfolgt; man setzt auf national<br />
eigenständige Lösungsansätze.<br />
Da die Luftwaffe erst Ende 2014 die dann<br />
zwölfte Serienmaschine erhält, wird die<br />
Luftwaffe sicherlich die Chance nutzen<br />
und frühzeitig der französischen Luftwaffe<br />
bei der Aufnahme des Flugbetriebs<br />
über die Schulter schauen, um daraus für<br />
die eigene Einführung ihre Erkenntnisse zu<br />
gewinnen.<br />
<br />
54 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · April 2013
RÜSTUNG & TECHNOLOGIE<br />
Das LCS-Programm der U.S. Navy<br />
Beteiligung deutscher <strong>Unternehmen</strong><br />
Dieter Stockfisch<br />
Das Programm der U.S. Navy zum Bau von Littoral Combat Ships (LCS) für den Einsatz in Küstengewässern<br />
(Littorals) unter asymmetrischen Bedrohungen ist einzigartig, denn es wurden im Wettbewerb zwei unterschiedliche<br />
Schiffstypen/Klassen entwickelt: Die LCS der FREEDOM-Klasse (LCS-1) mit konventionellem<br />
Schiffsrumpf (monohull) nach dem Design von Lockheed Martin und die LCS der INDEPENDENCE-Klasse<br />
(LCS-2) als Trimaran nach dem Design von General Dynamics. Beide Schiffe sind aus Stahl-Aluminium (Aufbauten)<br />
konstruiert und wurden als Prototypen gebaut. Ursprünglich sollten 55 LCS gebaut werden, doch<br />
wegen Budgetkürzungen und Kostenüberschreitungen ist vorerst der Bau von zehn Schiffen pro Klasse<br />
geplant.<br />
Die USS FREEDOM (LCS-1) wurde<br />
bereits 2008 und die USS FORT<br />
WORTH (LCS-3) soll Mitte 2013 in<br />
Dienst gestellt werden. Von den Trimaranen<br />
wurde die USS INDEPENDENCE (LCS-<br />
2) 2010 in Dienst gestellt und die USS CO-<br />
RONADO (LCS-4) soll Ende 2013 der U.S.<br />
Navy übergeben werden.<br />
FREEDOM-Klasse (LCS-1)<br />
(Foto: U.S. Navy)<br />
Das LCS-1 ist ein Mehrzweckschiff, das<br />
speziell für vielfältige Missionen in Küstengewässern<br />
bzw. Flachwassergebieten konstruiert<br />
wurde. Im Gegensatz zum LCS-2 besitzt<br />
das nach Stealth-Technologien gebaute<br />
Schiff einen konventionellen Rumpf. Die<br />
Aufbauten sind aus Aluminium gefertigt.<br />
Nach den konzeptionellen Einsatzvorgaben<br />
der US-Maritime Strategy („A<br />
Cooperative Strategy for 21st Century<br />
Seapower“) sollen die Schiffe als Einsatzverband<br />
(drei Schiffe) in Küstengewässern<br />
operieren, um diese Gewässer von<br />
gegnerischen Kräften bzw. Bedrohungen<br />
frei zu halten und damit die Operationen<br />
der U.S. Navy, die gegen gegnerische<br />
Küsten operieren, zu unterstützen. Dazu<br />
zählen die Fähigkeit zur U-Jagd und Minenabwehr,<br />
zur Bekämpfung von kleinen<br />
Überwasserzielen und zu humanitären<br />
Einsätzen in Küstengewässern. Für ihre<br />
Einsätze werden die Schiffe je nach Mission<br />
mit Missionsmodulen (U-Jagd, ASW;<br />
Minenabwehr, MCM; Überwasserkampf,<br />
ASuW) ausgerüstet, die flexibel und in<br />
kurzer Zeit eingerüstet und wieder ausgerüstet<br />
werden können. Das Flugdeck mit<br />
Hangar bietet ausreichend Platz für zwei<br />
Hubschrauber. Eine Heckrampe und eine<br />
Seitenrampe sind für die Anbordnahme<br />
der Missionsmodule vorgesehen. Zwei<br />
11-m-Festrumpfschlauchboote (Rigid Hull<br />
Das LCS-1 USS FREEDOM<br />
Inflatable Boat, RHIB) dienen zum Einsatz<br />
von Spezialkräften.<br />
Die USS FREEDOM hat nach ihrer Indienststellung<br />
2008 lange Werftliegezeiten<br />
absolvieren müssen. Bei den ersten<br />
Erprobungs- und Einsatzfahrten waren<br />
Korrosionsschäden und Risse in den Aluminiumaufbauten<br />
sowie Wassereinbrüche<br />
in den Ankereinrichtungen und Wellenaustritten<br />
aufgetreten. Zudem bedurften der<br />
Hangar für die Bordhubschrauber und die<br />
Aussetzvorrichtungen für die verschiedenen<br />
Missionsmodule einer grundlegenden<br />
Erneuerung. Diese Schäden bzw. Erneuerungen<br />
sind inzwischen behoben bzw.<br />
durchgeführt worden. Auch wurde das<br />
Einsatzkonzept für die LCS überarbeitet.<br />
Die Besatzungsstärke soll von 50 auf 60<br />
<strong>Personen</strong> erhöht werden. Da den Schiffen<br />
die Fähigkeit fehlt, sich gegen Anti-Ship-<br />
Cruise Missiles zu verteidigen, ist eine Nach-<br />
Technische Daten LCS-1<br />
Länge<br />
115,30 m<br />
Breite<br />
17,50 m<br />
Tiefgang 4,10 m<br />
Verdrängung 3.089 t<br />
Besatzung 50<br />
Antrieb<br />
CODAG-Antrieb<br />
Geschwindigkeit 45 kn<br />
Reichweite 3.500 sm/14 kn<br />
Bewaffnung 3 x Netfires NLOS-LS für<br />
SSM-FK<br />
1 x RAM<br />
1 x 57-mm-Geschütz<br />
2 x 30-mm-Geschütze<br />
VDS-Sonar<br />
(vorgesehen)<br />
Hubschrauber/UAV<br />
Missionsmodule<br />
66 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · April 2013
Das LCS-2 USS INDEPENDENCE<br />
Der Hochgeschwindigkeitskatamaran Joint High Speed Vessel<br />
rüstung mit Harpoon-Flugkörpern und der<br />
Austausch des 57-mm-Geschützes gegen<br />
ein 76-mm-Geschütz planerisch vorgesehen.<br />
USS-FREEDOM verlegt voll einsatzfähig<br />
im Frühjahr 2013 für zehn Monate nach<br />
Singapur, um die Präsenz der U.S. Navy im<br />
asiatisch-pazifischen Raum zu verstärken.<br />
INDEPENDENCE-Klasse<br />
(LCS-2)<br />
Das LCS-2 mit dem Trimaran-Rumpf basiert<br />
im Design auf dem erprobten und<br />
bewährten Austal (Herderson,<br />
Australia)-Hochgeschwindigkeits-Trimaran<br />
(bis 50 kn), der<br />
in Australien u.a. im Fährbetrieb<br />
eingesetzt wird. LCS-2 zeichnet<br />
sich durch ein großes Hubschrauberlandedeck<br />
(1.030 m²)<br />
mit Hangar auf dem Achterdeck<br />
aus. Das Landedeck ist größer als<br />
die Landedecks der US-Kreuzer<br />
und Zerstörer. Das Trimaran-De-<br />
MTU-Antriebsdiesel<br />
der Baureihe 8000<br />
Typ 20V 8000 M71L<br />
sign gewährleistet eine stabile Plattform<br />
für Hubschrauberoperationen bis zu Seegang<br />
5. Je nach Mission bzw. Einsatzprofil<br />
können vom Landedeck zwei MH60R Sea<br />
Hawk-Hubschrauber oder ein CH-53-Hubschrauber<br />
und UAV (Unmanned Aerial Vehicle)<br />
vom Typ Fire Scout eingesetzt werden.<br />
Das Schiff ist ein Mehrzweck-LCS,<br />
denn es kann für unterschiedliche Einsätze<br />
(ASW, MCM oder ASuW gegen kleine<br />
schnelle Fahrzeuge) flexibel und innerhalb<br />
weniger Stunden mit entsprechenden Sensor-<br />
und Waffenmodulen<br />
(Foto: U.S. DoD) (Foto: Austal)<br />
(Foto: MTU)<br />
Technische Daten LCS-2<br />
Länge<br />
127,20 m<br />
Breite<br />
31,60 m<br />
Tiefgang 4,50 m<br />
Verdrängung 2.790 t<br />
Besatzung 40 + 35<br />
Antrieb<br />
CODAG-Antrieb<br />
Geschwindigkeit max. 50 kn<br />
Reichweite 3.500 sm/14 kn<br />
Bewaffnung 3 x Netfires NLOS-LS für SSM-FK<br />
1x Sea RAM<br />
1x 57-mm-Geschütz<br />
4 x 12,7-mm-MG<br />
2 x 30-mm-Geschütze<br />
VDS-Sonar (vorgesehen)<br />
Hubschrauber/UAV<br />
Missionsmodule<br />
(Container) zusätzlich ausgerüstet werden,<br />
die das Schiff für spezifische Einsätze befähigen.<br />
Das LCS-2 verfügt über umfangreiche Laderäume<br />
für Ausrüstung, Gerät und Waffensysteme<br />
sowie über eine Ladefläche<br />
von 1.100 m² für den schnellen Transport<br />
von Truppenkontingenten mit Ausrüstung<br />
und Fahrzeugen. Eine Seitenrampe<br />
befähigt zur Roll-on/Roll-off-Beladung<br />
von Fahrzeugen. Das Schiff ist mit zwei<br />
11-m-Rhibs für Boarding- oder Spezialkräfte<br />
ausgerüstet. Der CODAG-Antrieb<br />
(2 Gasturbinen, 2 MTU-Dieselmotoren,<br />
4 Waterjets und RENK-Getriebe) verleiht<br />
dem LCS-2 eine Marschgeschwindigkeit<br />
von 4w4 kn und eine Höchstgeschwindigkeit<br />
von bis zu 50 kn. Der hohe Automatisierungsgrad<br />
in allen Schiffsbereichen<br />
erlaubt eine Besatzungsstärke (Stammbesatzung)<br />
von nur 40 <strong>Personen</strong> sowie<br />
35 <strong>Personen</strong> Spezialkräfte. Die Trimarane<br />
sollen in San Diego an der Pazifikküste der<br />
USA stationiert werden.<br />
Beteiligung deutscher<br />
<strong>Unternehmen</strong><br />
Am LCS-Programm der U.S. Navy sind<br />
auch deutsche <strong>Unternehmen</strong> mit mod<br />
e r n e r Marinetechnologie beteiligt. Im<br />
Antriebsbereich (Combined<br />
Diesel and Gas,<br />
CODAG) rüstet die<br />
Augsburger RENK AG<br />
die LCS beider Klassen<br />
mit hochleistungsfähigen<br />
Antriebsgetrieben aus.<br />
Jedes Schiff erhält zwei<br />
Gasturbinengetriebe und<br />
zwei Dieselmotorgetriebe.<br />
Die MTU Friedrichshafen liefert<br />
für die Trimarane (LCS-2)<br />
die Antriebsdiesel der Baureihe<br />
8000 Typ 20V 8000 M71L mit einer<br />
Leistung von jeweils 9.100 kW.<br />
April 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
67
RÜSTUNG & TECHNOLOGIE<br />
(Foto: MTU)<br />
(Foto: Cassidian)<br />
Die MTU-Motoren dieses Typs werden<br />
auch als Hauptantrieb für den ersten von<br />
zehn geplanten Hochgeschwindigkeits-<br />
Katamaranen – Joint High Speed Vessel<br />
(JHSV), die gemeinsam von der U.S. Navy<br />
und der U.S. Army betrieben werden sollen,<br />
geliefert. Für die weiteren neun JHSV<br />
besteht eine Lieferoption von 36 Motoren.<br />
Das Radarsystem TRS-3D von Cassidian<br />
Der 103,00 m lange und 2.395 t verdrängende<br />
JHSV-Katamaran ist ein Multifunktionsschiff<br />
der nächsten Generation. Das<br />
Schiff ist für den schnellen Truppentrans-<br />
port mit Ausrüstung in Küstengewässern<br />
und für humanitäre Einsätze konzipiert<br />
worden. Es erreicht eine Geschwindigkeit<br />
von über 35 kn.<br />
Der CODAG-Antrieb mit Getriebesatz<br />
von RENK und Dieselmotor<br />
von MTU<br />
Cassidian hat die LCS mit Radargeräten<br />
vom Typ TRS-3D ausgerüstet. Die ersten<br />
zwei Radare sind bereits seit vier Jahren mit<br />
Erfolg an Bord der USS FREEDOM und der<br />
USS FORTH WORTH im Einsatz. Das dritte<br />
und vierte Radarsystem werden demnächst<br />
in die USS MILWAUKEE und USS DETROIT<br />
integriert. Das Radarsystem TRS-3D ist<br />
ein multifunktionales 3-D-Schiffsradar für<br />
Überwachungs- und Selbstschutzzwecke<br />
sowie zur Geschützfeuerleitung und<br />
Hubschrauberführung. Es dient der automatischen<br />
Ortung und Verfolgung von<br />
Luft- und Seezielen. Ausgerüstet mit den<br />
modernen Signalverarbeitungstechnologien<br />
eignet sich das Radarsystem insbesondere<br />
für Früherkennung von kleinen, sich<br />
schnell bewegenden Objekten in Küstengewässern.<br />
<br />
Your business is the German and<br />
international maritime market <br />
www.hansa-online.de<br />
Mai 2012<br />
149. Jahrgang<br />
ISSN 0017-7504<br />
C 3503 E · € 14,80<br />
05<br />
9 770017 750007<br />
Nr. 5<br />
International Maritime Journal<br />
SCHIFFBAU<br />
Classification Societies<br />
Simulation im Schiffbau<br />
Offshore Special: Wind & Maritim<br />
SCHIFFFAHRT LOGISTIK | HAFEN<br />
Zukunft der Emissionshäuser Intermodal-Geschäfte wachsen<br />
Bekämpfung der Piraterie Kohleterminal in Wilhelmshaven<br />
Aktuelle Rechtsthemen Offshorehäfen Ostsee<br />
<br />
<br />
-Forum<br />
Schiffsfinanzierung<br />
<br />
<br />
www.hansa-online.de<br />
Bestellen Sie Ihr kostenloses Probeheft<br />
einfach per Fax an: +49 (0) 40 70 70 80-208 oder<br />
per Email unter: hansa@hansa-online.de<br />
Your publication is<br />
HANSA International Maritime Journal!<br />
Schiffahrts-Verlag »Hansa«<br />
Ein <strong>Unternehmen</strong> der Tamm Media<br />
Georgsplatz 1 | 20099 Hamburg<br />
Tel.: +49 (0)40 70 70 80-02<br />
Fax: +49 (0)40 70 70 80-208<br />
hansa@hansa-online.de
<strong>Unternehmen</strong> & <strong>Personen</strong><br />
(Foto: ATLAS ELEKTRONIK)<br />
Neuer Geschäftsführer der ATLAS<br />
ELEKTRONIK<br />
Alexander Kocherscheidt<br />
(39) ist seit<br />
dem 1. März 2013<br />
Geschäftsführer der<br />
ATLAS ELEKTONIK<br />
GmbH. Als Chief Financial<br />
Officer (CFO)<br />
führt er den kaufmännischen<br />
Bereich sowie<br />
die Bereiche Personal,<br />
Recht und Compliance.<br />
Zuvor war der<br />
studierte Wirtschaftsjurist<br />
als CFO beim Regional Centre British<br />
Islands von ThyssenKrupp Elevator mit Sitz<br />
in London tätig. Alexander Kocherscheidt<br />
folgt Dieter Rottsieper nach, der in der Geschäftsführung<br />
der ThyssenKrupp Marine<br />
Systems GmbH (TKMS) eingetreten ist.<br />
ATLAS ELEKTRONIK ist ein weltweit führender<br />
Anbieter von Marineelektronik mit<br />
Sitz in Bremen und Tochtergesellschaften<br />
weltweit. Das <strong>Unternehmen</strong> bietet Führungssysteme<br />
und Sonare für U-Boote und<br />
Überwasserschiffe, Minenjagdsysteme<br />
und unbemannte Unterwasserfahrzeuge<br />
sowie Küstenschutzsysteme und umfassende<br />
Service-Dienstleistungen an. (ds)<br />
EADS mit starkem Geschäftsjahr<br />
2012<br />
Anhaltendes Wachstum von Umsatz und<br />
Gewinn präsentierte EADS im März in seinen<br />
Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2012.<br />
Das zivile Geschäft des Konzerns wuchs<br />
weiter, während der Umsatz im Verteidigungsgeschäft<br />
weitgehend stabil blieb. Damit<br />
ist der Anteil militärischer Produkte von<br />
23 auf 20 Prozent gesunken. Der Umsatzanstieg<br />
um 15 Prozent auf 56,5 Mrd. Euro<br />
wurde im Wesentlichen von Airbus Commercial,<br />
Eurocopter und Astrium getragen.<br />
Der Auftragsbestand nahm um fünf Prozent<br />
auf 566,5 Mrd. Euro zu. Der Gewinn<br />
vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 2,2<br />
Mrd. Euro (plus 29 Prozent). Mit einem<br />
Umsatzanteil von fast 70 Prozent dominiert<br />
Airbus die Bilanz des Konzerns. Umsatzsteigerungen<br />
um 16 Prozent wiesen alle Divisionen<br />
auf – ausgenommen Cassidian, dessen<br />
Umsatz bei 5,7 Mrd. Euro stagnierte.<br />
Zuwächse des EBIT zwischen 111 Prozent<br />
(Airbus) und 17 Prozent verzeichnen die<br />
Divisionen, lediglich Cassidian musste eine<br />
Reduzierung auf weniger als die Hälfte (142<br />
Mio. Euro, minus 57 Prozent) hinnehmen.<br />
Wie bedeutsam die eingeleiteten Konsolidierungsbemühungen<br />
sind, zeigt das<br />
negative EBIT für das vierte Quartal 2012<br />
(-14 Mio. Euro). Der Auftragsbestand des<br />
Konzerns stieg um fünf Prozent und liegt<br />
(Fotos: PSM)<br />
bei dem Zehnfachen des Jahresumsatzes.<br />
Cassidian verzeichnete Auftragseingänge<br />
in Höhe des Jahresumsatzes und hatte in<br />
diesem Bereich den größten Zuwachs aller<br />
Divisionen. Moderates Wachstum und eine<br />
weitere Verbesserung des Ergebnisses erwartet<br />
EADS für den Konzern im laufenden<br />
Geschäftsjahr.<br />
(mh)<br />
Dr. Björn Bernhard<br />
Dr. Peter Hellmeister<br />
Dr. Björn Bernhard Geschäftsführer<br />
der PSM<br />
Die Puma-Projektgesellschaft PSM GmbH,<br />
das Joint Venture von Rheinmetall und<br />
Krauss-Maffei Wegmann zur Produktion<br />
des Schützenpanzers Puma hat mit Dr.<br />
Björn Bernhard zum 1. Januar 2013 einen<br />
neuen Geschäftsführer erhalten. Dr.<br />
Bernhard war als Systemingenieur zuletzt<br />
Projektmanager für das Gesamtsystem<br />
Schützenpanzer Puma. Er folgt Dr. Peter<br />
Hellmeister nach, der nach elf Jahren an<br />
der Spitze der PSM GmbH die Leitung der<br />
Repräsentanz der Rheinmetall AG in Abu<br />
Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) übernommen<br />
hat.<br />
(gwh)<br />
ThyssenKrupp: Australian Marine<br />
Technology<br />
ThyssenKrupp stärkt seine Präsenz im<br />
Raum Asia/Pacific. Dazu hat ThyssenKrupp<br />
das australische Ingenieurbüro Australian<br />
Marine Technologies (AMT) mit Sitz in<br />
Melbourne erworben. AMT verfügt über<br />
ein umfassendes Engineering und Design<br />
Know-how im Marineschiffbau und beschäftigt<br />
aktuell 31 Ingenieure und Konstruktionszeichner.<br />
Mit diesem Schritt soll<br />
ATM mit ThyssenKrupp Marine Systems<br />
Australia – einem <strong>Unternehmen</strong> der Business<br />
Aera Industrial Solutions – zusammengeführt<br />
werden. Dr. Hans Christoph Atzpodien,<br />
Vorsitzender des Bereichsvorstands<br />
der Business Area Industrial Solutions der<br />
ThyssenKrupp AG, unterstrich: „Im Rahmen<br />
der strategischen Weiterentwicklung<br />
richtet sich ThyssenKrupp konsequent auf<br />
die Märkte der Zukunft aus. Der südostasiatische<br />
Raum inklusive Australien und<br />
Neuseeland bietet zahlreiche Wachstumsperspektiven.<br />
Mit dem Erwerb von AMT<br />
stärken wir nicht nur unsere Präsenz in<br />
Australien, wir profitieren auch von dessen<br />
regionalem Netzwerk.“<br />
(ds)<br />
LHD Group Deutschland<br />
Mit dem einheitlichen Label „LHD-Group“<br />
für die Landesniederlassungen rüstet sich<br />
die LHD-Firmengruppe für den steigenden<br />
Umfang des Leistungsangebots bei wachsender<br />
globaler Ausrichtung. Mit Tochterfirmen<br />
in Deutschland, Frankreich, Australien,<br />
Hong Kong und der Schweiz ist die LHD<br />
Systemanbieter von innovativen, ganzheitlichen<br />
Dienstleistungen im Bereich Dienst-,<br />
Berufs- und Schutzbekleidung in Europa.<br />
Zu den Kunden der <strong>Unternehmen</strong>sgruppe<br />
gehören neben der Privatwirtschaft Streitkräfte<br />
und Behörden und Organisationen<br />
mit <strong>Sicherheit</strong>saufgaben. Die LHD Deutschland<br />
ist eine 100-Prozent-Tochter der LH<br />
Bundeswehrbekleidungsgesellschaft mbH<br />
(LHBw), die die Bundeswehr seit mehr als<br />
zehn Jahren mit Bekleidung und persönlicher<br />
Ausrüstung versorgt. (gwh)<br />
Rini Goos Vize-CEO der EDA<br />
Das Steering Board<br />
der Europäischen Verteidigungsagentur<br />
(EDA) hat Rini Goos<br />
zum stellvertretenden<br />
Geschäftsführer<br />
der EDA berufen.<br />
Goos leitete im niederländischen<br />
Wirtschaftsministerium<br />
das Kommissariat für<br />
Rüstungswirtschaft,<br />
das u.a. auf die Beteiligung<br />
der niederländischen Wirtschaft<br />
bei Beschaffungen von Wehrmaterial achtet.<br />
Goos ist ein erfahrener Beamter, der in<br />
mehreren internationalen Rüstungsgremien<br />
Erfahrungen gesammelt hat. (gwh)<br />
Hensoldt-Linie bei Cassidian<br />
Optronics<br />
Die Cassidian Optronics GmbH vertreibt<br />
ihre Zielfernrohre und Zieloptiken auch<br />
nach ihrem Wechsel von Carl Zeiss zu Cassidian<br />
als Hensoldt-Linie. Auf den jüngsten<br />
Fachmessen IWA & Outdoor Classics 2013<br />
in Nürnberg und der SHOT Show in Las<br />
(Foto: EDA)<br />
April 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
93
<strong>Unternehmen</strong> & <strong>Personen</strong><br />
(Foto: RST)<br />
Vegas wurde die optische Traditionslinie<br />
unter dem Namen Hensoldt präsentiert.<br />
Die Hensoldt AG gehörte ab 1928 zu Carl<br />
Zeiss. Die zur Hensoldt-Linie gehörende<br />
Zieloptik ZO 4x30 ist ein Kernelement<br />
bei Gladius, dem erweiterten System des<br />
Infanteristen der Zukunft, das vor wenigen<br />
Tagen offiziell übergeben wurde. Die<br />
Zieloptik kann schnell und einfach Nachtsichtoptik<br />
ohne zusätzliche Justierung mit<br />
verschiedenen Nachtsichtvorsätzen kombiniert<br />
werden.<br />
(gwh)<br />
Roman Sperl Geschäftsführer<br />
Reiser Systemtechnik<br />
GmbH mit Sitz in<br />
Berg-Höhenrain hat<br />
Dr.-Ing. Roman Sperl<br />
zum weiteren Geschäftsführer<br />
neben<br />
Wolfgang Reiser berufen.<br />
Dr. Sperl ist Luftund<br />
Raumfahrt-Ingenieur<br />
und seit 2004 im<br />
<strong>Unternehmen</strong> tätig.<br />
Mit der Erweiterung<br />
der Geschäftsführung<br />
wird der fortschreitenden Expansion der<br />
Reiser Systemtechnik GmbH Rechnung<br />
getragen, welche sich mit dem Bau von<br />
Flugsimulatoren und Ausbildungsgerät<br />
beschäftigt.<br />
(gwh)<br />
Bonner Thales-Empfang<br />
Ende Februar fand im Rheinhotel Dreesen<br />
der Bonner Jahresempfang von Thales<br />
statt. Peter Obermark, CEO von Thales<br />
Deutschland, konnte dabei viele hochrangige<br />
Vertreter aus Bundeswehr und Wirt-<br />
schaft begrüßen. In einer kurzen Ansprache<br />
hob Obermark die unsichere Lage der<br />
Bundeswehr hervor, die sich auch direkt<br />
auf die wehrtechnische Industrie auswirke.<br />
Für Thales gewinne deshalb der zivile<br />
Sektor immer mehr an Bedeutung. Das<br />
zweite wichtige Standbein bilde der Export.<br />
Mit rein deutscher oder europäischer<br />
Beschaffung ließen sich mittlerweile weder<br />
die Arbeitsplätze halten noch Gelder für<br />
Forschungs- und Entwicklungsprojekte erwirtschaften.<br />
(df)<br />
Bundeswehr meets Wirtschaft<br />
Just Networking – unter diesem Motto<br />
treffen sich ehemalige Offiziere der Universitäten<br />
der Bundeswehr mit Vertretern<br />
der Wirtschaft in Hamburg in diesem<br />
Jahr am 14. und 15. Juni. Bereits seit<br />
1991 engagieren sich ehemalige Offiziere<br />
ehrenamtlich für das enge Netzwerk<br />
zwischen Wirtschaft, Politik und Bundeswehr.<br />
Als Highlight gilt der alle zwei<br />
Jahre stattfindende Kongress, der dieses<br />
Jahr vom Ersten Bürgermeister Olaf Scholz<br />
als Schirmherr begleitet wird. Hier treffen<br />
sich nicht nur die Ehemaligen zum Erfahrungsaustausch,<br />
sondern auch große und<br />
mittelständische <strong>Unternehmen</strong> nutzen die<br />
Chance, sich möglichen späteren Mitarbeitern<br />
vorzustellen. Kontaktpflege und<br />
Innovationsaustausch in einem angenehmen<br />
und professionellen Umfeld – unter<br />
diesem Motto steht die Veranstaltung. So<br />
erklärt sich auch das abwechslungsreiche<br />
und gleichzeitig hochkarätige Programm.<br />
Neben einer großen Ausstellung der Partnerunternehmen<br />
bieten Exkursionen zu<br />
interessanten <strong>Unternehmen</strong> und Best-<br />
Ground Support Container System für die Luftwaffe<br />
Für den Einsatz des Eurofighters auf Deployed Operation Bases benötigt die Luftwaffe<br />
ein Container-basiertes System (Ground Support Container System, GSCS) als verlegefähige<br />
Basis, um den erforderlichen Ground-Support für ein Einsatzgeschwader sicherzustellen.<br />
Das GSCS wird jetzt im Auftrag des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik<br />
und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) realisiert und durch ein Konsortium<br />
der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH und steep GmbH (GSS + GbR) bis Ende<br />
2013 an die Bundeswehr ausgeliefert. Das GSCS ergänzt bereits eingeführte Systeme<br />
der beiden <strong>Unternehmen</strong> um eine weitere Kompetenz für die Führungsunterstützung<br />
des Waffensystems Eurofighter. Das System besteht aus 15 individuell ausgestatteten<br />
Funktionscontainern mit HF-Abschirmung, die mittels Flurcontainern zu einem zusammenhängenden<br />
Gebäudekomplex gekoppelt werden. Einzelne Container können je<br />
nach Einsatzerfordernis disloziert aufgestellt werden. Für die autarke Stromversorgung<br />
sorgen Energiemodule, die ebenfalls die Klimatisierung der Container in allen relevanten<br />
Klimazonen sicherstellen. In dem System werden drei unterschiedlich eingestufte Netze<br />
für die Einsatzunterstützung betrieben. Zwei Netze dienen in den jeweiligen Containern<br />
für den Betrieb der im Einsatz integrierten IT-Komponenten des GSS-Deployment des<br />
jeweiligen Eurofighter Geschwaders. Das dritte Netz wird vorkonfiguriert für die Stabsarbeit<br />
in allen Containern vorgesehen. Auf der diesjährigen AFCEA-Fachausstellung am<br />
24./25. April in Bonn-Bad Godesberg können sich Interessenten an den Ständen G1 und<br />
G11 zum GSCS sachkundig machen.<br />
(wb)<br />
Practice-Vorträge ein rundes Programm,<br />
neben dem auch noch Zeit bleibt, alte<br />
Kontakte wieder aufzufrischen und neue<br />
zu knüpfen. Teilnehmen können alle ehemaligen<br />
Studierenden der Bundeswehruniversitäten<br />
und andere Interessierte. Weitere<br />
Informationen und Anmeldung unter:<br />
www.alumniunibw.de.<br />
(wb)<br />
Luft- und Raumfahrtkonferenz<br />
in Friedrichshafen<br />
Nach einer ausgebuchten Premiere des<br />
Bodensee Aerospace Meetings im letzten<br />
Jahr bei Astrium setzten die Veranstalter<br />
aus Baden-Württemberg, Österreich und<br />
der Schweiz ihre Zusammenarbeit fort. Am<br />
13. März 2013 fand das 2. Bodensee Aerospace<br />
Meeting bei der Messe Friedrichshafen<br />
und der Zeppelin Luftschifftechnik<br />
in Friedrichshafen statt. In den Mittelpunkt<br />
stellten die Veranstalter das Thema „Neue<br />
Technologien als Erfolgsfaktoren für die internationale<br />
Luft- und Raumfahrtindustrie<br />
und deren Zulieferer“.<br />
(wb)<br />
Tognum investiert in Werksausbau<br />
und F&E<br />
Tognum will bis 2014 über eine Milliarde<br />
Euro für Zukunftsinvestitionen aufwenden.<br />
Je 600 Mio. Euro sollen in Forschung<br />
& Entwicklung (F&E) fließen und in längerfristige<br />
Sachanlagen. Einen Schwerpunkt<br />
bildet der Ausbau der Friedrichshafener<br />
Werke mit neuen Fertigungshallen.<br />
In das neue Werk im polnischen Stargard<br />
werden 90 Mio. Euro investiert. Im Werk<br />
in Aiken/USA werden neue Entwicklungsprüfstände<br />
für 40 Mio. Euro gebaut.<br />
Dort montiert Tognum MTU-Motoren<br />
der Baureihen 2000 und 4000. In Singapur<br />
errichtet Tognum ein neues Logistikzentrum.<br />
Große Wachstumschancen<br />
bietet der Markt für Motoren im unteren<br />
Leistungsbereich. Mit Inkrafttreten der<br />
Emissionsgesetze entsteht zudem eine<br />
besondere Dynamik, die Tognum nutzen<br />
will, um die starke Marktposition weiter<br />
auszubauen.<br />
(ds)<br />
German Forces Mobility Center<br />
Innerhalb des militärischen Camps Marmal<br />
in Mazar-e Sharif hat die BwFuhrparkService<br />
GmbH das German Forces Mobility<br />
Center (GFMC) ISAF in Betrieb genommen.<br />
Mit der Eröffnung des GFMC ISAF stellt die<br />
Gesellschaft zusätzliche Mobilitätsdienstleistungen<br />
durch die Einrichtung und den<br />
Betrieb eines Fahrzeugpools für das deutsche<br />
Einsatzkontingent zur Verfügung. Im<br />
Hinblick auf den geplanten Truppenabzug<br />
aus Afghanistan werden Mobilitätsdienstleistungen<br />
wirtschaftlich bedarfsgerecht<br />
bereitgestellt auch bei variierenden Anfor-<br />
94 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · April 2013
(Foto: Eurocopter)<br />
derungen und einer Reduzierung der Gesamtanzahl<br />
ungeschützter Fahrzeuge. Im<br />
Rahmen freier Kapazitäten vermietet die<br />
BwFuhrparkService GmbH Fahrzeuge auf<br />
Anfrage auch an andere NATO-Streitkräfte<br />
im Camp Marmal. Das GFMC ISAF ist nach<br />
der Unterstützung der Einsätze EUFOR<br />
und KFOR bereits das dritte Einsatz-Mobilitätscenter<br />
in Betrieb. Seit Mitte 2012 betreibt<br />
die BwFuhrparkService GmbH bereits<br />
eine Reparaturleitstelle ISAF zur Sicherstellung<br />
sämtlicher Serviceleistungen an den<br />
vermieteten Fahrzeugen vor Ort. (gwh)<br />
Guillaume Faury neuer CEO<br />
von Eurocopter<br />
Das EADS Board of<br />
Directors hat dem<br />
Wunsch von Lutz<br />
Bertling, mit Wirkung<br />
zum 30. April 2013<br />
das <strong>Unternehmen</strong> zu<br />
verlassen, entsprochen.<br />
Bertling steht<br />
seit November 2006<br />
an der Spitze der<br />
Hubschrauberdivision<br />
von EADS und wird<br />
zu Bombardier wechseln.<br />
Als Nachfolger von Bertling hat das<br />
EADS Board of Directors Guillaume Faury<br />
zum ernannt. Faury, der seit 2010 als<br />
Forschungs- und Entwicklungschef und<br />
seit 2009 Mitglied des Vorstands für Peugeot<br />
S.A. tätig ist, wird am 1. Mai 2013<br />
sein neues Amt antreten. Faury ist Flugversuchsingenieur<br />
und bekleidete von 1998<br />
bis 2008 verschiedene Führungspositionen<br />
bei Eurocopter, bevor er zu Peugeot<br />
S.A. wechselte. Er war Chefingenieur des<br />
EC225/725-Programms, Leiter der Flugversuchsabteilung<br />
für schwere Hubschrauber<br />
und führte jeweils als Executive Vice President<br />
die Bereiche Kommerzielle Programme<br />
und Forschung und Entwicklung. (wb)<br />
Advanced Cyber Defense Centre<br />
Seit neuestem ist das „Advanced Cyber Defense<br />
Centre (ACDC) des eco „Verband der<br />
deutschen Internetwirtschaft e.V.“ als weiterer<br />
Akteur der IT-<strong>Sicherheit</strong> hinzugekommen<br />
Dieses mit 16,34 Mio. Euro (davon<br />
7,8 Mio. Fördergelder von der EU) Budget<br />
ausgestattete Zentrum soll vor allen Dingen<br />
den Kampf gegen Botnetze aufnehmen<br />
und will hierfür fünf Einheiten aufbauen.<br />
Einheit Eins soll die zentrale Ansprechstelle<br />
für Datenspeicherung und -analyse sein.<br />
Die zweite Gruppe unterstützt <strong>Unternehmen</strong><br />
und User beim Umgang mit Virenbefall.<br />
Einheit Drei sucht und cleaned infizierte<br />
Webseiten, während die Analyse von<br />
Netzwerken nach verdächtigen Aktivitäten<br />
durch Einheit Vier geschieht. Die von Drei<br />
und Vier gesammelten Daten gehen zur<br />
zentralen Datenstelle (= Einheit Eins), wo<br />
die weitere Untersuchung und zur Verfügungstellung<br />
der Ergebnisse stattfindet.<br />
Die fünfte Gruppe des ACDC soll wiederum<br />
Tools für die Reinigung der End-User-<br />
PC von Schadsoftware erarbeiten. Der Start<br />
des ACDC fand Mitte Februar in Frankfurt<br />
mit 28 Partnern aus 14 europäischen Ländern<br />
statt.<br />
(df)<br />
Koblenzer Tag von Thales Deutschland<br />
Nur im intensiven Dialog mit dem Kunden erfährt man mehr über dessen Bedürfnisse.<br />
Dieses Prinzip lebt Thales Deutschland mit dem Koblenzer Tag, der am 17. und 18.<br />
April 2013 in der Außenstelle der Wehrtechnischen Dienststelle 41 (ehemals WTD 51)<br />
in Koblenz stattfindet. Hier zeigt Thales sein breites ziviles und militärisches Portfolio,<br />
in Vortragsform und am funktionierenden Gerät. „Wir können alle zwei Jahre genügend<br />
Neuerungen aufbieten, um unseren Koblenzer Tag inhaltlich für unsere Kunden<br />
und Partner interessant zu gestalten“, beschreibt Hartmut Jäschke, Vice President<br />
Marketing & Sales von Thales Deutschland, die Zielsetzung der aufwändig gestalteten<br />
Veranstaltung. „Der Koblenzer Tag ist für uns vor allem gelebte Kundennähe.<br />
Mit unserer Technologieschau von Produkten, Lösungen und komplexen Systemen<br />
haben wir über die vergangenen Jahre ein Format entwickelt, mit dem wir ganz nah<br />
am Nutzer und Entscheider sind.“, betont Jäschke.<br />
Die Inhalte des Koblenzer Tages sollen dabei keine Einbahnstraße sein. Schließlich<br />
nehmen auch die Besucher viele Eindrücke und Kenntnisse von marktverfügbaren<br />
und neuen Technologien sowie das Wissen um weitere, sich in der Entwicklung<br />
befindliche Projekte mit nach Hause. Der Austausch mit den Thales-Experten hilft<br />
zudem, bei Entwicklungen die Kundensicht besser zu verstehen. Nebenbei geht es<br />
um den Blick über den Tellerrand: Denn sowohl Soldaten als auch Polizisten kennen<br />
zwar häufig die Technologien im eigenen Bereich, wissen dafür aber kaum, was im<br />
jeweils anderen Sektor relevant ist und wo gegebenenfalls Synergien zu finden sind.<br />
„Bislang machten die Besucher von zivilen Institutionen – wie beispielsweise Polizei,<br />
Feuerwehr oder anderer <strong>Sicherheit</strong>sbehörden – ein knappes Viertel aller Gäste aus“,<br />
so Jäschke. „Gerade auf dem Gebiet der Vernetzten <strong>Sicherheit</strong> sind militärische und zivile<br />
Technologielösungen aber immer weniger voneinander zu trennen. Deshalb wird<br />
es auch in Koblenz spannend sein zu sehen, was sich aus den intensiven Gesprächen<br />
und Vorführungen entwickeln lässt.“ Weitere Informationen und Anmeldung unter:<br />
www.koblenzer-tag.de<br />
(df)<br />
Einzelausgabe: 6,99 Euro<br />
Abonnement (12 Ausgaben) 64,99 Euro<br />
Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
jetzt auch als E-Paper!<br />
Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> ist für Ihren Tablet-PC jetzt<br />
auch als E-paper im ikiosk der Axel Springer AG erhältlich!<br />
1. ikiosk App auf dem 2. Europäische<br />
Tablet-PC installieren <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
(kostenlos im App Store im ikiosk auswählen<br />
von Apple bzw.<br />
und erwerben! en!<br />
im Google Play Store)<br />
MITTLER REPORT VERLAG GMBH Hochkreuzallee 1 · 53175 Bonn<br />
Fax: 0228 / 3 68 04 02 · info@mittler-report.de · www.mittler-report.de<br />
ES&T<br />
Europäische<br />
<strong>Sicherheit</strong><br />
T<br />
& Sicherhe<br />
<strong>Technik</strong><br />
BESTELLEN
Raketenabwehr im Pazifik<br />
Instrument zur Einhegung oder Einbindung Chinas<br />
Michael Paul<br />
ÄUSSERE & ZIVILE SICHERHEIT <br />
(Foto: China Daily)<br />
China baut seine nuklearen Streitkräfte qualitativ und quantitativ<br />
aus – so sollen in wenigen Jahren ballistische Raketen auf Unterseebooten<br />
stationiert und mobile Interkontinentalraketen mit<br />
Mehrfachgefechtsköpfen bestückt werden.<br />
Diese Entwicklung gilt auch als Reaktion<br />
auf amerikanische Fähigkeiten<br />
zur Raketenabwehr, die primär gegen<br />
Nordkorea gerichtet sind, aber Chinas<br />
Raketenpotenzial beeinträchtigen könnten.<br />
Bereits bestehenden Spannungen im asiatisch-pazifischen<br />
Raum durch die umfangreiche<br />
konventionelle Modernisierung und<br />
Aufrüstung chinesischer Streitkräfte wird<br />
so eine weitere – nukleare – Dimension<br />
hinzugefügt. Es wird Zeit für eine Einbindung<br />
Chinas in die strategische Rüstungskontrolle.<br />
Der russische Präsident Boris Jelzin schockierte<br />
NATO-Generalsekretär Manfred<br />
Autor<br />
Dr. Michael Paul ist Senior Fellow in<br />
der Forschungsgruppe <strong>Sicherheit</strong>spolitik<br />
der Stiftung Wissenschaft und<br />
Politik (SWP) in Berlin.<br />
Wörner im Dezember 1993 mit der Aussage,<br />
dass er die Aussichten für einen NATO-<br />
Beitritt Russlands als „realistisch“ erachte.<br />
Seine einzige Sorge, fügte er hinzu, sei<br />
China. Zwanzig Jahre später könnte eine<br />
ähnliche Besorgnis im Zusammenhang mit<br />
einer Kooperation von NATO und Russland<br />
Der chinesische Zerstörer QINGDAO (DDG 113) verlässt am 10. September<br />
2012 den Hafen von Pearl Harbor<br />
in der Raketenabwehr aufkommen. Die<br />
russischen Vorbehalte gegen eine unter<br />
amerikanischer Führung etablierte Raketenabwehr<br />
sind nach wie vor groß. Aber<br />
angenommen, es komme zu einer substantiellen<br />
Kooperation zwischen NATO<br />
und Russland, die über ein bloßes Transparenzregime<br />
hinausgehen würde: Wie<br />
würde China darauf reagieren Denn die<br />
amerikanischen Fähigkeiten zur Raketenabwehr<br />
setzen in ihrem auf den asiatischpazifischen<br />
Raum ausgerichteten Potenzial<br />
schon heute die chinesische nukleare Abschreckungsfähigkeit<br />
unter Druck.<br />
Die aktuellen amerikanischen Planungen<br />
für ein Raketenabwehrsystem sind eine<br />
Antwort auf die sich abzeichnenden Risiken<br />
der Weiterverbreitung von ballistischen Raketen<br />
und Massenvernichtungswaffen und<br />
richten sich speziell gegen entsprechende<br />
Fähigkeiten seitens Iran und Nordkorea. Im<br />
Rahmen des Raketenabwehrsystems in Europa<br />
soll bis 2015 eine weiterentwickelte<br />
Version der SM-3-Abfangrakete (Block IB)<br />
stationiert und eine Bodenstation in Rumänien<br />
errichtet werden. Diese Anfangsbefähigung<br />
soll in den Folgejahren zur vollen<br />
Einsatzbereitschaft ausgebaut werden: Bis<br />
zum Jahr 2018 soll in amerikanisch-japanischer<br />
Kooperation eine abermals weiterentwickelte<br />
Version der SM-3 (IIA) disloziert<br />
werden, um Mittelstreckenraketen<br />
größerer Reichweite erfassen zu können.<br />
In der letzten Phase 4 soll bis 2020 eine<br />
komplett neue Abfangrakete (IIB) entwickelt,<br />
getestet und stationiert werden, die<br />
gegen ballistische Raketen interkontinentaler<br />
Reichweite (Intercontinental Ballistic<br />
Missile, ICBM) einsetzbar ist. Ob die Pläne<br />
für diese Phase realisiert werden, ist allerdings<br />
mittlerweile umstritten, und unter<br />
Umständen könnte der Verzicht darauf<br />
neue Abrüstungsverhandlungen mit Moskau<br />
ermöglichen.<br />
Das Rückgrat einer kontinuierlichen Fähigkeit<br />
zum Schutz der USA gegen strategische<br />
Raketen bilden 30 Abwehrraketen in<br />
Alaska (26) und Kalifornien (4). Darüber hinaus<br />
sind fünf Lenkwaffenkreuzer und 21<br />
Lenkwaffenzerstörer mit dem Aegis-Waffensystem<br />
ausgerüstet; 16 dieser Schiffe<br />
mit SM-Raketen sind der US-Pazifikflotte<br />
zugeordnet. Ihre Zahl soll bis 2018 auf insgesamt<br />
36 Schiffe erhöht werden. Davon<br />
soll über die Hälfte im Pazifik stationiert<br />
werden.<br />
Die chinesische nukleare Abschreckung<br />
wird beeinträchtigt, indem zunehmend eine<br />
Abwehrfähigkeit gegen Mittelstreckenraketen<br />
und Interkontinentalraketen im<br />
asiatisch-pazifischen Raum entsteht. Denn<br />
auch in Zukunft werden landgestützte,<br />
mobile ICBMs den Schwerpunkt der strategischen<br />
Nuklearwaffensysteme Chinas<br />
und damit der Abschreckungsfähigkeit<br />
gegenüber den USA bilden. In Ostasien<br />
spielen zudem die chinesischen Mittelstreckenraketen<br />
eine wichtige Rolle; etwa im<br />
Kontext einer möglichen Taiwan-Krise, die<br />
zwangsläufig die USA involvieren würde.<br />
In Peking wird bereits heftig kritisiert, asiatische<br />
Nachbarstaaten nähmen im Vertrau-<br />
April 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
111
ÄUSSERE & ZIVILE SICHERHEIT<br />
(Foto: U.S. Navy)<br />
Eine SM-3-Rakete wird vom US-Zerstörer LAKE ERIE aus abgefeuert<br />
en auf die amerikanische Raketenabwehr<br />
eine „aggressivere Haltung“ gegenüber<br />
China ein – so Japan im Streit um die<br />
Senkaku-Inseln (chinesisch: Diaoyu). Falls<br />
Japan, Australien und Südkorea in das Raketenabwehrsystem<br />
eingebunden werden<br />
würden, drohe ein Wettrüsten in Asien.<br />
Ähnlich wie Russland, das die Raketenbedrohung<br />
durch Iran als fragwürdige<br />
Begründung für das Abwehrsystem in<br />
Europa betrachtet, bezweifelt China, dass<br />
die amerikanischen Abwehrfähigkeiten im<br />
asiatisch-pazifischen Raum allein aus der<br />
Raketenbedrohung durch Nordkorea resultieren.<br />
Auch der erfolgreiche Start einer<br />
nordkoreanischen Langstreckenrakete am<br />
12. Dezember 2012 und der Atomwaffentest<br />
am 12. Februar 2013 ändern wenig an<br />
dieser Einschätzung, denn aus chinesischer<br />
Sicht ist die Aufwuchsfähigkeit des amerikanischen<br />
Abwehrsystems wichtiger für<br />
die eigene Bedrohungsanalyse. China und<br />
Russland sehen ihre außen- und sicherheitspolitischen<br />
Interessen bedroht und<br />
speziell ihr eigenes Raketenpotenzial durch<br />
amerikanische Fähigkeiten beeinträchtigt<br />
– wenn nicht heute, so möglicherweise in<br />
naher Zukunft.<br />
In den Planungen der USA stehen allerdings<br />
weniger Chinas strategische Nuklearwaffen<br />
im Vordergrund, sondern die<br />
chinesische Fähigkeit, mit ballistischen Raketen<br />
gegen Seeziele wie amerikanische<br />
Flugzeugträger vorzugehen. Dies ist insofern<br />
plausibel, als beide Seiten in einem<br />
potentiellen Konflikt bemüht sein würden,<br />
eine nukleare Eskalation zu verhindern. Dazu<br />
bedarf es überzeugender, strategischer<br />
konventioneller Fähigkeiten. Dennoch betreffen<br />
Abwehrfähigkeiten der USA mittel-<br />
Die schwerwiegendste Bedrohung chinesischer<br />
<strong>Sicherheit</strong> wäre eine Unabhängigkeitserklärung<br />
Taiwans, die Souveränität,<br />
territoriale Integrität und nationale Einheit<br />
der Volksrepublik China gefährden würde.<br />
Die USA haben sich 1979 im Taiwan Relations<br />
Act zum Schutz Taiwans verpflichtet.<br />
Daher kann ein militärischer Konflikt in der<br />
Taiwan-Straße in eine direkte chinesischamerikanische<br />
Konfrontation münden.<br />
In der Vergangenheit wurde häufig argumentiert,<br />
die USA würden Taiwan im Krisenfall<br />
nicht unterstützen, weil man nicht<br />
Los Angeles für Taipeh riskieren werde. Die<br />
wachsenden amerikanischen Fähigkeiten<br />
zur Raketenabwehr lassen diese Annahme<br />
aber fragwürdig erscheinen. Denn selbst<br />
eine begrenzte Abwehrfähigkeit lässt sich<br />
nur schwer überwinden, wenn nicht hohe<br />
Investitionen in strategischen Offensivwafbar<br />
das chinesische Nuklearwaffenarsenal,<br />
und es gibt prominente Befürworter in den<br />
USA, die diese Fähigkeit in langfristiger Perspektive<br />
unterstützen.<br />
Chinesische Nuklearwaffen<br />
Nuklearwaffen haben eine wichtige, aber<br />
begrenzte Bedeutung für die chinesische<br />
Außen- und <strong>Sicherheit</strong>spolitik. Sie symbolisieren<br />
Chinas internationalen Status als<br />
Großmacht und dienen vorwiegend der<br />
Abschreckung anderer Nuklearwaffenmächte,<br />
allen voran USA und Russland.<br />
Frühere Grenzstreitigkeiten mit Russland<br />
gehören der Vergangenheit an. Ein möglicher<br />
Taiwan-Konflikt dagegen könnte zu<br />
einer direkten, sino-amerikanischen Auseinandersetzung<br />
eskalieren. In erster Linie<br />
sollen chinesische Nuklearwaffen daher die<br />
USA von einer militärischen Intervention<br />
zur Verteidigung Taiwans und einer direkten<br />
Bedrohung des chinesischen Festlandes<br />
abschrecken.<br />
Das chinesische Waffenarsenal wird auf<br />
über 175 aktive Gefechtsköpfe geschätzt.<br />
Hinzu kommen etwa 65 Sprengköpfe, die<br />
als Reserve dienen, also insgesamt 240<br />
Nuklearwaffen. Als Trägersysteme verfügt<br />
China über 140 ballistische Raketen, die<br />
jeweils einen nuklearen Gefechtskopf befördern<br />
können. Als einziger der nach der<br />
Definition des Nichtverbreitungsvertrages<br />
fünf Atomwaffenstaaten verbessert China<br />
seine nuklearen Streitkräfte nicht nur, sondern<br />
baut sie auch aus. Dabei wird keine<br />
Gleichrangigkeit mit der überlegenen Nuklearwaffenkapazität<br />
der USA angestrebt.<br />
Eine wachsende Zahl von Gefechtsköpfen<br />
ist aber für Raketen großer Reichweite<br />
bestimmt. Amerikanische Geheimdienste<br />
schätzen, dass bis in die 2020er Jahre die<br />
Zahl der Gefechtsköpfe auf Raketen, die fähig<br />
zur Bedrohung der USA sind, auf „weit<br />
über 100“ steigen könne. Derzeit verfügt<br />
Peking über 40 Raketen des Typs DF-5A<br />
und DF-31A interkontinentaler Reichweite.<br />
Im Juli 2012 wurde erstmals eine ICBM mit<br />
Mehrfachgefechtsköpfen (DF-41) getestet,<br />
die mobil stationiert werden soll. Ihre Bestückung<br />
mit sechs bis zehn Gefechtsköpfen<br />
gilt als Reaktion auf die amerikanische<br />
Raketenabwehr.<br />
Neben mobilen ICBMs soll der Aufbau eines<br />
Nuklearwaffenpotentials auf See die<br />
Abschreckungsfähigkeit sicherstellen. Innerhalb<br />
der nächsten zwei Jahre werden<br />
nach Einschätzung amerikanischer Experten<br />
ballistische Raketen auf Unterseebooten<br />
stationiert werden. Dabei handelt es<br />
sich um Boote der Jin-Klasse, die zwölf<br />
Raketen des Typs JL-2 mit einer Reichweite<br />
bis 7.400 Kilometer mit sich führen können.<br />
Zwei Boote sollen bereits im Einsatz,<br />
insgesamt fünf Boote geplant sein. Damit<br />
würde China wie die USA über eine Triade<br />
land-, luft- und seegestützter Waffensysteme<br />
und so über eine ähnliche Zweitschlagsfähigkeit<br />
verfügen. Ein Jin-Unterseeboot<br />
könnte dann aus einer Entfernung von<br />
1.500 Meilen vor der US-Westküste seine<br />
Raketen gegen Washington starten (falls es<br />
die amerikanische U-Boot-Abwehr überwindet).<br />
Diese neue Qualität erhöht in Zukunft<br />
die chinesische Abschreckung. Selbst<br />
im Falle eines entwaffnenden Erstschlags<br />
gegen Raketenstellungen zu Lande sowie<br />
Flughäfen – zu dem theoretisch Russland<br />
und die USA imstande wären – würde China<br />
dann noch die Fähigkeit zu einer nuklearen<br />
Reaktion besitzen.<br />
Konfliktszenario Taiwan<br />
112 Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong> · April 2013
ÄUSSERE & ZIVILE SICHERHEIT <br />
(Foto: China Daily)<br />
fen getätigt werden (durch beispielsweise<br />
Täuschkörper, Mehrfachgefechtsköpfe<br />
oder Manövrierbarkeit der Wiedereintrittskörper).<br />
Die daraus entstehenden<br />
finanziellen und technischen Kosten wiederum<br />
behindern den Ausbau konventioneller<br />
Fähigkeiten. In dieser Logik nutzt<br />
es wenig, dass Peking über die Fähigkeit<br />
verfügt, Los Angeles zu bedrohen, solange<br />
es keinen Anlass dazu gibt, denn die chinesische<br />
Armee ist (noch) zu schwach, um<br />
wirkungsvoll gegen Taipeh vorzugehen.<br />
Wenn amerikanische Raketenabwehrkreuzer<br />
imstande sind, Schäden wirksam<br />
zu begrenzen, die chinesische Raketen<br />
anrichten können, wäre die amerikanische<br />
Abschreckungs- und damit Handlungsfähigkeit<br />
selbst im Rahmen eines für China<br />
erfolgversprechenden Taiwan-Szenarios<br />
gegeben – ein Grund, warum China schon<br />
in der Vergangenheit amerikanische Pläne<br />
für eine Raketenabwehr so vehement kritisiert<br />
hat. Solange China den USA nicht die<br />
Seeherrschaft streitig machen kann, bildet<br />
die seegestützte Raketenabwehr aufgrund<br />
ihrer hohen Mobilität eine wichtige ergänzende<br />
Fähigkeit sowohl im asiatisch-pazifischen<br />
Raum als auch im Kontext der nationalen<br />
US-Raketenabwehr. Die amerikanische<br />
Raketenabwehr konterkariert so die<br />
chinesische Strategie einer Abhaltung oder<br />
Verzögerung amerikanischen Eingreifens.<br />
Einbindung Chinas<br />
China ist bemüht, nukleare Trägersysteme<br />
und Gefechtsköpfe so weiterzuentwickeln,<br />
dass im Kriegsfall auch eine Raketenabwehr<br />
überwunden werden könnte. Dabei<br />
ist eine quantitative Aufrüstung nicht<br />
auszuschließen. Kann Rüstungskontrolle<br />
einen möglichen Rüstungswettlauf verhindern<br />
Zu Beginn der Bemühungen um ei-<br />
Chinesische Intercontinentalrakete DF-5A<br />
US-Präsident Barack Obama bei seiner „State of the Union“-Rede<br />
am 12. Februar 2013<br />
ne Begrenzung nuklearer Offensivwaffen<br />
im Rahmen des SALT-I-Vertrags von 1972<br />
wurden mit dem ABM-Vertrag die amerikanischen<br />
und sowjetischen Defensivpotenziale<br />
beschränkt. Um die weitere Abrüstung<br />
offensiver Nuklearwaffen voranzutreiben,<br />
wird bisweilen eine Neuauflage<br />
des ABM-Vertrages gefordert. Heute fehlt<br />
jedoch der strategische Kontext, der ein<br />
solches Vorgehen rechtfertigen würde. Die<br />
USA und Russland entwickeln Abwehrsysteme<br />
nicht mehr zu dem Zweck, sich voreinander<br />
zu schützen, sondern um Optionen<br />
für die Minimierung der Schäden zu gewinnen,<br />
die sich aus der Weiterverbreitung<br />
von ballistischen Raketen und Kernwaffen<br />
ergeben könnten. Andererseits spricht für<br />
eine neue vertragliche Regelung der Zahl<br />
und Art von Defensivwaffen, dass sinkende<br />
Obergrenzen bei Offensivwaffen kaum<br />
mit unbeschränkten Abwehrsystemen<br />
vereinbar sind. Unabhängig davon, ob ein<br />
strategischer Konflikt aufkommen könnte,<br />
würde im amerikanisch-russischen Verhältnis<br />
auf Dauer das Problem entstehen,<br />
dass eine Seite theoretisch in der Lage wäre,<br />
einen nuklearen Ersteinsatz zu riskieren,<br />
weil die Raketenabwehr es ermöglicht,<br />
die von den verbleibenden gegnerischen<br />
Offensivpotenzialen drohenden Schäden<br />
zu begrenzen. Kriseninstabilität wäre die<br />
Folge. Ähnliche Argumentationsmuster<br />
ergeben sich im sino-amerikanischen Verhältnis.<br />
Darüber hinaus demonstrierte China<br />
2007 die Fähigkeit zum Abschuss von<br />
Satelliten und hat diese mittlerweile zur<br />
Ausgangsbasis für eine eigene Abwehrfähigkeit<br />
weiterentwickelt. Offensichtlich<br />
will Peking keinen Rüstungswettlauf mit<br />
Washington wie ihn die Sowjetunion mit<br />
verheerender Wirkung praktizierte, sondern<br />
asymmetrische Fähigkeiten demonstrieren<br />
und etablieren.<br />
Präsident Barack Obama hat in seiner „State<br />
of the Union“-Rede am 12. Februar 2013<br />
angekündigt, Russland für eine weitere Reduzierung<br />
der Nuklearwaffenarsenale gewinnen<br />
zu wollen und so den mit „New<br />
START“ begonnenen Abrüstungsprozesses<br />
fortzusetzen. Nun wird eine Reduzierung<br />
des Arsenals um ein Drittel auf 1.000 Nuklearwaffen<br />
diskutiert. Derart tiefe Einschnitte<br />
machen eine Einbindung Chinas<br />
notwendig. Als erster Schritt wäre größere<br />
Transparenz auf chinesischer Seite hilfreich.<br />
Ob Peking darüber hinaus zu einer Begrenzung<br />
(freeze) seines Nuklearwaffenpotenzials<br />
bereit wäre, hängt wie im Falle Moskaus<br />
von der amerikanischen Bereitschaft<br />
ab, die Raketenabwehr zu begrenzen.<br />
Ohne Einbeziehung Chinas dürfte das Rüstungskontrollregime<br />
dauerhaft Schaden<br />
erleiden und die Weiterverbreitung von<br />
Raketen und Massenvernichtungswaffen<br />
voranschreiten.<br />
<br />
(Foto: White House)<br />
April 2013 · Europäische <strong>Sicherheit</strong> & <strong>Technik</strong><br />
113