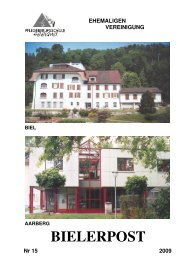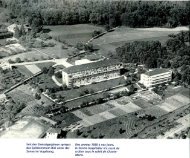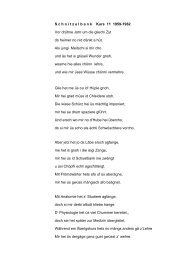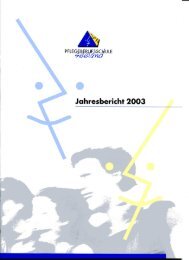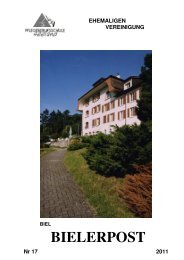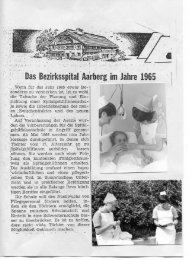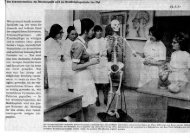Nr. 18 / 2012 - Ehemaligen-Vereinigung Pflegeberufsschule Seeland
Nr. 18 / 2012 - Ehemaligen-Vereinigung Pflegeberufsschule Seeland
Nr. 18 / 2012 - Ehemaligen-Vereinigung Pflegeberufsschule Seeland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
EHEMALIGEN<br />
VEREINIGUNG<br />
BIEL<br />
BIELERPOST<br />
<strong>Nr</strong> <strong>18</strong> <strong>2012</strong>
<strong>Ehemaligen</strong> <strong>Vereinigung</strong><br />
<strong>Pflegeberufsschule</strong> <strong>Seeland</strong><br />
evpbs@gmx.ch<br />
www.ehemalige-pbsseeland.ch<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Bielerpost <strong>Nr</strong>. <strong>18</strong> / <strong>2012</strong><br />
VORWORT DER PRÄSIDENTIN 2<br />
JAHRESBERICHT 2010 / 2011 DER PRÄSIDENTIN 3<br />
19. MITGLIEDERVERSAMMLUNG VOM 4. NOVEMBER 2011 6<br />
ZUSAMMENFASSUNG DES TAGUNGSTHEMAS 8<br />
STIMMUNGSBILD ZUM 4. NOVEMBER 2011 17<br />
FRÜHLINGSAUSFLUG RHEINSALINEN IN PRATTELN 19<br />
TREFFEN MIT DEN KURS-KONTAKTPERSONEN GÄRTNEREI LEONOTIS 21<br />
AKTUELLES AUS DER SCHULE 23<br />
NACHRUF MINNA SPRING 24<br />
NEUES AUS DEM SZB 25<br />
„SCHWELGEN IN ERINNERUNGEN“ / ANLASS 9. MAI <strong>2012</strong> 32<br />
SPENDEN VERDANKEN 35<br />
ERKLÄRUNG ZUM MITGLIEDERBEITRAG 35<br />
INTERVIEW MIT ERNA UND IRENE FIECHTER AUS DEM KURS 1 36<br />
DIE AUSBILDUNG ZUR „PFLEGEFACHFRAU“ IM BEZIRKSSPITAL BIEL VOR<br />
DER SCHULGRÜNDUNG 1947 42<br />
KLASSE-EGGE 48<br />
ADRESSVERZEICHNIS VORSTAND EVPBS 49<br />
Verantwortliche der Redaktion: Priska Lörtscher – Egli, Sonnhalde 6, 3250 Lyss<br />
Druck: Hausdruckerei Spitalzentrum Biel AG
Vorwort der Präsidentin<br />
Liebe Leserinnen<br />
Liebe Leser<br />
Ein Blick aus dem Fenster zeigt, der Herbst macht dem Winter langsam<br />
Platz und bald geht ein weiteres Jahr zu Ende.<br />
Hinter uns liegt eine bewegte Zeit. Seit dem Herbst 2010, befassen wir<br />
uns intensiv mit dem Buchprojekt der Pflegeberufschule. Aus den vielen<br />
wertvollen Dokumenten und Fotos der 64-jährigen Schulgeschichte soll<br />
etwas Bleibendes entstehen. Das Sortieren und ordnen der gesammelten<br />
Unterlagen in der Reihenfolge der geschriebenen Geschichte, war<br />
kein leichtes Unterfangen. Es folgten unzählige Verhandlungen und Gespräche<br />
mit dem Grafiker. Im September konnten wir dem Vorstand den<br />
ersten Buchentwurf vorstellen. Weitere Überarbeitungen mussten gemacht<br />
werden. – Heute, stehen wir kurz vor dem Ziel und wenn alles<br />
nach Plan läuft, wird das Buch bis ende Jahr vollendet sein. Dank dem<br />
motivierten Projektteam, welches immer an das Machbare glaubte, konnte<br />
dieses Erinnerungswerk realisiert werden. Eine immense Arbeit mit<br />
einem grossen Zeitaufwand, steckt dahinter.<br />
Entscheidend war auch die Geldbeschaffung. Die Finanzierung, die innerhalb<br />
der nötigen Frist sichergestellt werden konnte, verdanken wir<br />
unseren grosszügigen Hauptsponsoren, dem Spital Aarberg, dem Spitalzentrum<br />
Biel, der Stiftung Pflegebildung <strong>Seeland</strong>, den Mitgliedern der<br />
<strong>Vereinigung</strong> und allen übrigen Spenderinnen und Spendern. An dieser<br />
Stelle Danke ich Allen, die die Entstehung dieses Buches finanziell, materiell<br />
und ideell unterstützt haben.<br />
Auf Hochtouren laufen gegenwärtig die Vorbereitungen für den Anlass,<br />
9. Mai <strong>2012</strong>, im Weissen Kreuz in Lyss. Der Vorstand gestaltet ein<br />
Rahmenprogramm mit vielen Überraschungen. Dazu nur so viel: Ehemalige<br />
der PBS werden den Anlass musikalisch bereichern. Frau Barthelmy-<br />
Kaufmann Kurs A10, Schweizerin des Jahres 2010, wird auftreten.<br />
Und ein weiterer Höhepunkt ist die Buchvernissage. – Ein Programm<br />
für Jung und Alt. Nutzen Sie die Gelegenheit und nehmen Sie<br />
sich die Zeit, an diesem Tag mit vielen <strong>Ehemaligen</strong> in Erinnerungen zu<br />
schwelgen!<br />
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue mich auf zahlreiche persönliche<br />
Kontakte in Lyss.<br />
Margrit Lüthi- Zürcher, Präsidentin<br />
2
Jahresbericht 2010 / 2011 der Präsidentin<br />
«Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein Fortschritt. Zusammenarbeit<br />
ist der Erfolg.» (Henry Ford)<br />
Das vergangene Vereinsjahr von aktivem Zusammenarbeiten und vielen<br />
interessanten Gesprächen liegt hinter uns. Mit viel Elan und Herzblut hat<br />
der Vorstand mit der Unterstützung vieler Mitglieder, die aufwändigen<br />
Vorbereitungsarbeiten für den Anlass 9. Mai <strong>2012</strong> und dem Buchprojekt<br />
in Angriff genommen.<br />
Die Vereinstätigkeit im Rückblick<br />
Mitgliederversammlung und Herbsttagung vom 5. November 2010<br />
Die <strong>18</strong>. Vereinsversammlung mit einer durchschnittlichen Beteiligung der<br />
Mitglieder verlief gut.<br />
Neuwahlen sind die Folgen von Rücktritten im Vorstand. Mit Marianne<br />
Knöpfli und Rosmarie Stettler wurden zwei langjährige und verdienstvolle<br />
Vorstandsfrauen aus dem Vorstand verabschiedet. Für die Aufbau- und<br />
Weiterentwicklungs- Arbeiten, die sie zugunsten der <strong>Vereinigung</strong> geleistet<br />
haben, gebührt ihnen an dieser Stelle unser herzlicher Dank. Mit Waltraud<br />
Salzmann konnten wir eine sehr qualifizierte und engagierte Sekretärin<br />
gewinnen.<br />
«Ethikrichtlinien in der Pflege Umsetzen» war das Tagungsthema. Vom<br />
Referentinnen-Team Frau Barth und Frau Hengartner hörten wir, was<br />
Ethik leisten kann und wie Ethikkompetenz der Fachpersonen in Spitälern<br />
und Heimen konkret umgesetzt wird. Dazu die Zusammenfassung in<br />
der letzen Bielerpost.<br />
Vorstand<br />
Der Vorstand blickt auf ein Jahr intensiver Tätigkeit und konstruktiver<br />
Zusammenarbeit zurück. Eine Arbeitsgruppe von <strong>Ehemaligen</strong> investierte<br />
viel Zeit und Ausdauer, um die Adressen aller Kurse zu aktualisieren.<br />
Heute sind rund 1000 Adressen bereitgestellt für die Einladungen zum<br />
Anlass.<br />
Unser Buchprojekt besteht aus drei Teilen. Als erster Teil die geschriebene<br />
Geschichte der Schule. Diese wurde uns von der Schulleitung zur<br />
Verfügung gestellt. Der zweite Teil besteht aus Dokumenten und Fotos<br />
aus dem Nachlass der Pflegeberufschule und aus dem Besitz von <strong>Ehemaligen</strong>.<br />
Die Klassenfotos aus allen Kursen ist im Teil drei zusammengefasst.<br />
Unser Buch ist am Entstehen und auf dem guten Weg in die<br />
Schlussrunde zum Ziel. Die Finanzierung konnte innerhalb der gesetz-<br />
3
ten Frist sicher gestellt werden, dank den grosszügigen Spenden und<br />
nicht zuletzt dank unseren treuen Vereinsmitgliedern.<br />
Das Buch wird an unserem Anlass «Schwelgen in Erinnerungen», am 9.<br />
Mai <strong>2012</strong> veröffentlicht unter dem Titel:<br />
«Geschichte der Pflegeausbildungen im <strong>Seeland</strong>»<br />
1947 - 2011<br />
Alle zwei Jahre organisiert der Vorstand ein Treffen mit den Kurskontakt-Personen<br />
(KK-P). Diesmal mit einer Besichtigung der etwas anderen<br />
Gärtnerei Leonotis in Grossaffoltern. Nach einem überraschungsreichen<br />
Rundgang durch die Kräuterpergola und die Gewächshäuser, luden wir<br />
die 40 KK-Ps zum Zvieri in blumiger Umgebung ein. Eine gute Gelegenheit<br />
sie über unsere bevorstehenden Tätigkeiten zu informieren, d.h. Anlass<br />
und Buch. Mit dem Aufruf, dass sie uns unterstützen und mithelfen<br />
die genannten, aktuellen und wichtigen Mitteilungen an ihre Kurse weiterzuleiten.<br />
Wir wünschen uns, am 9. Mai <strong>2012</strong> mit möglichst vielen<br />
<strong>Ehemaligen</strong> in Erinnerungen schwelgen zu können. Mehr dazu im Bericht<br />
von Waltraud Salzmann und Peter Schranz auf Seite 21. Mit Fotos<br />
auf: www.ehemalige-pbsseeland.ch<br />
Zum letzten Mal vor der Schulschliessung konnte ich den Studierenden<br />
der DII Abschlussklasse in Biel (A+C <strong>18</strong>) unsere <strong>Vereinigung</strong> vorstellen.<br />
Anfang November werden sie diplomiert. Somit werden sie auch in die<br />
Rubrik der <strong>Ehemaligen</strong> eingehen. Als Jahresmitglieder sind sie alle aufgenommen<br />
worden und können damit an den Vereinsaktivitäten teilnehmen.<br />
Unser Ziel muss es sein, die jungen Pflegefachfrauen und Männer<br />
für die <strong>Vereinigung</strong> zu begeistern und für eine Mitgliedschaft zu motivieren.<br />
Seit Dezember 2010 sind die Aufgaben im Vorstand neu verteilt:<br />
Präsidentin: Margrit Lüthi Zürcher Kurs 11<br />
Vizepräsident: Werner Egloff Kurs 28<br />
Sekretariat: Waltraud Salzmann Kurs 42<br />
Protokollführung: Gina Gähwiler-Feletti Kurs 16<br />
Kassier: Peter Schranz Kurs 26<br />
Redaktion Bielerpost<br />
Website<br />
Buchprojekt : Priska Lörtscher- Egli Kurs 33<br />
Frühlingsausflug<br />
Herbsttagung: Vreni Meier-Gugger Kurs 16<br />
4
Mitglieder<br />
Der Mitgliederbestand liegt per 31. August 2011 leicht unter dem Vorjahreswert<br />
von 286 Mitgliedern. Es treten pro Jahr mehr Mitglieder aus als<br />
hinzu gewonnen werden können. Der Grund für die Austritte liegt hauptsächlich<br />
in der Altersstruktur unserer Mitglieder. - Mitglieder zu halten<br />
und zu gewinnen wird auch im nächsten Jahr ein Thema sein. Das heisst<br />
die Rekrutierung von jungen Mitgliedern ist für die <strong>Vereinigung</strong> «lebenswichtig».<br />
Wichtig ist uns, den bestehenden Mitgliedern eine gute Betreuung zukommen<br />
zu lassen. Dazu ist unsere Website immer auf dem neusten<br />
Stand von Informationen und gewährleistet auch gute Erreichbarkeit des<br />
Vorstandes.<br />
Bielerpost<br />
Mit den folgenden Worten von Minna Spring wurde im Juni 1959, die erste<br />
Bielerpost an alle Schwestern der Pflegerinnenschule des Bezirkspitals<br />
verschickt. Ich zitiere: «Noch besitzt unsere Bielerpost kein bestimmtes<br />
Gewändchen, aber was nicht ist kann werden! Inzwischen behilft<br />
man sich eben mit Übergangslösungen».<br />
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Äussere wie das Innere<br />
unseres Kommunikationsmittels gewandelt, verbessert und verjüngt. Mit<br />
stolz dürfen wir unsere Bielerpost 2011 präsentieren, welche hilft die fast<br />
300 Mitglieder zu verbinden wo auch immer das Mitglied zu Hause ist.<br />
Die Berichte, Mitteilungen und Hinweise zeigen unseren Lesern, was in<br />
unserem Verein abläuft. Dem Redaktionsteam, mit der engagierten Leiterin<br />
Priska Lörtscher herzlichen Dank.<br />
Besichtigung der Rheinsalinen in Prattelen<br />
Zum Frühlingsausflug an einem schönen, warmen Maientag trafen sich<br />
die <strong>Ehemaligen</strong> im Sommerpark im Restaurant Solbad. Nach dem langen<br />
Unterwegssein (Anreise) schmeckt das feine Essen ausgezeichnet.<br />
Gespräche, Erinnerungen werden miteinander ausgetauscht, bis Vreni<br />
Meier zum Aufbruch zur Besichtigung ermahnt. Vor der Führung, wurde<br />
uns mittels DVD- Präsentation viel Wissens- und Sehenswertes zur Entstehung,<br />
Gewinnung und Verarbeitung des Salzes präsentiert. Auf dem<br />
Rundgang durch die moderne Betriebsanlage, konnten wir uns vor Ort<br />
ein Bild über die ganze Salzverarbeitung machen. Der Besuch im Salzladen,<br />
eine Vielfalt von salzigen Überraschungen. – Dazu ein Bericht von<br />
Gina Gähwiler in der nächsten Bielerpost.<br />
Herzlichen Dank<br />
Allen Mitglieder für die Unterstützung.<br />
Allen Spendern und Spenderinnen für das Buchprojekt.<br />
5
Allen aktiven Kurskontakt- Personen für die Kurs- Vernetzung.<br />
Der Arbeitsgruppe „Anlass <strong>2012</strong>“ für die Vorarbeiten.<br />
Dem Vorstandskollegium für den grossen Einsatz und die Bereitschaft<br />
Neuerungen mitzutragen und mitzugestalten.<br />
Im Unterwegssein für und mit der <strong>Vereinigung</strong> seid ihr ein tolles Team.<br />
Ich freue mich auf ein gemeinsames, erfolgreiches Vereinsjahr <strong>2012</strong>.<br />
Oktober 2011<br />
Margrit Lüthi -Zürcher, Präsidentin<br />
19. Mitgliederversammlung vom 4. November 2011<br />
Die Präsidentin, Margrit Lüthi, begrüsst die 55 Mitglieder und zwei Gäste.<br />
Speziell begrüsst sie Rita Räss, Irène Fiechter und Erna Fiechter Kurs1.<br />
Entschuldigt haben sich 25 Mitglieder.<br />
6
Finanzen<br />
Dieses Jahr schliesst mit einem Ausgabenüberschuss ab.<br />
Die Jahresrechnung 2010 / 2011<br />
Einnahmen Fr. 11‘477.—<br />
Ausgaben: Fr. 12‘388.85<br />
Ausgabenüberschuss: Fr. 911.85<br />
Das Vereinsvermögen beträgt am 31. August 2011 Fr. 21‘869.10<br />
Das Budget 2011 / <strong>2012</strong> geht von einem Ausgabenüberschuss aus.<br />
Dieser wird verursacht durch die Rückstellungen für den Anlass im Mai<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Budget ohne Anlass <strong>2012</strong> und ohne Buchprojekt<br />
Einnahmen Fr. 14‘160.—<br />
Ausgaben Fr. <strong>18</strong>‘021.—<br />
- Fr. 3‘861.—<br />
Die Rückstellungen von total Fr. 10‘000.— für den Anlass im Mai <strong>2012</strong><br />
werden zusammen mit den Einzahlungen der TeilnehmerInnen gemäss<br />
Budget die erwarteten Ausgaben decken.<br />
Das Buchprojekt ist auf gutem Wege. Aufgrund von grosszügigen<br />
Spendeneingängen und dem angenommenen Erlös aus dem Buchverkauf<br />
gehen wir von einem ausgeglichenen Budget aus.<br />
Unverändert bleiben die Mitgliederbeiträge: Einzelmitglieder Fr. 30.—<br />
und Ehepaare Fr. 45.—.<br />
Mutationen<br />
In diesem Vereinsjahr dürfen wir fünf Neumitglieder begrüssen. Daneben<br />
sind neun Austritte zu verzeichnen.<br />
Aktuell zählt der Verein am 31.08.2011 282 Mitglieder und 56 Jahresmitglieder.<br />
Jahresprogramm <strong>2012</strong><br />
Januar / Februar <strong>2012</strong> Versand der Bielerpost <strong>Nr</strong>. <strong>18</strong><br />
9. Mai <strong>2012</strong> „Schwelgen in Erinnerungen“ im Restaurant Weisses Kreuz<br />
in Lyss<br />
Die 20. Mitgliederversammlung muss infolge Terminkollision (Aula ist<br />
schon sehr ausgebucht) auf einen Mittwoch und in den Monat Oktober<br />
verschoben werden! > Mittwoch, 24. Oktober <strong>2012</strong><br />
Tagungsthema: Pflegenotstand – neue Spitalfinanzierung<br />
7<br />
Priska Lörtscher, Kurs 33
Zusammenfassung des Tagungsthemas<br />
„Pflegediagnosen – Modetrend oder taugliches Werkzeug“<br />
Literatur:<br />
Brobst, Ruth et al.: Der Pflegeprozess in der Praxis, Huber, 2007.<br />
Doenges, Marylinn et al: Pflegediagnosen und Massnahmen, Huber, 2002.<br />
Fiechter, Verena et al: Pflegeplanung, Recom, 1987.<br />
Gordon, Marjory: Pflegediagnosen – theoretische Grundlagen, Urban&Fischer,<br />
2001.<br />
Menche, Nicole: Pflege heute, Lehrbuch für Pflegeberufe, Urban& Fischer Verlag,<br />
2009.<br />
Müller Staub, Maria: Seminar Pflegediagnostik, 2009<br />
1. Geschichte der Pflegediagnose<br />
Ein paar Daten aus einer Zusammenstellung von Dr. Maria Müller Staub.<br />
Jahr Ereignis<br />
1929 Ein Beitrag im American Journal of Nursing beschreibt einen<br />
ersten Versuch, pflegerische Probleme und medizinische Probleme<br />
zu unterscheiden, um herauszuschälen, welchen Beitrag<br />
die Pflege zur Rekonvaleszenz des Patienten leistet.<br />
1953 Virginia Fry prägt den Begriff „Pflegediagnose“, indem sie die<br />
Entwicklung einer Pflegediagnose und eines Pflegeplans als<br />
kreativen pflegerischen Ansatz beschreibt.<br />
Im gleichen Jahr verwendet Virginia Henderson erstmals den<br />
Begriff „Pflegeplanung“.<br />
1967 Helen Yura und Mary Walsh veröffentlichen das erste Buch<br />
über den Pflegeprozess (Einschätzen, Planen, Umsetzen,<br />
8
Auswerten). Der Pflegeprozess besteht aus 4 Schritten.<br />
1973 o Erste nationale Konferenz für Pflegediagnosen und Beschluss<br />
für 2-jährliche Treffen. Marjory Gordon wurde Vorsitzende<br />
der Task-Force für nationale Pflegediagnosen-<br />
Konferenzen.<br />
o In Grossbritannien wird der Pflegeprozess durch den National<br />
Health Service „politisch verordnet“<br />
1974 Die Pflegediagnose wird als eigenen Schritt im Pflegeprozess<br />
anerkannt. Der Pflegeprozess erhält einen 5. Schritt.<br />
1975 CH: Einführung des Pflegeprozesses in Kursen der Kaderschule<br />
für Krankenpflege SRK, Zürich<br />
1981 CH: Erstes Buch zur Pflegeplanung (Fiechter, V. & Meier, M.;<br />
Lehrerinnen Kaderschule SRK, Zürich) mit 6 Schritten.<br />
1982 Formelle Gründung der NANDA (North American Nursing Diagnosis<br />
Association), die aber bereits im Jahr 1973 ihren Anfang<br />
nahm.<br />
1990 Neunte NANDA-Konferenz. Die NANDA veröffentlicht die Taxonomie<br />
I, überarbeitete Fassung und die aktuell noch geltende<br />
Arbeitsdefinition für Pflegediagnosen<br />
1992 o Zehnte NANDA-Konferenz: Vorschläge für neue Pflegediagnosen<br />
kommen von Pflegekräften, Lehrkräften, PflegeforscherInnen<br />
und KrankenpflegeschülerInnen. Bevor eine<br />
neue Pflegediagnose in die NANDA-Taxonomie aufgenommen<br />
wird, muss sie einen strengen Beurteilungsprozess<br />
durchlaufen.<br />
o Übersetzung von „Doenges/Moorhouse: Nurse’s Pocket<br />
Guide Diagnoses, Interventions and Rationales“ (Pflegediagnosen<br />
und Maßnahmen) in die deutsche Sprache<br />
o Neue Ausbildungsbestimmungen (SRK) treten in Kraft,<br />
Pflegeprozess wird „offiziell“ als Ausbildungsinhalt festgelegt<br />
1993 Vereinzelter Beginn in der Schweiz, mit PD zu arbeiten<br />
1996 o CH: KVG tritt in Kraft. Die Krankenpflege-Leistungsverordnungen<br />
sehen die „Abklärung des Pflegebedarfs und<br />
des Umfeldes des Patienten und die Planung der notwendigen<br />
Massnahmen zusammen mit Arzt (Ärtzin) und Patient<br />
(Patientin)“ vor.<br />
o CH: ZEFFP (Zentrum für Entwicklung und Forschung Pflege)<br />
lanciert am UniversitätsSpital Zürich das Projekt Pflegediagnostik<br />
(im Rahmen des Modellversuchs Qualitätsmanagement,<br />
GD Kt. ZH)<br />
1997 Im österreichischen Bundesgesetz über Gesundheits- und<br />
9
Krankenpflegeberufe werden als allgemeine Berufspflichten die<br />
Pflegedokumentation beschrieben, welche die Pflegeanamnese,<br />
Pflegediagnose, Pflegeplanung und Pflegemassnahmen zu<br />
enthalten hat.<br />
ca.2000 Biel: Die Pflegediagnosen werden nach dem Schneeballsystem<br />
eingeführt. In der folgenden Zeit arbeiten die Frauenklinik<br />
und die Orthopädie mit standardisierten Pflegediagnosen. Die<br />
anderen Abteilungen müssen wegen Personalengpässen andere<br />
Prioritäten setzen.<br />
2002 NANDA wird umbenannt in NANDA International. Diese Bezeichnung<br />
gilt neu als Markenname für die Internationale Pflegediagnosenklassifikation.<br />
2003 CH: Im Bürgerspital Solothurn startet das erste grosse Projekt<br />
zur Einführung der Pflegediagnostik im Zusammenhang mit<br />
Pflegemassnahmen und Pflegergebnissen.<br />
2006 CH: Die Einführung der Pflegediagnostik – Massnahmen und –<br />
ergebnisse im Bürgerspital Solothurn ist abgeschlossen. Es<br />
wurde wissenschaftlich evaluiert durch M. Müller Staub.<br />
2007 Biel: Einführung der Pflegediagnosen auf Medizin<br />
2009 Biel: Einführung der Pflegediagnosen auf Chirurgie<br />
2010 Biel: Die beiden letzten chirurgischen Abteilungen werden in<br />
Pflegediagnostik eingeführt.<br />
2. Vom Pflegeproblem zur Pflegediagnose<br />
Während in der Schweiz seit den 1980er Jahren der Pflegeprozess vor<br />
allem unter dem Aspekt der Pflegeplanung gelehrt und allmählich in die<br />
Praxis eingeführt wurde, blieb der Begriff der Pflegediagnose im Hintergrund.<br />
Es fand zudem eine Auseinandersetzung über die pflegerische<br />
Fachsprache statt: Sollte man die komplizierte, ungenügend übersetzte<br />
und defizitorientierte Fachsprache aus dem Amerikanischen übernehmen<br />
oder besser selber formulierte Pflegeprobleme benennen, die dann<br />
von allen richtig verstanden wurden. Nicht zuletzt führte diese Auseinandersetzung<br />
zu einer verzögerten Einführung der Pflegediagnosen.<br />
Eine weitere Auseinandersetzung betraf die Rolle der Pflegenden: Steht<br />
es einer Krankenschwester zu, auch Diagnosen zu stellen? Wollen „die<br />
Studierten“ sich nun auf die Ebene der Ärzte stellen? Haben sie das nötig?<br />
Was ist dann der Unterschied zu einer medizinischen Diagnose?<br />
Medizinische Diagnosen benennen Krankheiten, Pflegediagnosen benennen<br />
individuelle Reaktionen eines Patienten auf eine Krankheit oder<br />
Therapie.<br />
10
Definition: Eine Pflegediagnose ist ein klinisches Urteil einer dipl. Pflegefachfrau<br />
über die individuelle Reaktion eines Patienten (oder Angehörigen<br />
oder Gruppe) auf seine Krankheit oder einen Lebensprozess.<br />
Inzwischen haben sich die 167 NANDA-International Diagnosen weitgehend<br />
durchgesetzt, nicht zuletzt dank der 3. überarbeiteten Auflage des<br />
Buchs von Doenges/ Moorhouse.<br />
3. Pflegediagnose als Teil des Pflegeprozesses<br />
Um die Pflegearbeit systematisch abbilden zu können, wurde in den<br />
1980er Jahren das Instrument des Pflegeprozesses eingeführt. Der Pflegeprozess<br />
ist ein systematischer Ansatz, um die Probleme und Ressourcen<br />
eines Patienten zu erkennen und pflegerisch zu handeln, um diese<br />
Probleme zu lösen oder zu lindern. Der Pflegeprozess beruht auf wissenschaftlichen<br />
Grundlagen und bietet eine Struktur, die darauf abzielt,<br />
das Wohlbefinden des Patienten zu verbessern, zu erhalten oder wiederzuerlangen<br />
(Brobst et al. 2007).<br />
Der Pflegeprozess ist keine Theorie, sondern er beschreibt als Handlungsmodell<br />
oder Arbeitsmethode den Ablauf von zielgerichteter und<br />
systematischer Pflege.<br />
6. Evaluation<br />
1. Anamnese<br />
2. Diagnose<br />
Die Pflegediagnosen oder<br />
Pflegeprobleme beschreiben<br />
Beeinträchtigungen<br />
oder Abhängigkeiten des<br />
Patienten oder mögliche<br />
Reaktionen auf seine Erkrankung.<br />
5. Durchführung<br />
4. Massnahmen<br />
3. Ziele<br />
Die Pflegediagnosen werden<br />
nach dem PES-Format<br />
beschrieben:<br />
P: Problem/ Pflegediagnosetitel<br />
(was?)<br />
E: Einflussfaktor/ Ursache<br />
(warum?)<br />
S: Symptom (wie zeigt sich<br />
das Problem?)<br />
Von allen Schritten im Pflegeprozess haben sich die Pflegediagnosen<br />
am meisten entwickelt. Inzwischen gibt es über <strong>18</strong>8 Pflegediagnosen.<br />
Pflegediagnosen begründen die Pflegetätigkeit (Motto: keine Massnahme<br />
ohne Diagnose) und legitimieren sie.<br />
11
Beispiel: Die medizinische Diagnose lautet: Demenz. Die Pflegediagnose:<br />
beeinträchtigte Gedächtnisleistung bedingt durch Medikamente und<br />
angezeigt durch fehlende kurzzeitige Erinnerung.<br />
Pflegediagnosen dienen der Professionalisierung und Vereinheitlichung<br />
der Pflegefachsprache. Die Pflegefachfrau übernimmt neu die Rolle der<br />
Diagnostizierenden. Sie übt diese Rolle als Teil ihrer Aufgabe aus. Sie<br />
nutzt die Pflegediagnose als Grundlage für die Behandlungsentscheide<br />
in ihrem pflegerischen Fachgebiet und übernimmt die Verantwortung für<br />
die Resultate ihrer pflegerischen Behandlung (z.B. intakter Hautzustand<br />
bei der Entlassung).<br />
Um zu einer korrekten Pflegediagnose zu kommen, befolgt die Pflegefachfrau<br />
die folgenden Schritte:<br />
2.6<br />
PES-<br />
Format<br />
2.5<br />
priorisiere<br />
n<br />
2.1<br />
gruppieren<br />
2.4<br />
streichen<br />
2.2<br />
vermuten<br />
2.3<br />
überprüfen<br />
12<br />
Prozess der Formulierung einer Pflegediagnose:<br />
2.1 Die Pflegephänomene<br />
gruppieren (z.B. Mobilität,<br />
Ausscheidung, kognitive<br />
Prozesse).<br />
2.2 mögliche und vermutete<br />
Pflegediagnosen<br />
aus der Liste auswählen.<br />
2.3 Gemäss der Definition<br />
und den Ursachen<br />
und Symptomen überprüfen.<br />
2.4 Nicht zutreffende<br />
Pflegediagnosen streichen.<br />
2.5. Die wichtigste Pflegediagnose<br />
bestimmen<br />
(ev. mit Rücksprache mit<br />
Pat.)<br />
2.6. Pflegediagnose nach<br />
dem PES-Format formulieren<br />
und dokumentieren.<br />
Beispiel: Beeinträchtigte körperliche Mobilität Grad 3 (P)<br />
bedingt durch verminderte Muskelkraft, Schmerzen, Wahrnehmungsstörungen<br />
(E),<br />
angezeigt durch begrenzte Bewegungsmöglichkeit, verlangsamte Bewegung,<br />
Gangveränderung, Unfähigkeit, sich zielgerichtet zu bewegen (S).
Risikodiagnosen enthalten nur die Elemente P und E, da noch keine<br />
Symptome vorhanden sind.<br />
Beispiel: Gefahr einer Hautschädigung (P) bedingt durch Bettlägerigkeit<br />
und fehlende Muskelkraft, sich im Bett selber zu bewegen (E).<br />
Fallbeispiel<br />
Frau Segmüller ist 77 Jahre alt und wird neu von Ihrer Institution betreut.<br />
Sie ist alleinstehend, ihr Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Sie hat eine<br />
Tochter, die in Frankreich lebt. Sie telefoniert jeden Sonntag mit ihr und<br />
hält sie auf dem Laufenden; mit ihr kann sie alles besprechen. Aus der<br />
Krankengeschichte entnehmen Sie, dass Frau Segmüller vor zwei Jahren<br />
gestürzt ist (als Ursache gibt sie auf Nachfrage Schwindel an) und<br />
sich den Oberschenkelhals gebrochen hat. Sie lag damals drei Wochen<br />
im Spital und anschliessend trainierte sie vier Wochen in einer Reha-<br />
Klinik ihre Mobilität. Seither nutzt sie einen Gehstock. Der Appetit von<br />
Frau Segmüller ist seit langem stark vermindert. Zu Hause kocht sie sich<br />
jeden 3. Tag und wärmt die Mahlzeiten in der Zwischenzeit auf. Seit dem<br />
Tod ihres Mannes schläft sie nicht mehr gut. „Wissen Sie, es ist nicht<br />
dasselbe, da fehlt einfach jemand.“ Dabei sammeln sich Tränen in ihren<br />
Augen. Die Körperpflege führt sie selbstständig aus. Nur zum Duschen<br />
benötigt sie Hilfe. Sie achtet sehr auf Sauberkeit, weil sie beim Husten<br />
oder Heben immer ein paar Tropfen Urin verliert. „Manchmal muss ich<br />
dann ganz schnell aufs WC, besonders nachts“. Frau Segmüller ist wegen<br />
Herzbeschwerden in Ihre Institution eingetreten, die sich in den letzten<br />
Monaten verschlechtert haben. Sie hat am Abend stark geschwollene<br />
Füsse. Treppensteigen strengt sie sehr an. Insgesamt nimmt sie weniger<br />
an Aktivitäten teil als noch vor wenigen Jahren.<br />
Aufgabe<br />
Welche Probleme (Pflegediagnosen) weist Frau Segmüller auf?<br />
Welche Pflegediagnose ist wohl die wichtigste, und warum?<br />
Pflegediagnose von Frau Segmüller:<br />
Problem:<br />
Einflussfaktor:<br />
Symptom:<br />
13
Mögliche Fehlerquellen beim Stellen von Pflegediagnosen<br />
o zu viele oder zu wenige Daten<br />
o mangelnde Kenntnisse oder fehlende Erfahrung mit Pflegediagnosen<br />
o Verwendung von untauglichen Daten<br />
o Nichtbeachtung von kulturellen Begebenheiten<br />
o unzutreffende Interpretation der Symptome<br />
o Nichtbeachtung widersprüchlicher Symptome<br />
o falsche Auswahl der Pflegediagnosetitel (Brobst et al. 2007)<br />
Pflegediagnosen werden nach ihrer Priorität geordnet. Die meisten Patienten<br />
haben mehrere Pflegediagnosen. Oft ist es jedoch nicht möglich,<br />
alle aufzuschreiben. Es lohnt sich zu überlegen, welche die wichtigste ist<br />
und diese konsequent zu verfolgen. Oft treten andere Diagnosen somit<br />
in den Hintergrund.<br />
4. Nutzen der Pflegediagnose im pflegerischen Alltag<br />
Der Pflegeprozess mit den Pflegediagnosen dient dazu:<br />
o die aktuellen Gesundheitsprobleme, die behandelt werden können, zu<br />
erkennen<br />
o potenzielle Gesundheitsprobleme, die zu verhüten sind, zu erkennen<br />
o Ressourcen, die gefördert werden können, zu erfassen<br />
Darüber hinaus macht der Pflegeprozess es möglich:<br />
o einen Plan zu entwickeln, der die aktuellen und potenziellen Probleme<br />
des Patienten lindert oder löst<br />
o Art und Umfang der pflegerischen Hilfe zu bestimmen<br />
o mit dem Patienten gemeinsam Ziele zu formulieren und zu erreichen.<br />
Der Pflegeprozess stellt damit die Grundlage der pflegerischen Arbeit<br />
dar und ermöglicht es, eine standardisierte und systematische Pflegeplanung<br />
zu erstellen.<br />
Voraussetzungen und fachliche Fähigkeiten :<br />
Eine Pflegefachfrau benötigt die folgenden Fähigkeiten, um den Pflegeprozess<br />
steuern zu können – diese Fähigkeiten haben sich auch frühere<br />
Generationen von Pflegenden angeeignet und weiterentwickelt:<br />
o Fachwissen, Neugier, Fragen stellen<br />
o beobachten, erkennen<br />
o analysieren, beurteilen und reflektieren<br />
o Beziehung aufbauen, interagieren<br />
o Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen<br />
o mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit<br />
o Kompetenzen aus der Familien- und Betreuungsarbeit<br />
14
Folgende Aussagen von Pflegenden sollen einen Einblick in den<br />
Nutzen für die Praxis geben:<br />
„Seit wir mit Pflegediagnosen arbeiten, legen wir vermehrt Wert auf eine<br />
sorgfältige Anamnese.“<br />
„Jeder Patient mit einer Pflegediagnose hat auch eine individuelle Pflegeplanung.<br />
Das heisst, wir alle ziehen am gleichen Strick.“<br />
„Wenn ich eine Pflegediagnose gelesen habe, weiss ich, was der Patient<br />
hat, warum er es hat und wie sich das Problem zeigt. Das heisst, ich habe<br />
ein klareres Bild von ihm, ohne dass ein ausführlicher Rapport nötig<br />
wäre.“<br />
Oder allgemeiner ausgedrückt:<br />
o Alle Pflegediagnosen eines Patienten zusammen beschreiben die<br />
Gründe, warum er Pflege benötigt, sie beschreiben den Pflegebedarf.<br />
o Von den Pflegediagnosen lassen sich die erforderlichen Pflegeleistungen<br />
und Pflegeinterventionen ableiten.<br />
o In den Pflegediagnosen sind die Informationen zusammengefasst,<br />
welche verschiedene an der Pflege Beteiligte benötigen, insbesondere<br />
bei Verlegungen.<br />
o Die Pflegediagnosen ermöglichen eine effektive und effiziente Kommunikation<br />
über den Zustand von Patientinnen aus pflegerischer<br />
Sicht.<br />
5. Pflegewissenschaftliche Erkenntnisse: Es ist erwiesen, dass…<br />
in Bezug auf den Pflegeprozess<br />
o ... dass Pflegediagnostik ermöglicht die Pflege fachlich fundiert und<br />
kontinuierlich umzusetzen.<br />
o ... dass Pflegediagnostik zur Professionalisierung beiträgt, indem sie<br />
Pflegenden erlaubt, ihr Handeln aus der pflegefachlichen Beurteilung<br />
der Patientensituation abzuleiten.<br />
o ... dass dank Pflegediagnosen auch Verbesserungen in der Qualität<br />
der Dokumentation (Ziele und Massnahmen!) erzielt werden.<br />
o ... dass mit dem Messinstrument Q-DIO (Qualität von Pflegediagnosen,<br />
-interventionen und -outcomes) Pflegediagnostik gezielt gemessen<br />
werden kann.<br />
o ... dass die Aufgaben der Dipl. Pflegenden dank Pflegediagnosen<br />
evidenz-basiert beschrieben und das Verantwortungsgebiet „Pflegeprozess“<br />
inhaltlich gefüllt und definiert ist.<br />
in Bezug auf Pflegediagnose-Klassifikation und Klinikinformationssystem<br />
o ... dass NANDA am meisten Klassifikationskriterien erfüllt.<br />
o ... dass die NANDA-Klassifikation fundierte, theoretische Auffassungen<br />
von Pflege abbildet.<br />
15
o ... dass die NANDA-Klassifikation bei jeder Diagnose die Definition<br />
mit Forschungen (z.B. Fallstudien und Konzeptanalysen) belegt und<br />
den ursächlichen Zusammenhang und die Zeichen zuordnet. Damit<br />
liefert sie Pflegefachwissen.<br />
o ... dass NANDA Diagnosen am meisten verwendet werden (in der<br />
Schweiz in 3 Universitätsspitälern sowie in mehr als 60 Spitälern).<br />
Auch international ist die NANDA die am häufigsten umgesetzte und<br />
erforschte Pflegediagnosen-Klassifikation.<br />
o ... dass NANDA Diagnosen eine theoriegeleitete Verbindung zu Pflegezielen,<br />
Massnahmen und Pflegeergebnissen in der elektronischen<br />
Patientendokumentation ermöglicht.<br />
o ... dass die elektronische Unterstützung niemals die klinische Entscheidungsfindung<br />
ersetzen kann.<br />
o ... dass der Einbezug von NANDA-Pflegediagnosen die Aussagekraft<br />
von AP DRG um 30 % erhöht.<br />
o ... dass unter Einschluss von NANDA Diagnosen in DRG die Aufenthaltsdauer,<br />
der Aufenthalt auf der Intensivstation, die Mortalität, der<br />
Austritt (nach Hause oder in Langzeitinstitution) sowie die Behandlungskosten<br />
um 30 % genauer belegt werden.<br />
in Bezug auf Qualität<br />
o ... ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Qualität<br />
der Pflegediagnostik und der von Patientinnen empfundenen Zufriedenheit<br />
gemessen wurde.<br />
o ... ein aufmerksamer und einfühlender Umgang im diagnostischen<br />
Prozess der wichtigste Prädiktor für Patientenzufriedenheit ist.<br />
o ... dass ein blosses Feststellen von Diagnosebezeichnungen nicht<br />
genügt, um den Pflegebedarf und die Bedürfnisse der Patienten genau<br />
zu erfassen.<br />
o ... genau gestellte Pflegediagnosen die Wahl von wirksameren Massnahmen<br />
zur Folge hat und dadurch die Patientenergebnisse signifikant<br />
besser sind<br />
in Bezug auf Schulungen<br />
o ... dass die klinische Urteilsbildung kritisches Denken erfordert. Die<br />
Schulung von kritischem Denken - im Unterschied zu kritisierenden<br />
Äusserungen (!) - und Fachwissen ist von grosser Bedeutung, um<br />
genaue Pflegediagnosen zu stellen<br />
o ... dass Fallbesprechungen, die auf einem breiten Hintergrund bezüglich<br />
Pflegediagnosen nach PES-Format basieren, eine gute Möglichkeit<br />
darstellen, Pflegediagnostik und klinische Urteilsbildung zu schulen.<br />
16
o ... dass Fallbesprechungen folgende Lerneffekte ermöglichen: Pflegeprobleme<br />
werden patientennah erfasst und der Pflegeprozess<br />
wirksam umgesetzt, pflegerische Aufgaben werden gezielter betrachtet<br />
und klarer benannt, Beziehungsgestaltung wird differenzierter<br />
wahrgenommen.<br />
Cornelia Willi<br />
Stimmungsbild zum 4. November 2011<br />
Wetter neblig – trüb, Temperatur zu warm.<br />
Ankunft mit dem Bus vor dem Spitalzentrum.<br />
Erster Rundblick: die Schafe sind noch da, das „Schulhaus“ auch – rein<br />
äusserlich. Was soll das nun wieder heissen…? Die Schule, unsere<br />
Schule, gibt es seit dem 31. Oktober 2011 nicht mehr. Die Ausbidlungsstätte<br />
vieler junger Menschen wurde wegrationalisiert „AUS – FERTIG -<br />
VORBEI“, 64 Jahre Geschichte! Schreibtischtäter haben entschieden.<br />
Ob das zum Wohl der Region ist „darf bezweifelt werden“.<br />
Wie immer beginnt unser Tag im Personalrestaurant mit Kaffee und Gipfeli.<br />
Ein Raumteil ist für uns reserviert. Die Tische sind mit Blumen geschmückt.<br />
Alles ist vorbereitet. Vielen Dank für den netten Empfang!<br />
Langsam steigt das Stimmengewirr, man hat sich viel zu erzählen.<br />
Pünktlich beginnt in der Aula das Programm mit den Tranktanden der<br />
Hauptversammlung. Speditiv wird ein Punkt nach dem anderen behandelt.<br />
Alles liegt im üblichen Rahmen.<br />
Aber jetzt geht’s los: das Buch über die Schule wird vorgestellt. Wir Zuhörer<br />
bekommen grosse Ohren. Ausgangslage: Die Schule ist Vergangenheit.<br />
Über 64 Jahre wurden Dokumente angehäuft und werden irgendwo<br />
eingelagert, sind nicht mehr greifbar. Der Vereinsvorstand kam<br />
auf die gute Idee das Material zu sichten, die Idee ein Buch zu gestalten<br />
war geboren. Eine riesige Aufgabe, mächtig legen sich alle ins Zeug.<br />
17
Während der Präsentation der Arbeiten zum Buch schickt die Sonne die<br />
einzigen Strahlen des Tages auf das bunte Laub der Bäume vor den<br />
Fenstern. Das ist doch bemerkenswert! --- Ich glaube auch Frau Spring<br />
hätte ihre Freude an dem Projekt „Buch“ gehabt. Unter viel Applaus und<br />
Bewunderung für den Einsatz endet der geschäftliche Teil.<br />
Frau Brunner wird erwartet, um uns möglicherweise vom Ende der Schule<br />
zu berichten. Sie ist nicht erschienen, aus welchem Grund auch immer.<br />
Von Interesse wäre es für uns sicher gewesen.<br />
Vor dem Mittagessen der erste Teil der Weiterbildung. Fortsetzung nach<br />
dem Essen.<br />
Pflegediagnose??? – wir wartens ab. Frau Willi trägt vor, dann werden<br />
uns Aufgaben gestellt, um anschliessend diskutiert zu werden. Frau Willi<br />
lenkt die Gespräche gekonnt. Immer wieder vergleichen wir mit früher.<br />
Wir arbeiteten damals mit unseren Sinnen – Hilfsmittel und Medikamente<br />
gab es nur wenig. Heute verfügen wir über eine Menge an Technik und<br />
Unmengen an Medikamenten. Alles hat sich grundlegend geändert und<br />
ist mit unserer Zeit nicht mehr vergleichbar. Von der Zuhörerseite kommt<br />
immer wieder: das haben wir doch auch schon so gemacht….<br />
Interessant ist es allemal so einen Werdegang erklärt zu bekommen. Im<br />
Spital ist die Schulung im Gange.<br />
Pünktlich um 16.00 Uhr endet die Tagung. Es war ein guter Anlass.<br />
Heidi Strebe, Kurs 10<br />
<strong>18</strong>
Frühlingsausflug Rheinsalinen in Pratteln<br />
Margrit und ich sind enttäuscht. Wir haben soeben vernommen, dass die<br />
gedeckten Tische im grossen, von der Morgensonne beschienenen<br />
Raum - kostbare Tischtücher, blütenweisse Servietten, glitzerndes Besteck<br />
und funkelnde Gläser - nicht für unsere Gruppe bestimmt sind. Für<br />
uns wurde ein enger, bescheidener, ein wenig düsterer Raum reserviert,<br />
ein Hinterzimmer, in dem lange nicht alle angemeldeten Teilnehmerinnen<br />
Platz finden werden. Daran hat man auch gedacht. Ein schmuckloser<br />
Tisch in einer Art Vor- oder Zwischenraum, in dem es zieht, wird bestimmt<br />
genügen, sagt die Frau, die uns einen Kaffee serviert hat. Wir befinden<br />
uns im Restaurant Solbad in Pratteln und wir protestieren. Es<br />
nützt nichts. Die Chefin ist noch nicht gekommen, sie hat das so angeordnet.<br />
Wir müssen warten und mit ihr verhandeln. Etwas später erscheint<br />
die Chefin und verschwindet gleich wieder. Sie ist nicht bereit mit<br />
uns zu sprechen. Guter Rat ist teuer.<br />
Die ersten Teilnehmerinnen treffen ein, Kolleginnen aus dem Vorstand.<br />
Ich bin erleichtert. Gemeinsam werden sie bestimmt eine Lösung finden.<br />
Ich begebe mich in den Garten, von hier aus hat man einen guten Überblick<br />
auf die Bushaltestelle. Ich bin neugierig und gespannt, ob ich die<br />
Ankommenden erkenne. Mit jedem Bus kommen neue bekannte Gesichter<br />
an. Alle Anwesenden werden fröhlich begrüsst und dann wird Ausschau<br />
gehalten nach den Kurskolleginnen und nach all jenen, auf die<br />
man sich schon so lange gefreut hat. Fast alle Gartentischchen sind<br />
schon besetzt und die Neuankommenden finden immer sehr rasch „ihr“<br />
Tischchen.<br />
Drinnen im Restaurant wurde in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden.<br />
Vreni Meier raunt sie mir heimlich zu: „Wir haben einen Tisch für uns!“<br />
Mit „wir“ ist der Kurs 16 gemeint. Der ist, wie immer, sehr gut vertreten.<br />
„Wir“ sind es gewohnt, ein wenig abseits zu stehen, zu sitzen oder zu<br />
wohnen, man denke an den Pavillon. Und ein Extrazüglein sind „wir“<br />
auch schon immer ganz gerne gefahren. Eine Lösung ganz nach „unserem“<br />
Geschmack!<br />
Während des Essens wird viel gelacht, geschwatzt, Neuigkeiten ausgetauscht<br />
und Grüsse übermittelt. Frieda geht es gut, sagt Hanne, ihre<br />
Schwägerin. Das freut mich, nur schade, dass sie nicht anwesend ist.<br />
Wir haben viel Zeit füreinander und miteinander. Sogar ein kleiner Verdauungsspaziergang<br />
an den Rhein liegt drin. Das Mittagessen schmeckt<br />
19
allen und der Service verläuft reibungslos. Alle sind zufrieden, niemand<br />
hat von der anfänglichen Verstimmung etwas mitbekommen.<br />
Der Nachmittag ist dem Salz gewidmet, dem weissen Gold. Dass Salz<br />
für den Menschen sehr wichtig ist, haben wir alle schon gewusst. Dass<br />
man es aber unter so vielen verschiednen Aspekten betrachten kann, ist<br />
neu. Salzvorkommen, die Technik der Salzgewinnung früher, die Geschichte<br />
der Salzgewinnung in der Schweiz, ihr Einfluss auf Politik und<br />
Wirtschaft in der Region, die Technik der Salzgewinnung heute. Umweltschutz.<br />
Engpässe in kalten Wintern (Streusalz) und als Abschluss im<br />
Salzladen, die Vielfältigkeit von Produkten aus Salz. „Salz ist kostbarer<br />
als Gold“, heisst ein tschechisches Bilderbuch, das ich mit meinen Kindern<br />
angeschaut und ihnen vorgelesen habe. Heute habe ich viel dazugelernt.<br />
Wenn mir das Buch mal wieder in die Hände kommt, werde ich<br />
es meinen Enkelinnen vorlesen und kann dann noch viel dazu erzählen.<br />
Einige haben eine lange Rückreise vor sich, andere haben heute noch<br />
etwas los. Viele sind schon gegangen, nur noch eine kleine Gruppe begibt<br />
sich in die Gartenwirschaft, die beim Salzladen gleich um die Ecke<br />
liegt. Das Restaurant schliesst um siebzehn Uhr, aber wenn wir gleich<br />
bezahlen, können wir sitzen bleiben solange wir wollen. Eine goldene<br />
Abendsonne scheint durch die Blätter der alten Bäume. Ein Hauch von<br />
Melancholie kommt über den verlassenen Biergarten. Die Gespräche<br />
verstummen. Wir brechen auf.<br />
20
Auf dem Weg zur Bushaltestelle kommen wir am Restaurant Solbad vorbei.<br />
Ich werfe einen Blick durchs Fenster. Die erwartete Gruppe ist nicht<br />
erschienen. Bis zum Abend hätte man alle Zeit gehabt umzudekorieren.<br />
Die Bedienung sitzt gelangweilt im Garten und raucht. Die Tische, die<br />
nicht für uns gedeckt wurden, sehen immer noch genau gleich aus. Oder<br />
doch nicht ganz. Die Gläser sind etwas trüb geworden und die blütenweissen,<br />
gestärkten Servietten sind zusammengefallen, sind schlaff geworden.<br />
Der Raum da drinnen strahlt eine unheimliche, sehr düstere Atmosphäre<br />
aus. Vielleicht gehört die Chefin, die wir nur ganz kurz gesehen<br />
haben, einer fremden Religion an? Vielleicht bereitet sie den Ahnen<br />
einmal im Jahr ein luxuriöses Mahl zu? Oder den im Rhein Ertrunkenen,<br />
oder sonst irgendwelchen Gespenstern? Plötzlich bevölkert sich der<br />
Raum. Seltsame, fast durchsichtige Gestalten tauchen auf, wunderschöne,<br />
engelgleiche, aber auch ein paar mit dämonischen Fratzen sind darunter<br />
und dort kommt sogar ein kleines, listiges Teufelchen. Ein Schauder<br />
läuft mir über den Rücken.<br />
„Hallo“, ruft Margrit von der anderen Strassenseite. „Der Bus kommt in<br />
ein paar Minuten, er fährt bis Liesthal-Bahnhof. Wir müssen nicht umsteigen.“<br />
Gut so. Es wird Zeit, die magisch-realistischen Vorstellungen<br />
aufzugeben und in die Basellandschaftliche Realität zurückzukehren.<br />
Dürrenroth, 31.8.2011 Gina Gähwiler-Feletti, Kurs 16<br />
Treffen mit den Kurs-Kontaktpersonen Gärtnerei Leonotis<br />
Am 17. Juni 2011, einem wunderschönen, heissen Sommertag treffen<br />
wir uns vor dem Eingang der Gärtnerei Leonotis in Grossaffoltern.<br />
In einer duftenden, farbenprächtigen Sommerflordekoration begrüsst<br />
man sich. Herr Hauert, der junge Inhaber der Gärtnerei heisst uns herzlich<br />
willkommen und erklärt uns den Ablauf der Führung, die er und sein<br />
Team vorbereitet haben. Wir teilen uns in zwei Gruppen. Die junge Gärtnerin,<br />
die unsere Gruppe durch die vier Gewächshäuser führt, erklärt<br />
und beschreibt, weiss vieles und auf jede unserer Fragen auch eine<br />
Antwort. Uns wird die Aufzucht von Jungpflanzen erklärt, die Wichtigkeit<br />
von Mutterpflanzen: Aussaat, pikieren, umtopfen. Wir sehen sehr junges<br />
Gemüse, Gewürzpflänzchen und riechen an verschiedensten Kräutern.<br />
Zurück in der Hauptgärtnerei erwartet uns ein kleiner Imbiss: wie in einer<br />
Orangerie stehen und hängen dort blühende, kletternde und rankende<br />
Pflanzen, die sechs Tische mit diversen Sitzgelegenheiten und ein Buffet<br />
21
mit Sandwiches und Getränken umrahmen. Einladend, sich auszuruhen,<br />
zu erfrischen und zu unterhalten.<br />
Darauf begrüsst uns Margrit Lüthi, die Präsidentin des EVPBS. Sie informiert<br />
uns über das Buchprojekt, den bevorstehenden Anlass im Mai<br />
<strong>2012</strong> und bittet uns, Werbung dafür zu machen, um möglichst viele<br />
Ehemalige einladen zu können. Sie bedankt sich für die vielen Spenden<br />
aus den Reihen der Mitglieder der <strong>Vereinigung</strong>. Gleichzeitig weist sie darauf<br />
hin, dass jeder Beitrag noch immer sehr willkommen ist. Sie macht<br />
darauf aufmerksam, dass Neumitglieder jederzeit sehr willkommen sind.<br />
Erfreulicherweise füllt eine Person den Antrag für die Mitgliedschaft<br />
gleich an Ort und Stelle aus.<br />
Nach weiterem Gedanken- und Ideenaustausch löst sich die Veranstaltung<br />
langsam auf. Die ersten verabschieden sich und gehen zielstrebig,<br />
andere suchen sich aus dem Angebot der Fülle die Pflanzen, die ihnen<br />
besonders aufgefallen sind oder suchen ganz zweckmässig Fenchelpflanzen<br />
oder Tomatenstöcklein.<br />
Ein starker Regenguss scheucht auch die letzten Teilnehmerinnen zum<br />
Auto und auf den Heimweg.<br />
Waltraud Salzmann, Kurs 42<br />
Peter Schranz, Kurs 26<br />
22
Aktuelles aus der Schule<br />
Im Februar und im Oktober dieses Jahres haben die beiden letzten Klassen<br />
DN II und Aufbauprogramme DN II in Biel abgeschlossen. Bei Kurs<br />
A / C 17 haben 16 DiplomandInnen erfolgreich das Ziel erreicht, bei Kurs<br />
A / C <strong>18</strong> waren es 13 Abschlüsse; Drei weitere folgen nach Verlängerung<br />
im Dezember 2011 und im März <strong>2012</strong>.<br />
Mit der Diplomfeier vom 4. November durfte der letzte Kurs als erster die<br />
neue Aula im Campus BZ Pflege Ausserholligen einweihen.<br />
Der Schulbetrieb wurde mit viel zusätzlichem Engagement der Lehrpersonen<br />
und der Administration bei guter Qualität bis zum Schluss aufrechterhalten.<br />
Mit einem Abschluss Apéro haben wir uns bei den Praktikumspartnern<br />
bedankt und verabschiedet. Bei milder Abendsonne konnten<br />
wir draussen nochmals den schönen Schulort in Biel mit Sicht auf die<br />
Alpen geniessen.<br />
Eine grosse Herausforderung stellte in den letzten Wochen die Archivierung,<br />
der IT-Abbau und die Räumung des Schulgebäudes dar. Die Schüler-<br />
und Lehrerbibliothek wurde neu inventarisiert und zur Übergabe an<br />
LTT Praxis <strong>Seeland</strong> bereit gemacht. Sie übernahmen auch einiges an<br />
Mobiliar, der Rest musste verkauft, verschenkt (z.B. an Schulen) oder<br />
entsorgt werden. Eine fast unerschöpfliche Aufgabe, so schien es; Dennoch<br />
am 31. Oktober 2011 um 11 Uhr waren wir zur Abnahme des<br />
Schulhauses und zur Abgabe der Schlüssel bereit.<br />
Von nun an gehen die Teammitglieder inklusive Sachbearbeiterinnen ihre<br />
eigenen Wege, sei es weiter am BZ Pflege, an der BFH oder in der<br />
Praxis. – Es war eine gute Zeit!<br />
Rita Brunner, Leiterin Schulort Biel-<strong>Seeland</strong><br />
Biel, 31. 10. 2011<br />
23
Nachruf Minna Spring<br />
„Ich habe Vertrauen in die jungen Menschen!“<br />
Minna Spring erzählt aus ihrem Leben.<br />
Ich habe Jahrgang 1922. Ursprünglich hatte<br />
ich den Wunsch Handarbeitslehrerin zu werden.<br />
Ich habe am Seminar in Thun eine Prüfung<br />
abgelegt und bestanden und hatte schon<br />
meinen Studienplatz.<br />
Aber da ich bei Schulaustritt noch keine 16<br />
Jahre alt war, empfahl mir die Schulleiterin<br />
am Seminar Thun ein Zwischenjahr einzulegen.<br />
Ich fand eine Stelle in Genf, im Hôpital<br />
Butigny. Da ich in diesem ersten Praktikumsjahr<br />
gelegentlich auf den Abteilungen des<br />
Spitals arbeiten durfte und mir diese Tätigkeit sehr gut gefiel, erwachte in<br />
mir der Wunsch den Pflegeberuf zu ergreifen. Ich blieb zwei Jahre in<br />
Genf und ging dann nach Bern ins Diakonissenhaus. Nach einem Vorkurs<br />
begann meine Lehrzeit. Das war 1941, mitten im Krieg. Schon im<br />
zweiten Lehrjahr wurden wir Schülerinnen in auswärtige Spitäler geschickt.<br />
Ich kam, da ich gut Französisch sprach, in die bilingue Stadt<br />
Biel. Das Pasquart-Spital, damals eine chirurgische Klinik, wurde mein<br />
Arbeitsplatz. Die Stadt Biel hat mir damals überhaupt nicht gefallen. Ich<br />
hatte durchaus nicht die Absicht da zu bleiben.<br />
Die Bieler Schule wurde 1947 gegründet. Kurz zuvor hatte das Diakonissenhaus<br />
meine Versetzung nach Interlaken veranlasst. Dr. Huber, den<br />
ich schon im Pasquart kennen gelernt hatte, hat nun eine Anfrage an das<br />
Diakonissenhaus gestellt, ob ich nicht nach Biel zurückkommen könnte.<br />
Dieser Wunsch wurde respektiert. Um mich auf meine neue Tätigkeit<br />
vorzubereiten, besuchte ich das Fortbildungsseminar (Höhere Fachschule)<br />
in Zürich.<br />
1956 wurden alle Diakonissen aus den Spitälern und Schulen zurück ins<br />
Diakonissenhaus gezogen. Ich hätte also die Bieler Schule verlassen<br />
müssen. Ich war aber in der Zwischenzeit Schulleiterin geworden, alles<br />
war gut eingespielt und lief wunderbar. Ich fühlte mich in Biel zu Hause.<br />
Ich gab den Austritt aus der Diakonie, um weiterhin in der Schule tätig<br />
sein zu können. Nach dem Austritt aus der Diakonie wurde ich in Biel als<br />
Schuloberin eingesetzt.<br />
In den 70iger Jahren ist Vieles anders geworden, besonders im Bildungswesen.<br />
Ich war 54 und hatte den Wunsch, mich zu verändern, so-<br />
24
lange dies noch möglich war, darum habe ich meine Stelle als Schuloberin<br />
gekündigt.<br />
Die Stadt Biel hat ein neues Alters- und Pflegeheim am Redernweg gebaut.<br />
Ich wurde angefragt, ob ich die Leitung dieses Heims übernehmen<br />
würde. Ich habe zugesagt. Ich bin in eine Wohnung an der Lienhardstrasse<br />
gezogen, weil ich Tag und Nacht erreichbar sein musste. Ich<br />
hatte den Posten einer Heimleiterin inne. In den folgenden acht Jahren<br />
hatte ich ein erfülltes und interessantes Berufsleben. Es war eine schöne,<br />
aber kampfvolle Zeit. Ich schaue gerne zurück.<br />
Ich habe mich im Jahr 1983, mit einundsechzig Jahren, pensionieren<br />
lassen Nun endlich konnte ich lang Erwünschtes verwirklichen.<br />
Als erstes bin ich gleich sieben Wochen nach Indonesien (in den Vogelkopf)<br />
geflogen. Leider habe ich von dort die Malaria mit nach Hause genommen...<br />
Als ich mich wieder einigermassen erholt hatte, habe ich in Brighton<br />
(England) eine Sprachschule besucht. Noch einmal erlebte ich das Zusammenleben<br />
von jung und alt in derselben Klasse. Es war eine sehr<br />
schöne Zeit.<br />
Im Jahr 1985 bin ich mit drei Kolleginnen, nach Amerika gereist. Wir fuhren<br />
mit dem Auto von Denver nach Las Vegas. Von dort aus bin ich allein<br />
nach Kanada weitergereist. Später habe ich diese Reisen wiederholt.<br />
Ich bin fünfmal in Amerika gewesen, habe viele Menschen kennen<br />
gelernt und, als ich wieder hier war, viel Besuch aus Amerika bekommen.<br />
Ich habe Vieles nachgeholt, habe noch Klettern gelernt und Gletscherwanderungen<br />
unternommen.<br />
Manchmal macht es mir Kummer, dass heute sich alles so schnell verändert.<br />
Aber ich habe Vertrauen in die jungen Menschen.<br />
Ausschnitte aus dem Interview aus dem Jahre 2006<br />
Neues aus dem SZB<br />
Liebe <strong>Ehemaligen</strong>, wieder war viel los im SZB. Ich versuche hier mit einigen<br />
Beiträgen aus den „à propos“ des Jahres 2010 dies zu spiegeln.<br />
In diesem Jahr standen vor allem die Vorbereitungen zur Einführung von<br />
SwissDRG und die damit zusammenhängende Neuorganisation im Vordergrund.<br />
Diese Änderungen lösen auch unter den Mitarbeitenden zum<br />
Teil Ängste und Ungewissheit aus.<br />
25
Gleiches Geld für gleiche Leistung<br />
Die Einführung von SwissDRG-Fallpauschalen im Rahmen der neuen<br />
Spitalfinanzierung soll helfen, die Gesundheitskosten zu senken. Die Risiken<br />
und Nebenwirkungen sind noch umstritten. Im Folgenden einige<br />
Meinungen dazu.<br />
Fallpauschalen:<br />
Die Sicht des ärztlichen Leiters und Chefarzt Chirurgie Prof. Dr. Urban<br />
Laffer:<br />
„Die zukünftige Verrechnung der Behandlungen und Eingriffe bei stationären<br />
Patienten mit SwissDRG-Fallpauschalen wird das gesamte Spitalwesen<br />
einschneidend verändern. Der positive Effekt vorneweg: Die<br />
Leistungen der Akutspitäler werden transparent und wir werden zu mehr<br />
Effizienz angespornt. Das heisst für uns, dass wir überprüfen müssen,<br />
wo und wie wir weitere Produktivitätssteigerungen ohne Qualitätseinbussen<br />
und ohne Beeinträchtigung unserer ethischen Überlegungen vornehmen<br />
können.<br />
Für mich sind Fallpauschalen weder gut noch schlecht, doch braucht es<br />
für die Umsetzung eine Übergangsfrist mit Übergangsbestimmungen.<br />
Auch wünsche ich mir eine Begleitforschung, um das Verhalten der Spitäler<br />
bei der Einführung des neuen Systems rasch zu erfassen. Wird es<br />
zu verfrühten Entlassungen kommen mit häufigen Wiedereintritten als<br />
Folge? Werden die Spitäler um die gewinnbringenden, risikoarmen Patienten<br />
buhlen und solche mit finanziellem Verlustrisiko gnadenlos abweisen?<br />
Diese Verhaltensforschung hätte meiner Meinung nach längst gestartet<br />
werden sollen.<br />
Es ist klar, dass dieses System zu einer Bereinigung der Spitallandschaft<br />
führt. Für gewisse Personen und Institutionen ist dieser Prozess anstrengend<br />
und schmerzhaft.“<br />
Gedanken zu den DRG aus Sicht von Miriam Etter Kommunikationsbeauftragte<br />
Personalkommission:<br />
„Auf die drei Buchstaben DRG reagieren so manche Mitarbeitende im<br />
Spital mit Unwille und Unbehagen; sind sie doch eng verknüpft mit der<br />
seit einiger Zeit herrschenden verschärften Kosten- und Produktivitätsorientierung<br />
der Geschäftsleitung. Die Vorbereitungen für die Verrechnung<br />
der Spitalleistungen mit dem SwissDRG-Tarifsystem ab Januar<br />
<strong>2012</strong> laufen auf Hochtouren: austretendes Personal wird nicht ersetzt,<br />
Stellen werden abgebaut, einigen Mitarbeitenden wurde gekündigt, Bettenabteilungen<br />
wurden zur Effizienzsteigerung zusammengelegt, mit<br />
weniger Personal werden mehr Patienten betreut, der Leistungsdruck<br />
steigt. Viele Mitarbeitende sind verunsichert. Sie fürchten um die Qualität<br />
ihrer Arbeit und den daraus folgenden Konsequenzen. Die Ansprüche<br />
26
werden hinunter geschraubt; man ist froh, wenn man nach Arbeitsschluss<br />
sagen kann, mir ist heute kein Fehler unterlaufen. Doch eigentlich<br />
möchten wir stolz sein auf unsere Tätigkeit, stolz auch auf unser Spital.<br />
Eigentlich ist SwissDRG-Fallpauschalen-Tarifsystem nur ein Instrument<br />
mit dem Ziel einer effizienten Verrechnung der Spitalleistungen,<br />
welche auf Kostenwahrheit basiert und den Vergleich unter den Spitälern<br />
erlaubt. Wie dieses Tarifsystem jedoch angewendet wird - welche Vorgaben<br />
uns die Regierung und die Geschäftsleitung auferlegt - darauf<br />
kommt es an. Folgeschäden, wie eine massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen,<br />
ständiger Personalmangel, hohe Qualitätseinbussen<br />
bei unseren Leistungen, Stress und Burnout möchten wir verhindern.<br />
Wir möchten deshalb für unsere Mitarbeitenden ein „Gefäss“ einrichten,<br />
in dem wir Erfahrungen, welche die befürchtete Entwicklung bestätigen,<br />
sammeln und dokumentieren. Falls Handlungsbedarf besteht, werden<br />
wir der Geschäftsleitung konkrete Lösungsvorschläge für flankierende<br />
Massnahmen unterbreiten.“<br />
Fallpauschalen: Die Sicht eines Konsiliararztes Walter Keller Facharzt<br />
für Gastroenterologie.<br />
„Ich glaube nicht, dass SwissDRG die Kosten unseres qualitativ hochstehenden<br />
Gesundheitswesens einzudämmen vermag. Das Outsourcing<br />
wird zu einem Kostenanstieg im ambulanten Bereich führen. Hinzu<br />
kommen die Kosten für den Ausbau des Verwaltungsapparates: die<br />
Löhne für die dringend benötigten medizinischen Codier-Spezialisten<br />
und jene für die Controller, welche die Arbeit der Codierer und die Abrechnung<br />
der Spitäler auf ihre Korrektheit überprüfen müssen. Wir können<br />
froh sein, wenn die Systemumstellung für das Schweizer Gesundheitswesen<br />
insgesamt kostenneutral über die Bühne gehen wird. Ein<br />
wirklich kostengünstigeres Gesundheitswesen erreichen wir erst dann,<br />
wenn wir bereit sind, auf vieles zu verzichten.“<br />
Metamorphose Neuorganisation <strong>2012</strong><br />
Auszüge von der Vorstellung der Neuorganisation von Marc Marthaler<br />
Kommunikationsbeauftragter im Spitalzentrum:<br />
Dass sich alles verändert, ist eine Binsenwahrheit. Sprüche wie „die Zeiten<br />
ändern sich“ sind Gemeingut, dennoch wecken bevorstehende Veränderungen<br />
oft Befürchtungen. Zunächst ist das Neue auch das Unbekannte<br />
und damit das Ungewisse. Und Ungewissheit löst Verunsicherungen<br />
aus, das ist verständlich. Jedoch wiegt man sich mit Aussagen<br />
wie „aber das haben wir schon immer so gemacht“ in trügerischer Sicherheit.<br />
Denn mit dem Festhalten an Althergebrachtem trägt man der<br />
Tatsache nicht Rechnung, dass sich ringsum alles wandelt.<br />
27
In einer Landschaft, die sich wirtschaftlich und gesundheitspolitisch stetig<br />
verändert, kann es sich ein Unternehmen wie das Spitalzentrum Biel<br />
nicht leisten, dem Wandel untätig zuzusehen. Daher ist die Neuorganisation<br />
keine Option, sondern schlicht unumgänglich. Vor allem aber sicher<br />
eine Chance, vorhandenes Optimierungspotential auszuschöpfen und<br />
dadurch die Zukunft des SZB als attraktives Spital und attraktiven Arbeitgeber<br />
zu sichern.<br />
Diese Neuorganisation betrifft allem voran die neuen medizinischen<br />
Strukturen. Die bisherigen <strong>18</strong> medizinischen Fachbereiche werden neu<br />
in den vier Departementen Chirurgie, Medizin, Frau&Kind und medizinische<br />
Dienste zusammengefasst.<br />
Die Leitungen der Departemente bestehen neu aus einem Chefarzt, einer<br />
Leiterin Pflege und einem Betriebswirtschafter. Pro Departement<br />
sind also drei massgebliche Interessen vertreten; die medizinischen, die<br />
pflegerischen und die wirtschaftlichen.<br />
Der Einsatz eines Betriebswirtschafters in einem medizinischen Führungsgremium<br />
mag auf den ersten Blick irritieren. Aber es ist kein Geheimnis,<br />
dass Leistungserbringer im Gesundheitswesen einem zunehmenden<br />
Effizienzdruck gewachsen sein müssen.<br />
Die Gefahr, dass der Patient durch dieses stärkere Augenmerk der Medizin<br />
auf wirtschaftliche Aspekte und der medizinischen Behandlung<br />
nicht mehr im Zentrum stehen könnte, besteht nicht. Denn mit der freien<br />
Spitalwahl unterliegt auch das SZB den Spielregeln der Marktwirtschaft.<br />
Und wenn es nicht möglich ist, gleiche Qualität zu günstigeren Preisen<br />
anzubieten, so bleibt nur die Möglichkeit, zu gleichen Preisen bessere<br />
Qualität zu bieten und der Konkurrenz damit den Rang abzulaufen.<br />
Neue Organisation <strong>2012</strong> um die Anforderungen der Zukunft besser<br />
zu meistern.<br />
Auszüge aus dem Interview mit Bruno Letsch Vorsitzender der Geschäftsleitung<br />
- Was möchten Sie mit dieser Neuorganisation der medizinischen Bereiche<br />
erreichen?<br />
Jede Organisation muss sich immer wieder neu überlegen, wie sie ihre<br />
Aufgaben möglichst gut erfüllen kann. Mit neuen Organisationsstrukturen<br />
und Prozessverbesserungen wollen wir uns den Anforderungen der Zukunft<br />
anpassen.<br />
- Welche konkreten Vorteile bietet die neue Struktur?<br />
Indem wir Departemente mit Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten<br />
bilden, erwarten wir eine bessere Führung und die Förderung<br />
28
der interdisziplinären Zusammenarbeit. Damit sollen die Qualität und die<br />
Wirtschaftlichkeit erhöht werden.<br />
Hilfsbereitschaft nicht lehren, sondern erleben.<br />
Bei der ersten Kraniosynosthose-Operation in der Geschichte der Republik<br />
Moldawien waren auch vier Vertreter der Spitalzentrums Biel dabei.<br />
Der 4. Oktober war ein besonderer Tag für die Republik Moldawien.<br />
Erstmals wurde im ärmsten Land Europa eine Kraniosynosthose-<br />
Operation modern durchgeführt. Das Kind, erst <strong>18</strong> Monate alt, litt seit<br />
seiner Geburt an einer Schädeldeformation. Wäre sie nicht frühzeitig<br />
operiert worden, hätte sie zu einer geistigen Behinderung führen können.<br />
Im staatlichen Spital „Center of Mother an Child“ in der moldawischen<br />
Hauptstadt Chisinau wurde dem Kind in einem sechsstündigen Eingriff<br />
Teile der Schädeldecke entfernt und neu wieder eingesetzt, damit sich<br />
das Hirn weiter entwickeln kann.<br />
Das moldawische Ärzteteam wurde dabei von Kollegen aus Italien und<br />
der Schweiz unterstützt, darunter vier Vertreter des Spitalzentrums Biel:<br />
Markus Schily, Leitender Arzt Anästhesie, Markus Bittel, Chefarzt Kinderchirurgie,<br />
Josef Bielek, Oberarzt Kinderchirurgie sowie Eberhard Fink,<br />
Leiter zentraler Sterilgutversorgungs-Abteilung.<br />
Die Operation wurde auf Initiative des „International Anesthesia Teaching<br />
Center“ (IATC) durchgeführt. Das IATC will in Europa die Qualität<br />
und Sicherheit in der Anästhesie verbessern.<br />
Die IATC-Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Die Aktivitäten umfassen<br />
Ausbildung und die Weiterleitung von Sachspenden, die gerade in moldawischen<br />
Krankenhäusern weiterhin dringend notwendig sind.<br />
Für die einzigartige Aktion in Moldawien haben die vier Mitarbeitenden<br />
des Spitalzentrums Ferientage eingesetzt. Ein kleiner Preis, um einem<br />
Kind eine Zukunft zu schenken, so das Quartett.<br />
Dreifacher Vorteil<br />
Die Hausärzte der Stadt Biel und das Spitalzentrum betreiben seit dem 1<br />
April gemeinsam eine Notfallpraxis.<br />
Entstanden ist die Idee bereits vor rund zwei Jahren im Rahmen einer<br />
Arbeitsgruppe des Spitalzentrums. Das oberste Ziel war es, die Notfallstation<br />
zu entlasten. Heutzutage haben viele Leute keinen Hausarzt<br />
mehr und sie kommen in Eigenregie mit Problemen ins Spital, die sehr<br />
gut von einem solchen behandelt werden könnten. Dies führt zu einem<br />
grossen Patientenfluss, der zu lange Wartezeiten führt.<br />
„Es ist selbstverständlich, dass wir uns zuerst um die Patienten mit lebensbedrohenden<br />
Verletzungen oder Krankheiten kümmern müssen“<br />
erklärt Dr. Claudio Jenni, „ viele Menschen erwarten aber heutzutage,<br />
29
sofort behandelt zu werden.“ Deshalb suchte das Spitalzentrum die Zusammenarbeit<br />
mit den Hausärzten. Diese sind im Verein HAND (Hausarzt-Notfalldienst<br />
Biel/Bienne) zusammengeschlossen und bieten nun<br />
diesen Notfalldienst in der neu eröffneten Praxis im Spitalzentrum an.<br />
Dazu werden die rund 40 Generalisten in der neuen Notfallpraxis eingesetzt<br />
und zwar von Montag bis Freitag von 17 bis 22 Uhr sowie am Wochenende<br />
von 12 bis <strong>18</strong> Uhr.<br />
Das Spitalzentrum hat innerhalb des Notfallbereichs Räumlichkeiten eingerichtet.<br />
Die Patienten melden sich am Empfang der Notfallstation, wo<br />
sie administrativ erfasst werden. Eine Notfallpflegefachfrau nimmt anschliessend<br />
die Triage vor. Die Patienten mit leicht zu behandelnden<br />
Krankheiten oder Unfällen kommen zum Hausarzt in die Notfallpraxis. Ist<br />
der Hausarzt nach seiner Anamnese trotzdem der Meinung, der Patient<br />
gehöre auf die Notfallstation, kann er diesen direkt nach nebenan schicken.<br />
Die Notfallpraxis verfügt über eine eigene medizinische Praxisassistentin<br />
sowie ein eigenes Labor für die gängigen Analysen. Weiterführende Untersuchungen<br />
fordert der Hausarzt vom Zentrallabor des Spitalzentrums<br />
an. Gleich nebenan bestellt er eine Röntgenaufnahme im radiologischen<br />
Institut des Spitalzentrums. Ist er im Zweifel, kann der Allgemeinmediziner<br />
die Kollegen des Spitalzentrums um eine Zweitmeinung bitten.<br />
Gesunde Mitarbeitende<br />
Die Fachstelle für ergonomische Arbeitsplatzgestaltung des Spitalzentrums<br />
Biel wurde mit dem 3. Rang mit dem Preis „Gesundheit im Unternehmen“<br />
ausgezeichnet.<br />
Der Preis, der jährlich von der Sektion Schweiz der Europäischen <strong>Vereinigung</strong><br />
für Gesundheitsförderung im Unternehmen vergeben wird, wurde<br />
am 24. Januar in Bern übergeben.<br />
Bessere Kommunikation und weniger Stress dank Wandmalereien<br />
Die Stiftung ANOUK verschönert Spitäler und Heime visuell. Das neuste<br />
Werk: die Patientenzimmer der Kinderklinik.<br />
Kinder und Erwachsene in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen, so<br />
lautet das Ziel der Genfer Stiftung ANOUK.<br />
ANOUK, die Namensgeberin der Stiftung, ist die behinderte Tochter eines<br />
Gönnerpaares, welche der Stiftung kostenlos Büroräumlichkeiten zur<br />
Verfügung stellt. Die beiden freiberuflichen Künstler, Vanessa Friang aus<br />
Marseille und Grégory Reti aus Paris, sind nun bald zehn Jahre in dieser<br />
Mission tätig. Sie haben die ursprüngliche Stiftung mitgeprägt und die<br />
neue Stiftung ANOUK im April 2008 gegründet. Die beiden Geschäftsführerinnen<br />
Beatriz Aristimuno und Vanessa Radicati konnten bereits<br />
damals auf zehn erfahrene Künstlerinnen und Künstler aufbauen.<br />
30
Pro Jahr werden 30 bis 40 Projekte umgesetzt, in Europa und auch in<br />
Israel.<br />
Die beiden Geschäftsführerinnen sowie die beiden Künstler haben die<br />
Kinderklinik vor Malbeginn besucht und zusammen mit dem Pflegeteam<br />
die Sujets entwickelt. „Das Pflegeteam hat Kalligraphie gewünscht“, so<br />
die Künstler, „verbunden mit emotionalen Begriffen in Multikulti-<br />
Ausführung. Wir mussten auch darauf achten, dass wir mit unseren<br />
Werken sowohl Kleinkinder wie Jugendliche und deren Eltern ansprechen.<br />
Als Thema für die Zimmer wurden Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika<br />
gewählt. Ein Zimmer ist dem Ozean gewidmet und Nordund<br />
Südpol durften auch nicht fehlen. Kalligraphisch wurden die emotionalen<br />
Begriffe Glück, Freiheit, Freunde, Begegnung, Träume, Sonne<br />
umgesetzt. Gemalt haben die Künstler auf Leinwände in schmalem<br />
Querformat. Spitalschreiner Fritz Habegger hat die Werke so hoch an<br />
den Wänden angebracht, dass sie auch von liegenden Patienten im Bett<br />
gut betrachtet werden können.<br />
Leichter bewegen leichter Pflegen<br />
Seit zwei Jahren besuchen alle Pflegenden im Spitalzentrum einen<br />
Grundkurs in Kinaesthetics. Hier lernen sie unter anderem, die eigenen<br />
Bewegungsmuster besser wahrzunehmen. Durch diese Erfahrung fällt<br />
es ihnen leichter, Patienten zu unterstützen. Zu wissen, wie Statik, Kraft<br />
und Balance in der Bewegung zusammenspielen, öffnet ganz andere<br />
Perspektiven für Hilfestellungen zu mehr Mobilität.<br />
Heute verfügt im Spitalzentrum jede Abteilung über eine Fachverantwortliche<br />
Kinaesthetics, die einen Aufbaukurs absolviert hat und regelmässige<br />
Vertiefungsnachmittage zur Weiterbildung nutzt. Die Fachverantwortliche<br />
ist Ansprechperson für alle Pflegenden bei Fragen und Unsicherheiten.<br />
Sie überprüft laufend die Anwendung von Kinaesthetics im Pflegealltag,<br />
denn gemeinsam geht es leichter.<br />
Beitrag von Selma Müller<br />
Fehlzeiten vermindern, Belastungsfaktoren wahrnehmen<br />
Das Spitalzentrum Biel führt ein Absenzen-Management ein, um die<br />
Personalzufriedenheit zu steigern und die Kosten zu senken.<br />
Die Statistik belegt, dass den Schweizer Unternehmen durch Krankheit<br />
und Unfall ca. 170 Millionen Arbeitsstunden verloren gehen. Dies entspricht<br />
durchschnittlich sechs Krankheitstagen pro Person und Jahr. Das<br />
Spitalzentrum Biel weist im Vergleich mit andern Betrieben und Spitälern<br />
relativ hohe Absenzen aus. Sie liegen, je nach Monat, zwischen drei und<br />
fünf Prozent der Totalzeit. Durch Krankheit und Unfall fehlen dem Spitalzentrum<br />
durchschnittlich gegen 70 Mitarbeitende pro Arbeitstag. Die<br />
dadurch entstehenden Arbeitsausfälle müssen mehrheitlich durch die<br />
31
anwesenden Mitarbeitenden kompensiert werden, was zu starken Mehrbelastungen<br />
führt und die Gefahr weiterer Absenzen nach sich zieht.<br />
Deshalb steht für die Geschäftsleitung ganz oben auf der Prioritätenliste,<br />
mit einem sinnvollen Absenzen-Management die Kurzabsenzen zu verringern.<br />
Zu diesem Zweck wird im ganzen Spitalzentrum ein einheitliches<br />
System eingeführt. Neu durchlaufen alle Krankheits- und unfallbedingten<br />
Absenzen einen einheitlichen Prozess bezüglich Meldung und Vorgehensweise<br />
sowie unterstützenden Massnahmen. Bei Abwesenheit meldet<br />
sich der Mitarbeitende umgehend beim Vorgesetzten. Die beiden<br />
bleiben in Kontakt und planen gemeinsam die Rückkehr an den Arbeitsplatz.<br />
Bei längerer Absenz reicht der Mitarbeitende wie bisher nach fünf<br />
Tagen ein Arztzeugnis ein. Nach jeder Abwesenheit - unabhängig der<br />
Dauer - führt der Vorgesetzte mit dem Mitarbeitenden ein Gespräch.<br />
Sinn dieses sogenannten Rückkehrgesprächs ist es, den Mitarbeitenden<br />
willkommen zu heissen, sich nach seinem Wohlbefinden zu erkundigen<br />
und ihn über Vorkommnisse während seiner Abwesenheit zu informieren.<br />
Fehlt ein Mitarbeitender weniger als dreimal in sechs Monaten, wird<br />
das Rückkehrgespräch formlos, das heisst ohne schriftliches Protokoll<br />
geführt. Weist ein Mitarbeitender drei Absenzen in sechs Monaten bzw.<br />
fünf innerhalb von zwölf Monaten auf, führt der Vorgesetzte mit ihm ein<br />
Unterstützungsgespräch. Das Unterstützungsgespräch findet normalerweise<br />
am Tag der Wiederaufnahme der Arbeit statt, wird schriftlich festgehalten<br />
und unterschrieben. Der Mitarbeitende hat die Möglichkeit, die<br />
Gründe für sein mehrmaliges Fehlen darzulegen und gemeinsam mit<br />
dem Vorgesetzten Lösungen zu finden. Aus Sicht des Spitalzentrums<br />
geht es vor allem darum, zu klären, ob die häufigen Absenzen mit der<br />
Arbeitssituation zusammenhängen.<br />
Dies waren wieder einige Beiträge aus den “à propos“ 2011<br />
Ich wünsche euch allen ein gutes Jahr bis zum nächsten Bericht<br />
Gruss Heinz Bussinger<br />
„Schwelgen in Erinnerungen“ / Anlass 9. Mai <strong>2012</strong><br />
Der Vorstand der <strong>Ehemaligen</strong>-<strong>Vereinigung</strong> <strong>Pflegeberufsschule</strong> <strong>Seeland</strong><br />
hat sich entschlossen, die Schliessung unserer Schule im Oktober 2011<br />
nicht stillschweigend hinzunehmen. Es war schnell klar, dass es einen<br />
Anlass geben sollte. Aber was für ein Anlass und wie sollte der benannt<br />
werden? Von einem Fest mag niemand reden – zu gross sind die Ent-<br />
32
täuschung und teilweise auch der Schmerz. So sprechen wir vom „Anlass<br />
<strong>2012</strong>“, welcher den Namen „Schwelgen in Erinnerungen“ erhielt. Zu<br />
diesem Anlass sollen alle ehemaligen Lernenden und Studierenden ins<br />
Restaurant „Weisses Kreuz“ in Lyss eingeladen werden. Vorerst musste<br />
eine grosse Adressen-Suche gestartet werden. Naheliegend war, dass<br />
wir zuerst Kontakt mit der Schule aufnahmen. Dabei erhielten wir neben<br />
Adresslisten, welche leider nicht mehr alle aktuell waren, viele Fotos und<br />
Dokumente aus den Jahren 1947 bis 2011. Ebenso erfuhren wir, dass<br />
die Schulleitung den Auftrag erhalten hat, die Geschichte der Schule<br />
aufzuarbeiten.<br />
Ein Team von <strong>Ehemaligen</strong> investierte viele, viele Stunden, um die Adressen<br />
aller Kurse zu aktualisieren. Leider war es bei einigen Kursen<br />
unmöglich die nötigen Unterlagen zu erhalten.<br />
Die Fotos und Dokumente wurden gesichtet und sortiert. Welch ein<br />
Schatz ist da vorhanden! So viel Material liegt einfach in einer Kiste und<br />
ist für niemanden einsehbar. Wir schwelgten wirklich in Erinnerungen<br />
und kamen zur Überzeugung, dass diese umfangreichen und wertvollen<br />
Unterlagen allen Interessierten zugänglich gemacht werden müssen. So<br />
entstand die Idee ein Buch zu machen. Die Schulleitung war von der<br />
Idee angetan und versprach uns, die geschriebene Geschichte zur Verfügung<br />
zu stellen. Diese stellt den ersten Teil unseres Buches dar. Im<br />
zweiten Teil werden von der <strong>Ehemaligen</strong>-<strong>Vereinigung</strong> die Dokumente<br />
und Fotos platziert. Zu finden sind in diesem zweiten Teil zum Beispiel:<br />
Die Kursunterlagen der Schülerinnen des ersten Kurses aus dem Jahre<br />
1947, die Verhandlungspapiere um die Rotkreuzanerkennung, Foto von<br />
Herrn Dr. Huber dem Schulgründer, Anstellungsvertrag und Fotos von<br />
Minna Spring, Schulhausneubau und Einweihung 1957, die diversen<br />
Diplombroschen, Fotos von den Gebäuden mit Innenräumen, verschiedene<br />
Werbeunterlagen, Zusammenschluss mit Aarberg, diverse Presseberichte<br />
gerade auch im Zusammenhang mit der Zentralisierung in Bern<br />
und Vieles mehr. Anhand der Offerte des Grafikers starteten wir die<br />
Spendensuche. Wir sind sehr glücklich und stolz, dass nicht zuletzt dank<br />
unseren treuen Vereinsmitgliedern die Finanzierung der Druckkosten<br />
des Buches sichergestellt werden konnte. UNSER Buch ist am Entstehen!<br />
An unserem Anlass „Schwelgen in Erinnerungen“ wird es veröffentlicht<br />
unter dem Titel<br />
„Geschichte der Pflegeausbildungen im <strong>Seeland</strong>“<br />
1947 bis 2011<br />
ergänzt durch Dokumente und Fotos<br />
33
Selbstverständlich wird es vor Ort zum Kauf angeboten.<br />
Diese Buchvernissage wird auf dem Programm einen wichtigen Platz<br />
einnehmen. Weiter werden verschiedene Personen, welche einen Abschnitt<br />
des Schullebens begleitet haben, auftreten. Ehemalige sorgen für<br />
die musikalische Umrahmung. Ein feines Essen wird nicht fehlen. Natürlich<br />
werden wir an dieser Stelle nicht schon alles ausplaudern. Es soll<br />
auch noch Überraschungen geben.<br />
Wir wünschen uns, am 9. Mai <strong>2012</strong> mit möglichst vielen <strong>Ehemaligen</strong> in<br />
Erinnerungen schwelgen zu können.<br />
Der Vorstand<br />
34
Spenden verdanken<br />
Liebe Ehemalige<br />
Wir danken euch allen herzlich, dass ihr unserem Spendenaufruf für die<br />
Druckkosten des Buches über unsere <strong>Pflegeberufsschule</strong> so grosszügig<br />
gefolgt seid. Wir haben gemeinsam fast Fr. 4‘500.—gesammelt!<br />
Mit eurem wertvollen Beitrag können wir dieses wichtige Projekt realisieren.<br />
Dies ist nicht nur ein Stück Bieler Geschichte, sondern für uns Pflegende,<br />
die im <strong>Seeland</strong> ihre Ausbildung genossen haben, ein Stück Lebensgeschichte.<br />
Zudem soll dieses Buch junge Menschen aus dem <strong>Seeland</strong><br />
motivieren, die Ausbildung zu einem der spannenden Pflegeberufe<br />
zu ergreifen und in Biel zu arbeiten.<br />
Der Vorstand<br />
Erklärung zum Mitgliederbeitrag<br />
Durch die Aufforderung den Mitgliederbeitrag bereits bis im Oktober dieses<br />
Jahres zu begleichen, statt wie bisher bis zum 5. März des kommenden<br />
Jahres, sind teilweise Missverständnisse entstanden. Dies bedauern<br />
wir sehr! Darum kommen wir noch einmal in dieser Bielerpost darauf<br />
zurück. Bekanntlich dauert unser Vereinsjahr vom 1. September bis<br />
31. August. Historisch bedingt wurde der Mitgliederbeitrag bisher erst 6<br />
Monate nach Beginn des neuen Vereinsjahres eingefordert. Nun haben<br />
wir uns entschieden, den Beitrag in Zukunft bei Beginn des Vereinsjahres<br />
in Rechnung zu stellen – zahlbar bis15. Oktober. Wir danken für ihr<br />
Verständnis.<br />
Der Vorstand<br />
35
Interview mit Erna und Irene Fiechter aus dem Kurs 1<br />
Kaum habe ich die Bahnhofshalle verlassen, spüre ich sie schon, die<br />
ganz spezielle, berauschende, billingue Bielerluft. Ich habe noch etwas<br />
Zeit und beschliesse, zu Fuss ins Beaumont zu gehen. Auf dem Weg<br />
vom Bahnhof ins Beaumont gibt es keine Strasse und keinen Platz, die<br />
nicht mit Erinnerungen verbunden sind. An der Zentralstrasse, zum Beispiel,<br />
gab es früher das „Café Libresso“. Dort wurden wir einmal höflich<br />
aber bestimmt aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Was zu diesem<br />
Rausschmiss führte, habe ich vergessen, so harmlos muss es gewesen<br />
sein. Vielleicht haben wir nur fünf- oder sechsstimmig gekichert und einen<br />
seriöseren Gast gestört und vergrault.<br />
Bei der Mühlebrücke stand damals eine Verkehrskanzel. Auf die ist Vreni<br />
K., „der Kunz“ genannt, einmal nach einem Kinobesuch gestiegen und<br />
hat den „Verkehr geregelt.“ Es war nach 22.00 Uhr und nicht mehr so<br />
viele Autos unterwegs, aber es ist ihr immerhin gelungen, die aus den<br />
verschiedenen Strassen kommenden Autos alle anzuhalten. Als sie bemerkte,<br />
was das Gefuchtel angerichtet hatte, verliess sie in Panik die<br />
Kanzel, lief durch die Schmiedegasse Richtung Leubringen-Bähnchen<br />
36
und verschwand in einem Gässchen der Altstadt. Wir, eine Clique von<br />
zehn oder mehr jungen Frauen, hatten die „Action“ mit begeisterten Zurufen<br />
angefeuert, standen nach dem abrupten Ende belämmert da und<br />
machten uns, nachdem ein Autofahrer Vorkehrungen traf, uns zur Rede<br />
zu stellen, schleunigst aus dem Staube. Kurz vor der Talstation des<br />
Bähnchens fanden wir wieder zusammen, keuchend, japsend, nach Luft<br />
schnappend und mit Tränen in den Augen. Wir hatten den ganzen Weg<br />
im Eiltempo zurückgelegt und dazu lauthals gelacht.<br />
Und in diesem Haus dort an der Obergasse, in der Nummer 5 oder war<br />
es die Nummer 7…?<br />
Vielleicht habe ich zu genüsslich in Erinnerungen geschwelgt, denn als<br />
ich im Personalrestaurant des Spitalzentrums ankomme, warten Erna<br />
und Irene und Margrit schon auf mich. Obschon ich den beiden Fiechters<br />
nie begegnet bin, habe ich das Gefühl, wir würden uns schon ewig kennen;<br />
am Tisch herrscht eine fröhliche, vertraute und herzliche Atmosphäre.<br />
Papiere und Schulhefte liegen bereit, die die beiden Frauen mitgebracht<br />
haben und ich bin versucht, mir eines herauszugreifen und mich<br />
fest zu lesen, nur ist dafür jetzt nicht die richtige Zeit.<br />
Margrit: Dass wir uns hier treffen, war auch Euer Wunsch. Mich dünkt<br />
das schön, dass ihr zurückgehen möchtet zu den Wurzeln und dass wir<br />
euch dabei begleiten dürfen. Ihr seid beide über 80 Jahre alt?<br />
Erna: Wir sind 82 und 83 Jahre.<br />
Margrit: Ich nehme an, ihr habt beide mit 19 Jahren die Ausbildung begonnen?<br />
Irene: Nein, ich war noch keine <strong>18</strong> und das war das Problem beim Roten<br />
Kreuz. Ich habe meine Lehre mit 17 Jahren und neun Monaten begonnen.<br />
Margrit: Dann gehen wir nun zurück in das Jahr 1947. Warum habt ihr<br />
ausgerechnet Biel als Ausbildungsstätte gewählt?<br />
Erna: Es wurde wohl in den Zeitungen bekannt gegeben, es war die erste<br />
Schule in der Schweiz, in der man kein Schulgeld bezahlen musste.<br />
Irene: Und es war die erste Schule, in der man mit <strong>18</strong> Jahren die Ausbildung<br />
beginnen konnte. In der Pflegerinnenschule (dr Pflägi) in Zürich<br />
musste man damals ein oder sogar zwei Jahre älter sein.<br />
Erna: Bei mir waren die Finanzen der Grund …<br />
Irene: … und bei mir das Alter.<br />
Erna: Ich hatte eine Schwester in der Pflegerinnenschule in Zürich. Sie<br />
sagte zu mir: Aber nein, du gehst doch nicht in so eine nichtsnutzige<br />
Schule, die noch gar nicht richtig strukturiert ist?! Sie konnte mich nicht<br />
von meinem Entschluss abbringen. Meine Schwester musste Geld verdienen<br />
und sparen für die Pflegerinnenschule.<br />
Irene: Ich bin im Kanton Tessin in die Schule gegangen und mein<br />
(schriftliches) Deutsch war mangelhaft. Ich dachte, in Biel, der billinguen<br />
37
Stadt, würde man es verstehen, wenn meine Schriftsprache zu wünschen<br />
übrig liesse.<br />
Margrit: Und warum habt ihr gerade diesen Beruf gewählt:<br />
Irene: Ich hatte im „Leben und Glauben“ einen Artikel und ein Inserat gelesen…<br />
Erna: … und ich hatte zuerst eine Lehre als Keramikmalerin begonnen,<br />
dann ging ich ein Jahr zu einer Haut-Couturière nach Zürich, aber das<br />
war eine böse Lehrmeisterin und mein Vater hat mich dort herausgeholt,<br />
er hat mich gerettet. Dann hatte ich eben die Schwester, in der Pflegerinnenschule<br />
und eine andere Schwester, die nach der Ausbildung zur<br />
Zahntechnikerin noch die Hebammenschule machte. Da es den beiden<br />
gefiel, dachte ich, ich kann es ja auch versuchen und gratis ist es auch<br />
noch.<br />
Irene: Ich war vor der Ausbildung immer zu Hause, machte das Büro und<br />
den Haushalt, einen Geschäftshaushalt, und meine Eltern fanden das<br />
gut so. Sie dachten, ich würde ja dann einmal heiraten … Man sagte mir,<br />
dir gäbe man am besten ein Retourbillet!<br />
Margrit: Und jetzt gehen wir wirklich zum Anfang zurück und ich will von<br />
euch wissen, ob ihr eine Aufnahmeprüfung machen musstet?<br />
Erna: Nein, wir mussten keine Eintrittsprüfung ablegen, aber es gab eine<br />
Probezeit.<br />
Irene: 6 Monate.<br />
Erna: Nach sechs Monaten wurde eine von unserem Kurs als zu wenig<br />
begabt befunden und weggeschickt.<br />
Margrit: Und die Theorie? Wurde die Ausbildung von Anfang an von einem<br />
Theoriekurs begleitet?<br />
Erna: Von Anfang an.<br />
Margrit: Wer waren die Dozenten?<br />
Irene: Die Assistenzärzte…<br />
Erna: … und später die Spezialisten, Neurologen, Gynäkologen, Kinderärzte<br />
…<br />
Margrit: … und Doktor Huber?<br />
Erna: Doktor Huber war Schulleiter und gab keine Kurse.<br />
Irene: Und natürlich die Diakonissen. Alles, was Ethik betraf und die<br />
Pflege am Krankenbett.<br />
Margrit: Die Diakonissen waren bestimmt sehr gute Lehrmeisterinnen …<br />
Erna: Sehr. Beruflich waren alle sehr gut. Daneben … es waren halt<br />
eben auch Menschen …<br />
Margrit: Und hattet ihr auch praktischen Unterricht? Wo war das Schulzimmer<br />
mit dem Bett?<br />
Irene: Das Theorieschulzimmer war im Neuhaus und dort stand ein Bett.<br />
Margrit: Und wann trat Schwester Minna in Aktion?<br />
Erna: Schwester Minna kam erst …<br />
38
Irene: … im dritten Lehrjahr…<br />
Erna: Genau. Das war, glaube ich, vor unserer Diplomierung.<br />
Margrit (zusammenfassend): Die praktische Ausbildung fand also vor allem<br />
am Patientenbett stand. So waren die Anfänge.<br />
Irene: Es wurde viel medizinisches Wissen und viel Ethik vermittelt.<br />
Erna: Ethik bei Schwester Ida Schütz. Ida Schütz war unsere Schulschwester,<br />
eine sehr gute Lehrerin.<br />
Irene: Und die oberste Leitung war Schwester Esther, Schwester Esther<br />
Gerber.<br />
Margrit: Fällt euch noch etwas Prägendes aus dieser ersten Zeit ein?<br />
Irene: Die Disziplin. Die grosse Disziplin. Abends um zehn Uhr war Lichterlösch.<br />
Erna: Dennoch, wir waren alle von Anfang an begeistert.<br />
Margrit: Es gab also um zehn Uhr Lichterlösch. Wohl nicht unbegründet,<br />
denn man musste früh aufstehen. Wie war so ein Tagesablauf?<br />
Irene: Die Arbeit begann um sechs. Unser Bett musste gemacht sein und<br />
das Zimmer aufgeräumt. Frühstück um acht. Die Oberschwester griff in<br />
die Tasten und alle mussten am Platz sein.<br />
Margrit: Das Frühstück begann mit einem Lied und einer Andacht?<br />
Irene: Genau. Wenn man zu spät dran war, musste man draussen das<br />
Ende der Andacht abwarten.<br />
Erna: Beim Essen sass die Schulschwester an unserem Tisch und so<br />
wurden wir auch mit Tischmanieren geschult. Von der Brotscheibe durfte<br />
nicht abgebissen werden. Schön ein Bröckli nach dem anderen abbrechen!<br />
Und so kam unsere liebe Schulschwester Ida zu ihrem Übernahmen:<br />
das Bröckli.<br />
Irene: Nach dem Frühstück ging die Arbeit im Spital weiter bis am Mittag.<br />
Mittagspause nach dem Essen eine Stunde. Am Nachmittag fand der<br />
Schulunterricht im Neuhaus statt. Zum Nachtessenverteilen ging man<br />
wieder auf die Abteilung und arbeitete bis 20.00 Uhr.<br />
Margrit: Ein sehr strenger Tag, körperlich war man sehr gefordert…<br />
Beide: Ja. Es gab auch viel anstrengende Putzarbeit zu erledigen, dies<br />
gehörte einfach dazu.<br />
Margrit: Und wie stand es mit dem Lohn?<br />
Erna: Im ersten Lehrjahr hatten wir dreissig Franken Lohn pro Monat,<br />
plus Kost und Logis, minus AHV. Es war das Jahr 1947, die AHV war<br />
gerade eingeführt worden.<br />
Gina: Und wie ging es am Abend weiter, wenn die Arbeit beendet war?<br />
Erna: Hausaufgaben. Man musste viel büffeln.<br />
Irene: Wir sassen oft im Schulzimmer und schrieben. Wir wohnten ja im<br />
Schulhaus, im Neuhausgut, in Zweier- und Dreierzimmern und hatten es<br />
da oft auch lustig, sehr lustig…<br />
Margrit: Ihr wart ja Lernende, hattet ihr eine Begleitung?<br />
39
Irene: Eigentlich nicht.<br />
Erna: „Lehrmeisterinnen“ hatten wir schon. Die Diakonissen waren unsere<br />
Lehrmeisterinnen. Das dritte Lehrjahr absolvierten wir in Thun. Hier<br />
passierte das Unglück: eine Kurskollegin, Bea, verletzte sich an einem<br />
Schnepper, der nur mangelhaft im Äther desinfiziert worden war und holte<br />
sich die infektiöse Gelbsucht. Sie starb innerhalb zwei Wochen. Das<br />
war für uns eine sehr schlimme Zeit. Sie war für uns ein Familienmitglied,<br />
ihr Tod war unfassbar und unnötig. Das war im Februar und im April<br />
hatten wir die Abschlussprüfung.<br />
Bevor wir nach Biel zurückkehrten sagte uns die Thunerschulschwester,<br />
die Thunerschule würde vom SRK anerkannt. Die Bielerschule hätte diese<br />
Anerkennung noch nicht beantragt und würde nur von der Sanitätsdirektion<br />
anerkannt werden. Wir müssten etwas unternehmen, damit wir<br />
die SRK-Anerkennung auch bekämen. So unternahm ich eines Tages<br />
eine Reise nach Biel, zu Dr. Huber. Aber er hat nichts unternommen<br />
oder es war zu spät. Wir wollten unbedingt die Anerkennung, denn wir<br />
hatten ja das gleiche geleistet wie unsere Kolleginnen in Thun.<br />
Irene: Vor der Abschlussprüfung hatten wir einen Monat Repetitionskurs<br />
in Biel. Da wurde nochmals eifrig die Theorie durchgenommen.<br />
Erna: Und am Schluss wurde das Examen abgenommen und das war<br />
dermassen hochgesteckt! Was wir alles wissen mussten! Man sagte uns<br />
immer: ihr müsst gut sein, ihr baut die Schule auf! Ein Arzt hat uns nach<br />
den Examen gesagt, das sei ja Wahnsinn, das seien ja Ärzteexamen.<br />
Aber dennoch bekamen wir die Anerkennung nicht. Dann kam Schwester<br />
Minna als Schulschwester in die Schule und ab ihrem Eintritt wurde<br />
die Schule in Biel vom SRK anerkannt. Aber von uns wurde verlangt,<br />
dass wir ein Jahr repetieren müssten, um die Anerkennung zu erlangen.<br />
Das war zuviel. Ich war sehr erbost und habe mich geweigert. Nach all<br />
dem, was wir leisten mussten! Ich wollte endlich arbeiten gehen und<br />
nicht nochmals ein Jahr grundlos wiederholen.<br />
Irene: Ich habe den Repetitionskurs auch nicht gemacht, aber eine von<br />
unserem Kurs, Ruth Hänni, hat ihn absolviert.<br />
Margrit: Es ist dokumentiert, dass du dich im Tiefenauspital beworben<br />
hast und…<br />
Erna: Jawohl, ich habe die Stelle nicht bekommen, weil ich „nur“ ein von<br />
der Sanitätsdirektion ausgestelltes Diplom vorzuweisen hatte.*<br />
Margrit: Eine Zwischenfrage, habt ihr beide euch nach dem Diplom getrennt?<br />
Irene: Wir waren noch fast ein Jahr gemeinsam im Zieglerspital Bern, wo<br />
man uns als Ferienablösung angestellt hatte. Wir waren verpflichtet, ein<br />
Jahr im Kanton Bern zu arbeiten, da der Kanton unsere Ausbildung finanziert<br />
hatte. Ich bin das ganze Jahr dort geblieben. Du hast etwas früher<br />
aufgehört…<br />
40
Erna: Als alle aus den Ferien zurückgekehrt waren, sagte uns die Oberschwester,<br />
sie hätte, aus finanziellen Gründen, nur eine Stelle zu vergeben.<br />
Aber sie habe gehört, in Genf, im Kantonsspital sei eine Stelle frei.<br />
Ich ging also nach Genf.<br />
Irene: Und ich bin noch in Bern geblieben und ging danach an die Uniklinik<br />
(damals noch Kantonsspital) nach Zürich. Diese Rotkreuz-Anerkennung<br />
stand in Zürich an der Uniklinik nie zur Diskussion und ich hatte<br />
den gleichen Lohn wie die Kolleginnen von der Pflägi.<br />
Erna: In Genf habe ich mich verlobt und musste dann zwecks Heirat<br />
nach Bern zurückzukehren. Ich meldete mich im Tiefenauspital und dort<br />
kam das angeblich mangelhafte Diplom zur Sprache. Ich bekam keine<br />
Anstellung. Im Zieglerspital wurde ich jedoch mit Freuden wieder in das<br />
Pflegeteam aufgenommen. Zwar hatte ich weniger Lohn als in Genf und<br />
auch eine Stunde weniger frei pro Tag. Nach der Diplomierung betrug<br />
der Durchschnittslohn hundertachzig Franken und Kost und Logis.<br />
Irene: Ich arbeitete im Unispital Zürich als ich heiratete. Ich war 24 Jahre<br />
alt. Als die Kinder kamen pausierte ich sechs Jahre und ging dann zurück<br />
auf den Beruf. Ich arbeitete Teilzeit auf der Chirurgie und konnte die<br />
Kinder als Nachtwache mit ins Spital nehmen. Sie übernachteten in einem<br />
Ärztezimmer. Ich wurde nicht eingearbeitet. Ich bekam am ersten<br />
Abend vor der Nachtwache Rapport und das war`s dann.<br />
Erna: Es war damals wie es heute wieder ist: man sprach von Sparmassnahmen<br />
und es herrschte Mangel an diplomierten Krankenschwestern.<br />
Beispiel Zieglerspital: Die Frischdiplomierten mussten nach Feierabend<br />
im Ops assistieren, dann warten bis die Patienten aufgewacht waren<br />
und das konnte dauern mit den damaligen Narkosen, und am Morgen<br />
mussten sie um sechs wieder zum Dienst erscheinen, egal wie lange<br />
sie in der Nacht noch gearbeitet hatten. Am Tag arbeiteten die<br />
Schwestern allein mit einer Hilfe auf einer Abteilung von zwanzig Patienten.<br />
Eine grosse Überforderung!<br />
Irene: Ich machte dann in der Uniklinik noch die Zusatzausbildung in Intensivpflege.<br />
Diese Ausbildung war recht happig. Ich habe immer auf<br />
dem Beruf gearbeitet, zuletzt im medizinischen Zentrum von Hotel Hof<br />
und Quellenhof in Bad-Ragaz. Im Quellenhof verkehrten die Reichen<br />
und die Promis aus der ganzen Welt. Ich habe Könige und Bundeskanzler<br />
betreut… Der Quellenhof lieferte die Garderobe, stellte eine eigene<br />
Wohnung zur Verfügung und bot die Gelegenheit Kosmetik- und Weiterbildungskurse<br />
zu besuchen. Ich arbeitete bis zum Alter von 63 Jahren<br />
und war, in der ersten Zeit nach der Pensionierung enttäuscht, unausgelastet<br />
und traurig. Aber dann begann ich mich wieder zu freuen, über unser<br />
Ferienhaus in Sedrun, über die langen Wanderungen mit meinem<br />
Mann in den Bündnerbergen, über das Beeren- und Pilzsuchen, über die<br />
Reisen in die weite Welt…<br />
41
Erna: Ab 1958 lebte ich mit meiner Familie während 16 Jahren wieder in<br />
Genf. Als die Kinder gross genug waren, arbeitete ich teilweise wieder im<br />
Hòpital Cantonal und gelegentlich als Quartierkrankenschwester. Letzteres<br />
brauchte allerdings eine Bewilligung des Kantons Genf. Also wieder<br />
einmal Anträge stellen und Bewilligungen einholen! Auch machte ich<br />
während ein paar Jahren wöchentlich eine Nachtwache bei einem Privatpatienten.<br />
1974 zog ich, aus beruflichen Gründen meines Mannes,<br />
nach Bern zurück und in der freiwilligen Betagtenhilfe gestaltete sich<br />
mein Leben langsam ruhiger.<br />
Margrit: Und jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen, in der Zeit<br />
danach. Wie geht es euch heute?<br />
Irene: Ich wurde noch lange immer wieder angefragt, ob ich nicht schnell<br />
zurückkommen könnte, ins Hotel, wenn etwas los war. Ich bin froh, dass<br />
ich noch Zeit bekommen habe, für meine Kinder und Schwiegerkinder,<br />
meine Enkel und Urenkel…<br />
Erna: Der Tod meines Mannes vor fünf Jahren hat mein Lebensglück<br />
geschmälert. Dank meiner Familie und guten Freunden wurde ich jedoch<br />
bis jetzt vor Vereinsamung bewahrt, dank guter Gesundheit gehöre ich<br />
immer noch zu den „rüstigen Senioren.“ Dankbar schaue ich auf mein<br />
reiches Leben zurück. Ein Lichtpunkt in den zahlreichen Jahren war<br />
auch meine Zeit in der Pflegerinnenschule des Bezirksspitals in Biel. Und<br />
nun schaue ich mit Spannung, was mein letztes Wegstück für mich noch<br />
bereit hält.<br />
Die Ausbildung zur „Pflegefachfrau“ im Bezirksspital Biel<br />
vor der Schulgründung 1947<br />
Im Jahresbericht des Spitals wird 1910 erstmals eine „Lehrtochter“<br />
erwähnt. Mit Ausnahme der Jahre 1926-1931 werden dann jeweils bis<br />
zur Schulgründung „Lehrtöchter“ in den Jahresberichten aufgeführt.<br />
1932 werden vier „Pflegelehrtöchter“ erwähnt und im Jahr 1937 ein<br />
neuer Lehrplan.<br />
1910 waren für die Spitalpatienten (60 Betten und 20 Betten im Asyl<br />
[=Nachbargebäude] rund 20 Personen angestellt:<br />
12 Diakonissen aus der Anstalt Dändliker-Schnell in Bern (später<br />
SALEM)<br />
1 Rotkreuz-Wärterin<br />
1 Köchin<br />
4 Hausmägde<br />
42
2 Wärter (zugleich Hausknechte)<br />
In diesem Jahr wurden gesamthaft 937 Patienten mit einer durchschnittlichen<br />
Aufenthaltsdauer von 32 Tagen (!) im Spital gepflegt.<br />
Ein Pflegetag kostete damals<br />
Fr. 2.86.<br />
Fr. 1.067 für das Essen<br />
Fr. 0.26 für Medikamente und Verbandsmaterial<br />
Fr. 1.533 für Pflege und medizinische Behandlung<br />
(gemäß Statistik aus dem Jahresbericht des Spitals von 1923)<br />
Mir liegen drei Ausbildungsverträge aus der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts<br />
vor:<br />
05.11.1915 mit Louise Brand von Saanen<br />
15.11.1935 mit Hanna Jakob von Dürrenroth<br />
<strong>18</strong>.03.1939 mit Anna Aeschbacher von Hindelbank<br />
Vertrag über die Ausbildung einer Krankenpflege-Schülerin im Bezirksspital<br />
zu Biel vom 05.11.1915 von Louise Brand aus Saanen<br />
Der Vertrag wurde zwischen dem „Komitee für Krankenpflege des bernischen<br />
Ausschusses für kirchliche Liebestätigkeit“ (=Verein der reformierten<br />
Landeskirche Bern der sich im Sozial- und Gesundheitswesen betätigte)<br />
und der „Direktion des Bezirksspitales in Biel“ abgeschlossen und<br />
von Louise Brand unterzeichnet.<br />
Demnach übergab das „Komitee für Krankenpflege“ der „Direktion des<br />
Bezirksspitales in Biel“ die 22-jährige Louise Brand von Saanen für 1 ½<br />
Jahre zur Erlernung der Krankenpflege unter den nachstehenden Bedingungen:<br />
Art.1 [Dauer]<br />
Die Lehrzeit dauert 1½ Jahre. Der erste Monat gilt als Probezeit. Innerhalb<br />
derselben steht es beiden Parteien frei, von dem Vertrage zurückzutreten.<br />
In einem solchen Fall kommt dem Spital eine Entschädigung<br />
für den Unterhalt der Lehrtochter von Fr. 2.- per Tag zu.<br />
Art.2 [Lehrgeld]<br />
Die Letztere [Louise Brand] hat dem Spital für Verköstigung und Wohnung<br />
im Spital während der ersten zwölf Monate der Lehrzeit Fr. 200.-<br />
zu entrichten, zahlbar zur Hälfte beim Eintritt, zur Hälfte nach sechs Monaten<br />
Lehrzeit. Nach dem Probemonat Austretende haben keinen Anspruch<br />
auf Rückerstattung, sofern nicht wichtige Gründe den Austritt be-<br />
43
dingt haben. Im dritten Halbjahr erhält die Schülerin einen Lohn von<br />
Fr. 30.- per Monat.<br />
Art.3 [Ausbildungsinhalte]<br />
Die Spitaldirektion bietet der Schülerin eine sachgemäße Ausbildung in<br />
der Krankenpflege nach der theoretischen und praktischen Seite.<br />
Sie wird darauf halten, dass Frl. Louise Brand durch die Spitalärzte und<br />
die Oberschwester oder eine der andern Schwestern die nötigen Stunden<br />
in Anatomie, Physiologie, Hygiene, Pflege und Ernährung der Kranken<br />
und über erste Hülfe bei Unglücksfällen erhält. Sie wird auch bei den<br />
Ortsgeistlichen die nötigen Schritte tun, damit die Schülerin in einigen<br />
Stunden über die religiös-sittlichen Pflichten einer Krankenpflegerin orientiert<br />
werde.<br />
Die Schülerin ist nach und nach in allen Spitalabteilungen, inklusive Absonderung,<br />
im Operationssaal und bei den Nachtwachen zu beschäftigen.<br />
Art.4 [Freizeit / Krankheit / Arbeitskleidung]<br />
Der Schülerin kommt täglich eine Freistunde zum Ergehen in frischer<br />
Luft zu. Ebenso hat sie das Recht auf möglichste Sonntagsruhe und einen<br />
freien halben Tag in der Woche. Nach vollzogener Nachtwache ist<br />
ihr am folgenden Tage ausreichende Gelegenheit zum Nachschlafen zu<br />
bieten. Bei Erkrankung gewährt derselben das Spital unentgeltlich Verpflegung<br />
und ärztliche Behandlung während der Dauer mindestens eines<br />
Monates.<br />
Über die mitzubringende Kleiderausstattung hat sie sich vorher mit der<br />
Oberschwester zu verständigen.<br />
Art.5 [Abschlussprüfung]<br />
Nach Absolvierung des Kurses hat sich die Schülerin einer Prüfung zu<br />
unterwerfen, welche von Abgeordneten des Komitees in Verbindung mit<br />
den Spitalbehörden und –Ärzten vorgenommen wird. Von dem Erfolge<br />
dieser Prüfung hängt die Erteilung eines Ausweises über ihre Befähigung<br />
zur Krankenpflege ab.<br />
Art.6 [Pflichten]<br />
Die Schülerin, Frl. Louise Brand verpflichtet sich, den Aufgaben ihres<br />
neuen Berufes gewissenhaft nachzukommen, den Anordnungen ihrer<br />
Vorgesetzten pünktlich Folge zu leisten, in der Pflege der Kranken die<br />
größte Treue zu beweisen und ihr möglichstes zu tun, um die Zufriedenheit<br />
der Spitalleitung zu erwerben und eine tüchtige Krankenpflegerin zu<br />
werden.<br />
44
Art.7 [Konfliktregelung]<br />
Anstände zwischen der Spitalleitung und der Schülerin sind in erster Linie<br />
unter den Beteiligten beizulegen. Sollte dies nicht ohne weiteres<br />
möglich sein, so ist die Angelegenheit durch je einen Vertreter der Spitaldirektion<br />
und des Krankenpflegekomitees zu erledigen.<br />
Art.8 [Unterschriften]<br />
Bemerkungen:<br />
Die Spitalärzte und die Oberschwester waren angehalten den Lernenden<br />
die notwendigen theoretischen Kenntnisse zu vermitteln und die Ortsgeistlichen<br />
hatten die Aufgabe die Schülerinnen über die „religiössittlichen<br />
Pflichten einer Krankenpflegerin“ zu orientieren (Art. 3). Welche<br />
religiös-sittlichen Pflichten wurden wohl vor 100 Jahren von einer Krankenpflegerin<br />
gefordert?<br />
Bemerkenswert erscheint mir auch die sehr unbestimmte Regelung,<br />
dass nach der Nachtwache „ausreichend Gelegenheit zum Nachschlafen“<br />
gewährt werden musste (Art. 4). Wie viele Stunden waren das wohl?<br />
Bei den Abschlussprüfungen (Art.5) wird die Oberschwester nicht mehr<br />
erwähnt. Offensichtlich traute man den Spitalbehörden und Spitalärzten<br />
mehr zu die Absolventin als Pflegefachperson zu beurteilen!<br />
Die Schülerin hatte sich weiter zu verpflichten (Art.6) in der Pflege der<br />
Kranken die größte Treue zu beweisen und ihr möglichstes zu tun, um<br />
die Zufriedenheit der der Spitalleitung zu erwerben!<br />
Im Jahr 1920 verlangte das Diakonissenhaus Bern vom Spital Biel für<br />
jede Schwester:<br />
regelmäßige, zusammenhängende Ruhepausen (Nachtruhe) von<br />
10 Stunden<br />
1 freier Nachmittag pro Woche<br />
1 Freitag pro Monat<br />
4 Wochen Urlaub pro Jahr<br />
1923 beschließt die Spitalkommission dem Abkommen das der Ausschuss<br />
für kirchliche Liebestätigkeit mit den Bezirksspitälern Burgdorf,<br />
Interlaken, Langenthal und Thun betreffs Platzierung und Ausbildung von<br />
Lehrtöchtern abgeschlossen haben, beizutreten.<br />
Der Verfasser des Jahresberichtes bemerkt dazu: „Die Zentralisierung in<br />
einem der Bezirksspitäler wäre zwar vorzuziehen da nur so alleine eine<br />
nach einheitlichen Grundsätzen erfolgende Ausbildung ermöglicht würde.<br />
Jedoch ist auch hier das Bessere der Feind des Guten.“<br />
45
Ausbildungsvertrag des Bezirksspitals Biel mit Fräulein Hanna Jakob<br />
von Dürrenroth vom 15.11.1935<br />
Der Vertrag wurde im Namen des Bezirksspitals vom Verwalter und der<br />
Lehrtochter unterzeichnet.<br />
Art.1 [Dauer]<br />
Neu dauert die Lehrzeit 2 Jahre. Ebenfalls neu wird geregelt: „Wenn<br />
bei einer Lehrtochter nach dem abgelaufenen Probemonat Charakterfehler<br />
oder gesundheitliche Mängel beobachtet werden, welche nach Ansicht<br />
der Verwaltung eine ersprießliche Beendigung der Lehrzeit in Frage<br />
stellen, so ist die Spitalverwaltung auch nach der Probezeit berechtigt,<br />
das Vertragsverhältnis auf 4 Wochen zu kündigen.<br />
Art.2 [Lehrgeld]<br />
Neu wurde das Lehrgeld auf Fr. 300.- angehoben. Der Lohn im<br />
2.Lehrjahr blieb jedoch bei Fr. 30.- pro Monat!<br />
Art.3 [Ausbildungsinhalte]<br />
Neu wird die Lehrtochter nur noch durch die Spitalärzte! in Anatomie,<br />
Physiologie, Hygiene, Pflege und Ernährung der Kranken…unterrichtet.<br />
Art. 4 [Abschlussprüfung]<br />
Neu besteht die Möglichkeit ein „Diplom“ zu erwerben. Dazu musste die<br />
ausgebildete Pflegerin noch ein drittes, sogenanntes „Ausbildungsjahr“ in<br />
einem anderen Spital des Kantons Bern machen. Ausnahmsweise konnte<br />
die Absolvierung des Ausbildungsjahres an einem ausserkantonalen<br />
Spital gestattet werden. Der Lohn des Ausbildungsjahres betrug bei freier<br />
Station (=Kost und Logis) monatlich Fr. 60.-<br />
Art. 5 [Pflichten]<br />
Neu wird die Lehrtochter zur Wahrung des beruflichen Geheimnisses<br />
verpflichtet.<br />
Art. 6 [Freizeit]<br />
Die tägliche Freistunde zum „Ergehen in frischer Luft“ wird nicht mehr<br />
erwähnt.<br />
Art. 7 [Neu: Absenzenregelung]<br />
Wird die 2 jährige Lehrzeit durch Krankheit oder aus anderen Gründen<br />
länger als 4 Wochen unterbrochen, so muss die gesamte ausfallende<br />
Zeit vor Erteilung der Examenbescheinigung nachgeholt werden. Zwei<br />
46
oder mehrere Pausen werden zusammengerechnet. Die Ferien sind davon<br />
nicht berührt.<br />
Art. 8 [Neu: Ferienregelung/Arbeitskleidung]<br />
Die Lehrtochter hat im ersten Lehrjahr 2 Wochen und im zweiten 3 Wochen<br />
Ferien.<br />
Die Lehrtochter hat genügend weiße Ärmelschürzen mitzubringen. Die<br />
zu tragenden weißen Häubchen werden vom Spital geliefert. Ärmelschürzen<br />
und Häubchen werden im Spiral gewaschen.<br />
Lehrvertrag des Bezirksspitals Biel mit Fräulein Anna Aeschbacher<br />
von Hindelbank vom <strong>18</strong>.03.1939<br />
Es ist ein unveränderter Vertrag wie vor vier Jahren.<br />
Der Mangel an (ausgebildetem) Personal macht sich dann vor allem<br />
während des 2. Weltkrieges (1939-1945) bemerkbar.<br />
Dies führte dazu, dass 1946 erstmals ausländische Hilfskräfte und Krankenschwestern<br />
angestellt wurden.<br />
Im gleichen Jahr erwarb das Spital das sogenannte Neuhausgut im<br />
Beaumont für die Eröffnung der Pflegerinnenschule 1947. Als erste<br />
„Schulschwester“ wird Ida Schütz angestellt welche 1950 durch Minna<br />
Spring (1922-2011) ersetzt wurde.<br />
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt maximal 60 Stunden. In der<br />
Regel 58 Stunden.<br />
4 Wochen Ferien pro Jahr<br />
Kein Lehrgeld mehr!<br />
Lohn: 1.Lehrjahr: Fr. 40.-<br />
2.Lehrjahr: Fr. 60.-<br />
3.Lehrjahr: Fr. 80.-<br />
Mindestalter: 19 jährig<br />
Peter Schranz, Kurs 26<br />
47
Klasse-Egge<br />
Eintritte<br />
02.12.2010 Pfäffli-Schär Margrit, Dählenweg 41, 2503 Biel<br />
Kurs 31<br />
11.01.2011 Frau Berta Zbinden, Altersheim Bühli, 8755 Ennenda<br />
Kurs 9<br />
27.04.2011 Monika Aeschlimann, Beundenweg 1, 2560 Nidau<br />
Kurs 33<br />
17.06.2011 Suter Omejc Mojca, Obermattstr. 8, 2575 Täuffelen<br />
Kurs 38<br />
16.08.2011 Wolf-Hesse Anna Marie, Ahornstrasse 1,<br />
DE 47509 Rheurdt, Kurs <strong>18</strong><br />
Austritte<br />
März 2011 Lucie Schmied, stv. Schulleiterin Biel-Aarberg<br />
März 2011 Bernadette Perrot, Kurs D 09 per 31.08.11<br />
April 2011 Lüem-Langenegger Käthi, Kurs 10 per 31.08.11<br />
April 2011 Lehmann Helen, Kurs C05 per 31.08.11<br />
Juni 2011 Käthi Hertig-Rüfli, Kurs 17 per 31.08.11<br />
Verstorben<br />
25.03.2011 Brigitte Bittner-Fluri, Weststrasse 28, 3005 Bern,<br />
Kurs 21<br />
29.04.2011 Spring Minna, Alters- und Pflegeheim Cristal, 2503 Biel,<br />
erste Schulleiterin<br />
25.05.2011 Graf-Joss Erika, Traubenquartier 2a, 8586 Erlen, Kurs 9<br />
Adressänderungen<br />
Gautschi-Gerber Claudia, Wannenfluhstr. 12, 3770 Zweisimmen,<br />
Kurs 42<br />
Susanne Hermann, Zentrum für Langzeitpflege, Mühlestr.11, 2504 Biel,<br />
Kurs <strong>18</strong><br />
Schlup-Hostettler Ruth, Eikerstrasse 8, 4325 Schupfart, Kurs 32<br />
Weber Kislig Susanne, Föhrenweg 8, 45428 Zuchwil, Kurs 39<br />
Geiser-Gylan Vreni, Bachmatte 6, 1716 Oberschrot Plaffeien, Kurs 4<br />
48
Adressverzeichnis Vorstand EVPBS<br />
Präsidentin: Margrit Lüthi-Zürcher 031 701 20 42 P Kurs 11<br />
Höheweg 12<br />
031 701 36 40 Fax<br />
3507 Biglen 079 795 14 82 N<br />
ma.luethi@bluemail.ch<br />
Vizepräsident: Werner Egloff 031 747 03 53 P Kurs 28<br />
Süri 88<br />
031 740 11 17 G direkt<br />
3204 Rosshäusern 031 740 11 11 G Zentrale<br />
079 372 86 84 N<br />
werner.egloff@bz-laupen.ch<br />
Sekretariat: Waltraud Salzmann 032 653 20 13 Kurs 42<br />
Finkenweg 2<br />
wa.salzmann@bluewin.ch<br />
2543 Lengnau<br />
Protokoll- Gina Gähwiler 062 964 17 33 P Kurs 16<br />
führung: Hubachschächli 114 gaehwilerwerner@bluewin.ch<br />
3465 Dürrenrot<br />
Kassier: Peter Schranz 079 216 01 57 N Kurs 26<br />
Hohlenrain 8<br />
peter.schranz@bluemail.ch<br />
3238 Gals<br />
Redaktion Priska Lörtscher-Egli 032 389 21 02 Kurs 33<br />
Bielerpost Sonnhalde 6 priska.loertscher@bluewin.ch<br />
Website: 3250 Lyss<br />
Mitglied: Vreni Meier-Gugger 032 396 26 83 P Kurs 16<br />
Rütistrasse 1<br />
078 824 30 38 N<br />
2575 Hagneck meier-vr@bluewin.ch<br />
Rechnungs- Sonja Hari-Boss 061 411 37 48 Kurs 15<br />
Revisorin: Plantanenweg 8<br />
4142 Münchenstein<br />
Rechnungs- Anne-Marie Gehri-Aerni 032 396 36 66 Kurs 10<br />
Revisorin: Hauptstrasse 9a pam.gehri@bluewin.ch<br />
2575 Gerolfingen<br />
Ersatz-Revisor: Marcel Iseli 032 342 25 71 Kurs 41<br />
Forellenweg 16<br />
2504 Biel<br />
49