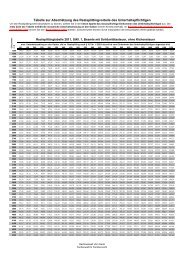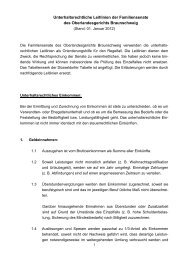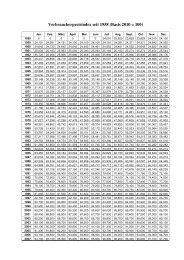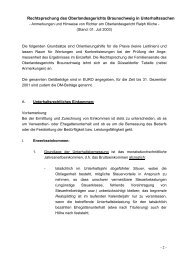Rechtsprechung FamRB-Beratungspraxis
Rechtsprechung FamRB-Beratungspraxis
Rechtsprechung FamRB-Beratungspraxis
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
104 <strong>Rechtsprechung</strong> 4/2010<br />
Unterhaltsrecht<br />
709 =61)könne die Klägerin durch eine ihr zumutbare<br />
eigene Erwerbstätigkeit decken.<br />
Konsequenzen für die Praxis: Der BGH festigt seine<br />
<strong>Rechtsprechung</strong> zur Bedarfsbemessung im Rahmen des<br />
§1615l BGB.<br />
Der Bedarf richtet sich allein nach der tatsächlichen Lebensstellung<br />
(§1610 Abs. 1BGB) des kinderbetreuenden<br />
Elternteils. Die Höhe der Einkünfte des anderen Elternteils<br />
ist auch im Fall eines (früheren) Zusammenlebens<br />
nicht bedarfsprägend. Soweit der besser verdienende<br />
Partner durch Leistungen im Rahmen einer nichtehelichen<br />
Lebensgemeinschaft den Lebensstandard des<br />
anderen Partners hebt, wird dies rechtlich nicht geschuldet<br />
und kann deshalb auch eine rechtlich gesicherte Lebensstellung<br />
des anderen Partners (i.S.d. §1610 Abs. 1<br />
BGB) nicht begründen (vgl. hierzu eingehend BGH v.<br />
16.12.2009 –XII ZR 50/08, FamRZ 2010, 357 m. Anm.<br />
Maier =<strong>FamRB</strong> 2010, 69).<br />
„Unterste Schwelle‘‘ für den Bedarf ist das (in Höhe des<br />
notwendigen Selbstbehalts für nicht Erwerbstätige –zzt.<br />
770 –pauschalierbare) Existenzminimum, weil ein unter<br />
dem Existenzminimum angesetzter Bedarf die im<br />
Einzelfall notwendige persönliche Kindesbetreuung<br />
nicht sichern würde.<br />
Beraterhinweis: Für die Höhe des Bedarfs ist nicht die<br />
Lebensstellung, die der kinderbetreuende Elternteil ohne<br />
die Geburt des Kindes erreicht hätte, sondern nur die Lebensstellung,<br />
die dieser zum Zeitpunkt der Geburt tatsächlich<br />
erreicht hatte, maßgeblich. Die durch die Geburt<br />
verursachten Nachteile in der beruflichen Entwicklung<br />
werden somit –anders als beim nachehelichen Unterhalt<br />
–nicht ausgeglichen.<br />
Die Sicherung des Existenzminimums (als Untergrenze<br />
des Bedarfs) durch den Unterhaltspflichtigen kann nur<br />
verlangt werden, solange eine Unterhaltsberechtigung<br />
nach §1615l Abs. 2Satz 2BGB dem Grunde nach noch<br />
besteht, also den kinderbetreuenden Elternteil noch keine<br />
vollschichtige Erwerbsobliegenheit trifft. Ein bereits<br />
vollschichtig erwerbspflichtiger Elternteil ist bereits dem<br />
Grunde nicht mehr unterhaltsberechtigt, auch wenn er –<br />
beispielsweise bei einer Tätigkeit im Niedriglohnsektor –<br />
ein das Existenzminimum übersteigendes Einkommen<br />
nicht erzielen kann,<br />
Das Existenzminimum ist als Untergrenze des Unterhaltsbedarfs<br />
jedenfalls für den Unterhalt nach §1615l<br />
BGB, den nachehelichen Betreuungsunterhalt nach<br />
§1570 BGB und den Trennungsunterhalt wegen der Betreuung<br />
eines Kindes zu beachten. Obder BGH seine<br />
<strong>Rechtsprechung</strong> zum Mindestselbstbehalt auch auf andere<br />
nachehelichen Unterhaltstatbestände ausweiten wird<br />
(was den Spielraum für Befristungen und Herabsetzungen<br />
nach §1578b BGB erheblich einengen würde), ist<br />
zurzeit noch unklar.<br />
„Nach oben‘‘ ist die Höhe des Unterhaltsanspruchs nach<br />
§1615l BGB durch die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen<br />
begrenzt. Dieser kann dem Berechtigten<br />
einen Selbstbehalt von 1.000 entgegenhalten. Zudem<br />
muss ihm aufgrund des Halbteilungsgrundsatzes die<br />
Hälfte des Gesamteinkommens beider Parteien verbleiben<br />
(BGH v. 15.12.2004 –XII ZR 121/03, <strong>FamRB</strong> 2005,<br />
97 =FamRZ 2005, 442 f.).<br />
RiOLG Andreas Wagner, Düsseldorf<br />
Zu dem weiteren in der Entscheidung angesprochenen Aspekt der<br />
Verlängerung des Betreuungsunterhalts nach §1615l BGB über<br />
das dritte Lebensjahr des Kindes hinaus s. nachstehend.<br />
Verlängerung des Anspruchs auf Betreuungsunterhalt<br />
nach §1615l BGB<br />
Betreuungsunterhalt nach §1615l Abs. 2BGB<br />
kann aus kindbezogenen oder elternbezogenen<br />
Gründenüber das dritte Lebensjahr des Kindes<br />
hinaus verlängert werden. Gründe, die für eine<br />
Verlängerung der Unterhaltsdauer sprechen, sind<br />
vomBerechtigten vorzutragen.<br />
BGH, Urt. v. 13.1.2010 –XII ZR 123/08<br />
(OLG Köln –25UF4/08)<br />
BGB §1615l<br />
Bestell-Nr.: FE-02948<br />
Das Problem: Die Parteien haben von 1997 bis 2004 in<br />
nichtehelicher Lebensgemeinschaft zusammengelebt.<br />
Aus der Verbindung ist im Jahr 2000 ein Kind hervorgegangen,<br />
für dessen Betreuung die Klägerin Unterhalt<br />
nach §1615l BGB für die Zeit ab April 2004 beansprucht.<br />
Die Klägerin, die §1615l BGB (in seiner Fassung<br />
vor und nach der Unterhaltsrechtsreform) für verfassungswidrig<br />
hält, hat bewusst darauf verzichtet, Gründe<br />
für eine Verlängerung der Unterhaltsdauer über den<br />
gesetzlich vorgesehenen Basiszeitraum von drei Jahren<br />
hinaus vorzutragen.<br />
Die Entscheidungdes Gerichts: Die Instanzgerichte haben<br />
die Unterhaltsklage abgewiesen. Diese Entscheidung<br />
hat der BGH auf die Revision der Klägerin bestätigt.<br />
Nach Ansicht des BGH bleibt für Unterhaltsansprüche<br />
vor dem 1.1.2008 die alte Fassung des §1615l BGB anwendbar.<br />
Das BVerfG habe die frühere Regelung des<br />
§1615l Abs. 2BGB allein gem. Art. 6Abs. 5GGwegen<br />
gleichheitswidriger Behandlung des nachehelichen Betreuungsunterhalts<br />
mit dem Unterhalt wegen Betreuung<br />
eines nichtehelich geborenen Kindes für verfassungswidrig<br />
erklärt, aber ausdrücklich erklärt, dass sie bis zur Beseitigung<br />
dieses verfassungswidrigen Zustands hinzunehmen<br />
sei (BVerfG v.28.2.2007 –1BvL 9/04, <strong>FamRB</strong><br />
2007, 226 =FamRZ 2007, 965). Die zeitliche Begrenzung<br />
des Unterhaltsanspruchs auf i.d.R. drei Jahre sei<br />
zudem vom BVerfG nicht beanstandet worden.<br />
Die Klägerin trage die Darlegungs- und Beweislast für<br />
die Voraussetzungen einer Verlängerung des Betreuungsunterhalts,<br />
habe aber kind- oder elternbezogene Gründe<br />
nicht vorgetragen. Verlängerungsgründe seien deshalb<br />
nur zu berücksichtigen, soweit sie auf der Grundlage des<br />
festgestellten Sachverhalts auf der Hand lägen. Nach<br />
dem festgestellten Sachverhalt habe die Klägerin mit<br />
dem Beklagten und dem gemeinsamen Kind dreieinhalb<br />
Jahre als Familie zusammengelebt, wodurch ein Vertrauen<br />
der Klägerin begründet worden sei. Im Ergebnis treffe<br />
die Klägerin eine Erwerbsobliegenheit, die im streitbe-