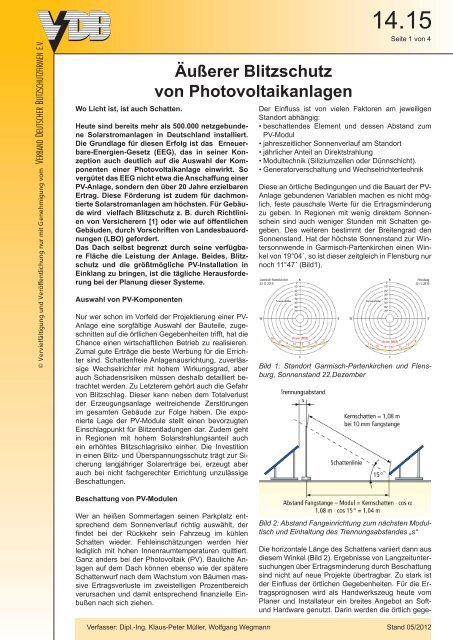ÃuÃerer Blitzschutz von Photovoltaikanlagen
ÃuÃerer Blitzschutz von Photovoltaikanlagen
ÃuÃerer Blitzschutz von Photovoltaikanlagen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
14.15<br />
Seite 1 <strong>von</strong> 4<br />
Wo Licht ist, ist auch Schatten.<br />
Äußerer <strong>Blitzschutz</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Photovoltaikanlagen</strong><br />
Heute sind bereits mehr als 500.000 netzgebundene<br />
Solarstromanlagen in Deutschland installiert.<br />
Die Grundlage für diesen Erfolg ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz<br />
(EEG), das in seiner Konzeption<br />
auch deutlich auf die Auswahl der Komponenten<br />
einer Photovoltaikanlage einwirkt. So<br />
vergütet das EEG nicht etwa die Anschaffung einer<br />
PV-Anlage, sondern den über 20 Jahre erzielbaren<br />
Ertrag. Diese Förderung ist zudem für dachmontierte<br />
Solarstromanlagen am höchsten. Für Gebäude<br />
wird vielfach <strong>Blitzschutz</strong> z. B. durch Richtlinien<br />
<strong>von</strong> Versicherern [1] oder wie auf öffentlichen<br />
Gebäuden, durch Vorschriften <strong>von</strong> Landesbauordnungen<br />
(LBO) gefordert.<br />
Das Dach selbst begrenzt durch seine verfügbare<br />
Fläche die Leistung der Anlage. Beides, <strong>Blitzschutz</strong><br />
und die größtmögliche PV-Installation in<br />
Einklang zu bringen, ist die tägliche Herausforderung<br />
bei der Planung dieser Systeme.<br />
Der Einfluss ist <strong>von</strong> vielen Faktoren am jeweiligen<br />
Standort abhängig:<br />
• beschattendes Element und dessen Abstand zum<br />
PV-Modul<br />
• jahreszeitlicher Sonnenverlauf am Standort<br />
• jährlicher Anteil an Direktstrahlung<br />
• Modultechnik (Siliziumzellen oder Dünnschicht).<br />
• Generatorverschaltung und Wechselrichtertechnik<br />
Diese an örtliche Bedingungen und die Bauart der PV-<br />
Anlage gebundenen Variablen machen es nicht möglich,<br />
feste pauschale Werte für die Ertragsminderung<br />
zu geben. In Regionen mit wenig direktem Sonnenschein<br />
sind auch weniger Stunden mit Schatten gegeben.<br />
Des weiteren bestimmt der Breitengrad den<br />
Sonnenstand. Hat der höchste Sonnenstand zur Wintersonnwende<br />
in Garmisch-Partenkirchen einen Winkel<br />
<strong>von</strong> 19°04´, so ist dieser zeitgleich in Flensburg nur<br />
noch 11°47´ (Bild1).<br />
Auswahl <strong>von</strong> PV-Komponenten<br />
Nur wer schon im Vorfeld der Projektierung einer PV-<br />
Anlage eine sorgfältige Auswahl der Bauteile, zugeschnitten<br />
auf die örtlichen Gegebenheiten trifft, hat die<br />
Chance einen wirtschaftlichen Betrieb zu realisieren.<br />
Zumal gute Erträge die beste Werbung für die Errichter<br />
sind. Schattenfreie Anlagenausrichtung, zuverlässige<br />
Wechselrichter mit hohem Wirkungsgrad, aber<br />
auch Schadensrisiken müssen deshalb detailliert betrachtet<br />
werden. Zu Letzterem gehört auch die Gefahr<br />
<strong>von</strong> Blitzschlag. Dieser kann neben dem Totalverlust<br />
der Erzeugungsanlage weitreichende Zerstörungen<br />
im gesamten Gebäude zur Folge haben. Die exponierte<br />
Lage der PV-Module stellt einen bevorzugten<br />
Einschlagpunkt für Blitzentladungen dar. Zudem geht<br />
in Regionen mit hohem Solarstrahlungsanteil auch<br />
ein erhöhtes Blitzschlagrisiko einher. Die Investition<br />
in einen Blitz- und Überspannungsschutz trägt zur Sicherung<br />
langjähriger Solarerträge bei, erzeugt aber<br />
auch bei nicht fachgerechter Errichtung unzulässige<br />
Beschattungen.<br />
Bild 1: Standort Garmisch-Partenkirchen und Flensburg,<br />
Sonnenstand 22.Dezember<br />
Beschattung <strong>von</strong> PV-Modulen<br />
Wer an heißen Sommertagen seinen Parkplatz entsprechend<br />
dem Sonnenverlauf richtig auswählt, der<br />
findet bei der Rückkehr sein Fahrzeug im kühlen<br />
Schatten wieder. Fehleinschätzungen werden hier<br />
lediglich mit hohen Innenraumtemperaturen quittiert.<br />
Ganz anders bei der Photovoltaik (PV). Bauliche Anlagen<br />
auf dem Dach können ebenso wie der spätere<br />
Schattenwurf nach dem Wachstum <strong>von</strong> Bäumen massive<br />
Ertragsverluste im zweistelligen Prozentbereich<br />
verursachen und damit entsprechend finanzielle Einbußen<br />
nach sich ziehen.<br />
Bild 2: Abstand Fangeinrichtung zum nächsten Modultisch<br />
und Einhaltung des Trennungsabstandes „s“<br />
Die horizontale Länge des Schattens variiert dann aus<br />
diesem Winkel (Bild 2). Ergebnisse <strong>von</strong> Langzeituntersuchungen<br />
über Ertragsminderung durch Beschattung<br />
sind nicht auf neue Projekte übertragbar. Zu stark ist<br />
der Einfluss der örtlichen Gegebenheiten. Für die Ertragsprognosen<br />
wird als Handwerkszeug heute vom<br />
Planer und Installateur ein breites Angebot an Softund<br />
Hardware genutzt. Darin werden die örtlich gege-<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Klaus-Peter Müller, Wolfgang Wegmann Stand 05/2012
14.15<br />
Seite 2 <strong>von</strong> 4<br />
Äußerer <strong>Blitzschutz</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Photovoltaikanlagen</strong><br />
benen Bedingungen und Einflüsse berücksichtigt. Die<br />
Auswirkung der linearen Schattenbildung <strong>von</strong> Bauteilen,<br />
z. B. bei Fangstangen, kleiner 1 cm Ø sind jedoch<br />
nicht immer hinterlegt. Zu gering ist deren Einfluss.<br />
Bild 3: Sonnenstände und durch die Fangstange erzeugter<br />
Schattenverlauf im Winter<br />
Bild 3 zeigt zudem, dass diese Schattenbildung außerhalb<br />
der Mittagszeit durch den dann jeweils steileren<br />
Einfallswinkel abnimmt beziehungsweise nicht mehr<br />
wirksam ist. Der Mechanismus verstärkt sich in den<br />
ertragsstarken Sommermonaten. Die schematische<br />
Kreisfläche, welche den Schatten einer Fangstange<br />
über den Tagesverlauf abbildet, verformt sich im Sommer<br />
immer weiter zu einer Ellipse. Zur Mittagszeit treffen<br />
die Schatten unmittelbar hinter der Fangstange auf<br />
(Bild 4).<br />
Hotspots gefährden PV-Zellen<br />
Eine Besonderheit der Photovoltaik ist die hohe Wirkung<br />
<strong>von</strong> punktuellen Kernschatten auf die Gesamtleistung<br />
des Systems [2]. Die serielle Verschaltung der<br />
Zellen und auch der Module zur Spannungserhöhung<br />
trägt bei lokaler Verschattung jedoch auch zur Leistungsreduzierung<br />
bei. Die sogenannte „Rückwärtsspannung“<br />
in einer Solarzelle, welche durch die Teilbeschattung<br />
hervorgerufen wird, ist hierfür die Ursache.<br />
Diese „Rückwärtsspannung“ (bis ca. 7 V) ergibt<br />
zusammen mit dem Stromfluss eine resultierende Verlustleistung.<br />
Diese wird als Verlustwärme in der Zelle<br />
umgesetzt. Addiert mit der Energie der Solarstrahlung<br />
selbst, bei gleichzeitig hohen Umgebungstemperaturen,<br />
ist dies die beste Grundlage zur Entstehung <strong>von</strong><br />
Hotspots. Diese punktuellen Übertemperaturen können<br />
zu irreparablen Schädigungen der Module führen.<br />
Seitens der Modulhersteller wird diesem Risiko,<br />
vornehmlich bei kristalliner Siliziumtechnik, mittels<br />
Bypassdioden entgegengewirkt. Sie begrenzen die<br />
Rückwärtsspannung auf z. B. 0,7 V und umgehen damit<br />
die gefährdenden Verlustleistungen.<br />
Beiblatt 5 zur <strong>Blitzschutz</strong>norm DIN EN 62305 Teil 3 [3]<br />
In dieser im September 2009 neu erschienenen Ergänzung<br />
sind zahlreiche Informationen zum Blitz- und<br />
Überspannungsschutz für PV-Stromversorgungssysteme<br />
zu finden. So werden darin die genormten Methoden<br />
wie Maschen- und Schutzwinkelverfahren und<br />
auch das Blitzkugelverfahren genannt. Letzteres wird<br />
meist mit Fangstangen und / oder Fangspitzen realisiert<br />
(Bild 5, Bild 6).<br />
Bild 4: Sonnenstände und durch die Fangstange erzeugter<br />
Schattenverlauf im Sommer<br />
Die Bilder 3 und 4 zeigen im Vergleich sehr deutlich,<br />
dass die Schattenbildung im Winter wesentlich ausgeprägter<br />
ist als im Sommer. Erkennbar ist dies an der<br />
Größe des Kernschattenbereiches. Für die Ertragsreduzierung<br />
durch Schattenbildung ist dieser Umstand<br />
aber eher positiv zu bewerten, da in den Monaten<br />
November bis Januar üblicherweise weniger als 10<br />
% des Ertrages erzeugt wird. In den ertragsstarken<br />
Monaten ist die Schattenbildung wesentlich geringer<br />
ausgeprägt.<br />
Bild 5: Planung einer <strong>Blitzschutz</strong>anlage mit Hilfe des<br />
Blitzkugelverfahrens<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Klaus-Peter Müller, Wolfgang Wegmann Stand 05/2012
14.15<br />
Seite 3 <strong>von</strong> 4<br />
Äußerer <strong>Blitzschutz</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Photovoltaikanlagen</strong><br />
Bild 6: Ermittlung Fangstangenhöhe und Abstand<br />
nach dem Blitzkugelverfahren entsprechend DIN EN<br />
62305 Teil 3<br />
Unabhängig da<strong>von</strong> ob der Trennungsabstand „s“ eingehalten<br />
werden kann, ist die primäre Aufgabe der<br />
Fangeinrichtung den direkten Blitzeinschlag, auch in<br />
die PV-Anlage zu verhindern. Das gilt für die Module,<br />
für die Verkabelung am Dach und für aufdachmontierte<br />
Wechselrichter und Generatoranschlusskästen<br />
(GAK). Die Fangstangen müssen, um dieser Aufgabe<br />
gerecht zu werden, die Anlage überragen. Eine tageszeitlich<br />
bezogene Verschattung ist hier besonders bei<br />
größeren Aufdachanlagen gegeben.<br />
Bild 7 zeigt ein Beispiel: Ergibt sich aus der durchzuführenden<br />
Risikoanalyse gemäß DIN EN 62305-2 [4]<br />
oder anderen Vorgaben ein Gefährdungspegel <strong>von</strong> III,<br />
so ist beim vorgenannten Blitzkugelverfahren ein Radius<br />
für die Blitzkugel <strong>von</strong> 45 m anzusetzen. Um die<br />
Anforderung zum Vermeiden <strong>von</strong> Direkteinschlägen<br />
in den Generator zu erfüllen, müssen Fangstangen<br />
bei 10 m diagonalem Abstand die PV-Einrichtung um<br />
mehr als 28 cm überragen.<br />
Häufig wird versucht möglichst viele Modulreihen auf<br />
der begrenzenden Dachfläche unterzubringen, um<br />
eine möglichst hohe Anlagenleistung zu erreichen.<br />
Entsprechend werden diese mit geringem Abstand untereinander<br />
montiert. In den Zwischenräumen werden<br />
die Fangeinrichtungen aufgestellt. Deren Aufgaben,<br />
sowohl den Trennungsabstand einzuhalten als auch<br />
den Schattenwurf auf die dahinter liegenden Module<br />
durch entsprechenden Abstand gering zu halten, bilden<br />
dann einen Konflikt.<br />
Bild 7: Fangstangen zum Schutz der Modulreihen vor<br />
direktem Blitzeinschlag<br />
Im Anhang A zum vorgenannten Beiblatt 5 sind Tabellen<br />
zur Ermittlung des eingangs beschrieben Kernschattens<br />
zu finden. Kernschatten ist der Bereich, welcher<br />
keinerlei direkte Sonnenstrahlen beinhaltet. Dieser<br />
verkleinert sich direkt proportional mit Erhöhung<br />
des Abstandes zum schattenbildenden Gegenstand.<br />
Mit anderen Worten ist eine Stange nicht in der Lage<br />
eine klar umrissene Dunkelfläche aufrecht zu erhalten,<br />
wenn der Abstand zu der dahinter befindlichen Fläche<br />
erhöht wird. Mit zunehmendem Abstand geht diese in<br />
einen Teilschatten über und bei steigender Entfernung<br />
gänzlich verloren. Dieser Kernschatten löst sich bei<br />
einer Fangstange mit 10 mm Durchmesser nach ca.<br />
1 m auf.<br />
Diese Entfernung ist entlang des Lichtstrahles zu sehen.<br />
Der horizontale Abstand, also zwischen Fangstange<br />
und Modul, ist entsprechend kürzer. Er wird zudem<br />
durch den örtlichen Einstrahlungswinkel, welcher<br />
vom Breitengrad zusammen mit dem jahreszeitlichen<br />
Sonnenstand abhängt, bestimmt. Die „kritische“ Entfernung,<br />
z. B. Fangstange zum Modul, ist eine variable<br />
Größe im Zeitraum eines Jahres.<br />
Optimale Modulreihendichte und Anlagenschutz durch<br />
Fangeinrichtung.<br />
Nicht auf jedem Dach sind Oberlichter oder andere<br />
Baukörper zu finden, welche die beschattungsfreie<br />
Montage <strong>von</strong> Fangstangen innerhalb Photovoltaikmodulfeldern<br />
ermöglichen.<br />
Ein gänzliches Ablehnen dieser Einrichtungen wegen<br />
möglicher Ertragseinbußen steht dem Risiko massiver<br />
Schäden an Anlage, Gebäude bis hin zu Personenschäden<br />
gegenüber. Ebenso der Mangel der technischen<br />
Unzulänglichkeit, wenn <strong>Blitzschutz</strong> gefordert ist.<br />
Wie in Bild 8 zu sehen ergeben sich im Norden <strong>von</strong><br />
Deutschland durch den höheren Abstand der Modulreihen<br />
reichlich Möglichkeiten, um Fangeinrichtungen<br />
unter Einhaltung des Trennungsabstandes „s“ zu montieren.<br />
In Süddeutschland (Bild 9), mit entsprechend<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Klaus-Peter Müller, Wolfgang Wegmann Stand 05/2012
14.15<br />
Seite 4 <strong>von</strong> 4<br />
Äußerer <strong>Blitzschutz</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Photovoltaikanlagen</strong><br />
geringeren Modulreihenabständen, wirkt sich der<br />
ganzjährig steilere Sonnenstand aus. Zusätzlich kann<br />
in Betracht gezogen werden, inwieweit sich eine Beschattung,<br />
welche sich nur zwischen November und<br />
Januar ereignen kann, sich auf den Jahresertrag niederschlägt.<br />
Tabelle 1 zeigt am Standort Regensburg,<br />
über das 10-jährige Mittel, den winterlichen Anteil des<br />
Jahresertrages. Auch eine zeitweilige Ertragseinbuße<br />
wird sich auf das Jahresergebnis nur entsprechend<br />
gering auswirken können.<br />
Bild 8: Standort Flensburg, Sonnenstand 21.Dezember,<br />
Modulreihenabstand 2,16 m<br />
Zusammenfassung<br />
Lineare und wandernde Kernbeschattungen, wie sie<br />
<strong>von</strong> Fangstangen erzeugt werden, beinhalten in den<br />
Wintermonaten kein generelles Potential schädliche<br />
Hotspots zu erzeugen.<br />
Neben der jahreszeitlich bedingten geringen Strahlungsenergie<br />
und den niedrigen Umgebungstemperaturen,<br />
wirken auch die niedrigeren Ströme in den Modulen<br />
dem entgegen.<br />
Grundsätzliche Vorbehalte beim Einsatz <strong>von</strong> <strong>Blitzschutz</strong>fangeinrichtungen<br />
im Zusammenhang mit Ertragsverlusten<br />
sind wenig begründbar. Eine detaillierte<br />
Betrachtung der vielschichtigen Aspekte im Zusammenhang<br />
mit den örtlichen Gegebenheiten ist notwendig.<br />
Der Verbesserung der langjährigen Ertragssicherung,<br />
wie sie durch den Schutz mit einem optimalen<br />
<strong>Blitzschutz</strong>system erreichbar ist, ist Vorzug zu geben.<br />
Bei Gebäuden mit der Forderung nach einem <strong>Blitzschutz</strong>system<br />
ist die fachgerechte Planung und Installation<br />
<strong>von</strong> PV-Anlagen und <strong>Blitzschutz</strong> eine lösbare<br />
Aufgabe.<br />
Literatur<br />
Bild 9: Standort Garmisch-Partenkirchen, Sonnenstand<br />
21. Dezember, Modulreihenabstand 1,33 m<br />
Tabelle 1: Durchschnittliche Monatserträge aus 10<br />
Jahre Anlagenbetrieb und jahreszeitbedingter horizontaler<br />
Abstand <strong>von</strong> einem bis auf 1,08 m wirksamen<br />
Kernschatten.<br />
[1] Risikoorientierter Blitz- und Überspannungsschutz,<br />
Richtlinien zur Schadenverhütung: VdS 2010, Ausgabe:<br />
2009-09, Hrsg: VdS-Verlag,<br />
[2] Prof. Dr. Quaschning, Volker:Simulation der Abschattungsverluste<br />
bei solarelektrischen Systemen<br />
/ Volker Quaschning. - 1. Aufl. - Berlin : Verlag Dr.<br />
Köster,1996<br />
[3] DIN EN 62305-1 (VDE 0185-305-1): 2006-10:<br />
<strong>Blitzschutz</strong> –<br />
Teil 1: Allgemeine Grundsätze (IEC 62305-1:2006);<br />
Deutsche Fassung EN 62305-1:2006<br />
DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2): 2006-10:<br />
<strong>Blitzschutz</strong> –<br />
Teil 2: Risiko-Management (IEC 62305-2:2006);<br />
Deutsche Fassung EN 62305-2:2006<br />
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3): 2006-10:<br />
<strong>Blitzschutz</strong> –<br />
Teil 3: Schutz <strong>von</strong> baulichen Anlagen und Personen<br />
(IEC 62305-2, modifiziert);<br />
Deutsche Fassung EN 62305-3:2006<br />
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4): 2006-10:<br />
<strong>Blitzschutz</strong> –<br />
Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in<br />
baulichen Anlagen<br />
(IEC 62305-4:2006);<br />
Deutsche Fassung EN 62305-4:2006<br />
VDE VERLAG Berlin<br />
[4] Beiblatt 5 VDE 0185-305-3 2009-10 DIN EN 62305-<br />
3: Schutz <strong>von</strong> baulichen Anlagen und Personen –<br />
Beiblatt 5: Blitz- und Überspannungsschutz für PV<br />
Stromversorgungssysteme, VDE VERLAG Berlin<br />
Verfasser: Dipl.-Ing. Klaus-Peter Müller, Wolfgang Wegmann Stand 05/2012