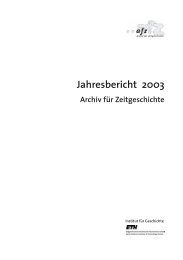Jahresbericht 2005/2006 - Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich
Jahresbericht 2005/2006 - Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich
Jahresbericht 2005/2006 - Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2005</strong>/<strong>2006</strong><br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Institut für Geschichte
_____________________________<br />
Herausgeber: <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich, 2007.<br />
Redaktion: Klaus Urner<br />
Satz und Gestaltung: Jonas Arnold<br />
Sämtliche Illustrationen aus dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich.<br />
Gedruckt mit Unterstützung des Freundes- und För<strong>der</strong>erkreises des <strong>Archiv</strong>s<br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong>, <strong>der</strong> Stiftung <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> und <strong>der</strong> Stiftung<br />
Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich.
Inhaltsverzeichnis<br />
Zum Geleit.............................................................................................................. 7<br />
Ein Haus für die <strong>Zeitgeschichte</strong> und ein För<strong>der</strong>ungswerk für die Zukunft... 11<br />
Dokumentationsstelle Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong>............................................. 14<br />
Erschliessungen......................................................................................................................... 14<br />
<strong>Archiv</strong> des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG)................. 14<br />
<strong>Archiv</strong> <strong>der</strong> Jüdischen Nachrichten (JUNA)................................................................... 18<br />
Vorlass Alfred A. Häsler....................................................................................................... 20<br />
Nachlass Hermann Levin Goldschmidt-Bollag..........................................................22<br />
<strong>Archiv</strong> <strong>der</strong> Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) .................................................24<br />
Neuzugänge ...............................................................................................................................24<br />
Nachlass Lajser Ajchenrand............................................................................................... 25<br />
Vorlass Rolf Bloch...................................................................................................................26<br />
Nachlass Sigi Feigel...............................................................................................................26<br />
Nachlass Rachela Frumes .................................................................................................. 27<br />
Einzelbestand Herbert Herz.............................................................................................. 27<br />
Einzelbestand Max Hirsch.................................................................................................. 27<br />
Einzelbestand Kurt Conrad Loew....................................................................................28<br />
Einzelbestand Edward Nahlik...........................................................................................28<br />
Vorlass Heinz Roschewski...................................................................................................29<br />
Vorlass Anne-Marie Imhof-Piguet.................................................................................. 30<br />
Einzelbestand Emma Ott................................................................................................... 30<br />
<strong>Archiv</strong> <strong>der</strong> „Gemeinschaft zur Unterstützung <strong>der</strong> Stiftung Solidarische<br />
Schweiz“ (GS)............................................................................................................................31<br />
Depot <strong>der</strong> Jüdischen Medien AG......................................................................................31<br />
„Israelitisches Wochenblatt für die Schweiz“, Zürich, 1901-2002................... 32<br />
„Jüdische Rundschau Maccabi“, Basel, 1947-2002................................................. 32<br />
„Aufbau“, New York, 1934-2002 .................................................................................... 32<br />
Forschungsdokumentationen..........................................................................................34<br />
Dissertationsarchiv Christof Dejung..........................................................................34<br />
Forschungsdokumentation Therese Schmid-Ackeret .........................................34<br />
Nachlieferungen zu vorhandenen Beständen...........................................................34<br />
Diverse Schenkungen zur Jüdischen <strong>Zeitgeschichte</strong>.............................................. 35<br />
Datenbank- und Verfilmungsprojekte............................................................................. 37<br />
Findmittel zu jüdischen Quellen in <strong>der</strong> Schweiz...................................................... 37<br />
Bildarchiv Schweizer Juden (BASJ).................................................................................. 37<br />
Bestand „Saly Mayer Annex“, Joint-<strong>Archiv</strong> New York .............................................38<br />
Veranstaltungen, Kooperationen.......................................................................................38<br />
Holocaustgedenktag im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>.................................................38<br />
Jahrestagung <strong>der</strong> Gesellschaft für Exilforschung, 17.-19. März <strong>2006</strong>:<br />
Europäische Fremdenpolitik im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t.....................................................43
Buchvernissage Lajser Ajchenrand, 20. September <strong>2006</strong>.....................................44<br />
Buchvernissage Zsolt Keller, 9. November <strong>2006</strong>.......................................................44<br />
Task Force for International Cooperation on Holocaust Education,<br />
Remembrance and Research (ITF)...................................................................................45<br />
Kolloquium zum Jüdischen <strong>Archiv</strong>wesen, Marburg 13.-15. 9.<strong>2005</strong>................... 46<br />
Ausstellungen ....................................................................................................................... 46<br />
Dokumentationsstelle Wirtschaft und <strong>Zeitgeschichte</strong>..................................47<br />
Erschliessungen........................................................................................................................ 48<br />
<strong>Archiv</strong>e economiesuisse – Verband <strong>der</strong> Schweizer Unternehmen................... 48<br />
Vorort-<strong>Archiv</strong>........................................................................................................................ 48<br />
Zentrale Verbandsakten – Erschliessung bis zur Gründung von<br />
economiesuisse (2000)................................................................................................ 48<br />
Wirtschaftsbeziehungen zu einzelnen Län<strong>der</strong>n (1950-1980)........................ 52<br />
Sachdossiers – Investitionsrisikogarantie, Statistik, Wissenschaft<br />
und Forschung, Branchen.............................................................................................54<br />
Protokolle – Digitalisierung und OCR-Erkennung ............................................. 55<br />
wf-Dokumentationsarchiv Teil II (1975-1993)...........................................................56<br />
Verkehrs- und Umweltpolitik, Bildungswesen und Medien..........................56<br />
Vorlass Roland Bless .............................................................................................................58<br />
Neuzugänge................................................................................................................................59<br />
Bestände <strong>der</strong> Zentrale für Wirtschaftsdokumentation (ZWD)...........................59<br />
<strong>Archiv</strong> Becker Audio-Visuals (BAV).................................................................................60<br />
Nachlass Ulrich Gross..........................................................................................................62<br />
Nachlass Friedrich Oe<strong>der</strong>lin-Ziegler...............................................................................62<br />
Nachlass Margaretha Rebsamen....................................................................................63<br />
Veranstaltungen, Kooperationen.......................................................................................63<br />
Arbeitsgruppe <strong>Archiv</strong>e <strong>der</strong> privaten Wirtschaft (VSA)............................................63<br />
Hearings zur Raumplanungsgeschichte <strong>der</strong> Schweiz............................................63<br />
Dokumentationsbereich Schweiz – Kalter Krieg........................................... 66<br />
Nachlass Marcel Brun............................................................................................................66<br />
Nachlass Heinrich Buchbin<strong>der</strong>............................................................................................67<br />
Nachlass Georg Theodor Schwarz.....................................................................................70<br />
Nachlass Ernst Cincera............................................................................................................71<br />
Einzelbestand Paul Coradi......................................................................................................71<br />
Schweizerischer Aufklärungsdienst / Schweizerische<br />
Arbeitsgemeinschaft für Demokratie (SAD).................................................................. 72<br />
Institut für politologische Zeitfragen (IPZ) / Nachlass Robert Vögeli................. 73<br />
Allgemeine schweizerische <strong>Zeitgeschichte</strong>.....................................................74<br />
Neuzugänge und Nachlieferungen..................................................................................74<br />
Nachlass Hans Hutter .........................................................................................................74<br />
Nachlass Dietrich Schindler sen. .................................................................................... 75
Vorlass Felix Auer ..................................................................................................................76<br />
Teilnachlass Fritz und Clara Sigrist-Hilty...................................................................... 77<br />
Vorlass Georg Kreis................................................................................................................78<br />
Einzelbestand Emil Bänziger.............................................................................................78<br />
Einzelbestand Robert Nicole.............................................................................................79<br />
Einzelbestand Alfred Reinhard Hohl..............................................................................79<br />
Einzelbestand Lina Meyer-Spörri.....................................................................................79<br />
Einzelbestand Albert Schoop........................................................................................... 80<br />
Einzelbestand Hans U. Steger.......................................................................................... 80<br />
Dissertationsarchiv Peter Boller ...................................................................................... 81<br />
Dissertationsarchiv Werner Vogt....................................................................................82<br />
<strong>Archiv</strong> des Verbands <strong>der</strong> Deutschen Hilfsvereine in <strong>der</strong> Schweiz<br />
sowie des Deutschen Hilfsvereins Zürich....................................................................82<br />
Erschliessungen.........................................................................................................................83<br />
Nachlass Max Imboden.......................................................................................................83<br />
Nachlass Karl Schmid.......................................................................................................... 84<br />
Nachlass Victor H. Umbricht.............................................................................................85<br />
Vorlass Arnold Fisch..............................................................................................................85<br />
Vorlass Hans Wili................................................................................................................... 86<br />
Forschungsdokumentation Reinhold Busch...............................................................87<br />
Dissertationsarchiv Stephan Winkler ...........................................................................87<br />
Forschungsdokumentation Neville Wylie....................................................................87<br />
Veranstaltungen, Kooperationen...................................................................................... 88<br />
Vernissage und Dokumentarfilm zu Warda Bleser-Bircher................................. 88<br />
Kooperation mit dem Ludwik Fleck Zentrum von <strong>ETH</strong> und Universität<br />
Zürich......................................................................................................................................... 89<br />
Sammlungen, Bibliotheken ............................................................................... 91<br />
Presseausschnittdokumentation....................................................................................... 91<br />
Bibliothek..................................................................................................................................... 91<br />
Audiovisuelle Quellen......................................................................................... 91<br />
Erschliessungen und Digitalisierungen..........................................................................92<br />
Oral History.................................................................................................................................93<br />
IT-Bereich...............................................................................................................95<br />
Information Retrieval im <strong>Archiv</strong> – Aufschaltung und Weiterentwicklung<br />
des virtuellen Lesesaals .........................................................................................................95<br />
Von DACHS zu CMI STAR – eine neue Ära <strong>der</strong> <strong>Archiv</strong>informationssysteme.....97<br />
Systemwartung, Weiterentwicklungen.......................................................................... 98<br />
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen........................................................... 99<br />
Gruppe Sammlungen und <strong>Archiv</strong>e; Kulturgüterkommission<br />
<strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich...........................................................................................................................99<br />
Tagungen, Seminarien und Präsentationen............................................................... 100
Benutzung.......................................................................................................... 103<br />
Erneuter Anstieg <strong>der</strong> Benutzungszahlen......................................................................103<br />
AfZ-Website...............................................................................................................................103<br />
Herkunft und Benutzungszweck.....................................................................................104<br />
Benutzte Bestände und betroffene Themenbereiche.............................................105<br />
Allgemeine <strong>Zeitgeschichte</strong> .............................................................................................105<br />
Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong>................................................................................................... 106<br />
Wirtschaft und <strong>Zeitgeschichte</strong>.......................................................................................107<br />
Kalter Krieg............................................................................................................................ 108<br />
Eingegangene Belegexemplare <strong>2005</strong>........................................................................... 109<br />
Eingegangene Belegexemplare <strong>2006</strong>............................................................................. 112<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter................................................................... 115<br />
Publikationsliste.......................................................................................................................116<br />
Stiftungen und Fonds......................................................................................... 117<br />
Stiftung <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>.................................................................................... 117<br />
Stiftung Dialogik, Mary und Hermann Levin Goldschmidt-Bollag......................118<br />
Jaeckle-Treadwell-Stiftung...................................................................................................118<br />
Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich................................................119<br />
Emil Friedrich Rimensberger-Fonds................................................................................. 121<br />
Simon und Hildegard Rothschild-Stiftung.................................................................... 121<br />
Karl-Schmid-Stiftung.............................................................................................................. 121<br />
Victor H. und Elisabeth Umbricht-Stiftung.................................................................. 122<br />
Dank .....................................................................................................................123<br />
AfZ-Team <strong>2005</strong>/<strong>2006</strong>........................................................................................ 124<br />
Öffnungszeiten...................................................................................................125
Zum Geleit<br />
Vier Jahrzehnte liegt die Gründung des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> zurück.<br />
1966 auf privater Basis begonnen, hat es sich an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich zu einem<br />
mo<strong>der</strong>nen Dienstleistungs- und Dokumentationszentrum für die Zeitgeschichtsforschung<br />
entwickelt.<br />
In den letzten zwei arbeitsintensiven Jahren, über die hier berichtet wird,<br />
blieb allerdings keine Zeit für retrospektive Reflexionen. Vielmehr galt es, die<br />
langfristig gesetzten Ziele bis Ende <strong>2006</strong> zu erreichen: den weiteren Ausbau<br />
unserer Dienstleistungen für die Forschung, den Abschluss mehrjähriger<br />
Erschliessungsprojekte sowie die Sicherung <strong>der</strong> infrastrukturellen und personellen<br />
Ressourcen für das Gesamtarchiv mit seinen Dokumentationsstellen<br />
auch für die Zukunft.<br />
Dabei waren die Erfolgsaussichten Anfang <strong>2005</strong> durchaus ungewiss. Über<br />
seine Tätigkeiten und über die Herausfor<strong>der</strong>ungen, die sich in einzelnen<br />
Bereichen stellten, geben die nachfolgenden Berichte des <strong>Archiv</strong>-Teams<br />
Aufschluss.<br />
Im Rahmen unserer Dokumentationsstelle Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> sind<br />
weitere grosse <strong>Archiv</strong>ierungsprojekte erfolgreich beendet worden. Das historisch<br />
wichtige <strong>Archiv</strong> des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes<br />
(SIG) liegt nun vollständig erschlossen<br />
vor. Nachfolgend werden auch<br />
zahlreiche Neuzugänge vorgestellt,<br />
darunter bedeutende Schenkungen<br />
wie diejenigen des Vorlasses von Dr.<br />
Dr. h.c. Rolf Bloch o<strong>der</strong> des Nachlasses<br />
von Dr. iur. Dr. iur. h.c. Sigi Feigel.<br />
Seit <strong>2005</strong> gehören Einladungen<br />
von Gymnasialklassen ins <strong>Archiv</strong><br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong> am Holocaustgedenktag<br />
neu zu seiner Bildungs- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit. Es zählt als<br />
„Forschungsstätte wi<strong>der</strong> das Vergessen“<br />
auch zu den <strong>Archiv</strong>en <strong>der</strong> Shoah<br />
und leistet hierzu einen spezifisch<br />
schweizerischen Beitrag.<br />
Blick in ein erschlossenes Segment <strong>der</strong> <strong>Archiv</strong>e<br />
des SIG.
Neue Perspektiven ergeben sich auch für unsere Dokumentationsstelle<br />
Wirtschaft und <strong>Zeitgeschichte</strong>, die einen erheblichen Zuwachs zu verzeichnen<br />
hat. Gefährdet waren historische Kernbestände <strong>der</strong> schweizerischen<br />
Privatwirtschaft: das <strong>Archiv</strong> des Schweizerischen Handels- und Industrie-<br />
Vereins (1870-2000) sowie das Dokumentationsarchiv <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung.<br />
Ende <strong>2006</strong> wurde mit economiesuisse, dem Verband <strong>der</strong> Schweizer<br />
Unternehmen, vereinbart, das bisherige Depot in eine Schenkung umzuwandeln.<br />
Für die langfristige Bewahrung und Nutzung dieses erstrangigen<br />
wirtschaftshistorischen Kulturgutes ist dadurch eine neue Ausgangsbasis<br />
geschaffen worden.<br />
Zusätzliche Synergien resultieren aus <strong>der</strong> Übernahme von Beständen <strong>der</strong><br />
ehemaligen Zentralstelle für Wirtschaftsdokumentation <strong>der</strong> Universität<br />
Zürich. Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> gehört inzwischen zu den führenden<br />
Wirtschaftsarchiven <strong>der</strong> Schweiz. Noch ist eine erhebliche Informationsarbeit<br />
zu leisten, bis auf die notwendige Unterstützung auch von Seiten <strong>der</strong> Privatwirtschaft<br />
gezählt werden kann, damit die ihm auf Grund vordringlicher<br />
Sicherungsbedürfnisse und zunehmen<strong>der</strong> Forschungsinteressen zugewachsenen<br />
Aufgaben erfüllt werden können.<br />
In den Bereichen „Schweiz – <strong>Zeitgeschichte</strong> allgemein“ und „Schweiz<br />
– Kalter Krieg 1945-1990“ werden vielfältige Quellenmaterialien zu einem<br />
breiten Themenspektrum zugänglich gemacht. Entsprechend weit gefasst<br />
sind die Forschungsthemen, für die – wie <strong>der</strong> Beitrag über die Benutzung<br />
zeigt – Bestände des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> ausgewertet werden.<br />
Inzwischen ist auch <strong>der</strong> virtuelle <strong>Archiv</strong>- und Leseraum eröffnet worden. Die<br />
Findmittel zu rund 140 Privatbeständen sowie zu institutionellen <strong>Archiv</strong>en<br />
können auf unserer Website mit innovativen Methoden bis auf Dossierebene<br />
durchsucht werden (http://onlinearchives.ethz.ch). Über die neuen<br />
Recherchiermöglichkeiten, die sich für die Benutzung ergeben, informiert<br />
<strong>der</strong> Beitrag aus dem IT-Bereich.<br />
Dank glücklicher Fügungen liessen sich zwei Vorhaben realisieren, die<br />
lange Zeit nahezu aussichtslos schienen: <strong>der</strong> Erwerb <strong>der</strong> Liegenschaft Hirschengraben<br />
62 zur langfristigen Sicherung unserer Arbeitsbasis sowie die<br />
Errichtung einer Stiftung für das Gesamtarchiv. Wie sich beide Projekte im<br />
Kontext des 150jährigen Jubiläums <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich doch noch verwirklichen<br />
liessen, ist im ersten Kapitel des <strong>Jahresbericht</strong>s nachzulesen.
Ermöglicht wurde dies durch die äusserst grosszügige Spende von zwei<br />
Millionen Franken <strong>der</strong> René und Susanne Braginsky-Stiftung sowie durch<br />
den Beitrag von 700‘000 Franken <strong>der</strong> Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> an<br />
<strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich. Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> darf seit vielen Jahren auf die<br />
tatkräftige För<strong>der</strong>ung durch Herrn René Braginsky zählen, <strong>der</strong> heute sowohl<br />
die Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
als auch die neue Stiftung <strong>Archiv</strong><br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong> präsidiert. Ihm<br />
und Frau Susanne Braginsky danken<br />
wir für ihre denkwürdige und<br />
einzigartige Unterstützung ganz<br />
herzlich.<br />
Im November <strong>2006</strong> besuchte die<br />
international besetzte Kommission<br />
zur Evaluation des Departements<br />
GESS <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich auch das<br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>, um sich<br />
über dessen Tätigkeit und Leistungsausweis<br />
zu informieren. Die<br />
Ergebnisse ihrer Beurteilung hat die Kommission im Evaluation Report <strong>2006</strong><br />
wie folgt festgehalten: „The Committee was impressed by the achievements<br />
and the quality of the <strong>Archiv</strong>e for Contemporary History and recommends<br />
further adequate support for this apparently unique unit in Switzerland by<br />
the <strong>ETH</strong> and a continuing affiliation of this institution with D-GESS.”<br />
Dieses positive Statement freut uns in doppelter Hinsicht: Die Empfehlung,<br />
das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> mit seiner Verankerung im Departement<br />
GESS weiterhin adäquat zu unterstützen, ist für seine künftige Tätigkeit<br />
von wegweisen<strong>der</strong> Bedeutung. Es enthält aber auch eine Anerkennung <strong>der</strong><br />
Leistungen, die das gesamte Team im Dienst und zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Zeitgeschichtsforschung<br />
erbringt.<br />
Auf Grund seiner Emeritierung trat Prof. Dr. Hans Werner Tobler Ende September<br />
<strong>2006</strong> von <strong>der</strong> Leitung des Instituts für Geschichte zurück. War Prof.<br />
Dr. Jean-François Bergier seit <strong>der</strong> Anglie<strong>der</strong>ung von 1974 in Angelegenheiten<br />
des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> fe<strong>der</strong>führend, so hat sich Hans Werner Tobler<br />
schon damals, vor allem aber als Institutsvorsteher seit Mitte <strong>der</strong> neunziger
Jahre, als im <strong>Archiv</strong> dynamische Entwicklungen begannen, für dessen Interessen<br />
eingesetzt. An jenen war er unter an<strong>der</strong>em als Gründungsmitglied<br />
<strong>der</strong> Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> unmittelbar beteiligt. Das <strong>Archiv</strong> für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong>, aber auch ich persönlich haben ihm viel zu verdanken.<br />
Neuer Vorsteher des Instituts für Geschichte ist Prof. Dr. David Gugerli, mit<br />
dessen Unterstützung die künftigen Herausfor<strong>der</strong>ungen im „Haus <strong>der</strong> <strong>Zeitgeschichte</strong>“<br />
am Hirschengraben 62 angegangen<br />
werden können, zu denen im Hinblick auf meinen<br />
Rücktritt im August 2007 auch die Neubestellung<br />
<strong>der</strong> Leitung des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> gehört.<br />
Allen, die dazu beigetragen haben, dass das <strong>Archiv</strong><br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong> auf gesichertem Fundament in<br />
die Zukunft blicken kann, sei herzlich gedankt: an<br />
erster Stelle <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich und ihrer Schulleitung.<br />
Als gesamtschweizerische Hochschule ermöglicht<br />
Prof. Dr. Hans Werner Tobler sie dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> eine einzigartige<br />
Arbeitsbasis. Die Verankerung im Institut für<br />
Geschichte und im Departement GESS hat sich für seine Tätigkeit nicht nur<br />
bewährt, son<strong>der</strong>n als ideal erwiesen.<br />
Eine ausserordentlich wichtige und unentbehrliche För<strong>der</strong>ung verdanken<br />
wir den Gönnerinnen und Gönnern, die den Ausbau des <strong>Archiv</strong>s für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> und insbeson<strong>der</strong>e seiner Dokumentationsstelle Jüdische<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> unterstützen. Die gemeinnützigen Stiftungen, auf <strong>der</strong>en Hilfe<br />
wir seit Jahren zählen dürfen, werden unter <strong>der</strong> Rubrik „Dank“ namentlich<br />
aufgeführt.<br />
Danken möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die motiviert<br />
und engagiert dafür besorgt sind, dass das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
seine Dienste für die Forschung überhaupt erbringen kann. Das Team wird<br />
am Schluss des Berichts vorgestellt. Werner Hagmann, Uriel Gast, Claudia<br />
Hoerschelmann, Daniel Nerlich, Jonas Arnold und Daniel Gerson nehmen<br />
an seinen Entwicklungen schon während mehr als ein o<strong>der</strong> sogar zwei<br />
Jahrzehnten aktiven Anteil und erfüllen in ihren Aufgabenbereichen mitgestaltende<br />
und leitende Funktionen. Ihnen gilt mein beson<strong>der</strong>er Dank für<br />
die bewährte und konstruktive Zusammenarbeit.<br />
Zürich, April 2007<br />
Klaus Urner<br />
10
Ein Haus für die <strong>Zeitgeschichte</strong> und ein För<strong>der</strong>ungswerk<br />
für die Zukunft<br />
Am 22. März 1994 erschien in <strong>der</strong> Neuen Zürcher Zeitung unter <strong>der</strong> Rubrik<br />
„Immobilien“ ein Inserat. Blickfang war ein schmuckes Haus mit dem verlockenden<br />
Text: „Hirschengraben 62: Diese repräsentative, renovierte Liegenschaft<br />
könnte Ihr neuer Geschäftsstandort sein! Inmitten des Herzens <strong>der</strong><br />
Stadt Zürich.“<br />
Das Beson<strong>der</strong>e: Mehr als ein Drittel <strong>der</strong> ausgewiesenen Nutzflächen waren<br />
<strong>Archiv</strong>lager – für ein Dokumentations- und Forschungszentrum wie geschaffen.<br />
Ein schöner Traum also war dieses Haus – damals fern aller Realitäten.<br />
Dass <strong>der</strong> Hirschengraben 62 im September 1996 dennoch zur Miete bezogen<br />
werden konnte, ist in erster Linie <strong>der</strong> Initiative von Dr. Branco Weiss,<br />
Dr. Sigi Feigel, Walter Gut und den Gönnern <strong>der</strong> Gruppe „Miete HRG 62“<br />
zu verdanken, aber auch Dr. Rolf Bloch und den Mitgrün<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Stiftung<br />
Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> sowie dem Entgegenkommen <strong>der</strong> Interkantonalen<br />
Landeslotterie (Swisslos) als Hauseigentümerin.<br />
Vor einigen Jahren signalisierte Swisslos, sich von ihrem Besitz in Zürich<br />
zu trennen und in Verkaufsverhandlungen treten zu wollen. Fortan galt<br />
unsere grösste Sorge <strong>der</strong> Frage, wie <strong>der</strong> Hirschengraben 62 dem <strong>Archiv</strong> für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> erhalten bleiben kann. Alle diesbezüglichen Anstrengungen<br />
endeten zunächst erfolglos. Im<br />
Jubiläumsjahr <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich<br />
kam die glückliche Wende.<br />
Mit ihrer Schenkung von zwei<br />
Millionen Franken haben René<br />
und Susanne Braginsky den<br />
Traum nicht nur denkbar, son<strong>der</strong>n<br />
realisierbar gemacht – eine<br />
wegweisende Zeichensetzung,<br />
die dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
höchst erfreuliche Perspektiven<br />
eröffnet.<br />
Mit Unterstützung <strong>der</strong> Stiftung<br />
Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich, die ihrerseits<br />
Das „Haus für die <strong>Zeitgeschichte</strong>“ in <strong>der</strong> NZZ entdeckt<br />
- Inserat vom 22. März 1994.<br />
11
700‘000 Franken zum Gelingen des Vorhabens beitrug, ging es René Braginsky<br />
jedoch um mehr als um einen bedeutenden Liegenschaftserwerb: Zweck<br />
<strong>der</strong> Schenkungen ist es, zusammen mit <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich die Ressourcen des<br />
<strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> zu stärken und ihm seine ideale Arbeitsbasis in<br />
unmittelbarer Nähe <strong>der</strong> Hochschulen und Bibliotheken auch in Zukunft zu<br />
erhalten. Für die Umsetzung bedurfte es mehrerer Schritte.<br />
Grundlegend ist die Vereinbarung zwischen <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich und den von<br />
René Braginsky vertretenen Stiftungen, die am 22. Dezember <strong>2005</strong> getroffen<br />
worden ist. Darin bekräftigt die Schulleitung in Anerkennung <strong>der</strong> grosszügigen<br />
Schenkungen ihren Willen, „das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> mit seinen<br />
Dokumentationsstellen insbeson<strong>der</strong>e auch zur Jüdischen <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
langfristig weiterzuführen und dieses bei <strong>der</strong> Wahrnehmung seiner Aufgaben<br />
auch künftig zu unterstützen und zu för<strong>der</strong>n.“<br />
Am 9. Februar <strong>2006</strong> erfolgte die Gründung <strong>der</strong> Stiftung <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
als För<strong>der</strong>ungswerk für das Gesamtarchiv. Sie ist eine Sammelstiftung,<br />
<strong>der</strong>en Statut es ermöglicht, für bedeutende Zuwendungen je nach<br />
Wunsch Fonds mit eigenen Namen und spezifischen För<strong>der</strong>ungsaufgaben<br />
innerhalb des allgemeinen Stiftungszweckes zu errichten.<br />
Die Stiftung unterstützt „die langfristige Sicherung und den Ausbau des<br />
<strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich“ und leistet „einen wesentlichen<br />
Beitrag zur dauerhaften Bewahrung und Nutzung von erstrangigem Kulturgut<br />
in <strong>der</strong> Schweiz auf <strong>der</strong> Basis mo<strong>der</strong>nster <strong>Archiv</strong>ierungs- und Informationstechnologien.“<br />
Ihre zweite Zielsetzung, die bei <strong>der</strong> Gründung wegen des akuten Handlungsbedarfs<br />
im Vor<strong>der</strong>grund stand, hat die Stiftung <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
sogleich realisiert: Am 4. April <strong>2006</strong> erwarb sie die Liegenschaft Hirschengraben<br />
62. Swisslos zeigte für das gemeinnützige Anliegen beson<strong>der</strong>es<br />
Entgegenkommen, wofür ihr und Herrn a. Direktor Georg Kennel herzlich<br />
gedankt sei.<br />
Der Hirschengraben 62 ist damit vollends zum „Haus <strong>der</strong> <strong>Zeitgeschichte</strong>“<br />
geworden. Dessen Verwaltung und Betrieb erfolgt durch den Infrastrukturbereich<br />
Immobilien <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich. Weitere Informationen zur Stiftung,<br />
zum Stiftungsrat und zu seiner Tätigkeit finden sich unter dem Abschnitt<br />
„Stiftungen und Fonds“ (s. S. 117).<br />
Am 22. Juni <strong>2006</strong> lud die Schulleitung <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich zu einem Empfang<br />
für René und Susanne Braginsky und Ehrengäste ins <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
12
Durch ihre grosszügige Spende erhielt das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> eine langfristige Grundlage:<br />
Susanne und René Braginsky.<br />
und zum anschliessenden Abendessen ein. Präsident Prof. Dr. Ernst Hafen<br />
und Rektor Prof. Dr. Konrad Osterwal<strong>der</strong> sprachen eindrückliche Dankesworte<br />
– ein Dank, den auch Prof. Dr. Hans Werner Tobler im Namen des Instituts für<br />
Geschichte und Prof. Dr. Klaus Urner für das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> zum<br />
Ausdruck brachten, gefolgt von einem illustrativen Ausblick von Dr. Daniel<br />
Nerlich in die Zukunftsvisionen des <strong>Archiv</strong>s. Ein Höhepunkt des musikalisch<br />
umrahmten Abends war im Lesesaal die Enthüllung <strong>der</strong> grafisch gestalteten<br />
Tafel mit <strong>der</strong> Widmung: „Ein Haus für die <strong>Zeitgeschichte</strong> – Susanne und René<br />
Braginsky in herzlicher Dankbarkeit.“<br />
„Wir neigen dazu, Aktuelles zu überschätzen und Vergangenes unterzubewerten“,<br />
gab René Braginsky in seinem Schlusswort zu bedenken. Er<br />
setzt sich auch auf Grund <strong>der</strong> eigenen Familiengeschichte für ein vertieftes<br />
historisches Verantwortungsbewusstsein ein: „Gerade in Zeiten, da die öffentliche<br />
Hand aufgrund ihrer Finanzlage wichtige Aufgaben vernachlässigt,<br />
ist privates Handeln gefragt.“<br />
Ihm gilt für sein beispielhaftes Engagement, zeitgeschichtliche Forschung<br />
nicht nur mit Worten, son<strong>der</strong>n auch mit Taten zu för<strong>der</strong>n, unser herzlichster<br />
Dank. Es ist dies eine Zeichensetzung, die eine weiterführende Resonanz<br />
verdient.<br />
13
Dokumentationsstelle Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Zwei Kernbestände zur jüdischen <strong>Zeitgeschichte</strong> in <strong>der</strong> Schweiz sind fertig<br />
erschlossen worden: die <strong>Archiv</strong>e des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes<br />
(SIG) sowie <strong>der</strong> Jüdischen Nachrichten (JUNA). Dies gilt auch<br />
für den Privatnachlass des Journalisten und Schriftstellers Dr. h.c. Alfred A.<br />
Häsler, <strong>der</strong> durch seine kritische Auseinan<strong>der</strong>setzung mit sozial- und zeitgeschichtlichen<br />
Themen, aber auch im Kontext des christlich-jüdischen Dialogs<br />
entscheidende Impulse gab.<br />
Unter den zahlreichen Neuzugängen sind die Bestände von Dr. Sigi Feigel,<br />
Präsident <strong>der</strong> ICZ (1972-1987), von Dr. Rolf Bloch, Präsident des SIG (1992-<br />
2000), sowie <strong>der</strong> literarische Nachlass des jiddischsprachigen Dichters Lajser<br />
Ajchenrand hervorzuheben.<br />
Der Aufbau einer Datenbank zu jüdischen Quellenbeständen im In- und<br />
Ausland, die sich auf die Schweiz beziehen, gehört zu den künftigen Zielsetzungen<br />
<strong>der</strong> Dokumentationsstelle. Als Pilotprojekt wurde mit <strong>der</strong> Erfassung<br />
von drei jüdischen Gemeindearchiven begonnen. Auch die externe Beratung<br />
in <strong>Archiv</strong>ierungsfragen gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung.<br />
Die Dokumentationsstelle trat mit mehreren Veranstaltungen an die<br />
Öffentlichkeit. Anlässlich des Holocaustgedenktages am 27. Januar wurden<br />
Schülerinnen und Schüler zu einer Begegnung mit Zeitzeugen eingeladen.<br />
In Kooperation mit ihr führte die deutsche Gesellschaft für Exilforschung<br />
im März <strong>2006</strong> an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich ihre öffentlich zugängliche und rege besuchte<br />
Jahrestagung durch. Mit diesen und weiteren Anlässen wurde die<br />
Dokumentationsstelle Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> auch in den Medien wahrgenommen.<br />
Erschliessungen<br />
<strong>Archiv</strong> des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG)<br />
Der Abschluss dieses grossen <strong>Archiv</strong>ierungsprojekts erfolgte im Herbst<br />
<strong>2006</strong>. Das SIG-<strong>Archiv</strong> war zwar seit <strong>der</strong> Übernahme für Forschungszwecke<br />
zugänglich, doch ist es erst jetzt nach <strong>der</strong> definitiven <strong>Archiv</strong>ierung möglich,<br />
zitierte Quellen korrekt nachzuweisen. Mit dem letzten Arbeitsdurchgang,<br />
<strong>der</strong> <strong>2005</strong>/<strong>2006</strong> erfolgte, konnte auch die Effizienz <strong>der</strong> Recherchen in <strong>der</strong><br />
Datenbank durch ergänzende Angaben zu Themen und Personen in den<br />
14
Das Parlament des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes tagt: 38 Delegierte aus 17<br />
Gemeinden beraten über eine Revision <strong>der</strong> Statuten (Protokollbuch 3 des SIG 1920–1926).<br />
15
Inhaltsfel<strong>der</strong>n <strong>der</strong> einzelnen Verzeichnungseinheiten noch einmal wesentlich<br />
verbessert werden.<br />
Das Team, zu dem unter <strong>der</strong> Leitung von Dr. Claudia Hoerschelmann lic.<br />
phil. Regina Gehrig, Dr. Daniel Gerson, lic. phil. Madeleine Lerf sowie lic. phil.<br />
Sandra Stu<strong>der</strong> gehörten, überarbeiteten zu diesem Zweck die über 3000<br />
Dossiers (70 Laufmeter). Neben <strong>der</strong> Bereinigung von Datenbankeinträgen<br />
wurden in einzelnen Segmenten die Dossiers neu geordnet. Abschliessend<br />
folgte die Vergabe definitiver Signaturen und die Etikettierung des Gesamtbestandes.<br />
Das umfangreiche SIG-Verzeichnis kann nun im Lesesaal des<br />
<strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> benutzt werden; <strong>der</strong> elektronische Zugang ist<br />
bei entsprechen<strong>der</strong> Autorisation im Lesesaal möglich. Zum erfolgreichen<br />
Abschluss trugen in früheren Jahren auch lic. phil. Elisabeth Eggimann, lic.<br />
phil. Michael Funk und lic. sc. rel. Zsolt Keller bei.<br />
Unterstützt wurde das Erschliessungsprojekt durch den Regierungsrat des<br />
Kantons Zürich mit einem im März 1999 bewilligten Beitrag von 300‘000<br />
Franken mit dem Ziel, diesen historisch relevanten Bestand zur jüdischen<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> als Teil des gesamtschweizerischen Kulturgutes für künftige<br />
Generationen zu sichern. Anlässlich des Projektabschlusses erinnern wir<br />
dankend an die gewährte Finanzierungshilfe durch den Kanton Zürich und<br />
die Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich.<br />
Organisationsstruktur des SIG: Grundlagen für die <strong>Archiv</strong>ablage<br />
Der Bestand selbst, aber auch seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte<br />
wi<strong>der</strong>spiegeln die bewegte Geschichte des schweizerischen Judentums im<br />
20. Jahrhun<strong>der</strong>t. Bei seiner Gründung im November 1904 war <strong>der</strong> SIG ein loser<br />
Zusammenschluss einzelner jüdischer Gemeinden mit dem Ziel, das seit 1893<br />
wirksame Schächtverbot zu bekämpfen und die Koscherfleischversorgung<br />
für ihre Mitglie<strong>der</strong> sicherzustellen. Diese diskriminierende Einschränkung<br />
<strong>der</strong> Religionspraxis beschäftigt den SIG bis in die Gegenwart.<br />
In den ersten Jahrzehnten seines Bestehens genügte das ehrenamtliche<br />
Engagement einzelner Gemeindepräsidenten, um die noch vergleichsweise<br />
bescheidenen Aktivitäten des Gemeindebunds zu gewährleisten. Es gab<br />
kein festes Sekretariat und die Akten blieben vollständig im Besitz des Präsidenten<br />
und <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong> des Central Comités (CC). Dies erklärt, weshalb<br />
aus dieser Frühzeit des SIG zahlreiche Unterlagen fehlen. Immerhin sind<br />
die Protokolle <strong>der</strong> CC-Sitzungen und <strong>der</strong> Delegiertenversammlungen fast<br />
vollständig erhalten geblieben.<br />
16
Ab 1929, als Saly Mayer die Funktion eines Sekretärs übernahm, sind die<br />
einzelnen Geschäfte bereits umfassen<strong>der</strong> belegt. Er war Sekretär von Jules<br />
Dreyfus-Brodsky, bis er 1936 selbst die Präsidentschaft übernahm. Ihm ist<br />
es zu verdanken, dass die Tätigkeiten des SIG zur Zeit <strong>der</strong> Verfolgungen <strong>der</strong><br />
Juden durch die deutschen Nationalsozialisten gut dokumentiert sind. Saly<br />
Mayer war auch als Vertreter des American Jewish Joint Distribution Committee<br />
(JDC) in <strong>der</strong> Schweiz tätig. Daher erhielt das Joint-<strong>Archiv</strong> in New York<br />
1950 seine zentralen Akten zur Rettung und Unterstützung <strong>der</strong> verfolgten<br />
Juden. Sie sind mittlerweile auf Mikrofilmen im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
einsehbar.<br />
Erst nach seinem Rücktritt 1943 wurde das Sekretariat unter dem Präsidenten<br />
Saly Braunschweig durch Leo Littmann professionalisiert. Es befand<br />
sich nun unabhängig von den Wohnorten <strong>der</strong> jeweiligen Präsidenten o<strong>der</strong><br />
Sekretären in Zürich. Willy Guggenheim trat von 1971 bis 1991 die Nachfolge<br />
Littmanns an. Das Amt wurde zum „Generalsekretariat“ erweitert, zumal<br />
Guggenheim auch zahlreiche repräsentative Aufgaben übernahm.<br />
Eine umfassende organisatorische Umgestaltung des SIG im Jahr 1944<br />
schuf die Grundlage für die heute geltende Struktur des SIG-<strong>Archiv</strong>s. Neben<br />
dem Central Comité wurde neu als Exekutivorgan eine Geschäftsleitung gebildet.<br />
Den sieben Geschäftsleitungsmitglie<strong>der</strong>n wurden einzelne Ressorts<br />
zugeteilt (Präsidialressort, Ressorts „Abwehr und Aufklärung“, „Jugend“,<br />
„Kulturelles“, „Religiöses“, „Flüchtlinge und Soziales“). Innerhalb <strong>der</strong> Ressorts<br />
wurden Kommissionen konstituiert, wie zum Beispiel die „Kommission für<br />
Koscherfleischversorgung“, die „Kommission zur Bekämpfung des Antisemitismus“<br />
o<strong>der</strong> die „Kommission Hilfe und Aufbau“. Die Ressorts und Schwerpunkte<br />
haben sich in <strong>der</strong> Folge nur geringfügig verän<strong>der</strong>t, da wichtige Tätigkeitsbereiche<br />
bis in die Gegenwart ihre Bedeutung beibehalten haben.<br />
Trotz <strong>der</strong> Bemühungen des SIG, eine zentrale Aktenablage zu organisieren,<br />
kam eine systematische Überlieferung nicht zustande. Wichtige Unterlagen<br />
konnten nach entsprechenden Recherchen bei ehrenamtlich tätigen Mitglie<strong>der</strong>n<br />
<strong>der</strong> SIG-Gremien o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en Nachkommen wie<strong>der</strong> aufgefunden werden.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e die Nachlässe führen<strong>der</strong> SIG-Präsidenten enthalten wertvolle<br />
Ergänzungen zum Geschäftsarchiv des Verbandes. Die Mehrheit dieser Bestände<br />
hat das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> sichern können und macht sie für die<br />
Forschung zugänglich. Es handelt sich um Akten und Dokumentationen von<br />
Saly Mayer (1936-1943), Saly Braunschweig (1943-1946), Georges Brunschvig<br />
17
(1946-1973), Jean Nordmann (1973-1980), Robert Braunschweig (1980-1988),<br />
Michael Kohn (1988-1992) und Rolf Bloch (1992-2000). Nur die Nachlässe<br />
<strong>der</strong> ersten beiden Präsidenten, Hermann Guggenheim (1904-1915) und Jules<br />
Dreyfus-Brodsky (1915-1936), fehlen bislang zur Vervollständigung.<br />
Ein reicher Fundus zur jüdischen Geschichte <strong>der</strong> Nachkriegszeit<br />
Das Wirken des Gemeindebundes im Kontext <strong>der</strong> nationalsozialistischen<br />
Bedrohung, des Holocaust und <strong>der</strong> Flüchtlingspolitik <strong>der</strong> 1930er und 1940er<br />
Jahre wurde anhand des SIG-<strong>Archiv</strong>s eingehend erforscht (Stefan Mächler,<br />
Jacques Picard). Auch die Problematik bezüglich <strong>der</strong> Schächtfrage wurde<br />
historisch aufgearbeitet (Pascal Krauthammer).<br />
Die <strong>Archiv</strong>materialien zur Nachkriegszeit harren hingegen <strong>der</strong> vertieften<br />
Auswertung. Im Bereich <strong>der</strong> jüdischen Sozial- und Kulturgeschichte sind<br />
noch zahlreiche Themen zu bearbeiten, zu denen auch die religiösen und<br />
kulturellen Entwicklungen nach 1945 gehören. Das SIG-<strong>Archiv</strong> beinhaltet zu<br />
Fragestellungen, die sich beispielsweise auf die Diskussion um die Anerkennung<br />
<strong>der</strong> religiös-liberalen Gemeinden o<strong>der</strong> die Entstehung verschiedener<br />
Gruppierungen am Rande <strong>der</strong> Einheitsgemeinden beziehen, einen für die<br />
Forschung unverzichtbaren Fundus. Noch nicht ausgewertet wurden auch<br />
die Materialien zu den Beziehungen Schweiz-Israel o<strong>der</strong> zu den Kontakten<br />
des SIG mit internationalen Organisationen, unter an<strong>der</strong>em zum World<br />
Jewish Congress.<br />
1949 war unter dem Vorsitz von Dr. Rudolf Zipkes innerhalb des SIG ein<br />
Komitee zur Schaffung eines jüdischen <strong>Archiv</strong>s gegründet worden. Wie aus<br />
den Unterlagen hervorgeht, fand dieses Vorhaben damals nicht die notwendige<br />
Resonanz, um erfolgreich umgesetzt werden zu können. Anfang<br />
<strong>der</strong> sechziger Jahre löste sich das Komitee wie<strong>der</strong> auf. Rund dreissig Jahre<br />
später sind in Kooperation mit dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> die geeigneten<br />
Voraussetzungen geschaffen worden, um das kulturelle Erbe dauerhaft<br />
sichern zu können, zu dem das nun voll erschlossene <strong>Archiv</strong> des SIG mit an<br />
erster Stelle gehört.<br />
<strong>Archiv</strong> <strong>der</strong> Jüdischen Nachrichten (JUNA)<br />
Das fünfköpfige Team, welches das SIG-<strong>Archiv</strong> bearbeitet hat, brachte auch<br />
die Erschliessung des JUNA-<strong>Archiv</strong>s im Umfang von 56 Laufmetern <strong>2005</strong> zum<br />
erfolgreichen Abschluss. Um das mo<strong>der</strong>ne, vom <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
mitentwickelte Recherchetool optimal nutzen zu können, wurden die Kor-<br />
18
espondenzen und Zeitungsdokumentationen feiner erfasst. Das Verzeichnis<br />
ist über die AfZ-Homepage einsehbar und kann unter www.afz.ethz.ch auch<br />
extern durchsucht werden.<br />
Die „Jüdischen Nachrichten“, die unter dem Namen „JUNA“ bekannt wurden,<br />
wirkten von 1936 bis 1971 als Pressestelle des SIG. Sie verdanken ihren<br />
Ursprung <strong>der</strong> Initiative von Dr. iur. Georg Guggenheim und wurden seit 1938<br />
von Dr. iur. Benjamin Sagalowitz geleitet, <strong>der</strong> bis Mitte <strong>der</strong> sechziger Jahre<br />
die Arbeit <strong>der</strong> JUNA geprägt hat. Ihre Tätigkeit umfasste vor allem zwei<br />
Aufgabenbereiche:<br />
Zum einen ging es um die Bereitstellung und Vermittlung von Informationen<br />
und Berichten mit <strong>der</strong> Intention, den Antisemitismus zu bekämpfen<br />
und das Judentum ohne Diskriminierung darzustellen. Die „JUNA“-Bulletins,<br />
welche von 1936 bis 1960 erschienen und im <strong>Archiv</strong> vollständig vorhanden<br />
sind, waren das wichtigste Mittel für die aktive Abwehr des Antisemitismus.<br />
Mit ihnen wurden zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften in <strong>der</strong> Schweiz<br />
beliefert und dadurch mit Informationen zur Lage <strong>der</strong> Juden im In- und<br />
Ausland versorgt. Die Bulletins erschienen auf Deutsch und Französisch. In<br />
<strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> nationalsozialistischen Bedrohung wurden jährlich bis über 20<br />
Bulletins verbreitet.<br />
Zum an<strong>der</strong>en wurden sowohl subtile als auch gezielt judenfeindliche<br />
Manifestationen in Medien und Öffentlichkeit dokumentiert. Ein Grossteil<br />
dieser umfangreichen Sammlungen<br />
von Zeitungsausschnitten, Berichten<br />
und an<strong>der</strong>en Materialien betrifft den<br />
Holocaust und seine Folgen. Diese<br />
begann Benjamin Sagalowitz selbst<br />
auszuwerten. Er beabsichtigte unmittelbar<br />
nach dem Krieg unter dem Titel<br />
„Der Weg nach Majdanek“ eine erste<br />
umfassende Darstellung <strong>der</strong> deutschen<br />
Judenvernichtungspolitik zu veröffentlichen.<br />
Das Werk lag – wie den Unterlagen<br />
im JUNA-<strong>Archiv</strong> zu entnehmen<br />
ist – bereits 1947 in Druckfahnen vor.<br />
Aus bis heute nicht geklärten Gründen<br />
wurde auf eine Publikation des Buches, Benjamin Sagalowitz (1901-1970)<br />
19
das damals wohl zu einem Pionierwerk <strong>der</strong> Holocaustforschung geworden<br />
wäre, verzichtet.<br />
Zahlreiche Dossiers des JUNA-<strong>Archiv</strong>s beziehen sich auf die juristische Verfolgung<br />
<strong>der</strong> Kriegsverbrecher o<strong>der</strong> auf die sogenannte „Wie<strong>der</strong>gutmachung“.<br />
Unter den verschiedenen Sammlungen befindet sich auch eine Dokumentation<br />
zu einzelnen Län<strong>der</strong>n, in <strong>der</strong> primär Presseartikel zum Antisemitismus<br />
und zum Verhältnis des jeweiligen Staates zu Israel gesammelt wurden.<br />
Die Nachfolger von Benjamin Sagalowitz waren Peter Woog (1964-1968)<br />
und Dr. Eugen Messinger (1969-1971). In den 1960er und 1970er Jahren rückte<br />
<strong>der</strong> Nahostkonflikt verstärkt ins Zentrum des Interesses. Im JUNA-<strong>Archiv</strong> sind<br />
zahlreiche Unterlagen überliefert, die Aspekte dieser Thematik beleuchten<br />
(u.a. antiisraelische Propaganda und Boykottdrohungen arabischer Staaten,<br />
gegen Israel gerichtete Terroraktionen).<br />
Mit <strong>der</strong> Ernennung von Dr. Willy Guggenheim zum Generalsekretär des SIG<br />
im Jahre 1971 wurde die PR- und Informationspolitik des SIG neu ausgerichtet.<br />
In <strong>der</strong> Folge wurde auf die Weiterführung <strong>der</strong> JUNA verzichtet.<br />
Zum Zeitraum von 1936 bis 1971, <strong>der</strong> vom Holocaust und seinen Folgen, <strong>der</strong><br />
Gründung Israels und dem Sieg im Sechstagekrieg entscheidend geprägt war,<br />
enthält das JUNA-<strong>Archiv</strong> in <strong>der</strong> Schweiz einmalige Dokumentationen.<br />
Vorlass Alfred A. Häsler<br />
Die archivische Aufarbeitung des journalistisch-publizistischen Bestandes<br />
von 11 Laufmetern konnte anfangs dieses Jahres von lic. phil. Regina Gehrig<br />
gerade rechtzeitig zum 85. Geburtstag von Dr. h.c. Alfred A. Häsler vollendet<br />
werden. Das detaillierte Verzeichnis ist nun elektronisch über das Internet<br />
zugänglich. Für die Unterstützung des Erschliessungsprojekts danken wir<br />
<strong>der</strong> Dr. h.c. Emile Dreyfus-Stiftung und <strong>der</strong> Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich.<br />
Häsler kämpfte als Journalist und Publizist während rund einem halben<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t gegen Rassismus, Antisemitismus, Gewalt und Ungerechtigkeit.<br />
Mit seinem bewegenden Buch „Das Boot ist voll“ zur Schweizer Flüchtlingspolitik<br />
während des Zweiten Weltkrieges, das 1967 im Zürcher Verlag Fretz<br />
& Wasmuth erschien, wurde er einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Das<br />
Buch erreichte Bestsellerstatus. Übersetzungen verschafften Häsler über<br />
die Landesgrenzen hinaus Resonanz. Die Filmadaption von Markus Imhoof<br />
wurde für einen Oscar nominiert.<br />
20
Schon während des Krieges machte<br />
<strong>der</strong> junge Typograf und Journalist<br />
auf die Not <strong>der</strong> vom Nationalsozialismus<br />
Verfolgten aufmerksam. Häsler<br />
erkannte die Zeichen <strong>der</strong> Zeit nicht<br />
erst im Nachhinein, son<strong>der</strong>n solidarisierte<br />
sich in <strong>der</strong> Aktualität mit den<br />
Verfolgten. Was er einmal für richtig<br />
erkannt hatte, mochte es noch so<br />
unbequem sein, sprach Häsler, wie<br />
Charles Linsmayer bemerkt, immer<br />
auch aus.<br />
Ein Beispiel dafür ist die Publikation<br />
„Leben mit dem Hass“. Sie enthält<br />
21 Gespräche mit prominenten Zeitzeugen<br />
wie Ernst Bloch, Max Frisch,<br />
David Ben Gurion, Herbert Marcuse,<br />
Alexan<strong>der</strong> Mitscherlich, Herbert Lüthy<br />
und wurde vom Rowohlt Verlag 1969<br />
Vom Typografen zum Bestsellerautor: Alfred<br />
A. Häsler präsentiert sein bewegendes<br />
Werk.<br />
herausgegeben. Zuvor waren die Gespräche in <strong>der</strong> „Tat“ veröffentlicht worden.<br />
Die im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> aufbewahrten Tondokumente zu den<br />
Interviews sind profund und aufrüttelnd. Häsler unternimmt den Versuch,<br />
in konkreten Fragen den Begriff Hass zu analysieren und gleichzeitig zu ergründen,<br />
wie diesem Phänomen entgegengetreten werden kann. Durch die<br />
Annäherung aus verschiedenen Richtungen, aus <strong>der</strong> Politik und Philosophie,<br />
Religion und Psychologie, wie sie für Alfred A. Häsler typisch ist, wird klar,<br />
dass reale Möglichkeiten vorhanden sind, den Hass als Antrieb für politische<br />
Entwicklungen, für Gewalt und Unterdrückung zu überwinden. Der von Herbert<br />
Lüthy in seinem Beitrag angeführte Kampf gegen das „Opium und seine<br />
Händler“ durch Aufdeckung des Unrechts führt zum Grundthema Häslers,<br />
<strong>der</strong> Frage nach dem menschlichen Gewissen.<br />
Sein journalistisches und schriftstellerisches Engagement umfasste auch<br />
konkrete Taten: So lancierte er 1979 die „Aktion für die Boat People“. Eine Woche<br />
nach seinem Artikel in <strong>der</strong> „Weltwoche“ über den Holocaust erschien <strong>der</strong><br />
Report über die Flüchtlingskatastrophe in Asien mit dem Titel „Das Boot ist<br />
nicht voll“. Der damalige Vorsteher des EJPD, Kurt Furgler, äusserte sich darin<br />
21
folgen<strong>der</strong>massen: „Es ist die Pflicht unseres Staates, das Menschenmögliche<br />
zu tun“. Bis Ende 1980 sollten in <strong>der</strong> Schweiz rund 2000 Vietnamflüchtlinge<br />
aufgenommen werden.<br />
Häsler befriedigte diese Antwort nicht: „Das Menschenmögliche für eines<br />
<strong>der</strong> reichsten Län<strong>der</strong> <strong>der</strong> Welt O<strong>der</strong> nicht eine Humanität nach Krämer-Manier“<br />
Die „Weltwoche“ for<strong>der</strong>te die Aufnahme von 10‘000 Flüchtlingen aus<br />
Indochina und startete eine Umfrage dazu. Das Echo war enorm. 90 Prozent<br />
<strong>der</strong> weit über 1000 Antworten unterstützten die For<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> „Weltwoche“.<br />
Viele boten ihre Mitarbeit zur Integration an o<strong>der</strong> spendeten Geld. Bundesrat<br />
Kurt Furgler prüfte diese For<strong>der</strong>ung und kam zum Schluss, sich nicht für<br />
eine Fixzahl, son<strong>der</strong>n für eine generelle, aber keineswegs kleinere Lösung zu<br />
entscheiden. Nach <strong>der</strong> Genfer Flüchtlingskonferenz liess er sich auf folgende<br />
Aussage behaften: „Die Schweiz wird einen substantiellen Beitrag leisten,<br />
und zwar auf allen Gebieten.“ (Weltwoche Nr. 30 v. 25.7.1979, S. 11)<br />
Häsler bewahrte seine umfangreichen Materialien sorgsam auf. So liegen<br />
aus seiner kritischen Zeitzeugenschaft wertvolle Quellen zur Schweizer<br />
Sozialgeschichte seit <strong>der</strong> Zwischenkriegszeit vor. Seine journalistische<br />
Tätigkeit bei <strong>der</strong> „Tat“, <strong>der</strong> „Weltwoche“, den „Ex-Libris“-Heften, sein rund<br />
40 Bücher umfassendes publizistisches Werk, seine Präsidentschaft beim<br />
Schweizer Schriftstellerverband und seine rege Vortragstätigkeit verlocken<br />
zu Forschungen in einem breiten Themenspektrum. Der Hauptteil dieses<br />
Quellenfundus‘ liegt in schriftlicher Form vor. Beson<strong>der</strong>s erwähnenswert<br />
aber ist die einmalige Tonbandkassettensammlung, die über hun<strong>der</strong>t Gespräche<br />
mit Zeitzeugen aus Politik, Wissenschaft und Kunst enthält sowie<br />
eine entsprechende Sammlung ausgezeichneter Fotoporträts.<br />
Nachlass Hermann Levin Goldschmidt-Bollag<br />
Nach <strong>der</strong> Integration <strong>der</strong> letzten, bisher erst provisorisch erfassten Ablieferung<br />
und <strong>der</strong> Neubearbeitung des gesamten Bestandes von 16 Laufmetern<br />
im ersten Halbjahr <strong>2005</strong> liegt zum Nachlass Hermann Levin Goldschmidt<br />
ein Findmittel vor, mit dem die <strong>Archiv</strong>ierung ihren Abschluss gefunden hat.<br />
Goldschmidt hat auch einzelne Dokumente aus dem Besitz seiner Vorfahren<br />
bei seiner Emigration in die Schweiz mitnehmen können. Der zeitliche Rahmen<br />
seines Nachlasses reicht daher vom Ende des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts bis zu<br />
seinem Tode 1998. Zu den frühen Zeitdokumenten gehört beispielsweise „das<br />
Merkbüchlein für Ball, Tanz und Soirée“ von Goldschmidts Mutter Irene aus<br />
22
Der Künstler und <strong>der</strong> Philosoph: Willy Guggenheim alias Varlin bedankt sich bei Hermann Levin<br />
Goldschmidt für das „interessante Werk“: Die Botschaft des Judentums, Frankfurt am Main:<br />
Europäische Verlagsanstalt, 1960.<br />
23
dem Jahre 1896. Der kleine unscheinbare Band entpuppt sich bei näherer Lektüre<br />
als sozialgeschichtlich illustrative Quelle, hat doch seine Mutter, die auf<br />
Grund ihrer nahen Verwandtschaft mit <strong>der</strong> Bankiersfamilie von Rothschild<br />
zur jüdischen Oberschicht Wiens zählte, darin alle ihre sozialen Kontakte<br />
festgehalten. Bei genauerem Studium bietet sich so ein überraschen<strong>der</strong><br />
Einblick in das jüdische Grossbürgertum zur Zeit <strong>der</strong> Belle Epoque.<br />
Ein halbes Jahrhun<strong>der</strong>t später musste Hermann Levin Goldschmidt an<br />
<strong>der</strong> Universität Zürich um seine Anerkennung als Philosoph und um seinen<br />
Aufenthalt im Exilland Schweiz kämpfen. Er durfte schliesslich in <strong>der</strong> Schweiz<br />
bleiben, doch war ihm eine wissenschaftliche Karriere in seiner neuen Heimat<br />
verwehrt. Sein Briefwechsel zeugt vom vergeblichen Bemühen, sich<br />
nach Kriegsende habilitieren zu können, und belegt eindrücklich, wie ein<br />
vergleichsweise privilegierter jüdischer Emigrant auch nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg an einer Schweizer Hochschule marginalisiert wurde.<br />
Goldschmidt musste als Philosoph einen Wirkungskreis ausserhalb <strong>der</strong> Universität<br />
suchen. Er fand ihn in <strong>der</strong> jüdischen und allgemeinen Erwachsenenbildung.<br />
Die rege und vielfältige Korrespondenz mit berühmten Zeitzeugen<br />
wie Robert Jungk und Peter Weiss, aber auch mit zahlreichen unbekannten<br />
Personen in <strong>der</strong> Schweiz und im Ausland reflektieren die menschliche und<br />
intellektuelle Ausstrahlung dieses eigenwilligen Denkers, <strong>der</strong> sich für das<br />
Fortwirken <strong>der</strong> deutsch-jüdischen Kultur bis zuletzt engagierte.<br />
<strong>Archiv</strong> <strong>der</strong> Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH)<br />
Mit <strong>der</strong> Bearbeitung <strong>der</strong> 2004 erfolgten Ablieferung zum SFH-<strong>Archiv</strong> ist im<br />
April <strong>2006</strong> begonnen worden. Sie umfasst Geschäftsakten <strong>der</strong> Jahre 1980<br />
bis 1995 im Umfang von gegen 40 Laufmetern. Lic. phil. Aurel Waeber hat im<br />
Rahmen eines Teilzeitpraktikums umfangreiche Materialien, welche sowohl<br />
die Tätigkeit <strong>der</strong> Leitungsgremien als auch <strong>der</strong> einzelnen Ressorts (Flüchtlingspolitik,<br />
Asylrecht, Fürsorge, Öffentlichkeitsarbeit und Mittelbeschaffung)<br />
dokumentieren, zunächst im Ist-Zustand erfasst und entsprechend <strong>der</strong><br />
Bestandesglie<strong>der</strong>ung zugeordnet. Nach diesen Vorarbeiten folgt nun die<br />
weitere Erschliessung.<br />
Neuzugänge<br />
In den Berichtsjahren durften wie<strong>der</strong> bedeutende Schenkungen entgegen<br />
genommen werden. Diese werden nach ihrer Erschliessung in den folgenden<br />
<strong>Jahresbericht</strong>en eingehen<strong>der</strong> vorgestellt.<br />
24
Bekanntheitsgrad <strong>der</strong> Flüchtlingshilfswerke in ausgewählten Regionen <strong>der</strong> Schweiz 1946: Umfrage-Ergebnisse<br />
des Institut Suisse de l‘Opinion Publique Lausanne (I.S.O.P.) im Auftrag <strong>der</strong> SFH.<br />
Nachlass Lajser Ajchenrand<br />
Der aus Polen stammende jiddischsprachige Dichter Lajser Ajchenrand<br />
(1911-1985) emigrierte 1937 nach Paris. Nach Kriegsbeginn verbrachte er fast<br />
zwei Jahre Jahre in Lagern und in <strong>der</strong> Illegalität, bis ihm im September 1942<br />
die Flucht in die Schweiz gelang. Aber auch hier war er unter schwierigen<br />
Bedingungen in Arbeitslagern interniert. 1944 engagierte sich <strong>der</strong> Verband<br />
Schweizerischer Jüdischer Flüchtlingshilfen für seine Entlassung aus dem<br />
Arbeitsdienst und verschaffte ihm eine Arbeitsbewilligung als Übersetzer.<br />
Ajchenrand war aktiv in <strong>der</strong> „Kulturgemeinschaft <strong>der</strong> Emigranten in Zürich“<br />
sowie in <strong>der</strong> „Union Jüdischer Flüchtlinge in <strong>der</strong> Schweiz“ und beteiligte sich<br />
an Kulturveranstaltungen <strong>der</strong> „Israelitischen Cultusgemeinde Zürich“. Auch<br />
Dank <strong>der</strong> Unterstützung von Hermann Hesse und Carl Seelig wurde ihm<br />
1949 das Dauerasyl gewährt.<br />
In seinem dichterischen Werk befasste sich Ajchenrand mit dem Holocaust<br />
und seinen Folgen. Anfangs <strong>der</strong> 1950er Jahre lernte er seine spätere Frau Claire<br />
kennen. Nach Aufenthalten in Argentinien (1952-1953) und Israel (1957-1961)<br />
kehrte er 1962 in die Schweiz zurück.<br />
Der Bestand dokumentiert unter an<strong>der</strong>em die Aufenthaltsregelung Ajchenrands<br />
in <strong>der</strong> Schweiz sowie den regen schriftlichen Kontakt mit Dichter- und<br />
Schriftstellerkollegen.<br />
25
Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> dankt Frau Claire Ajchenrand für die Schenkung<br />
und freut sich, dass am 20. September <strong>2006</strong> die Vernissage zum Gedichtband<br />
„Aus <strong>der</strong> Tiefe“ von Lajser Ajchenrand, <strong>der</strong> im Ammann-Verlag erschienen ist,<br />
in seinen Räumen stattfinden konnte (s.a. S. 44).<br />
Dr. iur. Rolf Bloch, vielfältiger För<strong>der</strong>er des<br />
<strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong>.<br />
Vorlass Rolf Bloch<br />
Dr. iur. Rolf Bloch (geb. 1930), <strong>der</strong><br />
sich seit Anfang <strong>der</strong> 1990er Jahre<br />
wegweisend für den Aufbau <strong>der</strong><br />
Dokumentationsstelle Jüdische<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> eingesetzt hat, war<br />
selbst Teil historisch relevanter Entwicklungen<br />
in <strong>der</strong> Schweiz. In seine<br />
Amtszeit als SIG-Präsident von 1992<br />
bis 2000 fiel die Debatte um die Rolle<br />
<strong>der</strong> Schweiz im Zweiten Weltkrieg<br />
und zum Umgang <strong>der</strong> Schweizer<br />
Banken mit den „nachrichtenlosen<br />
Vermögen“ in <strong>der</strong> Nachkriegszeit.<br />
Als Präsident des Schweizerischen<br />
Israelitischen Gemeindebundes wurde er zum wichtigen Vermittler zwischen<br />
dem World Jewish Congress und den Schweizer Behörden. Auch präsidierte<br />
er von 1997 bis 2002 den Schweizer Fonds zu Gunsten bedürftiger Opfer <strong>der</strong><br />
Shoah („Schweizer Holocaustfonds“).<br />
Rolf Bloch hat <strong>2006</strong> seinen Vorlass im Umfang von 14 Laufmetern dem<br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> geschenkt. Darin dokumentiert sind seine zentralen<br />
Funktionen innerhalb <strong>der</strong> schweizerischen jüdischen Gemeinschaft sowie<br />
sein Engagement in verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Organisationen.<br />
Ebenfalls ersichtlich wird sein Einsatz zu Gunsten von Stiftungen<br />
und För<strong>der</strong>ungswerken. Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> dankt Herrn Dr. Rolf<br />
Bloch für die Schenkung seines historisch bedeutenden Nachlasses.<br />
Nachlass Sigi Feigel<br />
Bereits zu seinen Lebzeiten war Dr. iur. Sigi Feigel (1921-2004) an das <strong>Archiv</strong><br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong> gelangt, um seinen Bestand, darunter auch Dokumentationen<br />
zum schweizerischen Judentum, zu Israel, zum Antisemitismus<br />
26
und dessen Bekämpfung, für die historische Forschung sichern zu können.<br />
Die Übernahme seiner Materialien aus seiner ehemaligen Anwaltskanzlei<br />
erfolgte <strong>2005</strong>.<br />
Sigi Feigel wirkte von 1972 bis 1987 als Präsident <strong>der</strong> Israelitischen Cultusgemeinde<br />
Zürich, die ihn nach seinem Rücktritt zum Ehrenpräsidenten<br />
ernannte. Als Mitglied <strong>der</strong> Geschäftsleitung engagierte er sich von 1984 bis<br />
1996 im Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG). 1978 gründete<br />
er den „Fonds gegen Rassismus und Antisemitismus“. Er war 1989 massgebend<br />
an <strong>der</strong> Errichtung <strong>der</strong> „Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus“<br />
beteiligt, gehörte schon 1982 zu den Initiatoren <strong>der</strong> Gesellschaft „Min<strong>der</strong>heiten<br />
in <strong>der</strong> Schweiz“, half 1996 bei <strong>der</strong> Gründung <strong>der</strong> Stiftung „Erziehung zur<br />
Toleranz“ mit und setzte sich 1998 als Mitbegrün<strong>der</strong> für die „Gemeinschaft<br />
zur Unterstützung <strong>der</strong> Stiftung Solidarische Schweiz“ ein.<br />
Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> dankt Frau Evi Feigel für die Schenkung<br />
dieses historisch wichtigen Nachlasses sowie Herrn Dr. iur. Eric Teitler für<br />
die dabei gewährte Hilfe.<br />
Nachlass Rachela Frumes<br />
Rachela Frumes (1913-1993) war 1935 als polnische Medizinstudentin in die<br />
Schweiz gekommen. Der Zweite Weltkrieg und <strong>der</strong> Holocaust verunmöglichten<br />
ihr die Rückkehr nach Polen. Neben ihrer Tätigkeit als Psychiaterin<br />
engagierte sie sich unter an<strong>der</strong>em im „Schweizerisch-polnischen Koordinations-<br />
und Hilfskomitee für das befreite Polen“. Für die Schenkung eines<br />
ersten Teils dieses Nachlasses danken wir Frau Ruth Michel Richter.<br />
Einzelbestand Herbert Herz<br />
Herbert Herz ist Regionaldelegierter des Departements „Gerechte“ des israelischen<br />
Gedenkzentrums Yad Vashem. Seit den frühen 1980er Jahren hat er<br />
sich dafür engagiert, dass Schweizerinnen und Schweizer, die sich während<br />
des Zweiten Weltkrieges als Helfer und Retter verfolgter Juden eingesetzt<br />
hatten, von Yad Vashem als „Gerechte <strong>der</strong> Völker“ geehrt werden. Wir danken<br />
Herrn Herz für die Schenkung <strong>der</strong> Dossiers zu 27 Einzelpersonen und Ehepaaren,<br />
<strong>der</strong>en Ehrungen er zwischen 1990 und <strong>2006</strong> vorbereitet hat.<br />
Einzelbestand Max Hirsch<br />
Max Hirsch (1899-1981), geboren in <strong>der</strong> Nähe von Würzburg, flüchtete 1936<br />
nach Kreuzlingen, wo er seine spätere Frau Hermine Dreifuss kennen lernte.<br />
27
1937 gründete er eine kleine Metallfirma, die Rheintalische Metallwaren<br />
Fabrik mit Sitz in Schaan, Liechtenstein. Später zog die Familie mit ihrer Tochter<br />
Ruth nach La Chaux-de-Fonds, wo er erneut ein Geschäft, die IMETA SA,<br />
aufbaute. Auf privater Basis versuchte er sein Möglichstes, um Verwandten<br />
und Bekannten zur Flucht aus dem Deutschen Reich zu verhelfen. Über den<br />
Familienkreis hinaus unterstützte Hirsch Internierte in den Lagern Gurs und<br />
Rivesaltes. Erhalten geblieben ist die Korrespondenz mit Flüchtlingen in den<br />
Kriegsjahren. Dokumentiert ist aber auch das Schicksal von Rückkehrern in<br />
<strong>der</strong> Nachkriegszeit sowie von Emigrierten, die in den USA geblieben sind.<br />
Frau Ruth Dreyfuss schenkte den Nachlass ihres Vaters <strong>2005</strong> dem <strong>Archiv</strong><br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong>, wofür wir ihr und Herrn Heinz Roschewski für die Vermittlung<br />
danken.<br />
Einzelbestand Kurt Conrad Loew<br />
Kurt Conrad Loew (1913-1980) war Jude und Mitglied <strong>der</strong> sozialistischen<br />
Jugend in Wien. Nach dem „Anschluss“ im März 1938 verhaftet, gelang<br />
ihm die Flucht nach Antwerpen, später nach Frankreich, wo er nach dem<br />
Einmarsch <strong>der</strong> Wehrmacht interniert wurde (Sammellager St. Cyprien, Rivesaltes,<br />
Gurs). Von dort kam er nach vier gescheiterten Fluchtversuchen<br />
1942 in die Schweiz.<br />
1945 nahm er an <strong>der</strong> Flüchtlingskonferenz von Montreux teil. Zwei Jahre<br />
später begann er ein Kunststudium in Genf und kehrte 1951 nach Wien zurück.<br />
In den 1960er und 1970er Jahren wirkte er als Lehrer an <strong>der</strong> Kunstakademie<br />
in Wien.<br />
Frau Edith Eschler übergab dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> denjenigen Teil<br />
des Nachlasses, <strong>der</strong> sich auf die Zeichnungen ihres Vaters bezieht, die er<br />
zum Lagerleben im südfranzösischen Interniertenlager Gurs in den Jahren<br />
1940 bis 1942 unter schwierigen Verhältnissen zusammen mit Karl Bodek<br />
angefertigt hatte. Die im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> vorliegende Sammlung<br />
umfasst 12 Zeichnungen, die Loew 1980 in Wien nach <strong>der</strong> Vorlage seiner<br />
Originale hergestellt hat.<br />
Wir danken Frau Edith Eschler für die Schenkung, die durch die Initiative<br />
von Frau Dr. Helena Kanyar zustande gekommen ist.<br />
Einzelbestand Edward Nahlik<br />
Die „Exilgesandtschaft“ Polens während des Zweiten Weltkrieges in Bern<br />
hatte eine wichtige Funktion bei <strong>der</strong> Vermittlung von Nachrichten zwischen<br />
28
den Alliierten und dem polnischen Wi<strong>der</strong>stand. Sie unterstützte auch verfolgte<br />
Juden in Polen.<br />
Diese Tätigkeit wurde im Buch „Polen-Juden-Schweizer“ von a. Botschafter<br />
Dr. Paul Stauffer, erschienen 2004 im Verlag NZZ Libro, aufgearbeitet. Er stützte<br />
sich dabei auch auf die Erinnerungen des ehemaligen Legationssekretärs<br />
Stanislaw Nahlik, <strong>der</strong> zwischen 1939 und 1945 zum diplomatischen Personal<br />
<strong>der</strong> „Exilgesandtschaft“ Polens gehörte. Nahlik hatte in den 1980er Jahren<br />
unter dem Titel „Durch das Sieb des Gedächtnisses“ zwei Memoirenbände<br />
verfasst, in welchen die Erinnerungen an die Schweizer Zeit im Band 2 nie<strong>der</strong>gelegt<br />
sind. Dr. Paul Stauffer verdanken wir die Schenkung <strong>der</strong> von ihm<br />
veranlassten deutschen Übersetzung dieses Teils <strong>der</strong> Memoiren.<br />
Vorlass Heinz Roschewski<br />
Der als Journalist und Historiker engagierte Heinz Roschewski übergab dem<br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> einen wesentlichen Teil seines Vorlasses. Dieser<br />
enthält vor allem Unterlagen zu seinen<br />
zeitgeschichtlichen Forschungen und<br />
Veröffentlichungen (u.a. „Die Juden in<br />
<strong>der</strong> Schweiz von 1945 bis 1994. Auf dem<br />
Weg zu einem neuen jüdischen Selbstbewusstsein“,<br />
Basel / Frankfurt a. M. 1994<br />
und „Rothmund und die Juden. Eine historische<br />
Fallstudie des Antisemitismus<br />
in <strong>der</strong> schweizerischen Flüchtlingspolitik<br />
1933-1957“, Basel / Frankfurt a. M. 1997,<br />
beide erschienen in <strong>der</strong> Schriftenreihe<br />
des SIG). Hinzu kommen Seminararbeiten<br />
sowie Materialien zu seinen<br />
Forschungen über Babij Jar, zu den Fällen<br />
Paul Grüninger und Frick/Hofer o<strong>der</strong> Heinz Roschewski<br />
zur Flüchtlingspolitik. Vorträge und Zeitungsartikel zu zeitgeschichtlichen<br />
Themen ergänzen diesen Teil.<br />
Weitere Dossiers beziehen sich auf sein Wirken in verschiedenen Institutionen,<br />
darunter als Präsident <strong>der</strong> Jüdischen Gemeinde Bern 1984 bis 1988, als<br />
Mitarbeiter bei <strong>der</strong> „St. Galler Volksstimme“ im Zweiten Weltkrieg o<strong>der</strong> als<br />
Chef <strong>der</strong> Abteilung Information bei Radio DRS.<br />
29
Ergänzend fertigte das Schweizerische Bundesarchiv auf Initiative von Herrn<br />
Roschewski von den dort aufbewahrten Zensurakten zur „Volksstimme“<br />
Kopien an. Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> dankt Herrn Roschewski für die<br />
Schenkung seiner Unterlagen und dem Schweizerischen Bundesarchiv für<br />
die ermöglichte Ergänzung des Vorlasses.<br />
Vorlass Anne-Marie Imhof-Piguet<br />
Anne-Marie Imhof-Piguet betreute während des Zweiten Weltkriegs jüdische<br />
Flüchtlingskin<strong>der</strong> in französischen Heimen wie „La Hille“ und „Montluel“.<br />
Sie verhalf einigen von ihnen zur Flucht in die Schweiz. Für ihre Hilfe zu<br />
Gunsten verfolgter Juden wurde sie 1990<br />
von Yad Vashem als „Gerechte unter den<br />
Völkern“ geehrt. Nachzulesen sind ihre<br />
Erinnerungen in ihrem Buch „La Filière“,<br />
das später auch unter dem deutschen<br />
Titel „Fluchtweg durch die Hintertür“<br />
(Frauenfeld: Verlag im Waldgut, 1987)<br />
erschienen ist.<br />
Frau Imhof-Piguet hat dem <strong>Archiv</strong> für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> durch Vermittlung von<br />
Frau Dr. Helena Kanyar diverse Fotos aus<br />
ihrer Zeit im französischen Dorf „La Hille“<br />
(1942 bis 1944) geschenkt. Sie übergab<br />
auch drei Tonbän<strong>der</strong> mit Sendungen von<br />
Radio DRS über Flüchtlingsschicksale<br />
Anne-Marie Imhof-Piguet 1944 im Zweiten Weltkrieg. Wir danken Frau<br />
Imhof-Piguet für ihre Schenkung und für ihre Absicht, dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
weitere Unterlagen anzuvertrauen.<br />
Einzelbestand Emma Ott<br />
Emma Ott arbeitete nach <strong>der</strong> Ausbildung zur Krankenschwester im Spital von<br />
Albert Schweitzer in Lambarene, wo sie von 1936 bis 1939 in verantwortlicher<br />
Position tätig war. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz blieb sie zwei Jahre am<br />
Spital Tiefenau in Bern und meldete sich dann angesichts des Kriegselends<br />
als Helferin beim Schweizerischen Roten Kreuz. 1942 bis 1946 leistete sie im<br />
Lager Rivesaltes sowie zusammen mit Elsbeth Kasser im Lager Gurs Hilfe. Es<br />
30
gelang ihr, Flucht- und Rettungsaktionen für Kin<strong>der</strong> und jüdische Mitarbeiter<br />
zu organisieren. Ihr weiteres Wirken für verfolgte Kin<strong>der</strong> und Jugendliche, u.a.<br />
auch im französischen Kin<strong>der</strong>heim „La Hille“, ist durch Interviews dokumentiert.<br />
Nach dem Krieg kehrte sie wie<strong>der</strong> in die Schweiz zurück und arbeitete<br />
bis 1972 als Oberschwester im Spital Tiefenau.<br />
Pfarrer Dr. Peter Märki, ein enger Vertrauter von Emma Ott, hat mit ihr<br />
1996 zwei autobiografische Interviews durchgeführt und diese dem <strong>Archiv</strong><br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong> geschenkt. Der historische Nachlass wurde von ihm gesichert<br />
und soll zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls archiviert werden.<br />
Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> dankt Pfarrer Märki für seine Schenkung und<br />
Frau Dr. Helena Kanyar für die Vermittlung des Kontakts.<br />
<strong>Archiv</strong> <strong>der</strong> „Gemeinschaft zur Unterstützung <strong>der</strong> Stiftung Solidarische<br />
Schweiz“ (GS)<br />
Mit <strong>der</strong> Solidaritätsstiftung, die im Zusammenhang mit den Diskussionen<br />
um die Rolle <strong>der</strong> Schweiz während des Zweiten Weltkrieges lanciert<br />
worden war und für die überschüssige Goldreserven <strong>der</strong> Nationalbank die<br />
finanzielle Grundlage bilden sollten, wollten die Initianten das humanitäre<br />
Wirken <strong>der</strong> Schweiz auf neuer Basis fortsetzen. Nachdem Bundesrat Koller<br />
1997 das Stiftungsprojekt angekündigt hatte, wurde die „Gemeinschaft zur<br />
Unterstützung <strong>der</strong> Stiftung Solidarische Schweiz“ gegründet mit dem Ziel,<br />
für das Vorhaben zu werben und sich für dessen Verwirklichung einzusetzen.<br />
Im Vorstand wirkten Dr. Sigi Feigel und Dr. Peter Arbenz massgeblich<br />
mit. Die Gemeinschaft bestand von 1997 bis 2004, war aber in den letzten<br />
Jahren kaum mehr aktiv. Carl Holenstein, Geschäftsleiter <strong>der</strong> Gesellschaft,<br />
veranlasste die Übergabe <strong>der</strong> Akten an das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>, die<br />
Anfang <strong>2005</strong> erfolgt ist.<br />
Depot <strong>der</strong> Jüdischen Medien AG<br />
Auf Grund <strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Jüdischen Medien AG Zürich getroffenen Vereinbarungen<br />
können im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> die beiden wichtigsten Zeitungsorgane,<br />
welche während des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts das jüdische Leben in- und<br />
ausserhalb <strong>der</strong> Schweiz dokumentieren, zugänglich gemacht werden. Hinzu<br />
kommen die Originalbände aus dem „Aufbau“-Redaktionsarchiv in New<br />
York. Diese fanden dank <strong>der</strong> Initiative von Herrn René Braginsky, <strong>der</strong> durch<br />
sein verlegerisches Engagement dem „Aufbau“ eine Fortführung auf neuer<br />
31
Erste Ausgabe des „Israelitischen Wochenblattes“ vom 4. Januar 1901<br />
Grundlage ermöglicht, den Weg ins <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>. Der „Aufbau“ ist<br />
für die jüdische Emigrationsgeschichte im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t von erstrangiger<br />
Bedeutung. Das Depot setzt sich wie folgt zusammen:<br />
„Israelitisches Wochenblatt für die Schweiz“, Zürich, 1901-2002<br />
Die Jüdische Medien AG Zürich hat dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> das „Israelitische<br />
Wochenblatt für die Schweiz“ (1901-2002) in einem kompletten<br />
und gebundenen Exemplar <strong>der</strong> von Yves Kugelmann geleiteten Redaktion<br />
von „tachles“ als Depot übergeben. Von <strong>der</strong> französischen Ausgabe „Revue<br />
Juive“ erhielten wir – ebenfalls in gebundener Form – die Jahrgänge 1989<br />
bis <strong>2005</strong>.<br />
„Jüdische Rundschau Maccabi“, Basel, 1947-2002<br />
Als weitere gedruckte Periodika und wichtige Quellen zur schweizerischjüdischen<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> fügte die Jüdische Medien AG auch sämtliche<br />
Jahrgänge <strong>der</strong> Zeitschrift „Jüdische Rundschau Maccabi“ in gebundener<br />
Form dem Depot bei.<br />
„Aufbau“, New York, 1934-2002<br />
Als Nachrichtenblatt des 1924 gegründeten German-Jewish Club Inc. New<br />
York erschien am 1. Dezember 1934 die erste Ausgabe des „Aufbau“. Unter den<br />
Mitarbeitern und För<strong>der</strong>ern befanden sich viele bekannte Persönlichkeiten,<br />
32
die als Emigranten das nationalsozialistische Deutschland verlassen hatten:<br />
u.a. Albert Einstein, Leon Feuchtwanger, Bruno Frank, Nahum Goldmann, Emil<br />
Ludwig, Thomas Mann und Franz Werfel. Herausgeber und Chefredaktor war<br />
26 Jahre lang <strong>der</strong> Berliner Manfred George (1893-1965). Die Emigrantenzeitschrift<br />
erschien bis Dezember 2004 in New York.<br />
Die Jüdische Medien AG erwarb im Jahr 2004 die Rechte am „Aufbau“.<br />
Damit erhielt sie auch Teile des Redaktionsarchivs, welche sie Anfang <strong>2005</strong><br />
dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> überliess. Als neu konzipiertes Monatsmagazin<br />
erscheint <strong>der</strong> „Aufbau“ seit Januar <strong>2005</strong> von Zürich aus.<br />
Der Bestand enthält sämtliche Ausgaben des „Aufbau“ von <strong>der</strong> ersten<br />
Ausgabe im Dezember 1934 bis zur letzten im Dezember 2002. Der grösste<br />
Teil davon ist in Jahresbänden gebunden, an<strong>der</strong>e sind als Einzelausgaben<br />
überliefert. Zudem ist aus <strong>der</strong> „Aufbau“-Redaktion eine umfangreiche<br />
alphabetische Kartei nach Autoren und den Titeln ihrer Beiträge erhalten<br />
geblieben.<br />
Da sich ein Teil <strong>der</strong> älteren Jahrgänge (ca. 1939-1955) in schlechtem Erhaltungszustand<br />
befindet, muss für die Konsultation dieser Bände noch eine<br />
Lösung gefunden werden. Die von <strong>der</strong> Deutschen Nationalbibliothek digitalisierten<br />
Jahrgänge 1934 bis 1950 sind im Internet einsehbar.<br />
Vom Nachrichtenblatt des German-Jewish Club, New York, zum bedeutendsten Organ <strong>der</strong><br />
deutsch-jüdischen Emigranten in den USA: erste Ausgabe vom 1. Dezember 1934.<br />
33
Forschungsdokumentationen<br />
Zu den Forschungsdokumentationen gehören Dissertationsarchive o<strong>der</strong><br />
Grundlagenmaterialien, die im Zusammenhang mit einzelnen Projekten<br />
zusammengetragen worden sind. Die entsprechenden Dokumentationen<br />
können weiterführende Recherchen zu den jeweiligen Themen wesentlich<br />
erleichtern.<br />
Dissertationsarchiv Christof Dejung<br />
Die Dissertation von Dr. Christof Dejung „Aktivdienst und Geschlechterordnung.<br />
Eine Kultur- und Alltagsgeschichte des Militärdienstes 1939-1945 in<br />
<strong>der</strong> Schweiz“, erschienen im Chronos-Verlag in Zürich <strong>2006</strong>, beruht neben<br />
Quellenmaterialien aus <strong>Archiv</strong>en auch auf Interviews mit Zeitzeugen, Tagebüchern<br />
und Erinnerungsalben, militärhistorischer Literatur und Propagandatexten.<br />
Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> dankt Herrn Christof Dejung<br />
für seine Schenkung, die auch Originaldokumente aus <strong>der</strong> Zeit des Zweiten<br />
Weltkriegs enthält.<br />
Forschungsdokumentation Therese Schmid-Ackeret<br />
Therese Schmid-Ackeret, evangelische Pfarrerin in Winterthur, führte 1999<br />
im Rahmen eines Sabbaticals ein „biografisches Projekt“ zum Leben und<br />
Wirken von Elsbeth Kasser (1910-1992) durch. Diese hatte sich als Rotkreuzschwester<br />
in den dreissiger Jahren für die Spanienkämpfer und anfangs <strong>der</strong><br />
vierziger Jahre für die Flüchtlinge in den südfranzösischen Interniertenlagern<br />
eingesetzt.<br />
Frau Schmid hat für ihre im Jahr 2000 publizierte biografische Skizze „Rotkreuzschwester<br />
Elsbeth Kasser 1910-1992“, <strong>der</strong>en Verwandte und Freunde<br />
interviewt und dabei auch Fotos, Briefe und Dokumente gesammelt. Beson<strong>der</strong>s<br />
wertvoll sind einige Originalmaterialien aus dem von Elsbeth Kasser<br />
weitgehend vernichteten Nachlass, wie z.B. das Fotoalbum des „Service<br />
Civil“ zum Spanischen Bürgerkrieg, einige Tonbandinterviews und Berichte.<br />
Wir danken Frau Schmid für die Schenkung, für die Frau Dr. Helena Kanyar<br />
wertvolle Impulse gab.<br />
Nachlieferungen zu vorhandenen Beständen<br />
Manche Bestände werden dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> in Teilablieferungen<br />
übergeben. Dabei handelt es sich vorwiegend um <strong>Archiv</strong>e von Institutionen,<br />
die noch den Zugriff auf ihre laufenden Dossiers benötigen o<strong>der</strong> um Bestände<br />
von Donatoren, die sich nur sukzessive von ihren Unterlagen trennen<br />
34
möchten. Mehrheitlich werden die Teilablieferungen provisorisch erfasst.<br />
Eine endgültige Erschliessung erfolgt in <strong>der</strong> Regel erst nach Vorliegen des<br />
Gesamtbestandes. Wir danken für folgende Nachlieferungen:<br />
Von Frau Liselotte Hilb, die im sozialen Bereich tätig war (u.a. Schweizer<br />
Hilfswerk für Emigrantenkin<strong>der</strong>, Schweizer Europahilfe, später auch bei <strong>der</strong><br />
Krebs- und <strong>der</strong> Rheumaliga), erhielten wir ein Fotoalbum sowie weitere<br />
persönliche Dokumente zur Familiengeschichte.<br />
2004 hatte Frau Gisela Blau eine umfangreiche Dokumentation zum Thema<br />
„Schweiz – Zweiter Weltkrieg“ übergeben, die sie als Journalistin angelegt<br />
hat. Diese hat sie nun durch die Schenkung von rund 30 Videofilmen mit<br />
Ton- und Bilddokumenten wesentlich erweitert.<br />
Die <strong>2005</strong> erfolgte letzte Ablieferung zum Nachlass des ehemaligen Präsidenten<br />
des SIG, Georges Brunschvig (1908-1973), durch Frau Odette Brunschvig,<br />
umfasst vor allem Korrespondenzen und Fotos aus dessen letzten<br />
Lebensjahren. Weitere Unterlagen beziehen sich auf seine Tätigkeit als<br />
Rechtsvertreter des SIG beim Berner Prozess zu den „Protokollen <strong>der</strong> Weisen<br />
von Zion“ in den dreissiger Jahren.<br />
Zum Nachlass von Charlotte Weber (1912-2000), <strong>der</strong> ehemaligen Leiterin<br />
<strong>der</strong> Schweizer Flüchtlingsheime Bienenberg, Hilfikon und Zugerberg sowie<br />
von Kin<strong>der</strong>heimen in Frankreich, konnten wir von Frau Dr. Goia Weber neben<br />
weiteren Unterlagen zwei Ehrenmedaillen und acht Videodokumente<br />
entgegen nehmen.<br />
Frau Vera Kronenberg, Präsidentin des Bundes Schweizerischer Jüdischer<br />
Frauenorganisationen (BSJF) von 1992 bis 2002, übergab <strong>2006</strong> die Akten aus<br />
ihrer Amtszeit und diejenigen ihrer Vorgängerin Frau Thea Hacker. Damit<br />
deckt <strong>der</strong> Bestand den Zeitraum von 1924 bis fast in die Gegenwart ab. Er ist<br />
inzwischen von Janine Wilhelm und Anne Frenkel bearbeitet worden.<br />
Diverse Schenkungen zur Jüdischen <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Für kleinere Schenkungen und Ergänzungen danken wir folgenden Donatorinnen<br />
und Donatoren: lic. phil. Monika Bucheli, Zürich; lic. phil. Christian<br />
Coradi, Zürich; Dr. med. Madeleine Erlanger, Zürich; lic. phil. Michael Funk,<br />
Zürich; Chaviva Friedmann, Zürich; Ruben Glückmann, Zürich; Katja Guth,<br />
Basel; Erich A. Hausmann, Zürich; Dr. Helena Kanyar, Basel; lic. phil. Madeleine<br />
Lerf, Zürich; Rhoda Schnur, St.Gallen; Dr. Eric Teitler, Zürich; Prof. Henry Wermus,<br />
Genf; Nina Zafran-Sagal, Herrliberg; Dr. Rudolf Zipkes, Zürich.<br />
35
Warme Mahlzeiten für jüdische Kin<strong>der</strong> in Polen: Spendenaufruf des „Bundes <strong>der</strong> Israelitischen<br />
Frauenvereine in <strong>der</strong> Schweiz“, 1937.<br />
36
Datenbank- und Verfilmungsprojekte<br />
Findmittel zu jüdischen Quellen in <strong>der</strong> Schweiz<br />
Bisher fehlt ein Überblick über das in <strong>der</strong> Schweiz reichhaltig vorhandene<br />
Kulturgut zur jüdischen Geschichte. Zweck des von <strong>der</strong> Dokumentationsstelle<br />
Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> mit Unterstützung des SIG initiierten Projektes ist es,<br />
diese Quellenmaterialien in einer Datenbank zu erfassen und einzelne Institutionen<br />
bei <strong>der</strong> Sicherung gefährdeter Bestände und in <strong>Archiv</strong>ierungsfragen<br />
zu beraten. Dabei wird vom Konzept einer dezentralisierten Aufbewahrung<br />
in den einzelnen Regionen ausgegangen.<br />
Zunächst konzentriert sich das Projekt auf die <strong>Archiv</strong>e <strong>der</strong> jüdischen<br />
Gemeinden. Da manche von ihnen auf Grund <strong>der</strong> demografischen Entwicklungen<br />
nicht mehr aktiv und in ihrem Fortbestehen gefährdet sind, ist<br />
Handlungsbedarf geboten, damit die wertvollen historischen Quellen auch<br />
künftig erhalten bleiben.<br />
In <strong>der</strong> Berichtsperiode wurden für das Pilotprojekt drei jüdische Gemeinden<br />
ausgewählt. Frau lic. phil. Sandra Stu<strong>der</strong>, Mitarbeiterin des <strong>Archiv</strong>s für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong>, machte dieses <strong>2006</strong> zum Inhalt ihrer Diplomarbeit an <strong>der</strong><br />
Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur: „Aufbau eines zentralen Quellennachweises<br />
für jüdische Gemeindearchive in <strong>der</strong> Schweiz – Pilotprojekt<br />
in Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Dokumentationsstelle Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich“. Für ihre Studie hat sie bei<br />
den jüdischen Gemeinden von Biel, La Chaux-de-Fonds und Kreuzlingen eine<br />
Grobinventarisierung <strong>der</strong> jeweiligen Gemeindearchive durchgeführt und die<br />
relevanten Daten für das Projekt ermittelt.<br />
Die Datenbank zu jüdischen Quellen in <strong>der</strong> Schweiz soll in den nächsten<br />
Jahren fortlaufend aufgebaut werden und neben Gemeindearchiven auch<br />
an<strong>der</strong>e Bestände einbeziehen.<br />
Bildarchiv Schweizer Juden (BASJ)<br />
Ziel des von Dr. Ralph Weingarten, Leiter des Florence Guggenheim-<strong>Archiv</strong>s,<br />
initiierten Projekts ist es, eine visuelle Dokumentation zum Leben und Wirken<br />
<strong>der</strong> Schweizer Juden aufzubauen. Dadurch sollen dem drohenden Verlust<br />
von Foto- und Bildmaterial zum jüdischen Leben in <strong>der</strong> Schweiz entgegen<br />
gewirkt und <strong>der</strong> Forschung zusätzliche Quellen erschlossen werden. Das<br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> unterstützt das Projekt und ist bestrebt, die Foto-<br />
37
dokumentation mit seinen technischen Mitteln auch elektronisch nutzbar zu<br />
machen. Bisher wurden erste konzeptionelle Vorarbeiten durchgeführt und<br />
mit Dr. Weingarten, <strong>der</strong> die Fe<strong>der</strong>führung für die Realisierung übernommen<br />
hat, eine Kooperationsvereinbarung getroffen.<br />
Bestand „Saly Mayer Annex“, Joint-<strong>Archiv</strong> New York<br />
Mit Hilfe von Walter Gut, Präsident <strong>der</strong> Saly Mayer Memorial Stiftung Zürich,<br />
konnte <strong>der</strong> im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> benutzbare Mikrofilmbestand zum<br />
Nachlass von Saly Mayer durch bedeutende kopierte und digitalisierte Materialien<br />
aus dem Joint-<strong>Archiv</strong> in New York ergänzt werden. Dabei handelt<br />
es sich in erster Linie um Unterlagen zum Wirken des ehemaligen SIG-Präsidenten<br />
als Vertreter des Joint in <strong>der</strong> Schweiz. Von den sogenannten „Lisbon<br />
Conversations“ liegen nun neben den bereits vorhandenen Notizen von Saly<br />
Mayer auch diejenigen von Seiten <strong>der</strong> Vertreter des Joint in Lissabon vor. Die<br />
Wortprotokolle stammen aus den Jahren 1943 bis 1945.<br />
Im Weiteren sind Korrespondenzen von Saly Mayer mit Hilfswerken,<br />
Behörden und Banken sowie mit Nathan Schwalb, darunter Briefe und<br />
Berichte von Verfolgten aus dem Machtbereich <strong>der</strong> Nationalsozialisten aus<br />
den Jahren 1942 bis in die ersten Nachkriegsjahre, elektronisch verfügbar.<br />
Belegt ist auch <strong>der</strong> Empfängerkreis, <strong>der</strong> von Saly Mayer als Vertreter des Joint<br />
Unterstützungsbeiträge erhielt.<br />
Für die Realisierung des Projekts, für das unsere Mitarbeiterin lic. phil.<br />
Sandra Stu<strong>der</strong> in New York tätig war, danken wir <strong>der</strong> Saly Mayer Memorial<br />
Stiftung Zürich und ihrem Präsidenten Walter Gut, Frau Sherry Hyman und<br />
Herrn Misha Mitsel vom <strong>Archiv</strong> des American Jewish Joint Distribution<br />
Committee.<br />
Veranstaltungen, Kooperationen<br />
Holocaustgedenktag im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Das Angebot, Gymnasialklassen ins <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> einzuladen,<br />
steht im Kontext einer gesamteuropäischen Initiative <strong>der</strong> Erziehungsminister,<br />
den 27. Januar als offiziellen Holocaustgedenktag in den Schulen zu etablieren<br />
und die Jugend an diesem Tag über die Shoah sowie die Auswirkungen<br />
von Rassismus und Antisemitismus zu informieren. Die von Daniel Gerson<br />
organisierten Veranstaltungen wurden <strong>2005</strong> und <strong>2006</strong> rege besucht. Die<br />
Durchführung erfolgte in Zusammenarbeit mit Dr. Karl Kistler, Geschichtsdi-<br />
38
Dringend benötigte Hilfsgel<strong>der</strong> für verfolgte Juden in Europa: Dankesbrief des Verbands<br />
Schweizerischer Jüdischer Flüchtlingshilfen an Saly Mayer, den Vertreter des American Jewish<br />
Joint Distribution Committee vom 3. Juni 1946.<br />
39
daktiker an <strong>der</strong> Universität Zürich, <strong>der</strong> den Kontakt zu interessierten Lehrern<br />
und Lehrerinnen herstellte. Jeweils im Zentrum standen die Erinnerungen <strong>der</strong><br />
Zeitzeugen, welche die Zuhörenden sehr berührten. Die von Daniel Gerson<br />
mo<strong>der</strong>ierte Diskussion zwischen Zeitzeugen und Schülern bot Gelegenheit<br />
zu Nachfragen. Eine kleine Ausstellung mit Dokumenten aus den Beständen<br />
<strong>der</strong> Dokumentationsstelle Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> reflektierte den Bezug<br />
des Holocaust zur Schweiz.<br />
Januar <strong>2005</strong> – Besuch von vier Gymnasialklassen<br />
Sechzig Jahre nach <strong>der</strong> Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau<br />
lud die Dokumentationsstelle Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> Schülerinnen<br />
und Schüler <strong>der</strong> Kantonsschulen Bülach, Hohe Promenade, Rämibühl und<br />
Wetzikon zur Begegnung mit folgenden Überlebenden des Holocaust ein:<br />
Dr. Jerzy Czarnecki wurde im ostpolnischen Mosty Wielkie geboren. Mit<br />
Ausnahme eines Bru<strong>der</strong>s wurden alle Familienmitglie<strong>der</strong> ermordet. Er selbst<br />
überlebte die Verfolgung getarnt als „arischer“ Zwangsarbeiter. Nach <strong>der</strong><br />
Befreiung durch die Rote Armee studierte er in Warschau und arbeitete<br />
anschliessend als Atomphysiker. In Folge <strong>der</strong> antisemitischen Kampagne<br />
in Polen von 1968 emigrierte Jerzy Czarnecki mit seiner Familie 1970 in die<br />
Schweiz, wo er am Paul-Scherrer-Institut in Würenlingen tätig war.<br />
Seine Erinnerungen sind unter dem Titel „Mein Leben als Arier. Jüdische<br />
Familiengeschichte in Polen zur Zeit <strong>der</strong> Schoáh und als Zwangsarbeiter in<br />
Deutschland“ im Hartung-Gorre-Verlag, Konstanz 2002, erschienen.<br />
Edith Goldberger wurde 1944 zusammen mit ihren Eltern und fünf Geschwistern<br />
von Ungarn nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Sie hat als<br />
einzige ihrer Familie die Shoah überlebt. 1947 konnte sie für einen Kuraufenthalt<br />
in die Schweiz einreisen. Anfang <strong>der</strong> fünfziger Jahre heiratete sie<br />
einen jüdischen Schweizer und gründete in Basel eine Familie. Im <strong>Archiv</strong> für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> berichtete sie erstmals über ihre traumatischen Erfahrungen<br />
während des Holocaust.<br />
Eva Koralnik gelangte als Kind Ende 1944 zusammen mit Mutter und<br />
Schwester dank dem Einsatz des Konsularbeamten Harald Feller aus Budapest<br />
nach St.Gallen, wo ihre Schweizer Grosseltern lebten. So entkamen sie<br />
dem Massenmord <strong>der</strong> Nationalsozialisten und ihrer ungarischen Verbündeten.<br />
Ihr Vater überlebte die Zwangsarbeit in Ungarn und konnte erst nach<br />
Kriegsende in die Schweiz ausreisen. Nach jahrelangen Schikanen durch die<br />
40
Zeitzeuge Jerzy Czarnecki im Gespräch mit Gymnasiasten im AfZ, 27. Januar <strong>2005</strong>.<br />
Fremdenpolizei durfte sich die Familie dauerhaft in <strong>der</strong> Schweiz nie<strong>der</strong>lassen.<br />
Eva Koralnik leitet heute eine renommierte Literaturagentur. Ihre Schwester<br />
Dr. iur. Vera Rottenberg Liatowitsch wirkt als Bundesrichterin in Lausanne.<br />
Cioma Schönhaus wurde als Kind russisch-jüdischer Migranten in Berlin<br />
geboren. Nach <strong>der</strong> Deportation seiner Eltern tauchte er unter und überlebte<br />
mehrere Monate in <strong>der</strong> Illegalität. Schönhaus fälschte Pässe, um Juden vor<br />
<strong>der</strong> Deportation zu bewahren. Als er steckbrieflich gesucht wurde, floh er<br />
1943 in die Schweiz. Er liess sich in Basel zum Grafiker ausbilden und gründete<br />
eine Familie. Seine Erinnerungen an die Shoah veröffentlichte er 2004<br />
unter dem Titel „Der Passfälscher. Die unglaubliche Geschichte eines jungen<br />
Grafikers, <strong>der</strong> im Untergrund gegen die Nazis kämpfte“. (Hrsg. von Marion<br />
Neiss, Frankfurt am Main: Scherz-Verlag).<br />
Die Begegnungen wurden in Wort und Bild festgehalten, so dass diese<br />
Zeitzeugnisse im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> auch für zukünftige Generationen<br />
erhalten bleiben. Der Anlass stiess auch auf reges Interesse bei den Medien<br />
(u.a. ausführliche Berichterstattung durch TeleZüri, im Tages-Anzeiger und<br />
in <strong>ETH</strong> Life).<br />
Januar <strong>2006</strong> – gemeinsame Einladung mit „Tamach“<br />
Am 27. Januar <strong>2006</strong> wurden Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> Zürcher Kantonsschulen<br />
Hohe Promenade und Rämibühl sowie <strong>der</strong> Gymnasien Kreuzlingen<br />
und Rychenberg (Winterthur) ins <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> eingeladen. Am<br />
Vormittag stand die Begegnung mit Zeitzeugen im Vor<strong>der</strong>grund:<br />
41
Maja Antosiewicz wurde in eine Familie des deutsch-jüdischen Bürgertums<br />
in Aachen geboren. Nach dem Tod <strong>der</strong> Mutter 1938 konnte die an Tuberkulose<br />
leidende junge Frau zur Kur in die Schweiz reisen. Dieser Umstand rettete<br />
ihr Leben, da die Schweiz zu diesem Zeitpunkt Kuraufenthalte für deutsche<br />
Juden noch gestattete. Vater und Schwester wurden im Zweiten Weltkrieg<br />
deportiert und ermordet.<br />
Jake Fersztand war noch ein kleiner Junge, als die Deutschen 1939 Polen besetzten.<br />
Der Vater wurde 1942 erschossen. Zusammen mit seiner Mutter und<br />
Schwester überlebte Jake mehrere Konzentrations- und Zwangsarbeitslager.<br />
1944 wurde er von Mutter und Schwester getrennt, kam nach Buchenwald<br />
und wurde schliesslich im Konzentrationslager Theresienstadt am 5. Mai 1945<br />
von <strong>der</strong> Roten Armee befreit. Im Sommer gelangte er mit einem Kin<strong>der</strong>transport<br />
nach Grossbritannien. Nach seiner Ausbildung zum Ingenieur baute er<br />
sich in den fünfziger Jahren in <strong>der</strong> Schweiz eine neue Existenz auf.<br />
Léon Reich wollte Uhrmacher werden, doch verunmöglichte ihm <strong>der</strong> Zweite<br />
Weltkrieg die Fortsetzung <strong>der</strong> begonnenen Lehre in Krakau. Vergeblich versuchte<br />
die grosse Familie, im Versteck ihren Verfolgern zu entkommen. Bis<br />
auf einen Bru<strong>der</strong> und eine Schwester wurden alle Angehörigen von den Deutschen<br />
ermordet. Léon Reich kam in mehrere Konzentrationslager, darunter<br />
Auschwitz und Gross-Rosen und wurde in Buchenwald von amerikanischen<br />
Truppen befreit. Er gelangte im Juni 1945 mit einem Transport jugendlicher<br />
Überleben<strong>der</strong> in die Schweiz. Hier konnte er seine Ausbildung zum Uhrmacher<br />
abschliessen und wurde in Biel ein erfolgreicher Unternehmer.<br />
Am Tag vor <strong>der</strong> Veranstaltung im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> wurde Léon<br />
Reich zusammen mit Edith Goldberger und Gabor Hirsch <strong>der</strong> „Schulpreis“<br />
<strong>der</strong> Stiftung für Erziehung zur Toleranz verliehen.<br />
Am Nachmittag wurde in Zusammenarbeit mit „Tamach, Psychosoziale<br />
Beratungsstelle für Holocaust-Überlebende und ihre Angehörigen in <strong>der</strong><br />
Schweiz“ zur Podiumsdiskussion „Die Shoah als Thema in <strong>der</strong> Schule: Aufarbeitung<br />
mit filmischen Mitteln“ ins <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> eingeladen. Frau<br />
Dr. Revital Ludewig-Kedmi (Tamach), Dr. Kurt Messmer (Pädagogische Hochschule<br />
Zentralschweiz), Eva Pruschy (Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund)<br />
und Daniel Gerson sprachen über die didaktische Vermittlung <strong>der</strong><br />
komplexen Thematik <strong>der</strong> Shoah in Schulen. Anstoss dazu gab das filmische<br />
Porträt von Léon Reich, das von Gabrielle Antosiewicsz in Zusammenarbeit<br />
42
mit dem SIG und „Tamach“ für Unterrichtszwecke gestaltet wurde. Teilnehmende<br />
waren Mitglie<strong>der</strong> von „Tamach“ sowie Lehrerinnen und Lehrer.<br />
Jahrestagung <strong>der</strong> Gesellschaft für Exilforschung, 17.-19. März <strong>2006</strong>:<br />
Europäische Fremdenpolitik im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
Auf Wunsch von Prof. Wolfgang Benz, Vorsitzen<strong>der</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft für<br />
Exilforschung und Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung <strong>der</strong><br />
Technischen Universität Berlin, übernahm<br />
das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
die Gastgeberrolle für <strong>der</strong>en Jahrestagung<br />
im März <strong>2006</strong>. Die Vorbereitung<br />
erfolgte durch Dr. Marion Neiss,<br />
Geschäftsführerin <strong>der</strong> Gesellschaft<br />
für Exilforschung, sowie Dr. Daniel<br />
Gerson, stellvertreten<strong>der</strong> Leiter <strong>der</strong><br />
Dokumentationsstelle Jüdische<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong>.<br />
Die dreitägige Veranstaltung wurde<br />
in <strong>der</strong> Semper-Aula von Prof.<br />
Konrad Osterwal<strong>der</strong>, dem Rektor <strong>der</strong><br />
<strong>ETH</strong> Zürich, eröffnet. Anschliessend<br />
Rektor Prof. Dr. Konrad Osterwal<strong>der</strong> eröffnet<br />
die Jahrestagung <strong>der</strong> Gesellschaft für Exilforschung<br />
in <strong>der</strong> Semper-Aula , 17. März <strong>2006</strong>.<br />
begrüssten Klaus Urner und Wolfgang Benz die zahlreichen Anwesenden.<br />
Die Tagung war <strong>der</strong> „Europäischen Fremdenpolitik im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t“<br />
gewidmet. Die Mehrheit <strong>der</strong> Referate bezog sich jedoch auf den Umgang<br />
<strong>der</strong> Schweiz mit Flüchtlingen und Migranten. Zeitlich am Weitesten zurück<br />
blickte Wolfgang Benz mit seinem Beitrag über „Deutsche Exilanten in <strong>der</strong><br />
Schweiz im Ersten Weltkrieg“. Den Bogen in die Gegenwart schlug Prof.<br />
Georg Kreis, <strong>der</strong> über „Die Bedeutung <strong>der</strong> Flüchtlingsgeschichte für die<br />
aktuelle Flüchtlingspolitik <strong>der</strong> Schweiz“ sprach. Stefan Mächler fasste in<br />
seinem Beitrag „Die Schweiz und die jüdischen Flüchtlinge 1933-1945“ das<br />
wohl dunkelste Kapitel <strong>der</strong> schweizerischen Flüchtlingspolitik zusammen.<br />
Von Seiten des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> referierten Uriel Gast zum Thema<br />
„Schweizerische Flüchtlings- und Asylpolitik – Forschungsgrundlagen im<br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich“ und Daniel Gerson über „Ägyptischjüdische<br />
Flüchtlinge in <strong>der</strong> Schweiz im Kontext <strong>der</strong> Suez-Krise von 1956“.<br />
43
Am Freitagabend lasen Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft für Exilforschung im<br />
Literaturhaus Texte zum Thema „Wo es hell ist, dort ist die Schweiz“. Am<br />
Sonntagvormittag wurde im Lesesaal des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> getagt.<br />
Martin Dreyfus führte anschliessend zahlreiche Interessierte unter dem<br />
Motto „Wenn Sie da herumgehen wollen, dann müssen Sie eine Menge<br />
Zeit haben“ auf den Spuren literarischer Emigranten durch die Altstadt<br />
Zürichs. Für die Pausenverpflegung sei <strong>der</strong> Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
gedankt.<br />
Buchvernissage Lajser Ajchenrand, 20. September <strong>2006</strong><br />
Lajser Ajchenrand (s.a. S. 25) überlebte den Holocaust – dem die meisten Mitglie<strong>der</strong><br />
seiner Familie zum Opfer fielen – nur dank einer Vielzahl glücklicher<br />
Umstände, die ihn 1942 in die<br />
Schweiz gelangen liessen.<br />
Das Wissen, ein Überleben<strong>der</strong><br />
zu sein, <strong>der</strong> nur durch<br />
Zufall <strong>der</strong> deutschen Judenvernichtungspolitik<br />
entkommen<br />
war, prägt sein Werk, das<br />
an diesem Abend durch die<br />
einfühlsame Lesung seiner<br />
Gedichte auf jiddisch durch<br />
Claire Ajchenrand und auf deutsch durch Egon Ammann dem Publikum<br />
eindrücklich nahe gebracht wurde.<br />
Mit <strong>der</strong> Publikation von Lajser Ajchenrands Gedichtband „Aus <strong>der</strong> Tiefe.<br />
Gedichte jiddisch und deutsch“ wurde einer <strong>der</strong> bedeutendsten Dichter jiddischer<br />
Sprache dem Vergessen entrissen. Zu verdanken ist dies dem Verleger<br />
Egon Ammann, <strong>der</strong> damit ein noch zu Lebzeiten des Dichters eingegangenes<br />
Versprechen einlöste, aber auch <strong>der</strong> Witwe Claire Ajchenrand, die das Werk<br />
ihres 1985 verstorbenen Gatten betreut. Die Buchvernissage, in die von Seiten<br />
des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> Uriel Gast einführte, wurde durch eine kleine<br />
Ausstellung zum Leben des Dichters ergänzt.<br />
Buchvernissage Zsolt Keller, 9. November <strong>2006</strong><br />
In seinem Buch „Der Blutruf (Mt 27,25). Eine schweizerische Wirkungsgeschichte<br />
1900-1950“, die <strong>2006</strong> im Göttinger Verlag Vandenhoeck & Ruprecht<br />
erschienen ist, untersucht lic. sc. rel. Zsolt Keller, ehemaliger Mitarbeiter des<br />
44
<strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong>, die Bedeutung und die fatalen Folgen des neutestamentarischen<br />
Verses „Sein Blut komme über uns und unsere Kin<strong>der</strong>“<br />
im Kontext des Antijudaismus und des judenfeindlichen Diskurses in <strong>der</strong><br />
Schweiz. Für die Studie wurden auch Quellen aus dem SIG- und JUNA-<strong>Archiv</strong><br />
ausgewertet. Prof. Klaus Urner, Prof. Jacques Picard und Prof. Max Küchler, <strong>der</strong><br />
das Vorwort zum Buch schrieb, sowie <strong>der</strong> Autor führten in die Thematik ein.<br />
Task Force for International Cooperation on Holocaust Education,<br />
Remembrance and Research (ITF)<br />
Die Task Force for International Cooperation on Holocaust Education,<br />
Remembrance and Research geht auf eine Initiative des damaligen schwedischen<br />
Aussenministers Göran Persson im Jahre 1998 zurück. Sie bezweckt<br />
eine internationale Zusammenarbeit von Regierungen, Wissenschaftlern,<br />
Bildungsexperten sowie nichtstaatlichen Organisationen.<br />
Am 18. Mai 2004 beschloss <strong>der</strong> Bundesrat, dass die Schweiz in <strong>der</strong> ITF mitarbeiten<br />
soll. Anlässlich <strong>der</strong> Vollversammlung <strong>der</strong> ITF vom 13. bis 16. Dezember<br />
2004 in Triest wurde die Schweiz formell als Mitglied aufgenommen. In <strong>der</strong><br />
Task Force sind gegenwärtig 24 Staaten vertreten.<br />
Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> wurde vom EDA eingeladen, sich an einer<br />
Begleitgruppe bestehend aus Vertretern staatlicher und nichtstaatlicher<br />
Institutionen und Organisationen zu beteiligen. Es delegierte hierfür Daniel<br />
Gerson, <strong>der</strong> zusammen mit Prof. Jacques Picard zum Vertreter <strong>der</strong> Schweiz in<br />
<strong>der</strong> Academic Working Group <strong>der</strong> ITF ernannt wurde. Diese för<strong>der</strong>t wissenschaftliche<br />
Projekte zum Holocaust und engagiert sich für die pädagogische<br />
Vermittlung <strong>der</strong> Forschungsergebnisse.<br />
Daniel Gerson nahm als Schweizer Vertreter dieser Gruppe an den Vollversammlungen<br />
<strong>der</strong> ITF vom 26. bis 29. Juni <strong>2005</strong> in Warschau, vom 12. bis<br />
17. November <strong>2005</strong> in Krakau und vom 3. bis 6. Dezember <strong>2006</strong> in Budapest<br />
teil. Am 17. Juni <strong>2005</strong> und am 14. Dezember <strong>2005</strong> vertrat er das <strong>Archiv</strong> für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> an den Sitzungen <strong>der</strong> ITF-Begleitgruppe in Bern. Im Zusammenhang<br />
mit <strong>der</strong> Arbeit <strong>der</strong> ITF stand auch seine Teilnahme an <strong>der</strong> von <strong>der</strong><br />
Schweizerischen Konferenz <strong>der</strong> Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) organisierten<br />
nationalen Tagung „Unterrichten in <strong>der</strong> Schweiz zur Erinnerung<br />
an den Holocaust“ vom 19. Dezember <strong>2005</strong> in Bern.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Kooperation mit <strong>der</strong> ITF wurden das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
und das <strong>Archiv</strong> des Internationalen Roten Kreuzes in Genf als einzige<br />
45
Schweizer Institutionen in die von <strong>der</strong> Stiftung Topographie des Terrors in<br />
Berlin betreute Website http://www.memorial-museums.net aufgenommen,<br />
auf <strong>der</strong> die weltweit wichtigsten Institutionen im Bereich <strong>der</strong> Erinnerungsarbeit<br />
bezüglich des Holocaust festgehalten sind.<br />
Kolloquium zum Jüdischen <strong>Archiv</strong>wesen, Marburg 13.-15. September<br />
<strong>2005</strong><br />
Aus Anlass des 100. Jahrestags <strong>der</strong> Gründung des Gesamtarchivs <strong>der</strong> deutschen<br />
Juden veranstalteten <strong>der</strong> „Zentralrat <strong>der</strong> Juden in Deutschland“, das<br />
„Zentralarchiv für die Erforschung <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> Juden in Deutschland“<br />
und die „<strong>Archiv</strong>schule Marburg“ ein Kolloquium zum jüdischen <strong>Archiv</strong>wesen,<br />
an dem Uriel Gast über die Sicherung gefährdeter Quellen zur schweizerisch-jüdischen<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> und über Erfahrungen beim Aufbau <strong>der</strong><br />
Dokumentationsstelle Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> sprach.<br />
Ausstellungen<br />
An <strong>der</strong> von Dr. Helena Kanyar an <strong>der</strong> Universitätsbibliothek Basel organisierten<br />
Ausstellung (28.10. bis 16.12.<strong>2005</strong>) zur Thematik „Gerettetes Leben:<br />
Diplomatische und undiplomatische Hilfe für verfolgte Juden in Ungarn<br />
und in <strong>der</strong> Schweiz“ beteiligte sich auch das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> mit<br />
Dokumenten aus dem Nachlass von Carl Lutz.<br />
Ebenso stellte das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> für die von Frau Dr. Kanyar an<br />
<strong>der</strong> Universität Bern (Unitobler) organisierte Ausstellung über Getrud Lutz-<br />
Fankhauser „Diplomatin und Humanistin“ (3.11. bis 4.12.<strong>2006</strong>) Zeitzeugnisse<br />
zur Verfügung.<br />
46
Dokumentationsstelle Wirtschaft und <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Am 27. und 28. November <strong>2006</strong> wurde zwischen economiesuisse und <strong>der</strong><br />
<strong>ETH</strong> Zürich eine Schenkungsvereinbarung unterzeichnet mit dem Ziel <strong>der</strong><br />
„Sicherung, Erschliessung und Nutzbarmachung des historischen <strong>Archiv</strong>s<br />
des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins (SHIV) sowie <strong>der</strong> Dokumentationen<br />
<strong>der</strong> Gesellschaft zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> schweizerischen Wirtschaft<br />
(wf).“<br />
Die Schenkung an das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> umfasst mehr als einen<br />
Laufkilometer Akten. Dazu gehört in erster Linie das SHIV-<strong>Archiv</strong>, das von <strong>der</strong><br />
Gründungskorrespondenz 1869 bis ins Jahr 2000 reicht, als <strong>der</strong> Vorort im neuen<br />
Dachverband economiesuisse aufging. Neben den wirtschaftspolitischen<br />
Dossiers setzt sich <strong>der</strong> Bestand insbeson<strong>der</strong>e aus den Protokollserien <strong>der</strong><br />
Verbandsgremien, Handakten von Direktoren und Sekretären, sogenannten<br />
Missivenbüchern mit ausgehen<strong>der</strong> Korrespondenz, Eigenschriften und einer<br />
umfangreichen Wirtschaftsbibliothek zusammen.<br />
Bestätigt wurde auch die bereits früher erfolgte Schenkung <strong>der</strong> über 400<br />
Laufmeter Materialien <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung (wf). Sie enthalten eine <strong>der</strong><br />
umfangreichsten historischen Dokumentationen zur Schweizer Wirtschaft<br />
mit rund 3500 Sachdossiers aus dem Zeitraum 1943 bis 1993.<br />
Mit <strong>der</strong> Umwandlung des bisherigen Depots des Wirtschaftsdachverbandes<br />
in eine Schenkung sind die Grundlagen für eine langfristige Sicherung dieses<br />
Kernbestandes zur schweizerischen Wirtschafts- und Aussenwirtschaftspolitik<br />
gelegt worden. Economiesuisse ist an dieser Stelle für die Schenkung<br />
und die finanzielle Unterstützung seit 1995 zu danken. Sie ermöglichten den<br />
Aufbau <strong>der</strong> Dokumentationsstelle Wirtschaft und <strong>Zeitgeschichte</strong>, die im Berichtszeitraum<br />
durch die Übernahme <strong>der</strong> historischen <strong>Archiv</strong>e <strong>der</strong> Zentrale<br />
für Wirtschaftsdokumentation <strong>der</strong> Universität Zürich weiter an Bedeutung<br />
gewann. Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> erachtet es als ideelle Verpflichtung,<br />
das überantwortete Kulturerbe gemeinsam mit interessierten Kreisen <strong>der</strong><br />
Privatwirtschaft zu bewahren und für die Forschung nutzbar zu machen.<br />
Deshalb gilt es nun, das angestrebte För<strong>der</strong>ungswerk zu konkretisieren,<br />
damit <strong>der</strong> angenommene Auftrag zur Langzeitarchivierung und die damit<br />
verbundenen Aufgaben finanziert werden können.<br />
47
Erschliessungen<br />
<strong>Archiv</strong>e economiesuisse – Verband <strong>der</strong> Schweizer Unternehmen<br />
In den Jahren <strong>2005</strong> und <strong>2006</strong> wurden von lic. phil. Philipp Hofstetter und<br />
Sabina Bellofatto zusammen mit Praktikantinnen und Praktikanten in <strong>der</strong><br />
Arbeit am Vorort-<strong>Archiv</strong> drei Schwerpunkte gesetzt. Erschlossen wurden<br />
rund 130 Laufmeter Kernakten zur Verbandstätigkeit bis ins Jahr 2000 und<br />
sachthematische Unterlagen bis 1980. Um einen benutzerfreundlichen<br />
Zugang zu ermöglichen und die Originale künftig zu schonen, wurden zum<br />
zweiten die Protokolle des Vororts ab dem Geschäftsjahr 1924 digitalisiert.<br />
Und schliesslich erfolgte drittens die Einarbeitung <strong>der</strong> umfangreichen historischen<br />
Vorort-Bibliothek mit Büchern älterer Provenienz im Umfang von 60<br />
Laufmetern in die systematisch geordneten Buchbestände des <strong>Archiv</strong>s für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong>. Im Rahmen dieses Projekts wurden die Publikationen nach<br />
Themen o<strong>der</strong> Reihen in <strong>der</strong> zentralen Datenbank erfasst, womit sie nun auch<br />
recherchiert werden können und für die Benutzung zugänglich sind.<br />
Vorort-<strong>Archiv</strong><br />
Zentrale Verbandsakten – Erschliessung bis zur Gründung von economiesuisse<br />
(2000)<br />
Aus <strong>der</strong> Nachlieferung 2004 von economiesuisse wurden zunächst zentrale<br />
Unterlagen im Umfang von rund 42 Laufmetern säurefrei verpackt und in<br />
<strong>der</strong> Datenbank detailliert verzeichnet. Kernakten zu Vereinsangelegenheiten,<br />
Handakten und wichtige Sachdossiers zu Themen wie Landesverteidigung,<br />
Recht und Gesetz, Wirtschafts- und Konjunkturpolitik sowie Energiepolitik<br />
bis zur Gründung von economiesuisse sind damit bereits für die künftige<br />
Nutzung aufbereitet. Unter den Vereinsangelegenheiten wurden insbeson<strong>der</strong>e<br />
wichtige jüngere Reihen von Protokollen und Missiven erfasst.<br />
Die Handakten von Sekretären und <strong>der</strong> Direktoren Gerhard Winterberger<br />
(1970-1987) und Kurt Moser (1987-1998) beinhalten <strong>der</strong>en Korrespondenzen,<br />
Notizen und Referate.<br />
Im thematischen Bereich <strong>der</strong> Landesverteidigung sind Gesetzes- und Abstimmungsvorlagen,<br />
insbeson<strong>der</strong>e zur Beschaffung <strong>der</strong> F/A-18 Kampfjets und<br />
zur Revision des Kriegsmaterialgesetzes wie auch <strong>der</strong> Rat für Gesamtverteidigung<br />
in den 1980er und 1990er Jahren dokumentiert. Der Teilbestand zu<br />
Recht und Gesetz wurde komplett neu geglie<strong>der</strong>t und in zwei Hauptkapitel<br />
zum öffentlichen und zum privaten Recht eingeteilt. Im öffentlichen Bereich<br />
48
„...es sollten sich die Industriellen <strong>der</strong> Schweiz zu Sicherung <strong>der</strong> kommerziellen und<br />
gewerblichen Zwecke vereinigen.“: Rundschreiben <strong>der</strong> Glarner Handelskommission<br />
vom 30. März 1869 an die Zürcher Handelskammer mit dem Vorschlag zur nationalen<br />
Organisation wirtschaftspolitischer Interessen (v.l.n.r. Gründungsväter Hans Wun<strong>der</strong>ly-von<br />
Muralt, Eduard Blumer, Conrad Cramer-Frey, Conrad Widmer-Heusser).<br />
49
dominieren Fragen wie die Totalrevision <strong>der</strong> Bundesverfassung, Justiz- und<br />
Verwaltungsreformen sowie insbeson<strong>der</strong>e in den 1980er und 1990er Jahren<br />
die Staats-, Personen- und Datenschutzproblematik. Privatrechtlich interessante<br />
Dossiers betreffen neben <strong>der</strong> Entwicklung von Versandkontrolle und<br />
Haftpflichtrecht vor allem die Spielbankengesetzgebung o<strong>der</strong> etwa den<br />
Übergang zum Sharehol<strong>der</strong>denken im Gesellschaftsrecht zu Beginn <strong>der</strong><br />
1990er Jahre.<br />
Das Kapitel zur Wirtschafts- und Konjunkturpolitik wurde durch bedeutende<br />
Neuzugänge bereichert zu Themen wie das öffentliche Beschaffungswesen,<br />
Liberalisierung und Deregulierung, Eurolex / Swisslex, Asyl und Migration,<br />
Exportför<strong>der</strong>ung und Exportrisikogarantie, Revision des Kartellgesetzes<br />
in den 1990er Jahren, Bodenrecht, Mietrecht, Lex Friedrich, Raumplanung,<br />
Regionalpolitik, KMU und Konsumkreditgesetz.<br />
Bei <strong>der</strong> Erschliessung wichtiger Sachdossiers wurde das Ziel weiterverfolgt,<br />
auf breiter Basis Unterlagen bis ins Jahr 1980 zugänglich zu machen.<br />
Erreicht wurde dies im Bereich <strong>der</strong> Finanz- und Fiskalpolitik (8 Laufmeter),<br />
wo sich interessante Dossiers zu<br />
Kapitalexporten in den 1950er<br />
Jahren und zur hitzig geführten<br />
Diskussion über den Zusammenhang<br />
von Export und flexiblen<br />
Wechselkursen in den 1970er<br />
Jahren finden. Weitere Themen<br />
sind hier die Bundesfinanzen,<br />
Banken, Steuern, Steuerrekurskommission,<br />
Doppelbesteuerung<br />
und Aktienrecht.<br />
In die Umweltpolitik (3 Laufmeter)<br />
griff <strong>der</strong> Vorort ab 1970<br />
verstärkt ein. Durch einen technischen<br />
Berater wurden zunächst<br />
Mitwirkungsmöglichkeiten<br />
sondiert. Es folgten die<br />
Positionsbezug <strong>der</strong> Gesellschaft zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
schweizerischen Wirtschaft zur Bauerninitiative 1952<br />
(wf-Abstimmungsplakate).<br />
Mitarbeit in den verschiedenen<br />
eidgenössischen Kommissionen<br />
und die Koordination <strong>der</strong> Privat-<br />
50
wirtschaft in einem eigenen Gremium, <strong>der</strong> Arbeitsgruppe Umweltschutz.<br />
In <strong>der</strong> Landwirtschaftspolitik (9 Laufmeter) stand nach Beendigung des<br />
Zweiten Weltkriegs erneut die Paritätsfor<strong>der</strong>ung bei den Löhnen über entsprechende<br />
Mechanismen des Produktepreisausgleichs zur Debatte. Mit dem<br />
Landwirtschaftsgesetz vom 3. Oktober 1951 war die Grundlage geschaffen, auf<br />
<strong>der</strong> sich in <strong>der</strong> Folge <strong>der</strong> landwirtschaftliche Rationierungs- und Kontrollapparat<br />
<strong>der</strong> kriegswirtschaftlichen Organisation in einen protektionistischen<br />
Gesetzesdschungel umzuwandeln begann.<br />
Der Vorort äusserte sich dazu lange Zeit kaum kritisch. Anfänglich wurden<br />
die Eingaben an den Bund sogar gemeinsam mit dem Bauernverband getragen.<br />
Erst in den 1960er Jahren liessen sich skeptische Stimmen bezüglich <strong>der</strong><br />
statistischen Datenerhebung des Bauernsekretariats in Brugg vernehmen.<br />
Während aber bis Ende <strong>der</strong> 1970er Jahre <strong>der</strong> Status Quo im Bauernschutz<br />
beibehalten wurde, fand erst in den 1980er Jahren eine Wertediskussion in<br />
<strong>der</strong> Agrarpolitik statt. Der Vorort war dabei ein Akteur unter vielen, die den<br />
Wandel vorantrieben.<br />
Bei <strong>der</strong> Arbeits- und Sozialpolitik (4 Laufmeter) standen zum einen Sozialversicherungsfragen<br />
wie die Arbeitslosen- und die Krankenversicherung<br />
sowie die Erwerbsersatzfrage im Mittelpunkt. Beson<strong>der</strong>s gut dokumentiert<br />
sind die Gesetzesrevisionen zwischen 1959 und 1974, als die Krankenversicherungskonzepte<br />
Hauptthema waren. Mit den neuen Wirtschafts- und<br />
Sozialartikeln war 1947 die verfassungsrechtliche Basis für die Arbeitslosenversicherung<br />
geschaffen worden. Das am 22. Juni 1951 erlassene Bundesgesetz<br />
über die Arbeitslosenversicherung überführte dann den Inhalt des<br />
bisherigen Vollmachtenbeschlusses in das ordentliche Recht.<br />
Die wirtschaftliche Rezession Mitte <strong>der</strong> 1970er Jahre erfor<strong>der</strong>te später eine<br />
Anpassung <strong>der</strong> Versicherung. So erschien die Einführung eines Versicherungsobligatoriums<br />
dringlich, für dessen Ausarbeitung eine Expertenkommission<br />
eingesetzt wurde. Da jedoch das Zustandekommen eines solchen Gesetzes<br />
einige Zeit in Anspruch nahm, entschied man sich für eine Übergangsregelung.<br />
Diese wurde erst am 25. Juni 1982 durch das Bundesgesetz über die<br />
obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung<br />
abgelöst.<br />
Die Akten zu dieser Phase umfassen insbeson<strong>der</strong>e Materialien zu den<br />
Sitzungen <strong>der</strong> Expertenkommission für eine Neukonzeption <strong>der</strong> Arbeitslosenversicherung.<br />
Im Weiteren befinden sich Unterlagen zu Umfragen<br />
51
im Teilbestand, welche die Än<strong>der</strong>ungen betreffen, die <strong>der</strong> Anstieg <strong>der</strong><br />
Arbeitslosenzahlen anfangs <strong>der</strong> 1990er Jahre mit sich brachte. Es finden<br />
sich in diesem sozialpolitischen Kapitel aber auch Akten zur Europäischen<br />
Sozialcharta und zur Menschenrechtskonvention, in welchen die Frage nach<br />
einem Beitritt beziehungsweise einer Ratifikation seitens <strong>der</strong> Schweiz eher<br />
passiv dokumentiert wird.<br />
Im Bereich <strong>der</strong> Verkehrspolitik (11 Laufmeter) – ob Strasse o<strong>der</strong> Schiene,<br />
Wasser o<strong>der</strong> Luft betreffend – intervenierte <strong>der</strong> Vorort entschieden aktiver.<br />
Der Verband machte seinen Einfluss etwa in <strong>der</strong> Kommerziellen Konferenz<br />
<strong>der</strong> schweizerischen Transportunternehmungen zur Festlegung <strong>der</strong> Transporttarife<br />
im Eisenbahnverkehr geltend o<strong>der</strong> im Zusammenhang mit <strong>der</strong><br />
Abstimmung über die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA)<br />
im Jahr 1998. Beson<strong>der</strong>s interessant sind die Akten zur Neugründung <strong>der</strong><br />
Swissair als nationale Fluggesellschaft und zum Bau <strong>der</strong> internationalen<br />
Flughäfen am Ende des Zweiten Weltkriegs.<br />
Wirtschaftsbeziehungen zu einzelnen Län<strong>der</strong>n (1950-1980)<br />
Unter Mitarbeit von Anna Sieg wurde die Erschliessung von Akten zu Beziehungen<br />
<strong>der</strong> Schweiz zu einzelnen Län<strong>der</strong>n weiter vorangetrieben. In diesen<br />
Dossiers spiegelt sich die Tätigkeit einer bilateralen Wirtschaftsdiplomatie,<br />
die nach <strong>der</strong> allmählichen Ablösung durch die multilaterale Verhandlungsweise<br />
ein kleines Comeback in <strong>der</strong> Krisenphase <strong>der</strong> 1970er Jahre erlebte.<br />
Neu wurden im Bereich <strong>der</strong> europäischen Län<strong>der</strong> die Unterlagen zu Jugoslawien<br />
und Slowenien (16 Laufmeter) für die Forschung zugänglich gemacht.<br />
Sie illustrieren vorwiegend den Beginn eines verstärkten Schweizer Engagements<br />
in den 1970er Jahren und reichen – noch innerhalb <strong>der</strong> Schutzfrist<br />
– bis in die Zeit nach 1992.<br />
Unterlagen zur Sowjetunion (5 Laufmeter) wurden geson<strong>der</strong>t von den<br />
Russland- und an<strong>der</strong>en Nachfolgestaaten-Akten erschlossen. Die Dossiers<br />
umfassen die Jahre 1968 bis 1991, wobei zu <strong>der</strong> letzten Phase noch Nachlieferungen<br />
zu erwarten sind. Neben den für bilaterale Beziehungen üblichen<br />
Verhandlungsdossiers (oft zu gemischten Kommissionen), Wirtschaftsberichten<br />
und Korrespondenzen finden sich hier ebenfalls die Akten <strong>der</strong><br />
privatwirtschaftlichen sogenannten Interessengemeinschaft Schweiz - Sowjetunion.<br />
Diese war 1972 zur Intensivierung des Kontakts mit sowjetischen<br />
Wirtschaftsvertretern gegründet worden, den in <strong>der</strong> Schweizer Botschaft in<br />
Moskau tätige wissenschaftliche Mitarbeiter vermittelnd organisierten.<br />
52
Treffen <strong>der</strong> schweizerischen und irakischen Delegation zur Aushandlung des „Abkommen vom<br />
11. Februar 1978 über den Handelsverkehr sowie die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit<br />
zwischen <strong>der</strong> Schweizerischen Eidgenossenschaft und <strong>der</strong> Republik Irak“.<br />
Im Län<strong>der</strong>dossier zu Portugal sind die Jahre 1955 bis 1964 während <strong>der</strong> Diktatur<br />
und die Krisenphase zwischen 1974 und 1976, in jenem zu Spanien etwa<br />
jene des Freihandelsabkommens mit <strong>der</strong> EFTA von 1978 gut dokumentiert.<br />
Neu zugänglich sind schliesslich auch weitere Län<strong>der</strong>dossiers zu Irland,<br />
Malta, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Tschechoslowakei,<br />
Ungarn und Zypern.<br />
Mit den Län<strong>der</strong>n des Nahen und Mittleren Ostens und Afrika (8 Laufmeter)<br />
trat die Schweiz insbeson<strong>der</strong>e im Verlauf <strong>der</strong> Entkolonialisierung in bilaterale<br />
Wirtschaftsverhandlungen. Die höchste Aktendichte erstreckt sich von<br />
<strong>der</strong> Mitte <strong>der</strong> 1950er Jahre bis Ende <strong>der</strong> 1970er Jahre. Mit Beginn <strong>der</strong> 1980er<br />
Jahre nimmt sie dagegen stetig ab und ist nur noch für einzelne Län<strong>der</strong><br />
„Schwarzafrikas“ bis Ende <strong>der</strong> 1990er Jahre erheblich. Inhaltlich handelt es<br />
sich grösstenteils um die Dokumentationen <strong>der</strong> Handelsabteilung des EVD,<br />
mit welchen <strong>der</strong> Vorort vom Bund informiert wurde. Es finden sich aber<br />
immer wie<strong>der</strong> auch Korrespondenzen mit <strong>der</strong> OSEC und an<strong>der</strong>en Interessenvertretern,<br />
Umfragen bei den Sektionen und Verhandlungsakten z.B. von<br />
gemischten Kommissionen.<br />
53
Insgesamt wurden für „Schwarzafrika“ rund drei Dutzend und für den arabischen<br />
Raum, den Nahen und Mittleren Osten gegen zwanzig Län<strong>der</strong>dossiers<br />
gebildet, in denen nun systematisch recherchiert werden kann. Dazu<br />
gehören auch Unterlagen zur Türkei o<strong>der</strong> zum Irak, mit dem am 11. Februar<br />
1978 ein Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit geschlossen<br />
wurde.<br />
Materialien zu Asien (7,5 Laufmeter) umfassen die Phase von 1950 bis<br />
1988 mit Län<strong>der</strong>dokumentationen, vereinzelten Verhandlungsakten und<br />
Sachdossiers. Ähnlich strukturiert und mit vergleichbarer Zeitstellung präsentieren<br />
sich die Unterlagen zu Australien, Neuseeland (1.5 Laufmeter) und<br />
Lateinamerika (4,5 Laufmeter).<br />
Sachdossiers – Investitionsrisikogarantie, Statistik, Wissenschaft und Forschung,<br />
Branchen<br />
Das Thema <strong>der</strong> Investitionsrisikogarantie (1 Laufmeter) ist vor allem bis zum<br />
Bundesgesetz über die Investitionsrisikogarantie von 1970 gut dokumentiert.<br />
Interessant sind die Dossiers zu den internationalen Bemühungen zur multilateralen<br />
Absicherung von Investitionen in <strong>der</strong> Internationalen Handelskammer<br />
(ICC), <strong>der</strong> OECD o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Weltbank und aus schweizerischer Sicht auch<br />
die Überlegungen zu Investitionen und Freihandelszone im Jahr 1957.<br />
Ein kleinerer Teilbestand zur Statistik umfasst die Jahre 1918 bis 1987. Er enthält<br />
Material zu statistischen Erhebungen, zur Zahlungs- und Ertragsbilanz,<br />
zur Volkseinkommensstatistik und zu Betriebs- und Volkszählungen. Die Dossiers<br />
dokumentieren unter an<strong>der</strong>em die Schwierigkeiten bei <strong>der</strong> Erstellung<br />
von gesamtschweizerischen Statistiken im Bereich <strong>der</strong> Volkswirtschaft.<br />
Von einer nationalen industriellen Forschungspolitik (6 Laufmeter) kann<br />
erst ab den 1960er Jahren gesprochen werden. Damals wurden die ersten<br />
statistischen Erhebungen zur Forschungstätigkeit durchgeführt und eine<br />
Kommission zur Thematik eingesetzt. Der Vorort spielte dabei eine prominente<br />
Rolle und trieb etwa die Koordination <strong>der</strong> Reaktorpolitik und <strong>der</strong><br />
Weltraumforschung mit voran. Kernpunkt <strong>der</strong> Debatten war die För<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Hochschulen durch den Bund. Mit <strong>der</strong> beruflichen Ausbildung hatte sich<br />
<strong>der</strong> Vorort dagegen bereits ab 1923 beschäftigt.<br />
Der Hauptteil <strong>der</strong> etwa 200 neuen Dossiers zur Forschungspolitik betrifft<br />
die Jahre zwischen 1960 und 1980, wobei auch hier die Ablieferung jüngerer<br />
Akten noch aussteht. Interessante und ganz unterschiedliche Unterlagen<br />
54
zur Branchenthematik (5 Laufmeter) beleuchten schliesslich das Versicherungsabkommen<br />
mit <strong>der</strong> EWG von 1989, Pharmafragen nach 1980, aber etwa<br />
auch die Holzverzuckerungsanlage in Ems in den 1940er und 1950er o<strong>der</strong> die<br />
schweizerische Hotelgesetzgebung seit den 1930er Jahren.<br />
Protokolle – Digitalisierung und OCR-Erkennung<br />
Im Mai und Juni <strong>2006</strong> führte Christian Coradi im Rahmen seines <strong>Archiv</strong>praktikums<br />
ein Projekt zur Digitalisierung <strong>der</strong> Protokolle des Vororts aus den<br />
Geschäftsjahren 1924 bis 2000 durch. Massgebend für die Auswahl dieses<br />
Zeitraums war das Vorhandensein maschinengeschriebener Dokumente. Bis<br />
1990 dauerte ein Geschäftsjahr jeweils vom 1. April bis zum 31. März. Danach<br />
entsprach das Vereins- dem Kalen<strong>der</strong>jahr.<br />
Die Protokolle sind mit wenigen Ausnahmen chronologisch geordnet,<br />
wobei die Verzeichnungseinheiten meist mit <strong>der</strong> ersten bzw. letzten Sitzung<br />
eines Vereinsjahres beginnen beziehungsweise enden. Um dieses<br />
Ordnungsprinzip konsequent anzuwenden und um eine effiziente Suche<br />
zu ermöglichen, wurden die einzelnen Protokolle <strong>der</strong> jeweiligen Vereinsjahre<br />
zu einer pdf-Datei zusammengefasst. Für das Scanning, die OCR-Erkennung<br />
und die Abspeicherung als pdf-Dokumente wurde das Programm ABBYY<br />
Mehrwert durch Volltexterkennung: Die letzte Seite eines Vorort-Protokolls durchläuft den<br />
OCR-Prozess (Optical Character Recognition) im Programm ABBYY FineRea<strong>der</strong>.<br />
55
FineRea<strong>der</strong> 8.0 Corporate Edition verwendet. Die weitere Bearbeitung <strong>der</strong><br />
pdf-Dateien wurde mit dem Programm Adobe Acrobat 7.0 Professional<br />
Version 7.0.7 vorgenommen.<br />
In dieser Kollektion von insgesamt rund 17’000 Seiten kann nun effizient<br />
nach Suchbegriffen recherchiert werden, was eine schnelle Übersicht über<br />
relevante Dokumente bringt. Die Konsultation <strong>der</strong> Protokolle erfolgt sinnvollerweise<br />
bei fast je<strong>der</strong> Einsichtnahme in das Vorort-<strong>Archiv</strong>. Mit dem Projekt,<br />
das gleichzeitig eine Schonung <strong>der</strong> Papieroriginale mit sich bringt, wurde<br />
somit ein echter Mehrwert für die Benutzung erzielt.<br />
wf-Dokumentationsarchiv Teil II (1975-1993)<br />
Verkehrs- und Umweltpolitik, Bildungswesen und Medien<br />
Im Dokumentationsarchiv <strong>der</strong> wf wurden im Berichtszeitraum rund 700<br />
Schachteln aus vier Hauptbereichen von Sabina Bellofatto, Edy Affolter, lic.<br />
phil. Franziska Sidler, Anna Sieg und Hubert Vilimek bearbeitet.<br />
Der Umweltschutz entwickelte sich in den siebziger Jahren zu einem zentralen<br />
neuen Politikfeld und damit auch zu einer Konstante in <strong>der</strong> öffentlichen<br />
Wahrnehmung. Intensiv dokumentiert und diskutiert wurden damals und in<br />
den 1980er Jahren die verschiedenen Umweltschutz-Initiativen im Bereich<br />
des Gewässerschutzes, <strong>der</strong> Lufthygiene o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Strassenlärmbegrenzung.<br />
In diese Phase fällt insbeson<strong>der</strong>e die lange Geschichte des Bundesgesetzes<br />
über den Umweltschutz (USG), das 1985 in Kraft trat.<br />
Internationale und negative Schlagzeilen schrieb aber nicht dieser Legiferierungsprozess,<br />
son<strong>der</strong>n die Dioxin-Katastrophe in Seveso vom 10. Juli 1976<br />
und <strong>der</strong> Brand in Schweizerhalle vom 1. November 1986. Deren Folgen lassen<br />
sich anhand <strong>der</strong> entsprechenden Dossiers bis zum Beginn <strong>der</strong> 1990er Jahre<br />
nachzeichnen. Nicht ganz so dramatisch verlief die Entwicklung im Bereich<br />
des Bildungswesens, wenngleich die heftigen Jugendunruhen <strong>der</strong> frühen<br />
1980er Jahre grosse Aufmerksamkeit fanden. Gegen ein neues Hochschulför<strong>der</strong>ungsgesetz<br />
(HFG) war kurz zuvor in einer wirtschaftlich rezessiven<br />
Zeit aus finanzpolitischen Überlegungen das Referendum ergriffen worden.<br />
Dieses wurde in <strong>der</strong> Volksabstimmung vom 28. Mai 1978 trotz rasant wachsen<strong>der</strong><br />
Studierendenzahlen gutgeheissen, sodass künftig die Kantone für die<br />
massiven Mehrkosten alleine aufkommen mussten. Erfolg war dagegen dem<br />
dritten Berufsbildungsgesetz beschieden, welches zahlreiche Neuerungen<br />
wie die gesetzliche Verankerung <strong>der</strong> Institutionen <strong>der</strong> höheren Berufsbildung<br />
56
Abfallbewirtschaftung als Happening: Aufruf zum ersten Zürcher Abfalltag, 14. Mai 1988 (wf-<br />
Dokumentationsarchiv)<br />
57
achte und über das fast gleichzeitig abgestimmt wurde. Interessant zu<br />
beobachten ist in den neu geordneten wf-Beständen schliesslich ein zunehmendes<br />
Spannungsfeld innerhalb <strong>der</strong> schweizerischen Medienlandschaft.<br />
Ausführlichen Dossiers zu rund 150 Zeitungstiteln einer sich vielfältig präsentierenden<br />
Presse steht die in dieser Periode intensiver werdende Diskussion<br />
einer strukturbedingten Pressekonzentration gegenüber.<br />
Vorlass Roland Bless<br />
Der promovierte Historiker Roland Bless begann seine Laufbahn 1988 als<br />
Journalist bei <strong>der</strong> Schweizerischen Depeschenagentur (SDA). Nach einer<br />
Anstellung bei <strong>der</strong> Schweizerischen Zentrale für Handelsför<strong>der</strong>ung (OSEC)<br />
wechselte er 1991 in die Bundesverwaltung, wo er zuerst im Integrationsbüro<br />
EDA/EVD als Informationschef und ab 1993 als Leiter des Presse- und<br />
Informationsdienstes <strong>der</strong> Bundeskanzlei tätig war. Ab August 1997 arbeitete<br />
Bless als Korrespondent des Tages-Anzeigers in Hanoi. Im August 1999 wurde<br />
er von <strong>der</strong> Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) zum<br />
Sprecher ihrer Mission im Kosovo und zum Leiter <strong>der</strong> Abteilung Presse und<br />
Öffentlichkeit <strong>der</strong> Kosovo-Mission ernannt. Von Dezember 2000 bis Mitte<br />
2004 war Roland Bless Pressesprecher des Stabilitätspaktes für Südosteuropa<br />
in Brüssel. Seit Ende 2004 ist er politischer Berater des OSZE-Medienfreiheitsbeauftragten<br />
in Wien.<br />
Die 1997 dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> geschenkte und nun von Daniel<br />
Hüppin erschlossene Forschungsdokumentation im Umfang von 4 Laufmetern<br />
umfasst Materialien, die aus <strong>der</strong> Tätigkeit von Bless bei <strong>der</strong> OSEC,<br />
vor allem aber aus seiner Zeit als Informationschef des Integrationsbüros<br />
EDA/EVD (1991-1993) und <strong>der</strong> Bundeskanzlei (1993-1997) stammen. Von beson<strong>der</strong>em<br />
Interesse sind jene Dokumente, welche die Beziehung <strong>der</strong> Schweiz<br />
zur EG bzw. EU zum Thema haben. Dazu gehören Materialien rund um die<br />
Volksabstimmung vom 6. Dezember 1992 über den Beitritt <strong>der</strong> Schweiz zum<br />
EWR.<br />
Ein erster Teil besteht denn auch aus dieser Dokumentation zur europäischen<br />
Integration, welche die Jahre 1971 bis 1996 umfasst. Sie enthält<br />
Vortragsunterlagen, aber auch Materialien und Publikationen des Integrationsbüros,<br />
des Bundesrates und weiterer Bundesbehörden sowie <strong>der</strong> OSEC.<br />
In einem zweiten Block zu aussenwirtschaftlichen Themen finden sich<br />
Materialien aus dem Zeitraum 1986 bis 1995 zum GATT, zur NEAT/Alpenini-<br />
58
tiative, zum Thema Blauhelme/Armee 95, zur Forschungsinitiative EUREKA<br />
sowie zur OSZE.<br />
Neuzugänge<br />
Bestände <strong>der</strong> Zentrale für Wirtschaftsdokumentation (ZWD)<br />
Ein ehemals bedeutendes Wirtschaftsarchiv <strong>der</strong> Universität Zürich, das<br />
in <strong>der</strong> ursprünglichen Form nicht mehr weitergeführt wird, hat nun mit<br />
zentralen Beständen im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> Aufnahme gefunden<br />
und erweitert hier die Basis unserer Dokumentationsstelle Wirtschaft und<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong>.<br />
Gegründet wurde die Zentrale für Wirtschaftsdokumentation (ZWD) 1910<br />
und damit fast gleichzeitig wie das Wirtschaftsarchiv in Basel. Der Name <strong>der</strong><br />
als Dokumentationszentrum für Wirtschaftsthemen konzipierten Institution<br />
war „<strong>Archiv</strong> für Handel und Industrie <strong>der</strong> Schweiz“ und wurde 1972 mit <strong>der</strong><br />
Anglie<strong>der</strong>ung an die Universität Zürich in „Zentralstelle für Wirtschaftsdokumentation“<br />
geän<strong>der</strong>t. Nach<br />
mehreren Umzügen (Apollostrasse,<br />
Wiesenstrasse) wurde sie 1990 <strong>der</strong><br />
Bibliothek für Betriebswirtschaft<br />
<strong>der</strong> Universität Zürich angeglie<strong>der</strong>t<br />
und mit dieser in einem Neubau an<br />
<strong>der</strong> Plattenstrasse 14 zusammengeführt.<br />
Die Hauptschwerpunkte <strong>der</strong> Sammeltätigkeit<br />
sind heute <strong>Jahresbericht</strong>e<br />
von Firmen und wirtschaftliche<br />
Publikationen amtlicher Stellen<br />
sowie Zeitungen und Zeitschriften<br />
mit wirtschaftlichem Hintergrund.<br />
Dazu kommt eine nahezu vollständige<br />
Sammlung <strong>der</strong> Publikationen<br />
<strong>der</strong> OECD. Studierenden und <strong>der</strong><br />
interessierten Öffentlichkeit bietet<br />
die Zentrale damit Quellenmaterial<br />
an, das die Bearbeitung empirischer<br />
Fragen ermöglicht.<br />
Anfänge eines organisierten Wirtschaftsarchivwesens:<br />
Bericht zur ersten Tagung für<br />
Wirtschaftsarchivare im deutschen Kaiserreich<br />
1913, an <strong>der</strong> auch ein Vertreter des <strong>Archiv</strong>s<br />
für Handel und Industrie aus Zürich teilnahm<br />
(ZWD-<strong>Archiv</strong>).<br />
59
Durch Vermittlung von Frau Katharina Hertzberg Schilling, Leiterin <strong>der</strong> Bibliothek<br />
für Betriebswirtschaft <strong>der</strong> Universität Zürich, übernahm das <strong>Archiv</strong><br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong> im September <strong>2005</strong> einen Kernbestand <strong>der</strong> Zentrale für<br />
Wirtschaftsdokumentation. Es handelt sich um das historische <strong>Archiv</strong> und<br />
die Dokumentation <strong>der</strong> ZWD im Umfang von insgesamt 27,5 Laufmetern.<br />
Nach dem Umzug von <strong>der</strong> Plattenstrasse 14 ins <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
begannen die Erschliessungsarbeiten. Zunächst wurden die kleineren Bestände,<br />
d.h. das Geschäftsarchiv <strong>der</strong> ZWD, die Dokumentation Handelskammern<br />
und Office Suisse d‘Expansion Commerciale (OSEC) sowie die Zeitschriften<br />
(„Tradition“: Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiografie;<br />
Zeitschrift für Unternehmensgeschichte; Wirtschaftliche Mitteilungen)<br />
bearbeitet.<br />
Wesentlich mehr Zeit nahm die Erschliessung <strong>der</strong> Dokumentationen zu<br />
Wirtschaftsthemen in Anspruch, umfasste dieser Bereich doch etwa 20 Laufmeter<br />
Broschüren, Gutachten o<strong>der</strong> Presseartikel. Schwerpunkte bilden hier<br />
Themen <strong>der</strong> schweizerischen Wirtschaftspolitik, diverse Wirtschaftszweige<br />
und europäische Organisationen. Ein Register zu diesem Altbestand existiert<br />
nicht mehr. Um ein Verzeichnis für diesen Bereich erstellen zu können, erfolgte<br />
eine provisorische Erschliessung, verbunden mit <strong>der</strong> Verpackung <strong>der</strong><br />
meisten Akten in <strong>Archiv</strong>schachteln. Diese Arbeit dauerte bis Januar <strong>2006</strong>. Die<br />
Bestände des ZWD-<strong>Archiv</strong>s reichen zeitlich von 1910 bis <strong>2005</strong> und beziehen<br />
sich auf Wirtschaftsthemen vom 18. bis 20. Jahrhun<strong>der</strong>t.<br />
<strong>Archiv</strong> Becker Audio-Visuals (BAV)<br />
Egon Benjamin Becker war ein Fernsehmann <strong>der</strong> ersten Stunde. Als Autodidakt<br />
hatte er in den 1950er Jahren zunächst begonnen, Kinowerbung zu<br />
schreiben, und kam 1960 zum jungen Schweizer Fernsehen. Als Redaktor und<br />
Reporter arbeitete er für Sendegefässe wie „Tagesschau“ o<strong>der</strong> „Antenne“ und<br />
produzierte einen ersten Fernsehspielfilm „Mehr Schuhe“. Bald gründete <strong>der</strong><br />
Selfmademan eine eigene Firma, Becker Audio-Visuals. Das Unternehmen<br />
begann mit <strong>der</strong> Auftragsproduktion von Tonbildschauen. Durch die Erfindung<br />
<strong>der</strong> sogenannten Multivision, einer vollautomatischen Tonbildschau mit<br />
Überblendtechnik, wurde Becker zum Pionier <strong>der</strong> audio-visuellen Medien<br />
in <strong>der</strong> Schweiz. Bis Ende <strong>der</strong> 1990er Jahre folgten zahlreiche Werkaufträge<br />
für namhafte Firmen und Organisationen, die oft mit internationalen Auszeichnungen<br />
prämiert wurden.<br />
60
Pionier <strong>der</strong> audio-visuellen Auftragsproduktion: Egon Becker (rechts) bei Dreharbeiten mit<br />
seinem langjährigen Kameramann Ishwar Chandra Pandey.<br />
Herauszuheben ist etwa die frühe Produktion „Wir in <strong>der</strong> Schweiz“, ein<br />
Multimediaprogramm im Auftrag <strong>der</strong> Sozialpartner <strong>der</strong> Schweizerischen<br />
Maschinen- und Metallindustrie, das sich aus beschäftigungspolitischen<br />
Überlegungen gegen die Überfremdungsinitiativen <strong>der</strong> frühen 1970er Jahre<br />
richtete. Becker bearbeitete aber auch weitere Themen mit zeitgeschichtlichem<br />
Bezug. Nebst den audiovisuellen Porträts von international tätigen<br />
Schweizer Grossfirmen erstellte er solche auch von Parteien o<strong>der</strong> setzte<br />
wirtschaftliche Themen wie beispielsweise die Sicherheit im Devisenmarkt<br />
o<strong>der</strong> die Frage <strong>der</strong> Wahrung von Geschäftsgeheimnissen in <strong>der</strong> Industrie<br />
multimedial um.<br />
Während <strong>der</strong> Geschäftsauflösung im Sommer <strong>2005</strong> kam es auf Vermittlung<br />
von Frau Bernadette Meier von <strong>der</strong> Zürcher Dokumentationsstelle <strong>der</strong><br />
Cinémathèque Suisse zu einem ersten Kontakt des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
mit Egon Becker. Schnell zeigte eine Sichtung, dass das aufgrund <strong>der</strong> bevorstehenden<br />
Räumung gefährdete <strong>Archiv</strong> mehr als hun<strong>der</strong>t Tonbildschauen<br />
mit Diakarussell und zugehörigen Tonkassetten enthielt. Diesen repräsentativen<br />
Querschnitt durch sein Schaffen zu erhalten, war ein Anliegen, für<br />
das sich Egon Becker bis zu seinem unerwarteten Tod am 5. August <strong>2006</strong><br />
unermüdlich einsetzte.<br />
61
Die Ablieferung <strong>der</strong> dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> geschenkten Tonbildschauen<br />
und begleitenden Materialien wenige Wochen zuvor konnte er noch<br />
persönlich überwachen und durch wichtige Informationen ergänzen. Nicht<br />
mehr möglich war dann die Führung und Tonaufzeichnung ausführlicher<br />
Interviews zu den einzelnen Produktionen und zur Biografie Beckers, <strong>der</strong> in<br />
Danzig als Sohn einer jüdischen Zürcherin und eines Deutschen geboren<br />
wurde und als Flüchtling in die Schweiz gekommen war.<br />
Seiner Tochter Madeleine Mattil-Becker dankt das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
dafür, dass sie im Sinne ihres Vaters das Projekt <strong>der</strong> <strong>Archiv</strong>sicherung unterstützt.<br />
In einem Test bereits erfolgreich durchgeführt wurde die Digitalisierung<br />
einer ersten Tonbildschau. Durch die Zusammenführung von Bild und<br />
Ton auf elektronischer Basis wird die Nutzung dieses für die Visualisierung<br />
technik- und wirtschaftsgeschichtlicher Themen äusserst interessanten<br />
Bestandes neu auch ohne mechanische Abspielgeräte ermöglicht.<br />
Nachlass Ulrich Gross<br />
Ulrich Gross (1854-1916) war Rechtskonsulent <strong>der</strong> Nordostbahn. Vor Ausbruch<br />
des Ersten Weltkriegs wurde er zum Generaldirektor <strong>der</strong> Orientalischen<br />
Eisenbahnen ernannt. Im Auftrag <strong>der</strong> Schweizerischen Kreditanstalt begab<br />
er sich nach Konstantinopel. Einige Akten hierzu wurden von seinem Enkel<br />
Peter Gross dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
übergeben. Sie enthalten Unterlagen zur<br />
Orientalischen Eisenbahn sowie einen<br />
Nekrolog.<br />
Friedrich (Fre<strong>der</strong>ick) Oe<strong>der</strong>lin-Ziegler<br />
(1880–1968)<br />
Nachlass Friedrich Oe<strong>der</strong>lin-Ziegler<br />
Friedrich Oe<strong>der</strong>lin-Ziegler (1880-1968)<br />
arbeitete seit 1911 für die Firma Gebrü<strong>der</strong><br />
Sulzer AG. Von 1915 bis 1916 gehörten in<br />
New York die Beschaffung und Verschiffung<br />
von Rohstoffen in die Schweiz zu<br />
seinen Aufgaben. Nach einem Kurzaufenthalt<br />
in <strong>der</strong> Schweiz reiste er erneut<br />
nach Übersee. Von 1917 bis Ende 1919<br />
war er in <strong>der</strong> Schweizer Gesandtschaft<br />
in Washington unter Minister Hans Sul-<br />
62
zer für die Versorgung <strong>der</strong> Schweiz mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen<br />
aus den USA verantwortlich. In Vertretung Sulzers, dessen Nachlass sich im<br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> befindet, beteiligte er sich an <strong>der</strong> Vermittlung des<br />
Waffenstillstandsabkommens zwischen den USA und Deutschland im Oktober<br />
/ November 1918. Nach 1920 verfolgte er seine Karriere innerhalb des<br />
Sulzer-Konzerns weiter; dabei wurde er Delegierter des Verwaltungsrats. 1961<br />
trat er in den Ruhestand. Die von Herrn Renato Esseiva vom Winterthurer Sozialarchiv<br />
überreichten Akten dokumentieren seine Tätigkeit in den USA.<br />
Nachlass Margaretha Rebsamen<br />
Margaretha Lucia Rebsamen (1889-1968) war die Privatsekretärin von Minister<br />
Hans Sulzer, in dessen Dienst sie von 1917 bis zu dessen Tod am 4.1.1959<br />
blieb. Die Akten, welche von Renato Esseiva dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
übergeben wurden, enthalten Dossiers zu ihrer Tätigkeit, Fotos zum USA-<br />
Aufenthalt 1917 bis 1920 sowie Fotos und Korrespondenzen zum 50jährigen<br />
Dienstjubiläum bei <strong>der</strong> Sulzer AG, Winterthur.<br />
Veranstaltungen, Kooperationen<br />
Arbeitsgruppe <strong>Archiv</strong>e <strong>der</strong> privaten Wirtschaft (VSA)<br />
Als Mitglied <strong>der</strong> Arbeitsgruppe „<strong>Archiv</strong>e <strong>der</strong> privaten Wirtschaft“ des Vereins<br />
Schweizerischer <strong>Archiv</strong>arinnen und <strong>Archiv</strong>are nimmt Daniel Nerlich für das<br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> Einsitz in dieses Fachgremium. Neben <strong>der</strong> Aktualisierung<br />
<strong>der</strong> Eckdaten zu Wirtschaftsbeständen in <strong>Archiv</strong>en <strong>der</strong> Schweiz und<br />
in Liechtenstein im Rahmen des Internetverzeichnisses „arCHeco“ (http://<br />
www.archeco.info) richtete die Arbeitsgruppe am 8. April <strong>2005</strong> gemeinsam<br />
mit <strong>der</strong> Schweizerischen Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte<br />
(SGWSG) eine Tagung des VSA in Bern mit dem Titel „Unternehmensarchive<br />
und Unternehmensgeschichte“ aus.<br />
Hearings zur Raumplanungsgeschichte <strong>der</strong> Schweiz<br />
Die Anfänge einer Raumplanung in <strong>der</strong> Schweiz gehen auf den Architekten<br />
und FDP-Nationalrat Armin Meili zurück, <strong>der</strong> auch als Direktor <strong>der</strong> Schweizerischen<br />
Landesausstellung von 1939 in Erinnerung bleibt. Er for<strong>der</strong>te als erster<br />
die Erstellung eines Zonenplans für die gesamte Schweiz. 1943 präsidierte er<br />
die neu gegründete „Schweizerische Vereinigung für Landesplanung“. Deren<br />
Aufgabe bestand in <strong>der</strong> wissenschaftlichen Begleitung und koordinierenden<br />
63
Raumplanungsexperten im Gespräch: Hearing vom 2. November <strong>2006</strong> im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
(v.l.n.r. Claude Wasserfallen, Walter Walch, Fritz Wagner, Rudolf Stüdeli und Karl<br />
Otto Schmid).<br />
Beratung kantonaler und regionaler Planungsstellen. Da <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> Planung<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg lange mit Einengung gleichgesetzt und<br />
negativ besetzt war, wurde die Landesplanung erst in den 1960er Jahren ein<br />
ernstzunehmendes Thema auf dem nationalen Parkett.<br />
Das 1961 errichtete Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung (ORL)<br />
an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich schuf mit <strong>der</strong> Erarbeitung von Leitbil<strong>der</strong>n und Richtlinien<br />
die Grundlagen für einen Verfassungsartikel zur Raumplanung im Jahr<br />
1969. Nach Bundesbeschlüssen über dringliche Massnahmen und einer gescheiterten<br />
Volksabstimmung folgte 1980 schliesslich das Inkrafttreten des<br />
Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG), dessen wichtigste Konsequenz<br />
die strikte Trennung von Baugebiet und Nicht-Baugebiet ist.<br />
Eine umfassende Geschichte <strong>der</strong> Raumplanung in <strong>der</strong> Schweiz fehlt bisher.<br />
Das Netzwerk Stadt und Landschaft <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich (NSL) befasst sich mit<br />
<strong>der</strong>en Entstehung, ihren Akteuren und den jeweiligen Rahmenbedingungen.<br />
Um die Quellenbasis zu sichern, müssen auch ehemalige Protagonisten <strong>der</strong><br />
Raumplanung in Verwaltung und Wissenschaft befragt werden. Frau Dr.<br />
Martina Koll-Schretzenmayr, die Leiterin <strong>der</strong> Publikationsstelle des NSL, bat<br />
das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>, seine Erfahrungen im Umgang mit Zeitzeugen<br />
64
einzubringen und bei <strong>der</strong> Realisierung mitzuhelfen. Nach <strong>der</strong> Digitalisierung<br />
und langfristigen Sicherung älterer Tonmitschnitte des NSL im <strong>Archiv</strong> für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> fanden am 31. Oktober und 2. November <strong>2006</strong> eingehende<br />
Hearings mit knapp zwei Dutzend Raumplanungsexperten statt. An den<br />
zweimal vierstündigen Veranstaltungen wurde eingehend den Anfängen <strong>der</strong><br />
Raumplanung, ihren Visionen und erreichten beziehungsweise verfehlten<br />
Zielsetzungen nachgespürt. Als Zeitzeugen wirkten mit (in alphabetischer<br />
Reihenfolge ohne akademische Titel): Fritz Berger, Carl Fingerhuth, Hans<br />
Flückiger, Peter Güller, Hans-Rudolf Henz, Benedikt Huber, Hans Rudolf Isliker,<br />
Riccardo Jagmetti, Alfred Kuttler, Martin Lendi, Jakob Maurer, Andres<br />
Nydegger, Werner Raths, Helmut Ringli, Karl Otto Schmid, Pierre Strittmatter,<br />
Rudolf Stüdeli, Fritz Wagner, Walter Walch, Claude Wasserfallen und Dieter<br />
Wronsky.<br />
Die digital gefilmten Hearings bilden zusammen mit den historischen<br />
Interviews von ORL und NSL einen wichtigen Fundus für Forschungen zu<br />
den Landschafts-, Siedlungs- und Transportstrukturen <strong>der</strong> Schweiz. Diese<br />
Zeitzeugnisse werden im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>, das bei dem Projekt durch<br />
Daniel Nerlich vertreten war, zugänglich gemacht. Sie beleuchten zugleich<br />
gesellschaftspolitische Entwicklungen, welche in steter Wechselwirkung mit<br />
dieser brisanten Thematik standen und stehen.<br />
65
Dokumentationsbereich Schweiz – Kalter Krieg<br />
Wie wichtig es ist, frühzeitig mit zeitgeschichtlich relevanten Akteuren in<br />
Kontakt zu treten, um bedeutende Quellenbestände vor dem Verlust zu<br />
retten, zeigt sich im Dokumentationsbereich Schweiz – Kalter Krieg an den<br />
Beispielen von Marcel Brun, Ernst Cincera und Dr. Robert Vögeli. Da das <strong>Archiv</strong><br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong> bereits zu Lebzeiten mit allen drei inzwischen verstorbenen<br />
Donatoren die Schenkung ihrer Nachlässe vereinbart und diese mindestens<br />
schon teilweise übernommen hatte, konnten ihre Quellenbestände zur<br />
schweizerischen Nachkriegsgeschichte gesichert werden.<br />
Hervorzuheben ist aber auch die Schenkung des Nachlasses von Heinrich<br />
Buchbin<strong>der</strong>, dem ehemaligen Trotzkisten, Atomwaffengegner und späteren<br />
Militärexperten <strong>der</strong> SPS. <strong>2006</strong> ist ein erster Teil seines umfangreichen Nachlasses<br />
übernommen worden.<br />
Der Nachlass Georg Theodor Schwarz, <strong>der</strong> sich als EMD-Beamter in den<br />
1970er und 1980er Jahren hauptsächlich mit <strong>der</strong> Agitation gegen die Armee<br />
befasste, ist nun vollständig<br />
geordnet und verzeichnet<br />
und damit für die Benutzung<br />
verfügbar.<br />
Nachlass Marcel Brun<br />
Am 8. September <strong>2006</strong> ist in<br />
Dreesch, im deutschen Bundesland<br />
Brandenburg, Marcel<br />
Brun verstorben. Der unter dem<br />
Pseudonym Jean Villain bekannte<br />
Schweizer Schriftsteller und<br />
Publizist übersiedelte 1961 – unmittelbar<br />
vor dem Mauerbau – in<br />
die DDR, welche in den folgenden<br />
Jahrzehnten zu seiner Wahlheimat<br />
werden sollte. Schon zu Lebzeiten<br />
hat Brun seinen Nachlass<br />
dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
geschenkt.<br />
Die Lebenserinnerungen von Marcel Brun (1928-<br />
<strong>2006</strong>), erschienen 2007 im Verlag Zytglogge,<br />
Oberhofen.<br />
66
Nachdem ein erster Teil des Bestandes im Herbst 2004 übernommen werden<br />
konnte, folgten im Sommer <strong>2005</strong> weitere Unterlagen. Diejenigen Akten, die<br />
Brun für die Arbeit an seinem autobiografischen Manuskript „Reisen ohne<br />
Rückfahrkarte“ benötigte, blieben vorerst in Dreesch. Er hat fast bis zuletzt<br />
an seinen Memoiren geschrieben und diese noch zum Abschluss bringen<br />
können. Sie sind im Frühjahr 2007 im Zytglogge Verlag (Oberhofen) publiziert<br />
worden.<br />
Nach dem Tod von Marcel Brun sind die restlichen Unterlagen in Dreesch<br />
durch Dr. Werner Hagmann im Spätherbst <strong>2006</strong> gesichtet und übernommen<br />
worden, so dass sich nun fast <strong>der</strong> gesamte Nachlass im <strong>Archiv</strong> für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> befindet. Dazu gehört auch ein umfangreiches elektronisches<br />
<strong>Archiv</strong>, welches von Brun verfasste Texte (Manuskripte, Exposés, Korrespondenz,<br />
Tagebücher etc.), aber auch nachträglich digitalisierte Unterlagen aus<br />
seinem Nachlass enthält.<br />
Inhaltlich dokumentiert wird vor allem seine publizistische Tätigkeit in <strong>der</strong><br />
DDR und nach <strong>der</strong> Wende von 1989. Neben zahlreicher Korrespondenz und<br />
persönlichen Tagebüchern sind beson<strong>der</strong>s das zu Brun angelegte voluminöse<br />
Staatsschutzdossier <strong>der</strong> Schweizer Bundespolizei sowie – als Pendant – das<br />
entsprechende, ebenfalls sehr umfangreiche Stasi-Dossier hervorzuheben.<br />
Diese sind von Brun teilweise durch Erläuterungen und Kommentare ergänzt<br />
worden. Zur Beurteilung seines in <strong>der</strong> Presse kürzlich thematisierten Verhältnisses<br />
zur Stasi erhalten diese Quellen dadurch beson<strong>der</strong>e Bedeutung.<br />
Nachlass Heinrich Buchbin<strong>der</strong><br />
Im Dezember <strong>2005</strong> hat Frau Chantal Buchbin<strong>der</strong>, Witwe von Heinrich Buchbin<strong>der</strong><br />
(1919-1999), einen ersten Teil des umfangreichen und substanziellen<br />
Nachlasses ihres Mannes dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> als Schenkung<br />
übergeben.<br />
Heinrich Buchbin<strong>der</strong> wurde als Sohn russisch-jüdischer Immigranten am<br />
6. Februar 1919 in Zürich geboren. Der frühe Tod seines Vaters zwang ihn, das<br />
Medizinstudium abzubrechen. 1939 verhalf er den Schweizer Chiropraktoren<br />
zur nationalen Anerkennung ihres Fachs. Von 1939 bis 1998 war er in beraten<strong>der</strong><br />
Funktion für die Schweizerische Chiropraktoren-Gesellschaft und die<br />
Schweizerische Vereinigung Pro Chiropraktik tätig. Hauptberuflich arbeitete<br />
Buchbin<strong>der</strong> als Publizist, 1977 bis 1992 war er Redaktor <strong>der</strong> Schweizerischen<br />
Krankenkassen-Zeitung.<br />
67
Im Kampf gegen die nukleare Bedrohung: Heinrich Buchbin<strong>der</strong> (2. von links) bei <strong>der</strong> Einreichung<br />
<strong>der</strong> Volksinitiative „für ein Verbot <strong>der</strong> Atomwaffen“ am 29. April 1959.<br />
Seine politische Karriere startete Buchbin<strong>der</strong> als Präsident <strong>der</strong> „Sozialistischen<br />
Arbeiterjugend“ und als Mitglied <strong>der</strong> Sozialdemokratischen Partei. Infolge<br />
eines sich verschärfenden Konflikts mit <strong>der</strong> Parteileitung trat Buchbin<strong>der</strong><br />
1951 aus <strong>der</strong> SPS aus. Danach war er Mitbegrün<strong>der</strong> und Präsident des „Sozialistischen<br />
Arbeiterbundes“ (SAB), einer linkssozialistischen Gruppierung<br />
trotzkistischer Ausrichtung, die auch unter <strong>der</strong> Bezeichnung „Proletarische<br />
Aktion“ in Erscheinung trat und die sich 1957 <strong>der</strong> „Sammlung <strong>der</strong> sozialistischen<br />
Linken“ unter dem Präsidium des Ex-PdA-Politikers und ehemaligen<br />
Nationalrats Emil Arnold anschloss.<br />
Gleichzeitig amtierte Buchbin<strong>der</strong> als Redaktor <strong>der</strong> Zeitung „Das Arbeiterwort“,<br />
dem „Organ <strong>der</strong> Proletarischen Aktion <strong>der</strong> Schweiz und des Sozialistischen<br />
Arbeiterbundes“. Schon damals war er auch auf internationaler Ebene<br />
als Mitglied <strong>der</strong> trotzkistischen IV. Internationale aktiv. Im Zusammenhang<br />
mit seinem Engagement gegen den Algerienkrieg wurde er 1956 von <strong>der</strong><br />
Bundespolizei verhaftet und musste eine Hausdurchsuchung über sich<br />
ergehen lassen.<br />
1958 trat Buchbin<strong>der</strong> als Mitinitiant und Mitglied des Ausschusses <strong>der</strong><br />
„Schweizerischen Bewegung gegen die atomare Aufrüstung“ hervor, wel-<br />
68
che 1959 die Volksinitiative „für ein Verbot <strong>der</strong> Atomwaffen“ einreichte. Sie<br />
wurde in <strong>der</strong> Volksabstimmung vom 1. April 1962 verworfen. Überdies wirkte<br />
er als Mitorganisator <strong>der</strong> Ostermärsche und als Präsident <strong>der</strong> „Europäischen<br />
Fö<strong>der</strong>ation gegen Atomrüstung“. 1962 beteiligte er sich an <strong>der</strong> vom Walliser<br />
SP-Nationalrat Karl Dellberg präsidierten „Accra Assembly“ in Ghana, welche<br />
unter dem Motto „The World without the Bomb“ stand.<br />
Nach seinem Wie<strong>der</strong>eintritt in die SPS berief die Partei in den 1970er Jahren<br />
den inzwischen auch auf internationaler Ebene bekannten Sicherheitsexperten<br />
an die Spitze ihrer Militärkommission. Als Mitglied <strong>der</strong> Sozialistischen<br />
Internationale gehörte Buchbin<strong>der</strong> zu einem Kontaktkreis für inoffizielle<br />
Sondierungsmissionen zwischen Ost und West. Während <strong>der</strong> Zeit des Kalten<br />
Krieges beteiligte er sich in Krisenfällen und bei den Vorbereitungen von Abrüstungsgesprächen<br />
an Übermittlungsdiensten zwischen den Weltmächten.<br />
Er unterhielt ein weit gespanntes internationales Beziehungsnetz – zu seinen<br />
Freunden zählten Willy Brandt, Bruno Kreisky und Olof Palme. Zusammen<br />
mit Kreisky fädelte er israelisch-palästinensische Kontakte ein, in den 1990er<br />
Jahren traf er sich persönlich mit Yassir Arafat.<br />
1977 bis 1993 gehörte Buchbin<strong>der</strong> dem Grossen Rat des Kantons Aargau<br />
an. Er präsidierte auch die SP-Bezirkspartei Brugg und von 1983 bis 1989<br />
den Aargauer Gewerkschaftsbund. Mehrmalige Nationalratskandidaturen<br />
blieben erfolglos. Am 11. Dezember 1999 ist Heinrich Buchbin<strong>der</strong> in Schinznach-Dorf<br />
verstorben.<br />
Inhaltlicher Schwerpunkt des im Dezember <strong>2005</strong> übernommenen ersten<br />
Teils des Nachlasses im Umfang von rund 10 Laufmetern bildet Heinrich Buchbin<strong>der</strong>s<br />
Engagement in <strong>der</strong> Anti-Atomwaffenbewegung auf schweizerischer<br />
und internationaler Ebene in den 1950er und 1960er Jahren. Dokumentiert<br />
wird auch seine politische Tätigkeit in trotzkistischen Organisationen, später<br />
in <strong>der</strong> Sozialdemokratischen Partei und in den Gewerkschaften sowie in <strong>der</strong><br />
Sozialistischen Internationale. Auch sein Engagement im Zusammenhang<br />
mit Algerien und Vietnam sowie im Bereich <strong>der</strong> Sicherheitspolitik wi<strong>der</strong>spiegelt<br />
sich in den Unterlagen. Dank sofort eingeleiteter konservatorischer<br />
Massnahmen konnte rund ein Laufmeter vom Schimmelpilz befallener Unterlagen<br />
zur Anti-Atomwaffenbewegung vor dem weiteren Zerfall bewahrt<br />
werden.<br />
Der Nachlass von Heinrich Buchbin<strong>der</strong> ermöglicht eine wesentliche Erweiterung<br />
<strong>der</strong> Dokumentationsbasis zum Kalten Krieg im <strong>Archiv</strong> für Zeitge-<br />
69
schichte. Die darin dokumentierte Perspektive bildet eine aufschlussreiche<br />
Ergänzung zu Nachlässen wie jenem von Divisionär Gustav Däniker.<br />
Nachlass Georg Theodor Schwarz<br />
Agitation gegen die Armee: Kasernenzeitung<br />
Liestal aus dem Jahr 1976, hrsg. vom Soldatenkomitee<br />
Basel, aus <strong>der</strong> Dokumentation des<br />
EMD-Mitarbeiters Georg Theodor Schwarz.<br />
Dr. Georg Theodor Schwarz (1930-2002), <strong>der</strong> als Archäologe verschiedene<br />
grössere Ausgrabungsprojekte geleitet hatte, trat 1970 als wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter in die Dienststelle<br />
Heer und Haus ein. Hier war er<br />
unter an<strong>der</strong>em für die Bearbeitung<br />
von Fragen zur armeefeindlichen<br />
Agitation zuständig. Mit ähnlichen<br />
Aufgaben befasste er sich auch nach<br />
seiner 1975 erfolgten Ernennung zum<br />
Chef des Informations- und Dokumentationsdienstes<br />
<strong>der</strong> Gruppe für<br />
Ausbildung (GA) und ab 1983 bis zur<br />
1991 erfolgten Frühpensionierung als<br />
Informationschef <strong>der</strong> Zentralstelle<br />
für Gesamtverteidigung (ZGV).<br />
Durch Vermittlung von Dr. Bernhard<br />
Degen hat das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
2002 einen kleinen Teil eines<br />
ursprünglich viel umfangreicheren,<br />
hauptsächlich Dokumentationsmaterial<br />
umfassenden Bestandes<br />
übernommen, den Schwarz im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit bei sich<br />
zuhause angelegt und nach seiner Frühpensionierung dem Historischen<br />
Institut <strong>der</strong> Universität Bern übergeben hatte.<br />
Der nun durch lic. phil. Christoph Manasse erschlossene Nachlass beinhaltet<br />
in erster Linie ungedruckte Materialien, welche anschaulich die Beobachtung<br />
und Dokumentation <strong>der</strong> Agitation wi<strong>der</strong>spiegeln, die als armeefeindlich<br />
eingestuft wurde. Ersichtlich werden auch die durch die verschiedenen<br />
Dienststellen, für die Schwarz tätig war, ergriffenen Abwehrmassnahmen.<br />
Gut dokumentiert sind die in den 1970er Jahren sehr aktiven Soldatenkomitees<br />
mit einer Sammlung von oft nur in kleiner Auflage vervielfältigten und<br />
direkt an die Rekruten und Soldaten verteilten Kasernenzeitungen.<br />
70
Ergänzt wird <strong>der</strong> Bestand durch eine Kopie <strong>der</strong> Fiche und des Dossiers, welche<br />
die zivilen Staatsschutzorgane zu Schwarz angelegt hatten. Für <strong>der</strong>en<br />
Schenkung danken wir Frau Sibylle Charlé Schwarz. Es entbehrt nicht einer<br />
gewissen Ironie, dass Schwarz, <strong>der</strong> aus beruflichen Gründen den Kontakt zu<br />
als subversiv eingestuften Kreisen pflegte, selbst ins Visier <strong>der</strong> Bundesanwaltschaft<br />
geraten ist. Sein Bestreben, sich ein möglichst differenziertes Bild<br />
von den <strong>der</strong> Armee gegenüber kritisch eingestellten Kreisen zu verschaffen,<br />
dürften das ihm – zeitweise auch im EMD – entgegengebrachte Misstrauen<br />
mitverursacht haben.<br />
Nachlass Ernst Cincera<br />
Am 30. Oktober 2004 ist mit Ernst Cincera <strong>der</strong> wohl bekannteste und zugleich<br />
auch umstrittenste private „Staatsschützer“ aus <strong>der</strong> Zeit des Kalten Krieges<br />
verstorben. Einen ersten Teil seines politischen Nachlasses hat er noch zu<br />
Lebzeiten dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> geschenkt (vgl. <strong>Jahresbericht</strong> 2004).<br />
Das eigentliche „Cincera-<strong>Archiv</strong>“, also die von ihm zusammengetragene<br />
Dokumentation zu Personen und Organisationen vor allem des linken politischen<br />
Spektrums, existiert allerdings nicht mehr.<br />
Im Dezember <strong>2005</strong> hat Herr Andreas Cincera weitere Unterlagen aus<br />
dem Nachlass seines Vaters dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> übergeben. Im<br />
Mittelpunkt stehen dabei umfangreiche Aktenkopien aus dem <strong>Archiv</strong> des<br />
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes <strong>der</strong><br />
ehemaligen DDR (BStU) in Berlin. Diese beziehen sich vor allem auf den<br />
Fall des 1979 ermordeten Schweizer Fluchthelfers Hans-Ulrich Lenzlinger<br />
sowie auf einen IM mit dem Pseudonym „Niklaus Meienberg“. Bei Letzterem<br />
handelt es sich um einen Ende <strong>der</strong> 1970er Jahre in die DDR übersiedelten<br />
ehemaligen Zürcher Gewerkschafter. Ergänzt werden die Aktenkopien durch<br />
Publikationen <strong>der</strong> BStU.<br />
Einzelbestand Paul Coradi<br />
Auch im 53. Jahr des Bestehens <strong>der</strong> Schweizer Koreamission steht das geteilte<br />
ostasiatische Land erneut im Fokus <strong>der</strong> Weltpolitik. In den Anfangszeiten<br />
beteiligte sich 1955 auch <strong>der</strong> damals im Range eines Majors stehende Zürcher<br />
Paul Coradi an <strong>der</strong> Mission. Zu seinem militärischen Auslandeinsatz drehte er<br />
einen Film von rund 23 Minuten, den uns Christian Coradi aus dem Nachlass<br />
seines Grossvaters für die Anfertigung einer Kopie zur Verfügung gestellt hat.<br />
71
Schweizerkreuz in Korea: Standbild aus einem 8-mm-Film vom Major Paul Coradi, 1955.<br />
Eine weitere, knapp viertelstündige Filmkopie zeigt ein Defilee aus den 1950er<br />
o<strong>der</strong> 1960er Jahren. Neben dem auf einem Podest stehenden Bundesrat Paul<br />
Chaudet, <strong>der</strong> dem EMD in den Jahren 1954 bis 1966 vorstand, sind auf <strong>der</strong><br />
Zuschauertribüne auch ausländische Militärvertreter erkennbar.<br />
Schweizerischer Aufklärungsdienst / Schweizerische<br />
Arbeitsgemeinschaft für Demokratie (SAD)<br />
Die Erschliessung <strong>der</strong> beiden Teilbestände SAD-<strong>Archiv</strong> und SAD-Dokumentation<br />
wurde 2004 beendet. Mit <strong>der</strong> im Januar <strong>2006</strong> erfolgten Aufschaltung<br />
des detaillierten Findmittels auf unsere Website ist die SAD-Dokumentation<br />
nun bis auf Dossierebene im Internet abfragbar, so dass dieser reichhaltige<br />
Quellenfundus – u.a. zur Neuen Linken in den 1970er und 1980er Jahren<br />
– noch besser genutzt werden kann.<br />
Im Juni <strong>2006</strong> hat die inzwischen in „Horizonte Schweiz“ umbenannte<br />
SAD dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> weitere Akten aus dem SAD-Sekretariat<br />
in Lenzburg im Gesamtumfang von mehr als sechs Laufmetern übergeben.<br />
72
Dabei handelt es sich mehrheitlich um Unterlagen bis ca. 1990, insbeson<strong>der</strong>e<br />
um Mitglie<strong>der</strong>dossiers sowie um vereinzelte Buchhaltungsakten. Etwa ein<br />
Drittel des übernommenen <strong>Archiv</strong>guts betrifft SAD-Geschäftsakten ab 1991,<br />
welche die Tätigkeit <strong>der</strong> Vereinigung nach dem Ende des Kalten Krieges<br />
dokumentieren. Darin enthalten sind insbeson<strong>der</strong>e die Akten <strong>der</strong> leitenden<br />
Gremien, Korrespondenz, Unterlagen zu den Finanzen, zur Mitglie<strong>der</strong>bewegung,<br />
zu Projekten und Veranstaltungen sowie Publikationen.<br />
Die älteren Unterlagen werden in das SAD-<strong>Archiv</strong> integriert. Über das<br />
Vorgehen bei <strong>der</strong> Erschliessung <strong>der</strong> Geschäftsakten ab 1990 wird erst nach<br />
einer Bewertung <strong>der</strong> Unterlagen entschieden.<br />
Institut für politologische Zeitfragen (IPZ) / Nachlass Robert<br />
Vögeli<br />
Am 15. Februar <strong>2005</strong> ist Dr. Robert Vögeli im 78. Lebensjahr in Aarau verstorben.<br />
In den heissesten Jahren des Kalten Krieges hat Vögeli die im Zweiten<br />
Weltkrieg ins Leben gerufene, nach Kriegsende jedoch deaktivierte Sektion<br />
Heer und Haus des Armeekommandos wie<strong>der</strong> aufgebaut. Ab 1970 leitete er<br />
das von ihm initiierte Institut für politologische Zeitfragen (IPZ) in Zürich.<br />
Als das IPZ nach dem Ende des Kalten Krieges 1992 seine Tätigkeit einstellen<br />
musste, hat Robert Vögeli sowohl Teile <strong>der</strong> umfangreichen Dokumentation<br />
wie auch das Geschäftsarchiv sukzessive dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
übergeben. Auch sein privater Nachlass, welcher hauptsächlich Unterlagen<br />
zu seiner Tätigkeit bei Heer und Haus enthält, ist von ihm dem <strong>Archiv</strong> für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> anvertraut worden.<br />
Ein von Vögeli <strong>der</strong> Forschungsstelle für Sicherheitspolitik <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich<br />
übergebener Teilbestand aus dem IPZ-<strong>Archiv</strong> im Umfang von 6,5 Laufmeter<br />
konnte dank dem Entgegenkommen von Prof. Dr. Andreas Wenger im Frühjahr<br />
<strong>2005</strong> mit dem im <strong>Archiv</strong> befindlichen Bestand zusammengeführt und<br />
provisorisch erschlossen werden. Neben einzelnen Geschäftsakten (darunter<br />
die bisher fehlenden Vorstandsprotokolle <strong>der</strong> Jahre 1966 bis 1980) beinhaltet<br />
<strong>der</strong> Teilbestand Dossiers <strong>der</strong> IPZ-Dokumentation zu den Themenkreisen<br />
Agitation, APO Schweiz, Jugendbewegung, Jugoslawien, Rechtsextremismus,<br />
Spionage, Staatsschutz-Affäre und Terrorismus.<br />
73
Allgemeine schweizerische <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Zwei grössere Schenkungen im Bereich <strong>der</strong> allgemeinen schweizerischen<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> verdienen beson<strong>der</strong>e Erwähnung, nämlich die Nachlässe<br />
des kürzlich hochbetagt verstorbenen Spanienfreiwilligen Hans Hutter sowie<br />
des Zürcher Staats- und Völkerrechtsprofessors Dietrich Schindler sen.<br />
Hinzu kommt eine ganze Reihe kleinerer, nicht min<strong>der</strong> interessanter Neuerwerbungen.<br />
Schenkungen einzelner Unterlagen sowie kleiner Nachträge zu<br />
bereits vorhandenen Beständen verdankt das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> Irina<br />
Strub-Siegenthaler und German Vogt. Neben <strong>der</strong> Vorordnung des Nachlasses<br />
von Dietrich Schindler sen. konnten auch <strong>der</strong> Nachlass des Staatsrechtlers<br />
Max Imboden und die Vorlässe <strong>der</strong> Bundeshauskorrespondenten Arnold<br />
Fisch und Hans Wili erschlossen werden.<br />
Neuzugänge und Nachlieferungen<br />
Nachlass Hans Hutter<br />
Am 9. Dezember <strong>2006</strong> ist mit Hans Hutter einer <strong>der</strong> letzten noch lebenden<br />
Spanienfreiwilligen verstorben. Die Sicherung seines Privatnachlasses hat<br />
er noch selbst in die Wege geleitet: In feierlichem Rahmen unterzeichneten<br />
<strong>der</strong> 93jährige Donator und seine Familienangehörigen am 16. August <strong>2006</strong><br />
Einer <strong>der</strong> letzten Spanienfreiwilligen: Hans Hutter aus Winterthur, <strong>der</strong> 1936–1938 für die<br />
spanische Republik kämpfte, anlässlich <strong>der</strong> Schenkung seines Nachlasses im AfZ, 16. August<br />
<strong>2006</strong>.<br />
74
die Schenkungserklärung im Lesesaal des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> – <strong>der</strong><br />
Anlass fand auch in <strong>der</strong> Presse Beachtung.<br />
Hans Hutter aus Winterthur war einer von mehreren hun<strong>der</strong>t Schweizer<br />
Freiwilligen, die im Spanischen Bürgerkrieg zwischen 1936 und 1939 für die<br />
Republik gegen die Franco-Faschisten gekämpft hatten und dafür nach ihrer<br />
Rückkehr von <strong>der</strong> Militärjustiz hart bestraft wurden. Eine rechtliche Rehabilitation<br />
<strong>der</strong> Spanienkämpfer steht bis heute aus. Hutter hat eindrückliche<br />
Erinnerungen unter dem Titel „Spanien im Herzen. Ein Schweizer im Spanischen<br />
Bürgerkrieg“ (Zürich: Rotpunktverlag, 1996) veröffentlicht.<br />
Der Bestand umfasst Tagebuchaufzeichnungen, Korrespondenzen und<br />
Fotos zum Spanischen Bürgerkrieg, aber auch zeitgenössische Presseerzeugnisse<br />
und Schriften sowie später erschienene Bücher, Medienberichte<br />
und Dokumentarfilme. Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> freut sich über diese<br />
Schenkung, die zentrale Quellen zu <strong>der</strong> bis heute aktuellen Thematik enthält.<br />
Der Bestand wird nach <strong>der</strong> Übergabe und archivischen Aufarbeitung <strong>der</strong><br />
Forschung zugänglich gemacht.<br />
Nachlass Dietrich Schindler sen.<br />
Dietrich Schindler sen. wurde am 3. Dezember 1890 in Zürich als Sohn von<br />
Anna und Dietrich Schindler-Huber geboren. Sein Vater war Generaldirektor<br />
<strong>der</strong> Maschinenfabrik Oerlikon. Das Studium <strong>der</strong> Jurisprudenz in Zürich, Leipzig<br />
und Berlin schloss er 1916 mit <strong>der</strong> Promotion ab. 1921 folgte die Habilitation,<br />
anschliessend ein Studienaufenthalt in den Vereinigten Staaten. 1927 wurde<br />
<strong>der</strong> junge Privatdozent zum ausserordentlichen, 1936 zum ordentlichen<br />
Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, später auch für Völkerrecht und<br />
Rechtsphilosophie, an die Universität Zürich berufen.<br />
Neben seiner universitären Laufbahn war Schindler Mitglied des Grossen<br />
Stadtrates von Zürich, des Zürcher Kantonsrates und <strong>der</strong> Kirchenpflege<br />
Zollikon. Ab 1940 präsidierte er den Verwaltungsrat <strong>der</strong> NZZ, dem er seit 1928<br />
angehörte. Ausserdem wirkte er als Mitglied im Internationalen Komitee<br />
vom Roten Kreuz mit.<br />
Schindler publizierte zahlreiche juristische Monografien und Aufsätze und<br />
entfaltete eine rege Gutachtertätigkeit, insbeson<strong>der</strong>e zu Fragen, die sich im<br />
Konfliktfeld zwischen <strong>der</strong> Schweiz und den kriegführenden Parteien während<br />
und nach dem Zweiten Weltkrieg ergaben. Am 10. Januar 1948 ist Dietrich<br />
Schindler im Alter von 58 Jahren in Zürich verstorben.<br />
75
Herr Prof. Dr. Dietrich Schindler jun. hat den Nachlass seines Vaters im Herbst<br />
<strong>2006</strong> zusammen mit Frau Charlotte Zollikofer-Schindler und Herrn Prof. Dr.<br />
Alfred Schindler dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> geschenkt. Ein Jahr zuvor<br />
hatte er die im Wesentlichen auf dem Nachlass basierende Biografie „Ein<br />
Schweizer Staats- und Völkerrechtler<br />
<strong>der</strong> Krisen- und Kriegszeit:<br />
Dietrich Schindler (sen.),<br />
1890-1948“ (Zürich: Schulthess,<br />
<strong>2005</strong>) publiziert. Dank <strong>der</strong> durch<br />
den Donator vorgenommenen<br />
Vorordnung und Verzeichnung<br />
konnte <strong>der</strong> Bestand bereits provisorisch<br />
in <strong>der</strong> <strong>Archiv</strong>datenbank<br />
erschlossen werden.<br />
Der Nachlass im Umfang von<br />
mehr als fünf Laufmetern beinhaltet<br />
Unterlagen zu Schindlers<br />
Tätigkeit als Professor <strong>der</strong> Universität<br />
Zürich, im Verwaltungsrat<br />
<strong>der</strong> NZZ, im Pressestab von<br />
Prof. Dr. Dietrich Schindler sen. (1890–1948)<br />
Bundesrat Eduard von Steiger,<br />
als Militärrichter sowie zu seinem Engagement für die Swiss-American<br />
Society for Cultural Relations. Eingehend dokumentiert ist seine Gutachtertätigkeit<br />
von <strong>der</strong> Zwischenkriegszeit über den Zweiten Weltkrieg bis in die<br />
Nachkriegszeit hinein. Als Auftraggeber traten vor allem Minister Pierre<br />
Bonna und ab 1945 Minister Walter Stucki von <strong>der</strong> Abteilung für Auswärtiges<br />
des EPD sowie Oberst i. Gst. Paul Logoz, <strong>der</strong> das Büro des Generalstabschefs<br />
leitete, in Erscheinung. Hinzu kommen eine umfangreiche Korrespondenz,<br />
die zu Kontroversen mit prominenten deutschen Vertretern seines Fachs in<br />
<strong>der</strong> Zeit des Nationalsozialismus Aufschluss geben, sowie zahlreiche Publikationen<br />
aus seiner Fe<strong>der</strong>.<br />
Vorlass Felix Auer<br />
Dr. rer. pol. Felix Auer (geb. 1925) – in Bottmingen bei Basel aufgewachsen – arbeitete<br />
nach seinem Studium <strong>der</strong> Volkswirtschaft zunächst unter an<strong>der</strong>em<br />
als freier Journalist und als Sekretär <strong>der</strong> Evangelisch-reformierten Kirche des<br />
76
Kantons Basel-Landschaft, bevor er von 1969 bis 1991 für die Ciba-Geigy AG<br />
tätig war. Politisch engagierte er sich in <strong>der</strong> FDP seines Heimatkantons, die<br />
er von 1976 bis 1980 präsidierte. Von 1971 bis 1975 war er Baselbieter Landrat<br />
und von 1971 bis 1991 Mitglied des Nationalrates.<br />
<strong>2005</strong> übergab er dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> primär Unterlagen zu<br />
seiner publizistischen Auseinan<strong>der</strong>setzung mit dem sozialdemokratischen<br />
Nationalrat Jean Ziegler. Felix Auer veröffentlichte als Antwort auf Jean<br />
Zieglers „Die Schweiz, das Gold und die Toten“ (München: Bertelsmann, 1997)<br />
sein Buch „Das Schlachtfeld von Thun o<strong>der</strong> Dichtung und Wahrheit bei Jean<br />
Ziegler“ (Stäfa: Th. Gut-Verlag, 1997; Lausanne: Edition L‘Age d‘Homme, 1998,<br />
mit einem Vorwort von Georges André Chevallaz).<br />
Weitere Unterlagen beziehen sich auf den Filmemacher Roman Brodmann.<br />
Im Zentrum <strong>der</strong> Debatte steht hier <strong>der</strong> 1987 entstandene Dokumentarfilm<br />
Brodmanns für das Schweizer Fernsehen „Der Traum vom Schlachten <strong>der</strong><br />
heiligen Kuh“. Felix Auer kritisierte die in seinen Augen armeefeindliche<br />
Ausrichtung des Films im Kontext <strong>der</strong> Volksinitiative zur Abschaffung <strong>der</strong><br />
Schweizer Armee.<br />
Der Bestand belegt die publizistische Tätigkeit eines engagierten liberalen<br />
Politikers, <strong>der</strong> seine Positionen kämpferisch vertrat und während Jahrzehnten<br />
ein offenes, intellektuelles Streitgespräch mit seinen politischen Gegnern<br />
führte.<br />
Teilnachlass Fritz und Clara Sigrist-Hilty<br />
Der an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs im Osmanischen<br />
Reich begangene Völkermord, welcher rund eine Million Opfer for<strong>der</strong>te, wird<br />
bis heute trotz <strong>der</strong> an<strong>der</strong>s lautenden historischen Belege immer wie<strong>der</strong> in<br />
Zweifel gezogen. Umso wertvoller sind Aufzeichnungen von Augenzeugen<br />
wie Fritz und Clara Sigrist-Hilty.<br />
Der in Beirut als Sohn von Auslandschweizern geborene Fritz Sigrist wirkte<br />
von 1910 bis 1918 in <strong>der</strong> Gegend von Aleppo und des Amanus als Sektionsingenieur<br />
am Bau <strong>der</strong> Bagdadbahn mit. Nach <strong>der</strong> Heirat folgte ihm 1915 seine<br />
Ehefrau Clara Sigrist-Hilty ins Osmanische Reich, wo sie an ihrem Wohnort<br />
Keller (dem nachmaligen Fevzipasa) am Rande des Amanusgebirges Augenzeugen<br />
<strong>der</strong> Deportation <strong>der</strong> Armenier wurden. Ihre Beobachtungen hat<br />
Clara Sigrist-Hilty in einem Bericht sowie in ihrem Tagebuch festgehalten.<br />
Der Bestand enthält auch Korrespondenz, Aufzeichnungen und Fotografien<br />
77
zu ihren Reisen und zum Aufenthalt<br />
in <strong>der</strong> Türkei sowie Unterlagen zur<br />
Biografie. 1926 kehrten Fritz Sigrist<br />
und im folgenden Jahr auch seine<br />
Frau erneut in die Türkei zurück, wo<br />
er bis 1937 als Oberingenieur unter<br />
an<strong>der</strong>em beim Bau <strong>der</strong> Südanatolischen<br />
Bahn mitwirkte.<br />
Rudolf Sigrist hat einen Teil des<br />
Nachlasses seiner Eltern <strong>2005</strong><br />
dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
geschenkt. Jene Unterlagen, die<br />
vorwiegend den Bahnbau in <strong>der</strong><br />
Türkei betreffen, hat er den Spezialsammlungen<br />
<strong>der</strong> <strong>ETH</strong>-Bibliothek<br />
Fritz und Clara Sigrist-Hilty in <strong>der</strong> Türkei 1916.<br />
übergeben. Für die Zurverfügungstellung des Tagebuchs von Clara Sigrist, von<br />
dem sich eine Kopie im Bestand findet, dankt das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Frau Kati Gabathuler-Sigrist.<br />
Vorlass Georg Kreis<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> 2003 getroffenen Schenkungsvereinbarung übergab Prof. Dr.<br />
Georg Kreis eine weitere Ablieferung zu seinem zeitgeschichtlich und thematisch<br />
wichtigen Vorlass. Sie umfasst Ergänzungen zu seiner Korrespondenz,<br />
zu seiner wissenschaftlichen Tätigkeit und Mitarbeit in Kommissionen, aber<br />
auch Materialien zum Verhalten gegenüber Freimaurern in <strong>der</strong> Zwischenkriegszeit,<br />
zum Staatschutz in <strong>der</strong> Schweiz sowie zu den Selbstdarstellungen<br />
<strong>der</strong> Schweiz anlässlich des Jubiläums von 1991 und <strong>der</strong> Expo 2001/2002.<br />
Einzelbestand Emil Bänziger<br />
Die Unterlagen aus dem Nachlass des Textilindustriellen Dr. Emil Bänziger<br />
(1872-1946) aus Romanshorn betreffen hauptsächlich dessen Engagement<br />
in <strong>der</strong> Gruppe Oberthurgau <strong>der</strong> Neuen Helvetischen Gesellschaft (NHG),<br />
<strong>der</strong>en Tätigkeit er seit <strong>der</strong> Gründung <strong>der</strong> Gruppe 1916 zunächst als Kassier,<br />
1932 bis 1946 als Präsident entscheidend prägte. Die frühesten Unterlagen<br />
beziehen sich vor allem auf den Landesgeneralstreik vom November 1918. Einen<br />
inhaltlichen Schwerpunkt bildet die Diskussion um die „Überfremdung“<br />
durch Deutsche und Italiener in den Jahren des Zweiten Weltkriegs sowie die<br />
78
Säuberungsaktionen gegen nationalsozialistische Deutsche und faschistische<br />
Italiener in <strong>der</strong> Schweiz unmittelbar nach Kriegsende, insbeson<strong>der</strong>e in<br />
den Kantonen Graubünden, Tessin und Thurgau. Es handelt sich dabei um<br />
Korrespondenz und Berichte des engagierten NHG-Mitglieds Eduard Wepf<br />
aus Müllheim (TG) an Emil Bänziger, welche offenbar zum Teil auch unter<br />
den Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> NHG-Gruppe Oberthurgau zirkulierten. Die Schenkung<br />
<strong>der</strong> Unterlagen verdanken wir Frau Cornelia L. Drechsel.<br />
Einzelbestand Robert Nicole<br />
Frau Dr. med. Gret Nicole-Gisler hat dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> die noch<br />
vorhandenen Originalunterlagen ihres Mannes Prof. Dr. med. Robert Nicole<br />
zur Teilnahme an den Ärztemissionen geschenkt, welche als Einzelbestand<br />
unter seinem Namen archiviert werden. Neben Korrespondenz mit seiner<br />
späteren Ehefrau aus <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> ersten Ostfrontmission enthält <strong>der</strong> Bestand<br />
auch einen umfangreichen Bericht über die Schweizerische Ärztemission<br />
nach Finnland vom Februar bis Mai 1940, welche unter <strong>der</strong> Leitung von<br />
Nicole stand.<br />
Einzelbestand Alfred Reinhard Hohl<br />
Am 12. November 2004 ist alt Botschafter Alfred Reinhard Hohl in Luzern<br />
verstorben. Nach dem Studium <strong>der</strong> Rechts- und Politikwissenschaft war er<br />
1957 in den diplomatischen Dienst eingetreten. Im Rang eines Botschafters<br />
vertrat er die Schweiz in Moskau (1978-1981), Belgrad (1982-1987), Bonn (1987-<br />
1991) und Athen (1991-1995). Während die Jahre in Moskau, wo er bereits<br />
1960 bis 1962 als Botschaftssekretär tätig war, noch in die Ära des Kalten<br />
Krieges fielen, erlebte er in Bonn den Zusammenbruch des Ostblocks und<br />
die deutsche Wie<strong>der</strong>vereinigung mit. Im Bestand finden sich Kopien seiner<br />
Politischen Berichte nach Bern sowie seiner in den jeweiligen Gastlän<strong>der</strong>n<br />
gehaltenen Vorträge aus den Jahren 1978 bis 1995. Beigefügt sind vier Politische<br />
Berichte (Kopien) von Legationsrat Alfred Zehn<strong>der</strong> zur Situation <strong>der</strong><br />
Schweizer Gesandtschaft in Berlin bei Kriegende 1945. Für die Schenkung<br />
danken wir Herrn lic. iur. Christoph Hohl.<br />
Einzelbestand Lina Meyer-Spörri<br />
Lina Meyer-Spörri (1891-1970), geboren und verheiratet in Bäretswil, Hausfrau<br />
und Mutter zweier Kin<strong>der</strong>, hat in insgesamt 22 Heften vom Juni 1938 bis Juli<br />
1970 fast täglich handschriftlich aufgezeichnet, was sie erlebte und was sie<br />
79
ewegte. Die Einträge sind manchmal durch Presseausschnitte (meist Fotos)<br />
ergänzt. Persönliches und Profanes findet sich neben Hochpolitischem.<br />
Oft sind im gleichen Eintrag Bemerkungen zum Wetter, zu Familiärem,<br />
zu Lokalem, aber auch zum schweizerischen und internationalen Zeitgeschehen<br />
enthalten. Beson<strong>der</strong>s minutiös werden die Kriegsereignisse von<br />
1939 bis 1945 rapportiert, während in politisch ruhigeren Zeiten eindeutig<br />
Aufzeichnungen zum Alltags- und Familienleben im Vor<strong>der</strong>grund stehen.<br />
Bei beson<strong>der</strong>s erschütternden Ereignissen wie bei <strong>der</strong> sowjetischen Besetzung<br />
Ungarns 1956 o<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>schlagung des „Prager Frühlings“<br />
1968 rückt auch in den Jahren des Kalten Krieges wie<strong>der</strong> die Politik in den<br />
Vor<strong>der</strong>grund. Die Tagebuchautorin verzichtet weitgehend auf Kommentare<br />
und Wertungen. Nur selten und oft nur indirekt lassen sich Rückschlüsse auf<br />
ihre eigene Haltung ziehen. Für die Schenkung <strong>der</strong> Tagebücher danken wir<br />
Herrn Prof. Dr. Paul Hugger und dem Heilsarmee-Brockenhaus in Wetzikon.<br />
Ergänzende Angaben zur Biografie verdanken wir Herrn Peter Meyer, Enkel<br />
<strong>der</strong> Tagebuchautorin.<br />
Einzelbestand Albert Schoop<br />
Dr. phil. Albert Schoop (1919-1998) war Historiker, Gymnasiallehrer und Verfasser<br />
historischer Werke, insbeson<strong>der</strong>e zur Geschichte des Kantons Thurgau.<br />
Die Schenkung umfasst vor allem Unterlagen zur „Hochschulgruppe für freiheitlich-demokratische<br />
Politik“ (HGFDP) an <strong>der</strong> Universität Zürich, welche als<br />
Wi<strong>der</strong>standsgruppe 1940 gegründet wurde. Sie wollte allen Übernahmeversuchen<br />
nationalsozialistischen Denkens entschieden begegnen und diesen<br />
einen bewusst schweizerischen Standpunkt entgegensetzen. Interessant<br />
sind die von Schoop verfassten Wochenrückblicke aus den Jahren 1941/1942.<br />
Die Hochschulgruppe setzte ihre Tätigkeit nach Kriegsende fort. In diesen<br />
Einzelbestand wurden auch Akten von Dr. iur. Eric Homburger eingeglie<strong>der</strong>t,<br />
<strong>der</strong> ebenfalls in dieser studentischen Vereinigung aktiv war.<br />
Einzelbestand Hans U. Steger<br />
Der unter dem Kürzel H. U. ST. bekannt gewordene Karikaturist Hans U. Steger,<br />
<strong>der</strong> während vielen Jahren für den Zürcher Tages-Anzeiger zeichnete, hat<br />
seinen Bestand durch zahlreiche Kopien von Karikaturen zu in- und ausländischen<br />
Politikern ergänzt. Die Zeichnungen mit Schweizer Bezug betreffen<br />
Bundesräte, National- und Stän<strong>der</strong>äte, Regierungsräte, Bundesbeamte, Vertreter<br />
aus Militär und Wirtschaft sowie das Verhältnis <strong>der</strong> Schweiz zum Schah<br />
80
Der Bundesrat nach <strong>der</strong> Schlankheitskur, Karikatur von Hans U. Steger, 1995.<br />
von Persien. Die Karikaturen ausländischer Politiker sind geglie<strong>der</strong>t nach Kontinenten<br />
und Län<strong>der</strong>n. Hinzu kommen Porträts <strong>der</strong> UNO-Generalsekretäre.<br />
Die übergebenen Zeichnungen sind zwischen 1945 und 2003 entstanden<br />
und dokumentieren damit über ein halbes Jahrhun<strong>der</strong>t <strong>Zeitgeschichte</strong> seit<br />
dem Ende des Zweiten Weltkriegs.<br />
Darüber hinaus verdanken wir Herrn Steger die Schenkung einer grösseren<br />
Anzahl Pressefotos zu vorwiegend französischen Politikern, die ihm als Vorlagen<br />
für seine Karikaturen dienten. Die Fotos werden in die Fotosammlung<br />
des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> integriert.<br />
Dissertationsarchiv Peter Boller<br />
Dr. Peter Boller übergab dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> seine Tonbandsammlung,<br />
die im Zuge <strong>der</strong> Bearbeitung seiner Dissertation „Mit Psychologie die<br />
Welt verän<strong>der</strong>n – Die psychologische Lehr- und Beratungsstelle (Zürcher<br />
Schule) von Friedrich Liebling 1952-1982: Eine psychologische Schule und<br />
soziale Bewegung in lebensgeschichtlichen Interviews“ bei Prof. Martin<br />
Schaffner in Basel entstanden ist.<br />
Die Tonbandsammlung umfasst 20 biografische Interviews mit zumeist<br />
langjährigen Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Zürcher Schule. Diese Zeitzeugen ermöglichen<br />
81
einen Einblick in die nicht unumstrittene Bewegung, die insbeson<strong>der</strong>e für<br />
Zürich während Jahren eine gesellschaftspolitische Bedeutung hatte. Wir<br />
danken Herrn Peter Boller für diese Schenkung. Seine Dissertation ist unter<br />
dem Titel „Mit Psychologie die Welt verän<strong>der</strong>n. Die „Zürcher Schule“ Friedrich<br />
Lieblings in ihrer Zeit (1952-1982) 2007 im Chronos-Verlag erschienen.<br />
Mit einer Vision für Europa in <strong>der</strong> Schweiz:<br />
Winston Churchill wird in Genf-Cointrin am<br />
23. August 1946 begeistert empfangen.<br />
Dissertationsarchiv Werner Vogt<br />
Die Pressionen, denen die Schweizer<br />
Redaktionen zur Zeit des Zweiten<br />
Weltkriegs ausgesetzt waren, werden<br />
exemplarisch durch die Dissertation<br />
von Dr. Werner Vogt zur Berichterstattung<br />
<strong>der</strong> NZZ über Winston Churchill<br />
zwischen 1938 bis 1946 offen gelegt<br />
(Vogt, Werner: Winston Churchill.<br />
Mahnung, Hoffnung und Vision 1938<br />
bis 1946. Das Churchill-Bild in <strong>der</strong> Berichterstattung<br />
und Kommentierung<br />
<strong>der</strong> Neuen Zürcher Zeitung und <strong>der</strong><br />
unternehmensgeschichtlichen Hintergründe,<br />
Zürich: NZZ-Verlag, 1996).<br />
Das umfangreiche Material, das<br />
<strong>der</strong> Autor für seine Studie sichtete,<br />
darunter auch Akten aus dem Politischen <strong>Archiv</strong> des Auswärtigen Amtes in<br />
Berlin und <strong>der</strong> Leitungsorgane <strong>der</strong> NZZ, ist nun im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
zugänglich und ergänzt in wertvoller Weise den Nachlass von Willy Bretscher,<br />
<strong>der</strong> als damaliger Chefredaktor bei <strong>der</strong> Verteidigung <strong>der</strong> Freiheit des<br />
geschriebenen Wortes eine Schlüsselrolle übernahm.<br />
<strong>Archiv</strong> des Verbands <strong>der</strong> Deutschen Hilfsvereine in <strong>der</strong> Schweiz<br />
sowie des Deutschen Hilfsvereins Zürich<br />
Am 7. Februar 1856 wurde <strong>der</strong> Deutsche Hilfsverein Zürich mit dem Zweck<br />
gegründet, in Not geratene eingewan<strong>der</strong>te Deutsche zu unterstützen.<br />
1863 erfolgte die Errichtung des Zentralvereins für die gesamte Schweiz,<br />
dessen Vorort jeweils von einem örtlichen Sekretariat übernommen wurde.<br />
Anlässlich des Jubiläums erschien die von Renate Hochholzer verfasste<br />
Chronik „150 Jahre Deutscher Hilfsverein in Zürich, 1856-<strong>2006</strong>“. Die dabei<br />
82
verwendeten Quellen sind anschliessend vom amtierenden Präsidenten<br />
Manfred Gutermuth dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> übergeben worden. Die<br />
Akten bestehen aus den nur zum Teil erhaltenen <strong>Jahresbericht</strong>en, Kassabüchern<br />
und Protokollen. In ihnen wi<strong>der</strong>spiegelt sich die bürgerlich geprägte,<br />
sozialgeschichtlich interessante Hilfstätigkeit von Deutschen für Deutsche<br />
in <strong>der</strong> Schweiz, die schon vor dem Kaiserreich begann, zwei Weltkriege und<br />
das Dritte Reich überstand und bis in die Gegenwart fortdauert.<br />
Erschliessungen<br />
Nachlass Max Imboden<br />
Max Imboden wurde am 19. Juni 1915 in St. Gallen als Sohn des Ärzteehepaars<br />
Karl und Frieda Imboden-Kaiser geboren. Das Studium <strong>der</strong> Jurisprudenz an<br />
den Universitäten Genf, Bern und Zürich schloss er 1939 mit <strong>der</strong> Promotion<br />
ab.<br />
Von 1946 bis 1953 war Imboden als Rechtskonsulent für den Stadtrat von<br />
Zürich tätig. Nach seiner Habilitation wurde er 1948 von <strong>der</strong> Universität<br />
Zürich zum ausserordentlichen Professor für Verwaltungsrecht berufen.<br />
1953 erfolgte seine Wahl zum ordentlichen Professor für Staats- und Verwaltungsrecht<br />
<strong>der</strong> Universität Basel, <strong>der</strong> er 1963/64 als Rektor vorstand. Als<br />
Pionier <strong>der</strong> Wissenschaftspolitik wurde er 1965 zum ersten Präsidenten des<br />
Schweizerischen Wissenschaftsrats gewählt.<br />
Imboden machte sich als Herausgeber des wie<strong>der</strong>holt neu aufgelegten<br />
Standardwerks „Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung“ sowie als<br />
Autor wichtiger Gesetzesentwürfe und zahlreicher Rechtsgutachten einen<br />
Namen. 1964 publizierte er die viel beachtete Schrift „Helvetisches Malaise“,<br />
welche einen wesentlichen Anstoss zur Diskussion um eine Totalrevision<br />
<strong>der</strong> Bundesverfassung gab. Er arbeitete auch in <strong>der</strong> Kommission für die<br />
Vorbereitung <strong>der</strong> Totalrevision <strong>der</strong> Bundesverfassung mit. Zwischen 1961<br />
und 1964 war Imboden Mitglied des Grossen Rats des Kantons Basel-Stadt<br />
und des Basler Verfassungsrates, von 1965 bis 1967 vertrat er die Basler FDP<br />
im Nationalrat. Am 7. April 1969 ist Max Imboden im Alter von 54 Jahren in<br />
Basel verstorben.<br />
Die Erbengemeinschaft Max Imboden hat den Privatnachlass 1997 dem<br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> geschenkt, welcher dank dem Entgegenkommen<br />
des Staatsarchivs Zürich mit einem bis 1996 dort befindlichen Teilbestand<br />
zur Lehrtätigkeit Imbodens zusammengeführt werden konnte. Der im<br />
83
Sommer <strong>2006</strong> vollständig erschlossene Nachlass im Gesamtumfang von<br />
fast 2.5 Laufmetern dokumentiert insbeson<strong>der</strong>e seine Zeit als Professor an<br />
den Universitäten Zürich und Basel (Vorlesungsunterlagen u.a.) sowie die<br />
Gutachtertätigkeit. Einzelne Unterlagen beziehen sich auf die Revision <strong>der</strong><br />
Bundesverfassung und auf die Revisionen <strong>der</strong> Kantonsverfassungen von<br />
Nidwalden und Basel. Beson<strong>der</strong>s wertvolle Zeitdokumente sind die ausführlichen<br />
Tagebücher <strong>der</strong> Jahre 1961 bis 1969. Zum Bestand gehören zudem<br />
eine umfangreiche Korrespondenz sowie eine Vielzahl von Manuskripten<br />
und Publikationen (Monografien, Aufsätze, Reden, Presseartikel) von Max<br />
Imboden. Kaum Unterlagen finden sich hingegen zu seiner Schrift „Helvetisches<br />
Malaise“.<br />
Nachlass Karl Schmid<br />
Seit seiner Übernahme und <strong>der</strong> ersten<br />
Erschliessung 1974 bis 1983 wurde <strong>der</strong><br />
Nachlass des Zürcher Germanisten,<br />
Staatsdenkers und <strong>ETH</strong>-Rektors Prof.<br />
Dr. Karl Schmid durch mehrere grössere<br />
und kleinere Nachlieferungen<br />
vervollständigt. Seit Mai 2004 wird <strong>der</strong><br />
Bestand von lic. phil. Daniel Schmid mit<br />
dem Ziel überarbeitet, ihn langfristig<br />
zu sichern und <strong>der</strong> Forschung leichter<br />
zugänglich zu machen. Der 13,4 Laufmeter<br />
umfassende Privatbestand wurde<br />
dabei gründlichen konservatorischen<br />
Vor 100 Jahren geboren: Karl Schmid (1907-<br />
1974) , Kin<strong>der</strong>bild 1910.<br />
Massnahmen unterzogen. Gezielte<br />
Recherchen werden durch die elektronische<br />
Erfassung <strong>der</strong> Dossiertitel und<br />
Inhalte ermöglicht. Ausserdem wurden die substantiellen Nachlieferungen in<br />
den Bestand eingeflochten. Zudem konnten die im Rahmen <strong>der</strong> Briefedition<br />
von Karl Schmid entstandene Forschungsdokumentation von Frau Dr. Sylvia<br />
Rüdin dem Bestand hinzugefügt werden. Diese erleichtert die Arbeit mit <strong>der</strong><br />
umfangreichen Korrespondenz Karl Schmids erheblich. Die eigentliche Neuerschliessung<br />
konnte im Oktober abgeschlossen werden. Noch ausstehend<br />
sind die Korrektur- und Anpassungsarbeiten sowie die Etikettierung, welche<br />
in <strong>der</strong> ersten Jahreshälfte 2007 beendet werden.<br />
84
Nachlass Victor H. Umbricht<br />
Der promovierte Jurist Victor H. Umbricht (1915-1988) zählte von den sechziger<br />
bis in die achtziger Jahre zu den wichtigsten Schweizer UNO-Mitarbeitern.<br />
Sein Nachlass umfasst fast<br />
ausschliesslich Materialien aus <strong>der</strong><br />
Zeit nach 1957. Schwerpunkte bilden<br />
seine bedeutende Mediatoren-Tätigkeit<br />
im Kongo, in Laos, Kambodscha,<br />
Indochina und Ostafrika. Weitere<br />
Dossiers beziehen sich auf die<br />
Frage eines Beitritts <strong>der</strong> Schweiz zur<br />
UNO und belegen sein Engagement<br />
in internationalen Institutionen, in<br />
diversen Vereinen und Verbänden.<br />
Nach einem Unterbruch sind die<br />
Arbeiten am Nachlass wie<strong>der</strong> aufgenommen<br />
worden. Als Nachfolger<br />
von lic. phil. Michael Funk wurde<br />
Humanitärer Einsatz in Dacca: Victor H. Umbricht<br />
(links) übergibt einen Rollstuhl für Kriegsversehrte<br />
in Bangladesh, Januar 1973.<br />
Dr. Daniel Schwane seit Mai <strong>2006</strong><br />
für diese Aufgabe gewonnen. Er<br />
erschloss im Rahmen eines Teilzeitpensums<br />
zunächst Unterlagen zu Umbrichts Wirken in <strong>der</strong> Privatwirtschaft.<br />
Dieser war Leiter <strong>der</strong> Ciba in den USA; nach <strong>der</strong> Fusion gehörte er von 1970<br />
bis 1985 dem Verwaltungsrat <strong>der</strong> Ciba-Geigy AG an.<br />
Anschliessend wurden die allerdings rudimentären Unterlagen zur „Eidgenössischen<br />
Finanzverwaltung“ erfasst, <strong>der</strong> er von 1957 bis 1960 vorstand.<br />
Geordnet wurden auch die Aktengruppen „Kommission Schweiz - UNO“<br />
und „Entwicklungshilfe und technische Zusammenarbeit des Bundes“<br />
sowie die Korrespondenzen und Dokumentationen zur „Hague Academy<br />
of International Law“. Dank einer Schenkung von Frau Monique Sellschopp-<br />
Umbricht konnte <strong>der</strong> Fotobestand durch illustrative Zeitdokumente erweitert<br />
werden.<br />
Vorlass Arnold Fisch<br />
Dr. iur. Arnold Fisch (geb. 1913) wirkte ab 1943 während dreieinhalb Jahrzehnten<br />
als Bundeshausjournalist in Bern, zunächst für die „Schweizer Mit-<br />
85
telpresse“, die spätere „Schweizerische Politische Korrespondenz“, dann für<br />
verschiedene Zeitungen, insbeson<strong>der</strong>e für die „Basler Nachrichten“. Neben<br />
seiner journalistischen Tätigkeit war Fisch auch in Fachvereinigungen aktiv.<br />
Er beteiligte sich am Aufbau <strong>der</strong> „Vereinigung <strong>der</strong> Bundeshausjournalisten“,<br />
<strong>der</strong> er ab 1955 als erster Präsident vorstand. 1962 bis 1968 gehörte er dem<br />
Zentralvorstand des „Vereins <strong>der</strong> Schweizer Presse“ an. Auch nach seiner<br />
Pensionierung betätigte er sich publizistisch.<br />
Zu Fischs Tätigkeit für die „Schweizer Mittelpresse“ und die „Basler<br />
Nachrichten“ sowie zur Geschichte dieser beiden Institutionen finden sich<br />
Unterlagen im Bestand, ebenso zu Peter Dürrenmatt, dem langjährigen<br />
Chefredaktor <strong>der</strong> „Basler Nachrichten“. Dokumentiert ist auch sein Engagement<br />
in <strong>der</strong> „Vereinigung <strong>der</strong> Bundeshausjournalisten“ und im „Verein <strong>der</strong><br />
Schweizer Presse“ (VSP), darunter Dossiers zur Haltung des VSP gegenüber<br />
dem „Blick“ o<strong>der</strong> zur Aufnahme von Kommunisten. Bei den Publikationen von<br />
Arnold Fisch ist neben zahlreichen thematisch geglie<strong>der</strong>ten Presseartikeln die<br />
Schrift „Meine Bundesräte. Von Etter bis Aubert“ (Stäfa: Th. Gut & Co. Verlag,<br />
1989) hervorzuheben. Darin entwirft er persönliche Porträts aller Mitglie<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Landesregierung, denen er während seiner langen Jahre im Bundeshaus<br />
begegnet ist. Ergänzt wird diese Publikation durch Korrespondenz mit und<br />
Fotos von den dargestellten Magistraten.<br />
Vorlass Hans Wili<br />
Als profilierter Journalist und Redaktor prägte <strong>der</strong> 1918 geborene Hans Wili die<br />
katholisch-konservative Presse <strong>der</strong> Schweiz in <strong>der</strong> Nachkriegszeit wesentlich<br />
mit. Nach dem Abschluss seines Studiums in Germanistik und Geschichte<br />
an den Universitäten Zürich und Fribourg war er ab 1945 als Redaktor unter<br />
an<strong>der</strong>em für die unabhängige Wochenzeitung „Der Weg“, für die „Schweizerische<br />
Politische Korrespondenz“ sowie für die „Ostschweiz“ tätig.<br />
Von 1959 bis 1983 berichtete Wili mit kurzem Unterbruch als Bundeshausredaktor<br />
für die „Ostschweiz“ und die „Freiburger-Nachrichten“ sowie für<br />
das „Vaterland“ über das politische Geschehen aus Bern. Zwischen 1966<br />
und 1973 arbeitete er überdies nebenamtlich als Presseschau-Redaktor für<br />
Radio Bern.<br />
Vorübergehend wechselte Wili die Seite und wurde 1973 bis 1974 Pressechef<br />
für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement unter Bundesrat Kurt<br />
Furgler. 1975 bis 1977 war er als Pressechef für den „Verband <strong>der</strong> Schweize-<br />
86
ischen Lebensversicherungsgesellschaften“ tätig. 1963 gründete er das<br />
Journalistische Seminar <strong>der</strong> Universität Freiburg i. Ue., das er anfänglich auch<br />
leitete. 1982 trat er als Mitinitiant <strong>der</strong> „Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und<br />
Gesellschaft“ innerhalb <strong>der</strong> CVP in Erscheinung.<br />
Der 1999 übernommene und <strong>2006</strong> erschlossene Vorlass dokumentiert Wilis<br />
redaktionelle Tätigkeit für die Wochenzeitung „Der Weg“, für das „Aufgebot<br />
<strong>der</strong> Jungen“ (Beilage zu „Das Aufgebot“) sowie für die „Presse-Schau“ von<br />
Radio Bern. Daneben finden sich zahlreiche Referate und Ansprachen <strong>der</strong><br />
Bundesräte Kurt Furgler und Hans Hürlimann, an <strong>der</strong>en Entwürfen Hans<br />
Wili mitgewirkt hat.<br />
Belegt ist auch Wilis Engagement im Rahmen <strong>der</strong> Expertenkommission<br />
für die Überprüfung des zivilrechtlichen Schutzes <strong>der</strong> Persönlichkeit (insbeson<strong>der</strong>e<br />
im Zusammenhang mit den Massenmedien) und <strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaft<br />
Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) <strong>der</strong> CVP. Abgerundet wird<br />
<strong>der</strong> Bestand durch ein Personendossier zu Georg Bru<strong>der</strong>er (Suspendierung<br />
als EMD-Beamter) und durch Sachdossiers zur Kontroverse um den Film über<br />
den „Landesverräter Ernst S.“ von Richard Dindo und Niklaus Meienberg<br />
sowie zu einer Ruanda-Reise Wilis im Jahr 1970.<br />
Forschungsdokumentation Reinhold Busch<br />
Dr. med. Reinhold Busch hat seine Forschungsdokumentation zu den Schweizer<br />
Ärztemissionen an die Ostfront durch Kopien von weiteren Originalquellen<br />
ergänzt, darunter insbeson<strong>der</strong>e Unterlagen zur Teilnahme <strong>der</strong> Rotkreuzschwester<br />
Elsi Eichenberger an <strong>der</strong> ersten Ostfrontmission 1941/1942.<br />
Dissertationsarchiv Stephan Winkler<br />
Das 1997 von Dr. Stephan Winkler geschenkte Dissertationsarchiv zu den bilateralen<br />
Beziehungen <strong>der</strong> Schweiz zum geteilten Italien 1943 bis 1945 wurde<br />
<strong>2006</strong> durch interessantes Tonmaterial erweitert. Der Autor und ehemalige<br />
Mitarbeiter des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> überliess die Mitschnitte seiner<br />
Interviews mit über zwei Dutzend Zeitzeugen (darunter Pierre Micheli, Otto<br />
Pünter und Paul Ruegger). Silvan Abicht hat den Bestand im Rahmen eines<br />
Praktikums erschlossen.<br />
Forschungsdokumentation Neville Wylie<br />
Die von Dr. Neville Wylie <strong>2006</strong> übergebene Forschungsdokumentation mit<br />
Kopien aus englischen <strong>Archiv</strong>en umfasst sowohl ausgewählte Korrespon-<br />
87
denzmaterialien zwischen dem britischen Aussenministerium und dem<br />
britischen Botschafter David V. Kelly in Bern sowie innerhalb des britischen<br />
Wirtschaftsministeriums bezüglich <strong>der</strong> britisch-schweizerischen Schmuggler-Aktivitäten<br />
zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Exemplarisch verdeutlicht<br />
werden diese Aktivitäten anhand <strong>der</strong> Unterlagen von Sir Anthony Lousada,<br />
einem Mitarbeiter des britischen Kriegswirtschaftsministeriums.<br />
Veranstaltungen, Kooperationen<br />
Vernissage und Dokumentarfilm zu Warda Bleser-Bircher<br />
Am 28. August <strong>2006</strong> starb die Geologin und Botanikerin Warda Bleser-Bircher,<br />
die im Vorjahr ihren 100. Geburtstag gefeiert hatte. Für die grosszügige Unterstützung<br />
bei <strong>der</strong> Erschliessung und Vermittlung ihres Nachlasses gedenkt<br />
das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> <strong>der</strong> Verstorbenen in Dankbarkeit.<br />
Am 15. April <strong>2005</strong> fand in <strong>der</strong> Semperaula <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich die Vernissage <strong>der</strong><br />
von Nora Bussmann verfassten und im NZZ-Verlag erschienenen Biografie<br />
„Die mutige Pionierin – Warda Bleser-Birchers Jahrhun<strong>der</strong>t“ statt. Nach<br />
einer biografischen Einführung durch Daniel Nerlich referierten Dr. Verena<br />
Steiner und die Autorin zu Entstehungsbedingungen <strong>der</strong> Studie, die aus<br />
dem Nachlass im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> schöpft. Den chronologischen<br />
Erzählstrang ihrer Arbeit entwickelt Bussman entlang des abenteuerlichen<br />
Lebensjahrhun<strong>der</strong>ts einer Frau, <strong>der</strong>en berufliches Engagement in <strong>der</strong><br />
Männerdomäne des Ölgeschäfts sie in unzähligen Reisen rund um den<br />
Globus geführt hatte.<br />
Das im Wortsinn vielschichtige originelle Design <strong>der</strong> Publikation wurde<br />
zwischenzeitlich mit dem red dot grand prix, einem renommierten internationalen<br />
Preis für Kommunikationsdesign ausgezeichnet. Sie ist ein interessanter<br />
Versuch, historische Inhalte einem neuen Publikum näherzubringen,<br />
das die multimediale Informationsaufnahme im Internet gewohnt ist.<br />
An einem Salonabend auf Schloss Lenzburg war Daniel Nerlich am 22. April<br />
<strong>2005</strong> eingeladen, den Nachlass und die Biografierte vorzustellen. Im Zentrum<br />
dieser Veranstaltung standen Teile von André Birchers Antikensammlung, die<br />
<strong>der</strong> Grossvater <strong>der</strong> Nachlasserin in den 1880er Jahren dem Kanton Aargau<br />
geschenkt hatte.<br />
Ein noch einmal an<strong>der</strong>s geartetes Forschungsprojekt zu Warda Bleser-Bircher<br />
konnte wenige Tage vor ihrem Tod vollendet werden. Die Filmemacher<br />
Susanne Hausammann und Jens-Peter Rövekamp drehten ihr dokumenta-<br />
88
Frühform <strong>der</strong> Globalisierung: Warda Bleser-Bircher mit Ehemann Paul Bleser auf einer ihrer<br />
zahlreichen Seereisen.<br />
risches Porträt „Warda – Unter einer an<strong>der</strong>en Sonne geboren“ teilweise im<br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> und unterlegten es mit vielfältigem <strong>Archiv</strong>material<br />
aus dem Nachlass.<br />
Kooperation mit dem Ludwik Fleck Zentrum von <strong>ETH</strong> und Universität<br />
Zürich<br />
Am 7. Juli <strong>2005</strong> wurde das Ludwik Fleck Zentrum (LFZ) in Zürich gegründet.<br />
Die am Collegium Helveticum von Universität und <strong>ETH</strong> Zürich domizilierte<br />
Institution beschäftigt sich mit <strong>der</strong> Erforschung des Werks des polnischen<br />
Bakteriologen und Wissenschaftstheoretikers Ludwik Fleck (1896-1961).<br />
Der in Lemberg geborene und dort beruflich tätige Fleck war nach <strong>der</strong><br />
deutschen Besetzung ins jüdische Ghetto verbracht worden. 1943 wurde er<br />
nach Auschwitz deportiert, wo er für das so genannte Hygiene-Institut <strong>der</strong><br />
SS einen Impfstoff gegen das Fleckfieber entwickelte.<br />
Im Anschluss an leitende Tätigkeiten in den vierziger und fünfziger Jahren<br />
in Lublin und Warschau emigrierte Fleck nach einem Herzinfarkt und einer<br />
Krebsdiagnose nach Israel. Hier arbeitete er bis zu seinem Tod am Institut<br />
für biologische Forschung in Ness-Ziona. Von <strong>der</strong> Wissenschaftsphilosophie<br />
neu entdeckt wurde Fleck als Ideengeber für Thomas S. Kuhns bekanntes<br />
89
Werk „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“.<br />
Bereits wenige Tage nach dem Gründungsanlass<br />
gelangte <strong>der</strong> Leiter des LFZ, Prof.<br />
Johannes Fehr, an das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>,<br />
das unter <strong>der</strong> Projektleitung von<br />
Daniel Nerlich Kooperationsmöglichkeiten<br />
im Rahmen eines Depotvertrags prüfte. Im<br />
Zentrum <strong>der</strong> gemeinsamen Planung stand<br />
die Sicherung und digitale Aufbereitung<br />
einschlägiger <strong>Archiv</strong>bestände des LFZ sowie<br />
die Eröffnung einer neuen Plattform für die<br />
Fleck-Forschung mit <strong>der</strong> Internet-Präsentation<br />
in AfZ Online <strong>Archiv</strong>es.<br />
Ludwik Fleck (1896–1961)<br />
Vertraglich festgehalten wurde die integrale Digitalisierung einer grösseren<br />
Forschungsdokumentation zur Wissenschaftsphilosophie Flecks,<br />
von Korrespondenzen des Schwabe-Verlags in Basel zu den Werkeditionen<br />
sowie von Unterlagen von Prof. Marcus Klingberg, dem wissenschaftlichen<br />
Nachlassverwalter Flecks. Die vorgängige Bestandeserschliessung im <strong>Archiv</strong><br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong> erfolgte durch Daniel Schwane, <strong>der</strong> insbeson<strong>der</strong>e auch<br />
polnische Unterlagen für die deutschsprachige Forschung erstmals greifbar<br />
machte. Das nie<strong>der</strong>ländische Unternehmen „Digital Manufacturing and<br />
Production“ (DMP) führte anschliessend die Dokumentdigitalisierung durch<br />
und erstellte pdf-Formate von den Dossiers, die durch Volltexterkennung<br />
effizienter benutzbar werden.<br />
Am 15. November <strong>2006</strong> stellten Daniel Nerlich und Daniel Schwane im Rahmen<br />
des Fleckolloquiums in ihrer Präsentation „Fleck im <strong>Archiv</strong> – Dokumente<br />
des Ludwik Fleck Zentrums und neue Recherchen“ die Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
Arbeit mit den seit diesem Datum aufgeschalteten Online-Beständen vor.<br />
90
Sammlungen, Bibliotheken<br />
Presseausschnittdokumentation<br />
Die seit Mitte <strong>der</strong> 1960er Jahre im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> aufgebaute und<br />
von Michael Schär bis in die Gegenwart weitergeführte Presseausschnittdokumentation<br />
mit den drei Teilbeständen Biografische Sammlung, Sammlung<br />
Geschichte und Systematische Sammlung (zum aktuellen Zeitgeschehen in<br />
<strong>der</strong> Schweiz) erfreute sich erneut einer regen Nachfrage. Mit <strong>der</strong> Aufschaltung<br />
zahlreicher Findmittel auf die AfZ-Website wird nun auch die rund<br />
10‘000 Dossiers zu Personen <strong>der</strong> <strong>Zeitgeschichte</strong> umfassende Biografische<br />
Sammlung im Internet abfragbar, was zweifellos mit dazu beigetragen hat,<br />
dass diese die mit Abstand höchste Benutzungszahl aller knapp 500 Bestände<br />
im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> erreichte.<br />
Bibliothek<br />
Neben dem Zukauf ausgewählter aktueller Sekundärliteratur und einzelner<br />
Quelleneditionen zu zeitgeschichtlichen Themenkreisen wurde <strong>der</strong> Bibliotheksbestand<br />
erneut durch zahlreiche kleinere und grössere Schenkungen<br />
sowie durch eine stattliche Anzahl eingegangener Belegexemplare (vgl.<br />
Liste im Kapitel Benutzung) erweitert. Schenkungen von Büchern, Periodika<br />
und Druckschriften verdankt das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> namentlich Prof.<br />
Dr. Jean-François Bergier, Ruth Binde, Tamara Brunner, Nina Grässli, Verena<br />
Hofstetter, Ida Ritter-Braun, Walter Schmid, Dr. Stephan Winkler sowie dem<br />
„Arbeitskreis Gelebte Geschichte“.<br />
Audiovisuelle Quellen<br />
Zahlreiche audiovisuelle Quellen wurden in <strong>der</strong> Berichtszeit als Teile von<br />
Nachlässen, Forschungsdokumentationen und institutionellen <strong>Archiv</strong>en<br />
übernommen. Sie werden in den Kapiteln <strong>der</strong> Schwerpunktsbereiche und<br />
Dokumentationstellen beschrieben.<br />
Beson<strong>der</strong>s hervorzuheben ist <strong>der</strong> Neuzugang des Lebenswerks von Egon<br />
Becker, das einen reichhaltigen Fundus zur Illustration des Schweizer Wirtschaftsgeschehens<br />
in <strong>der</strong> Nachkriegszeit beinhaltet. Dieses breite Angebot<br />
wird in <strong>der</strong> Fotosammlung durch Bilddokumente zu Wirtschaft und Technik<br />
ergänzt. Hier finden sich beispielsweise auf Fotoalben zu Eisen- und Bergbahnen<br />
in <strong>der</strong> Zwischenkriegszeit o<strong>der</strong> zur Waffenschmiede Oerlikon Contraves<br />
(1977), die das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> von Rolf Wanner und Prof. Dr. Paul<br />
91
Aus dem Erinnerungsalbum eines Aktivdienstlers: Schiessübung anlässlich des Patrouillenlaufs<br />
<strong>der</strong> 5. Division in Arosa, 1945.<br />
Hugger erhielt. Unser Fotoarchiv und die Sammlung illustrativer Ausstellungsobjekte<br />
umfasst auch Bildmaterialien zur Militärgeschichte, die u.a.<br />
dank <strong>der</strong> Vermittlung von Renato Esseiva durch mehrere Fotoalben, Einzelaufnahmen<br />
und Erinnerungsstücke zu den Aktivdiensten in <strong>der</strong> Schweizer<br />
Armee von 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945 ergänzt werden konnten.<br />
Von Hanna Zweig und Dr. Stefan Mächler erhielten wir zahlreiche Fotografien<br />
zum Bereich Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong>, darunter Aufnahmen von<br />
Entscheidungsträgern <strong>der</strong> schweizerischen Flüchtlingspolitik zur Zeit des<br />
Zweiten Weltkriegs sowie von Hilfeleistenden <strong>der</strong> jüdischen Gemeinde in<br />
<strong>der</strong> Schweiz und im Ausland während <strong>der</strong> Zwischenkriegs- und Kriegszeit.<br />
Erweitert wird die Sammlung durch die bereits erwähnten Schenkungen<br />
von Hans U. Steger und Gisela Blau.<br />
Erschliessungen und Digitalisierungen<br />
Die Praktikanten und Praktikantinnen, die im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> die<br />
Gelegenheit wahrnehmen, sich mit <strong>der</strong> <strong>Archiv</strong>arbeit vertraut zu machen,<br />
arbeiten auch bei <strong>der</strong> Erschliessung und Digitalisierung audiovisueller<br />
92
Quellen mit. So haben Paola Cimino und Karin Rauch im Rahmen ihrer<br />
Praktikumseinsätze verschiedene Verzeichnisse aktualisiert und insbeson<strong>der</strong>e<br />
die 2001 übernommene Sammlung von Otto Wobmann mit rund<br />
100 Videodokumentationen zum Thema Nationalsozialismus und Zweiter<br />
Weltkrieg erschlossen.<br />
Die Digitalisierungsprojekte dienten in <strong>der</strong> Berichtszeit prioritär <strong>der</strong> Sicherung<br />
von stark gefährdeten Tondokumenten. Zahlreiche Aufnahmen, die sich<br />
im Original auf älteren Tonbandkassetten befinden, wurden <strong>2005</strong> und <strong>2006</strong><br />
überspielt, darunter über 80 Zeitzeugnisse in <strong>der</strong> Forschungsdokumentation<br />
Stephan Winkler, im SIG-<strong>Archiv</strong> und dem Bestand Netzwerk Stadt und<br />
Landschaft (NSL) zur Geschichte <strong>der</strong> Raumplanung sowie Mitschnitte <strong>der</strong><br />
Verhöre von Adolf Eichmann aus dem Nachlass Avner W. Less. In einigen Fällen<br />
dienen Digitalisierungen auch dem aktuellen Interesse von Forschenden,<br />
welche die „Media Assets“ dann effizient im Lesesaal konsultieren können.<br />
Hierzu gehören auch sämtliche Filme aus dem Nachlass Walter Bosshard,<br />
dessen Zeitzeugnisse zu China in einem abendfüllenden Dokumentarfilm<br />
ausgewertet werden sollen.<br />
Oral History<br />
Der Bereich oral history verzeichnet zahlreiche Neuzugänge, im Rahmen<br />
<strong>der</strong> Berichtszeit speziell auch Mitschnitte anlässlich <strong>der</strong> beiden Holocaust-<br />
Gedenktage, Aufnahmen mit einzelnen Zeitzeugen, aber auch Interviews,<br />
die Forschende wie Dr. Stephan Winkler und Dr. Peter Boller dem <strong>Archiv</strong> für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> überliessen. Die Reihe <strong>der</strong> seit 1973 veranstalteten Kolloquien<br />
des Freundes- und För<strong>der</strong>erkreises des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> wurde<br />
<strong>2005</strong>/06 mit Rückblicken folgen<strong>der</strong> Persönlichkeiten fortgesetzt:<br />
23.3.<strong>2005</strong>: Dr. iur. Rudolf Zipkes: Jude und Schweizer sein, Erfahrungen,<br />
Begegnungen, Konzeptionen und Fehleinschätzungen im persönlichen<br />
Rückblick 1920-2000.<br />
22.6.<strong>2005</strong>: Prof. Dr. Franz A. Blankart, a. Staatssekretär: Zwischen Isolation<br />
und Integration. Als Negoziator im Dienst <strong>der</strong> schweizerischen<br />
Europa- und Aussenwirtschaftspolitik. Rückblick Teil I (1964-<br />
1980).<br />
9.11.<strong>2005</strong>: Prof. Dr. h.c. mult. Ernst Ludwig Ehrlich: Verfolgung und Aufbruch<br />
– jüdisches Leben nach dem Holocaust – Mein Engagement für<br />
den christlich-jüdischen Dialog (Erinnerungen 1940-1996).<br />
93
Kolloquium zur Europa- und Aussenwirtschaftspolitik: a. Staatsekretär Prof. Dr. Franz Blankart<br />
und Klaus Urner, 22. Juni <strong>2005</strong>.<br />
14.12.<strong>2005</strong>: Prof. Dr. Franz A. Blankart, a. Staatssekretär: Schweizerische<br />
Aussenwirtschaftspolitik im Spannungsfeld globaler Konflikte<br />
1980-1986. Rückblick Teil II.<br />
10.5.<strong>2006</strong>: Prof. Dr. Franz A. Blankart, a. Staatssekretär: Aufbruch in den<br />
EWR – missglückter Beitrittsversuch zur EG. Erfolgreiche Uruguay-Runde.<br />
Rückkehr zum Bilateralismus. (Rückblick III. Leitung<br />
Bundesamt für Aussenwirtschaft 1986-1998).<br />
13.12.<strong>2006</strong>: Prof. Dr. Dr. h.c. Jean-François Bergier: L‘histoire vécue. Vom Mittelalter<br />
zur <strong>Zeitgeschichte</strong>: Rückblick 1952-2002.<br />
94
IT-Bereich<br />
Die IT-Abteilung unter Leitung von lic. phil. Jonas Arnold blickt auf zwei ereignisreiche<br />
Jahre zurück. Zu den Zielsetzungen gehörten die Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
des externen Informationsangebots sowie <strong>der</strong> zentralen Arbeitsinstrumente<br />
<strong>der</strong> IT-Infrastruktur. Dass diese weitgehend erreicht werden konnten, ist auch<br />
Martin Schacher zu verdanken, <strong>der</strong> als Systemadministrator und Projektinformatiker<br />
von 2003 bis <strong>2006</strong> wesentlich zum Gedeihen dieses Bereichs<br />
beigetragen hat.<br />
Information Retrieval im <strong>Archiv</strong> – Aufschaltung und<br />
Weiterentwicklung des virtuellen Lesesaals<br />
Mit <strong>der</strong> Aufschaltung von AfZ Online <strong>Archiv</strong>es wurde eine neue Ära des<br />
elektronischen Informationsangebots des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> eingeleitet.<br />
Die gesamte Beständeübersicht sowie elektronische Findmittel zu<br />
zahlreichen Beständen werden <strong>der</strong> breiten Öffentlichkeit online zugänglich<br />
gemacht. Über eine benutzerfreundliche Oberfläche kann in Beständen und<br />
Akten mit probabilistischen Methoden gezielt recherchiert und ausgewähltes<br />
<strong>Archiv</strong>gut in elektronischer Form gesichtet werden. Die Aufschaltung<br />
von AfZ Online <strong>Archiv</strong>es erfolgte am 27. Januar <strong>2006</strong> anlässlich des „1. Swiss<br />
Innovation Forum“. Auf Einladung dieser erstmals stattfindenden Innovationsplattform<br />
präsentierten Daniel Nerlich und Jonas Arnold das System in<br />
Baden am Stand des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong>, <strong>der</strong> bei Vertreterinnen und<br />
Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Publizistik auf reges Interesse<br />
stiess.<br />
Im Vorfeld <strong>der</strong> Aufschaltung wurde durch die Firma Xylix Software GmbH<br />
ein umfassendes technisches und grafisches Feintuning vorgenommen.<br />
Das IT-Team des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> nahm <strong>der</strong>weil ein sanftes Lifting<br />
und eine inhaltliche Überarbeitung <strong>der</strong> Corporate Website vor. Ein weiterer<br />
Arbeitsschwerpunkt betraf die Konfiguration und Bereitstellung von<br />
Schnittstellen und Basistechnologien für das AfZ Online <strong>Archiv</strong>es sowie <strong>der</strong><br />
Errichtung eines Hilfesystems.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e unterstützte das IT-Team die task force im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>,<br />
welche intensive Vorarbeiten für die Aufschaltung <strong>der</strong> elektronischen<br />
Findmittel im Internet zu leisten hatte. Hierzu gehörten die Erarbeitung<br />
<strong>der</strong> Konzepte für die externe Präsentation unter Berücksichtigung von<br />
Schutzbedürfnissen und die akribische Überarbeitung <strong>der</strong> Metadaten <strong>der</strong><br />
95
Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> am 1. Swiss Innovation Forum: Daniel Nerlich präsentiert den<br />
virtuellen Lesesaal AfZ Online <strong>Archiv</strong>es.<br />
weit über hun<strong>der</strong>t frei gegebenen Bestände. Der hierzu von Martin Schacher<br />
entwickelte Daxolix, ein internes Tool zur Massenbearbeitung <strong>der</strong> Daten in<br />
<strong>der</strong> zentralen <strong>Archiv</strong>datenbank DACHS-A, erwies dabei wertvolle Dienste.<br />
AfZ Online <strong>Archiv</strong>es ist – wie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit aufgelistet<br />
– als virtueller Lesesaal zahlreichen Fachkräften mit positiver Resonanz präsentiert<br />
worden. Unter den Innovationen, welche dank Xylix Software GmbH<br />
im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> realisiert werden konnten, ist insbeson<strong>der</strong>e die<br />
Möglichkeit <strong>der</strong> Einschränkung <strong>der</strong> probabilistischen Suche auf theoretisch<br />
beliebige Schlüsselwerte wie Zugänglichkeit, Laufzeit, Quellenarten o<strong>der</strong><br />
einzelne Ebenen <strong>der</strong> <strong>Archiv</strong>tektonik zu erwähnen. Damit wird den Benutzern<br />
ermöglicht, die Stärken <strong>der</strong> probabilistischen Volltextsuche in Verbindung<br />
mit klassischen Recherchetechniken zu nutzen.<br />
Als Element zum Auf- und Ausbau des digitalen <strong>Archiv</strong>s wurden im Sommer<br />
<strong>2006</strong> zusätzliche Instanzen von AfZ Online <strong>Archiv</strong>es für das Intranet und<br />
den Lesesaal implementiert. In diesen wird ein kontinuierlich erweitertes<br />
Angebot digitalisierten <strong>Archiv</strong>guts angeboten, welches im Rahmen von Digitalisierungsprojekten<br />
verscannt und für die Benutzung aufbereitet wird.<br />
Zur Darstellung von Media Content war die Entwicklung von Viewern für<br />
96
audiovisuelle Quellenarten wie Bild-, Ton- und Film- bzw. Videodokumente<br />
und die Reorganisation des digitalen <strong>Archiv</strong>s nötig.<br />
Als erster Media Content wurden Ausschnitte zu 140 Kolloquien „Zeugen<br />
<strong>der</strong> Zeit“ akustisch sowie Forschungsunterlagen und Materialien von und<br />
zum Mikrobiologen, Mediziner und Wissenschaftstheoretiker Ludwig Fleck<br />
(1896-1961) im Januar und November <strong>2006</strong> als Originaldokumente in AfZ<br />
Online <strong>Archiv</strong>es verfügbar gemacht.<br />
Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> arbeitet zusammen mit Xylix Software an<br />
weiteren Innovationen, darunter die Optimierung <strong>der</strong> Absuche <strong>der</strong> Metadatenebene,<br />
die Erschliessung von Webkollektionen in zeitgeschichtlichen<br />
Fachportalen bis hin zur Verwaltung und zum Retrieval grosser Kollektionen<br />
digitalen <strong>Archiv</strong>guts. Für das bisher Erreichte danken wir den Mitarbeitern<br />
von Xylix Software.<br />
Von DACHS zu CMI STAR – eine neue Ära <strong>der</strong> <strong>Archiv</strong>informationssysteme<br />
Die Projekte zu AfZ Online <strong>Archiv</strong>es zeigten die Stärken, aber auch klare<br />
Leistungsgrenzen <strong>der</strong> seit 2000 gemeinsam mit <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> betriebenen <strong>Archiv</strong>datenbank<br />
DACHS-A auf. Nachdem die Lieferfirma DISOS GmbH 2004 durch<br />
das angelsächsische Unternehmen Iron Mountain, einem Anbieter reiner <strong>Archiv</strong>dienstleistungen,<br />
übernommen worden war, gab es begründete Zweifel,<br />
dass DACHS – wie ursprünglich in Aussicht gestellt – zu einem mo<strong>der</strong>nen<br />
<strong>Archiv</strong>informationssystem mit Modulen für die Lagerbewirtschaftung o<strong>der</strong><br />
den Benutzungsdienst weiterentwickelt wird.<br />
Tatsächlich erwies sich die notwendig gewordene Migration des Systems<br />
von oracle 8.0.5 auf oracle 10g im April <strong>2005</strong> als ein schwieriges Unterfangen.<br />
Auch waren die von DISOS jährlich gelieferten Upgrades mit unbereinigten<br />
Fehlern behaftet, so dass sie im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> nicht eingesetzt<br />
wurden. Dies war Grund genug, die ständige Beobachtung des Marktes<br />
für Anbieter von <strong>Archiv</strong>informationssystemen zu intensivieren und neue<br />
Partner zu suchen.<br />
Die ersten Kontakte zur Firma CM Informatik AG (CMI), einem Schweizer<br />
Anbieter von Systemen für <strong>Archiv</strong>e und für die Geschäftskontrolle, reichen in<br />
das Jahr 2004 zurück. Damals stellten das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> und die<br />
Firma Xylix Software GmbH die gemeinsam entwickelten Innovationen anlässlich<br />
des Internationalen Symposiums für Informationswissenschaften in<br />
97
Chur vor, an welchen die Firma CMI Interesse zeigte. In weiteren Gesprächen<br />
manifestierte sich das gegenseitige Interesse an einer partnerschaftlichen<br />
Entwicklung, die mit einer Testinstallation des <strong>Archiv</strong>informationssystems<br />
CMI STAR mit integrierter Xylix-Absuche im Sommer <strong>2005</strong> ihren konkreten<br />
Anfang nahm.<br />
Es folgte <strong>der</strong> Entwurf für einen auf CMI STAR basierenden Webclient für das<br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> sowie eine Reihe von erfolgreichen gemeinsamen<br />
Präsentationen, u.a. am <strong>Archiv</strong>kongress in Stuttgart im September <strong>2005</strong>.<br />
Die positiven Erfahrungen zeigten, dass die Produkte CMI STAR und Xylix<br />
füreinan<strong>der</strong> und für das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> wie geschaffen sind.<br />
Mit dem Abschluss von Kooperationsverträgen zwischen dem <strong>Archiv</strong> für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong>, Xylix Software und CMI im Februar und Juli <strong>2006</strong> ist <strong>der</strong><br />
Weg frei geworden für eine Zusammenarbeit, in <strong>der</strong>en Rahmen als erstes<br />
Projekt die Ablösung <strong>der</strong> <strong>Archiv</strong>datenbank DACHS in Angriff genommen<br />
wurde. Nach <strong>der</strong> Einrichtung <strong>der</strong> Basisinfrastruktur (August <strong>2006</strong>) und <strong>der</strong><br />
Installation des Systems sind gegenwärtig die abschliessenden Tests und<br />
das Feintuning in vollem Gange.<br />
Dabei zeigen sich Schritt um Schritt die Vorteile <strong>der</strong> neuen Technologie, auf<br />
<strong>der</strong> das <strong>Archiv</strong>informationssystem CMI STAR basiert. Es besticht vor allem<br />
durch seine enorme Flexibilität. Neben <strong>der</strong> praktisch beliebigen Parametrierbarkeit<br />
und <strong>der</strong> wählbaren Datenbanktechnologie (oracle o<strong>der</strong> MS-SQL)<br />
gaben vor allem die mächtigen Import- und Reportingmodule sowie die<br />
offenen Schnittstellen für weitere Umsysteme insbeson<strong>der</strong>e im Bereich<br />
<strong>der</strong> Langzeitarchivierung den Ausschlag für das Produkt des Anbieters, <strong>der</strong><br />
seit 1988 auf dem Markt ist und in den letzten Jahren zahlreiche Ausschreibungen<br />
gewonnen hat. Insgesamt hat das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> mit<br />
CMI einen Partner gefunden, <strong>der</strong> einen neuen technologischen Zyklus im<br />
Bereich <strong>der</strong> <strong>Archiv</strong>informationssysteme eingeläutet hat und mit dem es<br />
– auch in Zusammenarbeit mit Xylix Software – zukunftsweisende Projekte<br />
realisieren möchte.<br />
Systemwartung, Weiterentwicklungen<br />
Diese Projekte wurden neben dem eigentlichen Tagesgeschäft weiterverfolgt:<br />
Aufrechterhaltung und Mo<strong>der</strong>nisierung <strong>der</strong> IT-Infrastruktur und Büromatik<br />
sowie <strong>der</strong> Support für alle <strong>Archiv</strong>bereiche und für den Benutzungsdienst.<br />
Zur Mo<strong>der</strong>nisierung gehörten die Einführung von fünf neuen Laptops als<br />
98
mobile Arbeitsstationen, die Einrichtung eines Hotspots im Lesesaal und<br />
die Reorganisation <strong>der</strong> zentralen Server in einem Racksystem. Im Bereich<br />
Sicherheit wurden mit <strong>der</strong> Migration sämtlicher Rechner in das Reservenetz<br />
<strong>der</strong> <strong>ETH</strong> die Grundlagen für die Einführung von NET-NG geschaffen.<br />
In diesem Zusammenhang wurde auch die Auslagerung verschiedener<br />
Dienste an entsprechende Stellen in <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> eingehend geprüft. Der für<br />
das Departement GESS ausgearbeitete Bericht zeigt, dass ein erhebliches<br />
Entwicklungspotential im IT-Bereich des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> besteht,<br />
das effizient zu nutzen aber auch eine Anpassung des seit Jahren stagnierenden<br />
IT-Kredits erfor<strong>der</strong>t.<br />
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen<br />
Gruppe Sammlungen und <strong>Archiv</strong>e; Kulturgüterkommission<br />
<strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> von Daniel Nerlich geleiteten Arbeitsgruppe „<strong>Archiv</strong>e an <strong>der</strong><br />
<strong>ETH</strong> Zürich“, zu <strong>der</strong> das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>, das Hochschularchiv <strong>der</strong> <strong>ETH</strong><br />
(<strong>Archiv</strong>e und Nachlässe), das <strong>Archiv</strong> gta zur Theorie und Geschichte <strong>der</strong> Architektur,<br />
das Max-Frisch-<strong>Archiv</strong> und das Thomas-Mann-<strong>Archiv</strong> gehören, werden<br />
Fragen möglicher Synergien im Bereich <strong>der</strong> Informationstechnologien und die<br />
Situation <strong>der</strong> räumlichen Infrastruktur thematisiert. Zur Intensivierung <strong>der</strong><br />
Öffentlichkeitsarbeit wurde <strong>der</strong> gemeinsame Webauftritt auf <strong>der</strong> Homepage<br />
<strong>der</strong> <strong>ETH</strong> weiterentwickelt (https://www.ethz.ch/libraries/collections).<br />
Die Arbeitsgruppe public relations entwickelte ein Abendführungskonzept,<br />
das allen Sammlungen und <strong>Archiv</strong>en <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> die Möglichkeit bietet, sich einmal<br />
jährlich einem Publikum zu präsentieren, welches beson<strong>der</strong>es Interesse<br />
an den kulturellen Institutionen <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> findet. Für die im Monatsrhythmus<br />
stattfindenden einstündigen Führungen werben die Sammlungen und <strong>Archiv</strong>e<br />
mit einem gemeinsamen Flyer.<br />
Die Anliegen <strong>der</strong> <strong>ETH</strong>-<strong>Archiv</strong>e vertrat Daniel Nerlich auch als Mitglied <strong>der</strong><br />
Kulturgüterkommission (KGK), welche die Schulleitung per <strong>2005</strong> als beratendes<br />
Gremium in Fragen <strong>der</strong> Aufbewahrung, Erhaltung und Präsentation <strong>der</strong><br />
Kulturgüter in den Sammlungen und <strong>Archiv</strong>en <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich neu eingesetzt<br />
hatte. In den sechs Sitzungen des Berichtszeitraums gab sich die KGK eine<br />
Geschäftsordnung und bereitete die Aufnahme verschiedener Kulturgüter<br />
ins entsprechende Verzeichnis <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> vor.<br />
99
Abendführungen für die Öffentlichkeit – gemeinsamer Auftritt <strong>der</strong> Sammlungen und <strong>Archiv</strong>e<br />
<strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich.<br />
An <strong>der</strong> zweiten von ihr organisierten Plenarsitzung <strong>der</strong> Sammlungen und<br />
<strong>Archiv</strong>e referierte Prof. Christoph Flüeler am 29. November <strong>2006</strong> über die<br />
Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften <strong>der</strong> Stiftsbibliothek St. Gallen.<br />
Obwohl die Kulturgüterkommission zur Zeit über kein eigenes Budget<br />
verfügt, ist zumindest die Prüfung und koordinierende Unterstützung vergleichbarer<br />
Projekte an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> in ihrer Geschäftsordnung vorgesehen. Auf<br />
diesen Support ist auch das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> bei seinen aufwändigen<br />
Digitalisierungsvorhaben künftig dringend angewiesen, die letztlich<br />
dazu dienen, die cultural assets <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> nach aussen besser sichtbar und<br />
komfortabler nutzbar zu machen.<br />
Tagungen, Seminarien und Präsentationen<br />
Seminarien, Proseminare, Gymnasialklassen und weitere Gruppen haben<br />
auch <strong>2005</strong>/06 das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> besucht, sei es für Präsentationen,<br />
für eine Einführung in die Arbeit mit Originalquellen o<strong>der</strong> im Kontext<br />
mit spezifischen Themen, wobei auch an externen Anlässen über unsere<br />
Tätigkeit informiert wurde:<br />
100
26.1.<strong>2005</strong> Informationsveranstaltung für Mittelschullehrer und Mediothekare<br />
des Kantons Zürich: Nachhaltiger Umgang mit digitalen Assets (Speichermedien<br />
– Formate – Metadaten), Digitalisierungsprojekte im<br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>, sinapsis.ch (Jonas Arnold, Daniel Nerlich)<br />
11.2.<strong>2005</strong> Historisches Seminar <strong>der</strong> Universität Basel (Dr. Erik Petry), Proseminar:<br />
Jüdisches Leben im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t. Referate: Die Dokumentationsstelle<br />
Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> (Uriel Gast), Gesamtpräsentation AfZ<br />
(Jonas Arnold); Die Jüdische Pressezentrale in Zürich: Ein Schweizer<br />
Blick auf die jüdische Welt <strong>der</strong> Zwischenkriegszeit (Daniel Gerson)<br />
17.2.<strong>2005</strong> Lernnachmittag <strong>der</strong> Gesellschaft für Judaistische Forschung mit PD<br />
Dr. Joachim Schlör, Universität Potsdam<br />
8./17.3.<strong>2005</strong> Besuch Schulklasse Kantonsschule Wettingen. Referat: Die Schweiz<br />
im Zweiten Weltkrieg (Regina Gehrig)<br />
15.3.<strong>2005</strong> Sektion Zürich <strong>der</strong> Gesellschaft Schweiz - Israel. Referate: Gesamtpräsentation<br />
des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> und <strong>der</strong> Dokumentationsstelle<br />
Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> (Jonas Arnold, Uriel Gast); „Für<br />
kein Geld in <strong>der</strong> Welt möchte ich mehr in die Schweiz zurück“: Die<br />
Aliyah des Erich Goldschmidt aus <strong>der</strong> Schweiz nach Israel und ihre<br />
Vorgeschichte (Daniel Gerson)<br />
3.6.<strong>2005</strong> Historisches Seminar <strong>der</strong> Universität Bern (Dr. Patrick Kury), Proseminar:<br />
Antisemitismus. Referate: Die Dokumentationsstelle Jüdische<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> (Uriel Gast); Recherche und Benutzung (Jonas Arnold);<br />
Die Jüdische Pressezentrale in Zürich (Daniel Gerson)<br />
30.6.<strong>2005</strong> Gruppe <strong>Archiv</strong>e an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich, Referat: Das Projekt Xylix Online<br />
<strong>Archiv</strong>es – Lösung zur Online-Präsentation archivischer Metadaten<br />
(Jonas Arnold)<br />
13.-15.9.<strong>2005</strong> Präsentation am 10. archivwissenschaftlichen Kolloquium <strong>der</strong> <strong>Archiv</strong>schule<br />
Marburg anlässlich des 100. Jahrestags <strong>der</strong> Gründung<br />
des Gesamtarchivs deutscher Juden. Referat: „Sicherung gefährdeter<br />
Quellen zur schweizerisch-jüdischen <strong>Zeitgeschichte</strong>. Erfahrungen<br />
beim Aufbau <strong>der</strong> Dokumentationsstelle Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong>“<br />
und Leitung <strong>der</strong> Paneldiskussion (Uriel Gast)<br />
29.9.<strong>2005</strong> Generalversammlung des För<strong>der</strong>vereins <strong>der</strong> Karl-Schmid-Stiftung.<br />
Referate: Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> im Überblick (Werner Hagmann);<br />
Der Nachlass Karl Schmid (Daniel Schmid)<br />
12.10.<strong>2005</strong> Präsentation für das Dokumentationszentrum doku-zug.ch. Referat:<br />
Vom gedruckten Findmittel zum virtuellen Informationsraum, Informationstechnologien<br />
im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> (Jonas Arnold,<br />
Daniel Nerlich)<br />
101
9.11.<strong>2005</strong> Ethikkommission <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich. Referat: Erinnern vs. Vergessen<br />
– <strong>Archiv</strong>alltag im Spannungsfeld von Forschungsfreiheit und Datenschutz<br />
(Jonas Arnold)<br />
18.11.<strong>2005</strong> Einführungskurs des Vereins Schweizerischer <strong>Archiv</strong>arinnen und<br />
<strong>Archiv</strong>are. Referate: Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> (Daniel Nerlich);<br />
Informationstechnologien im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> (Jonas Arnold);<br />
Das VSJF-<strong>Archiv</strong> und seine Datenbank (Daniel Gerson)<br />
27.1.<strong>2006</strong> . Swiss Innovation Forum, Baden: Präsentation AfZ Online <strong>Archiv</strong>es<br />
(Jonas Arnold, Daniel Nerlich)<br />
10.2.<strong>2006</strong> Historisches Seminar <strong>der</strong> Universität Basel (Dr. Erik Petry), Proseminar:<br />
Jüdische Familiengeschichte im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t. Referate: Die<br />
Dokumentationsstelle Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> (Uriel Gast); Gesamtpräsentation<br />
AfZ, Recherche und Benutzung (Jonas Arnold); Deutschjüdische<br />
Familiengeschichte am Beispiel ausgewählter Dokumente<br />
im Nachlass Hermann Levin Goldschmidt (Daniel Gerson)<br />
23.2.<strong>2006</strong> hist <strong>2006</strong>. Geschichte im Netz – Praxis, Chancen, Visionen. Humboldt-Universität<br />
(Berlin), Referat: AfZ Online <strong>Archiv</strong>es – Der virtuelle<br />
Lesesaal des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> (<strong>ETH</strong> Zürich). Werkstattbericht<br />
im Rahmen <strong>der</strong> Tagung (Daniel Nerlich)<br />
16.8.<strong>2006</strong> Empfang anlässlich <strong>der</strong> Unterzeichnung <strong>der</strong> Schenkungserklärung<br />
zum Vorlass Hans Hutter. Referat: Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
und seine Quellenbestände zum Spanischen Bürgerkrieg (Werner<br />
Hagmann)<br />
29.9.<strong>2006</strong> Kantonsschule Rämibühl, Zürich (Sebastian Bott), Themenwoche Zürich<br />
im Zweiten Weltkrieg. Präsentation zweier Flüchtlingsschicksale<br />
aus dem VSJF-<strong>Archiv</strong> (Uriel Gast)<br />
15.11.<strong>2006</strong> Fleckolloquium des Ludwik Fleck Zentrums am Collegium Helveticum<br />
(Zürich), Referate: „Fleck online“ – Langzeitarchivierung und Internetpräsentation<br />
von Quellenbeständen des Ludwik Fleck Zentrums<br />
im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich (Daniel Nerlich, Daniel<br />
Schwane)<br />
102
Benutzung<br />
Die schon 2004 in die Wege geleitete Reorganisation des Benutzungsdienstes,<br />
für den eine durch Drittmittel finanzierte Stelle geschaffen wurde, hat<br />
sich bewährt, und die dadurch erreichte personelle Kontinuität wird allgemein<br />
sehr geschätzt. Mit Frau Marijke Rupp konnte vom September <strong>2005</strong> bis<br />
Ende <strong>2006</strong> eine kompetente I+D-Assistentin gewonnen werden.<br />
Erneuter Anstieg <strong>der</strong> Benutzungszahlen<br />
Der in den letzten Jahren zu beobachtende kontinuierliche Anstieg <strong>der</strong><br />
Benutzungszahlen setzte sich auch im Berichtszeitraum fort: <strong>2005</strong> wurden<br />
620 Benutzungen im Lesesaal registriert, <strong>2006</strong> sogar 660 (2004: 614 Benutzungen).<br />
Im Steigen begriffen ist auch die Zahl <strong>der</strong> Fernbenutzungen,<br />
nämlich insgesamt 68 in beiden Berichtsjahren zusammen. Bei total 423<br />
verschiedenen Benutzungen (mit teils mehreren Besuchen im Lesesaal)<br />
entspricht dies immerhin einem Anteil von 16 Prozent – bei fast je<strong>der</strong> sechsten<br />
Benutzung wurden die gewünschten Unterlagen also nicht vor Ort im<br />
Lesesaal konsultiert, son<strong>der</strong>n in Form von Papierkopien o<strong>der</strong> Digitalisaten<br />
per Briefpost o<strong>der</strong> elektronisch übermittelt. Die Fernbenutzungen dürften<br />
durch die auf unserer Website neu geschaffene Möglichkeit einer Recherche<br />
auf Dossierebene weiterhin zunehmen.<br />
AfZ-Website<br />
Das Webangebot des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> konnte mit <strong>der</strong> Aufschaltung<br />
von AfZ Online <strong>Archiv</strong>es ab Ende Januar <strong>2006</strong> wesentlich erweitert werden,<br />
was mit zu einer spürbaren Steigerung <strong>der</strong> Nutzung beitrug. In den Jahren<br />
103
<strong>2005</strong> und <strong>2006</strong> wurden für die Website des <strong>Archiv</strong>s und für AfZ Online <strong>Archiv</strong>es<br />
über 250’000 Besuche von rund 94‘000 Rechnern festgestellt, was<br />
im Falle <strong>der</strong> Besuche gegenüber <strong>der</strong> Vergleichsperiode (2003-2004) eine<br />
Steigerung von 34 Prozent bedeutet. Erfreulich ist neben <strong>der</strong> wachsenden<br />
Beliebtheit von AfZ Online <strong>Archiv</strong>es <strong>der</strong> zu beobachtende Trend, dass generell<br />
mehr User das Webangebot des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> wie<strong>der</strong>holt<br />
nutzen (plus 67 Prozent) und die durchschnittliche Dauer eines Besuchs<br />
(plus 10 Prozent) ansteigt.<br />
Herkunft und Benutzungszweck<br />
Fast ein Fünftel <strong>der</strong> Benutzenden (17,3 Prozent) vor Ort stammt aus dem<br />
Ausland, vor allem aus Deutschland (rund 10 Prozent). Der Rest verteilt sich<br />
auf Österreich (8 Einzelbenutzungen), Frankreich (6), USA (6), Nie<strong>der</strong>lande (3),<br />
Israel (2), Australien, Grossbritannien, Kenya, Korea und Tschechien (je 1).<br />
Grund für die <strong>Archiv</strong>benutzung war in jedem zweiten Fall eine wissenschaftliche<br />
Forschungsarbeit (Seminar-, Diplom-, Lizentiatsarbeiten, Dissertationen,<br />
Nationalfondsprojekte etc.). An zweiter Stelle folgen Recherchen<br />
zu journalistischen und publizistischen Zwecken mit 24 Prozent. <strong>Archiv</strong>benutzungen<br />
mit amtlichem bzw. beruflichem Hintergrund machen gut<br />
104
10 Prozent aus, solche zu rein privaten Zwecken ohne Publikationsabsicht<br />
knapp 9 Prozent. Den kleinsten Anteil bilden Benutzungen für Schularbeiten<br />
(Gymnasien, Berufsschulen etc.) mit rund 7 Prozent.<br />
Benutzte Bestände und betroffene Themenbereiche<br />
In den Jahren <strong>2005</strong>/<strong>2006</strong> wurden 198 von insgesamt 488 verschiedenen Beständen<br />
im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> benutzt. Mit 63 Benutzungen steht die<br />
Biografische Sammlung klar an <strong>der</strong> Spitze. Auch auf die übrigen gedruckten<br />
Dokumentationen (NZZ-<strong>Archiv</strong>, wf-<strong>Archiv</strong>, Sammlung Geschichte, Systematische<br />
Presseausschnittsammlung) sowie die Zeitungs- und Zeitschriftenbestände<br />
wurde mehrheitlich je zwischen 20 und 30 Mal zugegriffen.<br />
Unter den institutionellen Beständen haben jene aus dem Bereich <strong>der</strong><br />
jüdischen <strong>Zeitgeschichte</strong>, namentlich die <strong>Archiv</strong>e von JUNA, SIG und VSJF<br />
mit je zwischen 45 und 55 Benutzungen die mit Abstand grösste Nachfrage<br />
erfahren. 21 Mal wurde das Vorort-<strong>Archiv</strong> konsultiert und je 10 Mal das SFH-<br />
<strong>Archiv</strong> sowie <strong>der</strong> Bestand zum Gotthard-Bund.<br />
Unter den Privatnachlässen steht jener des Schweizer Konsuls Carl Lutz<br />
mit 17 Benutzungen – u.a. im Zusammenhang mit Ausstellungsprojekten<br />
– an <strong>der</strong> Spitze. Je zehn und mehr Benutzungen verzeichnen zudem die<br />
Nachlässe Gustav Däniker sen., Hermann Levin Goldschmidt, Alfred A. Häsler,<br />
Rolf Henne, Erwin Jaeckle sowie <strong>der</strong> Fotobestand Peter Keckeis. Insgesamt 13<br />
Mal wurde <strong>der</strong> Bestand Tondokumente Zeugen <strong>der</strong> Zeit zu den vom <strong>Archiv</strong><br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong> veranstalteten Kolloquien beigezogen.<br />
Mehr als vier Fünftel aller Benutzungen beziehen sich auf Themen zur<br />
allgemeinen <strong>Zeitgeschichte</strong> (43,5 Prozent) und zur jüdischen <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
(40,7 Prozent). Der Rest verteilt sich auf die Bereiche Wirtschaft und <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
(10,4 Prozent) sowie Kalter Krieg (5,4 Prozent).<br />
Allgemeine <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Bei einem Grossteil <strong>der</strong> Benutzungen zu diesem Bereich stehen Recherchen<br />
zu einzelnen Persönlichkeiten <strong>der</strong> <strong>Zeitgeschichte</strong> im Mittelpunkt: Gefragt<br />
waren Unterlagen unter an<strong>der</strong>em zu Lily Abegg, Wilhelm Abegg, Jacobo<br />
Arbenz, Warda Bleser-Bircher, Eduard Blocher, Ferdinand Bolt, Walter Bosshard,<br />
Franco Brenni, Emil Brunner, Adolf Butenandt, Reto Caratsch, Winston<br />
Churchill, Otto Dietrich, Carl Doka, Friedrich Ebert, Paul Gentizon, Karl Gerold,<br />
Wolfgang Graetz, Alfred A. Häsler, Eduard von <strong>der</strong> Heydt, Wilhelm Hoegner,<br />
105
Max Huber, Klaus Hügel, Alfred Huggenberger, Arnold Jaggi, Hans Koch,<br />
Herbert Lüthy, Golo Mann, Valentin Oehen, Max Petitpierre, Franz Riedweg,<br />
Werner Rings, Karl Schmid, Edgar Schumacher, Hans Konrad Son<strong>der</strong>egger,<br />
René Son<strong>der</strong>egger, Attilio Tamaro, Ernst Freiherr von Weizsäcker, Felix M.<br />
Wiesner und Laure Wyss.<br />
Zeitlich bilden Themen zur Zwischenkriegszeit und zum Zweiten Weltkrieg<br />
den Schwerpunkt. Klar im Vor<strong>der</strong>grund standen dabei Forschungen zum<br />
Frontismus und zu an<strong>der</strong>en Erneuerungsbewegungen sowie zu Schweizern<br />
in <strong>der</strong> Waffen-SS, welche sich grossenteils aus Frontistenkreisen rekrutierten.<br />
Weitere Themenschwerpunkte betreffen Flüchtlinge und Militärinternierte<br />
sowie die Pressepolitik. Geforscht wurde überdies zur Auslän<strong>der</strong>politik allgemein,<br />
zu den Schweizerischen Ärztemissionen an <strong>der</strong> Ostfront, zur Rolle<br />
des Roten Kreuzes im Zweiten Weltkrieg, zum Nachrichtendienst, zu nationalsozialistischen<br />
Auslandorganisationen in <strong>der</strong> Schweiz, zu den Schweizer<br />
Spanienkämpfern, zur Kirchenpolitik <strong>der</strong> Religiös-Sozialen und zur „Spanischen<br />
Grippe“ im Jahr 1918.<br />
<strong>Archiv</strong>benutzungen zur Nachkriegszeit betrafen insbeson<strong>der</strong>e die Auslän<strong>der</strong>-<br />
und Flüchtlingspolitik (jugoslawische Arbeitsimmigration, Tamilen,<br />
Ungarnflüchtlinge, Schweizerische Flüchtlingshilfe, Asylbefragungen), die<br />
Entwicklungspolitik, die NS-Kriegsverbrecherprozesse im Spiegel <strong>der</strong> NZZ, die<br />
Nahostpolitik <strong>der</strong> Schweiz, die Jugendunruhen (Zürcher Rolling Stones-Konzert<br />
1967), den Grundstückerwerb durch Auslän<strong>der</strong> sowie das Schweizerische<br />
Institut für Auslandforschung. Zeitlich übergreifende Themen befassten sich<br />
unter an<strong>der</strong>em mit <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> Schweizer Diplomatie, den kulturellen<br />
Aussenbeziehungen <strong>der</strong> Schweiz, <strong>der</strong> Ausbürgerung von Schweizerinnen<br />
sowie mit Auslandschweizern in Bulgarien und in Südostasien.<br />
Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Auch im Bereich <strong>der</strong> jüdischen <strong>Zeitgeschichte</strong> betraf ein grosser Teil <strong>der</strong><br />
Recherchen einzelne jüdische und nichtjüdische Persönlichkeiten, darunter<br />
gleich mehrmals Georges Brunschvig, Else Lasker-Schüler und Carl Lutz. Im<br />
weiteren wurden Unterlagen verlangt zu Lajser Ajchenrand, Leo Baeck, Max<br />
Brod, Ulrich Fleischhauer, Gisi Fleischmann, Joseph Ganz, Paul Grüninger, Paul<br />
Guggenheim, Louis Haefliger, Heinz Stefan Herzka, Berthold Jacob, Hans Klee,<br />
Gertrud Kurz, Johann von Leers, Friedrich Liebling, Gertrud Lutz, Carl Mayer,<br />
Saly Mayer, Robert Neumann, Hans Ornstein, Irene Paucker-Andorn, Benjamin<br />
106
Sagalowitz, Nathan Schwalb-Dror, Moses Silberroth, Manfred Sturmann,<br />
Margarethe Susman, Zwi und Jacob Taubes, Paul Vogt, Jakob und Julie Wassermann,<br />
Samuel Weil-Neuburger, Theodor Weisz und Hans Weyermann.<br />
Auch bei <strong>der</strong> jüdischen <strong>Zeitgeschichte</strong> stehen ganz klar Themen zur Zwischenkriegszeit<br />
und zum Zweiten Weltkrieg im Vor<strong>der</strong>grund. Der Schwerpunkt<br />
liegt dabei eindeutig bei Fragestellungen zur Flüchtlingspolitik <strong>der</strong><br />
Schweiz in <strong>der</strong> Zeit des Nationalsozialismus, wobei oft die Flüchtlingshilfe,<br />
regionale Verhältnisse o<strong>der</strong> einzelne Flüchtlingsschicksale im Zentrum<br />
standen. Mehrere Benutzungen galten dem Antisemitismus in <strong>der</strong> Schweiz,<br />
etwa den „Protokollen <strong>der</strong> Weisen von Zion“ o<strong>der</strong> den Verhältnissen in <strong>der</strong><br />
Stadt St. Gallen. Wie<strong>der</strong>holt hatten die Forschungsthemen einen Bezug zur<br />
Shoah, etwa zu Rettungsaktionen mit schweizerischer Beteiligung o<strong>der</strong> zur<br />
Rolle des IKRK, aber auch zur Lage <strong>der</strong> jüdischen Bevölkerung in Deutschland<br />
o<strong>der</strong> in im deutschen Einflussbereich stehenden Län<strong>der</strong>n. Jüdische Organisationen,<br />
einzelne jüdische Gemeinden und das schweizerische Judentum<br />
insgesamt bilden weitere Interessensschwerpunkte. Untersucht wurden<br />
schliesslich auch die Beziehungen zwischen <strong>der</strong> Schweiz und dem britischen<br />
Mandatsgebiet Palästina.<br />
Die Flüchtlingsthematik dominiert auch die Benutzungen zur Nachkriegszeit:<br />
Geforscht wurde unter an<strong>der</strong>em zur Aufnahme einer Gruppe<br />
von Jugendlichen aus dem Konzentrationslager Buchenwald in <strong>der</strong> Schweiz,<br />
zum Erholungsaufenthalt ehemaliger Konzentrationslagerinsassen in <strong>der</strong><br />
Schweiz, zu jüdischen Ungarn-Flüchtlingen und zu weiblichen Flüchtlingsschicksalen.<br />
Weitere Themen waren die Beziehungen zwischen <strong>der</strong> Schweiz<br />
und Israel, die Gesellschaft Schweiz - Palästina und die Wahrnehmung des<br />
Antisemitismus durch den SIG. Zeitlich übergreifende Themen mit Bezug<br />
zur Schweiz betrafen unter an<strong>der</strong>em die Juden und die Alpen, jüdische<br />
Wirtschaftstätigkeit, jüdische Selbsthilfe, Synagogen sowie die jüdischen<br />
Bibliotheken in <strong>der</strong> Schweiz.<br />
Wirtschaft und <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Im Vergleich zur allgemeinen <strong>Zeitgeschichte</strong> und zur jüdischen <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
ist die chronologische Verteilung <strong>der</strong> einzelnen Forschungsthemen ausgeglichener,<br />
wobei die Fragestellungen zur Nachkriegszeit leicht überwiegen.<br />
Abgesehen von einer Ausnahme, einer Recherche zu Werner K. Rey, finden<br />
sich keinerlei personenbezogene Fragestellungen.<br />
107
Inhaltlich stehen erneut aussenwirtschaftliche Themen im Vor<strong>der</strong>grund:<br />
Gefragt waren Quellen zur Aussenhandelspolitik ab 1945, zum Bundesamt<br />
für Aussenwirtschaft (<strong>der</strong> ehemaligen Handelsabteilung), zur „Union <strong>der</strong><br />
schweizerischen Handelskammern im Ausland“, zum Aussenhandel im<br />
Zweiten Weltkrieg, zur europäischen Integration und zur EWR-Abstimmung,<br />
zu den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland und zu Japan<br />
sowie zum Waffenexport. Unter dem Themenkreis Arbeits- und Sozialpolitik<br />
finden sich <strong>Archiv</strong>recherchen zum Verhältnis zwischen Arbeitgebern und<br />
Arbeitnehmern (Friedensabkommen, Fremdarbeiterstreiks u.a.), zur Gewerkschaftspolitik,<br />
zur Erwerbsarbeit von Frauen, zur Arbeitslosenversicherung<br />
und zur AHV. Mehrere Fragestellungen galten <strong>der</strong> Finanzpolitik, vor allem<br />
<strong>der</strong> Diskussion über die Doppelbesteuerung im Völkerbund, <strong>der</strong> Fiskalpolitik<br />
des Bundes in den Jahren 1938 bis 1946, <strong>der</strong> Bundesfinanzreform 1945 bis<br />
1958 und <strong>der</strong> Finanzpolitik in den 1990er Jahren. Weitere Forschungsthemen<br />
betrafen wirtschaftsrechtliche Fragen (Aktienrecht, Kartellgesetz), das<br />
Bankwesen (Bankgeheimnis, Schweizerische Kreditanstalt, Schweizerische<br />
Volksbank), die Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitik des Bundes während<br />
<strong>der</strong> Krise <strong>der</strong> 1930er Jahre, die Entwicklungspolitik <strong>der</strong> 1950er und 1960er<br />
Jahre, das Redressement National, Emotionen in Abstimmungsplakaten, die<br />
„Anbauschlacht“ im Zweiten Weltkrieg, die Automobilindustrie und den<br />
Warenschmuggel.<br />
Kalter Krieg<br />
Bei einigen Benutzungen zum Kalten Krieg standen einzelne Persönlichkeiten<br />
im Zentrum, namentlich <strong>der</strong> unter dem Pseudonym Jean Villain bekannte<br />
Publizist Marcel Brun, Divisionär Gustav Däniker sowie Ernst Schürch. Jeweils<br />
mindestens zwei Benutzungen befassten sich mit dem Antikommunismus<br />
und <strong>der</strong> Geistigen Landesverteidigung in <strong>der</strong> Schweiz seit 1945, mit kommunistischen<br />
Parteien und Strömungen (PdA, KPS/ML, Trotzkismus), mit<br />
<strong>der</strong> Schweizerischen Korea-Mission, mit den Indochinakriegen bzw. mit <strong>der</strong><br />
Anti-Vietnamkriegsbewegung und mit den Ungarnflüchtlingen. Weitere<br />
Recherchen galten dem Kalten Krieg allgemein, Albanien, <strong>der</strong> Rolle des IKRK<br />
im Korea-Krieg, dem „Prager Frühling“, <strong>der</strong> rechtsbürgerlichen Presse, dem<br />
„Hofer-Club“ und dem „Institut für politologische Zeitfragen“.<br />
108
Eingegangene Belegexemplare <strong>2005</strong><br />
• Brunschwig, Annette / Heinrichs, Ruth / Huser, Karin: Geschichte <strong>der</strong> Juden im<br />
Kanton Zürich. Von den Anfängen bis in die heutige Zeit. Hg.: Ulrich Bär / Monique<br />
R. Siegel, Zürich: Orell Fussli Verlag AG, <strong>2005</strong>.<br />
• Bucher, Martin J.: Die Deutschlandkontakte <strong>der</strong> Schweizer Pfadfin<strong>der</strong> 1920-1945.<br />
„Schaut auf das Heldische <strong>der</strong> deutschen Hitlerjugend“, Münster: LIT-Verlag,<br />
2004.<br />
• Bussmann, Nora: Die mutige Pionierin. Warda Bleser-Birchers Jahrhun<strong>der</strong>t, Zürich:<br />
Verlag Neue Zürcher Zeitung, <strong>2005</strong>.<br />
• Calvo, Silvana: 1938 Anno infame. Antisemitismo e profughi nella stampa ticinese,<br />
Bologna: Edizioni dell‘ Arco, <strong>2005</strong> (I libri di Olokaustos 1).<br />
• Christe, Sabine / Natchkova, Nora / Schick, Manon / Schoeni, Céline: Au foyer de<br />
l‘inégalité. La division sexuelle du travail en Suisse pendant la crise des années 30<br />
et la Deuxième Guerre mondiale, Lausanne: Éditions Antipodes, <strong>2005</strong>.<br />
• Drews, Isabel: „Schweizer erwache!“ Der Rechtspopulist James Schwarzenbach<br />
(1967-1978), Frauenfeld: Verlag Huber, <strong>2005</strong> (Studien zur <strong>Zeitgeschichte</strong>. Hg. v. Urs<br />
Altermatt, Bd. 7).<br />
• Eichenberger, Elsi: Als Rotkreuzschwester in Lazaretten <strong>der</strong> Ostfront. Schweizer<br />
Ärztemissionen im II. Weltkrieg - Teil 3 - Smolensk, Kriegswinter 1941/42, ein Erlebnisbericht.<br />
Hg.: Reinhold Busch, 2. vollständig überarbeitete Auflage, Berlin: Verlag<br />
Frank Wünsche, 2004.<br />
• Ernst & Young AG: Untersuchung zu nachrichtenlosen Vermögenswerten bei<br />
liechtensteinischen Banken in <strong>der</strong> NS-Zeit. Bericht <strong>der</strong> Ernst & Young AG gemäss<br />
Mandatsverträgen vom 9. Juli 2002 und 5. Mai 2003 zwischen <strong>der</strong> Unabhängigen<br />
Historikerkommission Liechtenstein Zweiter Weltkrieg und <strong>der</strong> Ernst & Young AG<br />
(Studie 5), in: Veröffentlichungen <strong>der</strong> UHK: Studien 5 u. 6, Vaduz / Zürich: Historischer<br />
Verein für das Fürstentum Liechtenstein / Chronos Verlag, <strong>2005</strong>, S. 7-81.<br />
• Fanzun, Jon A.: Die Grenzen <strong>der</strong> Solidarität. Schweizerische Menschenrechtspolitik<br />
im Kalten Krieg, Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, <strong>2005</strong>.<br />
• Geiger, Peter / Brunhart, Arthur / Bankier, David / Michman, Dan / Moos, Carlo /<br />
Weinzierl, Erika: Fragen zu Liechtenstein in <strong>der</strong> NS-Zeit und im Zweiten Weltkrieg:<br />
Flüchtlinge, Vermögenswerte, Kunst, Rüstungsproduktion. Schlussbericht <strong>der</strong><br />
Unabhängigen Historikerkommission Liechtenstein Zweiter Weltkrieg, Vaduz /<br />
Zürich: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein / Chronos Verlag,<br />
<strong>2005</strong> (Veröffentlichungen <strong>der</strong> UHK: Schlussbericht).<br />
• Genni, Nicola / Toppi, Silvano: Storie: Il ritorno di Inge [Ginsberg], Televisione svizzera<br />
di lingua italiana, [Lugano], [20.3.] <strong>2005</strong> (DVD).<br />
• Gisel-Pfankuch, Susanne / Lüthi, Barbara: Gezeichnet. Wladimir Sagal (1898-1969)<br />
– Flüchtling und Künstler, Zürich: Chronos, <strong>2005</strong>.<br />
• Gisler, Martina: Die Bedeutung <strong>der</strong> heutigen SwissCham für die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
schweizerischen Aussenwirtschaft in den Jahren 1975-1994, Lizentiatsarbeit, Zürich<br />
<strong>2005</strong>.<br />
109
• Glur, Stefan: Vom besten Pferd im Stall zur persona non grata. Paul Ruegger als<br />
Schweizer Gesandter in Rom 1936-1942, Diss. Zürich, Bern: Peter Lang, <strong>2005</strong> (Geist<br />
und Werk <strong>der</strong> Zeiten: Arbeiten aus dem Historischen Seminar <strong>der</strong> Universität<br />
Zürich, Nr. 100).<br />
• Haentjes, Mathias: Der Meisterspion von Bern. Allen Dulles und die Schweiz im 2.<br />
Weltkrieg. Dokumentarfilm für Schweizer Fernsehen DRS, Zürich, Abt. DOK – Spuren<br />
<strong>der</strong> Zeit, Sendedatum: 31.1.<strong>2005</strong>.<br />
• Hoechner, Francesca: Grenzverwischer. „Jud Süss“ und „Das Dritte Geschlecht“:<br />
Verschränkte Diskurse von Ausgrenzung, Lizentiatsarbeit, Basel <strong>2005</strong>.<br />
• Jost-Luong, Thomas: Die Anerkennung <strong>der</strong> Volksrepublik China 1950 durch die<br />
Schweiz: Eine Konsequenz <strong>der</strong> schweizerischen Chinapolitik seit 1945 Lizentiatsarbeit,<br />
Zürich 2004.<br />
• Jud, Ursina: Liechtenstein und die Flüchtlinge zur Zeit des Nationalsozialismus.<br />
Studie im Auftrag <strong>der</strong> Unabhängigen Historikerkommission Liechtenstein Zweiter<br />
Weltkrieg, Vaduz / Zürich: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein /<br />
Chronos Verlag, <strong>2005</strong> (Veröffentlichungen <strong>der</strong> UHK: Studie 1).<br />
• Karlen, Stefan: Versicherungen in Liechtenstein zur Zeit des Nationalsozialismus.<br />
Studie im Auftrag <strong>der</strong> Unabhängigen Historikerkommission Liechtenstein Zweiter<br />
Weltkrieg, (Studie 6), in: Veröffentlichungen <strong>der</strong> UHK: Studien 5 u. 6, Vaduz / Zürich:<br />
Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein / Chronos Verlag, <strong>2005</strong>, S.<br />
83-141.<br />
• Keller, Zsolt: Theologie und Politik - Beginn und Konkretisierung des christlich-jüdischen<br />
Dialoges in <strong>der</strong> Schweiz, in: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und<br />
Kulturgeschichte, Fribourg, 99. Jg. (<strong>2005</strong>), S. 157-175.<br />
• Keller, Zsolt: Jüdische Bücher und <strong>der</strong> Schweizerische Israelitische Gemeindebund<br />
(1930-1950). Anmerkungen zu einem bislang wenig beachteten Thema, in: Bulletin<br />
<strong>der</strong> Schweizersichen Gesellschaft für Judaistische Forschung SGJF, Nr. 14 / <strong>2005</strong><br />
(Beiheft zu JUDAICA, Nr.3 / <strong>2005</strong>), S.20-34.<br />
• Kieser, Hans-Lukas / Schaller, Dominik (Hg.): Der Völkermord an den Armeniern<br />
und die Shoah / The Armenian Genocide and the Shoah, Zürich: Chronos Verlag,<br />
2002.<br />
• Kistler, Judith: Emotionalisierung in Abstimmungsplakaten: Unterschiede zwischen<br />
sozialen und finanziellen Themen im Zeitraum von 1950 bis 2002, Seminararbeit,<br />
Zürich <strong>2005</strong>.<br />
• Krummenacher-Schöll, Jörg: Flüchtiges Glück. Die Flüchtlinge im Grenzkanton<br />
St.Gallen zur Zeit des Nationalsozialismus, Zürich: Limmat Verlag, <strong>2005</strong>.<br />
• Kury, Patrick / Lüthi, Barbara / Erlanger, Simon: Grenzen setzen. Vom Umgang mit<br />
Fremden in <strong>der</strong> Schweiz und den USA (1890-1950), Köln / Weimar / Wien: Böhlau<br />
Verlag <strong>2005</strong>.<br />
• Leimgruber, Matthieu: Achieving Social Progress Without State Intervention A<br />
Political Economy of the Swiss Three-Pillar Pension System (1890-1972), Dissertation,<br />
Lausanne 2004.<br />
110
• Leisinger, Thomas: Entwichene russische Kriegsgefangene in <strong>der</strong> Schweiz 1942-<br />
1945, Lizentiatsarbeit, Basel <strong>2005</strong>.<br />
• Lussy, Hanspeter / López, Rodrigo: Finanzbeziehungen Liechtensteins zur Zeit des<br />
Nationalsozialismus. Studie im Auftrag <strong>der</strong> Unabhängigen Historikerkommission<br />
Liechtenstein Zweiter Weltkrieg, 2 Teilbände, Vaduz / Zürich: Historischer Verein<br />
für das Fürstentum Liechtenstein / Chronos Verlag, <strong>2005</strong> (Veröffentlichungen <strong>der</strong><br />
UHK: Studie 3/I u. 3/II).<br />
• Mächler, Stefan: Hilfe und Ohnmacht. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund<br />
und die nationalsozialistische Verfolgung 1933-1945. Hg.: Schweizerischer<br />
Israelistischer Gemeindebund, Zürich: Chronos Verlag, <strong>2005</strong> (Beiträge zur Geschichte<br />
und Kultur <strong>der</strong> Juden in <strong>der</strong> Schweiz, Bd. 10).<br />
• Marxer, Veronika / Ruch, Christian: Liechtensteinische Industriebetriebe und die<br />
Frage nach <strong>der</strong> Produktion für den deutschen Kriegsbedarf 1939-1945. Studie im<br />
Auftrag <strong>der</strong> Unabhängigen Historikerkommission Liechtenstein Zweiter Weltkrieg,<br />
Vaduz / Zürich: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein / Chronos<br />
Verlag, <strong>2005</strong> (Veröffentlichungen <strong>der</strong> UHK: Studie 2).<br />
• Pasotti, Enrico / Sofia, Aldo: La casa di vetro, Televisione Svizzera di lingua italiana,<br />
Lugano 2004 (Video).<br />
• Rechsteiner, Ulrich: Germanophile Strömungen in Politik und Armee. In den 30er<br />
und frühen 40er Jahren. Am Beispiel von Dr. Heinrich Frick, Oberstleutnant, Bachelorarbeit,<br />
<strong>ETH</strong> Zürich <strong>2005</strong>.<br />
• Ramò, Mario / Schnoz, Monika: Powered by emotion. Emotionen in Abstimmungsplakaten<br />
<strong>der</strong> Deutschschweiz. Codebuch und Inhaltsanalyse, Seminararbeit, Zürich<br />
<strong>2005</strong>.<br />
• Rudolph, Katrin: Hilfe beim Sprung ins Nichts. Franz Kaufmann und die Rettung<br />
von Juden und „nichtarischen“ Christen, Berlin: Metropol Verlag, <strong>2005</strong> (Dokumente<br />
- Texte - Materialien. Hg.: Zentrum für Antisemitismusforschung <strong>der</strong> Universität<br />
Berlin, Bd. 58).<br />
• Sommer, Marianne: Ich war als Häftling in Dachau – Die Geschichte des Albert<br />
Mülli, Maturitätsarbeit an <strong>der</strong> Kantonsschule Oerlikon, Zürich, November 2004.<br />
• Tisa Francini, Esther: Liechtenstein und <strong>der</strong> internationale Kunstmarkt 1933-1945.<br />
Sammlungen und ihre Provenienzen im Spannungsfeld von Flucht, Raub und<br />
Restitution. Studie im Auftrag <strong>der</strong> Unabhängigen Historikerkommission Liechtenstein<br />
Zweiter Weltkrieg, Vaduz / Zürich: Historischer Verein für das Fürstentum<br />
Liechtenstein / Chronos Verlag, <strong>2005</strong> (Veröffentlichungen <strong>der</strong> UHK: Studie 4).<br />
• Waeber, Aurel: Georgine Gerhard und ihre Aktivitäten in Flüchtlingshilfe, Frauenbewegung<br />
und Sozialpolitik. Eine Basler Biographie, Lizentiatsarbeit, Basel 2004.<br />
• Wipf, Matthias: Bedrohte Grenzregion. Die schweizerische Evakuationspolitik 1938-<br />
1945 am Beispiel von Schaffhausen, Zürich: Chronos, <strong>2005</strong> (Schaffhauser Beiträge<br />
zur Geschichte, Bd. 79).<br />
• Wollenmann, Reto: Zwischen Atomwaffe und Atomsperrvertrag. Die Schweiz auf<br />
dem Weg von <strong>der</strong> nuklearen Option zum Nonproliferationsvertrag (1958-1969),<br />
111
[Lizentiatsarbeit], Zürich 2004 (Zürcher Beiträge zur Sicherheitspolitik und Konfliktforschung<br />
Nr.75. Hg.: Andreas Wenger, Forschungsstelle für Sicherheitspolitik<br />
<strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich).<br />
• Zeller, Cé<strong>der</strong>ic: Die Mitglie<strong>der</strong> des Schweizerischen Handels- und Industrievereins<br />
im Zeitraum von 1933 bis 1935. Eine Untersuchung über die Verbindungen und<br />
Beziehungen zu Unternehmen, Politik und an<strong>der</strong>en Interessengruppen, Seminararbeit,<br />
Basel <strong>2005</strong>.<br />
• Ziegler, Manuela: Wahrnehmungswandel. Eine historische Fallstudie zur individuellen<br />
Wahrnehmung von Grenze am Beispiel des Journalisten Ferdinand Bolt,<br />
Magisterarbeit, Konstanz <strong>2005</strong>.<br />
• Zur Erstveröffentlichung des Rosenbaumplädoyers. Das Verbrechen an den Rotter in<br />
Liechtenstein 1933. Mit Beiträgen von Ursina Jud, Klaus Bie<strong>der</strong>mann, Peter Kamber,<br />
Pius Heeb, Norbert Haas und Hansjörg Qua<strong>der</strong>er, Vaduz: Historischer Verein für das<br />
Fürstentum Liechtenstein, 2004 (Son<strong>der</strong>druck aus dem Jahrbuch des Historischen<br />
Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, Bd. 103, 2004).<br />
Eingegangene Belegexemplare <strong>2006</strong><br />
• Aerne, Peter: „Wehe <strong>der</strong> Christenheit ..., Wehe <strong>der</strong> Judenschaft ...“. Der Weihnachtsbrief<br />
an die Juden in <strong>der</strong> Schweiz von 1942, 2 Teile, in: Judaica. Beiträge zum<br />
Verstehen des Judentums. Hg.: Stiftung für Kirche und Judentum, Zürich, 58 Jg.,<br />
Heft 4 / Dezember 2002, S. 234-260, u. 59 Jg., Heft 1 / März 2003, S. 24-48.<br />
• Aerne, Peter: Religiöse Sozialisten, Jungreformierte und Feldprediger. Konfrontation<br />
im Schweizer Protestantismus 1920-1950, Diss. Bern, Zürich: Chronos, <strong>2006</strong>.<br />
• Beglinger, Martin: Die tödliche Spanierin [Grippeepidemie von 1918 in <strong>der</strong> Schweiz],<br />
in: Das Magazin, Zürich, Nr. 13 /1.-7.4.<strong>2006</strong>, S.18-26.<br />
• Belart, Caroline: Viele von ihnen weinten. Polnische Internierte in <strong>der</strong> Gemeinde<br />
Thalheim (AG) während des 2. Weltkrieges. Schularbeit an <strong>der</strong> Pädagogischen<br />
Hochschule Aargau, Schinznach-Dorf <strong>2005</strong>.<br />
• Belart, Caroline: Viele von ihnen weinten. Polnische Internierte in <strong>der</strong> Schweiz und<br />
insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> Gemeinde Thalheim (AG) während des Zweiten Weltkriegs,<br />
in: Argovia <strong>2006</strong>. Jahresschrift <strong>der</strong> Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau,<br />
Bd. 118, Baden: hier + jetzt, <strong>2006</strong>, S. 47-63.<br />
• Bill, Ramón: Waffenfabrik Solothurn. Schweizerische Präzision im Dienste <strong>der</strong><br />
deutschen Rüstungsindustrie, Solothurn 2002 (Schriftenreihe des Kantonalen<br />
Museums Altes Zeughaus Solothurn, Heft 14).<br />
• Bonhage, Barbara / Gautschi, Peter / Hodel, Jan / Spuhler, Gregor: Hinschauen und<br />
Nachfragen. Die Schweiz und die Zeit des Nationalsozialismus im Licht aktueller<br />
Fragen, Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, <strong>2006</strong>.<br />
• Botzenhardt, Ann-Kathrin: Jüdische Selbsthilfe in <strong>der</strong> Schweiz – Organisation und<br />
Arbeitsweisen 1904-1945, Magisterarbeit Freiburg i. Br. <strong>2006</strong> (unpubliziert).<br />
• Burgener, Gianni: Der Berner Prozess um die „Protokolle <strong>der</strong> Weisen von Zion“.<br />
Proseminararbeit, Zürich <strong>2006</strong>.<br />
112
• Colombo, Carlo: Vogelgrippe: Damit die „Spanische Grippe“ nicht zurückkehrt /<br />
Grippe aviaire: Les scénairios d‘ urgence sont en place / Influenza aviaria: Affinchè<br />
non si riviva l‘incubo della spagnola,in: Krankenpflege. Hg.: Schweizer Berufsverband<br />
<strong>der</strong> Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, Bern, 99. Jg., Nr. 6 / <strong>2006</strong>, S.<br />
10-14, 40-43, 62-64.<br />
• Dejung, Christof: Aktivdienst und Geschlechterordnung. Eine Kultur- und Alltagsgeschichte<br />
des Militärdienstes in <strong>der</strong> Schweiz 1939-1945, Diss. Zürich, Zürich:<br />
Chronos, <strong>2006</strong>.<br />
• Erlanger, Simon: „Nur ein Durchgangsland“. Arbeitslager und Internierungsheime<br />
für Flüchtlinge und Emigranten in <strong>der</strong> Schweiz 1940-1949, Diss. Zürich, Zürich:<br />
Chronos, <strong>2006</strong>.<br />
• Es lohnt sich noch. Karl Gerold zum 100. Geburtstag. Hg.: Karl-Gerold-Stiftung zum<br />
100. Geburtstag von Karl Gerold, Frankfurt a. M. <strong>2006</strong>.<br />
• Frei, Fabian: Gelebte „Neutralität“. Die Anfänge <strong>der</strong> schweizerischen Korea-Mission<br />
nach Zeitzeugenberichten, Lizentiatsarbeit, Zürich <strong>2006</strong>.<br />
• Gillabert, Matthieu: „L‘affaire Gustloff“ 1936. Diplomatie allemande et propagande<br />
nazie en Suisse entre surenchères et rivalités, Mémoire de licence, Fribourg<br />
<strong>2006</strong>.<br />
• Graber, Roger: Entwicklungshilfe und Exportför<strong>der</strong>ung im Kalten Krieg. Interessen,<br />
Motive und Strategien <strong>der</strong> Schweizer Exportindustrie in Entwicklungslän<strong>der</strong>n<br />
(1955-1965), Lizentiatsarbeit, Zürich <strong>2006</strong>.<br />
• Höfer, Candida: Bibliotheken, München: Schirmer / Mosel, <strong>2005</strong>.<br />
• Jehle, Frank: Emil Brunner. Theologe im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t, Zürich: Theologischer<br />
Verlag Zürich, <strong>2006</strong>.<br />
• Kanyar Becker, Helena (Hg.): Gertrud Lutz-Fankhauser: Diplomatin und Humanistin,<br />
Basel / Bern: Publikation <strong>der</strong> Universitätsbibliothek Basel, Nr. 38, <strong>2006</strong>.<br />
• Keller, Zsolt: Der Blutruf (Mt 27,25). Eine schweizerische Wirkungsgeschichte 1900-<br />
1950, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, <strong>2006</strong>.<br />
• Klein, Philippe: Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen <strong>der</strong> Schweiz und Deutschland<br />
zur Zeit des Zweiten Weltkrieges im Spiegel <strong>der</strong> NZZ-Berichterstattung,<br />
Lizentiatsarbeit, Zürich <strong>2006</strong>.<br />
• Loepfe, Willi: Geschäfte in spannungsgeladener Zeit. Finanz- und Handelsbeziehungen<br />
zwischen <strong>der</strong> Schweiz und Deutschland 1923 bis 1946, Weinfelden:<br />
Wolfau-Druck AG, <strong>2006</strong>.<br />
• Lupp, Björn-Erik: Von <strong>der</strong> Klassensolidarität zur humanitären Hilfe. Die Flüchtlingspolitik<br />
<strong>der</strong> politischen Linken 1930-1950, Diss. Basel, Zürich: Chronos, <strong>2006</strong>.<br />
• Mattli, Angela: Der Bund Schweizerischer Jüdischer Frauenvereine im Spannungsfeld<br />
von Solidarität und Resignation: Politik und Engagement in den Jahren <strong>der</strong><br />
Bedrohung 1933-1945, Seminararbeit, Freiburg i. Ue. <strong>2006</strong>.<br />
• Metzger, Thomas: Antisemitismus in <strong>der</strong> Stadt St.Gallen 1918-1939, Fribourg:<br />
Academic Press, <strong>2006</strong> (Religion – Politik – Gesellschaft in <strong>der</strong> Schweiz. Hg.: Urs<br />
Altermatt, Bd. 42).<br />
113
• Morawietz, Katharina: Die Kulturgemeinschaft <strong>der</strong> Emigranten in Zürich 1941-<br />
1945. Ein kulturelles Engagement als Beispiel <strong>der</strong> Selbsthilfe von Flüchtlingen,<br />
Lizentiatsarbeit, Basel <strong>2005</strong>.<br />
• Mühlhausen, Walter: Friedrich Ebert 1871-1925. Reichspräsident <strong>der</strong> Weimarer Republik.<br />
Hg.: Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte (Heidelberg) und<br />
Friedrich-Ebert-Stiftung (Berlin / Bonn), Bonn: Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH,<br />
<strong>2006</strong>.<br />
• Nie<strong>der</strong>häuser, Peter (Hg.): Das jüdische Winterthur. Begleitpublikation des Historischen<br />
Vereins Winterthur zur gleichnamigen Ausstellung im Museum Lindengut<br />
(Winterthur) vom 15. März bis 8. Oktober <strong>2006</strong>, Winterthur / Zürich: Historischer<br />
Verein Winterthur / Chronos Verlag, <strong>2006</strong>.<br />
• Oswald, Nik: Jeep, Tschiip. Die ersten Jeeps in <strong>der</strong> Schweiz, 1941 bis 1947, [Schwyz]:<br />
Eigenverlag, <strong>2006</strong>.<br />
• Rebmann, Frédéric: Une économie autogérée sans intervention de l‘Etat Le rôle et<br />
la position du Vorort dans le processus de législation sur les cartels (1950-1962)“,<br />
mémoire de licence, Lausanne <strong>2006</strong>.<br />
• Rossé, Christian: Le Service de renseignements suisse face à la menace allemande<br />
1939-1945, Panazol: La Vauzelle / Neuchâtel: Editions Alphil, <strong>2006</strong>.<br />
• Schindler, Dietrich (jun.): Ein Schweizer Staats- und Völkerrechtler <strong>der</strong> Krisen- und<br />
Kriegszeit – Dietrich Schindler (sen.) 1890-1948, Zürich / Basel / Genf: Schulthess,<br />
<strong>2005</strong>.<br />
• Schreiber, Sabine: Hirschfeld, Strauss, Malinsky. Jüdisches Leben in St.Gallen 1803<br />
bis 1933, Diss. Zürich, Zürich: Chronos, <strong>2006</strong> (Schriftenreihe des Schweizerischen<br />
Israelitischen Gemeindebundes: Beiträge zur Geschichte und Kultur <strong>der</strong> Juden in<br />
<strong>der</strong> Schweiz, Band 11).<br />
• Schmid, Daniel: „den steilen Emmentaler Högern nicht gewachsen“ – Die Entstehung<br />
und Entwicklung des Redens über Tamilen in <strong>der</strong> Schweizer Presse 1982 bis<br />
1995, Lizentiatsarbeit, Zürich <strong>2005</strong>.<br />
• Schulz, Kristina: Neutralität und Engagement: Denis de Rougement und das<br />
Konzept <strong>der</strong> „aktiven Neutralität“. Son<strong>der</strong>druck aus: Zwischen den Fronten.<br />
Positionskämpfe europäischer Intellektueller im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t, hg. von Ingrid<br />
Gilcher-Holtey, Berlin: Akademie Verlag, <strong>2006</strong>, S.153-177.<br />
• Sidler, Roger: Arnold Künzli. Kalter Krieg und „geistige Landesverteidigung“ – eine<br />
Fallstudie, Diss. Luzern, Zürich: Chronos, <strong>2006</strong>.<br />
• Späti, Christina: Die schweizerische Linke und Israel. Israelbegeisterung, Antizionismus<br />
und Antisemitismus zwischen 1967 und 1991, Diss. Freiburg i. Ue., Essen:<br />
Klartext Verlag, <strong>2006</strong> (Antisemitismus: Geschichte und Strukturen, Bd. 2).<br />
• Sprecher, Thomas (Hg.): Im Geiste <strong>der</strong> Genauigkeit. Das Thomas-Mann-<strong>Archiv</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>ETH</strong> Zürich 1956-<strong>2006</strong>, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, <strong>2006</strong> (Thomas-Mann-<br />
Studien. Hg. vom Thomas-Mann-<strong>Archiv</strong> <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> in Zürich, 35. Bd.).<br />
• Stal<strong>der</strong>, Rafael: Carl Doka et la Schweizerische Rundschau / Carl Doka et<br />
l‘antisemitisme, Seminararbeit, Fribourg <strong>2006</strong>.<br />
114
• Uhlig Gast, Christiane: Die Flüchtlingshilfe des Verbandes Schweizerischer Jüdischer<br />
Fürsorgen VSJF für die jüdischen Flüchtlinge aus Ungarn 1956. Hg.: VSJF,<br />
Zürich <strong>2006</strong>.<br />
• Vogel, Sandra: Urteil in Sachen Flüchtlingshelfer Grüninger, Seminararbeit Zürich,<br />
<strong>2006</strong> (unpubliziert).<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
Das Team des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> wird auf S. 124 namentlich aufgeführt.<br />
Ihm gehörten Ende <strong>2006</strong> insgesamt 23 Voll- und Teilzeitmitarbeitende<br />
sowie Praktikantinnen und Praktikanten an. Wenige Mutationen sind bei den<br />
Anstellungen zu vermerken. Nach dreieinhalbjähriger Tätigkeit im IT-Team<br />
nahm Martin Schacher im November <strong>2006</strong> eine neue Herausfor<strong>der</strong>ung bei<br />
einem <strong>der</strong> führenden Schweizer Anbieter im Bereich <strong>der</strong> <strong>Archiv</strong>informatik<br />
an. Sein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis und die Kreativität bei<br />
Informatikprojekten bleiben in bester Erinnerung. Er ist von Walter Sutter<br />
abgelöst worden, <strong>der</strong> dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> als Teilzeitkraft neben<br />
seinem Fachhochschulstudium zur Verfügung steht. Die zweite Mutation<br />
Das AfZ-Team Weihnachten <strong>2005</strong>.<br />
im Kernteam betraf den Benutzungsdienst, wo die I+D-Assistentin Marijke<br />
Rupp im Dezember <strong>2005</strong> Sarah Küng nachfolgte. Nach über siebenjähriger<br />
Mitarbeit trat Hubert Villimek Ende Oktober <strong>2005</strong> in den Ruhestand. Seine<br />
vielfältigen Dienste auch als grafischer und technischer Allroun<strong>der</strong> kamen<br />
allen <strong>Archiv</strong>bereichen zugute, wofür wir ihm herzlich danken.<br />
Fünfzehn Auszubildende, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger<br />
konnten im Berichtszeitraum innerhalb von Praktika o<strong>der</strong> in befristeten<br />
Anstellungen Einblick in die archivische Tätigkeit nehmen und Erfahrungen<br />
sammeln. Eddy Affolter, Christian Coradi, Daniel Hüppin, Franziska Sidler und<br />
115
Anna Sieg taten dies im Rahmen <strong>der</strong> Dokumentationsstelle Wirtschaft und<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong>. In Erschliessungsprojekten <strong>der</strong> Jüdischen <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
arbeiteten Anne Frenkel, Helene Metz, Aurel Waeber und Janine Wilhelm<br />
mit und im Rahmen <strong>der</strong> allgemeinen <strong>Zeitgeschichte</strong> engagierten sich Silvan<br />
Abicht, Paola Cimino, Mike Gadient, Christoph Manasse, Karin Rauch und<br />
Daniel Schwane. Sowohl denjenigen, welche die <strong>Archiv</strong>entwicklung nachhaltig<br />
mitgestalten, als auch allen, die kurzfristig im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
mitarbeiteten, sei hier herzlich gedankt.<br />
Publikationsliste<br />
Aus den Reihen des AfZ-Teams wurden folgende Beiträge zur Geschichte<br />
publiziert:<br />
• Gerson, Daniel: Die Kehrseite <strong>der</strong> Emanzipation in Frankreich. Judenfeindschaft<br />
im Elsass 1778 bis 1848, Diss. Berlin, Essen: Klartext-Verlag <strong>2006</strong>.<br />
• Ders.: Der Hohe Priester, in: Mona Körte und Marion Neiss (Hrsg.): Von Schöpfern<br />
und Schurken. To B. or not to be, Berlin: Metropol-Verlag <strong>2006</strong>, S. 92-93.<br />
• Ders.: Silvain Guggenheim, in: Historisches Lexikon <strong>der</strong> Schweiz, Bd. 5, Basel <strong>2006</strong>,<br />
S. 792-793.<br />
• Hagmann, Werner: Das „Rote Werdenberg“, in: 100 Jahre SP Kanton St.Gallen. Hg.:<br />
SP des Kantons St.Gallen, St.Gallen <strong>2005</strong>, S. 22-26.<br />
• Ders.: Das „Rote Werdenberg“. Eine ländliche Region als SP-“Hochburg“, in: Werdenberger<br />
Jahrbuch 19 (<strong>2006</strong>), Buchs SG <strong>2005</strong>, S.197-204.<br />
• Ders.: „Feüers Brünste“ – „in hiesigen Gegenden und in fremden Län<strong>der</strong>en“. Schil<strong>der</strong>ungen<br />
aus <strong>der</strong> Chronik von Christian Hagmann aus Sevelen, in: Werdenberger<br />
Jahrbuch 20 (2007), Buchs SG <strong>2006</strong>, S. 105-115.<br />
• Lerf, Madeleine: Aus dem Konzentrationslager Buchenwald in die Schweiz – Studie<br />
zur wechselseitigen Wahrnehmung, in: Gesellschaft für Exilforschung (Hg.):<br />
Kindheit und Jugend im Exil – Ein Generationenthema. Exilforschung: Ein internationales<br />
Jahrbuch Bd. 24, München <strong>2006</strong>, S. 79-94.<br />
• Manasse, Christoph: Flugschriften <strong>der</strong> badischen Revolution von 1848/1849.<br />
Ihre Funktion in <strong>der</strong> Revolutionsöffentlichkeit und ihre inhaltlich-thematischen<br />
Bezüge, dargestellt an <strong>der</strong> Sammlung Cajetan Jägers, in: Zeitschrift des Breisgau-<br />
Geschichtsvereins „Schau-ins-Land“, Jahrbuch 124, Freiburg im Breisgau <strong>2005</strong>, S.<br />
135-168.<br />
• Ders.: Strukturwandel und Neuorientierung <strong>der</strong> Gasindustrie in <strong>der</strong> Zwischenkriegszeit<br />
unter Berücksichtigung des Gaswerks Basel, in: Basler Zeitschrift für<br />
Geschichte und Altertumskunde, Bd. 105 (<strong>2005</strong>), Basel <strong>2005</strong>, S. 50-78.<br />
• Ders.: Die Anfangsgeschichte <strong>der</strong> Gasversorgung <strong>der</strong> Stadt Basel, in: GWA 9/<strong>2006</strong>,<br />
Zürich <strong>2006</strong>, S. 751-757.<br />
116
• Ders.: Geschichte des Staatsarchivs Basellandschaft, in: Baselbieter Heimatblätter,<br />
Nr. 2, Liestal <strong>2006</strong>, S. 37-58.<br />
• Ders. / Tréfás, David: Vernetzt, Versorgt, Verbunden. Die Geschichte <strong>der</strong> Basler<br />
Energie- und Wasserversorgung, Basel: Christoph Merian Verlag, <strong>2006</strong>.<br />
• Nerlich, Daniel: Lebensschichten einer Pionierin, in: Bussmann, Nora: Die mutige<br />
Pionierin. Warda Bleser-Birchers Jahrhun<strong>der</strong>t. Eine Biografie, Zürich: NZZ-Verlag,<br />
<strong>2005</strong>, Booklet, S. 1-6.<br />
• Schwane, Daniel: Wi<strong>der</strong> den Zeitgeist Konflikt und Deeskalation in West-Berlin<br />
1949 bis 1965, Diss. Berlin, Stuttgart: ibidem-Verlag, <strong>2005</strong>.<br />
• Ders.: Dybiec, Joanna: Guidebook Gazes: Poland in American and German Travel<br />
Guides, Münster 2004 (Rezension), in: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/.<br />
• Ders.: Das „Laboratorium“ West-Berlin: Hansjakob Stehle und die Passierscheinverhandlungen<br />
1962/63, in: Lemke, Michael (Hrsg.): Schaufenster <strong>der</strong> Systemkonkurrenz.<br />
Die Region Berlin-Brandenburg im Kalten Krieg, Köln / Weimar / Wien<br />
<strong>2006</strong>, S. 18-43.<br />
Stiftungen und Fonds<br />
Stiftung <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Die Errichtung <strong>der</strong> neuen Stiftung <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> erfolgte am 9.<br />
Februar <strong>2006</strong> im Notariat Fluntern, wo <strong>der</strong> Stiftungsrat gleich auch seine<br />
konstituierende Sitzung durchführte. Ihm gehören René Braginsky, <strong>der</strong> die<br />
Gründung des neuen För<strong>der</strong>ungswerkes ermöglicht hat, als Präsident, Walter<br />
Gut als Vertreter <strong>der</strong> Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong>, von Seiten des<br />
<strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> Prof. Klaus Urner (Vizepräsident), Dr. Daniel Nerlich<br />
(Aktuar) und Dr. Uriel Gast an. Die <strong>ETH</strong> Schulleitung ist im Stiftungsrat<br />
durch ihren Delegierten lic. phil. Hugo Bretscher vertreten. Im Zentrum <strong>der</strong><br />
ersten Sitzung stand <strong>der</strong> Beschluss, die Liegenschaft Hirschengraben 62 zu<br />
kaufen, auch wenn die Finanzierung nicht vollständig aus eigenen Mitteln<br />
erfolgen konnte.<br />
Seit dem Grundbucheintrag vom 4. April <strong>2006</strong> ist die Stiftung nun neue<br />
Eigentümerin des Hirschengraben 62. An <strong>der</strong> Stiftungsratssitzung vom 27.<br />
April wurden Regelungen zur Mietvereinbarung mit <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich, die<br />
Errichtung eines Unterhaltsfonds und die Budgetanträge des <strong>Archiv</strong>s für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> für <strong>2006</strong> und 2007 gutgeheissen.<br />
Aus den Mieteinnahmen und dank einem ganz wesentlichen Beitrag <strong>der</strong><br />
Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> an die Infrastrukturkosten werden Stellen<br />
117
Ein denkwürdiger Moment in <strong>der</strong> Geschichte des AfZ: René Braginsky vollzieht den Hauskauf,<br />
Grundbucheintrag vom 4. April <strong>2006</strong>.<br />
mitfinanziert, die bisher von <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> nicht übernommen wurden und die wie<br />
die Dienstleistungen für die Benutzung und im IT-Bereich für den gesamten<br />
<strong>Archiv</strong>betrieb unentbehrlich sind. Zudem sollen Projekte geför<strong>der</strong>t werden,<br />
für die insbeson<strong>der</strong>e im Rahmen <strong>der</strong> allgemeinen und schweizerischen<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> eine entsprechende Unterstützung fehlte.<br />
Dankbar und mit Freude darf vermerkt werden, dass das umfassend<br />
angelegte För<strong>der</strong>ungswerk bereits im Gründungsjahr seine Tätigkeit aufgenommen<br />
hat. Noch sind aber erhebliche Anstrengungen erfor<strong>der</strong>lich, damit<br />
die Sammelstiftung <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> durch Legate und weitere<br />
Zuwendungen ausgebaut und zur vollen Entfaltung gelangen kann.<br />
Stiftung Dialogik, Mary und Hermann Levin Goldschmidt-Bollag<br />
Nachdem die Stiftung Dialogik in <strong>der</strong> 1990 errichteten Form nicht mehr<br />
weitergeführt wird, ist gemäss Fondsreglement vom 14. Dezember <strong>2006</strong><br />
innerhalb <strong>der</strong> Stiftung <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> neu <strong>der</strong> „Mary und Hermann<br />
Levin Goldschmidt-Bollag-Fonds“ ins Leben gerufen worden. Der<br />
Fonds nimmt die ursprünglichen Stiftungszwecke zu Gunsten des <strong>Archiv</strong>s<br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong> wahr.<br />
Jaeckle-Treadwell-Stiftung<br />
Der Stiftungsrat <strong>der</strong> Jaeckle-Treadwell-Stiftung, <strong>der</strong> am 25. April <strong>2006</strong> im<br />
<strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> tagte, wählte Dr. Thomas Feitknecht als Nach-<br />
118
folger von Prof. Dr. Eduard Stäuble ins Präsidium <strong>der</strong> Stiftung. Prof. Stäuble<br />
hat die Geschicke <strong>der</strong> Stiftung seit dem Tod von Dr. Erwin Jaeckle geleitet<br />
und wirkt in diesem Gremium auch künftig mit. Dr. Feitknecht, erster Leiter<br />
des Schweizerischen Literaturarchivs (1990-<strong>2005</strong>), gehört dem Stiftungsrat<br />
seit den Anfängen an. Sowohl das Schweizerische Literaturarchiv als auch<br />
das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>, die beide den Nachlass von Erwin Jaeckle betreuen,<br />
werden durch das För<strong>der</strong>ungswerk begünstigt. Auf Grund knapper<br />
Ressourcen musste <strong>2005</strong>/06 auf die Ausrichtung von Beiträgen allerdings<br />
verzichtet werden.<br />
Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich<br />
Im Stiftungsrat <strong>der</strong> Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> sind seit <strong>der</strong>en Gründung<br />
Ende 1995 erstmals Mutationen zu verzeichnen. Herr Dr. Rolf Bloch, Mitbegrün<strong>der</strong><br />
und langjähriger Präsident <strong>der</strong> Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich, trat an <strong>der</strong> Sitzung vom 6. Juli <strong>2005</strong> von seinem Amt und<br />
als Vertreter des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes zurück. Er<br />
bleibt weiterhin ad personam Mitglied des Stiftungsrates. Der Stiftungsrat<br />
und das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> würdigten und verdankten das langjährige<br />
erfolgreiche Wirken von Herrn Dr. Bloch für die schweizerisch-jüdische<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong> und sein beson<strong>der</strong>es Engagement in den För<strong>der</strong>ungswerken<br />
zu Gunsten des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong>.<br />
Zum neuen Präsidenten wählte <strong>der</strong> Stiftungsrat Herrn René Braginsky,<br />
welcher schon bisher entscheidend zum Gedeihen <strong>der</strong> Dokumentationsstelle<br />
Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> beigetragen hat. Auf Vorschlag des SIG wurde Frau<br />
Doris Krauthammer, Präsidentin des VSJF, in den Stiftungsrat gewählt.<br />
Im Juli <strong>2006</strong> trat Dr. Branco Weiss aus dem Stiftungsrat zurück. Er hat den<br />
Ausbau des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> vor allem in den Jahren 1993 bis 1999<br />
massgeblich geför<strong>der</strong>t. Auch in schwierigen Phasen hat er sich persönlich für<br />
die Anliegen des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> eingesetzt. Der mit seiner Hilfe<br />
ermöglichte Umzug aus den engen Verhältnissen an <strong>der</strong> Scheuchzerstrasse<br />
68 an den Hirschengraben 62 ist und bleibt ein Meilenstein in <strong>der</strong> Geschichte<br />
des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong>, mit dem die Grundlage für die nachfolgende<br />
dynamische Entwicklung gelegt worden ist. Für die gewährte wegweisende<br />
Unterstützung danken wir Herrn Dr. Weiss herzlich.<br />
Die Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> finanzierte wie<strong>der</strong>um Teilzeitstellen<br />
unterschiedlicher Dauer sowie studentische Einsätze und Praktika: Daniel<br />
119
Zum Abschied: Klaus Urner übergibt Dr. Rolf Bloch eine vom AfZ-Mitarbeiter und Künstler Hubert<br />
Vilimek gestaltete biografische Collage.<br />
Gerson, stellvertreten<strong>der</strong> Leiter <strong>der</strong> Dokumentationsstelle Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong>,<br />
Regina Gehrig (Erschliessung, Beratung, Recherchen, Auswertung<br />
Jüdische Medien, Führungen), Sarah Küng und Marijke Rupp (Benutzerbetreuung),<br />
Madeleine Lerf (Erschliessung), Sandra Stu<strong>der</strong> (Erschliessung)<br />
und Hubert Villimek (Magazin, Transporte, Grafik, allgemeine Dienste). Sie<br />
unterstützte die Informatik-Abteilung des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong>, indem<br />
sie die Stelle von Martin Schacher mitfinanzierte. Ausserdem ermöglichte sie<br />
studentische Einsätze und Praktika von Jure Tornic, Anna Sieg, Helene Metz,<br />
Aurel Waeber und Janine Wilhelm.<br />
An <strong>der</strong> Gründung <strong>der</strong> neuen Stiftung <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> im April<br />
<strong>2006</strong> und am Kauf des Hauses Hirschengraben 62 beteiligte sich die Stiftung<br />
Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> mit einem Beitrag von 700‘000 Franken. Als<br />
Vertreter <strong>der</strong> Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> wurde Herr Walter S. Gut in<br />
den Stiftungsrat <strong>der</strong> neuen Stiftung gewählt. Dem Stiftungsrat gilt unser<br />
Dank für die grosszügige und unentbehrliche Unterstützung <strong>der</strong> Dokumentationsstelle<br />
Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong>.<br />
120
Emil Friedrich Rimensberger-Fonds<br />
Nachdem das Kuratorium seit dem Tod <strong>der</strong> Stifter Petronella Rimensberger<br />
und Rudolf Zehn<strong>der</strong> nicht mehr getagt hatte, wurde es nach einer weitgehenden<br />
Neukonstituierung im Dezember <strong>2005</strong> reaktiviert: Drei <strong>der</strong> vier bisherigen<br />
Mitglie<strong>der</strong>, Prof. Dr. Jean-Francois Bergier, Pieternel von Salis-Rimensberger<br />
und Jean-Claude Zehn<strong>der</strong> erklärten per Ende <strong>2005</strong> ihren Rücktritt. An ihrer<br />
Stelle wurden neu Dr. iur. Ulysses von Salis, Dr. Ursula Akmann-Bodenmann<br />
und Dr. Werner Hagmann gewählt. Als Vorsitzen<strong>der</strong> des Kuratoriums stellte<br />
sich weiterhin Prof. Klaus Urner zur Verfügung. Am 5. Oktober <strong>2006</strong> fand<br />
die erste Sitzung des Kuratoriums in neuer Zusammensetzung statt. Dabei<br />
wurde ein Rahmenkredit von 20‘000 Franken für das Jahr 2007 zur Finanzierung<br />
von kleineren Erschliessungsprojekten im Bereich <strong>der</strong> allgemeinen<br />
schweizerischen <strong>Zeitgeschichte</strong> gutgeheissen.<br />
Simon und Hildegard Rothschild-Stiftung<br />
Auch bei <strong>der</strong> 1999 ins Leben gerufenen Simon und Hildegard Rothschild-<br />
Stiftung erfolgte ein Wechsel an <strong>der</strong> Spitze. Gründungspräsident Dr. Rolf<br />
Bloch, <strong>der</strong> die Errichtung <strong>der</strong> Stiftung wesentlich vermittelt hat, trat an <strong>der</strong><br />
Sitzung vom 6. Oktober <strong>2005</strong> von seinem Amt und gleichzeitig auch als Vertreter<br />
des SIG zurück. Für die souveräne Leitung <strong>der</strong> Stiftung, die im <strong>Archiv</strong><br />
für <strong>Zeitgeschichte</strong> wertvolle För<strong>der</strong>ungsarbeit leistet, gilt Herrn Dr. Bloch<br />
unser herzlicher Dank.<br />
Zum neuen Präsidenten wählte <strong>der</strong> Stiftungsrat Herrn Daniel A. Rothschild,<br />
Basel, Mitglied <strong>der</strong> Geschäftsleitung des SIG. Der Stiftungsrat verlängerte<br />
dem <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> den Dispositionskredit von 50‘000 Franken,<br />
auf die im Interesse einer Konsolidierung nicht zurückgegriffen worden ist.<br />
Bis Ende <strong>2006</strong> erreichte das Stiftungsvermögen wie<strong>der</strong> die ursprüngliche<br />
Höhe des Gründungskapitals von einer Million Franken.<br />
Karl-Schmid-Stiftung<br />
Nach dem Hinschied von alt Regierungsrat Prof. Dr. Hans Künzi, des Präsidenten<br />
und grössten För<strong>der</strong>ers <strong>der</strong> Karl-Schmid-Stiftung, im Herbst 2004<br />
hat sich <strong>der</strong> Stiftungsrat unter <strong>der</strong> interimistischen Leitung von Dr. med.<br />
Christoph Schmid mit Fragen zur Neuorientierung <strong>der</strong> Stiftung befasst.<br />
Mit <strong>der</strong> Herausgabe <strong>der</strong> Gesammelten Werke (1998) und <strong>der</strong> Briefe (2000)<br />
121
Karl Schmids sowie nach <strong>der</strong> Überarbeitung des Nachlasses im <strong>Archiv</strong> für<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong>, die 2007 abgeschlossen wird, hat die Karl-Schmid-Stiftung<br />
die primären Ziele, welche sie sich im Stiftungsstatut von 1992 gesetzt hatte,<br />
weitgehend erfüllt. Für September 2007 ist eine Ausstellung zu Karl Schmid<br />
im Museum Bärengasse geplant. Die Phase <strong>der</strong> vorwiegend auf Werk und<br />
Mensch bezogenen Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Karl Schmid kommt damit zu<br />
ihrem Abschluss.<br />
Der Stiftungsrat prüfte Möglichkeiten einer Weiterführung unter an<strong>der</strong>er<br />
Zielsetzung. Einen attraktiven Rahmen bietet die bereits in früheren Jahren<br />
verfolgte Idee einer Vorlesungsreihe.<br />
Der Stiftungsrat <strong>der</strong> Karl-Schmid-Stiftung, <strong>der</strong> Vorstand des För<strong>der</strong>vereins<br />
sowie Ausschüsse zu den einzelnen Projekten führten ihre Sitzungen in<br />
den Räumlichkeiten des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong> durch. Das Sekretariat<br />
<strong>der</strong> Stiftung befand sich in den Berichtsjahren ebenfalls im <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
und wurde von Daniel Schmid betreut. Er hat auch die von <strong>der</strong><br />
Stiftung finanzierte Neuerschliessung des durch umfangreiche Ergänzungen<br />
erweiterten Nachlasses bis auf letzte Bereinigungen erfolgreich beendet.<br />
Victor H. und Elisabeth Umbricht-Stiftung<br />
Am 21. Juli <strong>2006</strong> fand unter dem Vorsitz von Prof. Christopher Umbricht in<br />
Zürich die Sitzung des Stiftungsrates <strong>der</strong> Victor H. und Elisabeth Umbricht-<br />
Stiftung statt, <strong>der</strong>en Sekretariat seit Mai <strong>2006</strong> von Daniel Schwane betreut<br />
wird. Der Stiftungsrat bewilligte auf Antrag des <strong>Archiv</strong>s für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
auch für 2007 ein Budget, mit dem die Weiterbearbeitung des Nachlasses<br />
von Victor H. Umbricht finanziert wird.<br />
122
Dank<br />
Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> dankt folgenden Institutionen, Gönnerinnen<br />
und Gönnern für ihre <strong>2005</strong>/<strong>2006</strong> gewährte Unterstützung:<br />
Stiftungen und Fonds<br />
• Stiftung <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
• Stiftung Dialogik, Mary und Hermann Levin Goldschmidt-Bollag<br />
• Stiftung Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong> an <strong>der</strong> <strong>ETH</strong> Zürich zur Sicherung und<br />
Erschliessung historischer Quellen in <strong>der</strong> Schweiz<br />
• Simon und Hildegard Rothschild-Stiftung<br />
• Dr. h.c. Emil Dreyfus-Stiftung<br />
• Jaeckle-Treadwell-Stiftung<br />
• Karl Schmid-Stiftung<br />
• Victor H. und Elisabeth Umbricht-Stiftung<br />
• Emil Friedrich Rimensberger-Fonds<br />
Legate<br />
• Legat Dr. Warda Bleser-Bircher<br />
• Legat Heinrich Schalcher<br />
Gönnerbeiträge <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>/Dokumentationsstelle Jüdische<br />
<strong>Zeitgeschichte</strong><br />
• Georg und Jenny Bloch Stiftung<br />
• René und Susanne Braginsky Stiftung<br />
• Willi und Mimi Guggenheim Stiftung<br />
• Israelitische Cultusgemeinde Zürich<br />
• Kirschner Loeb Stiftung<br />
• Saly Mayer Memorial Stiftung, Zürich<br />
• Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund<br />
• Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus<br />
• Ernst und Jacqueline Weil Stiftung<br />
• Dr. h.c. mult. Branco Weiss<br />
Beiträge an die Dokumentationsstelle Wirtschaft und <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
• economiesuisse<br />
Beiträge an den Dokumentationsbereich „Schweiz–Kalter Krieg (1945-1990)“<br />
• Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Demokratie<br />
123
AfZ-Team <strong>2005</strong>/<strong>2006</strong><br />
(Stand 31.12.<strong>2006</strong>)<br />
<strong>Archiv</strong>leitung:<br />
Prof. Klaus Urner<br />
Dokumentationsstelle Jüdische <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Leitung:<br />
Dr. Uriel Gast<br />
Stellv. Leitung:<br />
Dr. Daniel Gerson<br />
MitarbeiterInnen:<br />
lic. phil. Regina Gehrig<br />
lic. phil. Madeleine Lerf<br />
lic. phil. Sandra Stu<strong>der</strong><br />
Dokumentationsstelle Wirtschaft und <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
Leitung:<br />
Dr. Daniel Nerlich<br />
MitarbeiterInnen:<br />
Sabina Bellofatto<br />
lic. phil. Philipp Hofstetter<br />
Anna Sieg<br />
Dokumentationsbereich Schweiz – Kalter Krieg<br />
Leitung:<br />
Dr. Werner Hagmann<br />
Mitarbeiter:<br />
Michael Schaer<br />
Dokumentationsbereich Allgemeine <strong>Zeitgeschichte</strong><br />
MitarbeiterInnen:<br />
lic. phil. Christoph Manasse<br />
Dr. Sylvia Rüdin<br />
lic. phil. Daniel Schmid<br />
Dr. Daniel Schwane<br />
Stabsdienste / Informatik<br />
Leitung:<br />
lic. phil. Jonas Arnold<br />
Mitarbeiter:<br />
Walter Sutter<br />
Benutzungsdienst:<br />
Marijke Rupp<br />
Kompetenzzentrum Erschliessung: Dr. Claudia Hoerschelmann<br />
<strong>2005</strong>/<strong>2006</strong> leisteten temporäre Mitarbeit bzw. Praktika:<br />
lic. phil. Silvan Abicht, Edy Affolter, lic. phil. Christian Coradi, lic. phil. Paola<br />
Cimino, Ricarda von Ellerts, Anne Frenkel M.A., Mike Gadient, lic. phil. Daniel<br />
Hüppin, lic. sc. rel. Zsolt Keller, Helene Metz, Karin Rauch, lic. phil. Franziska<br />
Sidler, lic. phil. Aurel Waeber und Janine Wilhelm.<br />
124
Öffnungszeiten<br />
Das <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong> ist von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und<br />
17.00 Uhr geöffnet. Die Benutzung erfolgt auf Voranmeldung und gemäss<br />
geltendem <strong>Archiv</strong>reglement: Gedruckte Dokumentationen sind frei zugänglich,<br />
für die Einsichtnahme in ungedruckte Unterlagen ist ein schriftliches<br />
Gesuch erfor<strong>der</strong>lich.<br />
• Standort: Hirschengraben 62, 8001 Zürich (Tram 3, 4, 6, 7, 10, 15, Bus 32 bis<br />
Central)<br />
• Postadresse: <strong>Archiv</strong> für <strong>Zeitgeschichte</strong>, <strong>ETH</strong> Zürich, CH-8092 Zürich<br />
• Telefon: (0041) 44 632 40 03 (Benutzungsdienst, Voranmeldung)<br />
• Fax: (0041) 44 632 13 92<br />
• e-mail: afz@history.gess.ethz.ch<br />
• Website: http://www.afz.ethz.ch<br />
125