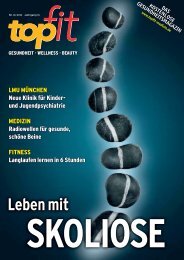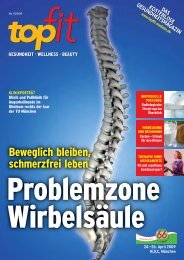Worauf es ankommt. Wann Hilfe nötig ist. - Topfit
Worauf es ankommt. Wann Hilfe nötig ist. - Topfit
Worauf es ankommt. Wann Hilfe nötig ist. - Topfit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
26 Rat und <strong>Hilfe</strong> aus der Apotheke<br />
Pharmazie von der Wi<strong>es</strong>e<br />
Echt<strong>es</strong> Mäd<strong>es</strong>üß — pflanzliche<br />
Vorstufe d<strong>es</strong> Aspirins<br />
Schon die keltischen Druiden und vor allem die Menschen<br />
im Mittelalter schätzten das Echte Mäd<strong>es</strong>üß als<br />
Pfl anze mit Heilkraft. Der honigartig-süßliche Duft,<br />
den die Blüten im Hochsommer verströmen, soll sogar<br />
königliche Nasen betört haben. Von der englischen<br />
Königin Elisabeth I. wird berichtet, dass sie ihr Schlafgemach<br />
mit den Blüten d<strong>es</strong> Mäd<strong>es</strong>üß ausstreuen ließ.<br />
Auch heutzutage fi nden die getrockneten Blüten und<br />
Stängel der Pfl anze in Fertigte<strong>es</strong> zur unterstützenden<br />
Behandlung von Erkältungskrankheiten und als Schwitzkur<br />
therapeutische Anwendung.<br />
Von Apotheker Thomas Knaier<br />
Das Echte Mäd<strong>es</strong>üß (botanisch:<br />
Filipendula ulmaria)<br />
kommt in fast ganz Europa,<br />
mit Ausnahme der südlichen<br />
Mittelmeerländer, vor. Heute <strong>ist</strong><br />
die Pflanze auch ins östliche Nordamerika<br />
eingewandert und hat sich<br />
nahezu auf der ganzen nördlichen<br />
Halbkugel verbreitet. Sie b<strong>es</strong>iedelt<br />
gern feuchte, nährstoffreiche<br />
Standorte. Früher war sie oft in den<br />
Bach- und Flussauen von Erlen-<br />
Eschen-Wäldern zu finden. Da di<strong>es</strong>e<br />
selten geworden sind, hat sie sich<br />
mittlerweile auf Zonen entlang von<br />
Bächen und Wassergräben sowie<br />
auf selten gemähten Feuchtwi<strong>es</strong>en<br />
ausgebreitet.<br />
Mäd<strong>es</strong>üß gehört botanisch zur Familie<br />
der Rosaceen und <strong>ist</strong> eine ausdauernde<br />
Staude, die zwischen 50<br />
und 150 Zentimeter hoch werden<br />
TOPFIT 2/2009<br />
kann. Auch Wuchshöhen bis zu zwei<br />
Metern sind b<strong>es</strong>chrieben. Aus dem<br />
kräftigen Wurzelstock entwickelt<br />
sich jed<strong>es</strong> Jahr eine Rosette grundständiger<br />
Blätter, aus denen ein aufrechter,<br />
kantiger, oben verzweigter,<br />
häufig rot überlaufener Stängel hervorgeht.<br />
Die auffälligen Blütenstände<br />
b<strong>es</strong>tehen aus vielen cremeweißen<br />
Einzelblüten, die in endständigen<br />
Doldentrauben angeordnet sind.<br />
In der Blütezeit von Juni bis August<br />
sondern sie einen intensiven honigmandelsüßen<br />
Duft ab, der sich gegen<br />
Abend noch verstärkt. Der süße<br />
Duft und das reiche Pollenangebot<br />
locken zahlreiche Insekten, etwa<br />
den Mäd<strong>es</strong>üß-Perlmutt falter, an,<br />
für den die Pflanze eine ex<strong>ist</strong>enzielle<br />
Bedeutung hat. Die Raupe <strong>ist</strong><br />
auf Mäd<strong>es</strong>üß als einzige Nahrungsquelle<br />
angewi<strong>es</strong>en.<br />
Anwendung<br />
in der Volksmedizin<br />
Der deutsche Name »Mäd<strong>es</strong>üß«<br />
hat mit »süßen Mädchen« nichts<br />
zu tun. Zur Herkunft gibt <strong>es</strong> verschiedene<br />
Theorien. So soll ihm<br />
der Begriff »Mahd süße« zugrunde<br />
liegen, weil die Blätter und Blüten<br />
nach der Mahd einen süßen Geruch<br />
verströmen. Eine andere Erklärung<br />
bezieht sich auf die Namensvariante<br />
»Metsüße« , da früher die Blüten<br />
zum Süßen und Aromatisieren<br />
von Wein, insb<strong>es</strong>ondere Met (Honigwein)<br />
ver wendet wurden. Der<br />
Volksmund kennt noch eine Reihe<br />
weiterer Namen, etwa »Wi<strong>es</strong>enkönigin«,<br />
der auf die stattliche Größe der<br />
Pflanze anspielt, »Federbusch« und<br />
»Spierstaude« (bezieht sich auf die<br />
Form d<strong>es</strong> Blütenstands). Auch als<br />
»Immenkraut« (Kraut der Imker)<br />
wurde die Pflanze bezeichnet, da<br />
das Einreiben der Bienenstöcke mit<br />
dem Kraut die Bienen vor Krankheiten<br />
schützen und die Honigausbeute<br />
steigern sollte. Auch der wenig<br />
poetische Name »Stopp arsch«<br />
fand sich in einigen Gegenden;<br />
er bezog sich auf die Wirkung bei<br />
Durchfallerkrankungen.<br />
In den Kräuterbüchern d<strong>es</strong> Mittelalters<br />
von Lonicerus und Hieronymus<br />
Bock wird die Wurzel d<strong>es</strong> Mäd<strong>es</strong>üß<br />
als gallereinigend und zur Behandlung<br />
der Roten Ruhr (infektiöse,<br />
oft tödliche Darmerkrankung) erwähnt.<br />
In der Volksmedizin wird<br />
das Kraut als leicht<strong>es</strong> Adstringens,<br />
RAT DES APOTHEKERS<br />
�<br />
�<br />
Antirheumatikum, Diuretikum<br />
und schweißtreibend<strong>es</strong> Mittel verwendet.<br />
Auch heute noch gilt die<br />
Empfehlung als leicht<strong>es</strong> Schmerz-<br />
und Fiebermittel. Wie Holunderblüten<br />
werden auch Mäd<strong>es</strong>üßblüten<br />
in der Küche zur Aromatisierung<br />
von Süßspeisen, Fruchtspeisen und<br />
Getränken verwendet.<br />
Medizing<strong>es</strong>chichte<br />
d<strong>es</strong> Mäd<strong>es</strong>üß<br />
Medizing<strong>es</strong>chichtlich <strong>ist</strong> die im<br />
Sommer blühende Pflanze hochinter<strong>es</strong>sant.<br />
Schon 1839 isolierten zwei<br />
deutsche Chemiker aus der damals<br />
als Spierstaude bezeichneten Pflanze<br />
erstmals Salicylsäure, die sie Spirsäure<br />
nannten. Neben der Weide<br />
diente danach lange Zeit das Mäd<strong>es</strong>üß<br />
zur Salicylsäuregewinnung.<br />
Mit der chemischen Synth<strong>es</strong>e und<br />
Ver<strong>es</strong>terung der Salicylsäure zur<br />
Acetylsalicylsäure – dem Aspirin –<br />
im Jahr 1899 durch Hofmann verlor<br />
das Mäd<strong>es</strong>üß jedoch zunehmend<br />
an Bedeutung. Dennoch trug Mäd<strong>es</strong>üß<br />
zur Begriffsbildung d<strong>es</strong> Markennamens<br />
Aspirin® maßgeblich<br />
bei. Während das »A« d<strong>es</strong> Namens<br />
für Acetyl steht, <strong>ist</strong> »spirin« aus dem<br />
Begriff »Spirsäure« abgeleitet.<br />
Kraut der Kelten<br />
Zusammen mit dem Eisenkraut,<br />
der M<strong>ist</strong>el und der Wasserminze<br />
gehörte das Mäd<strong>es</strong>üß zu den heiligen<br />
Kräutern der Druiden, der keltischen<br />
Pri<strong>es</strong> ter. Die in der Sonn-<br />
Zur Bereitung ein<strong>es</strong> Te<strong>es</strong> aus Mäd<strong>es</strong>üß wird empfohlen, ein bis zwei Teelöffel<br />
pharmazeutischer Droge mit siedendem Wasser (ca. 150 ml) zu übergießen<br />
und nach 10—15 Minuten abzuseihen. Als Tag<strong>es</strong>dosis sollten vier bis fünf<br />
Gramm Droge nicht überschritten werden. Es <strong>ist</strong> empfehlenswert, den Tee<br />
möglichst dreimal täglich heiß zu trinken. Bei b<strong>es</strong>timmungsgemäßer Anwendung<br />
wird von keinen unerwünschten Wirkungen berichtet.<br />
Obgleich Mäd<strong>es</strong>üßblüten nur geringe Mengen an Salicylaten enthalten, sollten<br />
Patienten mit einer Salicylat–Überempfi ndlichkeit den Mäd<strong>es</strong>üß-Tee nicht<br />
anwenden. Gleich<strong>es</strong> gilt für Säuglinge, Kleinkinder und Asthmatiker. Schwangeren<br />
und Stillenden wird ebenso von einer Zubereitung ein<strong>es</strong> Mäd<strong>es</strong>üß-Te<strong>es</strong><br />
abgeraten.