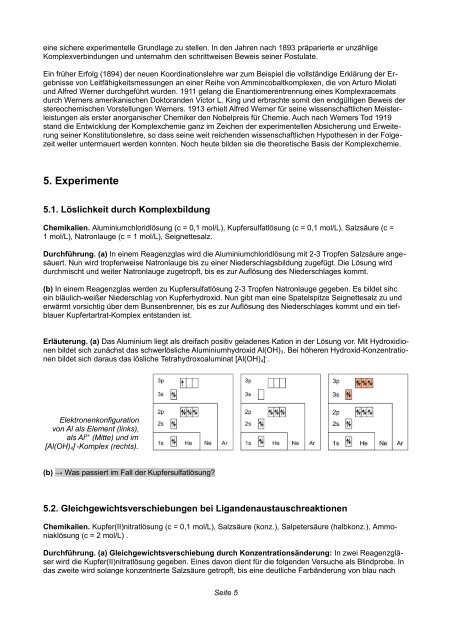Komplexchemie - Ingo Schnell
Komplexchemie - Ingo Schnell
Komplexchemie - Ingo Schnell
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
eine sichere experimentelle Grundlage zu stellen. In den Jahren nach 1893 präparierte er unzählige<br />
Komplexverbindungen und unternahm den schrittweisen Beweis seiner Postulate.<br />
Ein früher Erfolg (1894) der neuen Koordinationslehre war zum Beispiel die vollständige Erklärung der Ergebnisse<br />
von Leitfähigkeitsmessungen an einer Reihe von Ammincobaltkomplexen, die von Arturo Miolati<br />
und Alfred Werner durchgeführt wurden. 1911 gelang die Enantiomerentrennung eines Komplexracemats<br />
durch Werners amerikanischen Doktoranden Victor L. King und erbrachte somit den endgültigen Beweis der<br />
stereochemischen Vorstellungen Werners. 1913 erhielt Alfred Werner für seine wissenschaftlichen Meister-<br />
leistungen als erster anorganischer Chemiker den Nobelpreis für Chemie. Auch nach Werners Tod 1919<br />
stand die Entwicklung der <strong>Komplexchemie</strong> ganz im Zeichen der experimentellen Absicherung und Erweiterung<br />
seiner Konstitutionslehre, so dass seine weit reichenden wissenschaftlichen Hypothesen in der Folgezeit<br />
weiter untermauert werden konnten. Noch heute bilden sie die theoretische Basis der <strong>Komplexchemie</strong>.<br />
5. Experimente<br />
5.1. Löslichkeit durch Komplexbildung<br />
Chemikalien. Aluminiumchloridlösung (c = 0,1 mol/L), Kupfersulfatlösung (c = 0,1 mol/L), Salzsäure (c =<br />
1 mol/L), Natronlauge (c = 1 mol/L), Seignettesalz.<br />
Durchführung. (a) In einem Reagenzglas wird die Aluminiumchloridlösung mit 2-3 Tropfen Salzsäure angesäuert.<br />
Nun wird tropfenweise Natronlauge bis zu einer Niederschlagsbildung zugefügt. Die Lösung wird<br />
durchmischt und weiter Natronlauge zugetropft, bis es zur Auflösung des Niederschlages kommt.<br />
(b) In einem Reagenzglas werden zu Kupfersulfatlösung 2-3 Tropfen Natronlauge gegeben. Es bildet sihc<br />
ein bläulich-weißer Niederschlag von Kupferhydroxid. Nun gibt man eine Spatelspitze Seignettesalz zu und<br />
erwärmt vorsichtig über dem Bunsenbrenner, bis es zur Auflösung des Niederschlages kommt und ein tiefblauer<br />
Kupfertartrat-Komplex entstanden ist.<br />
Erläuterung. (a) Das Aluminium liegt als dreifach positiv geladenes Kation in der Lösung vor. Mit Hydroxidionen<br />
bildet sich zunächst das schwerlösliche Aluminiumhydroxid Al(OH)3. Bei höheren Hydroxid-Konzentrationen<br />
bildet sich daraus das lösliche Tetrahydroxoaluminat [Al(OH)4] - .<br />
Elektronenkonfiguration<br />
von Al als Element (links),<br />
als Al 3+ (Mitte) und im<br />
[Al(OH)4] - -Komplex (rechts).<br />
(b) → Was passiert im Fall der Kupfersulfatlösung?<br />
5.2. Gleichgewichtsverschiebungen bei Ligandenaustauschreaktionen<br />
Chemikalien. Kupfer(II)nitratlösung (c = 0,1 mol/L), Salzsäure (konz.), Salpetersäure (halbkonz.), Ammoniaklösung<br />
(c = 2 mol/L) .<br />
Durchführung. (a) Gleichgewichtsverschiebung durch Konzentrationsänderung: In zwei Reagenzgläser<br />
wird die Kupfer(II)nitratlösung gegeben. Eines davon dient für die folgenden Versuche als Blindprobe. In<br />
das zweite wird solange konzentrierte Salzsäure getropft, bis eine deutliche Farbänderung von blau nach<br />
Seite 5