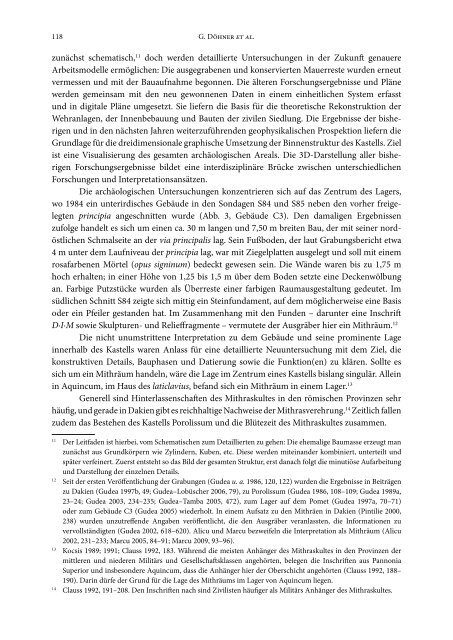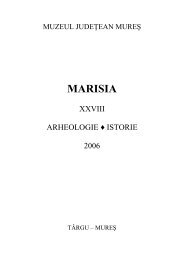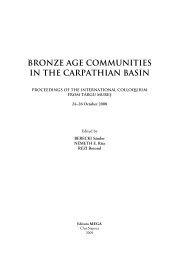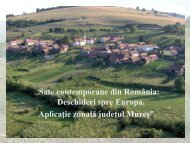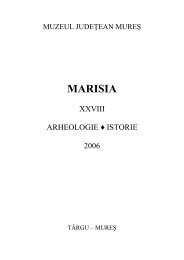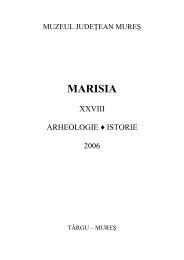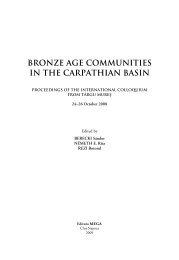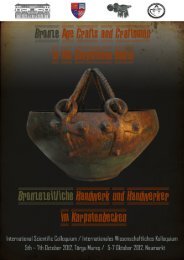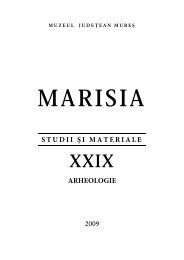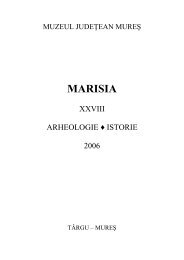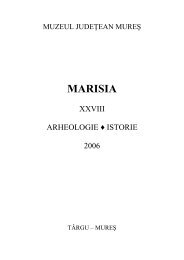MARISIA 2010 CU CORECTURA-CS5.indd - Muzeul Judeţean Mureş
MARISIA 2010 CU CORECTURA-CS5.indd - Muzeul Judeţean Mureş
MARISIA 2010 CU CORECTURA-CS5.indd - Muzeul Judeţean Mureş
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
118<br />
G. Döhner et al.<br />
zunächst schematisch, 11 doch werden detaillierte Untersuchungen in der Zukunft genauere<br />
Arbeitsmodelle ermöglichen: Die ausgegrabenen und konservierten Mauerreste wurden erneut<br />
vermessen und mit der Bauaufnahme begonnen. Die älteren Forschungsergebnisse und Pläne<br />
werden gemeinsam mit den neu gewonnenen Daten in einem einheitlichen System erfasst<br />
und in digitale Pläne umgesetzt. Sie liefern die Basis für die theoretische Rekonstruktion der<br />
Wehranlagen, der Innenbebauung und Bauten der zivilen Siedlung. Die Ergebnisse der bisherigen<br />
und in den nächsten Jahren weiterzuführenden geophysikalischen Prospektion liefern die<br />
Grundlage für die dreidimensionale graphische Umsetzung der Binnenstruktur des Kastells. Ziel<br />
ist eine Visualisierung des gesamten archäologischen Areals. Die 3D-Darstellung aller bisherigen<br />
Forschungsergebnisse bildet eine interdisziplinäre Brücke zwischen unterschiedlichen<br />
Forschungen und Interpretationsansätzen.<br />
Die archäologischen Untersuchungen konzentrieren sich auf das Zentrum des Lagers,<br />
wo 1984 ein unterirdisches Gebäude in den Sondagen S84 und S85 neben den vorher freigelegten<br />
principia angeschnitten wurde (Abb. 3, Gebäude C3). Den damaligen Ergebnissen<br />
zufolge handelt es sich um einen ca. 30 m langen und 7,50 m breiten Bau, der mit seiner nordöstlichen<br />
Schmalseite an der via principalis lag. Sein Fußboden, der laut Grabungsbericht etwa<br />
4 m unter dem Laufniveau der principia lag, war mit Ziegelplatten ausgelegt und soll mit einem<br />
rosafarbenen Mörtel (opus signinum) bedeckt gewesen sein. Die Wände waren bis zu 1,75 m<br />
hoch erhalten; in einer Höhe von 1,25 bis 1,5 m über dem Boden setzte eine Deckenwölbung<br />
an. Farbige Putzstücke wurden als Überreste einer farbigen Raumausgestaltung gedeutet. Im<br />
südlichen Schnitt S84 zeigte sich mittig ein Steinfundament, auf dem möglicherweise eine Basis<br />
oder ein Pfeiler gestanden hat. Im Zusammenhang mit den Funden – darunter eine Inschrift<br />
D∙I∙M sowie Skulpturen- und Relieffragmente – vermutete der Ausgräber hier ein Mithräum. 12<br />
Die nicht unumstrittene Interpretation zu dem Gebäude und seine prominente Lage<br />
innerhalb des Kastells waren Anlass für eine detaillierte Neuuntersuchung mit dem Ziel, die<br />
konstruktiven Details, Bauphasen und Datierung sowie die Funktion(en) zu klären. Sollte es<br />
sich um ein Mithräum handeln, wäre die Lage im Zentrum eines Kastells bislang singulär. Allein<br />
in Aquincum, im Haus des laticlavius, befand sich ein Mithräum in einem Lager. 13<br />
Generell sind Hinterlassenschaften des Mithraskultes in den römischen Provinzen sehr<br />
häufig, und gerade in Dakien gibt es reichhaltige Nachweise der Mithrasverehrung. 14 Zeitlich fallen<br />
zudem das Bestehen des Kastells Porolissum und die Blütezeit des Mithraskultes zusammen.<br />
11<br />
Der Leitfaden ist hierbei, vom Schematischen zum Detaillierten zu gehen: Die ehemalige Baumasse erzeugt man<br />
zunächst aus Grundkörpern wie Zylindern, Kuben, etc. Diese werden miteinander kombiniert, unterteilt und<br />
später verfeinert. Zuerst entsteht so das Bild der gesamten Struktur, erst danach folgt die minutiöse Aufarbeitung<br />
und Darstellung der einzelnen Details.<br />
12<br />
Seit der ersten Veröffentlichung der Grabungen (Gudea u. a. 1986, 120, 122) wurden die Ergebnisse in Beiträgen<br />
zu Dakien (Gudea 1997b, 49; Gudea–Lobüscher 2006, 79), zu Porolissum (Gudea 1986, 108–109; Gudea 1989a,<br />
23–24; Gudea 2003, 234–235; Gudea–Tamba 2005, 472), zum Lager auf dem Pomet (Gudea 1997a, 70–71)<br />
oder zum Gebäude C3 (Gudea 2005) wiederholt. In einem Aufsatz zu den Mithräen in Dakien (Pintilie 2000,<br />
238) wurden unzutreffende Angaben veröffentlicht, die den Ausgräber veranlassten, die Informationen zu<br />
vervollständigten (Gudea 2002, 618–620). Alicu und Marcu bezweifeln die Interpretation als Mithräum (Alicu<br />
2002, 231–233; Marcu 2005, 84–91; Marcu 2009, 93–96).<br />
13<br />
Kocsis 1989; 1991; Clauss 1992, 183. Während die meisten Anhänger des Mithraskultes in den Provinzen der<br />
mittleren und niederen Militärs und Gesellschaftsklassen angehörten, belegen die Inschriften aus Pannonia<br />
Superior und insbesondere Aquincum, dass die Anhänger hier der Oberschicht angehörten (Clauss 1992, 188–<br />
190). Darin dürfe der Grund für die Lage des Mithräums im Lager von Aquincum liegen.<br />
14<br />
Clauss 1992, 191–208. Den Inschriften nach sind Zivilisten häufiger als Militärs Anhänger des Mithraskultes.