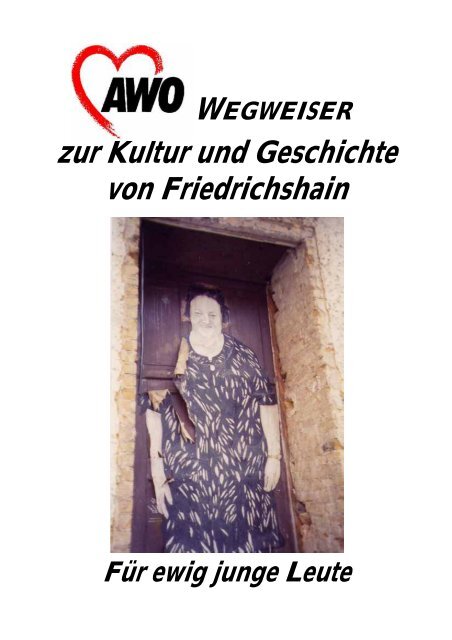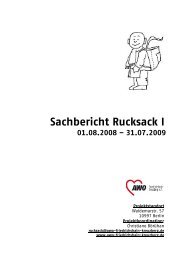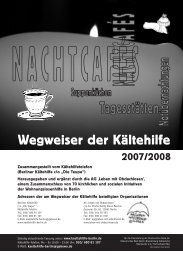Die Geschichte Friedrichshains - AWO Friedrichshain Kreuzberg
Die Geschichte Friedrichshains - AWO Friedrichshain Kreuzberg
Die Geschichte Friedrichshains - AWO Friedrichshain Kreuzberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8. Stralau 89Vom Rudolfkiez nach Alt-Stralau zur Liebesinsel 89Jugendclub E-Lok 94Jugendclub Freibeuter 95Ausblick 96Auswahlbibliographie 97
Einleitung<strong>Die</strong>ser Wegweiser zur Kultur und <strong>Geschichte</strong> <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong> möchtedie Neugierde auf den Stadtteil des Bezirks <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong>wecken.Was es hier alles zu sehen gab und was es zu sehen gibt! EinStalindenkmal, ein Lenindenkmal, das Zillemilieu, das gab es hier einmal.Der Friedhof der Märzgefallenen von 1848, eine Büste und eineGedenkstätte von Karl Marx, das Frankfurter Tor, die East-Side-Gallery,die ehemalige Mauer, kann man in <strong>Friedrichshain</strong> besichtigen. VieleIndustriegebäude und Kirchen, die im 19. Jahrhundert in <strong>Friedrichshain</strong>gebaut wurden, sind Repräsentanten der <strong>Geschichte</strong> der wirtschaftlichen,technischen, politischen und religiösen <strong>Geschichte</strong> Berlins und Deutschlands.Aber auch die uralte evangelische Dorfkirche von Alt-Stralau aus demJahr 1459 zeugt von einer vergangenen Zeit.<strong>Friedrichshain</strong> ist kein gewachsener Stadtteil und hat kein Zentrum.<strong>Die</strong> Hauptverkehrsstraße vom Osten, die Frankfurter Allee, die Karl-Marx-Allee führt durch <strong>Friedrichshain</strong> ins Zentrum Berlins und wurdezu repräsentativen Zwecken genutzt und hat eine wechselhafte<strong>Geschichte</strong>. Hier begann am 16. Juni 1953 der Volksaufstand in derDDR.<strong>Die</strong> Oberbaumbrücke als Bindeglied zwischen den beiden Stadtteilendes Bezirks <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong> wird von den Berlinern wegen desschönen Blicks die Spree entlang auf das Berliner Zentrum und wegenseiner Rundbögen und Türme immer mehr geliebt.<strong>Die</strong> Spree, die den Stadtteil im Westen begrenzt, fließt in großer Breitein Richtung Alexanderplatz. <strong>Die</strong> Schönheit des Spreeufers<strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong> wird sich erst in Zukunft nach dem Bau einerPromenade für den Betrachter erschließen, da das Ufer ehemaligesbewachtes Grenzgebiet hinter der Mauer der heutigen East-Side-Gallery4war.All dies werden wir in verschiedenen Artikeln und Rundgängen indiesem Wegweiser vorstellen.<strong>Die</strong> <strong>Geschichte</strong> <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong> ist vielfältig. Kulturell scheint<strong>Friedrichshain</strong> nicht so viel zu bieten – keine Oper, kein großes Theater,kein großes Museum. Erst seit kurzem ist das Kosmos als großer35
kultureller Veranstaltungsort wieder eröffnet worden. Doch der Scheintrügt.In <strong>Friedrichshain</strong> ist eine Vielzahl von kleinen Theatern, Galerien,Musikclubs und Veranstaltungsorten zu finden. Für den Jugendtourismusist <strong>Friedrichshain</strong> beliebter als <strong>Kreuzberg</strong> und keinGeheimtipp mehr. Viele sehr kreative Menschen leben hier. So habensich die Häuser, Straßen und Plätze gegenüber früher verändert und sindfarbenfroher gestaltet. Immer wieder gibt es etwas Neues zu entdecken.Eine Vielzahl von Festen, Lesungen, Märkten machen das Leben in<strong>Friedrichshain</strong> lebenswert. Auch finden kulturelle Veranstaltungen inKirchen, Schulen und Galerien statt, die nicht zum kommerziellenKulturbetrieb gehören. Wer am Ostkreuz aus der S-Bahn steigt und inden Boxhagener Kiez geht, kann in <strong>Friedrichshain</strong> am Tage und beiNacht kulturelle Vielfalt, internationale Küche, Theater, Tanz und Musikerleben. In <strong>Friedrichshain</strong> kann man im Volkspark Natur und Kulturgenießen, in der Rummelsburger Bucht in Alt-Stralau am Wasser auf derPromenade spazieren gehen als sei man am Meer.In diesem Wegweiser werden Sie nicht nur Tipps zu kulturellen Ortenund Artikel über die <strong>Geschichte</strong> des Stadtteils finden. Für junge Leute,die selber aktiv und kreativ ihre Freizeit gestalten wollen, haben wirAdressen von Jugendclubs und deren Angebote zusammengestellt, diejeweils am Ende eines Rundgangs zu finden sind. Wir wünschen vielSpaß beim Lesen und Erforschen des Stadtteils!R. K.6
<strong>Die</strong> <strong>Geschichte</strong> <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong>Nachdem die politischen Entscheidungsträger des Landes Berlinbeschlossen hatten, aus den 23 Berliner Bezirken 12 zu bilden, entstandim Jahre 2001 der Bezirk <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong>. Wir begeben unsjedoch in diesem Wegweiser auf die Spurensuche in <strong>Friedrichshain</strong>, weilsich in diesem Stadtteil nicht nur Zeugnisse vergangener Zeiten, sondernauch Zeichen des nach der Wende im Jahre 1989 einsetzenden Wandelsfinden lassen.So beleuchtet der Wegweiser wichtige Ereignisse und Zeitabschnitte,wie die Begebenheiten rund um den 18. März 1848, die Ende des 19.Jahrhunderts einsetzende Industrialisierung, die Jahre 1933 bis 1945,1953, 1961 und nicht zuletzt die Zeit nach 1989, die dasErscheinungsbild und den Charakter des kleinsten Berliner Stadtbezirkesveränderten.<strong>Friedrichshain</strong> gehört nicht zu jenen Bezirken, die historischgewachsen sind. Es hat auch kein Zentrum, sondern setzt sich ausverschiedenen Gebieten und Stadtvierteln zusammen. Zu den ältestenSiedlungen <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong> zählt die Halbinsel Alt-Stralau. Sie wirderstmalig 1240 erwähnt. In einer aus diesem Jahr datierten Urkunde istvon einem Ritter von Stralow die Rede, nach dessen letztem Nachfahren,Rudolf, Jahrhunderte später Rudolfstraße und -platz benannt wurden.<strong>Die</strong> erste Ansiedlung, die bis 1891 den Namen Strelow/Stralow führte,verweist jedoch auf slawische Ursprünge. Größere Bekanntheit erzieltedas Dörfchen durch das seit 1574 bis in die 60er Jahre des 20.Jahrhunderts begangene Volkfest, den so genannten „Stralauer Fischzug“.Im 18. Jahrhundert entstanden die Kolonien Boxhagen undFriedrichsberg, für die der preußische König Friedrich II. dieVoraussetzungen schuf. Wie bereits sein Urgroßvater Kurfürst FriedrichWilhelm warb Friedrich II. Glaubensflüchtlinge aus Frankreich undBöhmen – Hugenotten und Katholiken – an, denen er Land zurBesiedlung anbot, um durch neue Produktionstechniken und -verfahrendie Erträge des Landes zu steigern sowie bessere oder in Preußen bisherunbekannte Fabrikate herstellen zu lassen. Auf dem Gelände nördlichdes 1543 erstmals urkundlich erwähnten Vorwerkes Boxhagen siedeltensich im Jahre 1771 acht böhmische Familien entlang der Boxhagener7
Straße 68 bis 89 und Nr. 70 und dem heutigen Wismarplatz an, um hierals Gärtner das Land zu bewirtschaften. Allerdings war dieser Siedlungkein ökonomischer Erfolg beschieden, die Kolonie wurde aufgelöst. Dasgleiche Schicksal ereilte die 1770 gegründete Siedlung Friedrichsberg, dieim Süden an die Boxhagener Kolonie angrenzte. Auf GeheißFriedrichs II. bemühten sich hier ebenfalls böhmische und andereNeusiedler, dem Land Erträge abzuringen. Doch auch dieseAnstrengungen scheiterten.Als sich im Jahre 1840 das Thronjubiläum des erwähnten preußischenHerrschers zum hundertsten Male jährte – er übernahm 1740 das Amtdes Königs von Preußen – beschlossen die Stadtväter, den neu zuerrichtenden Volkspark „<strong>Friedrichshain</strong>“ zu nennen. In jener Zeit, Mittedes 19. Jahrhunderts, erschütterten revolutionäre Ereignisse die deutschenStaaten und brachten die Monarchien ins Wanken. Zuerst hattenRevolutionäre in Frankreich im Februar 1848 die Abdankung des Königserzwungen und die Republik ausgerufen. Daraufhin kam es auch in dendeutschen Staaten zu revolutionären Aufständen. <strong>Die</strong> Teilnehmer derVolksversammlungen und Demonstrationen forderten Presse- undVereinsfreiheit, eine Volksmiliz und die Einberufung eines bundesweitenParlaments. Nachdem König Wilhelm IV. für Preußen eine Verfassungangekündigt hatte, versammelten sich am Nachmittag des 18. März 1848viele Berliner vor dem Stadtschloss. Als plötzlich Schüsse fielen, löstesich die Menge auf. Doch dasGerücht, das Militär hätte auf dasVolk geschossen, ließ dieMenschen auf die Barrikadengehen. <strong>Die</strong> sich darausentwickelnden blutigen Kämpfedauerten bis in den 19. Märzhinein an und forderten am Endeüber 200 Tote und vieleVerwundete. Am Morgen diesesTages ordnete der König an, dieTruppen abzuziehen. Als dieersten Toten durch denSchlosshof getragen wurden,erschien der König und verneigtesich vor den Gefallenen.8
Gleichzeitig wandte er sich an die Berliner Bürger und bewilligte ihneneine verfassungsgebende Nationalversammlung in Preußen. Danachwurden die Särge der Märzgefallenen auf dem Gendarmenmarkt feierlichaufgebahrt.Der Magistrat und die Stadtverordneten beschlossen, die gefallenenKämpfer auf einer eigenen Begräbnisstätte beizusetzen. Nachdem sichein Bürgerkomitee für den Lindenberg im damals noch nichtfertiggestellten Volkspark <strong>Friedrichshain</strong> entschieden hatte, wurden hierdie Toten der Märztage zu Grabe getragen. <strong>Die</strong> überwiegend armeBevölkerung <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong> nahm lebhaften Anteil an diesenEreignissen. Zudem hatten sich Arbeiter und Handwerker vor allem inden Straßen des damaligen Stralauer Viertels an den Barrikadenkämpfenjener Tage engagiert. Als Folge dieser Aufstände des März 1848 wurdeein gesamtdeutsches Parlament gewählt, das in Frankfurt am Mainzusammentrat, um eine Verfassung auszuarbeiten. <strong>Die</strong> Abgeordneteneinigten sich darauf, dem preußischen König die Kaiserkroneanzutragen. <strong>Die</strong> Ablehnung des Königs, aus der Hand der Revolutionärediese Ehrung entgegenzunehmen, besiegelte das endgültige Ende derNationalversammlung. Bis heute erinnert der Friedhof im Volkspark<strong>Friedrichshain</strong> an diese revolutionären Tage.Wesentliche Impulse für die Entwicklung des Stadtteils <strong>Friedrichshain</strong>gingen von der Industrialisierung aus, die Ende des 19. Jahrhundertseinsetzte. Zahlreiche Unternehmen und Firmen siedelten sich in dieser9
Zeit im <strong>Friedrichshain</strong>er Gebiet an. Andere, bereits seit Mitte des19. Jahrhunderts hier existierende Kleinbetriebe stiegen bald zuführenden Großbetrieben auf. 1861 erfuhr Berlin seine größte territorialeErweiterung, die große Vorstadtflächen in das Stadtgebiet mit einbezog.Ein Bauboom von bisher nicht gekanntem Ausmaß setzte ein. Nachdem1878 Berlin erstmalig die Millionengrenze erreicht hatte, entstand ringsum die historische Berliner Altstadt ein Mietskasernengürtel, der auchdas <strong>Friedrichshain</strong>er Gebiet erfasste. Um möglichst vielen Menscheneine Unterkunft zu geben, wurden auf engstem Raum zahlreicheGebäude errichtet. <strong>Die</strong>se zeichneten sich durch Wohnungen aus, dieaufgrund ihrer Lage in den Seitenflügeln und Quergebäuden dasSonnenlicht kaum einließen, oder sich im Keller befanden. Zu den amdichtesten bebauten Vierteln im Mietskasernenstil zählte das StralauerViertel, wo über die Hälfte der Häuser vier und mehr Stockwerke besaß.Darüber hinaus hatte sich das Gebiet um den heutigen Ostbahnhof bisgegen Ende des 19. Jahrhunderts zu einem der großen problemreichenProletarierviertel des Berliner Ostens entwickelt.<strong>Die</strong> Zeichnungen und Lithographien des in <strong>Friedrichshain</strong>aufgewachsenen Heinrich Zille spiegeln das Leben der hier ansässigenMenschen wider. In dem sogenannten „Zille Milieu“ konnte sich dieBerliner Arbeiterbewegung etablieren, die in diesem Stadtgebiet baldgroße Streiks und Massenveranstaltungenorganisierte, aufdenen unter anderen dieprominenten ArbeiterführerFriedrich Engels, August Bebelund Wilhelm Liebknecht alsRedner auftraten. In jener Zeiterwarb sich <strong>Friedrichshain</strong> denRuf des „roten proletarischenOstens“. <strong>Die</strong> schlechten ArbeitsundWohnbedingungen verschärftendie sozialen Probleme,die zu Unruhen und zu einererhöhten Kriminalität führten.<strong>Die</strong>bstahldelikte, aber auchMord und Totschlag warenAusdruck dieser verzweifelten10
Lage. Durch die soziale Not wuchs ebenfalls die Zahl frauenspezifischerDelikte. Frauen sahen sich gezwungen, ihre geringen Löhne alsArbeiterinnen in den verschiedensten Industrie- und Gewerbezweigenals Prostituierte aufzubessern. Da die Prostitution generell unter Strafestand, wurden die in diesem Gewerbe tätigen Frauen und Mädchen zuGefängnisstrafen verurteilt. Sie bildeten die Mehrheit der Insassen desBerliner Frauengefängnisses, das seit 1864 in dem düsteren Mietskasernenviertelin der <strong>Friedrichshain</strong>er Barnimstraße stand. Ebensowurde die Abtreibung strafrechtlich verfolgt, so dass Frauen, die einesolche Tat begangen hatten, Zuchthausstrafen von bis zu zehn Jahren zuerwarten hatten. Außerdem saßen politisch engagierte Frauen in derBarnimstraße ein, denn für sie galt das Verbot, sich in politischenVereinen zusammenzuschließen. Zu diesen Frauen gehörte PaulineStaegemann. Sie hatte bereits im Jahre 1873 einen Arbeiter-Frauen- undMädchenverein als erste sozialdemokratische FrauenorganisationDeutschlands ins Leben gerufen und ihn als Vorsitzende geleitet.Nachdem sie eine öffentliche Versammlung einberufen hatte, wurde siemit ihrer Mitarbeiterin zu einer Haftstrafe in der Barnimstraße verurteilt.Eine der bekanntesten politischen Insassinnen war Rosa Luxemburg, dievon Februar 1915 bis Februar 1916 hier inhaftiert war.Gegen Ende des Ersten Weltkrieges kam es zu Aufständen derArbeiterschaft in den Industriegebieten, in denen sich überall ArbeiterundSoldatenräte bildeten. Auch im Berliner Osten tobten heftigeKämpfe. <strong>Die</strong> Ereignisse im November 1918 führten schließlich zurAbdankung Kaiser Wilhelms II. und läuteten das Ende der Monarchieein. In Berlin begann eine neue Zeit, Deutschland wurde eine Republik.Der Führer der Sozialdemokraten, Friedrich Ebert, übernahm als ersterdie Regierungsgeschäfte des Landes. <strong>Die</strong> in Berlin Gefallenen dieser alsNovemberrevolution in die <strong>Geschichte</strong> eingegangenen Aufstände fandenebenfalls auf dem <strong>Friedrichshain</strong>er Friedhof der Märzgefallenen ihreletzte Ruhestätte.Im Jahre 1920 kam <strong>Friedrichshain</strong> durch die große Gebietsreform zuBerlin. <strong>Die</strong> verschiedenen Siedlungsgebiete bildeten nun den kleinstenBerliner Bezirk, dessen Bezeichnung sich von dem gleichnamigenVolkspark ableitet.Ende der 1920er Jahre trat die Schwäche der Politik der WeimarerRepublik offen zutage und bescherte sowohl den Linken als auch derNSDAP bedeutende Stimmenzuwächse. Zwischen beiden politischen11
Lagern kam es zu schweren Auseinandersetzungen. Zu denberüchtigtsten SA-Schlägern zählte der in der Frankfurter Straße 62wohnende Horst Wessel, der in den letzten Jahren der WeimarerRepublik mit seiner Bande <strong>Friedrichshain</strong> und <strong>Kreuzberg</strong> unsichermachte. Nach seinem Tod – er war am 14. Januar 1930 in seinerWohnung von Konkurrenten niedergeschossen worden und wenigeTage später im Krankenhaus <strong>Friedrichshain</strong> seinen Verletzungenerlegen – stilisierten ihn die Nazis zu einem ihrer großen Helden. Als dieNSDAP 1933 die Wahlen gewonnen hatte, benannte sie am27. September desselben Jahres <strong>Friedrichshain</strong> in „Horst-Wessel-Bezirk“um.Es blieb nicht bei der Namensänderung. Überall verbreiteten dieNazis Angst und Schrecken. In ihren zahlreichen Stützpunkten, wie z. B.in dem SA-Stützpunkt „Keglerheim“ in der Petersburger Straße 94,schlugen sie wehrlose Menschen zusammen. <strong>Die</strong>se politischeEntwicklung beunruhigte die Bevölkerung.Wie in ganz Deutschland zählten auch in <strong>Friedrichshain</strong> die jüdischenBewohner zu den Opfern des Nazi-Regimes. An sie erinnern die„Stolpersteine“, die an den einstigen Wohnorten jüdischer Bürger in<strong>Friedrichshain</strong> in die Strassen eingelassen wurden. Auf den aus Messingbestehenden Pflastersteinen sind die Namen der in <strong>Friedrichshain</strong>lebenden Juden, deren Geburts- und Sterbedaten, der Zeitpunkt ihresAbtransports sowie der Deportationsort eingraviert.Darüber hinaus wurden Menschen verfolgt, die in illegalenArbeiterorganisationen im noch immer „roten“ <strong>Friedrichshain</strong> aktivenWiderstand leisteten. Zu den bekannteren Opfern dieses Stadtteilszählten der Sportler und Kommunist Werner Seelenbinder sowie derSchlosser Willi Bänsch. Ebenso wurden Christen, deren Engagementsich gegen die Politik der Nationalsozialisten richtete, verfolgt odermassivem Druck ausgesetzt, wie der Pfarrer der Samariterkirchengemeinde,Dr. Wilhelm Harnisch, der wiederholt verhört wurdeund für kurze Zeit im KZ inhaftiert war. Auch Frauen beteiligten sich alsKommunistinnen, Gewerkschafterinnen, Parteilose und Christinnen anpolitischen Aktionen. Einige gehörten zu den aktiven Mitgliedern derWiderstandsgruppe „Rote Kapelle“. Junge, jüdische Frauen engagiertensich unter anderen in der Widerstandsgruppe Baum. Ihren Mutbezahlten viele Frauen mit dem Leben. Doch nur wenige Menschen12
handelten gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime. Vielemachten sich mitschuldig.<strong>Die</strong> <strong>Friedrichshain</strong>er Unternehmen, Firmen, Betriebe profitierten vondem Vorgehen der nationalsozialistischen Diktatur. So deckten sie ihrenerhöhten Arbeitskräftebedarf mit „Fremdarbeitern“, später mit KZ-Häftlingen ab. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg.Nach sechs Kriegsjahren erreichten im April 1945 die Alliierten TruppenBerlin. Sie setzten der Nazi-Herrschaft ein Ende. Bei den Kämpfen umdie Stadt erlitt <strong>Friedrichshain</strong> schwerste Verwüstungen: Das Viertel umdie Frankfurter Allee existierte nicht mehr, über 800 Firmen wurdenzerstört, die Hälfte aller Wohnungen war zerbombt.Am 26. April nahm die Rote Armee den Bezirk ein, der späterzusammen mit ganz Ostdeutschland Teil der sowjetischenBesatzungszone wurde. <strong>Die</strong> Amerikaner, Briten und Franzosen hieltendie deutschen Gebiete im Westen besetzt. Dann begann die Ära desKalten Krieges, in der sich die ehemaligen Alliierten USA undSowjetunion mit ihren jeweiligen Bündnispartnern unversöhnlichgegenüberstanden. Als Folge dieser Teilung bildeten sich zwei deutscheStaaten: Aus den westlichen Besatzungszonen entstand im Mai 1949 dieBundesrepublik und im Oktober erfolgte im Osten die Gründung derDeutschen Demokratischen Republik. Berlin stand weiterhin unter derKontrolle der vier Siegermächte. <strong>Die</strong> Grenze zu den Westsektorenverlief in <strong>Friedrichshain</strong> entlang der Spree. <strong>Die</strong> DDR verblieb mitanderen osteuropäischen Ländern im Einflussbereich der Sowjetunion.Mit deren Zustimmung etablierte sich in Ost-Berlin ein kommunistischesRegime unter Führung der SED.Anfang der 1950er Jahre plante die DDR ein ehrgeizigesAufbauprogramm, um ganz Berlin als „sozialistische Hauptstadt“ inneuem Glanz erstrahlen zu lassen. Nach Entwürfen HermannHenselmanns und anderer Architekten sollte zunächst in <strong>Friedrichshain</strong>eine Magistrale vom Strausberger Platz bis zur Proskauer Straßeentstehen, die zu Ehren des sowjetischen Diktators von FrankfurterAllee in Stalinallee umbenannt wurde. Den geplanten „Prachtboulevard“sollten die Türme am Frankfurter Tor beschließen. So entstand dieheutige Karl-Marx-Allee in <strong>Friedrichshain</strong>.Der Tod des sowjetischen Diktators Stalin am 5. März 1953 löste inder DDR innenpolitische Turbulenzen aus. Ulbricht, der weiterhin amdoktrinären und stalinistischen Herrschaftssystem festhielt, sollte13
abgelöst werden. Zudem verlor die SED-Führung wegen der schlechtenVersorgung der DDR-Bürger mit Lebensmitteln und der willkürlichenVerhaftung von Regimekritikern den Rückhalt unter der Bevölkerung.Nachdem dann der Ministerrat der DDR am 28. Mai 1953 eine 10%igeNormerhöhung für die Industrie- und Bauarbeiter verkündet hatte,brachen erste Unruhen aus. Als sich die Lage zuspitzte, verkündete dieSED-Führung auf Druck der sowjetischen Regierung einen „neuenKurs“. Sie versprach, die Preiserhöhungen zurückzunehmen und denKonsum zu verbessern, hielt jedoch weiterhin an der Normerhöhungfest. Daraufhin begannen am 16. Juni Bauarbeiter in der Stalinallee mitStreiks und Demonstrationen, dem sich am darauf folgenden Tag immermehr Arbeitnehmer anschlossen. Bald kam es in allen Industriezentren,in mehr als 560 Orten in der DDR, zu Volkserhebungen. <strong>Die</strong>Teilnehmer forderten inzwischen nicht mehr nur die Rücknahme derNormerhöhung, sondern auch den Rücktritt der Regierung, dieAblösung Ulbrichts und freie Wahlen. Als die SED-Führung sich nichtmehr in der Lage sah, diese Volkserhebung einzudämmen undschließlich ganz die Kontrolle darüber verlor, ließ sie sowjetischeTruppen den Aufstand niederschlagen. Eine Gedenktafel vor demRosengarten in der Karl-Marx-Allee erinnert an den Beginn desAufstandes am 16. Juni in der Stalinallee. Ulbricht vermochte es nicht,nach diesen Ereignissen seine Position zu stärken und seineinnerparteilichen Gegner auszuschalten.Acht Jahre später, im Juni 1961, löste er mit seiner Äußerung„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!“ erneut eineFluchtwelle von DDR-Bürgern nach Westdeutschland bzw. West-Berlinaus. Auf die seit der Teilung Deutschlands nicht endende Zahl vonFlüchtlingen reagierte das SED-Regime mit dem Bau einer Mauer. Ineiner Nacht- und Nebelaktion vom 12. auf den 13. August 1961 riegeltesie in Berlin beide Stadtteile hermetisch voneinander ab. Darüber hinauswurden alle Verkehrsverbindungen zwischen den beiden Teilen Berlinsunterbrochen und scharfe Kontrollen an allen Grenzen nach West-Berlinund zur BRD eingeführt. <strong>Die</strong> Spree, natürlicher Grenzfluss zwischenden Bezirken <strong>Friedrichshain</strong> und <strong>Kreuzberg</strong>, stellte nun einunüberwindliches Hindernis dar. Der Übergang über dieOberbaumbrücke wurde unterbrochen. Grenzschiffe, die auf der Spreepatrouillierten, verhinderten, dass Flüchtlinge schwimmend das andere,in <strong>Kreuzberg</strong> gelegene Ufer erreichen konnten. An den Sperranlagen, die14
entlang der gesamten innerdeutschen Grenze mit einem so genanntenTodesstreifen versehen und stellenweise vermint wurden, fanden vieleFlüchtlinge den Tod. Nachdem sich im Jahre 1989 die Lage in einigensozialistischen Ländern dramatisch verändert hatte, sah sich auch dieDDR-Regierung zu einem Kurswechsel gezwungen. Als am9. November das Polit-Büro-Mitglied Günter Schabowski auf einerPressekonferenz die Öffnung der Grenzen zu West-Berlin und nachWestdeutschland verkündete, fiel die Berliner Mauer und die Tage derDDR waren gezählt.Der Fall der Berliner Mauer lockte viele Menschen nach Berlin. Vieleklopften Teile aus der Mauer heraus, die sie als Andenken an dashistorische Ereignis mit nach Hause nahmen. Nach der Wiedervereinigungbeider deutscher Staaten am 3. Oktober 1990 wurde inBerlin ein Großteil der Mauer abgerissen und der Grenzstreifen inParkanlagen umgewandelt. Um ein längeres Stück der Berliner Mauer zuerhalten, gestalteten 118 Künstler aus 21 Ländern in <strong>Friedrichshain</strong> einen1,316 km langen Mauerabschnitt zwischen Oberbaumbrücke undOstbahnhof. Daraus entstand die größte Open-Air-Galerie, die unterdem Namen „East-Side-Gallery“ in aller Welt bekannt ist.Das Jahr 1990 war noch aus einem anderen Grund vongeschichtlicher Bedeutung. Seit Dezember 1989 hielten junge LeuteHäuser in allen großen Städten der DDR besetzt. In <strong>Friedrichshain</strong>waren 15-20 Häuser zwischen der Niederbarnim-, Kreutziger undMainzer Straße davon betroffen. <strong>Die</strong> politisch Verantwortlichenerklärten sich bereit, mit den Besetzern über eine Sanierung und spätereNutzung zu verhandeln. <strong>Die</strong> Bewohner der inzwischen 130 besetzten<strong>Friedrichshain</strong>er Gebäude gründeten im Juni 1990 ein Vertragsgremium,um für alle Häuser Nutzungsverträge abzuschließen. Doch diemonatelangen Gespräche zwischen den Besetzern und den Vertreternder Bezirksverwaltung und dem Magistrat (Ost) scheiterten. DerMagistrat ordnete an, die nach dem 24. Juni erfolgten Besetzungen nichtmehr zu genehmigen. Für alle vor diesem Datum belegten Häuser solltenNutzungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Als es daraufhin zuweiteren Besetzungen in Lichtenberg und <strong>Friedrichshain</strong> kam, wurdendie Häuser von der Polizei geräumt. In der Mainzer Straße eskaliertedann die Situation. Ein großes Polizeiaufgebot mit Wasserwerfern,Panzern und Spezialfahrzeugen stand den Besetzern gegenüber, dieinnerhalb kürzester Zeit Barrikaden errichteten, Autos umwarfen und15
Container anzündeten. Politiker wie Senatsabgeordnete und der damaligeBezirksbürgermeister, Helios Mendiburu, versuchten die Situation zuentschärfen und zwischen den Fronten zu verhandeln. <strong>Die</strong>s wurdejedoch vonseiten der Polizeiführung abgelehnt. Nach den fast 15Stunden währenden Straßenkämpfen gelang es den Besetzern, die Polizeizum Rückzug zu bewegen. Weil der Innensenator befürchtete, dass einegrößere Anzahl von Autonomen aus Hamburg und anderen westdeutschenStädten nach Berlin kommen würde, kündigte er eine härtereGangart gegenüber den militanten Besetzern an. In der Nacht vom 13.zum 14. November stürmten über 1000 Polizisten aus Berlin,Niedersachsen und NRW die Mainzer Straße und gingen massiv gegendie Bewohner vor. Nach zwei Stunden endeten die Straßenschlachten, inderen Folge Polizisten und Hausbesetzer verletzt und einige HundertPersonen festgenommen wurden, darunter auch Mitglieder der BerlinerKoalitionspartei Alternative Liste (AL). Daraufhin traten die AL-Senatoren von ihrem Amt zurück. Aufgrund dieses Ereignisses zerbrachdie erste rot-grüne Landesregierung in Berlin, die nach Neuwahlen durchdie große Koalition zwischen CDU und SPD abgelöst wurde. Heuteerinnert die Gegend rund um die Mainzer Straße kaum noch an dieseschwierigen Zeiten. Viele Häuser wurden aufwendig saniert undpräsentieren sich in neuem Glanz. Mieter aus Berlin und anderenGegenden im In- und Ausland haben inzwischen hier Einzug gehalten,so dass sich der Charakter dieses Viertels gewandelt hat.<strong>Die</strong> vorerst letzte große Veränderung des Stadtteils setzte mit der imJahre 2001 erfolgten Fusion mit dem einst zu West-Berlin gehörendenStadtbezirk <strong>Kreuzberg</strong> ein. <strong>Die</strong>ser Zusammenschluss stellte beideStadtteile, die auf eine unterschiedliche <strong>Geschichte</strong> zurückblicken, vorgroße Herausforderungen. Doch im Verlauf der folgenden Jahre habensie sich immer mehr angeglichen. Galt bisher <strong>Kreuzberg</strong> als der BerlinerBezirk mit dem höchsten Anteil ausländischer Bürger und einerAlternativszene, entwickelte sich <strong>Friedrichshain</strong> seit der Fusion ebenfallszu einem alternativen, multikulturellen Stadtteil, in dem heute viermal soviele Menschen nichtdeutscher Herkunft leben wie vor 1989. Man darfgespannt sein, wie die Entwicklung weitergeht.Angelica Hilsebein16
1. Von der „Magistrale Ostberlins“ zum„Tiergarten des Ostens“<strong>Die</strong> Karl-Marx-AlleeDen ersten Rundgang beginnen wir amStrausberger Platz, dem eindrucksvollsten Entree inden Stadtteil <strong>Friedrichshain</strong>. Nachdem dieFrankfurter Straße im Zweiten Weltkrieg starkzerstört worden war, begann in den 1950er Jahrenhier der Wiederaufbau. Er wurde in mehrerenEtappen – vom Strausberger Platz bis zurProskauer Straße – realisiert. In einem erstenSchritt wurde der um 1863 angelegte StrausbergerPlatz um 50 m nach Osten verlegt. Danachentstanden die von Hermann Henselmannentworfenen Turmbauten und Wohnhäuser, dieden Platz einrahmen. Im ehemaligen Haus desKindes, dem ersten Kinderkaufhaus in ganzDeutschland, üben heute Jungen und Mädchen inTanzZwietAnschrift:Strausberger Platz 1910243 BerlinTel.: 030/52 51 522 Internet:www.tanzzwiet.deder TanzZwiet das Pas de Deux. An die von FritzKühn 1967 geschaffene Brunnenanlage „SchwebenderRing“ schließt sich die 1,7 km lange und90 m breite Karl-Marx-Allee an, die ab Frankfurter19 17
Tor als Frankfurter Allee weitergeht. Nicht nur der Name dieses längstenBaudenkmals Deutschlands, sondern auch die Wohnhäuser undGeschäfte verweisen auf eine wechselvolle <strong>Geschichte</strong>. Mit derUmbenennung der Frankfurter Allee in Stalinallee vollzog die SED-Führung den Wechsel von der bürgerlichen zur sozialistischen Ära. Demsowjetischen Diktator Stalin zu Ehren errichtete die DDR-Regierung indieser Straße ein Denkmal, um ihre „unverbrüchliche Treue“ zurSowjetunion zu bekunden. Erst lange nach dem Tod Stalins beendete sieden Kult um dessen Person. 1961 wurde das Denkmal eingeschmolzenund die Stalinallee in Karl-Marx-Allee umgenannt. An den NamensgeberKarl Marx erinnert die von Willi Lammert geschaffene Büste, die auf derrechten Seite des Strausberger Platzes zu sehen ist. Sie steht am Eingangin die Karl-Marx-Allee, auf deren rechten Seite wir den Rundgangfortsetzen.<strong>Die</strong> im sogenannten „Zuckerbäckerstil“ errichteten Häuserorientierten sich einerseits am sowjetischen Vorbild, bezogenandererseits Stilelemente deutscher Baukunst mit ein. <strong>Die</strong> Fassadenwurden aufwändig mit Meißner Keramikplatten verkleidet, die Blendender darunter liegenden Läden, Restaurants und Balustraden sind ausNaturstein.Silvester 1952 wurden aus dem Topf der „Aufbaulotterie“ die Losefür die Mieter der ersten tausend Wohnungen in der Karl-Marx-Alleegezogen. Ferner bekamen hohe Funktionäre und all jene eine dieserbegehrten Wohnungen, die sich freiwillig an der Enttrümmerungsaktionbeteiligt und eine Aufbaunadel erworben hatten. <strong>Die</strong> Wohnqualität in derAllee verbesserte sich mit der Einrichtung zahlreicher Läden, Geschäfte,Restaurants und Cafés; der Boulevard avancierte zur besten EinkaufsstraßeOst-Berlins.In der Frankfurter Allee 72 wurde 1953 eine Milchtrinkhalle, ein Jahrspäter eine Milchbar eingerichtet.Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit ein kleines Kaffeehaus, dasin den 1960er Jahren als „Café Sibylle“ über die Grenzen <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong>hinaus bekannt wurde. Nach einer umfangreichen Sanierung konnte dasCafé im Jahre 2000 wiedereröffnet werden. <strong>Die</strong> restauriertenWandgemälde und die denkmalgeschützte Stuckdecke erinnern anvergangene Zeiten. Über die <strong>Geschichte</strong> der Allee und des Cafésunterrichtet eine ständige Ausstellung. Ein bis zweimal im Monatkönnen Gäste hier Lesungen oder musikalische Darbietungen erleben.20
Café SibylleAnschrift:Karl-Marx-Allee 7210243 BerlinTel.: 030/29 35 22 03 Öffnungszeiten:Mo-Fr 10.00-20.00Sa/So 12.00-20.00Ein paar Meter weiter befindet sich in der Nummer78 seit Herbst 1953 die Karl-Marx-Buchhandlung.Karl-Marx-BuchhandlungAnschrift:Karl-Marx-Allee 7810243 BerlinTel.: 030/29 33 37-0 Internet:www.kmbuch.deHier werden nicht nur Bücher verkauft, sondernauch Lesungen mit bekannten Autoren organisiert.Zu DDR-Zeiten boten diese Veranstaltungen denAutoren die Möglichkeit, ihre Meinung kritisch zuäußern.Von dem bisherigen Pfad abweichend, nimmtder Rundgang einen kurzen Abstecher in dieMarchlewskistraße. Das Haus Nummer 6 zeugtvon der Zeit des 19. Jahrhunderts. Es ist eine vonacht ehemaligen Feuerwachen, die HermannBlankenstein entworfen hat. Obwohl die seit 1884in den <strong>Die</strong>nst gestellte Feuerwache im Kriegzerstört worden war, blieb sie bis 1956 in Betrieb.Seit September 1998 ist das denkmalgeschützte Öffnungszeiten:Mo-Fr 10.00-19.00Sa 10.00-16.00Kulturamt<strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong>Anschrift:Marchlewskistraße 610243 BerlinTel.: 030/29 34 79 424 Internet:www.kulturamtfk.de21
Haus eine Kulturstätte mit einem Ausstellungsraum und einerStudiobühne. Ebenso ist es Sitz des Kulturamtes und eines Jugendclubs.Der Weberwiese, einer 1951/52 angelegten kleinen Parkanlage mitSpringbrunnen, schließt sich das erste Wohnhochhaus Ost-Berlins an.Der Architekt Hermann Henselmann orientierte sich hier am Baustil der1920er Jahre. Am 1. Mai 1952 zogen die ersten Mieter ein, die für diedamalige Zeit einen ungewöhnlichen Komfort mit Zentralheizung,Warmwasser und Fahrstuhl genossen. Den Haupteingang des Hausesschmückt ein Zitat Berthold Brechts.Wieder zurück auf der Karl-Marx-Allee kommen Wohnhäuser inSicht, die von der sie umgebenden Architektur der Magistrale abweichen.Bei den Gebäuden der Nummern 102-104 und 126-128 handelt es sichum die fünfgeschossigen, sogenannten Laubenganghäuser, derenGrundsteinlegung am 21. Dezember 1949, dem 70. Geburtstag Stalinserfolgte. <strong>Die</strong> Pläne der Architekten Herbert Klatt, Ludmilla Herzenstein,Karl Brockschmidt und Helmut Riedel sahen ursprünglich vor, dieseersten Wohnblöcke in eine aufgelockerte, begrünte Stadtanlageeinzubetten. Doch Ulbricht, der den Entwurf als primitiv bezeichnethatte, verhinderte die Ausführung des Vorhabens. Heute stehen dieHäuser unter Denkmalschutz. Langsam nähern wir uns der Türme, dieden Abschluss der Karl-Marx-Allee bilden. Herrmann Henselmannentwarf sie für das Wettbewerbsprojekt „Frankfurter Tor“.Lounge im Turm(StiftungDenkmalschutz Berlin)Anschrift:Frankfurter Tor 910243 BerlinTel.: 030/42 01 67 80 Internet:www.stiftungdenkmalschutzberlin.de/der-turm/Dass die Kuppeln an jene der Dome amGendarmenmarkt erinnern, ist kein Zufall.Henselmann bezog sich bei seiner Gestaltung desPlatzes bewusst auf dieses Baudenkmal. Nachdemer im Januar 1953 als Sieger aus dem Wettbewerbhervorgegangen war, errichtete er die Türme amFrankfurter Tor in den Jahren 1957-1960. In einemder Türme befindet sich heute der höchste SalonBerlins, der eine einzigartige Aussicht auf die Stadtbietet. Auf vier Ebenen werden hier Konferenzen,Empfänge und Feiern im kleinen Kreis abgehalten.Jetzt überqueren wir die Karl-Marx-Allee undbegeben uns auf die andere Seite der Straße zumzweiten Turm mit der Anschrift Frankfurter Tor 1.Im Jahre 1965 eröffnete der Verband BildenderKünstler Deutschlands in der DDR, Bezirk Berlin22
die Galerie imTurm. OstberlinerKünstler erhieltenGelegenheit, ihreKunstwerke einzelnoder in einerGruppe auszustellen.Nachdemder Designer undGrafiker Karl-Friedrich Schmalwasser1990 dieLeitung dieserkommunalen Galerieübernommen hatte, entstand die Ausstellungsreihe„Berliner Kabinett“, die ArbeitenBerliner Künstler zeigt. Auf der Karl-Marx-Allee,die wir weiter entlang spazieren, können wir ineines der mittlerweile hier etablierten Restaurantsmit internationaler Küche einkehren.Den Bau kultureller Einrichtungen sah bereitsdas Wohnungsbauprogramm der DDR vor. In derKarl-Marx-Allee 131a errichteten Josef Kaiser undHerbert Aust zwischen 1960 und 1962 das als UrundErstaufführungstheater geplante „Kino 1000“,das spätere „Kino Kosmos“. 1997 wurde es als„UFA-Palast Kosmos“ mit über zehn Sälen undinsgesamt 3400 Plätzen wiedereröffnet, musstejedoch 2005 Insolvenz anmelden. Mit demComedy-Musical „What a Feeling“ meldete sichdas Kosmos zurück. Inzwischen wird es von derKosmos-KG als multifunktionales Veranstaltungszentrummit Lounge, Bar, Bistro,Sommergarten, verschiedenen Sälen – Herzstückist der 1200 qm 2 große Saal mit 750 Sitzplätzen –und einem Kino weitergeführt.Entlang dieses Straßenabschnittes in unmittelbarerNähe des Kosmos findet einmalGalerie im TurmAnschrift:Frankfurter Tor 110243 BerlinTel.: 030/42 29 426 Internet:www.kulturamtfk.de/k_galerieimturm/ Öffnungszeiten:Di - So 14.00-20.00Kosmos KGAnschrift:Karl-Marx-Allee 131a10243 BerlinTel.: 030/40 04 81-30 Internet:www.kosmos-berlin.de Öffnungszeiten:tgl. von 10.00 bis openend23
wöchentlich der Wochenmarkt statt. <strong>Die</strong> zahlreichen Stände halten einbreitgefächertes Angebot bereit.<strong>Die</strong> Häuserzeile wird zwischen den Nummern 105 und 103 von einerkleinen Parkanlage unterbrochen, die Anwohner und Besucher zumVerweilen einlädt. <strong>Die</strong> friedliche Atmosphäre des von Rosen umranktenGartens verrät heute nichts mehr von den Ereignissen, die hier am 16.Juni 1953 begannen. An diesem Tag hatten sich Arbeiter der Stalinalleeversammelt, um gegen die Normerhöhung der DDR-Regierung zudemonstrieren. Schüler des <strong>Friedrichshain</strong>er Heinrich-Hertz-Gymnasiumsführten anlässlich der 50-jährigen Wiederkehr des Volksaufstandesvom 17. Juni eine Umfrage auf dem Alexanderplatz und in denSchönhauser-Allee-Arcaden in Berlin durch. Von den ca. 200 Befragten,die zwischen 11 und 95 Jahre alt waren und aus den verschiedenenTeilen Deutschlands kamen, wusste mehr als die Hälfte, dass an diesemTag ein Volksaufstand stattgefunden hatte. Manche Westdeutscheverbanden mit dem Datum den in der BRD bis 1990 begangenenFeiertag.An dieser Stelle verweisen wir auf die Informationstafeln, die entlangder Karl-Marx-Allee aufgestellt sind. Sie geben Auskunft über dieEntstehung und <strong>Geschichte</strong> des Boulevards, beschreiben aber aucheinzelne, historische Gebäude. Nicht zuletzt sollen die bereits zu DDR-Zeiten über die Grenzen <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong> hinaus bekannten Restaurants„Café Warschau“ und „Café Budapest“ erwähnt werden. Das CaféWarschau, das sich im Haus Nr. 93a befand, existiert nicht mehr.Stattdessen zog hier nach langem Leerstand 2005 die Geschäftsstelle derArbeiterwohlfahrt <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong> e.V. in die erste Etage ein.Im ehemaligen Café Budapest, dem heutigen Blockhaus-Restaurant,werden dagegen noch immer Speisen und Getränke serviert.Dem schließt sich ein Wochenmarkt an, der zwischen Koppenstraßeund Karl-Marx-Allee immer dienstags und donnerstags seine Warenfeilbietet. Doch nicht nur Wochenmärkte, sondern auch zahlreicheGeschäfte und Restaurants tragen zur Attraktivität des Boulevards bei.Darüber hinaus beleben Veranstaltungen, wie der im Monat Maiausgetragene Marktschreier-Wettbewerb und das im Septemberstattfindende Jazzfest die Karl-Marx-Allee.Im August präsentiert das Internationale Bierfestival im „längstenBiergarten der Welt“ zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Torzahlreiche regionale und überregionale Biersorten.24
Mit diesen Aussichten endet der Rundgang auf jener Straße, die zu dengeschichtsträchtigsten <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong>, wenn nicht sogar Berlins zählt.A. H.Jugendklub FeuerwacheWie bereits erwähnt, befindet sich in der Alten Feuerwache in derMarchlewskistraße 6 ein Jugendklub.Hier können sich Jugendliche sportlich betätigen, z. B. Fußball,Volleyball oder Tischtennis spielen, aber auch das Klettern üben.Daneben wird Hilfe bei den Hausaufgaben angeboten, Bildungsfahrtenorganisiert oder über fremde Länder und Kulturen informiert. An alle,die sich mit Musik beschäftigen, ob Rocker, Punker oder Hip Hopper,richtet sich die vom Jugendklub initiierte Musikreihe. An denVeranstaltungen können sich Mitglieder einer Band oder DJ’s beteiligen.<strong>Die</strong> Kandidaten treten gegeneinander an und das Publikum entscheidetüber Sieg oder Niederlage.Der Jugendklub ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 15 bis 21Uhr geöffnet.Adresse: Marchlewskistr. 6, 10243 Berlin, Kontakt: 030/29 34 79 440, Internet: www.jcfeuerwache.de25
Kirchliche und andere religiöse Einrichtungen –Begegnungsstätten für Gläubige undNichtgläubigeKirchliche und andere religiöse Einrichtungen nahmen wesentlichenEinfluss auf das Erscheinungsbild und den Charakter des Stadtteils<strong>Friedrichshain</strong>. <strong>Die</strong> Entwicklung der zwölf evangelischen und vierkatholischen Gotteshäuser sowie einer evangelisch-methodistischenKirche, die sich über den gesamten Stadtteil verteilen, veranschaulichtdie gesellschaftlichen Veränderungen in Deutschland. <strong>Die</strong> sozialen undpolitischen Verhältnisse Deutschlands seit der Reichsgründung 1871schufen die Voraussetzung für die Entstehung zahlreicher Kirchen: Siewurden zum einen für Gemeinden notwendig, deren Mitgliederzahlensich aufgrund des allgemeinen Bevölkerungsanstiegs stetig erhöhten,zum anderen waren sie Ausdruck des kirchlichen Selbstbewusstseins unddes gewachsenen Repräsentationsbedürfnisses des Kaiserhauses. Später,in der Zeit der Diktaturen – Naziherrschaft und SED-Staat –, sahen sichdie Kirchen in ihrer Existenz bedroht. Doch auch und gerade unterschwierigen Bedingungen blieben nicht wenige Christen ihrem Glaubentreu, boten Kirchen ihrem Auftrag gemäß Unterdrückten und VerfolgtenZuflucht. Zudem war es Regimegegnern in der DDR möglich, sich unterdem Dach der Kirchen frei zu äußern, Ideen zu entwickeln und nichtzuletzt den Widerstand gegen die Regierung zu organisieren. Nach derWiedervereinigung Deutschlands verloren die Kirchen an Bedeutung.<strong>Die</strong> Zahl der Gemeindemitglieder sank in den letzten Jahrzehntenrapide. <strong>Die</strong> Kirchen sind gezwungen, auch ohne ausreichende finanzielleMittel ihren seelsorgerischen Auftrag gerecht zu werden und ihreGebäude für die Zukunft zu erhalten.Es würde den Rahmen dieser Darstellung sprengen, hier alleGotteshäuser <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong> aufzuführen. Daher fiel die Wahl auf jeneEinrichtungen, die einerseits wegen ihres religiösen, politischen undsozialen Engagements während der DDR-Zeit überregionale Bedeutungerlangten und andererseits in einer weitgehend areligiösen Umgebungneue Wege beschritten, um ihre Existenz zu sichern. Ferner wird jeneGemeinschaft vorgestellt, die sich erst nach 1990 in <strong>Friedrichshain</strong>ansiedelte, das religiöse und kulturelle Leben in <strong>Friedrichshain</strong> bereichert26
und es dadurch vielfältiger erscheinen lässt – die buddhistischeGemeinde Bodhicharya.Den Auftakt bildet die in der Friedenstraße auf einer Anhöhe liegendeSt. Bartholomäuskirche, die zugleich den Eingang nach <strong>Friedrichshain</strong>am „Drei-Bezirks-Eck“ markiert. <strong>Die</strong>ses zweitälteste noch bestehendeGotteshaus entstand nach Plänen des Baumeisters Friedrich AugustStüler in den Jahren 1854 bis 1858 auf dem früheren LeßmannschenWeinberg, dessen Reben im kalten Winter des Jahres 1740 erfrorenwaren. König Friedrich Wilhelm IV, der sowohl das Patronat als auchdie Baukosten übernommen hatte, gab der Kirche ihren Namen. AmGeburtstag der Königin Elisabeth, dem 13. November 1858, wurde dasGotteshaus feierlich eingeweiht. Nachdem die Kirche durch denBaumeister Friedrich Adler Ende des 19. Jahrhunderts vollendet bzw.restauriert worden war, blieb sie nach den Luftangriffen im ZweitenWeltkrieg nur noch als Ruine stehen. Den Wiederaufbau übernahm 1952der Architekt Willi Nerger. Er errichtete einen schlichten Kirchenneubau,dessen feierliche Wiedereinweihung am 28. April 1957 stattfand.Wie viele Kirchen in der DDR bot auch die St. BartholomäusgemeindeMenschen Zuflucht, deren Gedanken, Ideen und Ansichten nicht imEinklang mit dem DDR-Regime standen. Als der Physiker Bernd Kantersich mit der Absicht trug, ein Antikriegsmuseum einzurichten, das sichan einer früheren, von den Nationalsozialisten verbotenen Einrichtungorientierte, stellte ihm die Bartholomäusgemeinde 1982 ihre südlichenSeitenräume zur Verfügung. Hier konzipierte Kanter mit Unterstützungehrenamtlicher Mitarbeiter Fotoausstellungen, die vor den Gefahrenkriegerischer Auseinandersetzungen warnten und Beispiele für friedlicheKonfliktlösungen aufzeigten. Nachdem 1984 ein ständiger Ausstellungsraumeröffnet werden konnte, folgten ein Jahr später dieFriedensbibliothek und ein Werkstattraum zur Vorbereitung verschiedenerAusstellungen. Obwohl die DDR sich stets als Friedensmachtbezeichnete, begleitete sie Kanters Antikriegsmuseum mit dem größtenArgwohn. <strong>Die</strong>ser hielt – jedoch nicht ohne den Beistand führenderKirchenvertreter – unbeirrt und kompromisslos an seiner Arbeit fest.Seit Kanters Tod wird das Museum, das mittlerweile in den Räumen desHauses der Demokratie in der Greifswalder Straße 4 angesiedelt ist, inseinem Sinne weitergeführt.27
Ein anderer, den Stadtteildominierender Kirchenbau befindetsich in dem nach ihm benanntenSamariterviertel. In den Jahren 1892bis 1894 erbaute Gotthilf LudwigMöckel diese Kirche im neugotischenStil. Zur Einweihung am 22. Oktober1894 kam die Kaiserin und KöniginAuguste Viktoria persönlich. Sie hattenicht nur für das Gotteshaus Geldaus den Erträgen der Schlossfreiheitslotteriegespendet undzusammen mit ihrem Gemahl einKirchenfenster gestiftet, sondernauch den Namen vorgeschlagen. Ererinnert an den barmherzigenSamariter, eine <strong>Geschichte</strong> aus demNeuen Testament. Der ZweiteWeltkrieg hinterließ auch an diesem Gebäude seine Spuren: Es wurdemehrfach beschädigt, so dass unter der Orgelempore eine Notkircheeingerichtet werden musste. Für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen 289Zivilisten und Soldaten aus dem Gemeindebereich legte Pfarrer Dr.Wilhelm Harnisch hinter der Kirche einen Notfriedhof an. Nachdem dasAreal 1979 geschlossen, 1983 eingeebnet und 1994 die Kriegsgräber nachHohenschönhausen umgebettet worden waren, befindet sich heute aufdem Gelände ein Spielplatz der Gemeinde-Kita.Von 1975 – 1990 war Rainer Eppelmann Gemeinde- und Kreisjugendpfarrer.Unter seiner Leitung fanden in der SamariterkircheVeranstaltungen statt, die Oppositionellen Raum für den freienGedankenaustausch und zur künstlerischen Entfaltung boten. Fernerengagierte sich die Gemeinde in der Friedensarbeit, wo sie sich aktiv mitFragen des Wehrdienstes, des Wehrkundeunterrichtes an den Schulenund der Friedenserziehung auseinander setzte. Daraus entwickelten sichdie Friedensdekaden und Friedenswochen, die in der Samariterkircheabgehalten wurden. Darüber hinaus ging die Gemeinde Friedenspartnerschaftenmit zahlreichen westdeutschen, West-Berliner undausländischen Gemeinden ein. Da der SED-Staat diese Aktivitätenmissbilligte, wurden Pfarrer Eppelmann und Mitglieder der Gemeinde28
von der Staatssicherheit überwacht und staatlichem Druck ausgesetzt.Auch die Jugendarbeit an der Samariterkirche betrachtete der Staat mitArgwohn. Stellvertretend seien hier die Bluesmessen genannt. NachdemPfarrer Eppelmann der Bitte des Musikers Günter Hollwas stattgegebenhatte, in der Kirche Bluesmusik zu spielen, fand am 1. Juni 1979 die ersteVeranstaltung dieser Art statt. Da Gottesdienste ohne Genehmigung derStaatsbehörden der DDR abgehalten werden konnten, entstanden ausder Verbindung von Musik und biblischen Texten die so genanntenBluesmessen. Bereits in der nächsten, nun offiziell als Bluesmesseangekündigten Veranstaltung am 13. Juni 1979 wurden in den MusikpausenTexte vorgetragen, die die unmittelbare Lebenswirklichkeit derJugendlichen in der DDR thematisierten. Auch die Predigten undSketche griffen verstärkt politische Tabuthemen auf. Dadurch fühltensich immer mehr Jugendliche angesprochen, so dass Tausende jungeFrauen und Männer, Christen und Nichtchristen aus dem gesamtenGebiet der DDR in die <strong>Friedrichshain</strong>er Samariterkirche strömten, diebald an die Grenzen ihrer Kapazität kam. Jedoch fühlten sich dieVertreter des Staates durch die von jungen Teilnehmern ausgesprochenenGedanken und Gefühle provoziert. Der SED-Staat hieltdiese Jugendlichen, die sich in Kleidung und Aussehen von der Mehrheitabhoben, für westlich-dekadent und feindlich gesinnt. Weil er negativeEinflüsse auf die Jugend der DDR befürchtete, nahm die Staatssicherheitdie wachsende Besucherschar der Bluesmessen verstärkt ins Visier. Auchdie Organisatoren der Bluesmessen, Pfarrer und Musiker wurden unterBeobachtung gestellt, einige auch zu Gefängnisstrafen verurteilt. Esfehlte auch nicht an Störaktionen, um die Bluesmessen zu verhindern.Mit der Verlegung dieser Gottesdienste in die Erlöserkirche nahm dieKirchenleitung Einfluss auf die Themen, die ihrer Meinung nach wiederreligiöser, weniger politisch werden sollten. Daraufhin entfernten sich dieBluesmessen in Inhalt und Ton von der Sprache der Jugendlichen,weshalb deren Interesse spürbar nachließ und sie den Veranstaltungenfernblieben. Im Jahre 1986 verschwanden schließlich die Bluesmessen,die zwanzigmal stattfanden, lautlos aus der Öffentlichkeit.Heute erinnert im Samariterviertel nichts mehr an diese aufregendeZeit der Rebellion und des Aufruhrs. Dass die Kirchengemeinde derinzwischen unter Denkmalschutz stehenden Samariterkirche auchweiterhin eine aktive Rolle spielt, zeigt sie in ihrem Engagement in derFlüchtlingshilfe, als Initiatorin der Gesprächsreihe „Interreligiöser29
Dialog“, in sozial-diakonischen Projektenund vielem anderen mehr.<strong>Die</strong> dritte evangelische Kirche, diehier vorgestellt wird, befindet sich inunmittelbarer Nachbarschaft zweierinnerstädtischer Friedhöfe in derFriedenstraße/Pufendorfstraße.Bereits vor der Entstehung desGotteshauses befand sich hier einArmenfriedhof, über den sich dieStadtverordneten mit der Kirchengemeindeeinigen mussten. Als dieZahl der Gemeindemitglieder der ander Weberstraße befindlichen St.Markuskirche weiter anwuchs,wurde ein Kirchenneubau immernotwendiger. Nachdem StadtbauratHerrmann Blankenstein den Grundriss für diese Kirche entworfen hatte,übernahm der Regierungsbaurat August Menken den Aufbau. AlsAuferstehungskirche wurde das Haus am 17. Mai 1895 eingeweiht.In den Jahren 1943 und 1945 trafen drei Fliegerbomben das Gebäude,so dass nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nur noch derausgebrannte Turmstumpf und die angeschlagenen Umfassungsmauerndes Kirchenschiffes stehen geblieben waren. Nach der Rekonstruktionder Turm- und Seitenwände wurde die Kirche am 14. Mai 1961 wiedereingeweiht. Da weitere finanzielle Mittel fehlten, konnte der Innenraumnicht neu gestaltet werden, der nun ohne die Emporen übermäßig hoch,kahl und kalt wirkte. Der Raum blieb schmucklos, verfügte jedochwieder über eine Orgel mit über 1.700 Pfeifen. Nach der Wende im Jahre1989 gab es verschiedene Vorschläge, die Kirche unter dem Eindrucksinkender Mitgliederzahlen für andere Vorhaben zugänglich zu machen.Schnell kam die Idee ins Gespräch, ein ökologisches Projekt an derAuferstehungskirche zu realisieren. Als die Senatsverwaltung fürStadtentwicklung 1998 5,4 Millionen DM aus dem Umweltförderprogrammbewilligte, begann im Jahre 2000 der Aufbau einesökologischen Zentrums. An Stelle des zerstörten Chorraumes wurdeunter ökologischen Gesichtspunkten ein viergeschossiger Glas-Stahl-Neubau errichtet. Am auffälligsten sind die Photovoltaikanlage und die30
Solarfassade, die die Energie der Sonne nutzen. Neben dem begrüntenDach wurde auch daran gedacht, das Regenwasser für den Betrieb einesSpringbrunnens aufzufangen. Seit 2002 sind die Auferstehungsgemeindeund das Umweltforum Berlin die Hauptnutzer dieser Kirche, die dengroßen Saal mit Orgel- und Seitenemporen zum einen alsGottesdienstraum und zum anderen als Veranstaltungs-, Tagungs- undMessezentrum nutzen.Ein Projekt ganz anderer Art entstand in der Friedhofskapelle in derBoxhagener Straße 99. Sie steht vor den Toren des 1867 eröffnetenFriedhofes der Georgen-Parochial-Gemeinde. Gustav Knoblauch, Sohndes Erbauers der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße, erbaute1879 die neoromanische turmlose Kapelle. Im Jahre 1937 wurde dasGebäude neugestaltet und nach der Wende umfangreich saniert. Heutefinden an diesem denkmalgeschützten Ort nur noch dienstagsTrauerfeiern statt. An den anderen Tagen ist hier das im Mai 2006eröffnete „Theater Transit“ zu Gast. Dessen Programme setzen sich vorallem mit dem Thema „Leben und Tod“ auseinander. Darüber hinausbeabsichtigen die Initiatoren, an diesem Ort Aufführungen gemeinsammit Schülern oder Veranstaltungsreihen mit Zeitzeugen zur <strong>Geschichte</strong>des Quartiers durchzuführen. Im Keller bietet der Musikclub„Bethlehem Basement“ Nachwuchskünstlern die Gelegenheit, sich zupräsentieren.In der Richard-Sorge-Straße erleben Besucher eine ganz besondereÜberraschung. Denn inmitten von Neu- und sanierten Altbauten stehteine kleine Holzkirche, die sich wie ein Fremdkörper von seinerUmgebung abhebt. Sie ist die Heimstatt der 1888 gegründetenmethodistischen Gemeinde. Seit 1895 hatte sie in einer auf demHinterhof der früheren Tilsiter Straße stehenden turmlosen KircheGottesdienste abgehalten, die mit ihrem sterngewölbten Emporensaal alsprächtigster und größter methodistische Kirchenbau Berlins galt. Docham 3. Februar 1945 schlug eine Bombe im Zweiten Weltkrieg auf demGelände ein und zerstörte das Gebäude. Mit Hilfe von Spendenamerikanischer Glaubensbrüder fertigte eine schwedische Firma einenhölzernen Serienbau mit fertiger Inneneinrichtung an, der jedoch durchdie verzögerte Baugenehmigung der Behörden erst 1948 aufgestelltwerden konnte. <strong>Die</strong>ses, als Notkirche errichtete Gotteshaus, nahm dieGemeinde am Ersten Weihnachtstag des Jahres 1948 feierlich in ihrenBesitz. Dass die Holzkonstruktion sich als nicht ungefährlich erwies,31
wurde bereits ein paar Tage später sichtbar: ein Brand hatte die Kirchestark beschädigt. Im Rahmen der 1973 ausgeführten Renovierung erhieltdie Kirche eine Orgel. Um das Provisorium zu beenden, plante dieGemeinde auf diesem Grundstück den Bau eines Gemeindezentrumsmit sozialen Einrichtungen. Weil jedoch die Kirche unterDenkmalschutz steht, erfüllten sich die Wünsche der Gemeinde nicht, sodass das Gebäude in seiner originalen Bauweise erhalten blieb. Sokönnen sich bis heute Besucher an der Einfachheit und der besonderenAkustik der Holzkirche erfreuen.Während die bereits erwähnten Einrichtungen auf eine lange<strong>Geschichte</strong> zurückblicken können, geht es jetzt um eine religiöseGemeinschaft, die noch nicht lange in <strong>Friedrichshain</strong> zu Hause ist.Es ist kaum vorstellbar, dass aus dem denkmalgeschützten Ensemblein der Kinzigstraße ein buddhistisches Zentrum entstehen soll. Doch mitviel Idealismus und großem Engagement bauen die ehrenamtlichenMitarbeiter die im Jahre 1860 errichteten kleinteiligen Häuser, Remisen,den früheren Pferdestall mit Gesindestube und Heuboden um. Dabeikommt ihnen die Kleinteiligkeit des Ensembles zugute, denn auf dieseWeise lässt sich die Sanierung in mehreren Bauabschnitten realisieren.Ob allerdings bis 2012 das geplante Kiezcafé, Büros, Seminar- undWohngebäude, Ausstellungsräume, Ateliers, ein Shop und ein Spielplatzfertiggestellt werden können, hängt davon ab, ob die Mitglieder, Freundeund andere bereit sind, mit Material- oder Geldspenden sowie alsehrenamtliche Mitarbeiter das Projekt zu unterstützen.Dass sich in <strong>Friedrichshain</strong> ganz unauffällig nichtchristlicheGemeinschaften etablieren, zeigt, wie offen und multikulturell dieserStadtteil inzwischen geworden ist. Es bleibt zu hoffen, dass auch inZukunft hier Christen, Gläubige anderer Religionen und areligiöseMenschen weiterhin friedlich miteinander leben.Angelica Hilsebein32
2. Von der „Magistrale Ostberlins“ zum„Tiergarten des Ostens“Von der St. Bartholomäuskirche in den Volkspark <strong>Friedrichshain</strong>Den Eingang in dieeinstige Georgenvorstadtund seit 1701so genannte Königsstadtbildet die aufeiner Anhöhe gelegeneSt. Bartholomäuskirche.<strong>Die</strong>Rückseite des Gotteshausesliegt in derGeorgenkirchstraße,wo es mit zwei weiterenEinrichtungenein „kirchliches Dreieck“bildet. An derEcke Friedenstraße befindet sich eine kleinechristliche Buchhandlung und wenige Schritteweiter erscheint das ehemalige EvangelischeMissionshaus und heutige Konsistorium, seit 1998Amtssitz des evangelischen Bischofs von Berlin-Brandenburg. <strong>Die</strong>se Gebäude gehören zu denwenigen Zeugnissen aus der Zeit des Kaiserreiches,während die sie umgebenden Wohnhäuser denWiederaufbau nach 1945 dokumentieren. Denn imZweiten Weltkrieg wurde nicht nur die der Straßeihren Namen gebende Georgenkirche zerstört,sondern auch das als düster beschriebeneMietskasernenviertel rund um die Barnimstraße. Eswurde in den 1970er Jahren durch Häuser imPlattenbaustil ersetzt. In diese Zeit fiel auch derAbriss des 1863/64 errichteten Frauengefängnisses.Heute erinnert die von Günter Junge 1977 geschaf-EvangelischeKirchengemeindeSt. BartholomäusAnschrift:Friedenstraße 110249 BerlinTel.: 030/24 11 405<strong>Die</strong> Kirchgemeindeunterhält ein Café Öffnungszeiten:Mi 15.00-17.00Do 14.00-18.0035 33
fene Rosa-Luxemburg-Gedenkstele in derWeinstraße vor allem an die berühmteInsassin Rosa Luxemburg. Dass ErichHonecker für kurze Zeit in diesemGefängnis inhaftiert war, ist wohl nurwenigen bekannt. Er floh am 6. März 1945aus der Haftanstalt und versteckte sich beieiner Wachtmeisterin in der LandsbergerStraße. Heute befindet sich auf demGelände der Haftanstalt ein Jugendverkehrsgarten.Auf dem Weg von der Friedenstraßezum heutigen Platz der Vereinten Nationenerfahren wir, wie die jeweiligen politischen Verantwortlichen dieGeschicke eines Ortes lenkten. <strong>Die</strong> DDR maß der Gestaltung desPlatzes und der Straße eine ebenso große Bedeutung bei wie einige Jahrezuvor der Frankfurter Allee. Deshalb standen für beide Straßensowjetische Namensgeber Pate: <strong>Die</strong> Frankfurter Allee wurde zurStalinallee und die zweite große Achse hieß künftig Leninallee mit demdazugehörigen Leninplatz. Nachdem Heinz Mehlan und seineMitarbeiter 1968-1970 den Platz nach Entwürfen HermannHenselmanns bebaut hatten, schuf der sowjetische Bildhauer NikolaiTomski ein neunzehn Meter hohes Lenindenkmal aus rotemukrainischem Granit. Es wurde am 20. April 1970 eingeweiht. ImGegensatz zu dem 1961 eingeschmolzenen Stalindenkmal in derheutigen Karl-Marx-Allee blieb das Lenindenkmal bis zur Wende aufseinem Platz stehen. 1991 beschloss der Senat, das denkmalgeschützteMonument zu beseitigen. Daraufhin erfolgte am 8. November unterheftigen Protesten die Demontage. Ein Jahr später wurde der Leninplatzin Platz der Vereinten Nationen und die Leninallee wieder inLandsberger Allee umbenannt. Nach dem Abriss des Denkmals wurdeder Platz neu gestaltet: Ein Brunnen aus fünf Granitblöcken symbolisiertdie fünf Kontinente. Der eine oder andere Zuschauer mag später mitWehmut an vergangene Zeiten gedacht haben, als es in dempreisgekrönten Film noch einmal „Goodbye Lenin“ hieß.Eine wirkliche Renaissance erfuhr das aus dem 19. Jahrhundertstammende Umspannwerk in der Palisadenstraße. An diesem Ort erlebendie Besucher heute spannende Abende im Kriminaltheater36
oder genießen kulinarischeStunden imRestaurant.In der Palisadenstraßeist auch dieSeniorenfreizeitstätteder Arbeiterwohlfahrtzu Hause. Hiertreffen sich ältereMenschen, um gemeinsamzu essen, zuspielen, sich zu unterhaltenoder kulturelleAngebote wahrzunehmen.Beim Überqueren der Friedenstraße in RichtungWeidenweg fällt der Blick auf einen Turmstumpf,der in der Pufendorfstraße hinter den Dächern derUmgebung und den Bäumen des Friedhofeshervorlugt. Erst bei genauerem Hinsehen könnenwir das „Umweltforum Auferstehungskirche“ mitdem Glas-Stahl-Neubau erkennen.Unverändert blieb dagegen die kleine Holzkircheder evangelisch-methodistischen Gemeinde in derUmspannwerk OstAnschrift:Palisadenstraße 4810243 BerlinTel.: 030/42 08 93 23 Internet:www.umspannwerkost.deSeniorenfreizeitstätteder <strong>AWO</strong><strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong> e.V.Anschrift:Palisadenstraße 4610243 BerlinTel.: 030/420 16 777UmweltforumBerlinAuferstehungskircheAnschrift:Pufendorfstraße 1110249 BerlinTel.: 030/41 72 42 0 Internet:www.umweltforumberlin.deRichard-Sorge-Straße. Wer die besondere Akustikund die schlichte Atmosphäre des Gotteshauseserleben will, ist zu einem Besuch herzlicheingeladen.37
EvangelischmethodistischeKirche(Christuskirche)Anschrift:Richard-Sorge-Straße14/1510249 BerlinTel.: 030/28 27 672 Internet:www.holzkirche.deTilsiter LichtspieleAnschrift:Richard-Sorge-Straße25a10249 BerlinTel.: 030/4 26 81 29 Internet:www.tilsiterlichtspiele.deSport- undErholungszentrum(SEZ)Anschrift:Landsberger Allee 7710249 BerlinIn unmittelbarer Nachbarschaft zur Christuskirchebefindet sich ein sehr unscheinbaresLichtspielhaus. Es wurde 1910 als kleines Kino imErdgeschoss der einstigen Tilsiter- und heutigenRichard-Sorge-Straße 25A gegründet. Nach derEröffnung des Kinos Kosmos in der Karl-Marx-Allee schloss das Tilsiter Kino 1961 seine Pforten.Im Jahre 1994 eröffnete das von einem kleinenVerein in Eigeninitiative betriebene TilsiterLichtspielhaus wieder. Hier werden jeden Abendca. 60 Zuschauern seltene, anspruchsvolleArthouse- und Dokumentarfilme gezeigt. Daskleine Café lädt die Besucher ein, sich auf denjeweiligen Film einzustimmen oder den Abendnach dem Filmerlebnis ausklingen zu lassen. In derRichard-Sorge-Straße/ Landsberger Allee hinterlassendie Ruinen der ehemaligen PatzenhoferBrauerei (siehe Aufsatz über industrielle Gebäude)einen traurigen Eindruck, denn sie warten nochimmer auf einen finanzkräftigen Investor.Ein besseres Schicksal ist hoffentlich dem SportundErholungszentrum (SEZ) an der Landsberger/DanzigerStraße beschieden. <strong>Die</strong>serSportkomplex wurde in den Jahren 1978-1981unter der Gesamtleitung von Erhardt Gißke mitBeteiligung ausländischer Firmen erbaut und vonErich Honecker am 20. März 1981 als erstesSpaßbad der DDR eröffnet. In seiner Dankesrede38
erwähnte Honecker allerdings nicht, dass dieses Gebäude sowie dessenInnengestaltung von einem westlichen Architekten konzipiert wordenwar. Im Mittelpunkt dieses dreigliedrigen Baukörpers stand dieSchwimmhalle mit dem ersten Wellenbad der DDR. Ein besonderesHighlight war der Wellentreff, wo Besucher in Badekleidung einenImbiss einnehmen konnten. Ein Kanal verband die Halle mit demAußenschwimmbecken, einer ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt in derDDR unbekannten Attraktion. Hobby- und Leistungssportler konnten ineiner Eissporthalle, in einer 1200 m 2 großen Halle für Ballsportarten, undauf einer Bowlinganlage trainieren. Darüber hinaus boten SportmedizinerBeratungen und Untersuchungen an. Als sich die DDR demneuesten Trend aus den USA, der Aerobic, nicht länger entziehenkonnte, nahm sie die Sportart unter dem Namen „Popgymnastik“ in ihreim SEZ gedrehte Sendung „Medizin nach Noten“ auf. Nach der Wendeschien das Ende des Erholungszentrums besiegelt. Nachdem jedoch fürdas seit 2001 geschlossene SEZ ein Investor gefunden wurde, erfolgt dieschrittweise Sanierung des Geländes. Inzwischen können ein Bowling-Center und eine Ballspielhalle wieder besucht werden, weitere Vorhabensollen folgen.<strong>Die</strong> Außenanlage des SEZ ist Teil des Volksparks <strong>Friedrichshain</strong>, demHerzstück des Stadtteils. Er entstand in den 1840er Jahren alsGegenstück zum Tiergarten. 1874/75 und 1923 wurden im Volksparkein Spiel- und Sportplatz, ein Teich und eine Spielwiese angelegt. Baldentwickelte sich der Park zur größten Grünfläche im Osten Berlins, wosich die <strong>Friedrichshain</strong>er gegen ein geringes Entgeld erholen konnten.Allerdings entzog der Bau des 1874 eingeweihten Krankenhauses<strong>Friedrichshain</strong> ein Fünftel der Gesamtfläche des Parks. 1941 wurde imVolkspark ein Flakturm errichtet, um hier das Bergungsgut aus denBerliner Museen zu lagern. Nach dem Krieg wurde der Trümmerschuttin den Volkspark gebracht und über den Mauern des Flakturmesabgeladen. Auf diese Weise entstanden der kleine und der großeBunkerberg. Der so genannte „Mont Klamott“ stellt mit seinen 78 m diehöchste Erhebung im Stadtteil dar. 1969/73 wurden die Wege fürMassenveranstaltungen, wie z. B. das Pressefest des Neuen Deutschlands,asphaltiert und verbreitert. Seit 1991 wurde der Volkspark Schrittfür Schritt neu gestaltet. Inzwischen können die <strong>Friedrichshain</strong>er undandere Anwohner sich auf einer Skatebahn sportlich betätigen, imSommer Filme im Freiluftkino sehen und sich an einer erneuerten Teich-39
und Bachanlage erholen. Darüber hinaus finden Veranstaltungen undFeste statt, wie z. B. das im Jahre 2006 zum neunten Mal ausgetrageneund von der <strong>AWO</strong> <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong> e. V. mitorganisierte„Lesbischwule Parkfest“. Auch der Namesgeber hat wieder einenwürdigen Platz im Park gefunden. Obwohl die von Christian D. Rauchgeschaffene Büste Friedrichs II. im Krieg unversehrt geblieben war,verschwand sie 1952 spurlos. Im Jahre 1997 fanden Mitarbeiter desGrünflächenamtes Teile des Denkmal wieder, so dass der SteinbildhauerAndreas Hoferick die Büste nach historischen Vorlagen restaurierenkonnte. Anlässlich des 150. Jahrestages des Volksparks im Jahre 1998wurden Skulpturen und Plastiken verschiedener Künstler im Volksparkaufgestellt, wie beispielsweise die „Große Stehende auf einem Bein“, die„Sitzende mit aufgestütztem Arm“ oder die „Bedrohte“.Außerdem erinnern zwei Mahnmale an die Zeit bewaffneter Kämpfe.Ein deutsch-polnisches Künstlerkollektiv gestaltete das auf einer leichtenErhebung im nordöstlichen Teil des Volksparks errichtete Denkmal despolnischen Soldaten und des deutschen Antifaschisten. Das von FritzCremer und Siegfried Krepp geschaffene Ehrenmal am südwestlichenRand des Volksparks ist den mehr als 3000 im Spanischen Bürgerkriegauf der Seite der Republik gefallenen Deutschen gewidmet.An die Toten der Revolutionen von 1848 und 1918 erinnert derFriedhof der Märzgefallenen, der sich ebenfalls auf dem Gelände desVolksparks in der Nähe des Krankenhauses befindet. Hier sind noch 18steinerne Grabplatten, eine Stele und drei eiserne Grabkreuze sowie zweigusseiserne Grabdenkmäler zu sehen. Seit 1948 steht ein Gedenksteinmit den Namen der 254 Toten der Märzgefallenen im Zentrum desFriedhofes. Für die in der Novemberrevolution gefallenen Soldatenschuf Hans Kies 1960 die überlebensgroße Bronzefigur „RoterMatrose“, die leicht versteckt an der äußeren Begrenzungsmauer steht.<strong>Die</strong> „Initiative 1848“ setzt sich heute für die Sanierung der Anlage ein,damit dieser wichtige historische Zeitabschnitt nicht in Vergessenheitgerät.Den westlichen Ein- und Ausgang des Parks, der zugleich denRundgang beschließt, bildet der 1913 nach Entwürfen LudwigHoffmanns eingeweihte Märchenbrunnen. <strong>Die</strong> von Ignatius Taschnergeschaffenen zehn Figuren Grimmscher Märchen werden nach dermutwilligen Zerstörung zurzeit aus französischem Muschelkalkstein neugehauen. Ferner ist vorgesehen, die Anlage des Wasserbeckens wieder40
zum Sprudeln zu bringen. Es ist zu hoffen, dass der Märchenbrunnenvor weiterer Zerstörung und Bemalung bewahrt bleibt, damit es nichtheißt: „Es war einmal.“A. H.Jugendklub KoCaAn dieser Stelle verweisen wir auf eine Einrichtung, die sich ganz speziellan Jugendliche im Alter von 13-21 Jahren richtet.Bereits zu DDR-Zeiten gab es in der Büschingstrasse den„Büschinglub“. Im Jahre 2004 zog der Jugendklub von derBüschingstrasse in die Landsberger Allee 15. Im April 2005 nahm er diekleine Villa mit großem Garten direkt am Volkspark <strong>Friedrichshain</strong>feierlich in seinen Besitz.In diesem idyllischem Ambiente können junge Leute in der Halle oderim Garten Sport treiben, drinnen Billard und Kicker oder draußenTischtennis und Basketball spielen, einen zehn Meter hohen Kletterturmbesteigen, Computer und Internet nutzen sowie im Sommer grillen undam Lagerfeuer sitzen. Darüber hinaus kann man sich an einemGraffitiprojekt künstlerisch betätigen, an einem Schlagzeugkurs und anTurnieren teilnehmen, Themenveranstaltungen besuchen oder einfachnur Partys feiern.Der Jugendklub hat montags, dienstags, donnerstags und freitags von15 bis 21 Uhr und mittwochs von 14 bis 20 Uhr geöffnet.Adresse: Landsberger Allee 15, 10249 Berlin, Kontakt: 030/93 95 52 90, Internet: www.koca-berlin.de41
3. Das SamariterviertelVom S-Bahnhof Frankfurter Allee zum BersarinplatzDen dritten Rundgang beginnen wir am S-BahnhofFrankfurter Allee. Wenn man aus der S-Bahnaussteigt, kann man an kleinen hübschenRestaurants und Geschäften vorbei entweder dieFrankfurter Allee hoch den Großstadtflair dervierspurigen Straße genießen oder sich diePettenkoferstraße entlang in das sanierte ruhigeSamariterviertel begeben. Gleich in der Nähe der S-Bahnstation in der Pettenkoferstraße befindet sichein bekannter Veranstaltungsort, das K 17, in demauf drei Etagen, in einer Halle und einem HofBands auftreten. Doch wir scheuen nicht denAutolärm und gehen die Frankfurter Allee entlangin Richtung Frankfurter Tor zuerst zu dem kleinenK 17Anschrift:Pettenkofer Straße 17a10247 BerlinTel.: 030/42 08 93 00 Internet:www.k17.deTheater „Verlängertes Wohnzimmer“. <strong>Die</strong>sesTheater bietet circa 60 Personen Platz und wurdevon Schauspielern, Varietékünstlern, Jongleurenund Kabarettisten gegründet, die nebenberuflichhier tätig sind. Das Theater bietet einabwechslungsreiches Programm. Weiter inRichtung Frankfurter Tor, im zweiten Hinterhofder Frankfurter Allee 53, befindet sich in einertopsanierten Fabrik die Kulturbar Oxident in demGebäude „La Fabrik“. Über 10 Jahre ist es her,VerlängertesWohnzimmerAnschrift:Frankfurter Allee 9110247 BerlinTel.: 030/47 30 69 94 Internet:www.verlaengerteswohnzimmer.de43
La Fabrik mitOxident Bar(Kulturbar)Anschrift:Frankfurter Allee 53,2. HH10247 BerlinTel.: 030/420 870 99(Di 16.00-18.00) Internet:www.lafabrik.de ÖffnungszeitenDi-Sa ab 19.00 UhrKulturprogramm ab21.00 UhrSpektrale 2006 Internet:www.sprektrale.orgdass die baufällige Fabrik in Künstlerateliersumgebaut wurde und das Haus für Kunst, Kulturund Begegnung entstand. Seitdem bietet „LaFabrik“ viele unterschiedliche Veranstaltungen an.„La Fabrik“ gehörte im Jahr 2006 auch zu denVeranstaltungsorten des Kunst- und Kulturtags für<strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong>, der „Spektrale“, diejährlich Anfang September in <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong>tattfindet. An diesem Tag werden in ganz<strong>Friedrichshain</strong> Veranstaltungen und Ausstellungenaus den Bereichen Kunst, Fotografie, Theater, Filmund Tanz, Kleinkunst und Literatur, Musik undClubs angeboten.<strong>Die</strong> Frankfurter Allee, auf der wir weiter inRichtung Frankfurter Tor spazieren, ist diewichtigste Ost-West Verbindung und Einkaufsstraße<strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong>. Hier befinden sich das RingCenter I und II, das Frankfurter Allee Plaza unddie Rathaus-Passage. <strong>Die</strong> Allee beginnt an derLichtenberger Brücke und endet an der KreuzungPetersburger-, Warschauer Straße an den beidenTürmen des Frankfurter Tors. Im Mittelalter führtebereits eine Heerstraße gen Osten hier in RichtungFrankfurt Oder. Ab 1824 war ihr NameFrankfurter Chaussee. Von 1872 bis 1950 hieß sieFrankfurter Allee, war dann Teil der Stalinallee undwurde 1961 wieder in Frankfurter Allee um-44
enannt.Das nächste sehenswerte Gebäude in derFrankfurter Allee ist die Rathauspassage. Hierbefinden sich das Rathaus von <strong>Friedrichshain</strong><strong>Kreuzberg</strong>, eine Abteilung der Volkshochschuleund ein Bürgerbüro. Seit 1996 ist dieses GebäudeSitz des Bezirksamts <strong>Friedrichshain</strong>. Im Jahr 2000brachte ein Münzwurf die Entscheidung für denneu fusionierten Bezirk <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong>,das Gebäude zum Standort des Rathauses desBezirks zu wählen.<strong>Die</strong> Volkshochschule <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong>bietet ein breit gefächertes Angebot an. ImProgrammbereich „Kultur und Gestalten“ könnenInteressierte Workshops sowie Kurse zur Kunst,Literatur und Theater besuchen. Wer sich fürZeichnen, Malen, Grafik und Bildhauerei begeistert,findet hier viele Anregungen.Auch aus den Bereichen Bildhauerei, Keramikund Kunsthandwerk gibt es Veranstaltungen.Fotografie, Tanz, Schauspiel und Musik gehörenebenfalls zum Programm.Würden wir den Rundgang weiter in RichtungFrankfurter Tor fortsetzen, kämen wir an derProskauer Straße vorbei, in der sich das Frieda-Frauenzentrum befindet. Das Frauenzentrumbesteht seit 1990 und bietet ein breites Spektruman Kommunikations-, Beratungs- und Bildungsangeboten.Zwischen Proskauer Straße und Frankfurter Torist die Allee durch einen Grünstreifen und einenbreiteren Fußgängerweg erweitert. Hier beginnt dervon 1953 bis 1958 erbaute Teil der Stalinallee.Mehrere Häuser stehen unter Denkmalschutz.Gedenktafeln erinnern an die <strong>Geschichte</strong> derStraße.<strong>Die</strong> Sanatorium 23 Bar in der Frankfurter Allee23, einer Mischung aus Bar, Club und Restaurant,Bezirksamt<strong>Friedrichshain</strong>(Rathaus mitBürgeramt und VHS)Anschrift:Frankfurter Allee35/3710247 BerlinTel./Bezirksamt:030/90298-0Tel./Bürgeramt:030/90298-4687/-4688Tel./VHS: 030/90298-4600/01/02/03Sprechzeiten:Bürgeramt:Mo 8.00-15.00Di und Do 11.00-18.00Fr 8.00-13.00FriedaFrauenzentrum e.V.Anschrift:Proskauer Straße 710247 BerlinTel.: 422 42 76 Internet:www.friedafrauenzentrum.de Öffnungszeiten:Mo geschlossenDi/Do 9.00-20.00Mi 9.00-18.00(Gruppentag)Fr 14.00-20.00Jeden 1. und 3. Sa11.00-14.0045
Sanatorium 23 BarAnschrift:Frankfurter Allee 2310247 BerlinTel.: 030/42 02 11 93 Internet:www.sanatorium23.de Öffnungszeiten:Mo-So ab 14.00Jersey-Bar„Lauschangriff“Anschrift:Rigaer Straße 10310247 BerlinTel.: 030/42 21 96 26 Internet:www.lauschangriffberlin.deGalerie „Barriqueund Leinwand“Anschrift:Rigaer Straße 7010247 BerlinTel.: 030/421 05 210 Internet:www.barriqueleinwand.de Öffnungszeiten:Di-Fr 16.00-20.00Sa 14.00-18.00und nachVereinbarungist ein weiterer Ort kultureller Veranstaltungen<strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong>. Hier werden unter anderem auchFilme gezeigt.Doch wir biegen in die Rathauspassage ein, demSitz der Bürgermeisterin oder des Bürgermeistersvon <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong>.In der Passage weist ein Schild auf dasBürgerbüro des Stadtteils hin. Hier kann manAuskunft und Hilfe bei vielen amtlichen Angelegenheitenerhalten.<strong>Die</strong> Rathauspassage durchqueren wir bis zurRigaer Straße und sind nun im Samariterviertel.Das Samariterviertel wird im Osten von der S-Bahnlinie, im Norden von der Eldenaerstraße, imSüden von der Frankfurter Allee und im Westenvon der Petersburger Straße eingegrenzt. Benanntwurde es nach der Samariterkirche, die auf einerAnhöhe in der Mitte des Viertels zu sehen ist.Wir stehen nun in der Rigaer Straße vor der1901/02 erbauten Heinrich-Hertz-Oberschule. Eshandelt sich hier um eine Dreiflügelanlage miteinem kleinen Dachturm. Zur Zeit der DDR galtdie Schule als Eliteschmiede im mathematischennaturwissenschaftlichenBereich. Zu den Absolventengehörten neben angehenden Mathematikernauch die spätere Rocksängerin Tamara Danz undder Politiker und Rechtsanwalt Gregor Gysi.In der Rigaer Straße befindet sich die Jersey-Bar„Lauschangriff“ und die Galerie „Barrique undLeinwand“. <strong>Die</strong> Galerie verbindet Weingenuss undKunst. Es werden Abendkurse für Malerei, Grafik,Zeichnen und Fotografie angeboten.Unser Rundgang führt uns in RichtungSamariterstraße, in die wir links einbiegen und ander Schreinerstraße vorbei eine kleine Anhöhehinauf zum Samariterplatz mit der Samariterkirchegehen. Ein Blick in die Schreinerstraße zeigt unseine wunderschöne, frisch sanierte Wohngegend.46
In den letzten Jahren wurden die Altbautenumfangreich umgebaut, so dass aus sehrheruntergekommenen Häusern und Hinterhöfeneine freundliche, gutbürgerliche Wohngegend inder Schreiner- und Bänschstraße entstanden ist.<strong>Die</strong> Samariterkirche mit ihrem 60 m hohenTurm ist die wichtigste Sehenswürdigkeit desViertels. <strong>Die</strong> Backsteinkirche wurde imneogotischen Stil märkischer Prägung erbaut. ImJahr 1894 weihte die Deutsche Kaiserin undKönigin von Preußen, Auguste Viktoria, im Volk„Kirchenguste“ genannt, das Gotteshaus ein. ImZweiten Weltkrieg wurde das Gebäude mehrfachbeschädigt. Erst Ende der 1980er Jahre setzte mandie Kirche vollkommen instand. Überregionalbekannt wurde die Kirche durch die in den 1980erJahren in der DDR stattfindenden Bluesmessenunter Pfarrer Rainer Eppelmann. Heute werden inder Kirche neben den regelmäßig stattfindendenGottesdiensten und Gemeindeaktivitäten Konzerteveranstaltet, Ausstellungen präsentiert und esfinden Diskussionsveranstaltungen in der Kirchestatt.Nachdem wir dieKirche besichtigthaben, führt unserRundgang auf derbaumbestandenenMittelpromenade dieBänschstraße entlangin Richtung Forckenbeckplatz.Hier befindetsich ein Kinderspielplatzund einegroße Rasenfläche undPlantsche, an derenRand zwei Elefanten stehen. Am südwestlichenZipfel ist die 1970 von Erwin Damerow geschaf-EvangelischeGaliläa-Samariter-KirchengemeindeAnschrift:Samariterstraße 2710247 BerlinTel./Gemeindebüro:030/42 67 775 Internet:www.samariterkircheberlin.deHinweis:<strong>Geschichte</strong> der Blues-Messen (DVD) im<strong>Kreuzberg</strong>-MuseumAdalbertstr. 95 A,10999 Berlin erhältlich47
fene bronzene Plastik „Junges Paar“ zu sehen. Neueröffnet wurde das im chinesischen Pavillonstilerbaute Lehmhaus für Jugendliche.Musikschule<strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong>Anschrift:Zellestraße 1210247 BerlinTel: 030/42 67 655 Internet:www.ms-fk.deSprechzeiten:Do 16.00-18.00Südlich des Forckenbeckplatzes in derZellestraße 12 ist die <strong>Friedrichshain</strong>er Abteilungder Musikschule <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong> angesiedelt.Hier wurden zahlreiche namhafteRockmusiker der DDR unterrichtet wie <strong>Die</strong>ter Birrvon den Puhdys, Uschi Brüning, Tamara Danz vonder Band Silly, Herbert Dreiling, Mitglied der BandKarat, Peter Gläser von der Gruppe Renft undToni Krahl von der Band City.Nördlich des Forckenbeckplatzes, nicht mehrzum Bezirk <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong> gehörend, liegt dasGelände des ehemaligen Schlachthofes EldenaerStraße, der in dem Roman von Alexander Döblin,Berlin Alexanderplatz in der Schlachthofszeneverewigt wurde. Um an die Schlachthöfe zuerinnern, wurde das Stahlgerüst der altenHammelauktionshalle konserviert und wiederaufgestellt. Zusätzlich entstand hier ein neuer Park,der nach dem bekannten Berliner ArchitektenHermann Blankenstein benannt wurde. Er entwarfdie Alte Feuerwache und die Auferstehungskirchein <strong>Friedrichshain</strong> sowie viele Schulgebäude undMarkthallen wie zum Beispiel die <strong>Kreuzberg</strong>erMarheinekehalle und die Eisenbahnhalle. Den48
Forckenbeckplatz hinter uns lassend gehen wir nunden Weidenweg in Richtung Bersarinplatz. Auf derlinken Seite im Hinterhof der Nummer 62 sehenwir die bunt bemalte Begegnungsstätte fürKindheit e.V. „Das Haus“, in dem verschiedenekulturelle Projekte wie z.B. das Tanzstudio unddiverse Beratungsstellenangesiedeltsind. Vor über 10Jahren hattenKünstler die Idee,Kindern und Jugendlichenmitihren Mitteln zuhelfen. <strong>Die</strong>se Ideerettete das Hausvor dem Abriss.Es wurde saniertundfarbenfrohgestaltet.Inzwischen habensich hier vieleProjekte angesiedelt,und es werden sogar Volkshochschulkurseangeboten. Im Café Parterre kann man sich hier ingemütlicher Atmosphäre aufhalten.Nicht weit von „Das Haus“ entfernt liegt derBersarinplatz. 1947 wurde er nach dem sowjetischenStadtkommandanten von Berlin, NikolaiBersarin, benannt, der sich um die Wiederherstellungder Versorgung und des öffentlichenLebens nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlinverdient gemacht hat und auf tragische Weise beieinem Motorradunfall 1945 ums Leben kam. Amehemaligen Rathaus <strong>Friedrichshain</strong> in derPetersburgerstraße 86-90 ist eine Bronzetafel mitdem Reliefportrait des Ehrenbürgers von Berlinangebracht.Das Haus-Begegnungsstättefür Kindheit e.V.Anschrift:Weidenweg 62, HH10247 BerlinTel.: 030/42 67 749 Internet:www.dashauskindheit.de49
Nun ist unser Rundgang fast zu Ende und wir gehen zur U-Bahnstation Frankfurter Tor. Im Hauseingang der Petersburgerstraße 94weist eine Gedenktafel auf das SA-Keglerheim hin, das zumHauptquartier des SA-Sturms 5 wurde, zu dessen Anführern HorstWessel gehörte, nach dem im Dritten Reich der Bezirk <strong>Friedrichshain</strong>benannt war (siehe Aufsatz zur <strong>Geschichte</strong> <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong>). AmFrankfurter Tor ist unser Rundgang zu Ende und wir können nachdiesem langen Spaziergang unseren Nachhauseweg mit der U-Bahnantreten.R. K.Jugendklub Liebig 19Jugendliche in diesem Viertel sind herzlich eingeladen, im JugendklubLiebig 19 – der Name ist gleich die Adresse – Billard und Tischtennis zuspielen oder Fußball in der zur Grundschule gehörenden Turnhalle zutrainieren. Zweimal in der Woche übt eine Jazzdancegruppe. Darüberhinaus gibt es einen Schlagzeug- und Gitarrenkurs, Fotoprojekte mitAusstellungen und Homepagegestaltung. Für Bands verschiedenerMusikrichtungen vergibt der Jugendklub Proberäume.Hier kann man aber auch im Internet surfen, chatten, nette Leutekennen lernen, Musik hören und quatschen.Der Jugendklub ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 14 bis21 Uhr und am Freitag von 15 bis 21 Uhr geöffnet.Adresse: Liebigstr. 19, 10247 Berlin, Kontakt: 030/44 72 83 231, Internet: http://home.snafu.de/jfe.liebig19/50
4. „Det is Zille sein Milljöh“?Für unseren vierten Rundgang suchen wir zunächstden Ort auf, der maßgeblich zur industriellenEntwicklung <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong> beitrug und denCharakter dieses Viertels zwischen LichtenbergerStraße und Warschauer Straße prägte, der zwischender heutigen Straße der Pariser Kommune und derKoppenstraße gelegene Ostbahnhof.<strong>Die</strong>ser 1842 eingeweihte Bahnhof entwickeltesich zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkteim Osten Berlins und erhöhtedadurch nicht nur die Mobilität der Bewohner,sondern auch die Attraktivität des Standortes<strong>Friedrichshain</strong> für Unternehmer.<strong>Die</strong> immer stärker werdende Bedeutung desVerkehrsmittels Eisenbahn spiegelt dasErscheinungsbild und die Namensgebung desBahnhofs wider: Hieß er 1842 noch FrankfurterBahnhof, erhielt er 1881 mit dem Anbau einerzweiten neuen Halle den Namen „SchlesischerBahnhof“. Ende des 19. Jahrhunderts konnte derBahnhof das steigende Fahrgastaufkommen undden Gütertransport nicht mehr allein bewältigen.Deshalb wurde 1896/97 der Wriezener Bahnhofgebaut, dessen Gelände nach dem Abriss derPostbahnhofAnschrift:Straße der PariserKommune 3 - 1010243 BerlinTel./Booking:030/69 81 28 14 Internet:www.postbahnhof.de53 51
Fritzclub imPostbahnhofAnschrift:Straße der PariserKommune 3 - 1010243 BerlinTel.: 030/69 81 28-0 Internet:www.fritzclub.comGebäude zu einer Grünfläche umgestaltet werdensoll.Nach der Zerstörung des Bahnhofes im ZweitenWeltkrieg nahm er 1950 seinen Betrieb unter demNamen „Ostbahnhof“ wieder auf. Der Bau einerneuen Empfangshalle in den späten 1980er Jahrenund der Namenswechsel in „Hauptbahnhof“bewies die wachsende Bedeutung des Bahnhofs alsbedeutendste Bahnstation im Osten der Stadt.Doch im wiedervereinten Berlin übt der<strong>Friedrichshain</strong>er Bahnhof nicht mehr die zentraleFunktion aus wie vor 1990. Infolgedessen wurdeder Bahnhof im Mai 1998 wieder in Ostbahnhofumgenannt.Vis-à-vis der Eingangshalle des Ostbahnhofesbefand sich eines der bedeutendsten Postämter desDeutschen Reiches. In diesem zwischen 1904 und1908 errichteten Gebäude wurde die aus denöstlichen und westlichen Provinzen ankommendePost verteilt und an ihre Bestimmungsorteverschickt. Als Ende des 19. Jahrhunderts derPostbahnsteig und die Packkammer im östlichenBahnhof die Grenzen ihrer Kapazität erreichten,wurde 1907/08 eine neue Ankunftspackkammerdes Postamtes errichtet. Das historische, im Stil dermärkischen Backsteingotik erbaute Postgebäude inder heutigen Straße der Pariser Kommune wurdeebenfalls im Zweiten Weltkrieg zerstört, spätervereinfacht wieder aufgebaut. Im August des Jahres2000 zog die Poststelle in das neueEmpfangsgebäude des Ostbahnhofes. Der alte,unter Denkmalschutz stehende Postbahnhof wurdedanach zu einem Gebäudeensemble umgebaut, dasheute den Fritzclub, die Gleishalle und dieEinpackkammer beherbergt. <strong>Die</strong>se Räumlichkeitenkönnen einzeln oder kombiniert für Messen,Empfänge, Partys, Festveranstaltungen, Workshops,Tagungen und Konzerte gemietet werden.54
Ehe wir das Areal rund um den Ostbahnhofverlassen, möchten wir noch auf einen ganzbesonderen Markt aufmerksam machen. Hinterdem Bahnhofsgelände kann man jeden Sonntag aufdem Flohmarkt nach Raritäten Ausschau haltenund die eine oder andere Antiquität erwerben.Jetzt nähern wir uns dem Karree zwischen derLichtenberger Straße und der Straße der PariserKommune. Obwohl hier die meisten Häuser imZweiten Weltkrieg zerstört wurden, entdeckt manbei genauerem Hinsehen das eine oder andere alteBauwerk, wie z: B die 1908 errichtetenVerwaltungs- und Fabrikgebäude der Julius PintschAG in der Andreasstraße 71-73.<strong>Die</strong>ses Industriedenkmal, das den Kriegunbeschadet überstanden hat, zeugt vom AufstiegJulius Pintschs zu einem der führenden Herstellerfür Gasgeräte und Gasbeleuchtungsanlagen.In einem weiteren, vom Krieg verschontenAltbau in dieser Straße befindet sich das CuevaBuena Vista. Mit ein wenig Glück kann man dielegendären Musiker des Buena Vista Social Cluberleben, die hier regelmäßig auf ihren Konzerttourneenzu Gast sind. Doch auch ohne dieberühmten Musiker ist der Club mit seinenoriginalen kubanischen Speisen und Getränkensowie lateinamerikanischer Musik immer einenBesuch wert. Wer will, kann hier auch Salsa tanzenlernen.Das einst von dem Maler und Zeichner HeinrichZille dargestellte „Milljöh“ in der unmittelbarenUmgebung des Ostbahnhofs existiert nicht mehr.Es wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Zille, derin einer Kellerwohnung in der kleinenAndreasstraße 17 wohnte, erlebte hier, wie vieleseiner Zeitgenossen die Schattenseiten desindustriellen Aufstiegs Deutschlands. In seinenErinnerungen gibt er die Lebens- und Wohnsitua-Cueva Buena VistaAnschrift:Andreasstraße 6610243 BerlinTel.: 030/24 08 59 51 Internet:www.cueva-buenavista.de Öffnungszeiten:Tgl. ab 17.00-open endTgl. ab 20.00TanzkurseFr und Sa ab 22.00-open end DiscotecaLatina55
tion in den Wilhelminischen Mietskasernenvierteln mit folgendenWorten wider: „Zusammengepfercht in hohe Mietskasernen, mitschmalen ungelüfteten Treppen. Elende Zufluchtsorte in nassen Kellernund über stinkenden Ställen, ohne Luft und Sonne. Man kann mit einerWohnung einen Menschen genauso gut töten, wie mit einer Axt!“An das Arbeitermilieu erinnertheute das Denkmal „Vater undSohn“, das Wilhelm Haverkamp1898 schuf und vor derAndreasstraße 21 A steht. Es istdas letzte Zeugnis derDenkmalskunst des Kaiserreiches.Hammer, Schmiedeschürzeund Mütze des Vatersweisen ihn als typischen Handwerkeraus, der an seinen Sohn die Berufstradition weitergibt.Ursprünglich gehörte zu dieser Gruppe auch eine „Muttergruppe“, diejedoch seit 1960 im Volkspark <strong>Friedrichshain</strong> steht. Am dichtestenwaren die Straßen um den einstigen Küstriner, dem heutigen Franz-Mehring-Platz bebaut. Von dem hier 1867 errichteten Bahnhof fuhr bisin die 1920er Jahre eine Bahn nach Küstrin. Nach der Einstellung desBahnbetriebes unterhielt das 1929 eröffnete Plaza in der riesigen Halledes Bahnhofs einen Tanzsaal und ein Restaurant. Ob das Etablissementals eines der größten Varietés Europas in den Krisenjahren dieBewohner von ihrem Elend abzulenken verstand?Nachdem auch dieses Viertel im Zweiten Weltkrieg fast vollständigzerstört worden war, erfolgte der Aufbau in mehreren Etappen. ImGegensatz zu den ersten Häusern, die Ende der 1940er bis Anfang der1950er Jahre in der heutigen Karl-Marx-Allee noch in dertraditionalistischen Bauweise errichtet worden waren, entschieden sichdie Architekten ab 1956 für den industriellen, typisierten und komplexenWohnungsbau. So entstanden zwischen der Koppen- und AndreasstraßeWohnquartiere in Großblockbauweise. In den Jahren 1971-1973 wurdenan der Straße der Pariser Kommune zwischen Ostbahnhof und Karl-Marx-Allee drei 21-geschossige Hochhäuser gebaut und zwischen 1969und 1974 gestaltete das Architektenkollektiv Hofmann und Just den1972 in Franz-Mehring-Platz umbenannten Küstriner Platz neu. Entlangder Rüdersdorfer Straße errichteten sie elfgeschossige Wohnungen und56
ein Bürohochhaus, das bis 1995 dem „NeuenDeutschland“ als Verlagsgebäude diente. Nachdemwir die Straße der Pariser Kommune überquerthaben, eröffnet sich uns ein Wohnquartier ganzanderer Art. Hier sehen wir zuerst Häuser aus derfrühen Nachkriegszeit, die renommierteArchitekten entwarfen.In den Jahren 1945-1951 errichteten dieBauherren Riedel, Paulick, Schmidt und Zahn inder Gaudenzer und Gubener Straße fünf Wohnzeilen,die durch Grünanlagen voneinandergetrennt sind.Kritiker lehnten diese Architektur jedoch ab, siehielten sie für nicht präsentabel. Nach ihrenVorstellungen hatte eine sozialistische Hauptstadtanders auszusehen. Deshalb wurden weitere Plänedieser Art nicht mehr in die Tat umgesetzt. Für dieHäuser in der Karl-Marx-Allee, in der GubenerStraße, Kadiner Straße, Wedekindstraße undMarchlewskistraße nahmen sich dann HermannHenselmann und andere sowohl die deutsche alsauch die sowjetische Bautradition zum Vorbild.Doch finden sich in diesem Karree zwischen derStraße der Pariser Kommune und der WarschauerStraße auch noch Altbauten der wilhelminischenEpoche, wie das Wohn- und Geschäftshaus in derKadiner Straße 11. Es wurde 1905 für denMalermeister Wilhelm Lohmann in märkischerBacksteingotik gebaut.In der Grünberger Straße kommt man ebenfallsan Alt- und Neubauten vorbei. <strong>Die</strong> im Hinterhofder Nummer 23 gelegenen ehemaligen Fabriketagenwurden nach der Wende umgestaltet. Seit 1998befindet sich hier unter anderem das Projekt desOdyssee Hostels und die Red Rooster Bar. DasLokal lädt nicht nur zum Essen und Trinken,sondern auch zu Musikveranstaltungen ein.In der kleinen, unscheinbaren, schwer zuRed Rooster Bar &StageAnschrift:Grünberger Straße 2310243 Berlin Internet:www.redroosterbar.de57
Theater der kleinenFormAnschrift:Pillauer Straße 7a10243 BerlinTel.: 030/29 35 04 61 Internet:www.theater-derkleinen-form.deFotogalerieAnschrift:Helsingforser Platz 110243 BerlinTel.: 030/29 61 684 Öffnungszeiten:Di- Sa 13.00-18.00Do 10.00-18.00findenden Pillauer Straße öffnet das Theater derkleinen Form seine Pforten für große, kleine, jungeund ältere Gäste.<strong>Die</strong> letzte Station dieses Rundganges befindetsich am Helsingforser Platz, nicht weit entfernt vonder S-Bahn Station „Warschauer Straße“. Hierwurde im August 1985 die erste Fotogalerie derDDR gegründet. In den 1990er Jahren stellten dieMitarbeiter Fotos zeitgenössischer nationaler undinternationaler Künstler aus. Stellvertretend seienhier die Ausstellungen zu Beginn der 1990er Jahregenannt, die diegesellschaftlichenUmbrüche in Ostdeutschlandsowiein Ost- und Südosteuropareflektierten.Seit Beginn desJahres 2001 versuchtder neueTräger, der Kulturringin Berlin e.V.,an die große Traditionder Galerieanzuknüpfen.A. H.58
Mädchentreff „Phantalisa“ und RegenbogenhausAuch in diesem Viertel finden Mädchen und Jungen, junge Frauen undMänner Einrichtungen, in denen sie ihren Interessen nachgehen können.Der Mädchentreff „Phantalisa“ in der Kadiner Straße 9 lädt Mädchen ab10 Jahren ein, miteinander zu reden, zu spielen, Musik zu hören,Schmuck zu entwerfen, Keramik herzustellen, zu nähen oder zuschneidern, spielerisch den Umgang mit dem Computer zu lernen undvieles andere mehr. Hier finden sie auch offene Ohren für ihre Sorgenund Nöte sowie Unterstützung bei den täglichen Hausaufgaben. Darüberhinaus organisiert der Mädchentreff Fahrten in den Sommerferien.„Phantalisa“ kann von Montag bis Freitag in der Zeit von 14 bis 19Uhr besucht werden. In den Ferien öffnet der Mädchentreff um 11 Uhrund schließt bereits um 17 Uhr.Adresse: Kadiner Str. 9, 10243 Berlin, Kontakt: 030/426 36 93, Internet: www.phantalisa.deIm benachbarten Regenbogenhaus können Kleine und Große, Jungenund Mädchen spielen, tanzen, malen, Theater spielen, fotografieren, denComputer nutzen, Keramik bearbeiten und sich im offenen Bereich nachLust und Laune betätigen. Hier kann man auch das Korbflechten undTöpfern lernen sowie in einer Band spielen. Der Kiez-Klub imRegenbogenhaus richtet sich an all diejenigen, die sich für die <strong>Geschichte</strong>des Bezirkes <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong> und der Stadt Berlininteressieren. In Stadtspielen und Exkursionen begeben sich dieTeilnehmer auf die Suche nach interessanten Ereignissen,Sehenswürdigkeiten und Zeitzeugen. Zu dem Programm des Klubsgehören auch Interviews, Tonband-, Video- und Fotoaufnahmen sowieeine Zeitung, die die Teilnehmer selbständig gestalten.Das Regenbogenhaus in der Kadiner Straße 9 ist in der Schulzeittäglich von 12.30 bis 18.30 und in den Ferien von 11 bis 18 Uhrgeöffnet.Adresse: Kadiner Str. 9, 10243 Berlin, Kontakt: 030/293 47 140, Internet: www.regenbogenhaus-berlin.de59
5. Der Boxhagener Kiez – <strong>Friedrichshain</strong> by dayand night<strong>Die</strong> Boxhagener Straße und das nördliche Wohnquartierim Boxhagener KiezIn unserem fünften Rundgang erkunden wir dasBoxhagener Viertel. Es wird von der WarschauerStraße, der Frankfurter Allee sowie der Stadt- undRingbahnlinie begrenzt. Boxhagen war ursprünglicheine Vorstadt Berlins und lag außerhalbdes alten Berliner Stadtkerns. Das Gebiet südlichder Boxhagener und Weserstraße bildete von 1889-1912 eine eigene Landgemeinde: BoxhagenRummelsburg. Im Jahre 1905 wurde Boxhagenvollständig parzelliert und aus dem alten Ortskernentstand eine typische Berliner Arbeiter-Wohngegend. Nach der großen Gebietsreform imJahre 1920 wurde Boxhagen-Rummelsburg in denBezirk Lichtenberg eingemeindet. 1939 zählte dieGemeinde wieder zum Bezirk <strong>Friedrichshain</strong>, dendie Nationalsozialisten 1933 den Namen „Horst-Wessel-Bezirk“ gaben.Verweilen wir zunächst auf der BoxhagenerStraße, die sich als pulsierende Verkehrsader durchden Kiez zieht. Am Beginn der Straße verbirgt sichin einem der Hinterhöfe die Berliner Schule fürSchauspiel. Sie wurde 1992 gegründet und gilt alseine der führenden privaten SchauspielschulenDeutschlands. <strong>Die</strong> von den Studierenden für diePrüfungen eingeübten Theaterstücke werden imTheatersaal der Schule öffentlich aufgeführt.An der Boxhagener/Niederbarnimstraße wurde imJahre 1917 das Kino Intimes mit über 200 Plätzenals Lichtspiel des Ostens eröffnet. Das Kino, dasseit 1924 Intimes Theater hieß, gehört zu denwenigen Lichtspielhäusern, die ihren Betrieb bisheute fortsetzen konnten. Inzwischen zählt es mitBerliner Schule fürSchauspielAnschrift:Boxhagener Straße 1810245 BerlinTel.: 030/42 79 600 Internet:www.schauspielschuleberlin.deKino IntimesAnschrift:Niederbarnimstraße 1510247 BerlinTel.: 030/29 66 46 3361
Theaterkapelle e.V.neunzig Plätzen zu den kleinsten Kinos im Ostteilder Stadt. Inmitten der von Straßen- und Baulärmerfüllten Boxhagener Straße erstreckt sich zwischenKreutziger und Mainzer Straße der Friedhof derGeorgen-Parochialgemeinde. An diesem Ortgedenken Angehörige ihrer Verstorbenen, aberauch andere Besucher können hier für einenMoment innehalten, die Stille und friedlicheAtmosphäre auf sich wirken lassen. <strong>Die</strong> amAnschrift:Boxhagener Straße 9910245 BerlinTel.: 030/40 98 43 00 Internet:www.theaterkapelle.deTextilkaufhausAnschrift:Boxhagener Straße 9310245 BerlinTel.: 030/29 03 85 68 Internet:www.bellanatura.de Öffnungszeiten:Mo-Fr 11.00-19.00 UhrSa 12.00-15.00 UhrEingang des Kirchhofes gelegene Kapelle ist seitMai 2006 auch Spielstätte des „Theater Transit“und der Lounge „basement“. Sie laden zu MusikundTheateraufführungen sowie zu anderenAktionen ein. <strong>Die</strong> künstlerische Leiterin desTheaters, Frau Emig-Könning, hofft „dass dieTheaterkapelle zu einer unverwechselbaren Adressein <strong>Friedrichshain</strong> und der Stadt wird, ein Ort derAuseinandersetzung zwischen uns und den verschiedenenWelten: ein Ort der Trauer und derFreude, des Schweigens und des Schreiens, kurzunseres ganzen Daseins.“Eine weitere, innovative Einrichtung befindetsich in der Nähe des Wismaer Platzes, in derBoxhagener Straße 93. Im Jahre 2003 hat dieArchitektin Marina Bell das Alte Textilkaufhausgegründet. Nachdem der Altbau ausgebaut undrenoviert worden war, arbeiten zurzeit fünfzehn62
Designer in zwölf Ateliers. <strong>Die</strong> von ihnengefertigten Unikate – Mode für Erwachsene undKinder, Schmuck, Steine, Fotos sowie Naturwaren– werden auf zwei Etagen ausgestellt und zumVerkauf angeboten. In einer Erlebniswerkstattkann man auch das Stricken, Häkeln, Zeichnen undFilzen lernen.Am Wismaer Platz geht die Boxhagener Straßein die Weserstraße über. Ein Abstecher in dieQuerstraßen nördlich der Boxhagener Straßeeröffnet ganz unterschiedliche Perspektiven:Während in der Jessnerstraße die „Supamolly“ zuSpace Rock, Electro-Music und Indian Danceeinlädt, stehen im „Café Größenwahn“ in derKinzigstraße Lesungen und Musik unbekannterBands auf dem Programm. Um jungen Frauen einePlattform für ihre Musik zu geben, findet hierjährlich das Ladyfest statt. <strong>Die</strong> Gebäude in derKinzigstraße 25-29 künden noch von einerfrüheren, kleingewerblichen Stadtbebauung. <strong>Die</strong>zwei- bis dreigeschossigen, von Gärten umgebenenWohnhäuser, Stallungen und Remisen gehörteneinst zu einem Fuhrunternehmen, einer GetreideundFouragehandlung. Das dreigeschossige Haus inder Nummer 29 errichtete der Baumeister JuliusBreiter 1873 für den Geflügelhändler AugustScholz. Es zählt zu den ältesten noch erhaltenenGebäuden in <strong>Friedrichshain</strong>. Im Jahre 2002 erwarbdie buddhistische Gemeinde dieses denkmalgeschützteEnsemble. Ehrenamtliche Mitarbeiter,Freunde und Helfer bauen hier Schritt fürSchritt das Buddhistische Zentrum für Frieden undVerständigung auf, dessen Eröffnung im Jahre2012 gefeiert werden soll.In die Schlagzeilen ganz anderer Art geriet dasWohnquartier rund um die Mainzer Straße. Hierfanden im November 1990 zwischen der Polizeiund den Hausbesetzern AuseinandersetzungenSupamollyAnschrift:Jessnerstraße 41Tel.: 030/29 00 72 94Café GrößenwahnAnschrift:Kinzigstraße 9, HH10247 BerlinTel.: 030/29 18 083BuddhistischesZentrum fürFrieden undVerständigungAnschrift:Kinzigstraße 25-2910247 BerlinTel.: 030/29 00 97 39 Internet:www.bodhicharya.de63
statt, die nach mehrerenTagen gewaltsam beendetwurden. <strong>Die</strong> Ausschreitungensowie das brutaleVorgehen der Polizei hatteein politisches Nachspiel:<strong>Die</strong> erste rot-grüne Koalitionin Berlin zerbrachund bei den Wahlen zumAbgeordnetenhaus im Dezemberdesselben Jahresvotierten die Berliner gegen das rot-grüne Regierungsbündnis.Heute weisen die sanierten Häuser keine Spuren mehr aus jener Zeitauf. Inzwischen wohnen, leben und arbeiten hier neue Mieter aus ganzBerlin oder aus anderen Teilen Deutschlands. Von dieser Straße führtder Weg über die Boxhagener in die Grünberger Straße, die zweiteHauptverkehrsader im Kiez.BezirksbibliothekAnschrift:Grünberger Straße 5410245 BerlinTel.: 030/29 77 85 6100 Internet:www.b.shuttle.de/stbfhkb/ Öffnungszeiten:Mo-Do 11.00-19.00Fr 11.00-17.00Sa 11.00-16.00Sofa-BarAnschrift:Grünberger Straße 8410245 Berlin Internet:www.sofa-bar.de<strong>Die</strong> Bebauung dieser Straße stammt aus demersten Jahrzehnt nach der Jahrhundertwende. Sieweist die für diese Zeit typische „BerlinerMischung“ aus, nämlich eine Kombination vonGebäuden aus Mauerwerk und Stahlkonstruktion,die gewerblich oder industriell genutzt wurden. Soentstanden zwischen 1905 und 1911 diefünfgeschossigen Etagenfabriken in der GrünbergerStraße 44/45. Sie bilden mehrere Höfe, dieim Jahre 2006 aufwändig gestaltet worden sind.Vor dem Eingang der Grünberger Apothekeverweist eine bunt bemalte Säule auf den über 1500m 2 großen Park mit Liegewiesen, Sonnenbänken,Spielplatz und einer von Kindern gestaltetenBrandschutzwand. <strong>Die</strong>sen Garten betritt derBesucher über die Zufahrt des Ärztehauses.Das gegenüberliegende alte Wohn- undGeschäftshaus aus dem Jahre 1911 in derGrünberger Straße 54 umschließt einen kleinenGewerbehof, dem eine fünfgeschossige Etagenfabrikangegliedert ist. In einem der Häuser64
efindet sich die Bezirkszentralbibliothek.Den Rundgang beschließen wir in derGrünberger Straße 84. Hier in der Sofa-Bar könnenBesucher bei Musik von Louis Armstrong, GlennMiller, James Brown und anderer Musiker„schwofen und grooven oder in einer stillen Eckebei einem guten Buch dahinträumen.“ Öffnungszeiten:Mo-Sa 19.00 bis openendSo geschlossenA. H.65
6. Der Boxhagener Kiez – <strong>Friedrichshain</strong> by dayand nightDas Wohnquartier südlich der Boxhagener Straße<strong>Die</strong>sen Rundgang beginnen wir an derRingbahnlinie, die den Stadtteil <strong>Friedrichshain</strong> vonLichtenberg trennt und zugleich die östlicheGrenze des Kiezes markiert.<strong>Die</strong> wichtigste Station an dieser S-Bahn-Streckeist das Ostkreuz, der Ausgangspunkt für unserenWeg durch das südliche Wohnquartier desBoxhagener Kiezes.Zuerst lenken wir unsere Schritte in die NeueBahnhofstraße 9 – 17. Hier wurde die von GeorgKnorr entwickelte Einkammerschnellbremseproduziert. In den Jahren 1913 - 1916 errichteteder Architekt Alfred Grenander ein neues FabrikundVerwaltungsgebäude für die Knorr-Bremse-AG. Grenander, der als künstlerischer Leiter derHochbahngesellschaft die Bahnhöfe der BerlinerU- und Hochbahn gestaltete, verlieh demfünfgeschossigen Verwaltungsbau ein repräsentativesAussehen. Ebenso sorgte er für dieAusgestaltung der Innenräume. Heute sind nochTeile der Möblierung, wie Aktenschränke,Anrichten, Schreibtischstühle, Kronleuchter undanderes erhalten. Nach der denkmalgerechtenSanierung des Gebäudekomplexes ließ sich hier dieRepräsentanz der Knorr-Bremse AG nieder. Überdie <strong>Geschichte</strong> des Unternehmens unterrichtet dasMuseum, das am Tag des Öffentlichen Denkmalsbesucht werden kann. Im alten Verwaltungsgebäuderesidiert die Berufsakademie Berlin.Nach diesem kurzen Abstecher zu einem derzahlreichen Industriedenkmäler <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong>begeben wir uns in das Viertel südlich derBoxhagener Straße. <strong>Die</strong> Gegend mit ihren vielen,Knorr-Bremse AGAnschrift:Neue Bahnhofsstraße9 - 1010245 Berlindas Museum ist nichtöffentlich zugänglich,nur am Tag desÖffentlichen Denkmalsund nach tel.Vereinbarung (HerrMüller,Tel.: 030/93921322)67
Zebrano-Theater(mit Café, Bar undLounge)Anschrift:Sonntagstraße 810245 BerlinTel/Bar.: 030/29 36 5874Tel./Karten: 030/2904 94 11 Internet:www.zebranotheater.deHinweis:Eingang zum Theaterdurch das CaféPuppentheater amOstkreuzAnschrift:Lehnbachstraße7a/EckeSonntagsstraße10245 BerlinTel.: 030/29 04 94 11teilweise sanierten Altbauten, Läden, Cafés undRestaurants ist längst kein Geheimtipp mehr. Hiererwacht das Leben erst in den Abendstunden, wiez. B. im Zebrano-Theater in der Sonntagstraße. Indieser Spielstätte werden ab 20 Uhr Theaterstückefür Erwachsene aufgeführt, während die kleinenBesucher im Puppentheater in der Lehnbachstraßeauf ihre Kosten kommen.Im weiteren Verlauf der Sonntagstraße fällt derBlick auf eine Wohnanlage, die in den Jahren 1904-1906 entstand. Stil und Aussehen der Häuserstanden im Kontrast zu den sie umgebendendüsteren Mietskasernen. Der nach Helene vonBudde, der Frau des damaligen Ministers füröffentliche Angelegenheiten, benannte Helenenhoferstreckt sich von der Sonntagstraße 17 - 22,Gryphiusstraße 1 - 8 über die Holteistraße 28 - 33bis zur Simplonstraße 41/51. Der „Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin“ hatte das Grundstückerworben und Erich Köhn beauftragt, die Anlagemit Wohnungen und Läden für kinderreicheBeamtenfamilien der unteren Gehaltsstufen zuentwerfen. In zwei Abschnitten entstanden über400 Wohneinheiten und vier Läden, die sich umbegrünte Innenhöfe gruppierten. Aufgrund dessenwaren die Wohnungen hell und gut belüftet. <strong>Die</strong>mit gepflasterten Wegen durchzogene Grünanlagewird von Mauern eingefasst. In den 1990er Jahrenwurde der Helenenhof aufwändig saniert.Jetzt verlassen wir die Sonntagstraße undkommen in der Wühlischstraße an einem für dieseGegend fremd anmutenden Schmucktor vorbei.Wer dieses Portal durchschreitet, entdeckt einebürgerliche Wohnstraße, die 1911-1913 fürwohlhabende Mieter konzipiert wurde. <strong>Die</strong> Häuserzeichneten sich durch abwechslungsreich gestalteteFassaden und Vorgärten aus. <strong>Die</strong> Wohnungenwaren überdurchschnittlich groß. Überdies wurde68
das Haus Knorrpromenade 9 mit einem elektrischenFahrstuhl ausgestattet. Heute residiert hierder Verein für Kunst, Kultur, Wirtschaft &Begegnung.In der Wühlischstraße 42 befindet sich das Kiez-Café der Arbeiterwohlfahrt <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong>. Das Café ist ein Treffpunkt fürwohnungslose und einkommensschwacheMenschen. Hier können sie bei Speis’ und Trankmit anderen Menschen ins Gespräch kommen,finden aber auch Gelegenheit zum Duschen undzum Wäschewaschen. Darüber hinaus wird ihnenHilfe im Krisenfall oder im Umgang mit denBehörden angeboten. Für Obdachlose gibt es auchSchlafplätze für Notübernachtungen.Wer Lust auf Mode, Filme und mehr hat, solltedas ARTliners Berlin in der Gärtnerstraßeaufsuchen. Hier werden regelmäßig Modenschauen,Filmabende und Lesungen veranstaltet.Musik unterschiedlichster Art, von Elektro, Hiphop,Jungle, Dubstep bis Beat, bietet das Lovelitein der Simplonstraße an und „Raumklang“ in derLibauer/Ecke Kopernikusstraße unterhält jungeLeute die ganze Nacht mit Soul, Funk,Elektronischer Musik sowie Musik neuer undbekannter Bands. Um den Besuchern einenbesonderen Hörgenuss zu ermöglichen, wurden dieRäume eigens mit speziellen Schallwandlernausgestattet.In der Revaler Straße kommen wir noch einmalan einem Industriedenkmal vorbei, der Eisenbahn-Hauptwerkstätte Berlin II, dem späteren Reichsbahn-Ausbesserungswerk„Franz Stelzer“. <strong>Die</strong><strong>Geschichte</strong> dieses Werkes ist eng mit derEntwicklung der Eisenbahn und der verkehrstechnischenErschließung des Stadtteilesverbunden. Für die Ostbahn, die inzwischen vonund nach Berlin verkehrte, errichtete der Eisen-Verein für Kunst,Kultur, Wirtschaft& Begegnung(Vkkwb)Anschrift:Knorrpromenade 910245 BerlinTel.: 030/42 02 92 41 Internet:www.vkkwb.deKiez-Café der <strong>AWO</strong><strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong> e.V.Anschrift:Wühlischstraße 4210245 BerlinTel.: 030/29 35 05 56Email: kiez-cafe@awofriedrichshain.deARTlinersAnschrift:Gärtnerstraße 2310245 BerlinTel.: 030/97 00 21 57 Internet:www.artlinersberlin.de Öffnungszeiten:Di-Fr ab 12.00Sa/So 10.00-17.0069
LoveliteAnschrift:Simplonstraße 38/4010245 Berlin Internet:www.lovelite.debahnbaumeister Nicolassen von 1868-1871 einegroße Lokomotiv- und Tendlerhalle, eine Halle fürPersonen-, Post- und Gepäckwaggons, eineSchmiede mit dem angeschlossenen Kesselhausund das Hauptmaterialmagazin. Hier wurden unteranderem Kesselprüfungen sowie Lackier- undStreicharbeiten für die Eisenbahn vorgenommen,später übernahm das Werk die Wartung derNahverkehrszüge.Im Jahre 1896 kamen ein neues Verwaltungsgebäudesowie ein Beamtenwohnhaushinzu. Nachdem das Ausbesserungswerk imZweiten Weltkrieg stark zerstört worden war,spiegeln heute nur noch die Bauten zur RevalerStraße hin das ursprüngliche Erscheinungsbildwider.RAW-Tempel e.V.Anschrift:Revaler Straße 9910245 BerlinTel.: 030/29 24 695 Internet:www.raw-tempel.deNach der Wende im Jahre 1989 verlor dasReichsausbesserungswerk (RAW) seine Funktion.Anfang der 1990er Jahre wurde der Saal des RAWfür die Sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung<strong>Friedrichshain</strong> genutzt, als diese noch100 Sitze hatte.Inzwischen etablierte sich auf diesem Geländeder RAW-Tempel e.V. In den Räumen des Vereinsarbeiten zurzeit 66 unterschiedliche soziokulturelleund kulturgewerbliche Projekte. Das ebenfalls aufdiesem Areal beheimatete Cassiopeia unterhälteinen Musikclub, ein Café, eine Bar und eine70
CassiopeiaAnschrift:Revaler Straße 9910245 BerlinTel.: 030/29 36 29 66 Internet:www.cassiopeiaberlin.deSkaterhalle.Der Rundgang endet in der Simon-Dach-Straße.<strong>Die</strong> Straße entwickelte sich nach der Wende zu derKneipen- und Flaniermeile <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong> mitinternationalem Flair. Hier reihen sich einRestaurant und ein Geschäft an das andere. Wasjedoch des einen Freud ist des anderen Leid. Dennvor allem in der Sommerzeit sitzen die Gäste bisweit nach Mitternacht im Freien, so dass sich dieAnwohner in ihrer nächtlichen Ruhe gestörtfühlten. Als sich Bewohner und Restaurantbesitzernicht auf eine für beide Seiten akzeptable Regelungverständigen konnten, wurden die Auseinandersetzungenzum Teil gerichtlich ausgetragen.Mittlerweile scheint sich die Situation entspannt zuhaben; gegenseitige Rücksichtnahme sorgt für einfriedliche, nachbarschaftliches Miteinander.A. H.71
Jugendklub SkandalGegenüber dem Helenenhof befindet sich der Jugendklub Skandal. Er istdie Nachfolgeeinrichtung des Jugendklubs „Herbert Herrmann“, einemder ersten Jugendklubs in Ost-Berlin.Heute lädt der Klub Jugendliche ein, je nach Lust und Laune Billard,Tischtennis und Gitarre zu spielen. Hobbyköche und solche, die eswerden wollen, können hier grillen, kochen und backen. Am Montagüben im Klub die Tanzgruppe, eine Rollenspiel-Gruppe sowie eineBand.Darüber hinaus wird Hilfe bei den Hausaufgaben und beiBewerbungen angeboten.Für Fotoarbeiten steht eine Dunkelkammer zur Verfügung. ImTonstudio werden nach Terminabsprache Demos für Schülerbandszusammengestellt und Hip Hop produziert.Jeden Monat gibt es zusätzliche Angebote für Mädchen und Jungen.Der Jugendklub arbeitet auch eng mit anderen Einrichtungen zusammenund engagiert sich für soziale Projekte.Ferner ist hier das Jugendprojekt der Arbeiterwohlfahrt „Point“,beheimatet, das versucht, Jugendliche unabhängig von ihrer Herkunft,Kultur und Religion zu integrieren.Der Jugendklub ist von montags und dienstags in der Zeit von 14 bis21 Uhr, mittwochs von 15 bis 21 Uhr sowie donnerstags und freitagsvon 14 bis 21 Uhr geöffnet.Adresse: Gryphiusstr. 29 - 31, 10245 Berlin, Kontakt: 030/2922409,E-mail: jfe.skandal@web.de72
<strong>Friedrichshain</strong>er Industriegebäudeeinst und jetztWie sehr sich <strong>Friedrichshain</strong> seit der politischen Wende im Jahre 1989gewandelt hat, zeigt sich am deutlichsten an der Architektur der einstigenIndustriegebäude. Denn die wirtschaftlich-politischen Veränderungender Zeit nach 1990 wirkten sich auch auf die <strong>Friedrichshain</strong>er Werke aus,die einst zu den führenden Unternehmen von überregionaler Bedeutunggehörten. Da sich ihre Produkte auf dem internationalen Weltmarktnicht mehr behaupten konnten, wurde ihre Herstellung eingestellt undArbeiter wie Angestellte entlassen. Doch was sollte mit den Gebäudengeschehen? Tendierte man früher dazu, alte, leerstehende Häuserabzureißen, um moderneren Platz zu machen, setzt sich mehr und mehrder Gedanke durch, die einstige Architektur zu erhalten, sie jedochanders als bisher zu nutzen. Demzufolge präsentieren sich heute dieGebäude einerseits mit der vertrauten, mit neuem Anstrich versehenenFassade und andererseits mit einer hochmodernen, an einem neuenKonzept orientierten Innenausstattung.Anhand ausgewählter Beispiele wird nun gezeigt, ob und wie dasgelungen ist.Als erstes soll die Entwicklungdes größten Betriebes in<strong>Friedrichshain</strong>, des BerlinerGlühlampenwerkes, dargestelltwerden. <strong>Die</strong>ses Unternehmendominierte den Südwesten desStadtteils und beschäftigte bis1990 über 5000 Arbeitnehmer.Für diesen gewaltigen, an derWarschauer Brücke gelegenenFirmenkomplex legte dieDeutsche Glasglühlicht AG(Auer-Gesellschaft) im Jahre1906 den Grundstein. Bereits einJahr später expandierte die Firmaund gab dem ArchitektenTheodor Kampffmeyer denAuftrag, weitere Gebäude73
zwischen Ehrenberg-, Rudolf-, Rother- und Naglerstraße zu planen. Zudiesen Häusern kam später noch der zentrale, elfgeschossige Turmhinzu, der als erster Wolkenkratzer Berlins gilt. Ihm folgte das vonHermann Dernburg 1910 errichtete Verwaltungsgebäude. Im Jahre 1919wurden die Glühlampenfabriken der AEG, der Firma Siemens & Halskeund der Auergesellschaft zur OSRAM GmbH zusammengelegt. DerName leitete sich von der neuen, hier produzierten Osramlampe ab,deren Glühfäden aus Osmium und Wolfram bestanden. In der Zeit von1933-1945 etablierte sich dieses Unternehmen zu einem von den Nazisprotegierten Betrieb, der ebenso wie andere Firmen seinenArbeitskräftemangel seit 1940 mit „Fremdarbeitern“ und seit 1943 mitKZ-Häftlingen abdeckte. Nachdem das Werk im Zweiten Weltkrieg sehrschwer zerstört und auch von den sowjetischen Besatzern demontiertworden war, nahm es 1949 als volkseigener Betrieb unter dem Namen„Rosa Luxemburg“ seine Arbeit wieder auf. Zwanzig Jahre späterfusionierte der <strong>Friedrichshain</strong>er Betrieb mit den Glühlampenwerken inPlauen, Oberweißbach, Brand-Erbisdorf und Tambach-<strong>Die</strong>tharz zumVEB Kombinat NARVA. Nach der Einstellung der Produktion im Jahre1992 wurden die inzwischen unter Denkmalschutz gestellten Gebäudeentkernt und bis 2000 zu dem modernen <strong>Die</strong>nstleistungs- undGewerbezentrum „Oberbaum-City“ umgebaut. Nicht nur dieAußenfassaden erstrahlen in neuem Glanz, sondern auch die Höfeerfuhren eine besondere Gestaltung. Sorgen Brunnen aus slowenischemTuffgestein in den Innenhöfen des Gebäudes IV zwischen derEhrenberg- und der Naglerstraße für eine angenehme Atmosphäre,erinnern die Glaslichtfußböden im Innenhof des Gebäudes V an dieeinst hier hergestellten Glühlampen. Ebenso wurde das einstigeWahrzeichen dieses auch als „Lampenstadt“ in die Industriegeschichteeingegangenen Standortes wieder aufgebaut: Der weithin leuchtendefünfgeschossige und 21 Meter hohe Glasaufsatz des Glühlampenwerkesauf dem Gebäude III ist eine Reminiszenz an den ersten WolkenkratzerBerlins. In den Gebäuden des ehemaligen Glühlampenwerkes arbeitenheute Möbeldesigner, Ingenieure, Übersetzer, Berater und <strong>Die</strong>nstleister.Ferner befinden sich in der Oberbaum-City ein Internationales DesignZentrum, Werbeagenturen, Druckereien sowie Hard- undSoftwarefirmen.Unweit dieses im heutigen Rudolfkiez gelegenen <strong>Die</strong>nstleistungs- undGewerbezentrums entstanden und entstehen auch an der Spree aus74
ehemaligen Industrie- und Hafengebäuden innovative Einrichtungen. InSichtweite des Ostbahnhofes wurde 1904 das Pumpwerk errichtet.Nachdem ein Gebäudeteil im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war,lagerte die Staatsoper zeitweise ihr Material im intakten denkmalgeschütztenFlügel. Der Berliner Architekt Gerhard Spangenbergverband bei dem im Jahre 2006 erfolgten Umbau des Geländes diehistorische Substanz mit einem modernen Baukörper. Im September2006 öffnete hier das Kunsthaus „Radialsystem“ seine Pforten. Der 2500m 2 große Veranstaltungsort beherbergt zwei Theatersäle, drei Studios,Cafés und Verwaltungsräume. Terrassen und Gärten laden zumEntspannen ein. <strong>Die</strong> Symbiose von Alt und Neu, von Tradition undModerne spiegelt auch das Anliegen der Betreiber wider: Den Dialogzwischen Alter Musik und Zeitgenössischem Tanz, KlassischenKonzerten und Neuen Medien sowie zwischen Bildender Kunst undLive Performance.Im weiteren Verlauf der Spree in Richtung Oberbaumbrücke, kommtein von außen recht unscheinbaranmutendes Gebäude zum Vorschein,dessen futuristischer Eingang überrascht.Es handelt sich dabei um das ehemaligeGelände der Berliner Gasanstalt undheutige Energie-Forum. Der in Europaeinmalige Komplex im Niedrigenergiestandard,der mit umweltverträglichen undrecycelbaren Materialien erbaut wurde,lädt seit Herbst 2003 zu einem Besuch ein.<strong>Die</strong> „Eingangsröhre“, durch die man dasGebäude am Stralauer Platz betritt, führtdirekt in das Herzstück des Hauses, dasAtrium. <strong>Die</strong>ses ausschließlich mitSonnenlicht beleuchtete Kommunikationszentrumwird von dem denkmalgeschütztenMagazingebäude der ehemaligen Gasanstalt aus dem Jahre1906 und den zwei L-förmigen Seitenflügeln eingerahmt, die durch einGlasdach miteinander verbunden sind. <strong>Die</strong> innovative Bauweise zeigtsich auf ganz unterschiedliche Art: Zum einen dient die grüneMetallverschalung der Seitenflügel der Wärmedämmung, wodurchEnergie eingespart wird. Zum anderen sind die Büros so angelegt, dass75
sie am Tag kaum Kunstlicht benötigen. <strong>Die</strong> Glaskonstruktion derSüdfassade ermöglicht es wiederum, das Sonnenlicht überFotovoltaikmodule für die Erzeugung von Elektrizität zu nutzen. Fernersorgen ein modernes Belüftungssystem, innenliegender Sonnenschutzund eine hochwirksame Sonnenschutzverglasung für ein gleichmäßigangenehmes Klima. Zu diesem trägt auch in ganz besonderer Weise eineWärmepumpe in Verbindung mit Energiepfählen bei. Für dieherausragende Leistung auf dem Gebiet der Bauphysik und derEnergietechnik erhielt das Planungsteam des Energie- Forums im Jahre2003 den Bauphysikpreis. Heute arbeitet hier ein Forschungsprojekt anneuen Technologien der Energieeinsparung.Eine ganz besondere Veränderung erfahren die Hafengebäude entlangdes Spreeufers. Sie entstanden im Zuge der Ende des 19. Jahrhundertseinsetzenden industriellen Entwicklung. Denn die Stadt, derenBevölkerung zunahm und sich dadurch immer weiter ausdehnte,benötigte in erhöhtem Maße Brenn- und Baustoffe, Getreide, Kohle undLebensmittel. <strong>Die</strong> Beförderung der Materialien übernahm seit demAusbau des Schienennetzes die Bahn. Aufgrund der hohenTransportkosten geriet jedoch der Wasserweg als billigere Alternativeerneut in das Blickfeld. Aufgrund dessen entschieden sich die Stadtväterfür den Bau des ersten und bis 1923 größten Hafens Berlins. Er wurdeam 28. September 1913 am rechten Spreeufer zwischen der TreptowerEisenbahnbrücke und der Oberbaumbrücke eingeweiht. Derklassizistische Stil der Lagerhäuser und Verwaltungsgebäude des Hafenswar ungewöhnlich. Doch er wurde bewusst gewählt, damit sich dieIndustriegebäude nicht von der Architektur des sie umgebendenWohnumfeldes abhoben. Der Osthafen wie der 1923 eingeweihte unddreimal größere Westhafen unterstanden der im Jahre 1923 gegründeten„Berliner Hafen- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft“ (BEHALA). Bis1940 konnten 79 Prozent der Güter mit dem Schiff transportiert werden.Im Zweiten Weltkrieg wurde der Osthafen fast vollständig zerstört undder Schiffsverkehr lahm gelegt. Nachdem die Rote Armee am 24. Aprilden Hafen besetzt hatte, übernahm nach der Teilung Berlins derOstberliner Magistrat dessen Verwaltung. Obwohl die Schließung derGrenze im Jahre 1961 den Güterumschlag erheblich einschränkte, stieger dennoch stetig an. Zwischen 1960 und 1989 passierten jährlichzwischen 2,2 und 2,8 Millionen Tonnen Güter den Osthafen. <strong>Die</strong>politischen Veränderungen nach 1989 bewirkten einen Strukturwandel76
der Ostberliner Unternehmen, weshalb auch die Zukunft des Osthafensungewiss war. Doch mit dem in den 90er Jahren des vergangenenJahrhunderts in Berlin einsetzenden Bauboom stellte der Osthafen, derseit 1992 wieder Teil der BEHALA geworden war, einenunverzichtbaren Bestandteil für den Umschlag und die Lagerungwichtiger Baustoffe und -schutt dar.Mittlerweile sind in die denkmalgeschützten Hafengebäude neueMieter eingezogen, wie beispielsweise in den ehemaligen achtgeschossigenGetreidespeicher an der Mühlenstraße. Ihn hatte derArchitekt Schreiber im Jahre 1907 für die Osthafenmühlen imklassizistischen Stil errichtet und mit dekorativen Elementen versehen.Nach der Vereinigung Berlins wurde er zu einem Treffpunkt fürTanzlustige ausgebaut.Das nach Plänen Oskar Punschs 1928/29 erbaute achtgeschossigeKühlhaus, im Volksmund auch „Eierkühlhaus“ genannt, bewahrteaufgrund eines Schutzmantels aus dicker Korkschicht zeitweilig soverderbliche Waren wie Eier, Wein, Butter, Konserven, Gefrierfleisch,Wild und Geflügel auf. Wiederholt lagerten in diesem Gebäude bis zu 75Millionen Eier. Nach der bis 2002erfolgten Sanierung des Hausesvertreten hier über 300 Mitarbeiterder Universal Music den weltweitgrößten Musikkonzern inDeutschland.Weitere Projekte werden hierrealisiert. Neben der bereitserrichteten MTV-Zentrale auf demAreal des Osthafens ist für denHerbst des Jahres 2006 dieEröffnung einer privaten Hochschulefür Entertainment vorgesehen.Dass nicht nur der Wasserwegvon Bedeutung war, sondern vorallem auch der Ausbau derEisenbahnstrecke, wurde bereitserwähnt. Als Ende des 19. Jahrhundertsbegonnen wurde, die Stadt und insbesondere <strong>Friedrichshain</strong> für77
den Eisenbahnverkehr zu erschließen, siedelten sich verstärkt großeUnternehmen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten an. Auch GeorgKnorr, der Erfinder der Einkammerschnellbremse, ent-schied sich fürein Gelände an der Ringbahnstrecke, auf dem er 1904 seine Fabrik undein Büro bauen ließ. Nachdem der Firmengründer des Knorr-Bremsen-Werkes in die Neue Bahnhofsstraße eingezogen war, erwarb er ein Jahrspäter bereits das Nachbargrundstück und errichtete darauf die sogenannte Neue Fabrik. Hier ließ Georg Knorr seine Bremsenproduzieren, zu deren Hauptabnehmern die deutsche Eisenbahn zählte.Nach seinem Tod im Jahre 1911 wurde sein Unternehmen in eineAktiengesellschaft umgewandelt. Alfred Grenander, der sich um dieGestaltung der U-Bahnhöfe verdient gemacht hatte, entwarf die Plänefür den Um- und Neubau des Gebäudekomplexes der Knorr-Bremse-AG in der Neuen Bahnhofstraße. Für vier Millionen Mark konnte dasVorhaben zwischen 1913-16 realisiert werden. <strong>Die</strong>ser sich über fünfStockwerke erstreckende Bau beherbergte das Verwaltungsgebäude unddie Fabrikräume, die sich jeweils um einen Hof gruppierten. Zwischenden beiden Weltkriegen entwickelte sich die Knorr-Bremse-AG zumgrößten Bremsenbauunternehmen Europas. Doch der Zweite Weltkrieghinterließ auch hier seine Spuren: Zwei Luftangriffe in den Jahren 1943und 1945 zerstörten dieses Werk erheblich. Danach wurde es enteignetund zu Reparationsleistungen an die Sowjetunion verpflichtet. Seitdembefindet sich die Konzernzentrale der Knorr-Bremse-AG in München.Später, zu DDR-Zeiten, waren in der Neuen Bahnhofstraße Firmen ausdem Bereich der Mess- und Regelungstechnik ansässig, während aufeinem außerhalb des S-Bahn-Rings gelegenen Fabrikgelände weiterhinBremsen hergestellt wurden. Nach dem Umzug der beiden Bereiche –Messelektronik und Knorr-Bremse – nach Berlin-Marzahn im Jahre 1993wurde das historische Gebäude originalgetreu restauriert und unterDenkmalschutz gestellt. Heute ist hier die Repräsentanz und dasMuseum der Knorr-Bremse-AG beheimatet, während im altenVerwaltungsgebäude die Berufsakademie Berlin, eine staatlicheStudienakademie des Landes Berlin, und die AOK residieren. Einweiteres Industriedenkmal, dessen ursprüngliche Funktion verloren ging,befindet sich in der Palisadenstraße. Es handelt sich um dasUmspannwerk Ost, das in den Jahren 1899/1900 nach PlänenSpringmanns errichtet und 1908 umgebaut wurde. Es versorgte als einesder ältesten Umspannwerke Berlin mit Elektrizität. Als Ende des 19.78
Jahrhunderts von Gleichstrom aufStarkstrom umgestellt wurde – einentscheidender Wandel in der Stromerzeugung–, übernahmen statt dermit Gleichstrom arbeitenden innerstädtischenZentralstationen Kraftwerkeam Rande der Stadt dieProduktion von Starkstrom. DasUmspannwerk in der Palisadenstraßehatte seitdem die Aufgabe, den 6000-Volt-Drehstrom des KraftwerkesOberspree für die Versorgung derumliegenden Haushalte und Gewerbetreibendenin Gleichstromumzuwandeln und in das Netzeinzuspeisen. Bereits im Jahre 1945wurde die Anlage stillgelegt. Nach derWende entdeckte man das inzwischen unter Denkmalschutz gestellteindustrielle Kleinod wieder, das daraufhin aufwändig rekonstruiert undals kulturelle Einrichtung im April 2000 wieder eröffnet wurde. DasUmspannwerk Ost beherbergt ein Restaurant, das Kriminaltheater, einenMusikklub, das Kulturhaus „Palisadenstraße 48 e.V.“ sowie TagungsundVeranstaltungsräume.Stand bisher die erfolgreiche Sanierung alter Industriegebäude und -anlagen im Mittelpunkt der Ausführungen, soll jetzt ein ehemaligesUnternehmen vorgestellt werden, dessen Ruinen immer noch imDornröschenschlaf schlummern. Heute vermutet wohl niemand mehr,dass hinter den zerstörten Mauern in der Landsberger Allee 54 undRichard-Sorge-Straße 51-62 einst Bier gebraut wurde. <strong>Die</strong> Entstehungdieser Brauerei geht auf den ersten Braumeister Georg Patzenhoferzurück, der aus Süddeutschland kam und hier das bis dahin in Berlinunbekannte dunkle, „untergärige“ bayrische Bier einführte. Auf derFriedrichshöhe, gegenüber dem Volkspark <strong>Friedrichshain</strong>, inunmittelbarer Nachbarschaft zu den drei innerstädtischen Friedhöfenlegte Patzenhofer den Grundstein für die nach ihm benannte Brauerei.Der Standort für die Kelleranlagen war klug gewählt: Denn zum einenlagen Friedhöfe stets an Orten, an dem das Grundwasser besonders tiefliegt. Das daraus gewonnene Wasser besaß eine gute Qualität, was79
wiederum den Brauerei-Brunnen zugute kam. Zum anderen sorgten dieFriedhofsbesucher für einen erhöhten Umsatz in dem 1858 eröffnetenAusschanklokal, das zur Brauerei gehörte, denn hier kehrten vor allemdie Beerdigungsgesellschaften ein. Nachdem 1886 noch die Sudhäuser,eine Mälzerei und Verwaltungsgebäude errichtet worden waren, konnten100.000 Hektoliter Bier gebraut und täglich 50.000 Flaschen abgefülltwerden. Im Jahre 1871 wurde die Brauerei in eine Aktiengesellschaftumgewandelt. <strong>Die</strong> Architektenbüros Arthur Rohmer und Alterthum &Zadek entwarfen Pläne für weitere Neu- und Anbauten, die zwischen1877 und 1896 realisiert wurden. Gleichzeitig fand die Umstellung aufdie maschinelle Fabrikation statt. Im Jahre 1920 verschmolz diePatzenhofer Brauerei mit der Schultheiss-Brauerei zur Schultheiss-Patzenhofer AG, wodurch sie zu einer der bedeutendsten Brauereien derWelt aufstieg. Dass dem Unternehmen auch weiterhin Erfolg beschiedenwar, verdankte es wohl nicht nur der Tatsache, dass die Brauerei übereine der größten Sudanlagen Europas verfügte, sondern auch demVermögen seines Direktors, Friedrich Goldschmidt. <strong>Die</strong>ser hatte sichauf einer <strong>Die</strong>nstreise zur Weltausstellung in Philadelphia über diemodernste Ausstattung der amerikanischen Brauereien informiert unddie Erkenntnisse dann in seinem Unternehmen erfolgreich umgesetzt.Doch die Brauerei überdauerte die politische Wende von 1989 nicht.Sie stellte im Jahre 1990 den Betriebein und ein Großteil der Anlagenwurde abgerissen. <strong>Die</strong> nocherhaltenen Teile übernahm dasDeutsche Technikmuseum. Lediglichdie unter Denkmalschutzstehende Villa und die Fassaden desSud- und Lagerhauses der Brauereifristen noch ihr Dasein am einst sowirkungsmächtigen Standort. Eswäre sehr bedauerlich, wenn dieseGebäude unwiderruflich zerstörtwürden. Vielleicht kann in ein paarJahren auch über diesesIndustriegelände eine neue Erfolgsgeschichtegeschrieben werden.Angelica Hilsebein
7. Das SpreeuferVon der Schillingbrücke bis zum OsthafenDer siebte Rundgang führt von der Schillingbrückedie Spree entlang bis zum Osthafen. Große Teiledes Gebietes waren ehemaliges Grenzgebiet Ost-Berlins zu West-Berlin. Grenzschiffe patrouilliertenauf der Spree. <strong>Die</strong> Mauer versperrte die Sicht aufden Fluss. Seit dem Fall der Mauer 1989 wirddurch vielfältige Projekte das Gebiet neuerschlossen. Einerseits wird das Spreeufer alswirtschaftlicher Standort „media spree“ neugenutzt, andererseits werden die Wohngebietesaniert und versucht, neue soziale Strukturen zuschaffen, die durch die Mauer und die Trennungder Stadt verloren gegangen sind. Das Spreeufersoll genauso attraktiv wie das Themseufer inLondon werden, Touristen anziehen, kulturelleAngebote bieten und der Erholung der Wohnbevölkerungdienen.Unser Rundgang beginnt am alten Pumpwerkam Ostbahnhof, das zum Kunsthaus „Radialsystem“mit Proben-, Aufführungsraum undStudios umgebaut wurde. Hier finden Tanz- undTheaterveranstaltungen statt, Alte Musik wird mitzeitgenössischem Tanz, klassische Konzerte mitneuen Medien und Bildende Kunst mitPerformance zusammengebracht. Es ist Heimstattfür die Akademie für Alte Musik und für dieTänzerin Sasha Waltz. Nicht weit entfernt davon,der Eingang an der Schillingbrücke, liegt der ClubMaria am Ostbahnhof, in dem man nachts zuspäter Stunde tanzen und rocken kann.Am Stralauer Platz 33 - 34 befindet sich dasEnergie-Forum, das mit seiner Eingangsröhre, demAtrium und dem Uferausbau zur Besichtigungeinlädt. Eine Hausnummer weiter in der NummerRadialsystem VAnschrift:Holzmarktstrasse 3310243 BerlinTel.: 030/28 87 88 50 Internet:www.radialsystem.deMaria amOstbahnhofmit Club JosefAnschrift:An derSchillingbrücke/Stralauer Platz 33-3410243 BerlinTel.: 030/21 23 81 90 Internet:www.clubmaria.deEnergie-ForumAnschrift:Stralauer Platz 33/3410243 BerlinTel.: 030/47 30 69 94 Internet:www.energieforumberlin.de83
Yaam-LocationAnschrift:Stralauer Platz 35,am Ufer der Spree10243 BerlinTel./yaam-office:030/61 51 354 Internet:www.yaam.de Öffnungszeiten:tgl. 14.00-24.00 oderlängerShake! Das Zelt amOstbahnhof35 hat hinter einer besprühten Mauer die Yaam-Location der Alternativ-Szene einen Ort für sichgefunden. Hier werden legale Graffitisprayerwettbewerbeausgetragen. Maler, Sprüher, Fotografenpräsentieren hier ihre Kunst. Yaam ist einmultikultureller Treffpunkt für viele Sport- undMusikliebhaber aller Nationen und Kulturen. DasSpreeufer ist zum Strand umgestaltet worden.Nicht weit davon entfernt in der Straße der PariserKommune ist der Fritzclub am Ostbahnhofangesiedelt, in dem Partys, Theater und Musikveranstaltungenstattfinden. Am Spreeufer, vis-a-visvom Ostbahnhof, hat die Shakespeare CompanyBerlin ihre Spielstätte im „Shake“, das Zelt amAnschrift:Straße der PariserKommune 1-2/EckeMühlenstraße10243 BerlinTel./ 030/21753035 Internet:www.shake-berlin.deHinweis:Zelt ist beheiztEastern Comfort-SchiffAnschrift:Mühlenstraße 73-7710243 BerlinTel.: 030/66 76 38 06 Internet:www.easterncomfort.deOstbahnhof. Neben Shakespeare für Jung und Altfinden dort auch World-Music-Konzerte statt.Zeitweise stehen nicht weit entfernt davon großeZirkuszelte auf dem Gelände an der Mühlenstraßeund locken mit ihrem Programm überregional dasPublikum an.An der Mühlenstraße bis zur Oberbaumbrückewurde auf einer 1,3 Kilometer langen Strecke einRest der Berliner Mauer erhalten. 1990 gestaltetenKünstler aus 21 Ländern die Mauer mit 114Gemälden. <strong>Die</strong>se „East-Side-Gallery“ gilt alslängste Freiluftgalerie der Welt und steht unterDenkmalschutz. Der Grenzstreifen hinter der East-84
Side-Gallery wird als Spreepromenade mit Grünstreifen und Sitzmöglichkeitenumgestaltet. 45 Meter Mauer wurden herausgebrochen,um von der auf der anderen Seite der Mühlenstraße geplanten Arena fürSportveranstaltungen den Blick auf die Spree zu ermöglichen.Vor der Oberbaumbrücke am Eingang zum Schiff Eastern-Comfortbefindet sich ein Touristenshop für die Mauerbesucher. Auf dem Schifffinden Musikveranstaltungen statt. Nur spärliche Informationen über diedeutsche Teilung sind hier am East-Side-Galleryshop zu erhalten. EineMauergedenkstätte könnte hier in Zukunft ihre Heimstatt finden. Vonhier aus sieht man beide Türme der Oberbaumbrücke, die im Wappendes Bezirks <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong> abgebildet sind. Bevor dieOberbaumbrücke gebaut wurde, stand zwischen 1724 und 1892 hier einehölzerne Zugbrücke, dieder Erhebung desSchiffszolls diente.Nachts wurde sie mitBaumstämmen verschlossen.Dem so genanntenOberbaum entsprach imUnterlauf der Spree aufder Höhe der Charité inMitte der so genannteUnterbaum. Während desZweiten Weltkriegs wurden die Haupttürme beschädigt. Seit August1961, der Errichtung der Berliner Mauer, wurde die Oberbaumbrückefür jeden Verkehr gesperrt. Seit 1972 jedoch für den grenzüberschreitendenFußgängerverkehr für Westberliner freigegeben. Erstnach umfangreicher Sanierung nach der Wende verkehrt seit 1995 dieU-Bahn wieder über die Brücke. <strong>Die</strong> durch den Krieg beschädigtenTürme wurden wieder hergestellt.Schräg gegenüber dem Touristenshop steht das East-Side-Hotel ander Mühlenstraße. Neben der Fotogalerie am Helsingforser Platz ist dasEast-Side-Hotel ein Ort, an dem seit einigen Jahren kontinuierlichFotoausstellungen in <strong>Friedrichshain</strong> präsentiert werden.Hinter der Oberbaumbrücke bis hin zur Elsenbrücke erstreckt sichdas Gebiet des Berliner Osthafens. <strong>Die</strong> alten Speicher wurden saniert,umgebaut und bekamen neue Nutzer.Aus dem ehemaligen Eierkühlhaus ist die Konzernzentrale von Uni-85
versal Music geworden. In einemSpeicher residiert jetzt die MTV-Zentrale.Noch wie in alten Zeiten werden in derHafenkantine vor allem HafenarbeiternSpeisen angeboten. Ein beeindruckendesGemälde in der Gaststätte, das unter Denkmalschutz steht, erinnert andie schwere Arbeit, die früher hier geleistet wurde.<strong>Die</strong> letzte Station unseres Rundgangs ist der Speicher, der zur privatenEntertainmentschule umfunktioniert wird. Drei Glasanbauten zur Spreehin künden davon, dass bald auch hier kulturelle Veranstaltungenstattfinden werden.R. K.86
8. StralauVom Rudolfkiez nach Alt-Stralau zur LiebesinselDer letzte Rundgang führt uns durch denRudolfkiez, auch Stralauer Kiez genannt, nach Alt-Stralau. Wir beginnen unseren Rundgang an derPromenade zwischen der U-Bahnlinie und derStraße Warschauer Platz am denkmalgeschütztenGebäude der Fachhochschule für Technik undWirtschaft Berlin. Unter der U-BahnstationWarschauer Straße befindet sich einer dergefragtesten Clubs Berlins, der Matrix Club, unddie Narva-Lounge. Gegenüber stehen die Gebäudedes ehemaligen Berliner Glühlampenwerks, das1906 erbaut wurde. Der sehr große Firmenkomplexwurde auch Lampenstadt genannt. Um die Größeder Lampenstadt zu vermitteln wurde einelfgeschossiger Turm gebaut, der als Berlins ersterWolkenkratzer galt. Der weithin leuchtendegläserne Aufsatz des Gebäudes III soll an dasWahrzeichen dieses ehemaligen Industriestandorteserinnern und wurde nach der Restaurierung unddem Umbau der Firmengebäude zu dem modernen<strong>Die</strong>nstleistungszentrum „Oberbaum-City“ auf dasalte Gebäude gesetzt. <strong>Die</strong> Lampenstadt des Osram-Werkes wurde im Krieg schwer zerstört. 1949wurde der Betrieb in den VEB „BerlinerGlühlampenwerk Rosa Luxemburg“ umgenannt,das später zum Narva-Kombinat gehörte. Seit 1992gibt es hier keine lichttechnische Produktion mehr.<strong>Die</strong> alten unter Denkmalschutz stehendenGebäude in der Rother-, Nagler-, Ehrenburg- undRudolfstraße wurden entkernt und für das<strong>Die</strong>nstleistungszentrum neu gestaltet.Unser Rundgang führt uns durch die mit Glasund Brunnen aus slowenischem Tuffgestein gestaltetenInnenhöfe der Gebäude bis zur Ehrenberg-Matrix Club &Event GmbHAnschrift:Warschauer Platz 1810245 BerlinTel.: 030/29 36 99-90 Internet:www.matrix-berlin.deNarva LoungeBerlinAnschrift:Warschauer Platz 1810245 BerlinTel.: 030/29 36 999-0 Internet:www.narva-lounge.de89 87
„Intershop 2000““Schaufenster desOstens”Anschrift:Ehrenbergstr. 3 - 710245 BerlinTel.: 030/31 80 03 64 Internet:www.intershop2000-berlin.de Öffnungszeiten:Mi-Fr 14.00-18.00Sa 12.00-18.00So 12.30-18.00Hinweis:Sonderöffnungszeitenkönnen telefonischvereinbart werden.Reisegruppen sindwillkommen!Hier befindet sich der „Intershop 2000“, einetransportable Raumerweiterungshalle, nach ihrereinstigen Produktionsstätte auch Both-Hallegenannt. Zu DDR-Zeiten stand diese Halle alsIntershop der Mitropa am Ostbahnhof. Dortwurden Waren gegen D-Mark verkauft. Seit demUmzug der Halle an den jetzigen Standort im Jahre1998 werden „überlebte“ Ostprodukte ausSammlungen, Restbeständen oder von Fabriken,die auch nach der Wende weiter produzieren, zumVerkauf oder zum Tausch angeboten. Eine zweiteHalle ist für Ausstellungen geplant. Der Verein zurDokumentation der DDR-Alltagskultur betreut dieVerkaufs- und Ausstellungsstätte.Weiter geht’s die Rotherstraße entlang inRichtung Rudolfplatz. Hier ist das Zentrum desKiezes, das bisher noch nicht richtig wieder belebtwerden konnte. Der Rudolfplatz sowie dieRudolfstraße sind nach dem Grundbesitzer Rudolfvon Stralow benannt. 1240 wurde er erstmalig alsBesitzer des Dorfes Stralow urkundlich erwähnt.Am parkähnlich gestalteten Platz stehen dieZwinglikirche, die Emanuel-Lasker-Oberschuleund das Umspannwerk Am Rudolfplatz. Alle dreisind denkmalgeschützt. Im rechten Flügel derEmanuel-Lasker-Oberschule befindet sich dasRudi-Nachbarschaftszentrum. Nach dem Kriegbeherbergte es zeitweilig ein Standesamt. An der90
Ecke Modersohn/Rudolfstraße sind das <strong>AWO</strong>-Projekt „Bayouma-Haus“ und die Jugendeinrichtung„<strong>Die</strong> Nische“ angesiedelt. Das Geländeist wie ein kleiner Kinderbauernhof mit Tieren undStällen angelegt. Das Bayouma-Haus wurde 1995als Beratungszentrum für Migranten gegründet, alsdie in der ehemaligen DDR lebenden Ausländernach der Wende vor einer schwierigen Situationstanden, und hat sich zu einer InterkulturellenBegegnungsstätte der <strong>AWO</strong> entwickelt.Besonders sehenswertist die Zwinglikirche,eine Kirche, die keineGemeinde mehr hat undin der zurzeit eineökumenische Jugendgemeindeaufgebaut werdensoll.Der Aufbau desStralauer Viertels begann1903. Damit wuchs dieevangelische Gemeindeund 1905 wurde mitdem Bau der Zwinglikirche begonnen, die 1908eingeweiht wurde. <strong>Die</strong> Kirche wurde nach demSchweizer Reformator Ulrich Zwingli benannt(1484-1531), der sich unter anderem für dieAbschaffung des Fastengebots einsetzte. 1978schloss sich die Zwingli-Gemeinde mit derGemeinde Stralau zusammen. <strong>Die</strong> Kirche wurdeverpachtet und diente von 1982 bis 1993 alsArchiv. Danach wurde sie renoviert und von 1995bis 1997 wieder als Kirche genutzt. Über 40 Orgelnwurden in der Kirche gelagert, doch der Plan, einOrgelmuseum einzurichten, konnte nicht realisiertwerden. So wartet diese Kirche auf eineWiederbelebung, die sie und den Rudolfplatzwieder zum Zentrum des Kiezes macht.Bayouma-HausInterkulturelleBegegnungsstätteAnschrift:Rudolfstraße 15b10245 BerlinTel.: 030/29 04 91 36 Internet:www.bayouma-haus.de Öffnungszeiten:Mo-Do 9.00-17.00Fr 9.00-16.0091
Q 3 A (Strandbar)Anschrift:Stralauer Allee 210245 BerlinTel.: 030/29 35 29 14Vom Rudolfplatz gehen wir die Corinthstraße zurMarkgrafenstraße hinunter, zur Straße Alt Stralauunter der S-Bahnunterführung hindurch. Dortbeginnt die Uferpromenade von Alt-Stralau. Seitder Wende hat sich die Landzunge zwischen Spreeund Rummelsburger See kolossal verändert. <strong>Die</strong>Industriebetriebe wurden stillgelegt und ein neuesWohnviertel entstand, die WasserstadtRummelsburger Bucht. Eine Promenade fastdurchgängig an der Spree und am RummelsburgerSee wurde angelegt und lädt die <strong>Friedrichshain</strong>erzur Naherholung ein.An der Uferpromenade liegt die Strandbar Q3A,in der man sich erholen und auch ab und anMusikveranstaltungen besuchen kann. Nicht weitdavon entfernt befindet sich eine kleine Parkanlage.Dort erinnert eine 1964 von Hans Kies geschaffeneGedenkstätte an den Aufenthalt von Karl Marx inStralau im Jahre 1837. Karl Marx studierte von1836 bis 1841 hauptsächlich Philosophie, aber auch<strong>Geschichte</strong> in Berlin. <strong>Die</strong> Gedenkstätte besteht auszwei Stelen. Auf der einen Stele ist ein Relief vonKarl Marx abgebildet, auf der anderen Seitediskutiert eine Gruppe von Männern an einemGartentisch und zeigt Marx in der Diskussion mitJunghegelianern. Auf der anderen Stele ist dasMotiv des Glasarbeiterstreiks von 1901 zu sehen.Heute erinnern eine Industrieruine und dieGlasbläserallee in Alt-Stralau daran, dass sich aufder Halbinsel einst eine Glashütte befand, von der1901 der erfolgreiche Streik der Glasarbeiter fürganz Deutschland ausging. <strong>Die</strong> Darstellung zeigtdie große Bedeutung, die die Schriften von KarlMarx für die Arbeiterbewegung hatte. Auf derRückseite der Stele ist das Marx Zitat zu lesen: „<strong>Die</strong>Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt aber darauf an, sie zu verändern.“<strong>Die</strong>ser Satz hat heute noch Gültigkeit, betrachtet92
man die enormen Veränderungen und die Steigerung der Lebensqualitätdes Stadtteils <strong>Friedrichshain</strong> für alle Bewohner in den letzten Jahren.Unser Weg führt uns nun die Straße Alt-Stralau entlang zur altenevangelischen Dorfkirche Alt-Stralau. Von 1459 bis 1464 wurde dieseKirche erbaut und ist somit das älteste Gotteshaus <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong>. Inder Kirche kann man eine große Anzahl von mittelalterlichenKunstwerken besichtigen. <strong>Die</strong> Ruhe des sie umgebenden an der Spreegelegenen Friedhofs ist für jeden Besucher zu spüren. Nicht weit hinterdem Friedhofsgelände beginnt eine Parkanlage an der Tunnelstraße, diesich bis zur Spitze der Halbinsel hinzieht. <strong>Die</strong> Tunnelstraße ist nach dem1900 hier gelegenen Spreetunnel benannt, der zerstört wurde.Seit 1574 bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts fand in Alt-Stralaudas populärste Berliner Volksfest, der Stralauer Fischzug statt, wurdeaber eingestellt und existiert nicht mehr. Neue, auch kleinere Festewerden aber begangen wie z. B. im Mai das Kunst-Stral-Fest auf demGelände der „Alten Weberei“ Alt Stralau 4.An der Spitze der Landzunge beginnt wieder die Promenade, die sichrund um den Rummelsburger See hinzieht. Auf der anderen Seite derSpree in Treptow ist die Insel der Jugend zu sehen. Dort kann mankleine Tret- oder Ruderboote ausleihen und über die Spree zu der<strong>Friedrichshain</strong>er Insel Kratzbruch und rund um die Liebesinsel rudern,die unter Naturschutz stehen. Etwas versteckt am Uferrand findet mandie nach „Paul und Paula“ benannte Parkbank, eine Remeniszenz an dieDreharbeiten zu dem gleichnamigen Film von Heiner Carow, BuchUlrich Plenzdorf, der ein Stück <strong>Friedrichshain</strong>er Zeitgeschichte Anfangder 1970er Jahre spiegelt und dann nach 1976 in der DDR verboten war.Wir schlendern noch ein kleines Stück die Promenade entlang. UnserRundgang endet auf dem Aussichtsplatz an der Promenade, von dem wireinen wunderschönen Blick auf den Rummelsburger See haben.R. K.93
Jugendklub E-LokIn der Laskerstraße 6 - 8 entwickelte sich im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative Urban II das Modellprojekt ÖkologischesBildungszentrum Lasker Höfe. Durch die Zusammenarbeit desJugendklubs E-Lok mit einem großen Ausbildungsbereich entstand einOrt, der Freizeit und Ausbildung miteinander verbindet.Neben den Projekträumen für Sport, Musik und Computerarbeitbefinden sich hier eine Küche, eine Werkstatt, ein Familiencafé sowie einTonstudio.Auf dem großen Freigelände können sich Besucher auf einemKletterturm, einer Boulderwand und in einem Niedrigseilgarten sportlichbetätigen. Im Garten gibt es einen Lehmofen und einen buntenBauwagen. Auf dem Nachbargrundstück entsteht in Abstimmung mitdem Jugendzentrum ein Bürgerpark mit Bolzplatz.Darüber hinaus bietet das Zentrum auch Beratung beim Übergangvon Schule und Beruf an, hilft Migranten, berät bei Familienrechtsproblemen,Schadensregelungen und Schulden.Des Weiteren sind im Haus Breakdancer, Trommler, dieMusikgruppen „Böse Mädchen“ und „Hoodcrime“, die Behindertengruppe„Händi-Käp“ und die „workstation - Ideenwerkstatt Berlin e.V.“aktiv. Volkshochschulkurse besonders im Bereich Bildende Kunst undkostenlose Sprachkurse in Englisch und Deutsch ergänzen neben YogaundQigongkursen die Palette des soziokulturellen Zentrums.Der Jugendclub ist von montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 20Uhr geöffnet, das Familiencafé kann von 13.30 bis 18.00 und nachAbsprachen besucht werden.Adresse: Laskerstraße 6 - 8, 10245 Berlin, Kontakt: 030/29 77 26 10, Internet: www.jugendclub-elok.de94
Jugendklub FreibeuterDas aus Expo-Geldern erbaute Jugendfreizeitschiff „Freibeuter“ liegtdirekt an der Rummelsburger Bucht. Seit dem 1. Mai 2000 könnenJugendliche ab 12 Jahren hier in der Werkstatt, im Tonstudio, imFitness- oder Computerraum ihre Fähigkeiten erproben und Neueslernen. Darüber hinaus helfen die Mitarbeiter bei den Hausaufgaben undbieten unterschiedliche Kurse an.Sonntags lädt das Jugendcafé ein, dessen Einnahmen demJugendbereich zu Gute kommen.Ferner kann das Schiff für Feiern und Veranstaltungen gemietetwerden.Das Schiff ist montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr geöffnet, dasCafé lädt am Sonntag von 14 bis 18 Uhr zum Verweilen ein.Adresse: Kynaststraße 17, 10317 Berlin, Kontakt: 030/29 00 87 13, Internet: www.foerderverein-berlin.org/schiff.htm95
AusblickIn diesem Wegweiser ist nur ein Ausschnitt der <strong>Geschichte</strong> und derheutigen kulturellen Aktivitäten <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong> dargestellt. Überall, wounsere Rundgänge uns hinführten, waren die Zerstörungen des ZweitenWeltkriegs und der vierzigjährigen Teilung der Stadt noch gegenwärtig.Der Stadtteil veränderte sich seit der Wende rasant. Viele Häuser undGebäude wurden umgebaut und saniert, neue Ideen umgesetzt und vieleskreativ und farbenfroh gestaltet. <strong>Friedrichshain</strong> ist ein multikulturellerStadtteil geworden. Alte und junge Menschen mit sehr unterschiedlichenErfahrungen leben hier. Sich mitzuteilen, aus dem Vergangenen zulernen und die Zukunft zu gestalten ist das Anliegen dieses Wegweisers.Wir hoffen, dass die Arbeiterwohlfahrt <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong> Ihnen,den ewig jungen Leuten, dazu mit diesem Buch Anregungen gibt.96
AuswahlbibliographieAllgemeine Literatur über <strong>Friedrichshain</strong>Abramowski, Wanja, Boxhagen zwischen Aufruhr und Langeweile. EineStadtgeschichte, Berlin-<strong>Friedrichshain</strong> 2003.Bouali, Kerima; Schulze, Maren, Bewegte Zeiten. <strong>Friedrichshain</strong>zwischen 1920 und heute, Berlin 2000.Denkmale in Berlin, Bezirk <strong>Friedrichshain</strong>, hg. vom LandesdenkmalamtBerlin, Berlin 1996.Engel, Helmut (Hg), Standort Berlin-Ostkreuz. Historische Knorr-Bremse – Industriekomplex im Wandel, Berlin 2000.Feustel, Jan, Spaziergänge in <strong>Friedrichshain</strong>, Berlin 1994.Feustel, Jan, Turmkreuze über Hinterhäusern: Kirchen im Bezirk Berlin-<strong>Friedrichshain</strong>, Berlin 1999.Friedel, Rudi, Berlin <strong>Friedrichshain</strong>: Ein historischer Spaziergang, Berlino.J.Fuchs, Claudia, Erinnerungen zwischen Gelb und Blau, in: BerlinerZeitung vom 01.12.2003, S. 22.Girod, Regina; Lidschun, Reiner; Pfeiffer, Otto, Nachbarn: Juden in<strong>Friedrichshain</strong>, Berlin 2000.Köcher, Romy, Plastiken, Denkmäler und Brunnen imBezirk <strong>Friedrichshain</strong>, Berlin 1993.Körting, Katharina, Sport- und Erlebniszentrum. Jede Woche einRohrbruch. Trotz alledem: Das SEZ in <strong>Friedrichshain</strong> machtweiter..., in: Tagesspiegel vom 06.12.2000, S.15.Mende, Hans-Jürgen; Wernicke, Kurt (Hg), Berliner Bezirkslexikon<strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong>, Berlin 2003.Molter, Sabine, Rundgänge durch Quartiere in <strong>Friedrichshain</strong> undPrenzlauer Berg: rund um den Volkspark, 2. aktualisierte Auflage,Berlin 1993.Naumann, Heike, Der <strong>Friedrichshain</strong>: <strong>Geschichte</strong> einer BerlinerParkanlage, Berlin 1994.Schmidl, Karin, Im Wellenbad gibt es künftig Kleinkunst. Im SEZ sollenmehrere Nutzungen getestet werden, in: Berliner Zeitung vom30.06.2004, S. 18.97
Wiebel, Martin, East Side Story. Biographie eines Berliner Stadtteils,Berlin 2004.Zimmermann, Felix, Ein Kessel Buntes, in: <strong>Die</strong> Zeit vom 20.03.2003,S. 48/49.Über politische EreignisseDer Friedhof der Märzgefallenen. Dorn im Auge der preußischenObrigkeit. Erinnerung an ein Denkmal. Eine Ausstellung derGeorg-Weerth-Oberschule in Zusammenarbeit mit dem Paul-Singer-Verein e.V. vom 04.03. -14.03.2003.Ein Projekt der AG des PW-Profilkurses des Heinrich-Hertz-Gymnasiums (2002/03), http://www.heinrich-hertzschule.de/homepageag/projekte/index.html.Flemming, Thomas, Der 17. Juni 1953, Berlin-Brandenburg 2003.Gelieu, Claudia von, Frauen in Haft. Gefängnis Barnimstraße. EineJustizgeschichte, Berlin 1994.Jucharcz, Marie, Sie lebten für eine bessere Welt. Lebensbilder führenderFrauen des 19. und 20. Jahrhunderts, Hannover 1971.Sandvoß, Hans-Rainer, Widerstand in <strong>Friedrichshain</strong> und Lichtenberg(Bd. 11 der Schriftenreihe über den Widerstand in Berlin von 1933bis 1945, hg. von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand), Berlin1998.<strong>Die</strong> Bluesmessen (1979-86). Ein Kapitel des Widerstandes in der DDR(DVD), Bezirksmuseum <strong>Friedrichshain</strong>/<strong>Kreuzberg</strong> in Zusammenarbeitmit der Alice-Salomon-Fachschule, Berlin 2006.98
BelletristikDöblin, Alfred, Berlin Alexanderplatz: die <strong>Geschichte</strong> von FranzBiberkopf. Mit einem Nachwort von <strong>Die</strong>ter Forte, Frankfurt amMain 2004.Flügge, Gerhard, Das dicke Zillebuch, Berlin 1971 ( 7 1982).Girgensohn, Katrin; Jakob, Ramona (Hg), Alles bleibt anders.<strong>Friedrichshain</strong>er Kaleidoskop der Erinnerungen II, Berlin 2003.Loest, Erich, Durch die Erde ein Riß. Ein Lebenslauf, Hamburg 1981.Loest, Erich, Sommergewitter, Göttingen 2005.Heym, Stefan, 5 Tage im Juni, München 1974.Lewald, Fanny, „Erinnerungen aus dem Jahre 1848“, 2. Band,Braunschweig 1850.Schulz, Torsten, Der Boxhagener Platz: Ein Roman, München 2004.Stave, John, Stube und Küche. Erlebtes und Erlesenes, Berlin 1987,4. erneuerte erweiterte Auflage 1994.ZeitungenBerliner AbendblattBerliner WocheBerliner ZeitungDer Tagesspiegel99
DanksagungDen Anstoß zu diesem Projekt gab uns Frau Dorit Lorenz, die uns die<strong>Geschichte</strong> und Kultur <strong><strong>Friedrichshain</strong>s</strong> näher gebracht hat. An dieserStelle möchten wir ihr sehr herzlich danken.100
ImpressumHerausgeber:Arbeiterwohlfahrt <strong>Friedrichshain</strong>-<strong>Kreuzberg</strong> e. V.Karl-Marx-Allee 93a, 10243 Berlin 030/42089034www.awo-friedrichshain.deKonzeption, Texte, Zusammenstellung: Ruth Köppen, AngelicaHilsebeinFotos: Ruth KöppenLayout: Eileen KoskaRedaktionsschluss: 01. Januar 20071. AuflageAlle Rechte vorbehalten