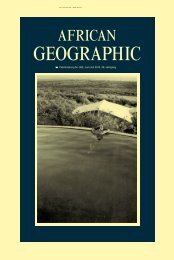Fabrikzeitung 255 – Pop am Ende? - Rote Fabrik
Fabrikzeitung 255 – Pop am Ende? - Rote Fabrik
Fabrikzeitung 255 – Pop am Ende? - Rote Fabrik
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
erstattungen in den Musikzeitschriften.Dort, wo das Musikgeschäft noch nichtvöllig zus<strong>am</strong>mengebrochen ist, dümpeltes lust- und belanglos vor sich hin.Den Hypes um Bands wie Arctic Monkeysoder Franz Ferdinand merkt manbereits beim Lesen an, dass sie keinerleiDringlichkeit besitzen, relativ willkürlichsind und schon gar nicht irgendeinenpopkulturellen Erdrutsch werdenauslösen können wie einst die Sex Pistolsoder <strong>–</strong> bedingt noch <strong>–</strong> Nirvana.Kein Kanon mehrDer Bedeutungsverfall von <strong>Pop</strong> wirdauch daran deutlich, dass sich seit denNeunziger Jahren kein Kanon mehr herausgebildet hat. Es fehlt an Leitfiguren,ja überhaupt an N<strong>am</strong>en, auf derenAkzeptanz sich eine grössere Gruppevon Menschen noch einigen könnte.Die «500 besten Alben aller Zeiten»,die der «Rolling Stone» 2003 gekürthat, sind ein schönes Beispiel für dieseOrientierungslosigkeit. Auf den ersten100 Plätzen finden sich ausschliesslichAlben von etablierten Künstlern vor1980, darunter Bob Dylan, The Beatles,Van Morrison, The Who, Led Zeppelin,J<strong>am</strong>es Brown und Pink Floyd. DieNeunziger Jahre kommen gerade nochmit «Nirvana» vor, die Zeit seit derJahrtausendwende gar nicht mehr. Erstauf den hinteren Plätzen schleichen sichhin und wieder N<strong>am</strong>en wie Radiohead,PJ Harvey, Coldplay und Jane’s Addictionein <strong>–</strong> doch alleine die willkürlichanmutende Nennung dieser N<strong>am</strong>en unterstreichtden anachronistischen Rock-Kanon der Jury. Mit ihrem alten Wertesystemkommen sie seit der Zeit, alsKolja ReichertIm Online-Archiv der «New YorkTimes» findet sich die älteste Meldungzum Thema Musikpiraterie. Sie st<strong>am</strong>mtvom 13. Juni 1897, aus der Gründerzeitder Phonoindustrie. «Kanadische Piraten»verschickten Raubpressungen vonSchallplatten über die Grenze und verkauftensie zu einem Zehntel des Originalpreises.Zeitungen druckten Listender verfügbaren Stücke <strong>–</strong> eine Art frühePirate Bay. 50 Prozent Umsatzeinbussenbeklagte die Industrie und forderte,dass die Post die Sendungen filtere.Eine vergleichsweise milde Massnahme,gemessen <strong>am</strong> Internet-Ausschluss, densich heute die Tonträgerindustrie fürFilesharer wünscht. Die Politik reagierenicht hart genug auf Internetpiraterie,begründete Dieter Gorny, Geschäftsführerdes Bundesverbands der Musikindustrie,die Absage der Branchenmesse<strong>Pop</strong>komm in Berlin und sorgteallseits für Kopfschütteln. Mark Chungvom Verband Unabhängiger Tonträgerunternehmen,der die Indie-Labelvertritt, sagt: «Starke Vereinfachungenhelfen niemandem.» Das Internetist nämlich nicht der Feind der Musik.Es ist nur der Feind der Tonträgerindustrie.Nach Wachswalze, Schallplatte,Magnetband und CD hat sich Musikvom physischen Träger gelöst undlässt sich mit geringem Aufwand beliebigoft kopieren. Legale Musikdownloadsmachen zwar in Deutschlandnoch nicht 39 Prozent des Marktes auswie in den USA; doch sind die Erlöseim ersten Quartal dieses Jahres wiederum 16 Prozent gestiegen. Bei allen Debattenum illegale Downloads geht esnicht um einen Konflikt zwischen Künstlernund Publikum, wie die Industrie ihnseit Jahren lautstark inszeniert. DerenInteressen lassen sich im Netz wunderbarvereinen.Die Do-It-Yourself-FrauNiemand führt die neuen Verhältnissegerade selbstbewusster vor als dieAmerikanerin Amanda Palmer, Sängerindes Cabaret-Rockduos DresdenDolls. Will Amanda Palmer ihr Publikummobilisieren, braucht sie kein PR-Büro und keine Konzertagentur. ÜberTwitter lädt sie zu Strandkonzerten mitGruppenfoto oder zur Spontanpartyin einer Stripbar. Einen Pressetermin<strong>Pop</strong> nicht mehr in Form von zyklischenBewegungen auftritt, nicht mehr zurecht.Daher wohl auch Nirvana alseinzige Nennung einer jüngeren Bandunter den «Top 100»: Grunge als medialkonstruiertes Phänomen war der letzteverzweifelte Versuch von Presse undTonträgerindustrie, so etwas wie eineBewegung zu installieren. Doch selbstin dieser Beurteilung liegt der »RollingStone« falsch, denn sollte Grunge jenseitsder medialen Blase je eine Rollegespielt haben, dann war «SuperfuzzBigmuff» von Mudhoney gegenüber«Nevermind» die mit Abstand wichtigereund musikalisch bessere Platte.Aber selbst diese Nerd-Unterscheidung,welche Platte zu welcher Zeit wegweisend,besser oder wichtiger war, wagtsich kaum mehr ein Kritiker auf die Musikder letzten Jahre anzuwenden. Esgibt sie zwar noch, die Jahreschartsvon «Spex», «Rolling Stone» oder «Musikexpress»,doch alle Beteiligten wissenim Grunde, dass es sich dabei umeine Farce handelt und das Gelistetevon Gossip bis Bloc Party, von Hot Chipbis Tomte keinerlei musikhistorischeWegmarke, sondern höchstens so etwaswie die Spitze des Wahrgenommeneninnerhalb der neuen Unübersichtlichkeitdarstellt.Die gute Tat der Piratenin einem leeren Kaufhaus verwandeltesie in ein Gratiskonzert für 350 Fans.An einem Freitagabend im Mai entstandbei einem Massenchat ein T-Shirt-Spruch. Palmer gestaltete direkt <strong>am</strong>Laptop die Druckvorlage, ein Freundsetzte einen kleinen Online-Shop auf.Am <strong>Ende</strong> der Nacht waren 200 T-Shirts verkauft. Am Tag darauf weitere200. In ihrem Blog zog die SängerinBilanz: «Einnahmen durch Twitter inzwei Stunden: 11 000 Dollar. Einnahmendurch mein Major-Soloalbum diesesJahr: 0 Dollar.» So klingt die Verzückungeiner Künstlerin, die ihre Machtentdeckt <strong>–</strong> und vorführt, dass die Zeiten,in denen sich Künstler von Managernsagen lassen mussten, wo eslanggeht, endgültig vorbei sind.Der Fan als ManagerIm Prinzip lassen sich heute alle Aufgabeneiner Plattenfirma <strong>–</strong> Aufnahme, Design,Booking, Buchhaltung <strong>–</strong> selbst erledigenoder an Freunde delegieren;während Fans in Netzwerken wie last.fm durch automatische Empfehlungenvia Geschmacksprofil für Werbung sorgenoder über Fundraising-Foren gleichin die Rolle des Investors schlüpfen undGeld für Produktionen vorstrecken. Zuletzts<strong>am</strong>melte Patrick Wolf das Geld fürsein viertes Studioalbum über die WebsiteBandstocks. Auch die Kölner BandAngelika Express finanzierte ihr letztesAlbum mittels «Angelika Aktien» imWert von 50 Euro, 80 Prozent der Einnahmensollten zurück an die Fans fliessen.Es streckt ohnehin kaum noch einLabel Geld für Studioaufenthalt undProduktionskosten vor. Lieber kauft manfertige Bänder. Die vier verbliebenenRiesen Sony, Universal, EMI und Warnersehen ihre Zukunft im Lizenzhandel fürMode, Werbung, Filme und Computerspiele.Sogenannte 360-Grad-Verträgesichern das Mitverdienen an allen Aktivitätender Künstler, vor allem an denKonzerteinnahmen. Auch Bertelsmannspielt, nachdem sich der Konzern 2008von Sony gelöst hatte, jetzt mit BMGRights Management wieder auf dembrummenden Rechtemarkt mit. Das Geschäftder erhabenen Alten: die Nachlassverwaltung.So sind neue Künstlerweitgehend sich selbst überlassen.Es schiessen Kleinstlabels aus dem Boden,die oft nicht mehr veröffentlichenals die Musik ihrer Gründer. Der BerlinerPressungsdienstleister Handle WithCare kann sich vor Aufträgen kaum retten<strong>–</strong> er hat sich auf Kleinstauflagen unter1000 spezialisiert.Der Künstler als UnternehmerEin Musterbeispiel erfolgreicher Selbstvermarktungim Netz ist der BerlinerDJ Alexander Ridha alias Boys Noize,der 2005 Boys Noize Records gründete.Auf der Website Hype Machine,die Hörempfehlungen beliebter Musikblogszus<strong>am</strong>menfasst, tauchen regelmässigseine Remixe auf. Währendandere Labels ihre Musikdateien entfernenlassen, hat Alexander Ridha dafürgar nicht die Zeit. Virales Marketingund kreatives Schaffen gehen beiihm in eins und führen zu einem endlosenStrom aus Clubgigs, Studioaufenthaltenund Myspace-Updates. SeineMusik verkauft Ridha vorwiegend überbeatport.com, das führende Downloadportalfür elektronische Tanzmusik, dasbeweist, dass im Netz auch hohe Preisegezahlt werden, solange die Klangqualitätstimmt. Wer ein zahlungswilligesPublikum erreichen will, muss in dengrossen Online-Stores präsent sein: iniTunes, music load und Amazon Mp3,das seit April aggressiv auf den deutschenMarkt drängt. Der Weg dorthinführt allerdings über Label und Zwischenhändler,sogenannte Content Aggregatoren.Abkürzen lässt er sich überQuasilabels wie «Artists without a Label»,das mit einem einfachen Standardvertragdie Präsenz auf iTunes undhohe Anteile sichert; Ausstieg jederzeitmöglich. Die Arctic Monkeys begannenhier, die Editors und Tina Dico. InDeutschland bietet das Bandportal regioactive.deeinen ähnlichen Zusatzservice,allerdings haben sich die 65 EuroStartgebühr bisher für kaum jemandenausgezahlt <strong>–</strong> online sein alleine reichteben nicht, um gehört zu werden.Lieber verschenken?Der DJ Martin Juhls erhielt hingegenweltweit Aufträge, nachdem er seineMusik gratis unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlichte, wiesie auch für freie Software üblich ist.Einzelgänger und AussenseiterBis in die frühen 1980er-Jahre hineinerschien im Rowohlt-Verlag eine Taschenbuchreihemit dem Titel «RockSession». Dort wurde über so <strong>am</strong>bitionierteMusiker wie Throbbing Gristle,Chrome, Pere Ubu und XTC geschrieben,im Anhang befand sich das«Lexikon der Aussenseiter». In diesem«Lexikon der Aussenseiter» gab esKurzportraits von unter anderem KevinCoyne, Townes Van Zandt, The Sonics,Phil Ochs, Peter H<strong>am</strong>mill und 13thFloor Elevator zu lesen. Eine krude Mischungalso. Und doch folgte die Auswahleiner inhärenten Logik, denn gelistetwurden Künstler, die es zu einerbestimmten Zeit und innerhalb einesbestimmten Genres nicht zu der ganzgrossen <strong>Pop</strong>ularität gebracht hattenund die dennoch etwas Eigenes aufweisen.Aus Townes Van Zandt wurde nunmal kein zweiter Johnny Cash, aus PhilOchs kein zweiter Bob Dylan, aus PeterH<strong>am</strong>mill kein zweiter Peter Gabriel,obwohl man es ihnen allen gegönnthätte. Und doch handelt es sich wederum Vergessene noch um Verschollene.Nun ist allerdings die spannende Frage,wie solch ein «Lexikon der Aussenseiter»heute aussehen würde, wenn mandarin ausschliesslich Künstler aus den2000ern listen wollte. <strong>–</strong> Schnell würdedeutlich werden, dass es die altenAbstufungen nicht mehr gibt. Entwederjemand ist drinnen im ganz grossenGeschäft oder er ist es nicht. Undweil 98% aller Musiker nicht drin sind,müssen wir uns angewöhnen, nahezudie komplette Branche als ein S<strong>am</strong>melbeckenvon Aussenseitern zu betrachten.Die Tatsache, dass sich die gegenwärtige<strong>Pop</strong>landschaft fast nur nochaus Aussenseitern und Einzelgängernzus<strong>am</strong>mensetzt, die trotz oder geradewegen uferloser Plattformen wie mySpacenur eine geringe Reichweite haben,bedeutet nicht, dass es keine guteMusik mehr gäbe. Im Gegenteil: Seltenwar das Angebot an undogmatischer,nonkonformer Musik so grosswie in den letzten Jahren. Doch diejenigen,die uns die allgemeine Verfügbarkeitals Segen preisen und die digitaleBoheme zum Zustand nie gekannterFreiheit erklären, verkennen die ökonomischenBedingungen: Die derzeitspannendste und beste Musik ist zwarjederzeit verfügbar, obwohl kein Radiosendersie mehr spielt und obwohl keinMusikmagazin mehr über sie schreibt.Aus diesem Grund wird sie in der Regelaber auch von 18- bis 25-Jährigen gespielt,die sich dies als spätpubertärenLuxus leisten, so lange sie noch keinenGedanken an Krankenversicherung undanderen finanziellen Ballast verschwendenmüssen. Das geht für ein paar Jahregut, dann verschwindet die jeweiligeBand wieder von der Bildfläche. Odersie setzt, wie das bei Animal Collectiveder Fall ist, mehr und mehr auf Vermarktbarkeit.Der Verschleiss an gutenMusikern ist so hoch, weil niemandmehr bereits ist, für Idealismus zu zahlen.Wolfgang Brauneis vom Kölner Labelund Vertrieb »a-Musik« hat daraufhingewiesen, dass Musik, die keineKompromisse an den Markt eingeht,langfristig wohl nur überleben kann,wenn sie sich in das Feld der BildendenKunst begibt. Im Rahmen von Ausstellungenund Kunst-Events besteht fürMusiker zumindest noch die Möglichkeit,halbwegs realistische Gagen zubekommen.Sie erlaubt, das Werk für private Zweckebeliebig zu kopieren. Das meistverkaufteMp3-Album 2008 bei Amazonwar «Ghosts» von Nine Inch Nails <strong>–</strong> obwohlzuvor mit CC-Lizenz veröffentlicht.In Deutschland könnten mehr Künstlerdiesen Weg gehen, würde die GEMAhierfür Tantiemen einführen <strong>–</strong> nur einBeispiel, wie ausbleibende politischeWeichenstellungen die neuen Möglichkeitenbehindern. Dass das Internet allesvon selbst regle, erweist sich ebensoals Aberglaube wie die Hoffnung, esliesse sich beliebig regulieren. Die schönenErfolgsbeispiele zeigen bislang vorallem, wie es gehen könnte <strong>–</strong> aber leidernoch viel zu selten geht. Für Starsist es leicht, in den neuen Kanälen gutauszusehen. Die grosse Frage ist, wieneue Künstler ihr Publikum finden. Hiersieht Indie-Vertreter Mark Chung derzeitschwarz: «Die neuen unter denfünf Millionen Künstlern, die ihre Myspace-Seiteneingerichtet haben, merkenschnell, dass es keinen gibt, der in sieinvestiert.» Die gute Nachricht: Künstlerdürfen in Zukunft wesentlich grössereStücke des Kuchens beanspruchen. Dieschlechte: Der Kuchen ist alleine schwerzu backen. Andreas Gebhard von derAgentur «newthinking communications»sieht hier einen wachsenden Markt fürBeratungs- und Software-Dienstleistungen.Auch der Staat wäre gefragt, seine«Initiative Musik» auszubauen. Wasinfrastrukturelle Förderung bringenkann, zeigt das <strong>Pop</strong>musterland Schweden.Die Industrie bezichtigt die Internetpiratengerne des Raubbaus. Einepikante Vereinfachung, denn nichts verschwindet,wenn man eine Datei kopiert,im Gegenteil: Hinterher hat manzwei. Doch dafür waren die alten Vertriebsstrukturennicht gemacht. Neuebilden sich erst aus. Es geht um nichtweniger als die Frage, wie die Gesellschaftin Zukunft ihre Künstler entlohntund ihre kulturelle Erneuerung sichert.«Die Trias aus Schöpfern, Interpretenund Hörern driftet auseinander», beklagtChristian Höppner, Generalsekretärdes Deutschen Musikrats. «Jederverfolgt seine Interessen, anstatt einengemeins<strong>am</strong>en Lösungsweg zu suchen.»Auf der einen Seite steht eine Industrie,die ihre Gewinne <strong>am</strong> liebsten einszu eins ins neue Medium hinüberrettenwürde; auf der anderen Seite eineNischen sind kein <strong>Pop</strong>Dies bedeutet allerdings auch, dasswir uns davon verabschieden müssen,im Zus<strong>am</strong>menhang mit all den derzeitexistierenden musikalischen Nischennoch von «<strong>Pop</strong>» zu sprechen. Mit«<strong>Pop</strong>» im Sinne von «populär» hat alldas nichts mehr zu tun. Es handelt sichvielmehr um ausdifferenzierte, hochkomplexeästhetische Darbietungen, dieSpezialwissen voraussetzen. Ein Beispiel:Obwohl eine Band wie die US<strong>am</strong>erikanischenWoods den ein oderanderen Song in ihrem Repertoire hat,der das Zeug zum Klassiker hätte undeinem Beatles-Song in nichts nachsteht,werden die Woods nie den Status derBeatles erreichen. Zum einen nicht, weildie Woods sowieso nur von einem Spezialistenpublikumwahrgenommen werden,das mit den Verästelungen derLoFi-, Post-Punk- und Neofolk-Spartenvertraut ist; zum anderen nicht, weildie kulturellen Rahmenbedingungenfür Phänomene wie die Beatles, RollingStones oder Bob Dylan nicht mehr gegebensind. Vorstellungen vom unmittelbarNeuen, Wegweisenden, für das dieBeatles einmal standen, sind im posthistorischen<strong>Pop</strong> unmöglich geworden.Die Kids hingegen stört das kaum. DasNeue ist ihnen egal geworden. Sie hörendie Plattens<strong>am</strong>mlungen ihrer Elterndurch, laden sich die Doors auf deniPod und tragen T-Shirts von Nirvana.<strong>Pop</strong> war gestern.Wenn von illegalen Musikdownloads die Rede ist, wird oft das <strong>Ende</strong> der Musikindustrie beschworen.Dabei verschiebt das Internet vor allem die Machtverhältnisse von Künstlern und Konzernen.grosse Hörerschaft, die nicht einsieht,warum sie für ein unbegrenzt kopierbaresDatenbündel noch immer 10 Eurozahlen soll. Und dazwischen die Künstler,auf sich selbst gestellt und ohne eigeneInteressenvertretung, in der nichtauch die Verwerter mitsprechen würden.Ein Zus<strong>am</strong>menschluss der Urheberist eine der Chancen, die in einem öffentlichorganisierten Vergütungssystemwie der Kulturflatrate liegen. Es könnteerstmals eine exakte Abrechnung zwischenKünstler und Hörer schaffen unddie Tauschbörsennutzer an die Kasseholen. Industrie und CDU würden diePiraten lieber gleich vom Internet trennen.Legalisierung oder Sanktionen <strong>–</strong>eine Frage für die nächste Legislaturperiode.Die Do-It-Yourself MesseDie Musikkonzerne verlieren den Anschlussan die Diskussion. Die BerlinerMesse findet nun ohne sie statt: als offeneKonferenz, bei der die Teilnehmerdas Progr<strong>am</strong>m mitgestalten wie ineinem Online-Forum. Die Entstehungder «all2gethernow» erinnert stark anAmanda Palmers T-Shirt-Aktion: Gornysagt die <strong>Pop</strong>komm ab, Internet-ExperteAndreas Gebhard ruft MusikunternehmerTim Renner an, der ruft das Radialsysteman, man setzt eine Website auf,gründet einen Verein und in wenigenTagen ist die ganze Berliner Musikszeneim Boot. Es gibt Diskussionsbedarf,das zeigen auch die Rahmenprogr<strong>am</strong>meder Kölner c/o <strong>Pop</strong> und des H<strong>am</strong>burgerReeperbahnfestivals. ZehnJahre ist es her, dass die erste TauschbörsensoftwareNapster das <strong>Ende</strong> derCD einläutete. Inzwischen sitzt der ersteInternetpirat im Europaparl<strong>am</strong>ent. Kulturpiraten,argumentiert der MusikjournalistMatt Mason in seinem gratis imNetz veröffentlichten Buch „The Pirate’sDilemma“, sind nicht der Feind. Sie erfindenneue Stile, Technologien und Geschäftsmodelle.Ohne ihre Innovationenwäre die heutige Kulturindustrie nichtdenkbar. Umgekehrt hiesse das: Mit ihrenIdeen wird die morgige denkbar.Elvis PresleyMarc BolanCassie GainesSteven GainesRonnie Van ZantTerry KathSandy DennyKeith MoonChris BellDonny HathwayJohn RitchieLowell GeorgeMinnie RippertonJohn GlascockBon ScottJacob MillerTommy CaldwellIan CurtisMalcolm OwenJohn Bonh<strong>am</strong>Steve TookDarby CrashJohn LennonTim HardinBill HaleyMike BloomfieldRobert HiteRobert MarleyHarry ChapinAlex HarveyBilly FuryKaren CarpenterPete FarndonTom EvansDennis WilsonJackie WilsonMarvin GayeEsther PhillipsSteve GoodmanNicholas DingleyDavid ByronIan StewardDennes BoonRick NelsonAlbert GrossmanTracy PewCarlton BarrettDalidaPaul ButterfieldScott SterlingPeter ToshCliff BurtonWill ShatterAndy GibbChet BakerChrista PaffgenRoy BuchananRobert CalvertVincent CraneJohn CipollinaPete De FreitasAllen CollinsRic GrechAndrew WoodSteve MarriottStiv BatorsBrent MydlandStevie VaughanTom FogertyTony DuhigSteve ClarkJohnny ThundersGene ClarkDavid RuffinEric CarrFreddie MercuryBill Grah<strong>am</strong>Dave Rowboth<strong>am</strong>Stefanie SargentPaul HackmanSteve GilpinRonnie BondHelnoEddie HazelJohn C<strong>am</strong>pbellGG AllinMia ZapataRay GillenMichael Clarke
Chris WilpertMainstre<strong>am</strong> der Nebensächlichkeiten<strong>Pop</strong> als Inszenierungsform kann noch gar nicht tot sein, solange wir uns der Illusion derEchtheit weiter hingeben. Lasst uns also feiern, bald kriegen wir als Ergänzung zum Beatles-Rockstar-Spiel für die Playstation auch den DIY-Web2.0-Ego-Shooter.1985 hatte Michael Jackson für lächerliche47,5 Millionen US-Dollar die Rechtean 251 Beatles-Songs erkauft, die eraber 1995 aufgrund seiner Schulden1995 wieder verkaufen musste, immerhinzum doppelten Preis. Während derMichael-Jackson-Ausverkauf jetzt natürlichauf Hochtouren läuft, jeder Supermarktsich eine eigene Devotionalieneckemit Postern, T-Shirts und sogarCDs von Michael Jackson einrichtete <strong>–</strong>wobei die CDs vermutlich die Wenigsteninteressieren <strong>–</strong>, muss man sich fragen,ob das Interesse an seiner Figur imFalle eines neuen Albums ebenso ungebrochenweiter gelaufen wäre. Zugleicherschien dieser Tage eine grossangekündigte Beatles-Box, im StereoundMono-Mix. Der Stereo-Mix, angeblichden neuen Hörgewohneiten angepasst(was natürlich sofort zum Vorwurfdes Lautheitswahns führte) kann hiervernachläsigt werden, da er, anders alsder Mono-Mix, nicht verspricht authentischzu sein. Dagegen käme der Monomixden Originalaufnahmen angeblich<strong>am</strong> nächsten, und noch dazu ist der limitiert!Der Mono-Mix ist echt! Wie früher!Auratisch! Limitiert! Wenn das malkein Argument ist. Das führt gleich zurleidigen Tonträgerdebatte. Denn andersals auf der High-End-Anlage ist es beiMP3s nun fast schon egal, ob sie in Stereooder Mono sind.Beatles im LautheitswahnHängen wir uns lieber an dem Wort«limitiert» auf: D<strong>am</strong>it kann man nichtnur jedeN Beatles-S<strong>am</strong>mlerIn locken,auch alle, die einer Subkultur anhängen.Wenn eine Platte oder ein Tapenur limitiert genug ist (egal ob auf 30,300 oder 3000 Stück), <strong>am</strong> besten nochhandbemalt, dann verkauft sich dasschon fast von alleine, unabhängig davon,wie gut die Musik ist. Es spieltdann auch keine Rolle mehr, dass diePlatte nur noch in den den gut sortierenSchrank wandert, schliesslich hat mansie eh schon auf dem Player.Woher kommt gerade in Subkulturen,und dabei ist es egal ob Hardcore, Antifolkoder Hip-Hop, diese Begeisterungfür das Greifbare, für den «echten»Tonträger? Als Beweis, dass das Kunstwerkin seiner organisierten Dauer bestehenkann, dass es nur in seiner Reproduktionwahrhaftig wird und gegendas Verschwinden in der digitalen Weltbesteht? Als Beweis dafür, dass man einen«besseren» Geschmack hat als Britney-Spears-Fans?Was können derenFans denn dafür, dass es die Alben zuerstals MP3-Download gibt und nie alsnummeriertes buntes Vinyl mit mundgehäkeltemCover? Zumal ein Britney-Spears-Album häufig interessanter istals so mancher marginale Tape-Realeasevon einem Konzertmitschnitt.«Yeah Yeah Yeah»Apropos Konzerte: Jene bieten scheinbardie letzte Bastion des Authentischen.Höchstens Star-Club-GängerInnenwürden bestreiten, dass die Beatles<strong>am</strong> Besten waren, als sie nicht mehrlive auftraten. Und auch gar nicht mehrlive auftreten konnten: Weder hättedie Anlage die Fans übertönen können,noch wäre der pompöse Studioaufwandlive reproduzierbar gewesen.Kein Wunder, dass Bands wie die Residentsoder die Gorillaz einfach hintereinem Vorhang spielen, ihren Filmoder ihre Alter-Egos darauf projizieren<strong>–</strong> und höchstwahrscheinlich auchnoch die Musik vom Band laufen lassen.Und wen stört das? Ein Micheal-Jackson-Konzert ohne Moonwalk wäreundenkbar gewesen, dass die Musikdabei nicht live war, dieser Illusion gabsich ohnehin kaum jemand hin. <strong>–</strong> Allerdingsbildete Michael Jackson zus<strong>am</strong>menmit Prince und Madonna in denAchtziger Jahren noch eine <strong>Pop</strong>-Avantgarde,ähnlich den Beatles und VelvetUnderground in den 1960ern, währendes heute, wo es keine Garde mehr gibt,der es voraus zu sein galt. Stattdessenverschwimmt im rhizomatischen Netzder Beliebigkeiten auf den Web2.0-Plattformen alles zu einem unispiriertenund uninspirierenden Nebeneinander,wo alle auf ihren Blogs oder Myspace-/Facebook-Profilen <strong>am</strong> «Next Big Thing»arbeiten. Ensprechend zeichnet sichjede Band durch den Eklektizismus aus,kein Review in dem dieses Wort nichtmehr fällt, als Beweis dafür wie gekonntsich die Band in der <strong>Pop</strong>geschichtepositioniert und alles davorgeweseneaufsaugt und vermischt.«Ich will meine Szene wieder haben!»So wie Emo. Oder das böse E-Word,wie es bereits 1989 in Dischord-Kreisenhiess. Zwanzig Jahre später kannman auch Teil dieser Jugendbewegungsein, wenn man mit H&M und nicht mitDischord sozialisiert wurde. Ausverkauf?Natürlich, wenn man nicht aufdie «richtigen» Bands steht, und dieGrenzen des guten Geschmacks sind inder Subkultur eng. Es geht um den vermeintlichauthentischen Anspruch, unterallen Umständen dem Vorwurf desKommerz zu entgehen.Jetzt, wo eine Bewegung wie Emocoreschon fast wieder vorbei ist <strong>–</strong> auch soeine missglückte Verheissung des Authentischenvon <strong>Pop</strong>: dass sich darin diegrossen Gefühle transportieren liessen!<strong>–</strong> tauchen als nachfolgende musikalischeSpielarten im Post-Emo/Metalcore-Gewand Phänomene wie Crabcoreauf: um das Authentische der Gefühleim Emo nachgerade durch Lächerlichkeitpreiszugeben. Die Rückkehr zuden Posen zeigt, dass es bloss um denschnellen Witz geht, nicht um Inhalte.Wo Posen bei den Beatles noch fehlten,bei David Bowie noch subversiv warenoder zumindest extraterrestrisch, beiMichael Jackson noch sexy, entlarvensie jetzt nur noch den Rockismus.«I got blisters on my fingers!»Ganz andere Strategien, um das Echtheits-und Authentizitätsversprechenvon <strong>Pop</strong> zu unterlaufen hatte Antifolkentwickelt. Quasi als Antwort aufdie Verheissung des möglichst Purenund Reduzierten, war der Aufnahmeprozessselbst zur Schau gestellt worden.Auf verrauschten Homrerecording-Albenerzeugt die Anwesenheitvon Verkehrsgeräuschen, Telefonklingeln,Räuspern und Verspielern fürden Hörer den Eindruck grösstmöglicherNähe. Gleichzeitig scheint in dieserperformativen Unfertigkeit und Fehlerhaftigkeitaber auch die Kritik anden klaren und sauberen Produktionendurch. Die Fehlerhaftigkeit als Beweis,dass auf Overdubs etc. verzichtetwurde, tritt progr<strong>am</strong>matisch in denVordergrund: Fehler is King, Fragilitätzeugt von Authentizität. In der scheinbarenNähe, die zu den Zuhörendenaufgebaut wird, und die in den Wohnzimmerkonzertenoch einmal potenziertwird, steckt aber nicht immer nurdie Kritik an den der unmöglichen Echheit,manchmal dominiert auch das banaleBedürfnis nach dieser Illusion vonNähe. Dass Antifolk auch nur noch ineiner kleinen Nische seine Open-Mic-Sessions abhält, während der Folk wiedervon bärtigen Barden wie BonniePrince Billy dominiert wird, zeigt,dass <strong>Pop</strong> als pathetischer Pomp nicht<strong>am</strong> <strong>Ende</strong> ist, solange immer noch die Illusionvon Authentizität über die Darstellungderselben triumphiert. Ob mandemnächst zusätzlich zum Beatles-Rockband-Spiel für die Konsole auchden ganz authentischen Egoshooter ausder Perspektive von Mark David Chapman,dem Mörder von John Lennon,serviert bekommt?Frank Apunkt SchneiderVom Konfliktstoff zum KonsensmaterialDie alte <strong>Pop</strong>geschichte war eine lange Erzählung darüber, wie gut sich Konflikte anfühlen. Vomklassischen Generationskonflikt mit den Eltern führte die Konfliktlinie ins Innere von <strong>Pop</strong> und verd<strong>am</strong>pftean der Jahrtausendschwelle in einer Wolke muffiger Toleranz.Traditionellerweise verbindet sich mit«<strong>Pop</strong>» die mehr oder weniger diffuseVorstellung eines Generationenkonflikts,die in den Nachkriegsjahrzehntengeprägt wurde. Die sozialen und ökonomischenUmbrüche der fünfziger undsechziger Jahre hatten aus den Jugendlichen«die Jugend» gemacht, eine sozialeFormation, die ungefähr dieselbenNöte, Bedürfnisse und Interessen teilte.Da die Produktionsverhältnisse immerbesser ausgebildete Subjekte erforderten,durchliefen Jugendliche immer längereAusbildungszyklen. Ihre Kaufkraftstieg; um sie abzuschöpfen, entstandder Jugendmarkt. Dessen Produktebrachten die Erfahrungen und Wünsche«der Jugend» in eine Warenform,indem sie sie zugleich ansprachen undherstellten. <strong>Pop</strong> redete ihr den Wunschnach Freiheit und Selbstverwirklichungein. Und erlöste sie d<strong>am</strong>it von Stumpfsinnund Langeweile, die ein zu Ruhe,Anstand und Ordnung verdonnertes Lebenbedeuteten <strong>–</strong> für die Dauer einerSchallplatte, eines Films.Teenage Kicks gegen den Kitt<strong>Pop</strong> brachte «die Jugend» in Konfliktmit dem, was die Gesellschaft fürsie vorgesehen hatte und versah ihnmit Sinn und Sinnlichkeit. Der alte Kittplatzte ab, die Jugendlichen annulliertenden alten Generationsvertrag<strong>–</strong> zumindest vorübergehend. Um denSound der Unruhe zu übersetzen, entstandenkomplexe Register aufrührerischerGesten und Codes. In diesenEntfremdungszeichen schufen sich dieJugendlichen eine neue Identität, diein der Zurückweisung derjenigen bestand,in die sie hineingeboren waren.Das war politisch, ohne Bezug aufklassische Politikbegriffe. Die neue Politikvon <strong>Pop</strong> bestand in der selbst verordnetenEntfremdung. In der Befreiungaus der Umkl<strong>am</strong>merung durchHerkunft und Milieu. Die bürgerlicheKultur und ihre Vermittlungsinstanzenliessen sich provozieren und in denKonflikt ziehen. Sie bekämpften <strong>Pop</strong> alsetwas diffus Bedrohliches, nannten ihnaufrührerisch, gefährlich, laut, störendund artfremd. Indem sie ihn rassifizierten,gaben sie Einblicke in die tatsächlicheStruktur bürgerlicher Identität. IhreAngst vor <strong>Pop</strong> erhöhte fraglos seinenReiz, setzte aber auch eine Eskalationsspiralein Gang: Um weiterhin denheissen Konfliktstoff zu liefern, der dieGesellschaft zwang, sich zu offenbaren,musste <strong>Pop</strong> sich ständig verändernund in Bewegung bleiben. Nur so konntedas unspezifisch zwischen Party undRevolte oszillierende Aufbegehren immerweiter gehen.Rollenkonfliktmodell RockstarWeil aber Haarlängen als Provokationnicht lange vorhielten, mussten immerneue Konfliktherde installiert werden.War <strong>Pop</strong> ursprünglich in subversiverWeise apolitisch, um sich der staatsbürgerlichenTeilhabepflicht zu entledigen,solidarisierte er sich bald mit denneuen politischen Bewegungen. DieRockstars wiederum bemühten sich,durch antisoziales Verhalten, den altenKontrakt weiterhin zu erfüllen. Sie versuchtendie Nobelhotelzimmer, in denensie mittlerweile abstiegen, wenigstensein bisschen stilvoll zu verwüsten.Um sich von handelsüblicher Prominenzabzugrenzen, legten sie mythischeAbgänge hin. Sie spielten so dieRollenkonflikte, die sich ihrer bemächtigthatten, noch einmal durch: Die Drogen-und <strong>Pop</strong>tode der frühen siebzigerJahre waren aber eher Abgesänge aufdie Ekstasen der Sechziger. Wer die Exzesseüberlebte, driftete <strong>–</strong> enttäuschtvon der Veränderung, die 1968 danndoch nicht stattgefunden hatte <strong>–</strong> kurzdarauf in freudlose Kompromisse mitder bürgerlichen Kulturtradition: Prog-, Jazz- und Bombastrock. Innerhalbnur weniger Jahre war <strong>Pop</strong> ein nützlichesMitglied der Gesellschaft geworden:ein nicht weiter störender Bestandteiljugendlichen Freizeitverhaltens. Die<strong>Pop</strong>sozialisierten der Anfangsjahre begannendie gesellschaftlichen Schlüsselpositionenuntereinander aufzuteilenund erklärten sich bereit, gesellschaftlicheVerantwortung zu übernehmen.Doch plötzlich sprang die alte Konfliktmaschinewieder an und rettete <strong>Pop</strong><strong>–</strong> noch einmal <strong>–</strong> vor sich selbst: «Dakämpft man als Rockmusikfan für dieGesellschaftsfähigkeit des Rock, undnun möchte man bald sagen, die Punksmachen uns alles kaputt», j<strong>am</strong>merte1978 ein Leserbrief an den «Stern».Punk war der erste popinterne Generationskonflikt,ein Angriff auf die ältere<strong>Pop</strong>generation, ihre Gesetztheit undArriviertheit.Rip it up and start againPunk unterzog die etablierten <strong>Pop</strong>werteeiner radikalen Umwertung. Und dasmit unverhohlener Feindseligkeit. Aggressionund Destruktion waren neueWerte, die er gegen eine Pokultur setzte,die ihre alten Werte verraten hatte.Aus der <strong>Pop</strong>geschichte, deren Verlaufer gut beobachtet hatte, wusste er,dass er sich schnell wieder selbst abschaffenmusste. Er musste sich verändern,um den neu aufgebrochenenKonflikt nicht wieder einschlafen zu lassen.Zumindest ahnten dies einige derProtagonistInnen. Sie verwarfen die rockistischeForm, die Punk kurz daraufannahm, und in der er bis heute dahinvegetiert,und erfanden neue: New undNo Wave, Industrial, Zitatpop usw. Sopflanzte sich der Konflikt fort und versorgtedie <strong>Pop</strong>geschichte mit der nötigenEnergie, um bis zum Erscheinenvon Hiphop und Techno durchzuhalten,die die <strong>Pop</strong>landschaft noch einmalaufwühlten und die Leute dazu zubrachten, ihre Plattens<strong>am</strong>mlung in dennächstgelegenen Second-Hand-Ladenzu tragen. Wie d<strong>am</strong>als 1976 anlässlichvon Punk.Viele Stile, wenig ZieleAber mit Grunge hatte zu Beginn derNeunziger bereits ein anderes ModellPremiere. Grunge schielte bereitsauf die Abwrackprämie für das historischeModell der <strong>Pop</strong>revolte. Er wiederholteleere Gesten der Abgrenzung,ohne eine wirkliche Idee zu haben, weroder was genau das Objekt dieser Abgrenzungsein sollte. Er konnte sichnicht einmal dazu durchringen, Punkund Hardcore loswerden zu wollen. Derenrechtzeitige Wiederabschaffunghatten bereits die Achtziger versäumt.Grunge legte sich einfach zwischen sieund wurde dort eine antriebsschwacheNische. Immerhin enthielt seine melancholischeZiellosigkeit noch das Wissen,dass es einmal Ziele gegebenhatte. Sie passte ganz gut in die wunderbareNischenvermehrung der Zeit:Noch mehr Stile, Nebenstile, Mischstile,die aber nichts mehr überwinden wollten.Schon gar nicht einander. Sie wurdeneinfach Mehrdesselben. Ihr gutnachbarschaftlichesNebeneinanderbesass kaum Konfliktpotential. Jedekleinbürgerliche Neubausiedlung warein Pulverfass dagegen.All together now<strong>Pop</strong> begann sich allmählich anzufühlenwie ein evangelischer Kirchentag.Bands wie Tomte wurden vorstellbar.Selbst Metal-Fans sprachen plötzlichund unaufgefordert von Toleranz. DerDJ wurde der beste Freund der Indiemusikerin,die sich gerade mit Beatsund S<strong>am</strong>ples neu erfunden hatte, beidesteckten sich von nun ab regelmässigihre Promo-CDs zu. Das fühlte sich gutan, fast idyllisch, klang aber umso uninteressanter.Eine Mischung aus Songund Track k<strong>am</strong> auf, die meist wederals Song noch als Track funktionierte.Das war das Abschiedsgeschenk der90er: <strong>Pop</strong> hatte sich mit einer Welt versöhnt,in der sowieso irgendwie alle<strong>Pop</strong> hörten.<strong>Pop</strong> scheint sich wohl zu fühlen als Bestandteildes neuen Gemeinschaftsgefühls,als Konsens und Staatsräson. Seinealten Konflikte zeigt er noch stolzvor: im Museum oder als historisch-kritischeNeuausgabe. Sie sind Bestandteilnationaler <strong>Pop</strong>identitätskonstruktion.<strong>Pop</strong>kompetenz gehört heute zur Grundausstattungder Subjekte. Sie lassensich von ihm nicht mehr provozieren.<strong>Pop</strong> artikulierte die Nöte der Kids inder Disziplinargesellschaft. In der Kontrollgesellschafthat es ihm in dem Massedie Sprache verschlagen, dass erimmer weiterplappern muss. Auf seinealten Tage ist er also doch noch einnützliches Mitglied der Gesellschaft geworden,das sich hüten wird, den Ast,auf dem es sitzt, noch mal zu Kleinholzzu verarbeiten.
Frank ZappaRhett ForresterKurt CobainEric GaleKristen PfaffDanny GattonFred SmithAlan BlakleyTed HawkinsMelvin FranklinVivian StanshallSchwichtenbergSelena QuintanilLee BrilleauxCarl AlbertRory GallagherPhyllis HymanLouise DeanSean HayesJerry GarciaDwayne GoettelShannon HoonMathew AshmanTony Willi<strong>am</strong>sJeffrey PierceBernard EdwardsBradley NowellJon MelvoinChas ChandlerRob CollinsTupac ShakurNick AclandTownes Van ZantRandy CaliforniaBrian ConnollyChris WallaceLaura NyroJeff BuckleyJohn ChristianWoltersFela KutiRay BarbieriLuther AllisonTommy TedescoJohn DenverGlenn BuxtonMike HutchenceTim KellyJohann HölzelCarl WilsonRobert PilatusDarren RobinsonEva CassidyL<strong>am</strong>ont ColemanGuy MitchellChristopher RiosOfra HazaTito PuenteGlenn HughesJoey R<strong>am</strong>oneJohn PhillipsAaliyah HaugtonGeorge HarrisonJason MizellLisa LopesOtis BlackwellDee Dee R<strong>am</strong>oneMary HansenBarry WhiteRick J<strong>am</strong>esLaura BraniganRussel JonesLuther VandrossEugene RecordLink WrayJ<strong>am</strong>es YanceyLynden HallSoraya JimenezJ<strong>am</strong>es BrownDavid ShaymanKevin DubrowIke TurnerUm Lee-RaIsaac HayesSeb HackertMichael JacksonMary Travers