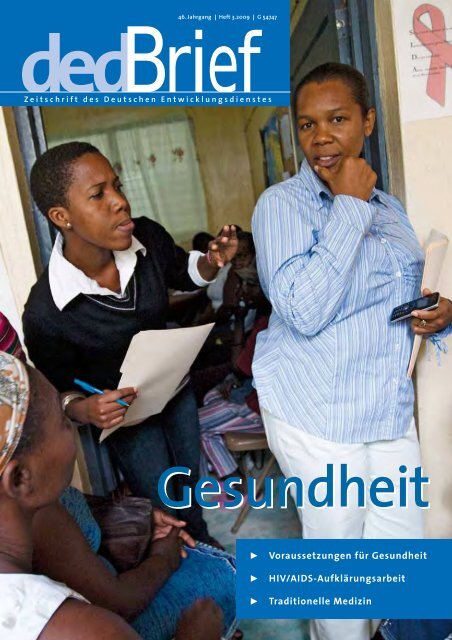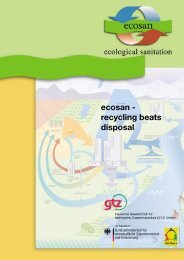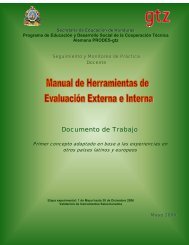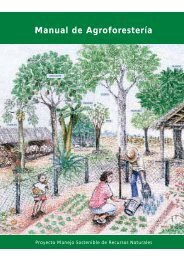Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
46. Jahrgang l<br />
Brief<br />
Heft 3.2009 l G 54747<br />
Zeitschrift des Deutschen Entwicklungsdienstes<br />
Gesundheit<br />
3 Voraussetzungen für Gesundheit<br />
3 HIV/AIDS-Aufklärungsarbeit<br />
3 Traditionelle Medizin
�<br />
Brief 3.2009<br />
INHALT<br />
SPEKTRUM<br />
Andreas Kahler<br />
Mining Watch –<br />
Wie Solwezi in Brüssel Gehör findet 4<br />
Martin Jovanov<br />
Ein Land mit solchen Naturreichtümern<br />
kann die Armut überwinden 6<br />
Was Kondome sind,<br />
weiß heute jeder,<br />
aber ist auch allgemein<br />
bekannt,<br />
dass es spezifische<br />
Frauenkondome gibt?<br />
Sie spielen eine<br />
wichtige Rolle bei<br />
der HIV/AIDS-Aufklärungsarbeit<br />
in Kamerun. Die Autorin versucht<br />
mit Unterstützung ihrer DED-Kolleginnen und<br />
Kollegen, das Thema HIV/AIDS in den Partnerorganisationen,<br />
direkt am<br />
21<br />
Arbeitsplatz der Menschen,<br />
zu thematisieren. Seite<br />
THEMA<br />
Peter Schmitz<br />
Es gilt, das Recht auf Gesundheit<br />
zu verwirklichen 8<br />
Olga Platzer<br />
Kambodscha –<br />
Schicksale hinter den Zahlen 13<br />
In Kambodscha sterben immer noch viele Frauen<br />
bei der Geburt ihres Kindes. Ein erster Schritt, um<br />
etwas dagegen unternehmen zu können, sind<br />
Maternal-Death-Audits. An Hand der Befragungsergebnisse<br />
können Ursachen für die hohe Müttersterblichkeit<br />
aufgezeigt und das Bewusstsein dafür<br />
geschärft werden, was bereits vor der<br />
13<br />
Geburt getan werden muss, um im<br />
Notfall schnell reagieren zu können. Seite<br />
Sabine Rundgren<br />
Kenia –<br />
Sie leiden ein Leben lang an den Folgen 16<br />
Winfried Zacher<br />
HIV/AIDS –<br />
Alle müssen Verantwortung übernehmen 18<br />
Meike Winterhagen<br />
Kamerun –<br />
Emanzipation des Kondoms – das Femidom 21<br />
Yvonne Sartor<br />
Sambia – <strong>Info</strong>rmiere Dich, schütze Dich<br />
und zeige Solidarität mit HIV-Positiven 24<br />
Christine Inongo<br />
Sambia – Ich habe mein Leben<br />
meiner Arbeit gewidmet 26<br />
Till Winkelmann<br />
Äthiopien – Kaffeezeremonien<br />
und Coming Out von HIV-Positiven 28<br />
Die Diskriminierung von HIV-positiven<br />
Menschen ist auch in Äthiopien ein großes<br />
Problem. Eine junge Frau, Genet, hat sich<br />
mutig öffentlich zu ihrer Krankheit bekannt<br />
und engagiert sich jetzt für andere Betroffene.<br />
Für den Abbau von Vorurteilen und Ängsten<br />
ist besonders die Aufklärungs-<br />
28<br />
arbeit in der direkten<br />
Nachbarschaft wichtig. Seite<br />
Christiane Boecker<br />
Malawi / Haiti –<br />
Gesundheit darf kein Geschäft sein 31<br />
Alexander Riesen<br />
Brasilien – Ein Schiff wird kommen 34<br />
Wie kann man in<br />
einem Land mit<br />
den Dimensionen<br />
Brasiliens Gesundheitsversorgung<br />
auch an entlegene<br />
Orte bringen? Zum<br />
Beispiel mit dem Hospitalschiff Abaré, das<br />
73 Gemeinden an den Flussufern des Tapajós<br />
in Amazonien anläuft. 25.000 Behandlungen<br />
werden jährlich auf dem Schiff vorgenommen,<br />
in schweren Fällen bringt das mitgeführte<br />
Schnellboot die Patienten<br />
34<br />
in das nächste Krankenhaus.<br />
Seite
Patrick Sakdapolrak<br />
Indien – Vom Alltagskampf der armen<br />
Stadtbevölkerung um Gesundheit 37<br />
In Vietnam hat die traditionelle<br />
Medizin einen<br />
hohen Stellenwert, die<br />
Heilkundigen genießen<br />
großes Ansehen und<br />
Vertrauen. Auch wenn<br />
die westliche Medizin<br />
gerade von jüngeren<br />
Leuten mehr und mehr zu Rate gezogen wird, so ist dies oft<br />
nur zur Diagnose. Zur Behandlung wird auf traditionelle<br />
Heilmittel zurückgegriffen, nicht zuletzt,<br />
39<br />
weil diese billiger sind. Viele Mediziner<br />
praktizieren heute aber auch beides. Seite<br />
Joyce Dreezens-Fuhrke<br />
Vietnam –<br />
Vertrauen in die überlieferte Heilkunst 39<br />
Marielle Zöllner<br />
Haiti – Zum Vodoopriester oder zum Arzt? 41<br />
BLICKPUNKT<br />
Inland /Ausland 43<br />
Veranstaltungen 44<br />
KULTUR<br />
Literatur 45<br />
OFFENE STELLEN 47<br />
Impressum 47<br />
EDITORIAL<br />
Liebe Leserin, lieber Leser,<br />
in den letzten Jahren ist weltweit im Gesundheitsbereich<br />
das Augenmerk vor allem<br />
auf die Bekämpfung von HIV/AIDS gelegt<br />
worden. Dies geschah sicher zu Recht und<br />
es gibt immer noch unendlich viel zu tun,<br />
um diese Pandemie einzudämmen.<br />
Dennoch dürfen auch die anderen Gesundheitsprobleme der Entwicklungsländer<br />
nicht aus dem Blickfeld geraten, denn nach wie vor verursachen<br />
Durchfallerkrankungen, Malaria und Tuberkulose dort die meisten Todesopfer.<br />
Ungelöst ist darüber hinaus das Problem, dass immer noch nicht ausreichend<br />
qualifizierte Fachkräfte für die Gesundheitsversorgung vor allem der ländlichen<br />
Bevölkerung zur Verfügung stehen.<br />
Unsere Autorinnen und Autoren haben zudem unterschiedliche Vorstellungen<br />
davon, wie die Gesundheitsversorgung in den DED-Partnerländern finanziert<br />
werden sollte: Ist es gerechtfertigt, dass Patienten für medizinische Leistungen<br />
etwas zahlen müssen oder ist es Aufgabe des Staates, eine Basisgesundheitsversorgung<br />
für alle kostenlos sicherzustellen? Kann der Staat dieser Forderung<br />
überhaupt nachkommen? In Brasilien zum Beispiel werden neue Wege<br />
beschritten, um auch den Bewohnern abgelegener Landstriche eine medizinische<br />
Grundversorgung zu gewährleisten.<br />
Und schließlich stellen unserer Autorinnen und Autoren fest, dass Gesundheit<br />
ganz entscheidend von den sozialen Lebensumständen der Menschen<br />
abhängt.Wollen wir also die gesundheitliche Situation der Menschen<br />
verbessern, dann muss es um soziale Grundsicherung gehen, um den<br />
Zugang zu sauberem Trinkwasser, um menschenwürdiges Wohnen,<br />
um ausreichende Nahrung und um Bildung.<br />
Wir näheren uns in diesem Heft dem Thema Gesundheit also unter vielen<br />
Aspekten und mit anschaulichen Beispielen aus unseren Partnerländern.<br />
Im Editorial des letzten Heftes haben wir Sie über den Wechsel in der<br />
Redaktion des DED-Briefes informiert. In dieser Ausgabe möchten wir<br />
Ihnen auch die neue Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DED,<br />
Angela Krug (linkes Foto), vorstellen. Angela Krug ist Politik- und Religionswissenschaftlerin<br />
und begann ihre berufliche Laufbahn in einem landund<br />
forstwirtschaftlichen Projekt des DED in Tansania. Heute hat sie langjährige<br />
Erfahrungen in Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit<br />
und war zuletzt Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Evangelischen<br />
Entwicklungsdienst.<br />
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und freuen uns über Ihre Kommentare.<br />
Maria Ehrke-Hurtado<br />
2<br />
3
SPEKTRUM<br />
� Brief 3.2009<br />
© Andreas Kahler<br />
Sambia<br />
Mining Watch –<br />
Wie Solwezi in Brüssel Gehör findet<br />
„Glokale“ Momente deutscher Demokratieförderung in Sambia<br />
Solwezi<br />
SAMBIA<br />
Lusaka<br />
Auch im Nordwesten<br />
Sambias ist die Weltwirtschaftskriseangekommen.<br />
Global oder<br />
Crunch sagt schlicht zur<br />
Erklärung, wer sich etwas<br />
nicht (mehr) leisten kann<br />
oder etwa Probleme hat,<br />
Schulden zurück zu zahlen.<br />
Bakwetu, ein lokales<br />
Nachrichtenmagazin,<br />
hat seine jüngste Ausgabe<br />
gleich mit einem Globus<br />
aufgemacht, um die Lage anzuzeigen.<br />
Dabei gilt noch immer ausgerechnet die<br />
Nordwest-Provinz als neue Boomregion<br />
Sambias, dessen Geschick seit jeher aufs<br />
Engste mit dem roten Metall zusammenhängt<br />
und dessen wichtigster Ballungsraum<br />
nicht zufällig Kupfergürtel (Copperbelt)<br />
heißt. Vergangenes Jahr hatte sich der<br />
Moderne Minenfahrzeuge.<br />
© Andreas Kahler<br />
Beeindruckende Dimensionen und laut Betreiber auch neue Standards hat die 2008 eröffnete Kupfermine Lumwana.<br />
Kupferbergbau vor allem im Nordwesten<br />
zu einem kaum geahnten Höhenflug aufgeschwungen,<br />
wodurch Solwezi, das Provinzhauptstädtchen,<br />
zum Aufbruchssymbol des<br />
New Copperbelt wurde. Investoren halten<br />
Einzug, Jobsucher strömen in den entlegenen<br />
Landesteil, um ihr Glück zu machen.<br />
Trieb bislang vor allem die Kupfer- und<br />
Goldmine Kansanshi das Geschehen voran,<br />
so übernimmt nun ein neues Bergwerk die<br />
Führung: Mit Lumwana nahm in Solwezi<br />
kürzlich die größte offene Gruben-Kupfermine<br />
Afrikas ihren Betrieb auf. – A New<br />
Mine! A New Standard!<br />
Während Sambias alter Copperbelt in den<br />
Augen Vieler seine Glanzzeit längst hinter<br />
sich hat, sieht die politische Klasse Lusakas<br />
den Nordwesten als den „Neuen Copperbelt“<br />
und Hoffnungsträger für Wachstum<br />
und Entwicklung. Zu Zeiten des Kupferbooms,<br />
2008, erregten die gigantischen<br />
Investitionen in Solwezi großes Aufsehen:<br />
Neben Kansanshi, der Stadt nah gelegenen,<br />
vor allem kanadischen Kupfer- & Goldmine,<br />
zog insbesondere Lumwana die Menschen<br />
in ihren Bann. Seit sie Ende 2008 ihren<br />
Betrieb aufgenommen hat, beansprucht<br />
Afrikas größte offene Kupfermine – die<br />
künftig auch Uranium abzubauen plant –<br />
„neue Standards“ zu setzen – selbst in<br />
Sachen Nachhaltigkeit.<br />
Welchen Nutzen<br />
hat der Bergbau für die Bevölkerung?<br />
Doch gleich ob Tage des Booms oder Rezessionszeiten<br />
die Wirtschaft prägen, mehren<br />
sich nun Stimmen aus der Zivilgesellschaft<br />
des Kupferlandes, die – unter dem Stichwort<br />
mining watch – nach dem Nutzen des<br />
globalisierten Bergbaus für die Sambier<br />
selbst fragen und negative Auswirkungen<br />
kritisieren. Neben der Kirchen nahen<br />
Nichtregierungsorganisation (NRO) Caritas<br />
hat sich in Solwezi die Civil Society for
Poverty Reduction (CSPR), ein Zusammenschluss<br />
von mehreren Dutzend Nichtregierungsorganisationen,<br />
dieser Kritik<br />
angenommen. Beide Organisationen sind<br />
Partnerinnen des Good-Governance-Programms<br />
von GTZ und DED.<br />
In unserer Zusammenarbeit mit dem Provincial<br />
Programme Management Team von<br />
CSPR kristallisierte sich der Aktionsbereich<br />
mining watch als ein bedeutender Schwerpunkt<br />
heraus. Ein Meilenstein war in dieser<br />
Hinsicht die Konferenz „First Northwestern<br />
Mining Watch“, zu der sich auf Einladung<br />
von CSPR und Caritas vergangenes Jahr<br />
erstmals Minen-Vertreter, Zivilgesellschaft,<br />
Verwaltung, Forschung und Medien im<br />
„Neuen Kupfergürtel“ von Solwezi trafen.<br />
(Eine Dokumentation ist online verfügbar.)<br />
Wissenschaftler wie Prof. John Lungu von<br />
der Copperbelt University stellten ihre neuen<br />
Forschungsergebnisse vor, aber auch CSPR<br />
präsentierte eine Studie über die Folgen des<br />
Grubenbergbaus in der Mine Kansanshi<br />
sowie über eine kleine Mine im Nachbardistrikt<br />
Kasempa, wo Umwelt und Arbeiter<br />
über langer Zeit mit wirklich krimineller<br />
Energie ausgebeutet wurden.<br />
Wie kann der Bergbau<br />
zur Armutsbekämpfung beitragen?<br />
Solwezi zeigt auch die Schattenseite des<br />
abrupten, kaum gesteuerten Wachstums.<br />
<strong>Info</strong>rmelle Siedlungen breiten sich aus, aber<br />
die Entwicklung der Stadt- oder Infrastruktur<br />
kommt kaum voran. Schon haben communities<br />
in Minennähe Probleme, an Wasser<br />
zu kommen. Neben der steigenden ländlichen<br />
Armut droht sich eine urbane<br />
Armut breit zu machen. Während die<br />
ausländischen Unternehmen große Gewinne<br />
machen, erhalten Provinz und Land<br />
nur wenige Einnahmen. Hinzu kommt<br />
das Risiko einer Fixierung auf den Bergbau:<br />
Davon zeugte der Niedergang des vormals<br />
glänzenden Copperbelts, als die Kupferpreise<br />
in den Keller gegangen waren.<br />
Zentrales, wiederkehrendes Thema ist natürlich<br />
die Frage, wie der hiesige Bergbau<br />
mehr zur Armutsbekämpfung beitragen<br />
könne; etwa durch Übernahme von Verantwortung<br />
der globalen Kupferunternehmen<br />
im Sinne von Corporate Social Responsibility,<br />
doch auch durch verbesserte Verhandlungsfähigkeiten<br />
der öffentlichen Verwaltung<br />
sowie der Regierung, wenn es um das Aushandeln<br />
der Auflagen und politischen Vorgaben<br />
zum Kupferabbau geht (Development<br />
Agreements).<br />
Momentan laufen die Vorbereitungen für<br />
eine Folgetagung – voraussichtlich mit Blick<br />
auf das Lumwana-Projekt, das den Spitzenplatz<br />
unter allen Investitionen in Sambia<br />
einnimmt. Es erhebt zugleich den höchsten<br />
Anspruch in Sachen Nachhaltigkeit. Und so<br />
prüfen die zivilgesellschaftlichen Akteure<br />
von CSPR nun, ob die Bergbaubetreiber<br />
tatsächlich ihr Wort halten. Als Lackmustest<br />
haben sie sich den Indikator Nahrungssicherheit<br />
ausgesucht, anhand dessen sie<br />
bewerten wollen, inwieweit Lumwana das<br />
Versprechen hält.<br />
Warum internationale Allianzen<br />
eingehen?<br />
Zusehends gewinnt das Engagement von<br />
CSPR dabei „glokalen“ Charakter. Und<br />
das hat durchaus seine Richtigkeit. Denn<br />
dadurch, dass an den Solwezier Bergbauprojekten<br />
vor allem mächtige, ausländische<br />
Investoren, einschließlich Entwicklungsbanken,<br />
beteiligt sind, müssen die Akteure<br />
der lokalen Zivilgesellschaft in ihrer Auseinandersetzung<br />
mit den global players der<br />
Rohstoffindustrie vermehrt internationale<br />
Allianzen eingehen.<br />
Counterbalance aus Brüssel (CEE Bankwatch<br />
Network/Counter Balance Coalition),<br />
ein Zusammenschluss europäischer Nichtregierungsorganisationen,<br />
die die Geldvergabepraxis<br />
der Europäischen Investitionsbank<br />
unter die Lupe nehmen und Ergeb-<br />
© Andreas Kahler<br />
Weitere <strong>Info</strong>rmationen zu den im Text<br />
genannten Organisationen:<br />
Civil Society for Poverty Reduction (CSPR):<br />
www.cspr.org.zm<br />
www.minewatchzambia.org<br />
www.counterbalance-eib.org<br />
4 5<br />
Offene Diskussionen gab es beim runden Tisch<br />
der ersten Northwestern Mining Watch-Konferenz.<br />
nisse ihrer „Fact Finding Missions“ in Afrika<br />
regelmäßig dem Europäischen Parlament<br />
vorlegen, besuchte in diesem Jahr das<br />
CSPR. Im Anschluss an diesen Besuch<br />
erhielt die CSPR-Koordinatorin Kypalushi<br />
Kapatamoyo von der italienischen NRO<br />
Campagna per la Riforma della Banca<br />
Mondiale (CRBM) eine Einladung und<br />
stellte das Solwezier Mining-Watch-<br />
Projekt auf dem zivilgesellschaftlichen<br />
G8-Gegengipfel im Juli 2009 in Italien<br />
vor. Die internationale Netzwerkbildung<br />
setzt sich also fort.<br />
Andreas Kahler<br />
Andreas Kahler ist Sozialwissenschaftler,<br />
Redakteur und Bildungsmanager und<br />
arbeitete von 2007 bis 2009 als Capacity-<br />
Building-Berater im Rahmen des GTZ-DED-<br />
Kooperationsprogramms Good Governance<br />
in Sambia.<br />
<strong>Info</strong>
SPEKTRUM<br />
� Brief 3.2009<br />
Bolivien<br />
Ein Land mit solchen Naturreichtümern<br />
kann Armut überwinden<br />
UNDP legt Studie über alternative Nutzungsmöglichkeiten der natürlichen Ressourcen vor<br />
Im November 2008 ist die Publikation des<br />
Entwicklungsprogramms der Vereinten<br />
Nationen (UNDP) mit dem Titel „La otra<br />
frontera“ zum Thema Alternative Nutzung<br />
der natürlichen Ressourcen in Bolivien erschienen.<br />
Die Studie soll als Grundlage dienen,<br />
um anhand von Ergebnissen und guter<br />
Beispiele eine Diskussion über eine nachhaltige<br />
Entwicklung in Bolivien anzustoßen.<br />
Die Leitfrage der Studie lautet: „Wie kann<br />
eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden,<br />
in der sich die Lebensbedingungen für<br />
die bolivianische Bevölkerung verbessern<br />
und die Armut unter Berücksichtigung des<br />
Umweltschutzes reduziert werden kann?“<br />
La Paz<br />
BOLIVIEN<br />
In Bolivien<br />
gehen jährlich<br />
immer noch<br />
große Waldflächen<br />
durch Abholzung<br />
verloren.<br />
Bolivien genießt einen großen natürlichen<br />
Reichtum mit einer außergewöhnlichen Artenvielfalt,<br />
üppigen Wasservorkommen und<br />
Bodenschätzen sowie einem bedeutenden<br />
Potenzial an Energieressourcen, vor allem<br />
große Erdgasvorkommen. Das laut Human<br />
Development Index ärmste Land in Südamerika,<br />
gehört zu den acht waldreichsten<br />
Ländern der Erde und befindet sich unter<br />
den 20 gering besiedeltesten Ländern der<br />
Welt. Laut Angabe des UNDP Berichtes<br />
hat das Land allerdings in den letzten zehn<br />
Jahren jährlich etwa 300.000 Hektar Waldfläche<br />
durch Abholzung und fortschreitende<br />
Agrarflächennutzung verloren. In vielen<br />
© Daniel Lüthi<br />
Fällen ist eine massive Umweltzerstörung<br />
durch eine kurzfristige, nicht nachhaltige<br />
Nutzung der natürlichen Ressourcen<br />
(Erdöl, Gas, Mineralien, Holzwirtschaft<br />
und konventionelle, großflächige Landwirtschaft)<br />
festzustellen. Die gewünschten positiven<br />
ökonomischen Auswirkungen der zumeist<br />
explorativen Wirtschaftsformen hin<br />
zu einem nachhaltigen und breitenwirksamen<br />
Wirtschaftswachstum, und der damit<br />
verbundenen Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten,<br />
konnten bislang nicht<br />
erreicht werden. Bolivien hängt nach wie<br />
vor von der Preisentwicklung auf den internationalen<br />
Rohstoffmärkten für Öl, Gas<br />
und Mineralien ab. Gleichzeitig nehmen<br />
Umwelt- und Ressourcenkonflikte, auch<br />
durch den Klimawandel bedingt, deutlich<br />
zu. Dass es dem bolivianischen Staat bisher<br />
nicht gelungen ist, durch Nutzung seiner<br />
reichhaltigen natürlichen Ressourcen seine<br />
Wirtschaft zu diversifizieren und ausreichend<br />
und vor allem qualitativ hochwertige<br />
Arbeitsplätze zu schaffen, lässt sich durch<br />
folgende Zahlen belegen: Während in<br />
Bolivien im Jahre 2007 ein Wirtschaftswachstum<br />
von fünf Prozent zu verzeichnen<br />
war, stieg die Zahl der Menschen, die unter<br />
der Armutsgrenze leben, um knapp 170.000<br />
weiter an. Dies zeigt offenbar, dass die ungleiche<br />
Verteilungspolitik zwar ein gesamtwirtschaftliches<br />
Wachstum bewirkt, ein<br />
pro-poor-growth, also eine Verbesserung der<br />
Lebenssituation der armen Bevölkerung<br />
aber bislang verhindert.<br />
Herausforderungen<br />
für eine nachhaltige Entwicklung<br />
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass<br />
angemessene Entwicklungschancen für die<br />
Mehrzahl der Menschen in Bolivien nur gesichert<br />
werden können, wenn der Naturverbrauch<br />
reduziert, natürliche Ressourcen in<br />
Wert gesetzt und nachhaltig bewirtschaftet<br />
werden. Entwicklungsziel muss daher sein,<br />
dass Bolivien künftig die Wertschöpfung in<br />
den alternativen und traditionellen Sekto-
en, vor allem für land- und forstwirtschaftliche<br />
Erzeugnisse, erhöht, um die Arbeitsund<br />
Wirtschaftsleistung zum Wohle aller<br />
Bolivianer und Bolivianerinnen zu steigern.<br />
Die Herausforderungen für staatliche und<br />
nichtstaatliche Einrichtungen, die Privatwirtschaft<br />
und die internationale Gebergemeinschaft<br />
bestehen laut Studie darin,<br />
nachhaltige Wirtschaftsformen zu entwickeln<br />
und zu fördern. Eine fundamentale<br />
Rolle zur Umsetzung der Agenda spielen<br />
Klein-, Mittel-, aber auch Großproduzenten,<br />
die in ihren Regionen angepasste Wirtschaftsmodelle<br />
entwickeln. Produzentenvereinigungen<br />
und Dachverbände wiederum sind<br />
wichtige Pfeiler zur Entwicklung von Sozialstandards,<br />
Zertifizierung von Bioprodukten,<br />
für nachhaltige Waldwirtschaft und Biokommerz.<br />
Die gewonnenen Erfahrungen<br />
der Akteure können zur Breitenwirksamkeit<br />
in anderen Regionen des Landes führen.<br />
Hierzu zählen auch Maßnahmen zur Anpassung<br />
an den Klimawandel.<br />
Gute Praxisbeispiele<br />
Eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung<br />
trägt zum Schutz der Umwelt, zu<br />
einer Entwicklung und Diversifizierung der<br />
Wirtschaft, zur Schaffung von Arbeitplätzen<br />
und somit zur Armutsreduzierung bei, das<br />
stellt die Studie eindrucksvoll dar. Alternative<br />
nachhaltige Wirtschafsformen schaffen<br />
bereits heute in den Bereichen Umweltdienstleistungen,<br />
nachhaltige Forstwirtschaft,<br />
Technologien zur CO2-Reduzierung, Biokommerz<br />
und Tourismus neue Arbeitsplätze.<br />
Die Exporterlöse angepasster<br />
Wirtschaftsformen in den verschiedenen<br />
Regionen des Landes (u.a. Kaffee, Kakao,<br />
Paranuss, Quinoa, Vikunjawolle, Leder,<br />
nachhaltige Waldwirtschaft und Gemeindetourismus)<br />
belaufen sich auf 300 Millionen<br />
Dollar pro Jahr. Das entspricht zehn Prozent<br />
der Exporteinnahmen des Landes.<br />
Trotz der räumlichen Zersplitterung und<br />
des noch geringen Umfangs stellen diese<br />
© Anja Bursche<br />
Modellcharakter hat zum Beispiel<br />
der ökologische Kakaoanbau:<br />
Eine Kakaofrucht und die<br />
getrockneten Kakaobohnen.<br />
neuen Marktformen ein enormes Potenzial<br />
für die Entwicklung der bolivianischen<br />
Wirtschaft dar.<br />
In der Studie La otra frontera sind auch Projekte<br />
mit Modellcharakter dargestellt, die<br />
der DED in Bolivien seit Jahren fördert.<br />
Zu den good practice-Beispielen zählen das<br />
Engagement des Dachverbandes ökologischer<br />
Produzenten Boliviens AOPEB, der<br />
Kakaoproduzenten-Kooperative El Ceibo,<br />
des Verbandes der Kaffeeexporteure Boliviens<br />
FECAFEB und der Kaffeeproduzentenkooperative<br />
MINGA. Im Fokus dieser<br />
Produzentenvereinigungen steht die nachhaltige<br />
ländliche Entwicklung. Sie tragen<br />
dazu bei, nachhaltige Landnutzungssysteme<br />
(Agroforstsysteme) zu etablieren und Bioprodukte<br />
(etwa Kaffee, Kakao, Quinoa,<br />
tropische Früchte) und deren Qualität für<br />
den lokalen, nationalen und internationalen<br />
Markt zu entwickeln. Durch die Umsetzung<br />
erster Verarbeitungsschritte bleibt die Wertschöpfung<br />
in steigendem Maße im Lande.<br />
Fazit für den DED in Bolivien<br />
Die Studie betont vor allem, dass die Kapazitäten<br />
in leistungsfähigen Organisationen<br />
auf regionaler und nationaler Ebene zu fördern<br />
sind. Der Beratungsansatz des DED<br />
in Bolivien sieht genau dies vor. Regionale<br />
Organisationen werden dabei unterstützt,<br />
ihre Mitglieder und die kleinbäuerlichen<br />
Familien so zu beraten, dass sie ihre forstund<br />
landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen<br />
nachhaltig bewirtschaften,<br />
qualitativ hochwertige Produkte ernten<br />
und vermarkten und damit ihre Lebenssituation<br />
verbessern.<br />
Doch Entwicklungsprozesse müssen längerfristig<br />
angelegt sein, Organisationsentwicklung<br />
braucht Zeit. Die prozessbegleitende<br />
Beratung des DED in Bolivien führt zu<br />
Aufbau und Entwicklung von Kompetenzen<br />
und Kapazitäten in Nichtregierungsorganisationen,<br />
Produzentenvereinigungen und<br />
Kommunen, so dass sich entwicklungsrelevante<br />
Strukturen nachhaltig festigen und<br />
armutsmindernd wirksam werden können.<br />
UNDP Studie:<br />
La otra frontera.<br />
Usos alternativos<br />
6 7<br />
Im Sinne einer Breitenwirkung alternativer<br />
Wirtschaftsformen ist es jedoch unerlässlich,<br />
gute Ansätze nicht nur auf der lokalen<br />
Ebene zu fördern. Vielmehr ist es sinnvoll,<br />
Synergien zwischen lokalen Initiativen und<br />
staatlichen Einrichtungen (Ministerien und<br />
Präfekturen) herzustellen. Nur so lassen sich<br />
Strategien, Instrumente und Standards für<br />
eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung<br />
zum Wohle für Mensch und Umwelt verbreiten.<br />
Über die Vernetzung der verschiedenen<br />
Ebenen (lokal bis national) kann der<br />
DED mit seinen Partnerorganisationen<br />
künftig einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen<br />
Entwicklung des Landes leisten<br />
und seine regionale wie fachliche Expertise<br />
einbringen.<br />
Martin Jovanov<br />
Martin Jovanov ist Umweltwissenschaftler<br />
und war von 2005 bis 2009 DED-Fachkoordinator<br />
für ländliche Entwicklung in Bolivien.<br />
de recursos natu-<br />
rales en Bolivia.<br />
PNUD Bolivia.<br />
La Paz.<br />
November 2008<br />
Das Dokument finden Sie unter: idh.pnud.bo<br />
<strong>Info</strong>
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
Es gilt, das Recht auf Gesund<br />
Aufgaben und Herausforderungen des DED im Gesundheitssektor<br />
Seit Beginn der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) geht es im Gesundheitsbereich um die Sicherung der medizinischen<br />
Grundversorgung für die Bevölkerung, um Maßnahmen der reproduktiven Gesundheit, aber auch um sauberes Trinkwasser<br />
und Hygiene – wichtige Aspekte für die Gesundheit der Menschen. Auch wenn schon viel erreicht wurde, die Ergebnisse<br />
sind noch nicht zufriedenstellend. Hinzugekommen sind vielmehr neue Probleme, wie HIV/AIDS oder auch die Aus-<br />
wirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit. Die Akteure der EZ und mit ihnen der DED sind mehr denn je gefragt,<br />
die Entwicklungsländer bei der Lösung der vielfältigen Probleme zu unterstützen.
Das Bild europäischer Ärztinnen und Ärzte,<br />
Krankenschwestern und Pfleger, die sich in<br />
peripheren Krankenhäusern in Afrika engagierten,<br />
ist maßgeblich geprägt vom Krankenhaus Lambarene,<br />
das Albert Schweizer vor rund 100 Jahren im<br />
heutigen Gabun gründete. Als Albert Schweitzer 1965<br />
in Lambarene starb, mangelte es in der Gesundheitsversorgung<br />
in vielen Regionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas<br />
immer noch an ausreichend qualifizierten<br />
Fachkräften im pflegerischen und ärztlichen Bereich.<br />
Das hatte zur Folge, dass die Arbeit von Entwicklungs-<br />
helferinnen und Entwicklungshelfern im Gesundheitssektor<br />
im Wesentlichen in der Versorgung von Patienten<br />
am Distrikt- oder Missionskrankenhaus stattfand. Der<br />
Bedarf war riesengroß. Unter einfachsten Bedingungen<br />
mussten zum Teil unbekannte Tropenkrankheiten<br />
diagnostiziert und behandelt, Notfalloperationen<br />
durchgeführt und Impfprogramme organisiert werden.<br />
Oft mussten all diese Aufgaben von einer Person durchgeführt<br />
beziehungsweise verantwortlich organisiert<br />
werden. Die direkte Behandlung von Patientinnen und<br />
Patienten, kurative, klinische Aufgaben standen im Vordergrund.<br />
Einheimische Fachkräfte wurden angelernt<br />
und ausgebildet.<br />
Sicherung der medizinischen Grundversorgung<br />
Die Erklärung von Alma Ata, dem heutigen Ulan Bator<br />
in der Mongolei, auf der Konferenz der Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO) 1978 war ein entscheidender<br />
Meilenstein für die Gesundheitsversorgung in der Entwicklungszusammenarbeit<br />
(EZ). Anlässlich dieser Konferenz<br />
wurde das Primary Health Care-Konzept aus der<br />
Taufe gehoben. Darin wurden Elemente zur präventiven<br />
und kurativen Gesundheitsversorgung formuliert und<br />
Prinzipien aufgestellt, die sehr eindeutig die politische<br />
Dimension des Rechts auf Gesundheit einfordern.<br />
Beteiligung der Bevölkerung, angepasste Methoden,<br />
Planung und Steuerung auf dezentraler Ebene und<br />
Nachhaltigkeit waren schon damals Kernpunkte der<br />
heit zu verwirklichen<br />
© Annekatrin El Oumrany<br />
Aufklärungsarbeit über Verhütungsmittel in Mali.<br />
Erklärung und belegen, dass das Konzept immer noch<br />
aktuell ist und viele Ziele, sei es bezogen auf die Gesundheitsversorgung<br />
oder auf die Mitbestimmung der<br />
Bevölkerung, noch nicht erreicht wurden. In der Folge<br />
von Alma Ata waren fast alle Arbeitsplätze im Gesundheitsbereich<br />
mit der Umsetzung des PHC-Konzeptes<br />
auf Distriktebene befasst. Immer noch gab es einen großen<br />
Bedarf an klinischer, kurativer Tätigkeit und zusätzlich<br />
kamen Aufgaben in der strukturierten Planung und<br />
Steuerung der Gesundheitsdienste dazu. Viele Aktivitäten<br />
zur Verbesserung der Gesundheit, gerade der armen<br />
8 9
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
Malaria-<br />
sprechstunde<br />
unter einem<br />
Moskitonetz.<br />
Bevölkerung, orientierten sich an internationalen Ansätzen<br />
der WHO und anderer UN-Organisationen:<br />
Impfprogramme, die Bekämpfung von Durchfallerkrankungen,<br />
die Förderung der Bereitschaft zum<br />
Stillen, Familienplanung und Bereitstellung von<br />
Zusatzernährung bei Unter- und Fehlernährung.<br />
Millenniumsziele Gesundheit<br />
Aufbauend auf diesen Erfahrungen orientieren sich die<br />
Zielsetzungen der EZ im Sektor Gesundheit heute an<br />
den Millenniumszielen (Millennium Development Goals,<br />
MDG). Die MDGs vier bis sechs beziehen sich auf:<br />
Senkung der Kindersterblichkeit (MDG 4), Senkung<br />
der Müttersterblichkeit (MDG 5) und Bekämpfung<br />
von Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Malaria und<br />
insbesondere HIV/AIDS (MDG 6). Leider wird oft<br />
übersehen, dass unter dem MDG 7 auch ganz wesentliche<br />
Ziele formuliert sind, die einen direkten Bezug zu<br />
Gesundheit und Hygiene haben: Der Zugang zu Trinkwasser<br />
und ausreichende Sanitärversorgung. Gerade das<br />
letztgenannte Ziel wird bis 2015 nicht erreicht werden.<br />
Leider muss festgestellt werden, dass auf Grund mangelnder<br />
Hygiene, Mangel an Latrinen und nicht ausreichender<br />
Wasserversorgung immer noch 4.000 Kinder<br />
täglich an Durchfallerkrankungen sterben. Auch müssten<br />
viele Kinder nicht an Lungenentzündungen sterben<br />
(die Erreger der Infektion werden oft über die Hände<br />
weitergegeben), wenn ihre Eltern es sich leisten könnten,<br />
regelmäßig Seife zum Händewaschen zu kaufen.<br />
© Annekatrin El Oumrany<br />
Trotz deutlicher Erfolge in der Gesundheitsversorgung<br />
sterben immer noch 10 Millionen Kinder unter fünf<br />
Jahren jedes Jahr an Krankheiten, die größtenteils<br />
durch Vorbeugung vermieden oder zumindest behandelt<br />
werden könnten. Lungenentzündungen und<br />
Durchfallerkrankungen sind die Haupttodesursachen.<br />
Die meisten dieser Kinder sterben immer noch in den<br />
ersten Stunden und Tagen ihres Lebens, da Mindestanforderungen<br />
an Schwangerenvorsorge und Unterstützung<br />
während und nach der Geburt nicht erfüllt<br />
sind und viele Geburten ohne qualifizierte Unterstützung<br />
stattfinden. Schwangere sterben auf Grund von<br />
Geburtskomplikationen, weil sie keine Möglichkeiten<br />
haben, rechtzeitig im Krankenhaus anzukommen.<br />
Oft sind es nicht die medizinischen Hürden, sondern<br />
der Mangel an anderen strukturellen Voraussetzungen,<br />
fehlende Transportmöglichkeiten, aber auch immer<br />
noch Unkenntnis und traditionelle Verhaltensmuster,<br />
die den Zugang zu der notwendigen Versorgung verhindern.<br />
Schwerpunkte:<br />
reproduktive Gesundheit und HIV/AIDS<br />
Daher sind Themen wie reproduktive Gesundheit, die<br />
Versorgung von Schwangeren und deren Kindern, Zugang<br />
zu Familienplanung unter Einbeziehung der sexuellen<br />
Selbstbestimmung und Schutz vor sexueller Gewalt<br />
wichtige Gesundheitsthemen der EZ. Gerade dieser<br />
Problemkreis steht in engem Zusammenhang mit<br />
den Maßnahmen zur Bekämpfung der Weiterübertragung<br />
von HIV und AIDS und erklärt, dass viele<br />
Arbeitsplätze des DED im Gesundheitswesen in diesem<br />
Bereich verortet sind.<br />
HIV/AIDS hat gewiss eine Sonderstellung, da die damit<br />
verbundenen Probleme vielfältige Folgen in den Gesellschaften<br />
der betroffenen Länder mit sich gebracht haben.<br />
AIDS ist ein Entwicklungshemmnis und muss in<br />
der EZ immer mitgedacht werden. In den Ländern, wo<br />
viele Menschen betroffen sind, werden mainstreaming-<br />
Prozesse gefördert, um für das Thema HIV/AIDS zu<br />
sensibilisieren und Möglichkeiten zu schaffen, Aufklärung,<br />
Vorbeugung, Minderung der Folgen, Behandlung<br />
und Unterstützung von Betroffenen und deren Angehörigen<br />
sicher zustellen. Arbeitsplatzprogramme, die zum<br />
Beispiel durch das AWISA Programm von DED und<br />
InWEnt gefördert werden und Unterstützung der Bevölkerung<br />
in Ihrem Lebensumfeld bieten, werden auch<br />
in der Zukunft wesentliche Programmkomponenten der<br />
EZ im Gesundheitsbereich bleiben.
Zielsetzung muss zudem sein, den Zugang zur Behandlung<br />
von AIDS und den typischen Begleiterkrankungen<br />
mit modernen Medikamenten zu erreichen. Die Anzahl<br />
der Menschen, die diese Behandlung brauchen und sie<br />
tatsächlich bekommen können, ist stetig gewachsen,<br />
dennoch werden bisher nur zwei Millionen von sechs<br />
Millionen erreicht.<br />
Abwanderung qualifizierter Fachkräfte<br />
Ein kritischer Punkt ist der Mangel an ausreichend qualifizierten<br />
Fachkräften in den betroffenen Ländern. Für die<br />
EZ kann das bedeuten, dass wieder mehr entsandte Fachkräfte<br />
in der klinischen Versorgung, etwa in der Ausbildung<br />
oder Supervision, beziehungsweise der Sicherstellung<br />
der kurativen Versorgung vor Ort eingesetzt werden müssen.<br />
Fachkräftemangel und Stärkung der Gesundheitssysteme<br />
sind daher ganz aktuelle Themen in der EZ.<br />
Dabei stoßen wir immer wieder auf alte Probleme, wie<br />
die mangelnde Attraktivität der peripheren Gesundheitsdienste<br />
für einheimische Fachkräfte und geringe Entlohnung<br />
für qualifizierte Leistungen. Darüber hinaus begünstigt<br />
der globale Arbeitsmarkt den Braindrain der qualifizierten<br />
Fachkräfte nach Europa oder in attraktivere Nachbarländer.<br />
Leider führt auch die massive Fokussierung auf<br />
die „big three“, AIDS, Malaria und Tuberkulose, mit modernen<br />
Instrumenten und Kampagnen zu einem internen<br />
Braindrain von einheimischen Fachkräften aus der Gesundheitsversorgung<br />
in die Kampagnenarbeit und Programmplanung<br />
und -gestaltung. Dabei ist die Mitarbeit<br />
im nationalen AIDS Programm sehr viel attraktiver als das<br />
notwendige Engagement zur Bekämpfung der Durchfallerkrankungen<br />
und zur Verbesserung der Hygiene.<br />
Neben dem Fachkräftemangel leiden die Gesundheitsdienste<br />
der betroffenen Länder daran, dass eine ausreichende<br />
Finanzierung über staatliche Stellen trotz<br />
massiver Budgetfinanzierung durch Geberquellen bei<br />
weitem nicht mehr möglich ist. Soziale Absicherung und<br />
Systeme der Krankenversicherung müssen entwickelt<br />
werden, um die Finanzierung einer qualifizierten Gesundheitsversorgung<br />
– zum Teil auch durch Zuzahlung der<br />
Bevölkerung – zu sichern. Erfahrungen aus der Demokratischen<br />
Republik Kongo (siehe Literaturhinweis:<br />
Kinzelbach) haben gezeigt, dass die Bevölkerung auch<br />
unter Krisenbedingungen bereit ist, sich an den Kosten<br />
zu beteiligen. Die Einführung von entsprechenden<br />
Modellen wie in der DR Kongo, gemeindebasierten<br />
Krankenversicherungen in Kambodscha oder genossenschaftlichen<br />
Unterstützungsmodellen sind neue, zukunftsweisende<br />
Arbeitsfelder im Bereich Gesundheit.<br />
© Cornelia Grade<br />
Gesundheitsversorgung und Menschenrechte<br />
Der Zugang zu Gesundheitsversorgung und sozialer<br />
Absicherung ist auch eine Frage der Menschenrechte.<br />
Mindestanforderungen an ein menschenwürdiges<br />
Leben sind klar definiert (siehe Literaturhinweis:<br />
Handbook …). Neben vielen anderen sozialen Kriterien<br />
sind Faktoren und Indikatoren im Bereich Gesundheit<br />
und Soziale Grundsicherung verfügbar, die herangezogen<br />
werden können, um aufzuzeigen, wie weit die Entwicklung<br />
noch von den gesteckten Zielen entfernt ist.<br />
Entscheidenden Einfluss auf die Gesundheitsversorgung<br />
und soziale Sicherung haben dabei die gesellschaftlichen<br />
Rahmenbedingungen. Ein großer Teil der jährlich zehn<br />
Millionen kindlichen Todesfälle steht in direktem Zusammenhang<br />
mit Mangel- und Fehlernährung. Der<br />
Einfluss der Hygiene wurde bereits erwähnt. Um eine<br />
nachhaltige Wirkung zu erreichen, bedarf es in Zukunft<br />
gerade auf lokaler oder regionaler Ebene, also dort wo<br />
die betroffenen Menschen leben, einer ganzheitlichen<br />
Betrachtung und Analyse, um festzustellen, welchen<br />
Beitrag die jeweiligen Sektoren zur Verbesserung der<br />
Lebensbedingungen beitragen können, und wie die<br />
Prioritäten gesetzt werden müssen. Diese Sichtweise in<br />
den Köpfen der Akteure in der EZ und in den Köpfen<br />
der Menschen in den betroffenen Ländern zu verankern,<br />
ist eine Herausforderung für die Zukunft. Dezentralisierung<br />
und Demokratieförderung können Voraussetzungen<br />
schaffen, dass diese Diskussion geführt und Entscheidungen<br />
mit entsprechendem Mandat nah an und<br />
mit der Bevölkerung gefällt werden können.<br />
DED-Arzt im Einsatz<br />
in Tansania.<br />
10 11
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
<strong>Info</strong><br />
© Malteser International<br />
Viele Infektionskrankheiten<br />
könnten<br />
vermieden werden,<br />
wenn Geld für den<br />
Kauf von Seife<br />
vorhanden wäre.<br />
Klimawandel und Gesundheit<br />
Das wohl aktuellste Thema ist der Zusammenhang zwischen<br />
Klimawandel und Gesundheit global und insbesondere<br />
in den ärmsten Ländern, wo immer mehr Menschen<br />
besonders anfällig für die Folgen sind. Mehr Menschen<br />
werden durch Infektionskrankheiten wie Malaria<br />
und Dengue Fieber bedroht, da die Überträger sich in<br />
Regionen ausbreiten, in denen sie früher nicht vorkamen.<br />
Vermehrte Überschwemmungen werden die<br />
Trinkwasserversorgung und die hygienischen Verhältnisse<br />
wieder verschlechtern und zum Anstieg übertragbarer<br />
Erkrankungen führen. Zusammen mit der Nahrungsmittelkrise,<br />
die der Klimawandel mit sich bringen<br />
wird, verschärfen Mangel- und Fehlernährung die Ge-<br />
Literatur zum Thema<br />
Kinzelbach, A., Schmitz, P.; Kostenbeteiligung bei der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung<br />
in 17 Gesundheitszonen in einer Provinz im Osten der DR Kongo –<br />
Erfahrungen von Malteser International; Journal of International Law of Peace<br />
and Armed Conflict, 1/2006<br />
Costello, A. et al.; Managing the health effects of climate change; Lancet Vol. 373,<br />
May 16, 2009, pp1693<br />
Handbook Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response,<br />
The Sphere Project; Oxford 2004. www.sphereproject.org/content/view/27/84/<br />
lang,english/<br />
World Health Report 2008 – Primary Health Care – Now More Than Ever,WHO;<br />
www.who.int/whr/2008/whr08_en.pdf<br />
sundheitsrisiken gerade der Kinder in den betroffenen<br />
Bevölkerungsgruppen. Deren Lebensraum wird direkt<br />
durch häufigere Naturkatastrophen, Überschwemmungen,<br />
Dürren und extreme Witterungsverhältnisse bedroht,<br />
was zu vermehrter Migration von mittellosen<br />
Menschen führen wird, die in vielerlei Hinsicht unterstützt<br />
und versorgt werden müssen. Die Bevölkerungsdynamik<br />
in den ärmeren Ländern wird somit auch<br />
durch die Veränderungen des Klimawandels beeinflusst<br />
und verstärkt die Folgen.<br />
Strategien, die die Folgen des Klimawandels mindern,<br />
müssen dringend umgesetzt werden. Ganz entscheidend<br />
ist die Forderung an die Politik, auf globaler, nationaler<br />
und lokaler Ebene den CO 2-Ausstoß zu mindern.<br />
Gleichzeitig müssen Anstrengungen unternommen werden,<br />
in der Armutsbekämpfung die sektoralen Veränderungen<br />
und Risiken für die besonders anfälligen Bevölkerungsgruppen<br />
zu analysieren und dementsprechend<br />
Kapazitäten aufzubauen. Das ist auch eine Herausforderung<br />
für die Gesundheitsdienste in den betroffenen<br />
Ländern, die dabei vom DED unterstützt werden sollten.<br />
Für den DED stellen sich für den Sektor Gesundheit,<br />
wie auch in anderen Sektoren, vielfältige neue Herausforderungen<br />
und Aufgaben, die sehr viel breiter im Kontext<br />
Entwicklungsförderung verankert sind als die klassischen<br />
präventiven und kurativen Ansätze der Medizin in<br />
der Vergangenheit. Der PHC-Ansatz ist dabei immer<br />
noch aktuell (siehe Literaturhinweis: World Health Report<br />
2008…). Aber die Anforderungen an Sektor übergreifender,<br />
bedarfsgerechter, koordinierter und kohärenter<br />
Planung und Umsetzung auf lokaler Ebene werden<br />
immer deutlicher. Die Beteiligung der Bevölkerung,<br />
wenn es um Themen wie Ernährung, Gesundheit,<br />
Wasserversorgung und Hygiene geht, ist essentiell.<br />
Auf dieser Ebene kann der DED auf viel Erfahrung<br />
zurückgreifen und hier können die Fachkräfte im<br />
Gesundheitssektor auch in Zukunft einen wesentlichen<br />
Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung leisten.<br />
Dr. Klaus Peter Schmitz<br />
Dr. Klaus Peter Schmitz ist Arzt, Chirurg und Ingenieur<br />
für Umwelttechnik und seit 2009 Leiter der Fachgruppe<br />
Gesundheit und des Ärztlichen Dienstes des DED. Er war<br />
zuvor seit 2000 Leitender Arzt von Malteser International.<br />
Von 1997 bis 1999 war Dr. Schmitz mit dem DED als<br />
Regional Medical Officer im Norden Namibias.
Kambodscha<br />
Schicksale hinter den Zahlen<br />
Bei Geburten auf dem Lande kommt oft jede Hilfe zu spät<br />
Im Jahr 2008 legte das kambodschanische<br />
Gesundheitsministerium fest, dass landesweit<br />
Maternal-Death-Audits, also Untersuchungs-<br />
verfahren zur Müttersterblichkeit,<br />
obligatorisch durchzuführen seien.<br />
Ziel ist es, mehr darüber in Erfahrung zu bringen,<br />
warum die Zahl der Frauen, die in Kambodscha<br />
bei der Geburt ihres Kindes sterben, so hoch ist.<br />
Die Autorin hat an vielen dieser Audits<br />
teilgenommen.<br />
Die Großmutter kümmert sich um das Baby<br />
Es ist Montagfrüh, mein erster Arbeitstag am<br />
Projektplatz. Ich bin Beraterin für Mutter- und<br />
Kindgesundheit am Provincial Health Department<br />
(PHD) in Kampong Thom, Zentralkambodscha.<br />
Mein Einstand beginnt mit einem traurigen Ereignis:<br />
Das PDH hatte in der Woche zuvor die Nachricht über<br />
den Tod einer Frau bei der Geburt erhalten. Heute werden<br />
wir nach Kampong Svay fahren, um mehr darüber<br />
zu erfahren. Über relativ gute Straßen erreichen wir<br />
schnell das knapp 20 Kilometer entfernte Gesundheitszentrum.<br />
Kambodscha ist um diese Jahreszeit recht karg.<br />
Die vielen Reisfelder sind durch die lang anhaltende<br />
Trockenperiode braun geworden und der Boden reißt<br />
in großen Schollen auf. Nur wenige Bäume spenden<br />
angenehmen Schatten. Das Gesundheitszentrum selbst<br />
ist unscheinbar. Über dem Eingangstor zum Gelände<br />
steht in Khmer und Englisch Kampong Svay Health<br />
Center. Ein überdachter kleiner Wartebereich befindet<br />
sich am Eingang. Dahinter ein kleiner Flur, von dem<br />
zu beiden Seiten Zimmer abgehen. Wir halten uns nur<br />
kurz hier auf, um die zuständige Hebamme abzuholen.<br />
„Wir“: das sind unser Fahrer, mein Kollege vom PHD,<br />
eine Kollegin vom Provinz-Team für Mutter- und<br />
Kindgesundheit sowie der zuständige Mitarbeiter<br />
vom Operational District.<br />
© Olga Platzer<br />
nach dem Tod der Mutter.<br />
Knapp fünf Kilometer liegt das Dorf vom Gesundheitszentrum<br />
entfernt. Dennoch dauert die Fahrt dorthin<br />
sehr lange. Diese Straße ist im Gegensatz zur Hauptstraße<br />
in einem sehr schlechten Zustand. Schmal, aus<br />
roter Erde, von Reisfeldern begrenzt und in einigen Teilen<br />
weg gebrochen, man kann nur erahnen, wie schwierig<br />
es während der Regenzeit sein muss, sie zu befahren.<br />
Ich bin froh, in einem Geländewagen zu sitzen. Doch<br />
die letzten 500 Meter zum Haus der Familie müssen wir<br />
zu Fuß gehen. Es ist ein kleines Holzhaus auf langen<br />
Stelzen, darunter scharrende Hühner und ein paar<br />
Hunde, die uns neugierig beäugen. Eine lange, steile<br />
Leiter führt in das obere Stockwerk. Aus diesem schaut<br />
uns bereits eine ältere Frau freundlich entgegen.<br />
Dieser freundliche Ausdruck verschwindet auch nicht,<br />
als ihr mein Kollege den Grund unseres Besuches erklärt.<br />
Während die beiden sich kurz unterhalten, laufen<br />
bereits Kinder und weitere Dorfbewohner herbei.<br />
Schnell hat sich die Neuigkeit über den unvorhergesehenen<br />
Besuch herum gesprochen.<br />
Wir werden von der Frau höflich ins Haus gebeten.<br />
Dort breitet sie eifrig Strohmatten aus, auf denen wir<br />
Platz nehmen können. Schnell füllt sich der kleine<br />
Raum mit Menschen jeden Alters. Eine junge Frau trägt<br />
ein kleines Bündel ins Zimmer, das sie behutsam in un-<br />
12 13
� THEMA<br />
Brief 3.2009<br />
© Olga Platzer<br />
Schlechte Straßen<br />
erschweren den Zugang<br />
zu den Dörfern.<br />
serer Mitte auf die Strohmatte legt. Ich weiß sofort, das<br />
ist das Kind, das die Mutter zur Welt gebracht hat, bevor<br />
sie starb. Im Inneren des Hauses ist es recht dunkel,<br />
jedoch angenehm kühl. Ein kleiner Bereich ist durch<br />
Vorhänge abgetrennt und dient eindeutig als Schlafplatz.<br />
Bilder hängen an den Wänden. Zumeist Fotos<br />
von Hochzeitspaaren in festlicher kambodschanischer<br />
Kleidung. Fotos aus fröhlichen Tagen. Die Befragung<br />
über die Vorgänge, die zum Tod der Frau führten, erfolgt<br />
durch meinen Kollegen. Unglücklich stelle ich fest,<br />
dass ich trotz langer Sprachvorbereitung nicht in der<br />
Lage bin, alle Details des Gesprächs in Khmer zu verstehen.<br />
So bin ich sehr dankbar, dass mein Kollege die<br />
Fragen und Antworten parallel für mich ins Englische<br />
übersetzt und ich so auch meinerseits Rückfragen stellen<br />
kann.<br />
Verlorener Wettlauf gegen die Zeit<br />
Die Verstorbene hieß Sokheng und war 38 Jahre alt. Es<br />
war ihre vierte Geburt. Sokheng war niemals ernsthaft<br />
krank. Sie war eine starke und kräftige Frau. Während<br />
der letzten Schwangerschaft besuchte sie (vorbildliche)<br />
viermal das Gesundheitszentrum zur Vorsorge. Ihr Mutterpass<br />
wurde ordnungsgemäß geführt und zeigt keinen<br />
Hinweis auf Besonderheiten. Am 6. Februar 2008 morgens<br />
um 10:30 Uhr begannen die Wehen. Die Familie<br />
informierte die traditionelle Geburtshelferin des Dorfes,<br />
doch als diese das Haus gegen 11:30 Uhr erreichte, war<br />
das Kind, ein gesundes Mädchen, bereits geboren. Noch<br />
während die Helferin dabei war, das Kind zu versorgen,<br />
klagte Sokheng über starke Schmerzen. Sie blutete stark.<br />
Besorgt über den starken Blutverlust und die zunehmende<br />
Schwäche ihrer Tochter fuhr Sokhengs Mutter<br />
mit einem geliehenen Moped zum Gesundheitszentrum,<br />
um Hilfe zu holen. Sie hatte Glück und erreichte<br />
die zuständige Hebamme. Beide kamen gegen 13:00<br />
Uhr zum Haus zurück. Sokheng blutete immer noch,<br />
jedoch bereits deutlich weniger. Die Hebamme stellte<br />
schnell fest, dass Sokheng bereits zu viel Blut verloren<br />
hatte. Sie war blass und reagierte kaum noch auf Ansprache.<br />
Einen so kritischen Zustand konnte die Hebamme<br />
vor Ort nicht behandeln. Sokheng musste ins<br />
Krankenhaus, so schnell wie möglich. Doch wie? Die<br />
Ambulanz vom Krankenhaus würde fast eine Stunde benötigen,<br />
um Sokheng in die Notaufnahme zu bringen.<br />
Für eine Transfusion während des Transportes sind die<br />
Fahrzeuge nicht ausgerüstet. Schneller wäre es, sie direkt<br />
dort hinzubringen. Doch dafür muss man Sokheng erst<br />
einmal die steile Treppe hinunter und über das Feld bis<br />
zum Haus des Mannes bringen, der als einziger über ein<br />
Auto verfügt. Noch während die Familie dabei ist, Hängematte<br />
und freiwillige Helfer zu organisieren, verlassen<br />
Sokheng die letzten Kräfte. Sie stirbt gegen 14:00 Uhr<br />
an den Folgen der starken Blutung, nicht einmal drei<br />
Stunden nach der Geburt ihrer Tochter. Sokheng hinterlässt<br />
einen Mann und drei Kinder im Alter von zwölf<br />
und sieben Jahren sowie das Baby.<br />
„Verbale“ Autopsie soll Daten zusammentragen<br />
Kambodscha liegt mit 472 Todesfällen pro 100.000<br />
Schwangerschaften (laut Health Strategic Plan 2008–<br />
2015, Ministry of Health, April 2008) nach Laos und<br />
Ost-Timor, auf einem traurigen dritten Platz in Südostasien<br />
(in Deutschland sind es 8/100.000). Bei geschätzten<br />
365.000 Schwangerschaften im Jahr bedeutet dies<br />
über 1.700 Todesfälle. Zur Rekonstruktion der Umstände,<br />
die zu diesen Todesfällen führen, gibt es nur wenig<br />
aussagekräftige Daten. Während in Deutschland zur<br />
Bestätigung eines Todesfalls per Gesetz ein ärztliches<br />
Gutachten gehört, werden in Kambodscha solche Fälle
© Olga Platzer<br />
Stolze Kambodschanische Mutter mit ihrem Sohn. Typisches Haus einer Familie auf dem Lande.<br />
häufig erst Tage später von den Angehörigen der Kommunalverwaltung<br />
gemeldet. Der buddhistische Glaube<br />
sieht vor, dass die Toten an einem spirituell günstigen<br />
Tag eingeäschert werden müssen. Das kann auch bereits<br />
der darauf folgende Tag sein. Obduktionen sind aus<br />
Glaubensgründen für große Teile der Bevölkerung tabu.<br />
Was bleibt, ist die Rekonstruktion der Ereignisse auf Basis<br />
von Erzählungen und (wenn vorhanden) durch Einsicht<br />
in die medizinische Dokumentation. Diese „verbale“<br />
Autopsie wurde 2008 durch das kambodschanische<br />
Gesundheitsministerium landesweit als obligatorische<br />
Maßnahme festgelegt.<br />
Im Jahr 2008 wurden in Kampong Thom, 22 Maternal-<br />
Death-Audits (MDA) durchgeführt, 18 davon in Begleitung<br />
der DED Fachkraft. Die überwiegende Zahl der<br />
Fälle ereignete sich in abgelegenen Gebieten. Schlechte<br />
oder fehlende Straßen, Flüsse, die überquert werden<br />
müssen, fehlender Transport und Mangel an Telefonen,<br />
aber auch Dunkelheit und überflutete Wege machen es<br />
den Familien unmöglich, schnell Hilfe zu rufen. Was<br />
bleibt, ist die Unterstützung durch traditionelle Hebammen,<br />
welche weder über das Wissen noch über die<br />
Möglichkeiten verfügen, Komplikationen vor, während<br />
oder nach der Geburt zu versorgen. Setzen die Blutungen<br />
erst einmal ein, bleiben den Frauen im Durchschnitt<br />
gerade mal 90 Minuten bis sie an den Folgen<br />
des Blutverlustes sterben. In 17 der 22 Fälle hieß die<br />
Diagnose „Verbluten“.<br />
© Olga Platzer<br />
Die Maternal-Death-Audits werden auch genutzt, um ein<br />
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass etwas „schief“ gehen<br />
kann während der Geburt, dass dann nur noch das professionelle<br />
Wissen einer ausgebildeten Hebamme oder<br />
eines Arztes hilft. So wird den Anwesenden erklärt, dass<br />
sie nicht bis zum kritischen Punkt warten dürfen, dass<br />
sie sofort bei Einsetzen der Wehen Hilfe suchen müssen.<br />
Bereits während der Schwangerschaft sollte alles für einen<br />
möglichen Transport organisiert und ein wenig Geld<br />
zurückgelegt werden. Vermittelt wird auch, dass sich<br />
schwangere Frauen auf bestehende Risiken hin untersuchen<br />
lassen müssen. Und dass sie bei diesen Untersuchungen<br />
im Gesundheitszentrum wichtige Arzneimittel<br />
erhalten können, die ihnen und ihrem ungeborenen<br />
Kind helfen, gesund zu bleiben. Für diese Aufklärungsarbeit<br />
sind die MDAs bislang fast das einzige Instrument.<br />
Doch das Interesse an den Untersuchungsergebnissen<br />
steigt. Mehr und mehr werden die Geschichten und<br />
Schicksale hinter den Zahlen gehört. Und es bleibt zu<br />
hoffen, dass zukünftig mehr getan wird, um der Bevölkerung<br />
zu helfen, auf Notfälle vorbereitet zu sein.<br />
Damit keine Frau mehr sterben muss bei dem Versuch,<br />
Leben zu geben.<br />
Olga Platzer<br />
Olga Platzer ist Diplom-Pflegewirtin und arbeitet seit<br />
2007 als Entwicklungshelferin des DED in Kambodscha.<br />
14 15
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
Kenia<br />
Sie leiden ein Leben lang an den Folgen<br />
Für eine bessere medizinische und psychologische Betreuung von Gewaltopfern<br />
Im Rahmen des Gesundheitsprogramms<br />
der deutschen Entwicklungs-<br />
zusammenarbeit will der DED Kenia<br />
dabei unterstützen, die Betreuungs-<br />
kapazitäten für Opfer von<br />
Gender Based Violence, in der Regel<br />
Gewalt gegen Frauen, auszubauen.<br />
Wichtig ist dabei ebenso,<br />
auf die Änderung von Einstellungen<br />
und Verhalten hinzuwirken, denn<br />
immer noch ist Gewalt gegen Frauen<br />
häufig nur ein „Kavaliersdelikt“.<br />
Männer und Frauen sind in Kenia<br />
noch lange nicht gleichberechtigt.<br />
Gender Based Violence (GBV) wird in der UN-<br />
Erklärung als jegliche Art von Gewalt, die zum<br />
psychischen, sexuellen oder psychologischen<br />
Leid oder Schaden einer Frau führt, definiert. Obwohl<br />
Männer auch Opfer von GBV sein können, sind Frauen<br />
gegenüber Männern aufgrund physischer Gegebenheiten<br />
und eines häufig schlechteren ökonomischen<br />
und sozialen Status weit eher betroffen.<br />
In Kenia sind laut einer Statistik des Nairobi Women’s<br />
Hospital fast 50 Prozent der Betroffenen von GBV Kinder<br />
beziehungsweise Minderjährige. Weiterhin belegen<br />
Statistiken in Kenia:<br />
■ dass alle 25 Minuten eine Frau vergewaltigt wird<br />
■ dass 15 Prozent aller verheirateten Frauen in der Ehe<br />
vergewaltigt worden sind<br />
■ dass die Zahl der erkannten, beziehungsweise gemeldeten<br />
Vergewaltigungen von Kindern von 2005<br />
bis 2006 um 35 Prozent zugenommen hat<br />
■ dass in den meisten Fällen der Täter dem Opfer<br />
bekannt ist<br />
■ dass Vergewaltigung immer noch eines der am<br />
wenigsten angezeigten Verbrechen ist.<br />
In Kenia gilt Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe oft<br />
genug als Kavaliersdelikt. Prügel für Frauen ist vielerorts<br />
immer noch eine weithin anerkannte „Erziehungsmaßnahme“<br />
für „widerspenstige“ und „ungehorsame“ Ehefrauen.<br />
Obwohl in Kenia Gewalt gegen Frauen strafbar ist und<br />
offiziell nicht toleriert wird, verschließen sich die Behörden<br />
häufig der konsequenten strafrechtlichen Verfolgung<br />
der Täter. Allzu oft wird auch die Polizei beschuldigt,<br />
Gewalt gegen Frauen nicht als Straftat anzusehen<br />
und dementsprechend dagegen vorzugehen; nicht selten<br />
wird die Polizei selbst zum Täter.<br />
Das wirkliche Ausmaß an Vergewaltigungen, Gewalt in<br />
der Ehe, Misshandlungen jeder Art bleibt weithin im<br />
Dunkeln. Viele Opfer beziehungsweise Überlebende<br />
von GBV lehnen es ab, ihren oder ihre Peiniger anzuzeigen.<br />
Die Gründe hierfür sind vielfältig: Scham, Angst<br />
vor Repressalien oder sogar weiteren Angriffen, Angst<br />
vor Vorwürfen aus Familie und Freundeskreis, Angst,<br />
man könnte als Lügnerin dastehen, unzureichende<br />
finanzielle Möglichkeiten und auch einfach Unkenntnis<br />
über persönliche Rechte und Möglichkeiten dem Angreifer<br />
gegenüber.<br />
© Cornelia Grade
Professionelle Behandlung ist nötig<br />
Für Überlebende von GBV gibt es außerdem immer<br />
noch viel zu wenige Möglichkeiten für eine qualitativ<br />
gute und umfassende medizinische und psychosoziale<br />
Betreung. Für Opfer von Vergewaltigungen etwa ist<br />
eine schnelle medizinische Versorgung innerhalb von<br />
72 Stunden besonders wichtig, um einer möglichen Ansteckung<br />
mit HIV/AIDS vorzubeugen (post exposure<br />
prophylaxe). In einigen, wenn auch bisher noch wenigen<br />
Kliniken und Krankenhäusern mit GBV-Abteilung sind<br />
im Rahmen eines umfassenden Behandlungs- und Betreuungsangebotes<br />
entsprechende Medikamente erhältlich.<br />
Gerade die psychologische Betreuung nach einem<br />
gewaltsamen Übergriff ist von immenser Bedeutung<br />
für die Betroffenen. Die meisten leiden ein Leben lang<br />
unter den Folgen.<br />
Allzu oft kommt die Hilfe zu spät, da die Opfer erst<br />
weite Strecken zurücklegen müssen, ehe sie überhaupt<br />
medizinisch versorgt werden können. Es ist davon auszugehen,<br />
dass viele Opfer von GBV keinerlei professionelle<br />
Behandlung und Unterstützung erhalten. Manche<br />
erfahren erst Hilfe, wenn andere über ihre Notsituation<br />
berichten. So wie im Fall der 68-jährigen Njoki: Njoki<br />
lebt in einem Slumgebiet von Nairobi. Durch einen Unfall<br />
verlor sie ein Bein und trägt seitdem eine Prothese.<br />
Aufgrund dieser Behinderung ist sie arbeitslos und hat<br />
es schwer, für sich zu sorgen. Njoki wurde nachts von<br />
mehreren Männern wiederholt vergewaltigt. Bei dem<br />
Versuch, sich zu wehren, verlor sie ihre Beinprothese.<br />
Ein Zeitungsreporter griff den Fall auf und erst dadurch<br />
erfuhr das Nairobi Women’s Hospital von Nyokis Lage.<br />
Sie wurde gefunden und ins Krankenhaus gebracht.<br />
Jetzt ist sie auf dem Weg der Besserung.<br />
Beratungsleistungen des DED<br />
Vergewaltigung und Gewalt aller Art nehmen besonders<br />
in Krisensituationen und Ausnahmezuständen zu, wie<br />
sie in Kenia während der Nachwahlkrise Anfang 2008<br />
geherrscht haben. Dies belegen die hohen Zahlen an<br />
GBV-Fällen in dieser Zeit. Betroffen waren vor allem<br />
die Armen in Slumgebieten und in den ländlichen Regionen.<br />
Nicht zuletzt angestoßen durch diese erschreckende<br />
Bilanz hat die deutsche Entwicklungszusammenarbeit<br />
den Ausbau des Gesundheitsprogramms um die Komponente<br />
GBV beschlossen. In Kooperation mit der<br />
GTZ wird der DED einen Beitrag dazu leisten, den<br />
Zugang für GBV-Opfer zu<br />
medizinischer und psychosozialer<br />
Betreuung sowie zu<br />
Rechtsberatung zu verbessern.<br />
Zielgruppen sind vor allem<br />
Frauen und Kinder, aber auch<br />
Männer. Der DED wird dazu<br />
mit staatlichen und privaten<br />
Krankenhäusern und Kliniken<br />
zusammenarbeiten.<br />
Es ist angestrebt, Partnerorganisationen<br />
besser zu vernetzen,<br />
den <strong>Info</strong>rmationsaustausch und<br />
die Datenerfassung zu GBV zu<br />
erweitern, Managementkapazitäten<br />
und -standards zu stärken<br />
und schwerer erreichbare Bevölkerung<br />
einzubeziehen (rollout).<br />
Dabei wird es besonders um<br />
Prävention von GBV gehen<br />
und dafür spielt Öffentlichkeitsarbeit<br />
zur Aufklärung und<br />
<strong>Info</strong>rmation über GBV eine<br />
herausragende Rolle. Studien<br />
sollen aufklären helfen, wo<br />
die Gründe für GBV und insbesondere<br />
Gewalt gegen Frauen<br />
und Kinder liegen. Letztendlich<br />
sollen die erfassten Daten auch<br />
als Basis dienen, um besser fundierte<br />
Politiken zur Bekämpfung<br />
von GBV zu entwickeln.<br />
Women’s Hospital.<br />
Die Zusammenarbeit im deutschen<br />
Gesundheitsprogramm in<br />
Kenia bringt Ressourcen zusammen, die ein solch komplexes<br />
Unterfangen realisierbar machen. Letztlich soll<br />
dadurch ein Prozess der Bewusstseinsänderung in Gang<br />
gesetzt werden, denn nur so kann Erfolg auf breiter<br />
Basis eintreten. Auch wenn es noch ein langer Weg ist,<br />
bis GBV in Kenia als verachtungswürdige Menschenrechtsverletzung<br />
angesehen und konsequent strafrechtlich<br />
verfolgt wird, die ersten Schritte hierzu sind getan.<br />
Sabine Rundgren<br />
Sabine Rundgren ist Agraringenieurin und arbeitet seit<br />
2008 als Entwicklungshelferin des DED in Kenia.<br />
© Sabine Rundgren<br />
© Edgar Kaeslin<br />
Das Nairobi Women’s Hospital<br />
bietet Opfern von Gewalt<br />
medizinische und psychologische Hilfe an.<br />
Eine schwerverletzte Frau im Nairobi<br />
16 17
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
HIV/AIDS<br />
Alle müssen Verantwortung übernehmen<br />
Die Ansätze des DED zur Bekämpfung von HIV/AIDS<br />
Der DED definiert die Bekämpfung<br />
von HIV/AIDS als Querschnittsthema,<br />
es ist also eine Aufgabe, die alle<br />
Interventionsebenen des DED betrifft.<br />
Wie dies konkret umgesetzt wird,<br />
schildert der folgende Beitrag.<br />
Als besonders erfolgreich hat sich dabei<br />
das Instrument der Arbeitsplatz-<br />
programme erwiesen, das von den<br />
Partnern des DED stark nachgefragt wird.<br />
Fest steht, es bleibt weiter viel zu tun,<br />
um die Pandemie zu bezwingen.<br />
Die Arbeiter<br />
hören gebannt zu –<br />
Aufklärung<br />
direkt am Arbeitsplatz<br />
© Winfried Zacher<br />
in Malawi.<br />
Demonstration des Kondomgebrauchs in Sambia.<br />
Seit nunmehr fast zehn Jahren befasst sich der<br />
DED mit der HIV/AIDS-Arbeit. Dabei war<br />
von Anfang an klar, dass es sich um einen Arbeitsbereich<br />
handelt, der – neben spezifischen Interventionsansätzen<br />
– als „Querschnittsthema“ umgesetzt werden<br />
muss. Die Begründung für diese Herangehensweise<br />
war und ist: In vielen Ländern ist HIV beziehungsweise<br />
AIDS ein so gravierendes Problem – oder droht es zu<br />
werden – dass es nicht ausreicht, die Bekämpfung,<br />
das heißt die Prävention, die Behandlung und die<br />
Folgenminderung, dem Gesundheitssystem zu überlassen.<br />
Vielmehr stellt diese Erkrankung eine so große<br />
Bedrohung nicht nur für die betroffenen Individuen,<br />
sondern für ganze Länder und deren Entwicklungschancen<br />
dar, dass alle Bereiche des privaten und des<br />
öffentlichen Lebens in die Bekämpfung eingebunden<br />
werden müssen.<br />
Beim Kampf gegen eine Krankheit einen Beitrag von<br />
allen Menschen, von der gesamten Gesellschaft zu<br />
fordern – das Thema zu mainstreamen – war neu.<br />
Es gab keine einschlägigen Erfahrungen, auf denen<br />
man hätte aufbauen, auf die man hätte zurückgreifen<br />
können. Insofern war davon auszugehen, dass dies ein<br />
Lernprozess werden musste, bei dem sicher auch Fehler<br />
gemacht würden.<br />
Für unterschiedliche Situationen<br />
unterschiedliche Antworten<br />
Von Anfang an war für den DED auch klar, dass ein<br />
solch umfassender Ansatz nur für Länder anzuwenden<br />
wäre, in denen das Problem bereits bedrohlich groß war<br />
oder aber unmittelbar zu werden drohte. Für die anderen<br />
Länder würde es genügen, wenn das Gesundheitssystem<br />
mit gezielten und spezifischen Interventionen<br />
die Ausbreitung in die Gesamtgesellschaft verhindern<br />
würde. Die Arbeit sah und sieht also für unterschiedliche<br />
Länder unterschiedlich aus.<br />
© Karin Perl
Zur Unterscheidung der verschiedenen Interventionsstrategien<br />
benutzen wir – auch wenn die Trennlinien in<br />
der Wirklichkeit oft nicht so scharf gezogen werden<br />
können – die Charakterisierung als „Hochprävalenzland“<br />
oder „Niedrigprävalenzland“ (siehe nebenstehende<br />
<strong>Info</strong>). Die „Grauzone“ zwischen drei Prozent und<br />
fünf Prozent ist bewusst offen gelassen: hier ist von Fall<br />
zu Fall zu entscheiden.<br />
Das Konzept sieht vor, dass jede Entwicklungshelferin<br />
des DED zusammen mit ihrer Partnerinstitution „etwas“<br />
gegen HIV unternehmen soll, dass jeder Entwicklungshelfer<br />
und dessen Partnerorganisation einen „Beitrag“<br />
leisten soll. Wie aber sieht das aus, wenn es sich<br />
um eine Stadtverwaltung mit einem entsandten Städteplaner,<br />
um eine bäuerliche Produktionsgenossenschaft<br />
mit einer Betriebswirtin, um eine Wasserversorgungseinrichtung<br />
mit einem Ingenieur handelt? Reicht es,<br />
ab und zu ein Plakat aufzuhängen? Ist es genug, eine<br />
<strong>Info</strong>veranstaltung zur Demonstration von Kondomen<br />
zu organisieren oder jeden Monat einen Packen <strong>Info</strong>broschüren<br />
auszulegen?<br />
Das sind gute Ansätze – aber sie reichen nicht aus. Seit<br />
langem ist klar, dass eines der Hauptprobleme der Querschnittsaufgabe<br />
darin liegt, die Betroffenen zu befähigen,<br />
dem Anspruch systematisch gerecht zu werden.<br />
Das wichtigste Instrument dazu sind Querschnittsberater<br />
und -beraterinnen. Das sind DED-Fachkräfte, die<br />
über eine Ausbildung und Kompetenzen in der HIV/<br />
AIDS-Arbeit verfügen und den anderen Entwicklungshelfern<br />
und deren Partnerorganisationen bei der Umsetzung<br />
von HIV/AIDS Aktivitäten nicht nur mit Rat,<br />
sondern auch mit Tat unter die Arme greifen.<br />
Wichtigstes Instrument:<br />
HIV/AIDS-Arbeitsplatzprogramme<br />
In der DED-Arbeit hat sich als beste und sehr handfeste<br />
Methode des mainstreaming die Einführung von „Arbeitsplatzprogrammen“<br />
etabliert.<br />
Bei der systematischen Entwicklung und der Korrektur<br />
vieler anfänglicher Fehler dieser Programme hat die<br />
Querschnittsarbeit des DED enorm von AWiSA (AIDS<br />
Workplace Programs in Southern Africa), einem Kooperationsprojekt<br />
mit InWEnt (Internationale Weiterbildung<br />
und Entwicklung gGmbH) profitiert, in<br />
dessen Zentrum solche Arbeitsplatzprogramme stehen<br />
(www.awisa.de).<br />
Länder mit niedriger HIV-Prävalenz<br />
= < 3%<br />
spezifische HIV-Arbeit<br />
durch HIV-Fachkräfte<br />
Voraussetzung für die Formulierung und Durchführung<br />
eines solchen Arbeitsplatzprogrammes ist, dass die Entscheidungsträger<br />
der Einrichtung es wollen und aktiv<br />
unterstützen, dass mindestens eine Person (focal person)<br />
und/oder eine Arbeitsgruppe die Verantwortung übertragen<br />
bekommen und rechenschaftspflichtig sind und<br />
dass Personen und Finanzen bereit gestellt werden, Aktivitäten<br />
zu planen und durchzuführen.<br />
Die wesentlichen Merkmale eines solchen Arbeitsplatzprogrammes<br />
sind dann, dass ein Zyklus von Veranstaltungen<br />
durchgeführt wird, der alle Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter der Einrichtung regelmäßig einbezieht<br />
und aktiv beteiligt:<br />
■ <strong>Info</strong>rmationen zu HIV/AIDS (IEC: information,<br />
education, communication) werden – möglichst interaktiv<br />
– angeboten.<br />
■ Verhaltensänderungen werden intensiv propagiert<br />
(BCC: behavior change communication).<br />
■ Kondome und Femidome werden (umsonst und<br />
diskret) zugänglich gemacht.<br />
■ Ein (unkomplizerter!) Zugang wird eröffnet zu persönlicher<br />
Beratung in Bezug auf HIV-Testung und<br />
die möglichen Konsequenzen sowie Möglichkeiten<br />
von (emotionaler und materieller) Unterstützung.<br />
■ Ein (unkomplizierter) Zugang zu freiwilligen HIV-<br />
Tests wird ermöglicht.<br />
■ Mindestens die Behandlung anderer Geschlechtskrankheiten<br />
und „opportunistischer Infektionen“<br />
wird ermöglicht.<br />
■ Für AIDS-therapiepflichtige Patienten wird nach<br />
Möglichkeiten gesucht, ihnen Zugang zu antiretroviraler<br />
Therapie zu eröffnen.<br />
■ Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung an<br />
veränderte Bedingungen wird durchgeführt.<br />
■ Das Unternehmen/die Einrichtung entwickelt und<br />
verabschiedet eine umfassende, betriebsangepasste<br />
Leitlinie (policy) in Bezug auf HIV/AIDS. Darin<br />
werden soziale, materielle und (arbeits-)rechtliche<br />
Aspekte für den Umgang mit HIV-positiven Mitarbeitern<br />
und Mitarbeiterinnen und an AIDS Erkrankten<br />
niedergelegt und die kontinuierliche und kompetente<br />
Umsetzung des Programms festgeschrieben.<br />
18 19<br />
Länder mit hoher HIV-Prävalenz<br />
= > 5 %<br />
spezifische HIV-Arbeit<br />
durch HIV-Fachkräfte<br />
<strong>Info</strong><br />
zusätzlich Querschnittsarbeit:<br />
alle EH helfen, die HIV-Thematik in die Arbeit<br />
der Partnerorganisation zu integrieren<br />
und werden dazu durch eine Querschnittsfachkraft<br />
motiviert und befähigt.
� THEMA<br />
Brief 3.2009<br />
Die Mobilisierung von Management und focal persons,<br />
die Ausbildung, die Veranstaltungen danach, die kontinuierliche<br />
Nachbetreuung, die Überwindung von<br />
Widerständen ebenso wie von Ermüdungserscheinungen<br />
kosten nicht nur viel Zeit und Energie, sie kosten auch<br />
Geld. Zunächst musste eine Reihe von Querschnitts-<br />
Beratern ihre Arbeit mit so geringen Beträgen bestreiten,<br />
dass sie kaum wirksam werden konnte, aber seit 2008<br />
werden in der DED-Zentrale Mittel für diese mainstreaming-Arbeit<br />
reserviert und Engpässe gezielt ausgeglichen.<br />
Externes Mainstreaming muss im Zentrum stehen<br />
Im Zentrum aller Bemühungen sollte beim mainstreaming<br />
in den Hochprävalenzländern stehen: die<br />
Personen im Arbeitsumfeld der DED-Fachkräfte für<br />
die Gefahren zu sensibilisieren, sie zu einem risikofreien<br />
Verhalten zu motivieren, sie zum Testen zu bewegen<br />
und – wo nötig – den Zugang zu einer Therapie zu eröffnen.<br />
Weil dieses „externe mainstreaming“ eine mühselige<br />
und schwierige Arbeit ist, besteht immer wieder<br />
die Gefahr, dass die Berater des DED den leichteren Weg<br />
gehen und das „interne mainstreaming“ überbetonen,<br />
das Aufklärung und Prävention für die – in der Regel<br />
wenigen – Ortskräfte des DED und die DED-Fachkräfte<br />
selbst betrifft. Das sollte zwar nicht ganz vernachlässigt<br />
werden, aber – im Vergleich zur Arbeit mit den<br />
Partnerorganisationen – nur eine geringe Rolle spielen.<br />
Die großen Programme wie der Global Fund on AIDS,<br />
Tuberculosis and Malaria (GFATM) ebenso wie das amerikanische<br />
President’s Emergency Plan For AIDS Relief<br />
(PEPFAR) haben sich vor allem Verdienste um den Zugang<br />
zur Therapie erworben: Mittlerweile erhalten über<br />
vier Millionen AIDS-Kranke die nötige Medikation.<br />
Das ist eine enorme Leistung. Andererseits ist die Anzahl<br />
der Neuinfektionen immer noch größer als die Anzahl<br />
derer, die Zugang zur Therapie erhalten. Das heißt:<br />
Das Problem ist keineswegs unter Kontrolle, es nimmt<br />
noch zu. Und dies trotz mittlerweile oft ganz guten<br />
Wissens über die Infektions- und Verhütungswege.<br />
Wie beim Rauchen oder dem Übergewicht in Industrieländern<br />
gibt es auch hier eine enorme Diskrepanz zwischen<br />
dem Wissen einerseits und dem individuellen<br />
Verhalten auf der anderen Seite. Das stellt für die AIDS-<br />
Arbeit eine große Herausforderung dar.<br />
Eine erste externe Evaluierung der Querschnittsarbeit<br />
im HIV/AIDS Bereich hat der DED 2006/07 durchgeführt.<br />
Das Ergebnis war insgesamt positiv; eine erneute<br />
© Cornelia Grade<br />
In Kenia unterstützt der Bund der Angestellten FKE<br />
das HIV/AIDS-Arbeitsplatzprogramm.<br />
Umfrage 2008 hat die Ergebnisse bestätigt: das Interesse<br />
der Partnerorganisationen, mehr gegen HIV/AIDS zu<br />
tun, ist unverändert groß; auch die Bereitschaft der<br />
Entwicklungshelfer, sich zu engagieren, ist ausgeprägt.<br />
Dennoch bedarf es kontinuierlicher und intensiver<br />
Unterstützung, um nicht nur viele Interventionsansätze<br />
zu initiieren und fortzuführen, sondern sicherzustellen,<br />
dass auch tatsächlich Wirkungen erzielt werden.<br />
Seit 2007 koordinieren sich die Organisationen der<br />
deutschen EZ unter dem Motto „EZ aus einem Guss“<br />
zunehmend auch im HIV/AIDS-mainstreaming Bereich.<br />
Noch gibt es zum Teil deutliche Differenzen in der<br />
Bekämpfungsstrategie: Während wir beim DED sicher<br />
sind, dass HIV/AIDS als Querschnittsthema in den<br />
Niedrigprävalenzländern nichts (mehr) zu suchen hat,<br />
scheuen sich die anderen, einen klaren Strategiewechsel<br />
in Bezug auf dieses Szenario einzuleiten. Um stärkere<br />
Synergieeffekte zu erzielen, wäre es hilfreich, zu einer<br />
gemeinsamen Strategievorstellung zu kommen.<br />
Winfried Zacher<br />
Winfried Zacher ist Arzt und war über viele Jahre für<br />
Dienste in Übersee (DÜ), die GTZ und den DED im Ausland<br />
und in der DED-Zentrale tätig, zuletzt von 1998<br />
bis 2009 als Leiter der Fachgruppe Gesundheit.
Kamerun<br />
Emanzipation des Kondoms –<br />
das Femidom<br />
Warum der DED in Kamerun die Verbreitung des Frauenkondoms unterstützt<br />
Die Anzahl der Frauen, die in Subsahara-Afrika mit<br />
dem HI-Virus leben, ist größer als die der Männer;<br />
so auch in Kamerun. Dafür gibt es zahlreiche<br />
Gründe biologischer und soziokultureller Natur.<br />
Die Möglichkeiten vieler Frauen, sich vor neuen<br />
Infektionen zu schützen, sind deutlich geringer<br />
als bei uns. So kommt dem in Deutschland<br />
wenig bekannten Frauenkondom in der Präventions-<br />
arbeit in Kamerun eine große Bedeutung zu.<br />
Mit einer HIV-Prävalenz von 5,1 Prozent der<br />
Bevölkerung zwischen 15 und 49 Jahren<br />
gehört Kamerun immer noch zu den sogenannten<br />
Hochprävalenzländern (HIV-Prävalenz<br />
> fünf Prozent), was die Entwicklungschancen dieses<br />
zentralafrikanischen Landes erheblich beeinträchtigt.<br />
Dass HIV als gesamtgesellschaftliche politische Herausforderung<br />
zu sehen ist und nicht lediglich als ein Gesundheitsproblem<br />
behandelt werden kann, ist weltweit<br />
anerkannt. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch<br />
der DED-Beitrag im Kampf gegen die Pandemie.<br />
Sein Engagement zielt darauf, die Anzahl der HIV-<br />
Neuinfektionen durch Präventionsmaßnahmen zu<br />
senken und dass HIV-positive Menschen durch Zugang<br />
zu Behandlung und <strong>Info</strong>rmation möglichst lange ein<br />
aktives Leben führen können, sie nicht stigmatisiert<br />
und ausgegrenzt werden. So sollen negative gesundheitliche<br />
und sozio-ökonomische Folgen für Personen,<br />
Gesellschaften und Staaten geschmälert werden.<br />
Mädchen und Frauen haben in der patriarchalen Gesellschaft<br />
Kameruns eine schwache Position. So ist ihr Zugang<br />
zu Bildung und <strong>Info</strong>rmation eingeschränkt, Sexualität<br />
wird noch weitverbreitet als Tabuthema verstanden<br />
und in Familien und in der Schule wenig erörtert. Frauen<br />
haben oft nicht die Möglichkeit, geschützten Geschlechtsverkehr<br />
zu „verhandeln“. Über Sex zu sprechen, die Initiative<br />
zu ergreifen, eigene Wünsche oder Vorstellungen<br />
vorzutragen, entspricht nicht dem traditionellen Rollenverständnis.<br />
Ein Mangel an Selbstbewusstsein und kommunikativen<br />
und sozialen Kompetenzen erschwert nur<br />
allzu häufig die Möglichkeit, safer sex einzufordern.<br />
Überdies gilt ungeschützter Verkehr als Vertrauens- und<br />
© Meike Winterhagen<br />
Agar Mbianda erklärt die korrekte Benutzung des Frauenkondoms.<br />
Liebesbeweis. Zahlreiche Frauen stehen nach wie vor unter<br />
großem Druck, viele Kinder auf die Welt zu bringen<br />
und schützen sich daher nicht mit Kondomen. Oder sie<br />
befinden sich in anderweitigen Abhängigkeitsverhältnissen,<br />
die es erschweren, deren Verwendung einzufordern.<br />
Hinzu kommt, dass sich Frauen aufgrund der Anatomie<br />
und Physiologie ihres Geschlechtsapparates (große Oberfläche,<br />
Fragilität der Schleimhäute, langer Verbleib des<br />
Spermas, Regelblutung, Menopause, asymptomatischer<br />
Ablauf anderer sexuell übertragbarer Infektionen oder<br />
deren späte Erkennung) leichter infizieren können als<br />
Männer. Darüber hinaus werden Verstöße gegen die<br />
kamerunische Strafgesetzgebung, zum Beispiel Ver-<br />
20 21
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
<strong>Info</strong><br />
Vorteile des Frauenkondoms<br />
■ Die in Kamerun erhältlichen subventionierten Frauenkondome sind aus Polyurethan.<br />
Das ist ein dünner, geruchloser, feinfühliger Kunststoff, der reißfester<br />
ist als bei den männlichen Kondomen aus Latex. Allergische Reaktionen auf dieses<br />
Material sind bisher nicht bekannt und auch keine anderen Nebenwirkungen.<br />
■ Polyurethan ist ein guter Wärmeleiter, so dass sich der Geschlechtsverkehr trotz<br />
Kondom gefühlsecht und natürlich anfühlt.<br />
■ Aufgrund der Materialbeschaffenheit können auch ölbasierte Gleitmittel verwendet<br />
werden.<br />
■ Es ist – bei korrekter Anwendung – genauso sicher wie das männliche Kondom.<br />
■ Der größere Ring bedeckt die äußeren Schamlippen und bietet daher mehr Schutz<br />
vor der Übertragung von Geschlechtskrankheiten als das männliche Kondom.<br />
■ Es kann bereits vor dem Verkehr eingeführt und muss nicht sofort danach entfernt<br />
werden. So bleibt noch Zeit für ein längeres harmonisches Miteinander.<br />
gewaltigungen oder Menschenhandel, nicht ausreichend<br />
verfolgt. Dies sind nur einige der Gründe, weswegen<br />
Frauen vulnerabler für eine HIV-Infektion sind. Und so<br />
sind in Kamerun etwa 60 Prozent der erwachsenen HIVpositiven<br />
Frauen.<br />
Effektiver Schutz<br />
und Stärkung der Selbstbestimmung<br />
Ein großer Teil der HIV-Arbeit des DED in Kamerun<br />
ist die Prävention vor Neuinfektionen. Über den Mainstreaming-Ansatz<br />
(siehe auch Artikel von Winfried Zacher)<br />
integrieren wir das Thema HIV in alle Interventionsbereiche<br />
des DED. Grundlage dafür kann selbstverständlich<br />
nur die Bereitschaft und Überzeugung der Partner<br />
sein, sich des Themas annehmen zu wollen und es nachhaltig<br />
in ihre jeweiligen Aktivitäten aufzunehmen.<br />
Das Spektrum der Methoden und die Inhalte dafür<br />
sind breit gefächert. Doch egal, wo wir als Querschnittsberater<br />
intervenieren, eines steht aus den oben genannten<br />
Gründen fest: Wir wollen über das Frauenkondom<br />
sprechen. Denn analog zum männlichen Kondom ist<br />
es ein effektiver Schutz gegen ungewollte Schwangerschaften<br />
und sexuell übertragbare Infektionen. Und die<br />
Frauen, die es benutzen, erfahren darüber hinaus ein<br />
Gefühl der Selbstbestimmung ihrer sexuellen und reproduktiven<br />
Rechte, die sonst allzu oft verletzt werden.<br />
Trotz der im nebenstehenden Kasten erläuterten Vorteile<br />
spricht in Kamerun noch vieles gegen die regelmäßige<br />
Benutzung des Frauenkondoms. Ein subventioniertes<br />
Frauenkondom kostet derzeit noch das Vierfache<br />
eines subventionierten männlichen Kondoms. Außerdem<br />
sind Frauenkondome nicht überall erhältlich,<br />
vor allem je ländlicher und abgelegener man sie sucht.<br />
„Das sieht ja aus wie eine Plastiktüte!“<br />
Die meisten unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
bei Workshops oder anderen Sensibilisierungsveranstaltungen<br />
kennen das Frauenkondom nicht. Manche<br />
haben bereits davon gehört, aber die wenigsten hatten<br />
schon mal eines in der Hand, geschweige denn es benutzt.<br />
So ist das Erstaunen groß, wird zum ersten Mal<br />
eines ausgepackt. „Oh, was ist das denn?“, „Mann, die<br />
sind aber groß!“ oder „Das sieht ja aus wie ’ne Plastiktüte!“<br />
sind Ausrufe, die wir häufig hören. Zu Beginn<br />
einer solchen Diskussion kommen viele Vorurteile ans<br />
Tageslicht. Aussagen wie: „Das macht doch Krach beim<br />
Sex“ oder „Das Femidom ist krebserregend“ werden<br />
debattiert. Danach wird versucht zu erklären, warum<br />
das Frauenkondom größer ist als das männliche Pendant.<br />
Seine korrekte Verwendung und die Vor- und<br />
Nachteile werden im Detail besprochen. So versucht<br />
beispielsweise Agar Mbianda, die als einheimische Fachkraft<br />
im Bereich Mainstreaming HIV für den DED in<br />
Workshop für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehrerer<br />
DED-Partnerorganisationen im Februar 2009 in Bafoussam<br />
in der Westregion Kameruns.<br />
© Agar Mbianda
Kamerun arbeitet, ihre Zuhörer zu überzeugen, indem<br />
sie versichert: „Ich selbst benutze das Femidom seit langer<br />
Zeit und sage euch, es macht keine unangenehmen<br />
Knistergeräusche. Das war vielleicht früher mal, aber<br />
heute, mit dem neuen Material, hört man nichts. Und<br />
es ist viel angenehmer, weil es sich natürlicher anfühlt,<br />
und der Mann sich nicht so eingeengt fühlt wie im<br />
Männerkondom.“<br />
Am Ende einer solchen Veranstaltung ist die Nachfrage<br />
zumeist sehr groß. Auch Männer, die dem Femidom<br />
zunächst skeptisch gegenüberstanden, wollen es zumindest<br />
mit ihrer Partnerin ausprobieren, um danach besser<br />
urteilen zu können. Und tatsächlich, spricht man sie<br />
einige Zeit später darauf an, so geben viele freimütig zu,<br />
sich „darin wesentlich wohler gefühlt zu haben“.<br />
Das Frauenkondom<br />
als eine Möglichkeit der Prävention<br />
Da das Frauenkondom im öffentlichen Bewusstsein<br />
Kameruns noch keine sehr große Rolle spielt, startet<br />
beispielsweise die Kamerunische Assoziation für Soziales<br />
Marketing (ACMS: Association Camerounaise pour le<br />
Marketing Social), eine der Partnerorganisationen des<br />
DED, mit Unterstützung der kamerunischen Regierung<br />
und des UAFC-Programms (UAFC: Universal Access to<br />
the Female Condom) eine diesbezügliche Kampagne. Das<br />
Frauenkondom soll bekannter und besser angenommen<br />
und seine Verfügbarkeit verbessert werden. Mitte dieses<br />
Jahres begann eine dreijährige Pilotphase der Kampagne<br />
in fünf Regionen des Landes (siehe Interview mit der<br />
Kampagnenleiterin in nebenstehendem Kasten).<br />
Um die Ausbreitung neuer HIV-Infektionen grundsätzlich<br />
zu verringern, bedarf es einer Verhaltensänderung.<br />
Die Benutzung des Frauenkondoms ist nur eine von<br />
mehreren Präventionsmöglichkeiten. Sich mit HIV anstecken<br />
zu können, muss als ein Risiko erkannt werden,<br />
dessen Beeinflussung jede und jeder Einzelne selbst in der<br />
Hand hat. Die Benutzung des Frauenkondoms zu fördern<br />
ist ein Beitrag zur Präventionsarbeit in Kamerun<br />
und wird sowohl direkt durch die Mitarbeit von zwei<br />
DED-Fachkräften bei ACMS als auch durch die Querschnittsarbeit<br />
HIV unterstützt. Auf dem langen Weg zur<br />
gewünschten Verhaltensänderung im Sexualverhalten<br />
kann dies allerdings nur ein kleiner Baustein sein, denn<br />
Faktoren wie zum Beispiel die Förderung des weiblichen<br />
Selbstbewusstseins, Veränderungen im traditionellen<br />
Rollenverhältnis und die Minderung der Benachteiligung<br />
von Mädchen und Frauen innerhalb der Gesellschaft beeinflussen<br />
ebenso eine dauerhaft erfolgreiche Prävention.<br />
Meike Winterhagen arbeitet seit 2008 als HIV-<br />
Querschnittsberaterin für den DED in Kamerun.<br />
Sie ist Physiotherapeutin und M.A. Romanische<br />
Philologie und Biologische Anthropologie.<br />
Meike Winterhagen<br />
22<br />
23<br />
Kurz-Interview<br />
Anni Salla<br />
Abteilungsleiterin Sektor HIV,<br />
ACMS (Association Camerounaise pour le Marketing Sociale), Yaoundé, Kamerun<br />
Wieso startet ACMS 2009 eine Kampagne zur Verbreitung des Frauenkondoms?<br />
ACMS hat festgestellt, dass seit 2002 die Nachfrage nach dem Frauenkondom in Kamerun<br />
stetig wächst, seine Verfügbarkeit bisher aber nur in geringem Maße gegeben<br />
ist. 2008 kam eine totale Lieferunterbrechung hinzu, so dass dieses Kondom eine<br />
Zeitlang überhaupt nicht mehr erhältlich war. Aus diesen Gründen starten wir dieses<br />
Jahr – mit der Unterstützung durch UAFC (Universal Access to the female condom) –<br />
eine ganzheitliche Kampagne zum Frauenkondom, dem Femidom. Diese Kampagne<br />
soll nicht nur seine Verfügbarkeit in Kamerun erhöhen, sondern auch mittels Öffentlichkeitsarbeit<br />
dazu beitragen, dass sich Verhaltensweisen im Zusammenhang mit<br />
HIV verbessern sowie Diskriminierung und Stigmatisierung verringert werden.<br />
Wie sind Ihre Erfahrungen bezüglich der Akzeptanz, ein Frauenkondom zu benutzen?<br />
Die Verkaufszahlen des subventionierten Frauenkondoms weisen seit 2002 eine<br />
deutlich steigende Tendenz auf, das heißt, die Nachfrage und somit auch deren Benutzung<br />
nehmen zu. 2007 wurden etwa achtmal so viele Frauenkondome verkauft<br />
wie noch 2002, auch wenn absolut gesehen die Zahl natürlich noch gering ist.<br />
Wieso kommt es überhaupt zu Lieferschwierigkeiten des Frauenkondoms?<br />
Dass in der Vergangenheit Frauenkondome nicht nachgeliefert wurden, lag an mangelnden<br />
Finanzierungmöglichkeiten der Gebergemeinschaft, die eine regelmäßige<br />
Lieferung gewährleistet hätten.Wir sind uns dieses Problems vor allem seit der Situation<br />
in 2008 bewusst und so wurde zusammen mit der kamerunischen Regierung<br />
und der Intervention von PSI (Population Services International) alles dafür getan,<br />
diese Lieferschwierigkeiten auf ein Minimum zu reduzieren, was uns bisher auch<br />
gelungen ist.<br />
Das Interview führte Meike Winterhagen.
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
Sambia<br />
<strong>Info</strong>rmiere Dich, schütze Dich<br />
und zeige Solidarität mit HIV-Positiven<br />
Präventionsarbeit einmal anders: Der Mitmach-Parcours zu AIDS, Liebe und Sexualität<br />
Yvonne Sartor mit dem VCT-Team Tigwirizane.<br />
Mit den Menschen offen über alle Fragen der Sexualität und HIV/AIDS<br />
sprechen zu können, ist Ziel des Join in Circuit on AIDS, Love and<br />
Sexuality (JIC). Der JIC geht auf ein Konzept der deutschen Bundeszentrale<br />
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zurück, das vor über zehn Jahren<br />
im Rahmen der deutschen Kampagne „Gib AIDS keine Chance“ speziell<br />
für Jugendliche entwickelt wurde und in Deutschland „Mitmach-Parcours<br />
zu AIDS, Liebe und Sexualität“ heißt. Mit dem JIC wurde diese Idee 2006<br />
für Sambia adaptiert und wird nun dort sehr erfolgreich eingesetzt.<br />
Die Menschen sind oft überfordert mit den<br />
<strong>Info</strong>rmationen zu HIV und AIDS. Es ist in<br />
unserem Land ein großes Thema. Daher sind<br />
alternative und partizipative Ansätze so wichtig, damit<br />
Menschen sich dem Thema öffnen und Antworten auf<br />
ihre Fragen finden können“, sagt Christine Inonge, die<br />
sich in der Aufklärungsarbeit engagiert und selbst HIVpositiv<br />
ist. (Siehe auch Artikel „Ich habe mein Leben<br />
meiner Arbeit gewidmet.“)<br />
© Karin Perl<br />
Beim Join in Circuit on AIDS, Love and Sexuality (JIC)<br />
stehen <strong>Info</strong>rmationen und der Spaß am Lernen im<br />
Vordergrund: Rätsel, Rollenspiele, Diskussionen oder<br />
einfach nur die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die<br />
ausgebildeten und kompetenten Moderatorinnen und<br />
Moderatoren der JIC-Teams vermitteln dabei durch<br />
zielgruppengerechte Anleitung differenziertes Fachwissen<br />
und regen die Teilnehmenden zur Reflexion des<br />
eigenen Verhaltens an. In Sambia gibt es zurzeit sechs<br />
aktive Teams, die in den unterschiedlichen Provinzen<br />
des Landes tätig sind.<br />
Die Vorteile der JIC-Methodik liegen unter anderem in<br />
der Möglichkeit, die Teilnehmenden nicht nur auf kognitiver,<br />
sondern auch auf emotionaler und verhaltensbezogener<br />
Ebene anzusprechen. Das Gespräch über Sexualität<br />
wird erleichtert, da sich die Teilnehmenden in ihrer Rolle<br />
als Spielende spontaner ausdrücken und öffnen können.<br />
Die offene Kommunikation regt an, die Gespräche in der<br />
Schulklasse, am Arbeitsplatz und vor allem mit dem Partner<br />
oder der Partnerin weiterzuführen.<br />
Die sambische JIC-Version umfasst sechs Themen zu<br />
HIV/AIDS sowie allgemeinen <strong>Info</strong>rmationen zur Sexualität<br />
und Partnerschaft: Übertragungswege von HIV,<br />
übertragbare Sexualinfektionen, Verhütungsmethoden<br />
und richtige Anwendung von Kondomen (Frauen- und<br />
Männerkondome), Körpersprache rund um das Thema<br />
Liebe und Partnerschaft, Leben mit HIV/AIDS und<br />
Prävention.<br />
Durch den JIC werden primär drei Hauptbotschaften<br />
vermittelt: <strong>Info</strong>rmiere dich, schütze dich und andere<br />
und zeige Solidarität mit Menschen, die mit HIV und<br />
AIDS leben.<br />
Mobile Version des Mitmach-Parcours<br />
Der DED hat in Sambia die Koordination des JIC innerhalb<br />
der deutschen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit<br />
(EZ) übernommen und wird seit<br />
2006 durch die Münstersche AIDS-Stiftung bei der<br />
Umsetzung von JIC-Aktivitäten, bei der Aus- und Fortbildung<br />
von JIC-Teams sowie der Materialentwicklung<br />
großzügig unterstützt. Die DED-Querschnittsberaterin<br />
HIV/AIDS hat zusammen mit JIC-Moderatoren den<br />
Mitmach-Parcours in ein handlicheres und mobiles<br />
toolkit 2007 (Materialkoffer) umgewandelt. Die mobile
Version macht es den Moderatoren einfacher, ihre unterschiedlichen<br />
Zielgruppen und -orte mit öffentlichen<br />
Verkehrsmitteln zu erreichen und sie können so mehr<br />
Mitmach-Parcours durchführen. Der JIC wird in<br />
Sambia primär an Schulen, bei den Partnerorganisationen<br />
der deutschen EZ-Organisationen in Rahmen<br />
der HIV/AIDS Arbeitsplatzprogramme und in ländlichen<br />
Gemeinden sowie armen urbanen Stadtteilen<br />
(compounds/townships) eingesetzt. Diese Zielgruppen<br />
haben oft nur begrenzt Zugang zu den so notwendigen<br />
aktuellen <strong>Info</strong>rmationen zu Themen wie Sexualität und<br />
HIV/AIDS. Das fehlende Wissen führt zu risikohaften<br />
Verhaltensweisen und zur Stigmatisierung und Diskriminierung<br />
von HIV-Positiven. Da es immer noch keine<br />
Heilung für eine HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung<br />
gibt, ist die Präventions- und Aufklärungsarbeit weiterhin<br />
von zentraler Bedeutung.<br />
Wichtige Rolle der Betroffenen bei der Aufklärung<br />
Viele der JIC-Aktivitäten werden mit sambischen Partnerorganisationen<br />
durchgeführt, so zum Beispiel mit<br />
mobilen Voluntary Counselling and Testing (VCT)-<br />
Teams, die in den Gemeinden beziehungsweise in den<br />
Arbeitsplatzprogrammen die Möglichkeit der Beratung<br />
und des HIV-Antikörpertests bieten. Ein wichtiger Teil<br />
der Präventionsarbeit ist der Test, um seinen eigenen<br />
HIV-Status zu kennen und sich und andere vor einer<br />
Infektion mit dem tödlichen Virus zu schützen. Sambia<br />
ist mit einer Fläche von 752.614 Quadratkilometern<br />
zweieinhalbmal so groß wie Deutschland. Die Mehrheit<br />
der Bevölkerung lebt im ländlichen Raum und hat nur<br />
begrenzt Zugang zu VCT und einer Behandlung durch<br />
Anti Retrovirale Therapie (ART) und zu <strong>Info</strong>rmationen<br />
allgemein. Deshalb ist eine enge und systematische Partnerschaft<br />
mit anderen Organisationen aus dem Bereich<br />
der HIV/ AIDS-Präventions- und Behandlungsarbeit<br />
umso wichtiger. Auch Selbsthilfegruppen von Betroffenen<br />
werden in die Arbeit einbezogen, wie zum Beispiel<br />
das Zambian Network for People Living with HIV and<br />
AIDS (NZP+) oder das JIC-Team der sambischen<br />
Nichtregierungsorganisation KARA Counselling.<br />
Menschen, die über ihren HIV-positiven Status, über<br />
ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse offen sprechen,<br />
leisten einen sehr wertvollen und nicht zu ersetzenden<br />
Beitrag bei der Bekämpfung der Pandemie und<br />
der Diskriminierung von HIV-positiven Menschen bzw.<br />
© Karin Perl<br />
AIDS-erkrankten Menschen. Stigma und Diskriminierung<br />
führen weiterhin dazu, dass sich Menschen „verstecken“,<br />
nicht zum VCT trauen, ihre Behandlung<br />
nicht beginnen oder unterbrechen und den Prozess<br />
zum „Positive Living“ nicht beginnen oder abschließen<br />
können. Der DED hat deshalb ganz bewusst und gezielt<br />
zwei JIC-Teams in Sambia ausgebildet, in denen die<br />
Moderatoren HIV-positiv sind.<br />
Dr. Yvonne Sartor<br />
Dr. Yvonne Sartor ist Diplom-Sozialpädagogin und<br />
arbeitet seit 2007 als HIV/AIDS-Querschnittsberaterin<br />
für den DED in Sambia.<br />
Der Mitmach-Parcours<br />
zu AIDS, Liebe und Sexualität<br />
Eine der sechs<br />
JIC-Stationen:<br />
„Positiv leben“.<br />
24 25<br />
Vor über zehn Jahren entwickelte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung<br />
(BZgA) im Rahmen der deutschen Kampagne „Gib AIDS keine Chance“, speziell für<br />
Jugendliche den „Mitmach-Parcours zu AIDS, Liebe und Sexualität“.<br />
Wegen der erfolgreichen Umsetzung dieses Instruments in der AIDS-Präventionsarbeit<br />
in Deutschland, entstand die Idee, den Mitmach-Parcours auch in Ländern einzusetzen,<br />
die besonders von HIV und AIDS betroffen sind. Die BZgA ging deshalb eine<br />
Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)<br />
ein, um den Mitmach-Parcours auch in verschiedenen Pilotländern der deutschen<br />
Entwicklungszusammenarbeit einzuführen. So soll zu den nationalen Bemühungen<br />
der jeweiligen Partnerländer in der HIV/AIDS-Bekämpfung ein kreativer und wirksamer<br />
Beitrag geleistet werden. Das Instrument lässt sich sehr gut adaptieren,<br />
wie das Beispiel Sambia zeigt.<br />
<strong>Info</strong>
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
Sambia<br />
Ich habe mein Leben<br />
meiner Arbeit gewidmet<br />
Bericht einer Betroffenen, die sich in der HIV/AIDS-Präventionsarbeit engagiert<br />
Christine Inonge bei der Aufklärungsarbeit zu HIV/AIDS.<br />
Christine Inonge ist eine langjährige und sehr erfahrene Moderatorin<br />
des Mitmach-Parcours (Join in Circuit on AIDS, Love and Sexuality, JIC).<br />
Sie berichtet im Folgenden über ihr persönliches Schicksal und ihre Arbeit<br />
für die Nichtregierungsorganisation KARA Counselling in den<br />
armen Stadtteilen von Lusaka, der Hauptstadt Sambias.<br />
Ich heiße Christine Inonge und bin 54 Jahre alt.<br />
Ich komme aus der Westprovinz in Sambia und<br />
ich gehöre der ethnischen Gruppe der Lozi an.<br />
1973 habe ich meinen Mann geheiratet, der Tonga war<br />
und aus der Südprovinz Sambias stammte. Die Tongas<br />
leben in einem polygamen System und ich fand nach<br />
meiner Hochzeit heraus, dass ich die vierte Ehefrau war.<br />
Mein Mann ließ sich von zwei Frauen bereits vor unserer<br />
Trauung scheiden, lebte aber mit seiner dritten Frau<br />
noch zusammen. Somit ging ich als Zweitfrau in die<br />
Ehe ein. Trotz unserer Eheschließung hatte mein Mann<br />
außer mit seinen Ehefrauen, sexuelle Beziehungen mit<br />
anderen Frauen. Dies ist als ein wichtiger Faktor für die<br />
Übertragung von HIV zu betrachten. Wir haben zusam-<br />
© Karin Perl<br />
men eine Tochter mit Namen Monde und ich blieb 15<br />
Jahre trotz seiner vielen Affären und seiner zum Teil gewaltvollen<br />
Übergriffe auf mich bei ihm. Ich litt sehr<br />
häufig unter verschiedenen sexuell übertragbaren<br />
Krankheiten und fand mich immer wieder in medizinischer<br />
Behandlung in lokalen Kliniken. Als mein Mann<br />
eine weitere Frau heiraten wollte, beschloss ich, ihn zu<br />
verlassen und mich scheiden zu lassen. Mein ganzes Hab<br />
und Gut blieb bei ihm und ich war auf meine Verwandten<br />
angewiesen.<br />
In meinem eigenen Haushalt gab es sehr nahrhaftes und<br />
ausreichendes Essen, da mein Mann gut verdiente. Ich<br />
hatte den HI-Virus bereits in mir, wusste es aber noch<br />
nicht, da mein Gesundheitszustand durch die abwechslungsreiche<br />
Nahrung stabil war. Erst nach der Trennung<br />
und den damit einhergehenden Veränderungen in meinem<br />
Leben, verschlechterte sich mein Gesundheitszustand<br />
drastisch. Ich hatte keinen Ort, wo ich hingehen<br />
konnte, war depressiv und hatte nicht mehr viel zu essen.<br />
Das war der Zeitpunkt, wo ich sehr krank wurde.<br />
Ich war oft im Krankenhaus mit unterschiedlichen<br />
Krankheiten und 1992 wurde mir mitgeteilt, dass ich<br />
HIV-positiv sei. Zu diesem Zeitpunkt waren Stigmatisierung<br />
und Diskriminierung in Sambia sehr weit verbreitet<br />
und ich konnte mich niemandem anvertrauen,<br />
da ich Angst vor Ablehnung und sozialer Ausgrenzung<br />
hatte. Ich lebte mit meiner Selbst-Stigmatisierung und<br />
konnte meinen HIV-Status nicht akzeptieren.<br />
Die Wende in meinem Leben<br />
Im Jahr 2002 nahm ich bei KARA Counsellling, einer<br />
sambischen Nichtregierungsorganisation (NRO), an<br />
einem Fachtraining für Menschen, die mit HIV und<br />
AIDS leben, teil. Die vier Monate der Ausbildung und<br />
der Austausch mit anderen betroffenen Menschen hat<br />
mich dazu bewegt zu akzeptieren, dass ich HIV-positiv<br />
bin. Diskriminierung kannte ich aus eigener Erfahrung<br />
und so entschloss ich mich, in der Aufklärungsarbeit tätig<br />
zu werden. <strong>Info</strong>rmationen zu HIV und AIDS waren<br />
nicht sehr weit verbreitet, viele diskriminierende Handlungen<br />
gehen auf fehlendes oder unzureichendes Wissen<br />
zurück. In Sambia glauben einige Menschen an Hexerei.<br />
Sie führen Symptome, die mit einer HIV-Infektion in<br />
Verbindung gebracht werden können, auf Verhexung<br />
(being bewitched) zurück und weigern sich, einen HIV-<br />
Antikörpertest durchzuführen. Ich war zunächst Volon-
tärin bei KARA und fing an, in den armen Stadteilen<br />
(compounds) von Lusaka HIV- und AIDS-Aufklärungsarbeit<br />
zu leisten.<br />
Unterhaltsame Aufklärung<br />
Eine der Voraussetzungen bei KARA arbeiten zu können<br />
ist, dass man seinen HIV-positiven Status akzeptiert<br />
und somit als Vorbild dienen kann. Ich erlebte viele Situationen,<br />
in denen ich und andere in den Gemeinden<br />
aufgrund unseres Status diskriminiert wurden. Der<br />
Kampf gegen die Verbreitung von AIDS war und ist<br />
auch immer noch der Kampf gegen Diskriminierung<br />
von Menschen, die HIV-positiv beziehungsweise an<br />
AIDS erkrankt sind. Der Join in Circuit on AIDS, Love<br />
and Sexuality (JIC) hat uns bei unserer Präventionsarbeit<br />
sehr geholfen. Unser KARA Gemeinwesenarbeitsteam<br />
wurde 2006 zu Moderatoren für JIC ausgebildet.<br />
JIC erleichtert mir die <strong>Info</strong>rmationsvermittlung zu<br />
HIV- und AIDS-Themen. Der Vorteil dieser Methodik<br />
besteht darin, dass der JIC viel mit Bildern arbeitet und<br />
es so meiner Zielgruppe erleichtert wird, die Komplexität<br />
von HIV und AIDS leichter zu begreifen. Eine weitere<br />
Stärke ist, dass der JIC sehr partizipativ ausgerichtet<br />
ist und zugleich auch für Unterhaltung sorgt, zum Beispiel<br />
durch Rollenspiele (Pantomime) und interaktive<br />
Diskussionen sowie Kondomdemonstrationen. Der JIC<br />
ist ein Instrument, das bei unterschiedlichen Zielgruppen<br />
eingesetzt werden kann. Wir haben JIC-Aktivitäten in<br />
Schulen, Gemeinden, bei HIV- und AIDS-Arbeitsplatzprogrammen<br />
(APP) sowie in Ausbildungen und Fortbildungskursen<br />
von HIV und AIDS Peer Educators und<br />
Focal Point Persons eingesetzt.<br />
Wichtig ist, sich testen zu lassen<br />
Besonders in den compounds und Arbeitsplatzprogrammen<br />
bewirkt der JIC, dass die Bereitschaft, sich testen<br />
zu lassen (Voluntary Counselling and Testing, VCT),<br />
wächst. Als Betroffene von HIV weiß ich, wie wichtig<br />
VCT ist und dass dies der Anfang für eine positive<br />
Lebenseinstellung sein kann. Die Teilnehmer des JIC<br />
erhalten <strong>Info</strong>rmationen und haben gleichzeitig die<br />
Option, sich beraten und testen zu lassen. Viele nehmen<br />
das Angebot wahr, da die VCT-Teams nicht aus ihren<br />
Gemeinden stammen und sie sich somit sicher fühlen<br />
können, dass Vertraulichkeit gewahrt wird. Für andere<br />
wiederum ist manchmal das VCT die einzige Möglich-<br />
© Karin Perl<br />
keit, da die nächste Klinik oder das Testzentrum weit<br />
von ihrem Wohnort entfernt liegen.<br />
Dadurch, dass ich selber HIV-positiv bin und offen mit<br />
meinem Status umgehe, suchen mich viele Menschen<br />
auf, um mich um Rat zu bitten. Wir sind durch unsere<br />
Organisation in vielen der townships und compounds von<br />
Lusaka bekannt und so können mich Menschen auch<br />
später wieder aufsuchen.<br />
Die Arbeit hat erst begonnen<br />
Sambia hat noch einen weiten Weg vor sich in der Bekämpfung<br />
der AIDS-Pandemie. Nach wie vor gibt es<br />
viele Menschen, die <strong>Info</strong>rmationen zu Themen aus dem<br />
Bereich HIV und AIDS brauchen. Ich habe mein Leben<br />
meiner Arbeit gewidmet. Oder meine Arbeit ist mein<br />
Leben. Ich bin davon überzeugt, dass ich einen kleinen<br />
Beitrag in diesem großen Kampf leisten kann. Ich sehe<br />
immer noch Menschen, die nicht akzeptieren wollen,<br />
dass sie HIV-positiv sind. Durch meine Erfahrungen<br />
kann ich die Menschen berühren und ihnen zeigen,<br />
dass es mir gut geht und dass ich mein Leben lebe und<br />
genieße wie jeder andere Mensch.<br />
Ich wünsche mir, dass unsere Jugend von HIV verschont<br />
bleibt, dass sie sich zu schützen weiß und in der<br />
Zukunft in Sambia wieder eine Generation ohne HIV<br />
leben wird. Ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit erst<br />
beginnt und dass ich mich so lange ich lebe dem Kampf<br />
gegen die Verbreitung von HIV und gegen Stigmatisierung<br />
und Diskriminierung stellen werde.<br />
Aufgezeichnet und übersetzt von Dr. Yvonne Sartor,<br />
HIV- und AIDS-Querschnittsberaterin des DED in Sambia.<br />
26 27<br />
Gruppenfoto des<br />
gesamten Teams<br />
mit Yvonne Sartor<br />
und Christine Inonge.
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
Äthiopien<br />
Kaffeezeremonien<br />
und Coming Out von HIV-Positiven<br />
Erfolgreicher Kampf gegen Diskriminierung durch lokale Initiativen<br />
Wie in vielen Länder der Welt ist es<br />
auch in Äthiopien ein langwieriger<br />
Prozess, Vorurteile über HIV/AIDS und<br />
vor allem die Angst vor HIV-positiven<br />
Menschen abzubauen. Es ist dem<br />
mutigen Auftreten von Frauen<br />
wie Genet in ihrer unmittelbaren<br />
Nachbarschaft zu verdanken,<br />
dass nun offener über das Thema<br />
gesprochen werden kann und der<br />
Umgang mit den betroffenen Menschen<br />
sich zu normalisieren beginnt.<br />
Genet –<br />
Mitbegründerin<br />
einer Selbsthilfe-<br />
gruppe von<br />
HIV-Positiven<br />
in Addis Abeba.<br />
Der Freiwillige Abiy klärt junge Tagelöhner über die Verwendung von Kondomen auf.<br />
Genet musste in vier Jahren 13 Mal umziehen.<br />
Ihre Vermieter hatten Angst. Angst vor einer<br />
HIV-Positiven, die in öffentlichen Veranstaltungen<br />
in ihrem Stadtteil von ihrem Leben und ihrem<br />
Schicksal erzählt. Genet war die erste in ihrem Stadtteil,<br />
die sich offen zu ihrem Status bekannt hat. Sie hat in Gemeindeversammlungen<br />
und in Schulen ihre Lebensgeschichte<br />
erzählt. Aufgewachsen ist sie auf dem Land im<br />
Norden Äthiopiens. Aus ärmsten Verhältnissen stammend,<br />
heiratete sie bereits mit 15 Jahren einen Soldaten,<br />
damit ihre Familie sie nicht mehr ernähren muss. Genet<br />
erzählt, wie sie kurz darauf ein Kind bekam, sich dann<br />
aber von ihrem Mann trennte, da er sie schlug und „in<br />
jedem Dorf eine Freundin hatte“. Mit 16 Jahren, als ihr<br />
leiblicher Vater die Familie verlässt, steht Genet plötzlich<br />
vor der Aufgabe, nicht nur ein Einkommen für sich und<br />
ihr Baby, sondern auch für ihre Geschwister zu erwirtschaften.<br />
Sie lässt das Baby bei ihrer Mutter zurück, zieht<br />
in die Stadt und prostituiert sich. Nach einiger Zeit<br />
merkt sie, dass sie sich immer krank fühlt. Sie lässt sich<br />
testen und findet heraus, dass sie HIV-positiv ist. Als sie<br />
zu ihrer Familie zurückkehrt, will diese nichts mehr von<br />
ihr wissen. Dabei wusste ihre Mutter immer, woher das<br />
Geld für den Unterhalt der Familie kam. Sie wird verstoßen,<br />
flüchtet todkrank in die Hauptstadt Addis. Noch<br />
schlimmer ist für sie, dass auch ihr Sohn HIV-positiv ist.<br />
Ein Tabuthema der äthiopischen Gesellschaft<br />
AIDS ist Ende der neunziger Jahre ein großes Thema in<br />
den äthiopischen Medien, allerdings werden verstörende<br />
Bilder gezeigt: HIV-Positive sind immer dünn, von Ausschlag<br />
übersät, werden als Skelette, als die lebenden Toten<br />
dargestellt. Diese Mediendarstellung schafft viele<br />
Vorurteile: man könne den Menschen ansehen, das sie<br />
infiziert seien und dass sie sowieso bald sterben würden.<br />
HIV/AIDS ist in der Gesellschaft ein großes Tabuthema,<br />
keiner kann darüber reden. Gerade ältere Menschen<br />
glauben, dass die bloße Benennung schon zu einer<br />
Infektion führen würde.<br />
In der Stadtverwaltung trifft Genet zum ersten Mal andere<br />
HIV-Positive. 2003 gründen sie in Mekanisa, einem<br />
Stadtteil am Stadtrand von Addis, die lokale Nichtregierungsorganisation<br />
(NRO) „Addis Hiwot“ (Neues<br />
Leben). Ziel ist es, die Bedürfnisse der Betroffenen bei<br />
den Behörden besser durchzusetzen, sich aber auch<br />
selbst zu helfen, einander zu versorgen, wenn jemand<br />
krank ist und durch die gemeinsame Beantragung von<br />
Mikrokrediten Unternehmen zu gründen, um Einkommen<br />
zu erwirtschaften.<br />
© Till Winkelmann
Ungefähr zur gleichen Zeit spricht Genet zum ersten<br />
Mal über ihren Status mit einem Fremden. Ein älterer<br />
Mann macht sie im Minibus an und lädt sie zu einem<br />
Kaffee ein. Er eröffnet ihr, dass er gerne mit ihr schlafen<br />
würde, da sie jung und hübsch sei und seine eigene Frau<br />
alt und hässlich. Genet erklärt sich. Zunächst ist der<br />
Mann geschockt. Genet: „Ich sagte ihm, dass ich wie<br />
seine Frau bin. Er solle aufhören, anderen Frauen nachzusteigen<br />
und seine Frau zu gefährden. Er verstand mich<br />
und hatte Mitleid mit mir. Nach diesem Tag habe ich das<br />
allen Männern erzählt, die mit mir schlafen wollten.“<br />
2003 outet sich Genet zum ersten Mal in aller Öffentlichkeit.<br />
Sie fängt an, verschiedene Iddir zu besuchen<br />
und dort ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Ein Iddir<br />
ist eine lokale, meist informelle soziale Sicherungsstruktur,<br />
der üblicherweise 200–300 Haushalte angehören.<br />
Im Todesfall wird die in Äthiopien sehr teure Beerdigung<br />
von den Iddirs ausgerichtet und bezahlt, die Hinterbliebenen<br />
bekommen eine Abfindung. Einmal im<br />
Monat findet eine Mitgliederversammlung statt, zu der<br />
verpflichtend alle Haushalte kommen müssen. Eine<br />
gute Möglichkeit also auch über HIV zu sprechen.<br />
Genet: „Eines Tages habe ich eine Veranstaltung in<br />
einem Iddir gemacht. Jeder fühlte sich schlecht, einige<br />
haben auch geweint. Als ich nach Hause kam, fand ich<br />
alle meine Sachen auf der Straße. Die Hausbesitzerin<br />
war in dem Iddir. Ich habe sie gefragt: ,Warum?‘ Sie<br />
sagte: ,Weil Du HIV-positiv bist.‘“<br />
Die Diskriminierung von HIV-Positiven war zu jener<br />
Zeit enorm stark in der äthiopischen Gesellschaft. Jeglicher<br />
Körperkontakt wurde vermieden, sei es das Händeschütteln<br />
als Begrüßung, sei es das gemeinsame Essen.<br />
HIV-Positive wurden in Cafés nicht geduldet, das Virus<br />
könne ja vom Stuhl auf andere Gäste „überspringen“.<br />
Fast alle HIV-Positiven verloren zu dieser Zeit ihre<br />
Wohnung.<br />
Aufklärungsarbeit von HIV-Positiven<br />
in ihrer Nachbarschaft<br />
Fünf Jahre später hat sich die Situation deutlich verbessert.<br />
Die Diskriminierung ist durchaus noch vorhanden,<br />
doch die Menschen sind besser aufgeklärt, haben eine<br />
viel genauere Vorstellung von den Übertragungswegen.<br />
Der zwischenmenschliche Umgang beginnt sich zu<br />
normalisieren, aber nach wie vor ist es schwierig, eine<br />
Wohnung zu finden. So gut wie alle erwachsenen<br />
Obdachlosen in Addis sind<br />
HIV-positiv!<br />
Besonders in den letzten zwei Jahren ist<br />
eine deutliche Veränderung insofern zu erkennen,<br />
als dass die Menschen viel offener<br />
über HIV und auch über Sexualität sprechen<br />
können. Großen Anteil an dieser<br />
Veränderung haben Ansätze auf Gemeindeebene.<br />
Insbesondere durch das Outing von<br />
HIV-Positiven und ihre Aufklärungsarbeit<br />
bei den Nachbarn, das heißt in einer Sprache<br />
und Form, die die Bevölkerung versteht,<br />
bekommt die Zielgruppe einen eigenen<br />
Zugang.<br />
Empirische Untersuchungen über einen<br />
Zeitraum von drei Jahren zeigen, dass insbesondere<br />
Genet und ihre NRO viel dazu<br />
beigetragen haben, dass die Menschen<br />
in Genets Viertel Mekanisa viel offener über HIV reden,<br />
als die in anderen Vierteln. Mittlerweile wird diese Idee<br />
auch von anderen Organisationen umgesetzt: Seit etwa<br />
drei Jahren gibt es in allen Stadtvierteln Home-Based-<br />
Care-Gruppen. Das sind Gruppen von Freiwilligen, meist<br />
jungen Erwachsenen, die sich für 18 Monate verpflichten,<br />
bettlägerige Kranke in ihrem Stadtteil zu versorgen. Sie<br />
werden zum Arzt gebracht; es wird aufgepasst, dass sie<br />
ihre Medikamente regelmäßig einnehmen; es wird aber<br />
auch gekocht, geputzt, gefüttert und eingekauft. Ursprünglich<br />
wurden diese Gruppen als Reaktion auf AIDS<br />
eingerichtet, mittlerweile werden jedoch auch andere<br />
Bettlägerige versorgt. Der Home-Based-Care-Ansatz stellt<br />
ein Novum für die äthiopische Gesellschaft dar: Hauptsächlich<br />
kümmert sich die Familie um Kranke, auch die<br />
enge Nachbarschaft und Freunde helfen mit. Nun kümmern<br />
sich zum ersten Mal Fremde ehrenamtlich um<br />
Fremde. Eine so intensive Versorgung bleibt natürlich<br />
auch von den Nachbarn nicht unbeobachtet. Um Gerüchte<br />
zu vermeiden, wird die Nachbarschaft von der<br />
Home-Based-Care-Gruppe zu einer traditionellen Kaffeezeremonie<br />
eingeladen. Bei frisch gebrühtem Kaffee und<br />
Popcorn wird ungezwungen über HIV aufgeklärt, die<br />
Übertragungs- und Vermeidungswege werden diskutiert<br />
und auch schon mal gezeigt, wie ein Kondom verwendet<br />
wird. Zu diesen Treffen werden häufig HIV-Positive aus<br />
anderen Vierteln als Gäste geladen, um aus ihrem Leben<br />
© Till Winkelmann<br />
28 29<br />
Die Ärmsten der Armen<br />
haben häufig keinen<br />
Zugang zu Aufklärungsmedien.
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
Aufklärungs-Poster<br />
an einer Hauptstraße<br />
in Addis Abeba.<br />
und von ihren Erfahrungen zu berichten. Und wenn die<br />
Stimmung gut genug ist, dann ist dies auch eine gute Gelegenheit<br />
für die Kranken, sich im Kreis ihrer Nachbarn<br />
zu outen und sie um ihre Unterstützung zu bitten.<br />
In den Untersuchungen hat sich gezeigt, dass diese<br />
Form der persönlichen Ansprache, des persönlichen<br />
Kontakts, die stärkste Wirkung bei der Aufklärung der<br />
Bevölkerung hat. Bei der medialen Vermittlung sind die<br />
Inhalte häufig zu abstrakt, der persönliche Bezug wird<br />
nicht hergestellt.<br />
Veränderungen durch Maßnahmen<br />
auf Gemeindeebene<br />
Bei einem von mir durchgeführten Studie (n = 268)<br />
stellte sich beispielsweise heraus, dass zwar 65,2 Prozent<br />
der Befragten glauben, dass HIV ein sehr großes Problem<br />
für Äthiopien darstellt, für Addis Abeba waren<br />
es noch 41,9 Prozent, für ihren Stadtteil glaubten dies<br />
13,3 Prozent, während nur noch 10 Prozent das für ihre<br />
unmittelbare Nachbarschaft so wahrnahmen. Dabei<br />
wurde die Untersuchung in den Stadtvierteln durchgeführt,<br />
die nach offizieller Einschätzung überdurchschnittlich<br />
stark von HIV betroffen waren. Die offiziellen<br />
Zahlen zu der HIV-Prävalenzquote sind genau „andersherum“:<br />
sehr hoch in den jeweiligen Stadtvierteln<br />
© Till Winkelmann<br />
(etwa 20 Prozent), etwas schwächer in Addis Abeba<br />
(11–16 Prozent), auf nationaler Ebene mit 2,2 Prozent<br />
für Subsahara-Afrika recht gering. Die Studie zeigt, dass<br />
die eigene Exposition unrealistisch eingeschätzt wird.<br />
Dies hat viel mit der Form der Aufklärung zu tun, die<br />
überwiegend medial erfolgt. Ein weiterer Nachteil bei<br />
der medialen Vermittlung, sei es in Form von Plakaten,<br />
Radio oder Fernsehbeiträgen, ist häufig, dass ein großer<br />
Teil der Zielgruppe überhaupt keinen Zugang zu diesen<br />
Medien hat. Obwohl in der Hauptstadt lebend, haben<br />
viele Menschen und insbesondere die mit geringem<br />
Einkommen, meist nur einen eingeschränkten Aktionsradius<br />
und häufig nicht das Geld für Transport, um<br />
dann die riesigen Plakatwände zu AIDS an den Hauptstraßen<br />
zu sehen. Und eben jene sind hoch vulnerabel<br />
gegenüber HIV; sei es, weil ihre Bildung schlecht ist,<br />
weil sie in einseitigen, informellen Abhängigkeitsverhältnissen,<br />
etwa als Dienstmädchen, stehen oder weil<br />
sie als Tagelöhner von der Hand in den Mund leben.<br />
Die Studie gab noch einen anderen wichtigen Hinweis:<br />
HIV-Positive haben überraschenderweise ein beinahe<br />
ebenso schlechtes Wissen zu den HIV-Übertragungswegen<br />
wie die normale Bevölkerung! Für die Praxis<br />
bedeutet dies, dass es wichtig ist, HIV-Positive vor einer<br />
Veranstaltung auf lokaler Ebene gezielt auszubilden,<br />
damit sich Fehlinformationen und auch Vorurteile<br />
nicht noch in der Bevölkerung vertiefen.<br />
Die Untersuchungen zeigten deutlich, dass eine veränderte<br />
Einstellung in der Bevölkerung zum Umgang mit<br />
HIV und AIDS, sei es in Form von veränderten Kommunikationsnormen,<br />
von Sexualhandeln oder vom täglichen<br />
Umgang mit den Virusträgern und deren Pflege,<br />
erst durch Maßnahmen auf Gemeindeebene erreicht<br />
werden konnten. Genet und ihre NRO haben das früh<br />
erkannt, der Erfolg lässt sich sehen: Die Menschen in<br />
ihrem Stadtteil reden nicht nur viel offener über HIV,<br />
auch die Lebensbedingungen für HIV-Positive sind<br />
deutlich besser geworden.<br />
Till Winkelmann<br />
Till Winkelmann ist Geograph und promoviert zu<br />
Risikowahrnehmung und -interpretation von HIV/AIDS<br />
in Äthiopien. Er ist Mitglied des Redaktionsbeirates<br />
des DED-Briefes.
Malawi/Haiti<br />
Gesundheit darf<br />
kein Geschäft sein<br />
Kostenlose Gesundheitsversorgung<br />
versus Kostenbeteiligung der Patienten<br />
Gesundheitsversorgung sollte in den Entwicklungsländern<br />
kostenlos sein. Dafür plädiert die Autorin,<br />
die in verschiedenen Ländern gearbeitet und dabei<br />
unterschiedliche Modelle der Finanzierung<br />
kennen gelernt hat. Sie schildert die Auswirkungen,<br />
wenn Menschen für Gesundheitsleistungen<br />
zahlen müssen, das nötige Geld nicht aufbringen können<br />
und deshalb keine medizinische Hilfe erhalten.<br />
Es besteht die Gefahr, dass Gesundheit zu einem lukrativen<br />
Geschäft auf dem Rücken der Patienten wird.<br />
Sie zeigt aber auch Probleme auf, die bei kostenloser<br />
Gesundheitsversorgung eine gute Behandlung erschweren.<br />
Malawi hat heute ein sogenanntes Basketfunding<br />
für Gesundheit, das heißt, es gibt<br />
verschiedene Geldgeber und diese einigen<br />
sich mit dem Gesundheitsministerium auf ein gemeinsames<br />
Arbeitsprogramm. Die Basis ist das Essential<br />
Health Package (Basisgesundheitsversorgung), das die<br />
wichtigsten Gesundheitsprogramme für alle zugänglich<br />
machen soll. Behandlung von HIV ist eingeschlossen.<br />
Die Gesundheitsversorgung ist in öffentlichen Einrichtungen<br />
kostenlos. Kirchliche Einrichtungen können mit<br />
dem Staat ein Abkommen schliessen, damit ihre Kosten<br />
übernommen werden, wenn sie kostenlose Versorgung<br />
anbieten. Personalkosten dieser Einrichtungen werden<br />
bereits vom Gesundheitsministerium bezahlt. Neben<br />
dem gemeinsamen SWAP-Fond (sector wide approach),<br />
einem von Geldgebern und Ministerium gemeinsam<br />
finanzierten Topf, der die wichtigsten Elemente des<br />
Essential Health Package finanziert, gibt es noch andere<br />
Geldgeber, die vertikale Programme finanzieren (zum<br />
Beispiel das Impf-, das Malaria- und das Tuberkuloseprogramm<br />
sowie mehrere HIV-Programme), die zentral<br />
gesteuert und supervisiert werden.<br />
Während meiner langjährigen Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit<br />
habe ich Erfahrungen mit<br />
verschiedenen Systemen der Finanzierung von Gesundheitsversorgung<br />
sammeln können. Mit Cost Recovery –<br />
© Christiane Boecker<br />
was bedeutet, dass Patienten oder Klienten für Gesundheitsleistungen<br />
bezahlen, aber auch mit kostenloser Gesundheitsversorgung.<br />
Malawi hat das am besten ausgestattete und finanzierte<br />
Gesundheitsprogramm, das ich in den letzten Jahren in<br />
armen Ländern gesehen habe. Es gibt Medikamente<br />
und Material, sogar Bettlaken und Narkosegeräte und<br />
vieles mehr. Leider ist aber die Müttersterblichkeit immer<br />
noch höher als selbst in Haiti. Und auch andere<br />
Indikatoren, wie die hohe Sterblichkeit an Malaria und<br />
Lungenentzündung, weisen darauf hin, dass die Gesundheitsversorgung<br />
immer noch schlecht ist. Woran<br />
liegt es? Daran, dass das Gesundheitswesen öffentlich<br />
und kostenlos ist, wie manche glauben?<br />
Konsequenzen von Cost Recovery<br />
Bevor ich nach Malawi ging, war ich in Haiti, wo ich in<br />
einem Programm gearbeitet habe, das Alternativen zur<br />
Politik des Cost Recovery in einem kleinen Gesundheitsdistrikt<br />
aufzeigen wollte. Cost Recovery ist noch immer<br />
die Regel in der Gesundheitsversorgung in den meisten<br />
armen Ländern. In Haiti wie in vielen anderen Ländern<br />
bedeutete das, dass Menschen für alles, angefangen bei<br />
der Sprechstunde über die Untersuchung, das Labor,<br />
die Medikamente, aber auch eine notwendige Operation<br />
Mutter mit<br />
unterernährtem Kind<br />
in Haiti.<br />
30 31
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
Entbindungsstation<br />
im Malawi Mizmba<br />
Hospital.<br />
bezahlen müssen. Oft muss, bevor ein Kaiserschnitt<br />
gemacht werden kann, die Familie alles dafür Nötige<br />
kaufen – vom Desinfektionsmittel über die Handschuhe<br />
und das Verbandsmaterial bis zum Faden für die Naht –<br />
und dann noch die Operationskosten und Medikamente<br />
zahlen. Wertvolle Zeit geht verloren, wenn die<br />
Angehörigen versuchen, sich überall Geld zu leihen.<br />
Familien bleiben nach einem Krankheitsfall tief verschuldet<br />
zurück. Viele Patienten und Patientinnen<br />
versuchen gar nicht erst, Gesundheitsversorgung zu<br />
bekommen und begnügen sich mit Selbstbehandlung<br />
mit überall auf dem Markt verkauften Medikamenten<br />
oft dubioser Herkunft oder sie gehen zum traditionellen<br />
Heiler, der die Bezahlung abstuft und auch andere Formen<br />
von Bezahlung annimmt.<br />
In Haiti haben wir in unserem kleinen Hospital die<br />
Gesundheitsversorgung subventioniert, um im kleinen<br />
Rahmen zu zeigen, dass Subvention von Gesundheitsleistungen<br />
nicht so teuer und auch in einem armen<br />
Land umsetzbar ist. Die Besucherzahlen des Krankenhauses<br />
gingen sofort in die Höhe, Frauen kamen zum<br />
Entbinden und viele HIV-Kranke suchten Rat. Wir sind<br />
aber mit unserem subventionierten Gesundheitsprogramm<br />
bald an Grenzen gestoßen: In ihrer Not kamen<br />
viele schwerstkranke Patienten von weit<br />
her, deren Versorgung in unserem kleinen<br />
Hospital nicht möglich war. Aus<br />
humanitären Gründen konnten wir sie<br />
nicht wegschicken und haben die Verlegung<br />
und die nötigen Kosten für Operationen<br />
und Untersuchungen bezahlt.<br />
Leider zeigte auch das Gesundheitsministerium<br />
kein großes Interesse an dem<br />
Modell und an einer Fortführung des<br />
Programms, da mit dem aktuellen System<br />
viel Geld verdient werden kann.<br />
In vielen armen Ländern hat Cost<br />
Recovery nämlich dazu geführt, dass Gesundheit<br />
ein Geschäft geworden ist,<br />
Wartende Mütter in der Sprechstunde.<br />
© Christiane Boecker<br />
© Christiane Boecker<br />
bei dem manche Gesundheitsarbeiter sich jeden Handgriff<br />
bezahlen lassen – über und unter dem Tisch. Mit<br />
Medikamentendealern werden Abkommen geschlossen,<br />
damit Gesundheitsarbeiter am Profit beteiligt sind. In<br />
Haiti zum Beispiel gibt es dubiose Apotheken ohne Registrierung<br />
vor jeder Gesundheitseinrichtung, meistens<br />
sind es Angehörige von Krankenschwestern und Ärzten,<br />
die selbst keine pharmakologische Ausbildung haben.<br />
In vielen Gesundheitseinrichtungen habe ich noch etwas<br />
anderes bemerkt: Wenn der Patient ein „Klient“<br />
wird, der das finanzielle Überleben des Gesundheitszentrums<br />
sichert, wird versucht, ihm auf alle Fälle etwas<br />
zu verkaufen, was er vielleicht brauchen könnte. So fand<br />
ich in vielen Gesundheitseinrichtungen alle möglichen<br />
Vitamine und Appetitanreger, Haarcremes und Hautbleichmittel,<br />
Babywäsche und Windeln, Seife und<br />
Shampoo statt der essentiellen Arzneimittel.<br />
Zu wenig Personal im Gesundheitswesen<br />
In Malawi war Gesundheitsversorgung immer kostenlos,<br />
aber in den letzten Jahren des Banda-Regimes war<br />
die Gesundheitsversorgung sehr schlecht, weil das<br />
ausgebildete Personal das Land verließ und es in den<br />
Gesundheitseinrichtungen wenig Medikamente und<br />
Materialien gab. Als dann die Gebergemeinschaft die<br />
aufblühende Demokratiebewegung unterstützen wollte,<br />
wurde auch in die Gesundheit investiert.
Seit dem Ende der Bandazeit werden Ärztinnen und<br />
Ärzte im Land ausgebildet und vermehrt auch Clinical<br />
Officers (eine Art praktischer Arzt im Schnellverfahren),<br />
Schwestern und Medical Assistants (die Sprechstunden<br />
halten und Medikamente verteilen). Dennoch gibt es<br />
immer noch zu wenig Personal im öffentlichen Gesundheitswesen,<br />
weil viele nach der Ausbildung privat<br />
arbeiten, auswandern oder in einem anderen Sektor<br />
Geld verdienen. Ein anderes Problem ist, dass über<br />
15 Prozent sich mit HIV infizieren und einige trotz<br />
Behandlungsmöglichkeiten zu krank werden, um weiterarbeiten<br />
zu können oder sie ziehen es vor zu sterben,<br />
als andere wissen zu lassen, dass sie infiziert sind.<br />
Fortbildung zur Aufbesserung des Gehaltes<br />
Leider ist die Motivation der Gesundheitsmitarbeiter oft<br />
sehr niedrig. Das Gehalt einer Krankenschwester deckt<br />
nicht die Lebenshaltungskosten der Familie und ein<br />
Arzt kann mit seinem Gehalt mal gerade das Allernötigste<br />
zum Überleben bezahlen.<br />
Statt Löhne zu erhöhen oder eine Belohnung für gute<br />
Arbeit zu zahlen, hat es sich in Malawi eingebürgert,<br />
für Fortbildungen und Meetings nicht nur Reise- und<br />
Hotelkosten, sondern auch allowances (Tagegelder) zu<br />
zahlen. Die Teilnahme an einer Fortbildung von sieben<br />
Tagen kann das Gehalt einer Krankenschwester fast verdoppeln.<br />
So bestehen die District Implementation Plans<br />
(Gesundheitsplanung der Distrikte), in denen die Aktivitäten<br />
budgetiert werden, fast nur aus Meetings und<br />
Trainings. Eine Krankenschwester möchte am liebsten<br />
mindestens zwei Wochen im Monat in Fortbildung sein,<br />
um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Was sie dabei<br />
lernt, ist ihr unwichtig. Im Krankenhaus will jeder<br />
zeigen, dass er etwas nicht gut genug kann, um auf ein<br />
Training geschickt zu werden. Oft werden eklatante<br />
Fehler in der Krankenversorgung mit „Ich habe darin<br />
noch kein Training gehabt“ kommentiert.<br />
Die kostenlose Versorgung hat auch zu einer hohen Zahl<br />
an Patienten geführt, so dass die Arbeitslast sehr groß ist.<br />
Ein Medical Assistant, der über hundert Patienten am Tag<br />
sieht, hat einfach keine Zeit, sorgfältig jeden Einzelnen zu<br />
untersuchen. So werden Menschen mit Lungenentzündung<br />
auf Malaria behandelt und Frauen mit einer durchgebrochenen<br />
Eileiterschwangerschaft bekommen Medikamente<br />
für Geschlechtskrankheiten.<br />
© Christiane Boecker<br />
Beratung der Gesundheitsbehörden gefragt<br />
Ich bin in der nördlichen Region von Malawi in sieben<br />
Gesundheitsdistrikten tätig: Gesundheitseinrichtungen<br />
supervisieren, Gesundheitsarbeiter coachen, aber auch<br />
Ratschläge geben, was besser organisiert werden kann,<br />
welche Fortbildung wirklich nötig ist, welche Medikamente<br />
fehlen, was repariert werden muss und vieles<br />
mehr. Unsere Partner sind einerseits die District Health<br />
Management Teams (die Leitung der Distriktkrankenhäuser<br />
und der Gesundheitszentren) und andererseits<br />
das Gesundheitsministerium, die Geber und die Distriktverwaltung.<br />
Wir analysieren auch die Audits über den Tod jeder<br />
schwangeren Frau, um zu sehen, was falsch lief und<br />
wie wir es erreichen können, dass derselbe Fehler nicht<br />
wieder passiert. Dieses Jahr wollen wir auch Todesfälle<br />
von Kindern untersuchen. Wirklich zur Rechenschaft<br />
wird hier niemand gezogen, auch wenn schwerwiegende<br />
Fehler festgestellt wurden, aber vielleicht kann es einfach<br />
zum Nachdenken verhelfen. Auf der anderen Seite<br />
wollen wir versuchen, guten Einsatz zu belohnen, um<br />
zur Nachahmung anzuregen.<br />
Ob das Sinn macht? Ich denke ja. Ich kann meine<br />
Kollegen einladen zu erleben, dass gute Gesundheitsversorgung<br />
Spaß macht, dass es ein gutes Gefühl ist,<br />
zu wissen, dass du alles getan hast, was möglich war,<br />
um ein Leben zu retten oder dass dich an einem Tod<br />
keine Schuld trifft. Gesundheit darf kein Geschäft sein.<br />
Auch wenn Gesundheitsversorgung teuer ist, müssen<br />
Wege gefunden werden, möglichst vielen Menschen<br />
Zugang zu Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.<br />
Dr. Christiane Boecker<br />
Dr. Christiane Boecker ist Ärztin und arbeitete in Benin,<br />
im Tschad und in Haiti. Seit 2008 ist sie Entwicklungshelferin<br />
des DED in Malawi.<br />
Werdende Mütter<br />
warten auf die<br />
Entbindung.<br />
32 33
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
Brasilien<br />
Ein Schiff wird kommen<br />
Unterwegs mit einer schwimmenden Arztpraxis<br />
Ankunft des Hospitalschiffes in einer Gemeinde am Rio Tapajós. Auf dem Hospitalschiff „Abaré“ herrscht immer großer Andrang.<br />
Als ein Modellprojekt betreibt das Projeto Saúde e Alegria (PSA), das Projekt Gesundheit und Freude,<br />
in Amazonien, im brasilianischen Bundesstaat Pará, ein Hospitalschiff, auf dem die Bevölkerung<br />
in abgelegenen Gemeinden am Fluss Tapajós regelmäßig medizinisch versorgt wird.<br />
Abaré,„der Freund, der sich kümmert“, haben die Bewohner das Schiff liebevoll getauft.<br />
Der flache Rumpf des Schiffes gleitet langsam an<br />
das sandige Ufer des Rio Tapajós, der Dieselmotor<br />
blubbert gedämpft. Heute morgen erreichen<br />
wir Acaratinga, eine der zahlreichen kleinen Gemeinden<br />
am Tapajós. Die landschaftliche Kulisse ist<br />
überwältigend. Gigantische Haufenwolken türmen sich<br />
über dem Fluss auf, dessen gegenüberliegendes Ufer nur<br />
als feine, blassgrüne Linie zwischen Wasser und Himmel<br />
am Horizont zu erkennen ist. Der Tapajós hat hier an<br />
seinem Oberlauf und kurz vor seiner Mündung in den<br />
Amazonas eine Breite von bis zu 18 Kilometern, also<br />
ungefähr die Breite des Bodensees.<br />
Dem Fluss zugewandt liegen vor uns die wie in den<br />
Wald gestreuten Stroh- und Holzhütten der etwa 200<br />
Einwohner, auf den ersten Blick pittoresk, doch die<br />
Idylle trügt. Die Verhältnisse sind bescheiden, die Bevölkerung<br />
lebt hauptsächlich vom Fischfang, baut Maniok<br />
an und nutzt in Sammelwirtschaft die mannigfaltigen<br />
Produkte des tropischen Waldes. Die Bewohner und Bewohnerinnen<br />
der Gemeinden sind caboclos, Nachfahren<br />
der ursprünglichen, indigenen Bevölkerung, die sich in<br />
den letzten Jahrhunderten vorwiegend mit den europäischen<br />
Einwanderern weißer Hautfarbe vermischt hat.<br />
© Projeto Saúde e Alegria<br />
Wir werden schon erwartet. Nachdem die Landungsbrücke<br />
festgezurrt ist, strömen Mütter mit Kinderscharen,<br />
Familienväter, ältere Frauen und Männer an Bord.<br />
An der Rezeption bilden sich Warteschlangen. Die ersten<br />
Kinder bekommen Schutzimpfungen gespritzt, Tränen<br />
kullern über Kindergesichter, dann Eintragungen in<br />
abgegriffene Impfpässe der brasilianischen Regierung.<br />
Beim Zahnarzt liegt schon die erste Patientin im Behandlungsstuhl.<br />
Ein Vater bringt seinen humpelnden<br />
Sohn in einen der anderen Behandlungsräume – ein<br />
entzündeter Insektenstich am Bein. Dazwischen wuseln<br />
jede Menge Kinder umher. Die Bordapotheke verteilt<br />
Medikamente nach Rezept. Am Eingang zum Beratungsraum<br />
für Familienplanung geben sich ausschließlich<br />
Frauen die Klinke in die Hand – nebenbei manifestiert<br />
sich so auch ein tradiertes Rollenverständnis. In der<br />
Wartezone des Schiffes führen heute bunt geschminkte<br />
Gaukler in Clownskostümen einen kurzen Sketch zum<br />
Thema Schlangenbisse auf. Alltag auf dem Hospitalschiff<br />
„Abaré“ der Nichtregierungsorganisation (NRO)<br />
Projeto Saúde e Alegria.<br />
© Alexander Riesen
Große Distanzen<br />
erschweren die medizinische Versorgung<br />
Die Situation der Gesundheitsversorgung in Amazonien<br />
ist vor allem außerhalb der großen Städte prekär und<br />
durch große Distanzen und schlechte Erreichbarkeit<br />
geprägt. Es gibt kaum ganzjährig befahrbare Straßen,<br />
meist bestehen nur Zugangsmöglichkeiten über den<br />
Wasserweg. Das gilt auch für viele der entlegenen Gemeinden<br />
am Rio Tapajós in den Kommunen Santarém,<br />
Belterra und Aveiro im Westen des Bundesstaates Pará.<br />
Eine öffentliche Gesundheitsversorgung ist in diesen<br />
durchweg bescheidenen Flussgemeinden bisher lediglich<br />
ansatzweise vorhanden; es gibt nur einige, meist rudimentär<br />
ausgestattete Gesundheitsposten. Und das<br />
nächstgelegene Hospital kann eine ein- oder mehrtägige<br />
Schiffsreise weit entfernt sein, für die zudem auch die<br />
Kosten aufgebracht werden müssen.<br />
Zwar ist in der brasilianischen Verfassung für alle Bürgerinnen<br />
und Bürger ein Recht auf eine öffentliche Gesundheitsfürsorge<br />
verbrieft, in der Praxis und vor allem<br />
in Amazonien konnte dieser Anspruch allerdings bisher<br />
bei weitem noch nicht eingelöst werden.<br />
Angesichts dieser Situation initiierte das Projeto Saúde e<br />
Alegria (PSA) in Santarém bereits vor über 20 Jahren ihr<br />
damaliges Pilotprojekt. Die Gründer der Organisation,<br />
der Arzt Eugênio Scannavino und sein Bruder Caetano<br />
Scannavino, begannen mit einem kleineren Schiff und<br />
einem schmalen Etat eine regelmäßige medizinische<br />
Versorgung in zunächst nur 16 Gemeinden.<br />
2006 dann konnten die Initiatoren die Organisation<br />
terre des hommes aus den Niederlanden als Stifter für ein<br />
professionelles Hospitalschiff sowie auch Finanzier für<br />
die kompletten laufenden Kosten, darunter die Hälfte<br />
der Personalkosten, gewinnen. PSA bewerkstelligt den<br />
Betrieb des Schiffes. Die Kommunen Santarém, Belterra<br />
und Aveiro, in deren Gebiet die versorgten Gemeinden<br />
liegen, entsenden jeweils für die Fahrten die andere<br />
Hälfte des gemischten Teams von Ärzten, Krankenpflegern,<br />
Pharmazeuten und Bordcrew.<br />
Seit Oktober 2006 besucht die mobile Versorgungsstation<br />
im Laufe des Jahres im Regelfall jeweils acht Mal<br />
die 73 Gemeinden an den Flussufern des Tapajós. Auf<br />
diese Weise erreicht das Schiff um die 2.780 Familien<br />
oder rund 15.000 Gemeindemitglieder, jährlich werden<br />
um die 25.000 Behandlungen (einschließlich Zahnbehandlungen)<br />
durchgeführt.<br />
Für akute oder schwerere Fälle, die eine<br />
stationäre Aufnahme erforderlich machen,<br />
gibt es noch die sogenannte Ambulancha,<br />
ein kompaktes Schnellboot für den Transport<br />
direkt zum nächsten Krankenhaus.<br />
Das Hospitalschiff hat das Boot für solche<br />
Fälle im Schlepptau oder ruft es über Funk<br />
herbei.<br />
Das Recht auf Gesundheitsversorgung<br />
ist gesetzlich definiert<br />
„Die ,Abaré‘ garantiert, dass die öffentliche<br />
Gesundheitsversorgung auch die Gemeinden<br />
Amazoniens erreicht, die bisher von<br />
diesem im Gesetz festgeschriebenen Recht<br />
ausgeschlossen waren“, beschreibt der Arzt<br />
Fábio Tozzi, Koordinator für die Abteilung<br />
Gesundheit bei PSA, die Wirkung des Hospitalschiffes.<br />
Mit diesem Modellprojekt will die NRO ein<br />
multiplizierbares Beispiel für die Gesundheitsversorgung<br />
durch die öffentliche Hand schaffen.<br />
Ein Bundesgesetz von 1990 definiert, basierend auf der<br />
brasilianischen Verfassung, das Sistema Único de Saúde<br />
(SUS), etwa das „Einheitsgesundheitssystem“, in dem<br />
die öffentliche Gesundheitsversorgung als ein Recht<br />
aller Bürgerinnen und Bürger und als Pflicht des Staates<br />
festgeschrieben ist. In der Statistik hat sich seitdem die<br />
Gesundheitssituation der Bevölkerung zwar insgesamt<br />
verbessert, aber regional in ganz unterschiedlichem<br />
Maße.<br />
Auch ein Zahnarzt ist an Bord.<br />
© Projeto Saúde e Alegria<br />
Sprechstunde beim Arzt<br />
auf dem Schiff.<br />
© Alexander Riesen<br />
34 35
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
In einem Land mit kontinentalen<br />
Ausmaßen wie<br />
Brasilien bestehen große<br />
räumliche Ungleichheiten<br />
zwischen dem pulsierenden,<br />
dichter besiedelten Süden<br />
und Südosten, dem traditionellen<br />
Kernraum des<br />
Landes, und dem peripheren<br />
Norden. Allein die<br />
verstreute Verteilung der<br />
Bevölkerung in den riesigen<br />
Kommunen der Flächenstaaten<br />
Amazoniens macht<br />
die Überwindung großer<br />
Das Reservoir für ein Wasserversorgungssystem Distanzen notwendig und<br />
wird installiert.<br />
führt zu fundamental anderen<br />
Bedingungen und Realitäten.<br />
Noch fehlt ein angepasster Einsatz der staatlichen<br />
Mittel für eine verbesserte Basisversorgung innerhalb<br />
des Gesundheitssystems auf der kommunalen Ebene,<br />
die die gesamte Bevölkerung erreicht. Innerhalb des<br />
föderalistischen Systems in Brasilien kommt dabei den<br />
Kommunen eine zentrale Rolle zu.<br />
Ein Schiff allein löst nicht alle Probleme<br />
© Projeto Saúde e Alegria<br />
Das Hospitalschiff „Abaré“ ist Teil der Gesamtstrategie<br />
von PSA, die in einem integrierten Ansatz partizipative<br />
Prozesse der ganzheitlichen und nachhaltigen Gemeindeentwicklung<br />
fördert. Die Bewohner werden nicht nur<br />
passiv versorgt, sondern übernehmen auch aktiv bei<br />
flankierenden Aktivitäten Verantwortlichkeiten in ihrer<br />
Gemeinde. So wurden für den Zugang zu sauberem<br />
Wasser zusammen mit den Bewohnern lokale Wasserversorgungssysteme<br />
(microsistemas) geplant und gebaut,<br />
die von den Gemeinden selbst instand gehalten werden.<br />
Im wasserreichen Amazonien klingt es paradox, aber der<br />
Zugang zu sauberem Wasser bleibt in vielen Gemeinden<br />
immer noch ein großes Problem, verunreinigtes Wasser<br />
verursacht viele Krankheiten und auch Todesfälle, allerdings<br />
heute schon weniger als in der Vergangenheit.<br />
Ein weiteres Element der Strategie des PSA ist die didaktisch<br />
geschickte Wissensvermittlung zum Thema<br />
Gesundheit. Mit kurzen Zirkusaufführungen oder Sketchen<br />
veranschaulichen zur NRO gehörende Gaukler<br />
pantomimisch auf heitere und spielerische Weise zum<br />
Beispiel den Zusammenhang zwischen dem Konsum<br />
verunreinigten Wassers und daraus resultierenden<br />
Durchfallerkrankungen oder geben kleine einprägsame<br />
Songs zum Besten, in denen es um die tägliche persönliche<br />
Hygiene geht. Das bleibt in den Köpfen hängen,<br />
nicht nur bei den Erwachsenen, sondern vor allem auch<br />
bei den Kindern und Jugendlichen.<br />
Das Projekt kann Studien zufolge als Erfolg bezeichnet<br />
werden. Indikatoren wie Kindersterblichkeit oder die<br />
durchschnittlich gesunkene Zahl der Durchfallerkrankungen<br />
bei Kindern belegen bereits spürbare Verbesserungen<br />
der Gesundheitssituation im Einzugsgebiet des<br />
Schiffes. Die Impfquote für Kinder bis zwei Jahre liegt<br />
bei 90 Prozent. Die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal<br />
für die Gesundheitsposten und Hebammen<br />
bleibt aber weiterhin wichtig.<br />
Mittelfristig möchte PSA den Betrieb des Schiffes von<br />
Spendengeldern unabhängig machen. In Zusammenarbeit<br />
mit den Kommunen wurde schon ein „Plan für<br />
Nachhaltigkeit“ entworfen, um die Versorgung durch<br />
eine mobile Einheit als Politik der öffentlichen Hand<br />
zu garantieren und langfristig zu verankern. Die Finanzierungsmodalitäten<br />
beziehungsweise der entsprechende<br />
kommunale Mitteleinsatz ist in den bestehenden<br />
Kontroll- und Partizipationsgremien für<br />
die Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel den kommunalen<br />
Gesundheitsbeiräten, weiter auszuhandeln und zu organisieren.<br />
Die Vision für die Zukunft bleibt die Anpassung der<br />
öffentlichen Gesundheitsversorgung an die Bedingungen<br />
Amazoniens und damit die Ausweitung des Modellprojektes<br />
auch auf ganz Amazonien. Dazu erhofft sich<br />
die NRO den Einsatz von vielen „Abarés“ auf den<br />
Flüssen Amazoniens. So soll das verbürgte Anrecht<br />
der Bürgerinnen und Bürger auf eine öffentliche Gesundheitsversorgung<br />
eingelöst werden und die gesamte<br />
Bevölkerung in das Gesundheitssystem (SUS) auf der<br />
kommunalen Ebene eingeschlossen werden.<br />
Alexander Riesen<br />
Alexander Riesen ist Diplomgeograph und seit 2005<br />
Entwicklungshelfer des DED in Brasilien. Er arbeitet<br />
in der Abteilung für Geodatenmanagement und<br />
unterstützt den Gesundheitssektor von PSA mit der<br />
Erstellung von thematischen oder noch nicht vorhandenen<br />
Karten.
Indien<br />
Vom Alltagskampf<br />
der armen<br />
Stadtbevölkerung<br />
um Gesundheit<br />
Trinkwassermangel, Abwasserprobleme<br />
und die gesundheitlichen Folgen<br />
Slumbewohner sind besonders wasserbezogenen Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Hier eine Wasserstelle in einem Slum von Chennai.<br />
Wie wichtig sauberes Wasser für die Gesundheit des Menschen ist, ist bekannt. Doch die besorgniserregende Realität ist,<br />
Von ihrer Operation wegen starker Unterleibsblutungen,<br />
die fast ihr Leben gekostet hätte,<br />
hat sich Selvi, die 45-jährige Slumbewohnerin<br />
aus Chennai, nicht mehr erholt. Sie fühlt sich krank und<br />
eigentlich zu schwach zum Arbeiten. Trotzdem steht Selvi<br />
jeden Morgen um vier Uhr auf und bereitet Idlis und<br />
Sambar (gedünstete Reismehlklöße mit einer scharfen<br />
Gemüsesuppe), das lokale Frühstücksgericht, für den<br />
Verkauf vor. Denn nachdem ihr Ehemann nach jahrelangem<br />
exzessivem Alkoholkonsum an einer Leberzirrhose<br />
starb, war sie plötzlich alleine für die Versorgung ihrer<br />
sieben Kinder verantwortlich. Mit der kleinen Garküche<br />
verdient sie gerade soviel, dass es für das tägliche Überleben<br />
reicht. Den Arzt sucht sie daher auch nur in<br />
äußersten Notfällen auf. Für die privaten Ärzte fehlt ihr<br />
das Geld und für die öffentlichen Einrichtungen die Zeit.<br />
Selvi ist eine unter Millionen von Menschen in Indiens<br />
Städten, die täglich um das bloße Überleben kämpfen.<br />
Der rapide Urbanisierungsprozess der letzten 50 Jahre<br />
– die Anzahl der Stadtbewohner hat sich in diesem Zeitraum<br />
auf 338 Millionen mehr als verfünffacht – wird<br />
begleitet von einer Urbanisierung der Armut. Gerade in<br />
den sich dynamisch entwickelnden Millionen- und Megastädten<br />
Indiens, wie Delhi oder Chennai, manifestiert<br />
sich Armut physisch und räumlich in der steigenden<br />
Zahl von Slumsiedlungen. Schätzungen der Vereinten<br />
Nationen zu Folge lebt etwa die Hälfte der Stadtbevölkerung<br />
Indiens in Slums.<br />
Urbane Gesundheitsrisiken<br />
Das rapide und zum Teil unkontrollierte Wachstum der<br />
Millionen- und Megastädte Indiens führt bereits heute zu<br />
krisenhaften Überlastungen der städtischen Kapazitäten,<br />
was sich negativ auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung<br />
auswirkt. So sind insbesondere die Armutsgruppen<br />
in den Städten mit gravierenden ökologischen Problemen<br />
wie der Gewässer- und Luftverschmutzung, sowie<br />
unkontrollierter Abwasser- und Abfallentsorgung<br />
konfrontiert. Sie sind zudem häufig auch vom Zugang zu<br />
grundlegender städtischer Infrastruktur (zum Beispiel zu<br />
sauberem Trinkwasser) und Dienstleistungen (zum Beispiel<br />
zu einer bezahlbaren und guten Gesundheitsversorgung)<br />
ausgeschlossen. Diese Problematik lässt sich am<br />
Beispiel Wasser exemplarisch verdeutlichen. Es wird geschätzt,<br />
dass etwa 80 Prozent der Krankheiten weltweit<br />
wasserbezogen sind. Dies gilt vor allem für Entwicklungsländer.<br />
Die mangelnde Versorgung mit Wasser und das<br />
Fehlen einer Abwasserinfrastruktur exponieren die Men-<br />
36 37<br />
© Patrick Sakdapolrak<br />
dass immer noch 80 Prozent der Krankheiten weltweit wasserbezogen sind. Dies hat vor allem in den Megastädten dieser Welt<br />
verheerende Auswirkungen für die armen Bevölkerungsgruppen. Der Autor berichtet darüber am Beispiel der indischen Städte<br />
Delhi und Chennai.
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
© Patrick Sakdapolrak<br />
schen gegenüber zahlreichen Krankheiten<br />
wie Diarrhö, Guineawurmkrankheit<br />
oder Typhus.<br />
Es wird geschätzt, dass vier Fünftel<br />
von Delhis Haushaltsabwässern (rund<br />
drei Milliarden Liter) ungeklärt bleiben.<br />
Unter dem Abwasserproblem leidet<br />
die Slumbevölkerung besonders.<br />
Ihre Siedlungen sind in der Regel<br />
nicht an das öffentliche Abwassersystem<br />
angeschlossen. Daraus resultiert<br />
Gesundheitsrisiken ergeben sich auch das Problem der Akkumulation von<br />
aus der fehlenden Abwasserinfrastruktur. Fäkalien im öffentlichen Raum. Die<br />
Slumsiedlungen befinden sich zudem<br />
häufig an Wasserwegen, die ungeklärte<br />
Abwässer von wohlhabenderen Wohnsiedlungen führen.<br />
Während Angehörige der städtischen Mittelschicht,<br />
die an das öffentliche Wasserleitungsnetz angeschlossen<br />
sind, bis zu 300 Liter am Tag pro Person beziehen können,<br />
müssen sich die Slumbewohner mit durchschnittlich<br />
16 Litern am Tag begnügen, wenn sie über Tanklastwagen<br />
versorgt werden. Offiziell ist dieses Wasser<br />
zwar kostenlos, doch müssen die Slumbewohner inoffizielle<br />
Zahlungen leisten. So kommt es dazu, dass die Armen<br />
im Durchschnitt 60 Rupien im Monat (etwa einen<br />
Euro) bezahlen, während die Reicheren nur ungefähr<br />
50 Rupien aufwenden müssen. Bezieht man diese Preise<br />
auf die Wassermengen, so bezahlen die wohlhabenden<br />
Stadtbewohner letztlich nur rund 5 bis 6 Rupien für<br />
einen Kubikmeter Wasser, während die Armen für die<br />
gleiche Menge etwa 125 Rupien aufwenden müssen.<br />
Krankheitslast trifft die Armen<br />
Der Gesundheitsstatus der städtischen Bevölkerung ist<br />
insgesamt besser als derjenige der ländlichen Bevölkerung.<br />
Differenziert man jedoch die Stadtbevölkerung<br />
nach sozio-ökonomischen Gruppen, so wird deutlich,<br />
dass der Gesundheitsstatus urbaner Armutsgruppen erheblich<br />
schlechter ist als der der restlichen städtischen<br />
Bevölkerung: Während die Kindersterblichkeit für die<br />
städtische Bevölkerung im Durchschnitt bei 41,7 pro<br />
1.000 Lebendgeburten liegt, beträgt sie für urbane Armutsgruppen<br />
54,6. Wie eine Studie der Weltbank feststellt,<br />
ist die arme Bevölkerung nicht nur verwundbarer<br />
gegenüber übertragbaren, wasserbezogenen Krankheiten<br />
und Problemen reproduktiver Gesundheit, sie konsumiert<br />
darüber hinaus auch häufiger Tabak und Alkohol<br />
und ist somit einem höheren Risiko ausgesetzt.<br />
Eine Studie des Arbeitsbereichs Geographische Entwicklungsforschung<br />
der Universität Bonn unter der Leitung<br />
von Hans-Georg Bohle, die den Gesundheitsstatus von<br />
220 Haushalten in zwei Slumsiedlungen Chennais über<br />
den Zeitraum von 15 Wochen überwacht hat, zeigt auf,<br />
dass sich die ungleiche Verteilung der Krankheitslast auch<br />
innerhalb der Armutsgruppen fortsetzt. Die ärmsten<br />
Haushalte weisen demnach eine deutlich höhere Sterberate<br />
auf als die im Vergleich bessergestellten Haushalte.<br />
Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen ferner, dass auch<br />
die Armen kostenpflichtige private Gesundheitsdienstleistungen<br />
in Anspruch nehmen, obwohl in Indien eine kostenfreie<br />
öffentliche Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen<br />
besteht. Die schwach mit Ressourcen ausgestatteten<br />
öffentlichen Einrichtungen – der öffentliche Anteil<br />
der Gesundheitsausgaben Indiens ist einer der niedrigsten<br />
weltweit – werden wegen der langen Wartezeiten und geringen<br />
Qualität gerade bei weniger gravierenden Krankheiten<br />
auch von armen Haushalten gemieden. Nur bei<br />
gravierenden Problemen lassen sie sich in den öffentlichen<br />
Kliniken behandeln. Der Zwang, Privatpraxen zur Behandlung<br />
von Krankheiten aufzusuchen, bedeutet für die<br />
Armutsgruppen natürlich eine erhebliche finanzielle Belastung.<br />
Die Befragung hat ergeben, dass die Bewohner<br />
im Durchschnitt mehr als zehn Prozent ihres monatlichen<br />
Haushaltseinkommens zur Deckung der Krankheitskosten<br />
ausgeben. Dieser Anteil liegt für den ärmeren Teil der<br />
Slumbewohner mit 24 Prozent sogar noch weit höher.<br />
Ein Anteil von Gesundheitsausgaben am Gesamteinkommen<br />
von zehn Prozent wird von vielen Experten schon als<br />
katastrophal eingestuft, da dann Einschnitte vor allem bei<br />
der Nahrungsversorgung gemacht werden müssen.<br />
Der Themenkomplex urbane Gesundheit wird im Zuge<br />
des fortschreitenden Urbanisierungsprozesses in den<br />
kommenden Jahren an Bedeutung hinzugewinnen. Im<br />
Fokus muss dabei vor allem die Lage der wachsenden<br />
Zahl urbaner Armutsgruppen liegen. Eine ganzheitliche<br />
gesundheitspolitische Intervention darf ihren Schwerpunkt<br />
nicht nur auf die Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen<br />
und die Frage der Krankheitskosten legen.<br />
Sie muss ebenso stark die Schaffung einer gesunden<br />
Arbeits- und Lebenswelt für alle Menschen unabhängig<br />
von ihrem sozialen Status forcieren.<br />
Patrick Sakdapolrak<br />
Patrick Sakdapolrak ist Geograph und promoviert an der<br />
Universität Bonn zum Thema gesundheitsbezogene Verwundbarkeit<br />
urbaner Armutsgruppen in Indien.
Vietnam<br />
Vertrauen in die überlieferte Heilkunst<br />
Zum Verhältnis von traditioneller und westlicher Medizin<br />
Seit Jahrhunderten wird in Vietnam<br />
traditionelle Medizin praktiziert. Sie ist neben<br />
der modernen Medizin fest etabliert und genießt<br />
bei der Bevölkerung nicht nur hohes Ansehen,<br />
sondern wird auch rege in Anspruch genommen.<br />
Die traditionelle Medizin macht heute dank<br />
staatlicher Förderung ungefähr ein Drittel der<br />
gesamten medizinischen Versorgung des Landes aus.<br />
Die überlieferte Medizin in Vietnam besteht aus<br />
der Südmedizin (Thuoc Nam), der eigentlich<br />
vietnamesischen Medizin, und der Nordmedizin<br />
(Thuc Bac), der traditionellen chinesischen Medizin.<br />
Beide Medizintraditionen werden unter Dong Y (östlicher<br />
Medizin) zusammengefasst und komplementär<br />
angewandt. Thuoc Nam baut auf das chinesische Yin<br />
und Yang-Prinzip auf und verfolgt einen holistischen<br />
Ansatz. Wie in allen asiatischen Medizintraditionen<br />
wird der Mensch als eine unzertrennliche Einheit von<br />
Körper und Seele betrachtet. Bei einer Erkrankung gilt<br />
es, das harmonische Gleichgewicht der Lebensenergien,<br />
khi, wieder herzustellen.<br />
Es gibt Prioritäten bei der Inanspruchnahme beider<br />
Traditionen. „Ich habe großes Vertrauen zu vietnamesischen<br />
Ärzten. Wenn ich Beschwerden habe, die im Körperinnern<br />
sind, dann suche ich einen Doktor auf, der<br />
vietnamesische Medizin verabreicht. Die macht den<br />
Körper kühl. Die chinesische Medizin ist für allgemeine<br />
Krankheiten gut“, informiert mich Frau Thu.<br />
Es gibt keine Familie in Vietnam, die keinen traditionellen<br />
Arzt oder Heiler kennt. Doch es sind besonders Menschen<br />
mittleren Alters und Ältere, die traditionelle Praktiker<br />
aufsuchen. „Die jungen Leute haben keine Zeit für<br />
langwierige Behandlungen. Sie wollen ganz schnell gesund<br />
werden, aber die Behandlung mit traditionellen<br />
Kräutern braucht Geduld. Der Kundenstamm, der zu<br />
uns kommt, fängt erst mit der Altersgruppe ab 30 Jahren<br />
an“, klagt Herr Ngoc, der traditionelle Arznei verkauft.<br />
Ebenso wenig gibt es Vietnamesen, die nicht ergänzend<br />
westlich ausgebildete Ärzte konsultieren. Bei akuten Erkrankungen,<br />
wie Atemnot oder Fieber, ist das moderne<br />
Krankenhaus die erste Anlaufstelle. Steht die Diagnose<br />
fest, wechseln die Patienten häufig zu einem traditionel-<br />
© Joyce Dreezens-Fuhrke<br />
Heilkräuterladen in der Pho Lan Ong-Straße in Hanoi.<br />
len Heilkundigen (Luong Y) und lassen sich auf eine lang<br />
andauernde Behandlung ein. Der Luong Y wird auch zu<br />
Rate gezogen, wenn der Schulmediziner versagt. Bei<br />
nicht eindeutigen Symptomen und chronischen Erkrankungen<br />
wird der Heiler als erste Wahl bevorzugt. Dies ist<br />
auch der Fall, wenn es darum geht, den Körper wieder<br />
aufzubauen oder das Immunsystem zu stärken, etwa<br />
nach einer Geburt oder nach einer schweren Krankheit.<br />
Gegenüber allopathischer Medizin (Schulmedizin) ist<br />
Skepsis verbreitet. „Normalerweise nehme ich nur traditionelle<br />
Medizin. Die westlichen Medikamente nehme<br />
ich höchstens einen Tag. Wenn es mir wieder gut geht,<br />
höre ich mit der Einnahme sofort auf, da ich Angst vor<br />
Nebenwirkungen habe“, vertraut mir Frau Thu an. Den<br />
Heilkräutern werden im Allgemeinen keine negativen<br />
Nebenwirkungen zugeschrieben.<br />
Traditionelle Behandlungen sind billiger<br />
Das tiefe und langjährige Vertrauen zum Doktor ist ein<br />
wichtiger Aspekt. Seit über 20 Jahren lassen sich Frau<br />
Nguyet und ihre Familie bereits von dem über neunzigjährigen<br />
Arzt Thien Tich und dem über achtzigjährigen<br />
Arzt Nguyen Thien Quyen behandeln, die ihre Ausbildung<br />
in China und in Hongkong absolviert haben.<br />
Eine entscheidende Rolle bei der Heilerwahl spielen die<br />
im Vergleich zur modernen Medizin niedrigen Behandlungskosten<br />
zwischen 60.000 und 200.000 Dong (25.000<br />
38 39
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
Auch Schlangen<br />
sind als Heilmittel<br />
© Ute Cremer<br />
im Angebot.<br />
Dong entsprechen 1 Euro), oft inklusive der Medikamente.<br />
Diese werden häufig von den Heilern selbst zubereitet.<br />
Dagegen können die in Vietnam hoch entwickelten<br />
Therapiemethoden wie Akupunktur, Akupressur und<br />
Massagen, die zunehmend auch von Ausländern aus dem<br />
Westen nachgefragt werden, durchaus teuer sein.<br />
Wie hoch der Bedarf nach traditionellen Mitteln ist, wird<br />
in Hanoi an den zahlreichen Läden in der Pho Lan Ong-<br />
Straße deutlich, benannt nach dem bedeutenden Heilkundler<br />
Hai Thuong Lan Ong. Ein großer Teil der aus<br />
Kräutern und Tierprodukten bestehenden Heilmittel<br />
stammt aus China. Das Angebotsspektrum ist riesig und<br />
reicht von der offiziell verbotenen, in Schnaps eingelegten<br />
Bärengalle über Tigerpfoten zu gigantischen Pilzen.<br />
Ob es sich immer um echte Ware handelt, ist fraglich.<br />
Der Staat ist um Kontrolle bemüht und deckt hin und<br />
wieder Medikamentenfälschungen auf. Auf traditionelle<br />
Arzneien spezialisierte Apotheken, die von den jeweiligen<br />
Ärzten empfohlen werden, sind vertrauenswürdig.<br />
Unter den Akteuren der traditionellen Medizin hüten<br />
Heiler ohne offizielle medizinische Ausbildung das von<br />
ihren Vorfahren überlieferte Wissen oftmals wie ein Familiengeheimnis.<br />
Diesem informellen Sektor sind auch<br />
Wahrsager zuzurechen, von denen viele Vietnamesen den<br />
günstigsten Zeitpunkt für eine Hochzeit, Schwangerschaft,<br />
Geburt oder Reise erfahren wollen. Demgegenüber<br />
wurden mehr als 3.710 private Anbieter der traditionellen<br />
Heilkunde vom Gesundheitsministerium lizenziert,<br />
denn Vietnams Verfassung schützt und fördert sie.<br />
Das Motto lautet Komplementarität<br />
Vor diesem Hintergrund ist zu betonen, dass der Studiengang<br />
Traditionelle Medizin an vielen medizinischen<br />
Colleges etabliert ist. Bemerkenswerte 50 Prozent der<br />
Ärzte, die traditionelle Medizin praktizieren, haben den<br />
Abschluss eines Medical Colleges. Ungefähr 19 Prozent<br />
arbeiten in einem Public Health Center, während der<br />
größte Teil im privaten Sektor tätig ist.<br />
Im berühmten National Institute of Traditional Medicine<br />
in Hanoi sind alle Ärzte in allopathischer Medizin ausgebildet<br />
und besitzen eine Zusatzausbildung in traditioneller<br />
Medizin. Das Krankenhaus bietet eine ausgezeichnete<br />
medizinische Grundversorgung und wurde<br />
1988 von der World Health Organisation als Lehrkrankenhaus<br />
für traditionelle Medizin akkreditiert.<br />
Neben dem Stadtkrankenhaus hat jedes Stadtviertel in<br />
Hanoi eine traditionelle Gesundheitsstation aufzuweisen.<br />
Die Gesundheitsleistungen in den staatlich registrierten<br />
Einrichtungen für traditionelle Medizin werden<br />
von der Krankenversicherung gedeckt.<br />
In den Provinzen ist die traditionelle Medizin gesellschaftlich<br />
und gesundheitspolitisch noch stärker verankert.<br />
Fast jedes Provinzkrankenhaus besitzt komplementär<br />
zu den schulmedizinischen Stationen eine Abteilung<br />
für traditionelle Medizin und einen Garten für Heilkräuter.<br />
Die Anwendung beider Medizintraditionen ist<br />
hier selbstverständlich. „Für die Diagnose benutzen wir<br />
die modernen Geräte, aber die Therapie erfolgt häufig<br />
in der kostengünstigeren traditionellen Abteilung“, berichtet<br />
Dr. Nguyen Tu Anh aus der Provinz Phu Yen.<br />
Überlieferte Krankheits- und Gesundheitsvorstellungen<br />
spielen zusammen mit den traditionellen Diagnose- und<br />
Therapieverfahren insbesondere im dezentralen Gesundheitssystem<br />
eine bedeutende Rolle und stellen eine<br />
wichtige Komponente des vietnamesischen Gesundheitssystems<br />
dar. Diese Tatsache sollten die an westlicher<br />
Medizin orientierten Entwicklungsprojekte zur Verbesserung<br />
der dezentralen Gesundheitsversorgung stärker<br />
berücksichtigen.<br />
Dr. Joyce Dreezens-Fuhrke<br />
Dr. Joyce Dreezens-Fuhrke ist Medizinethnologin<br />
und seit 2007 in Vietnam Koordinatorin des DED<br />
für den Bereich Gesundheit/Behinderung.
Haiti<br />
Zum Arzt oder zum Voodoopriester?<br />
Eine Zusammenarbeit mit Voodooisten würde die Gesundheitssituation im Lande verbessern<br />
Voodoo ist, neben der katholischen und<br />
protestantischen Kirche, die Volksreligion Haitis<br />
und spielt eine wesentliche Rolle<br />
bei der Vorbeugung und Heilung von Krankheiten.<br />
Leider sind vor allem Voodooisten<br />
wegen Diskriminierung und der mangelnden<br />
Zusammenarbeit zwischen Voodoopriestern,<br />
Heilern, Ärzten, Pastoren und Vertretern<br />
von Nichtregierungsorganisationen extrem anfällig<br />
für Krankheiten wie AIDS, Tuberkulose oder Malaria.<br />
Die Autorin plädiert dafür, den Voodoo<br />
in die Gesundheitsversorgung und besonders<br />
in die HIV/AIDS-Aufklärungsarbeit einzubeziehen.<br />
Ich dachte, ich hätte einen ‚Mò SIDA‘ und bin nicht<br />
ins Krankenhaus gegangen. Wenn ich den HIV-Test<br />
früher gemacht hätte, hätte ich nicht so schnell AIDS<br />
entwickelt. Kaum hatte ich die ersten Medikamente genommen,<br />
ging’s mir gleich besser. Davor hatte ich soviel<br />
Geld in die mystische Behandlung gesteckt. Ich sollte neun<br />
Tage lang jeden Tag sieben Tassen Tee trinken, die Blätter<br />
hier- und dorthin werfen. Danach hatte ich Durchfall“,<br />
berichtet der HIV-Positive Liony Accelus. So wie Liony<br />
geht es vielen Haitianern. Denn die meisten glauben<br />
eher an mystische Ursachen von Krankheiten als an die<br />
moderne Medizinwissenschaft.<br />
Die etwa achteinhalb Millionen Einwohner des Karibikstaates<br />
Haiti sind größtenteils afrikanischer Abstammung.<br />
Mit ihren Vorfahren, die vom 16. bis zum 18. Jahrhundert<br />
als Sklaven nach Haiti gebracht wurden, kam auch der<br />
Voodoo. Heute gehört zwar die Mehrheit der Bevölkerung<br />
den christlichen Kirchen an, glaubt aber gleichzeitig an<br />
den Voodoo. Im Voodoo gibt es neben dem obersten Gott<br />
Bondye mehrere hundert Loas (Geister, Götter), zu denen<br />
Hougans (Voodoopriester) und Mambos (Voodoopriesterinnen)<br />
Kontakt aufnehmen können.<br />
Haiti ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Die<br />
Gesundheitssituation ist schlecht: Acht Prozent der Kinder<br />
sterben vor ihrem fünften Lebensjahr. Die HIV-Rate beträgt<br />
landesweit 2,2 Prozent und ist unter Voodooisten mit<br />
zehn Prozent auffällig hoch.<br />
© Marielle Zöllner<br />
Voodoo-Heiler auf einem Volks- und Voodoofest.<br />
„Einer der Gründe, warum Voodooisten besonders gefährdet<br />
sind, ist, dass sie viel Alkohol trinken. Von den 200<br />
Menschen im Peristil (Tempel) sind 150 betrunken; sie gehen<br />
nach Hause und haben Sex ohne Kondom. Mancher<br />
hat zehn Frauen. Wenn er krank ist, sind gleich alle zehn<br />
gefährdet. Unsere Religion erlaubt Homosexualität, vernachlässigt<br />
aber über HIV/AIDS zu sprechen“, beschreibt<br />
die Voodoopriesterin Mirlène Johannis die Situation.<br />
Natürliche und mystische Krankheiten<br />
40 41<br />
Im haitianischen Verständnis gibt es natürliche und mystische<br />
Erkrankungen. Natürliche Erkrankungen<br />
gehen häufig auf Infektionen zurück (etwa<br />
HIV, Malaria, Durchfallerkrankungen). Viele<br />
Voodooisten schwören auf die Vorbeugung<br />
mit Kräutern. Mystische Erkrankungen entstehen,<br />
wenn der Betroffene sein spirituelles<br />
Gleichgewicht verliert und von einem<br />
Mò SIDA = Schlechter Geist,<br />
schlechten Geist besessen ist.<br />
der etwa AIDS hervorruft<br />
„Wenn der Geist ein Problem hat, spiegelt<br />
sich das in einem Problem des Körpers wider.<br />
Wenn etwa eine Frau immer von ihrem Mann<br />
geschlagen wird, ist sie ständig nervös, und es<br />
ist nicht verwunderlich, dass sie zum Beispiel<br />
Nierensteine oder Metastasen bekommt. Ihr<br />
Körper kommt in Unordnung. Wenn man<br />
dagegen in Harmonie ist, hat man mehr Re-<br />
Bondye = Gott<br />
Loa = Geist, Gottheit<br />
Hougan = Voodoopriester<br />
Mambo = Voodoopriesterin<br />
Peristil = Voodootempel<br />
Zombie = Schlechter Geist<br />
eines Untoten<br />
Malfektè = Scharlatan<br />
<strong>Info</strong>
THEMA<br />
� Brief 3.2009<br />
© Marielle Zöllner<br />
© Marielle Zöllner<br />
© Marielle Zöllner<br />
Voodoozeremonie<br />
in Jacmel.<br />
Mirlène Johannis,<br />
Voodoopriesterin<br />
Max Beauvoir,<br />
Oberhaupt<br />
der Nationalen<br />
Voodookonföderation<br />
Smith E. A.,<br />
Voodookundiger<br />
© Marielle Zöllner<br />
sistenz“, sagt Max Beauvoir, Oberhaupt der Nationalen<br />
Voodookonföderation und fügt hinzu: „Ein wichtiges Element<br />
im Leben heißt Vergnügen. Jede Voodoozeremonie<br />
ist ein Vergnügen und sehr wichtig für die mentale Gesundheit<br />
der Menschen.“<br />
Zudem gibt es mystische Krankheiten, die einem von einer<br />
anderen Person geschickt werden können. Diese Schwarze<br />
Magie wird vor allem zur Verteidigung oder Selbstjustiz<br />
angewandt. „Man fabriziert ein Gift oder schickt einen<br />
Zombie und der Betroffene stirbt oder sein Fuß schwillt<br />
an oder sein Geschäft geht Bankrott“, fürchtet Ulrick, ein<br />
Protestant. Einem Menschen allerdings, der sich nichts<br />
zu Schulden kommen lässt oder nicht an Schwarze Magie<br />
glaubt, kann kein Zombie geschickt werden. „Im Gegenteil,<br />
der schlechte Geist hat sogar Angst vor ihm“, beruhigt<br />
der Voodookundige Smith E. A.<br />
Behandlung von Krankheiten<br />
Im Falle einer Erkrankung suchen die meisten zuerst einen<br />
Hougan auf. Wenn man Glück hat und zu einem „sehenden“<br />
Hougan geht, kann dieser mit Hilfe von Karten,<br />
Knochen oder Kerzen feststellen, ob es sich um eine<br />
natürliche oder mystische Krankheit handelt. Wenn es<br />
eine mystische Krankheit ist, „vertreibt er den schlechten<br />
Geist, behandelt die Symptome, wäscht den Betroffenen<br />
und kocht ihm einen Kräutertee“, erklärt Smith E. A.<br />
Wenn es sich um eine natürliche Erkrankung handelt,<br />
behandelt er den Betroffenen mit Medikamenten oder<br />
schickt ihn zum Arzt.<br />
Wenn man allerdings Pech hat, kann man an einen „nichtsehenden“<br />
Hougan geraten, der unfähig ist, Krankheiten<br />
zu erkennen oder zu behandeln. Unter der Behandlung<br />
sterben sogar viele Menschen. Doch Scharlatane gibt es<br />
nicht nur unter Hougans, sondern auch unter Pastoren.<br />
„In meiner Voodoogemeinschaft gab es einen HIV-Positiven.<br />
Ich schickte ihn zu einer Organisation. Dort sagte<br />
eine Krankenschwester zu ihm, wenn er Protestant wäre,<br />
wäre er nicht krank. Er konvertierte. Man gab ihm Medikamente,<br />
die ihn auf wunderbare und göttliche Weise<br />
heilen sollten. Die Krankheit wurde immer schlimmer<br />
und schließlich kam er zurück zum Voodoo“, erzählt mir<br />
Mirlène Johannis. „Man sagt immer, so etwas passiert nur<br />
beim Voodoo, aber in Wirklichkeit ist es die ganze Gesellschaft,<br />
die an magische Heilung glaubt. Hougans nennen<br />
es mystisch, Pastoren nennen es göttlich.“<br />
Zusammenarbeit statt Diskriminierung<br />
„Die größte Verwundbarkeit des Voodoo ist die Diskriminierung.<br />
Die Türen zum Wissen sind für Voodooisten geschlossen.<br />
Niemand traut sich in die Peristile zu gehen, um<br />
mit den Leuten zu sprechen. Doch auch der Voodoo selbst<br />
verschließt sich. Zwischen diesen beiden Welten besteht<br />
eine Kommunikationsbarriere“, sagt Mirlène Johannis.<br />
Es stellt sich die Frage, wie die internationale Zusammenarbeit<br />
diese Diskriminierung überwinden und Voodoogemeinschaften<br />
in ihre Programme integrieren kann.<br />
Da die Bevölkerung eher dem Hougan als dem Arzt glaubt,<br />
sollten Hougans selbst bei der Aufklärung ihrer Gemeinschaft,<br />
idealerweise vor Ort in den Peristilen, beteiligt sein.<br />
Zur <strong>Info</strong>rmationsverbreitung sollten die Strukturen der<br />
Nationalen Voodookonföderation genutzt werden, die in<br />
Kontakt zu 41 über das Land verteilten Voodooorganisationen<br />
und bis zu 40.000 Voodootempel steht.<br />
Auf diese Weise arbeitet seit 2003 die haitianische Organisation<br />
FOVIS (Foyer pour l’intégration sociale des vodouisantes<br />
et vodouisants). „Wir gehen in Peristile, laden<br />
Initiierte und Leute der Umgebung ein, machen Filmvorführungen,<br />
zeigen Fotos von sexuell übertragbaren<br />
Krankheiten wie Gonorrhöe oder HIV/AIDS. Viele der<br />
Teilnehmer sagen dann: ‚Oh, ich dachte, das sind mystische<br />
Krankheiten.‘ Wir sagen dann: ‚Nein, das sind natürliche<br />
Krankheiten und ihr müsst nicht daran sterben,<br />
wenn ihr zum Arzt geht‘“, berichtet Mirlène Johannis.<br />
Eine andere Organisation, PSI (Population Services International)<br />
ist seit 1989 in Haiti tätig und seit 2008 Partnerorganisation<br />
des DED. Sie führt auf Volks- und<br />
Voodoofesten im ganzen Land etwa mit mobilen Filmvorführungen<br />
(„Cinemobile“) Aufklärungsarbeit über<br />
Familienplanung, HIV- und Malariaprävention und<br />
Wasseraufbereitung durch.<br />
„Ich hoffe, dass die internationalen Zusammenarbeit ihre<br />
Verantwortung gegenüber dem Voodoo nicht vergisst“,<br />
sagt mir Mirlène Johannis am Ende unseres Gespräches.<br />
Mareile Zöllner<br />
Mareile Zöllner ist medizinische Geographin und arbeitet<br />
seit 2008 als Kommunikationsfachkraft des DED bei PSI<br />
(Population Services International) in Haiti.
� BLICKPUNKT Brief 3.2009 42 43<br />
Inland<br />
Global-Compact-Mitgliedschaft im DED leben<br />
k Seit 2005 ist der DED Mitglied im internationalen Netzwerk<br />
Global Compact (GC) und setzt sich ideenreich und engagiert in<br />
Zentrale und Außenstruktur für die Weiterentwicklung der Umsetzung<br />
der zehn GC-Prinzipien der Nachhaltigkeit ein.<br />
Die Idee eines Netzwerkes stammt von Kofi Annan, der 1999 während<br />
des Weltwirtschaftsforums in Davos die Wirtschaftsvertreter<br />
in aller Welt aufforderte, sich für den Aufbau sozialer und ökologischer<br />
Eckpfeiler zu engagieren. Seither sind dem Netzwerk<br />
mehr als 5.000 Unternehmen, Arbeitnehmer-, Menschenrechts-,<br />
Umwelt- und Entwicklungsorganisationen beigetreten.<br />
Im DED werden die Prinzipien des Global Compact (zum Beispiel<br />
in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz,<br />
Korruptionsbekämpfung) durch soziales und ökologisches Engagement<br />
bei den Geschäftsprozessen in der Zentrale in Bonn und<br />
in den Büros der Außenstruktur umgesetzt. Darüber hinaus unterstützt<br />
der DED in einigen Partnerländern den Auf- und Ausbau<br />
von Corporate Social Responsibility (CSR)-Netzwerken.<br />
Die Dokumentation bewährter Verhaltensweisen und guter Beispiele<br />
aus Zentrale und Außenstruktur ermöglicht, diese im DED<br />
zu verbreiten. Darüber hinaus wird das CSR-Engagement des DED<br />
über die internationale Plattform des Global-Compact der interessierten<br />
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der DED berichtet<br />
regelmäßig über sein Engagement, über Fortschritte und Entwicklungen.<br />
Der erste Fortschrittsbericht wurde 2007 veröffentlicht.<br />
Die Berichterstattung 2010 wird von der Global Compact-<br />
Begleitgruppe, die es seit Juni 2007 im DED gibt, bereits vorbereitet.<br />
Sie besteht aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aller Bereiche,<br />
die Ansprechpartner in ihren Arbeitseinheiten sind und<br />
Prozesse zur Umsetzung der GC-Prinzipien aktiv unterstützen.<br />
Jürgen Wilhelm<br />
bleibt Geschäftsführer des DED<br />
k Der Verwaltungsrat des DED verlängerte am 24. August 2009<br />
ohne Gegenstimme den Vertrag von Jürgen Wilhelm. Damit<br />
bleibt der DED-Geschäftsführer bis zum 31. Januar 2012 im Amt.<br />
Der promovierte Jurist leitet den DED bereits seit November 1998.<br />
Unter der Leitung von Jürgen Wilhelm baute der DED seine Kooperationen<br />
mit der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit<br />
stark aus und diversifizierte sein Leistungsangebot<br />
unter anderem über Sonderprogramme wie den<br />
„Zivilen Friedensdienst“ oder „weltwärts mit dem DED“.Während<br />
seiner bisherigen Amtszeit konnte die Zahl der Entwicklungshelferinnen<br />
und Entwicklungshelfer auf rund 1.100 und die Zahl<br />
der Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika, in denen der DED<br />
arbeitet, auf 47 erhöht werden.<br />
Red.<br />
So wurde Anfang 2009 ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, bei dem<br />
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der DED-Zentrale ihre Ideen zum Bereich<br />
„Arbeitsnormen“ einreichen konnten. Die Mitarbeiterschaft hat sich<br />
rege daran beteiligt. Einige Ideen, die sich auf die Verbesserung der Vereinbarkeit<br />
von Beruf und Familie beziehen, sind bereits in dieZielvereinbarung<br />
im Rahmen der Zertifizierung „berufundfamilie“ eingeflossen.<br />
Allgemeine <strong>Info</strong>rmationen zum Global Compact finden Sie unter:<br />
www.unglobalcompact.org und www.globalcompact.de.<br />
Annette Roth, Global Compact Begleitgruppe<br />
Ausland<br />
SÜDAFRIKA<br />
Kooperation<br />
mit Barloworld<br />
und lovelife<br />
© Marielle Zöllner<br />
Dr. Jürgen Wilhelm mit<br />
k Am 13. August unterzeich- Kahnyisile Kweyama (Barloworld)<br />
neten DED-Geschäftsführer und Grace Mathlape (lovelife)<br />
Dr. Jürgen Wilhelm, die Grup- bei der Unterzeichnung des Vertrages.<br />
penleiterin Personalwesen<br />
der südafrikanischen Industriegruppe Barloworld Kahnyisile<br />
Kweyama und die lovelife-Geschäftsführerin Grace Mathlape in<br />
Johannesburg einen Vertrag zur Unterstützung des neuen Programmes<br />
„Connected“ der Nichtregierungsorganisation lovelife<br />
(www.lovelife.org.za). Kern des lovelife-Ansatzes ist die einjährige<br />
Ausbildung von Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren, die so zu<br />
Vorbildern in Ihren Gemeinden werden sollen. Diese Initiative soll<br />
dazu beitragen, die HIV-Infektionsrate unter Jugendlichen zu reduzieren.<br />
lovelife wird mit einer Million Rand, rund 87.000 Euro, vom<br />
DED und Barloworld im Rahmen einer Private Public Partnership<br />
(PPP) gefördert.<br />
Lovelife will in den nächsten fünf Jahren 5.000 junge Menschen in<br />
unternehmerischen und sozialen Fähigkeiten schulen, um ihnen<br />
neue Zukunftsperspektiven aufzuzeigen und damit die Risikotoleranz<br />
für HIV-Infektionen zu reduzieren. „Connected“ will durch<br />
die Ausbildung sozialer Multiplikatoren eine große Zielgruppe<br />
erreichen und damit die Gesellschaft durch eine „neue“ Generation<br />
von Jugendlichen positiv beeinflussen. Dr. Jürgen Wilhelm sagte zu<br />
der neuen Kooperation:„Wir glauben, dass die Unterstützung<br />
innovativer HIV-Präventionsansätze für die Risikogruppe der<br />
Jugendlichen der Schlüssel zu wichtigen Veränderungen in der<br />
HIV-Prävention in Südafrika ist.“<br />
Maren Lieberum, Entwicklungshelferin des DED in Südafrika
� BLICKPUNKT Brief 3.2009<br />
BOLIVIEN<br />
Handbuch für „gute Praktiken“<br />
zum Qualitätstourismus<br />
k Seit 2005 unterstützt der DED im tropischen Tiefland Boliviens die touristischen<br />
Akteure in den Landkreisen von Reyes, Rurrenabaque und Santa Rosa beim Aufbau<br />
eines ökologisch und sozial verträglichen Qualitätstourismus. Die Verbesserung der<br />
touristischen Serviceleistungen wird durch ein speziell entwickeltes Zertifizierungsverfahren<br />
der Kommunalverwaltungen für private Unternehmen gefördert.<br />
Die Ergebnisse der fast vierjährigen Kooperation und deren „gute Praktiken“ sind in<br />
einem 2009 erschienenen Handbuch dargestellt, das die erste Publikation dieser Art<br />
in Bolivien ist. Autorin ist Karin Allgöwer. Das Manual de Prácticas Responsables de Turismo Sostenible<br />
steht unter www.bolivien.ded.de als Download zur Verfügung. Viel Spaß beim Lesen!<br />
Veranstaltungen<br />
Martin Jovanov, DED-Fachkoordinator in Bolivien von 2005 – 2009<br />
Engagement weltweit<br />
k Die Fachmesse ENGAGEMENT WELTWEIT, die am 28. No-<br />
vember 2009 in Bonn stattfinden wird, bietet Interessierten<br />
die ideale Gelegenheit, sich direkt und umfassend über die<br />
Möglichkeiten des beruflichen Engagements im Ausland, die<br />
verschiedenen Arbeitsfelder, Qualifizierungsangebote, Nachwuchsförderungsprogrammesowie<br />
Entwicklungen und Trends in<br />
der Entwicklungszusammenarbeit<br />
zu informieren.<br />
Mehr als 50 Akteure der personellen<br />
Entwicklungszusammenarbeit, der<br />
Not- und Katastrophenhilfe sowie<br />
der Bildungsarbeit werden mit <strong>Info</strong>rmationsständen<br />
auf der Fachmesse<br />
vertreten sein. Zum Programm gehören<br />
Impulsreferate, Fachvorträge und Diskussionsrunden.<br />
Filme gewähren Einblicke in die unterschiedliche Arbeit von<br />
staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen und in die<br />
praktische Arbeit von Fachkräften in den Projekten vor Ort.<br />
ENGAGEMENT WELTWEIT ist in Deutschland die einzige<br />
Fachmesse zum Thema Arbeiten in der Entwicklungszusammenarbeit.<br />
Sie richtet sich insbesondere an berufserfahrene<br />
Fach- und Führungskräfte sowie an Hochschulabsolventen<br />
und Berufseinsteiger.<br />
Veranstalter ist der Arbeitskreis „Lernen und Helfen in Übersee“<br />
e.V. Die Fachmesse findet statt in der Beethovenhalle –<br />
Forum Süd,Wachsbleiche 26 in 53111 Bonn.Weitere <strong>Info</strong>rmationen<br />
finden Sie unter www.engagement-weltweit.de.<br />
Karoline Wiemers-Meyer,<br />
Arbeitskreis „Lernen und Helfen in Übersee“ e.V.<br />
Fahnen gegen<br />
Gewalt an Frauen hissen<br />
k Im Rahmen des Internationalen Gedenktags<br />
gegen Gewalt an Frauen ruft die Organisation<br />
Terres des Femmes am 25. November<br />
2009 zu einer Fahnenaktion auf. Die<br />
Fahne „Frei leben – ohne Gewalt“ soll<br />
in diesem Jahr zum neunten Mal in<br />
vielen Städten wehen. Auch Sie können<br />
sich für ein freies und selbstbestimmtes<br />
Leben für Frauen und Mädchen einsetzen,<br />
indem sie diese Flagge hissen.<br />
Im letzten Jahr konnte die Aktion einen<br />
großen Erfolg verbuchen: Über 5.000<br />
Fahnen wehten in über 850 Städten<br />
als Zeichen gegen Gewalt an Frauen.<br />
Darüber hinaus wird die Fahnenaktion<br />
jährlich von einem vielseitigen<br />
Programm begleitet. So wird in<br />
Tübingen vom 19. bis 25. November<br />
2009 das Filmfest „FrauenWelten“<br />
organisiert. Im Mittelpunkt stehen<br />
Dokumentar- und Spielfilme aus<br />
über 20 Ländern zum Thema<br />
Menschenrechte von Frauen.<br />
Über weitere Veranstaltungen sowie über<br />
Materialien können Sie sich auf der Homepage<br />
www.frauenrechte.de informieren.<br />
Marie-Josephine Keller,<br />
Praktikantin im DED
� KULTUR<br />
Brief 3.2009<br />
»<br />
Kultur<br />
Christoph Schlingensief<br />
in Mosambik<br />
Literatur<br />
3 Auf der Suche nach einem geeigneten Ort für sein geplantes<br />
afrikanisches Festspielhaus war der bekannte Theaterregisseur<br />
auf Einladung von Henning Mankell auch in Mosambik.<br />
Mankell, der schwedische Erfolgsautor und Dramaturg,<br />
ist seit vielen Jahren dem Teatro Avenida in Maputo verbunden,<br />
mit dem auch das DED-Projekt ICMA (Deutsch-mosambikanisches<br />
Kulturinstitut) eng zusammenarbeitet. Die Entwicklungshelferin<br />
Birgit Plank-Mucavele, Kulturmanagerin<br />
des ICMA, hatte das Programm für Schlingensief vorbereitet.<br />
Neben offiziellen Terminen und dem Besuch potenzieller<br />
Standorte war ein Abend auch dem Teatro Avenida gewidmet,<br />
bei dem die Strindberg-Adaptation „Menina Júlia“ und<br />
Auszüge aus dem Stück „Mulher Asfalto“ vorgeführt wurden.<br />
Schlingensief zeigte sich beeindruckt von Mosambik und<br />
seiner quirligen Kunstszene, wird aber das Festspielhaus<br />
vermutlich doch eher in Ouagadougou, im westafrikanischen<br />
Burkina Faso, einrichten.<br />
Eckehard Fricke, DED-Landesdirektor in Mosambik<br />
Go International!<br />
3 Die Neuauflage dieses Buches füllt eine gravierende Lücke: Seit lan-<br />
gem gab es keine aktuelle Einführung für angehende Katastrophenoder<br />
Entwicklungshelfer für den Gesundheitsbereich, die sich auf eine<br />
Arbeit in Entwicklungsländern vorbereiten wollten. Nun ist dieses<br />
Manko behoben – und mit Bravour!<br />
Der Bogen des Buches ist weit gespannt: von einer allgemeinen Einführung<br />
in die Entwicklungszusammenarbeit ebenso wie in die humanitäre<br />
Hilfe – und die „Grauzone“ dazwischen –, reicht es über den<br />
Projektkreislauf und dessen wichtigste Aspekte bis zu Basiswissen<br />
Gesundheitsversorgung . Es enthält konzeptionelle Kapitel zu Primary<br />
Health Care (Basisgesundheitsversorgung) und zu den Millennium<br />
Development Goals (MDG) und stellt die wichtigsten Interventionsfelder<br />
vor – und das unter transkulturellen Aspekten. Schilderungen<br />
konkreter Projekterfahrungen machen die Theorie dann sehr anschaulich.<br />
Ein ausführlicher <strong>Info</strong>teil rundet das Ganze ab.<br />
Wie immer können Sie Bücher gewinnen<br />
Alle vorgestellten Bücher werden wieder verlost. Dazu senden Sie eine<br />
Postkarte mit dem jeweiligen Stichwort bis zum 15. November 2009<br />
an die DED-Brief Redaktion,Tulpenfeld 7, 53113 Bonn.<br />
Alle Einsendungen nehmen teil, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.<br />
Das Stichwort finden Sie im Anschluss an jede Rezension.<br />
Wüstenblume<br />
3 Unter der Regie von<br />
Sherry Hormann und mit<br />
hervorragender Besetzung<br />
(unter anderen Liya<br />
Kebede, Sally Hawkins,<br />
Benjamin Herrmann und<br />
Danny Krausz) wurde das<br />
Buch „Wüstenblume“<br />
von Waris Dirie verfilmt.<br />
Der Film schildert den<br />
Weg eines afrikanischen<br />
Nomadenmädchens zum<br />
internationalen Topmodel.Waris Dirie hat ihre Bekanntheit genutzt,<br />
um gegen die weibliche Genitalverstümmelung, deren<br />
Opfer sie selbst ist, zu kämpfen. Der Film ist ab 24. September<br />
im Kino und wird sicher an vielen Orten auch Anlass sein, auf die<br />
Arbeit von Organisationen, die gegen die Genitalverstümmelung<br />
kämpfen, aufmerksam zu machen (www.wuestenblume-film.de,<br />
www.netzwerk-integra.de).<br />
Red.<br />
Die umfangreiche Erfahrung ebenso wie das<br />
Engagement der Verfasser sind auf jeder Seite<br />
präsent. Das Buch ist ein must für jeden, der<br />
sich auf eine Arbeit im Gesundheitsbereich in<br />
den Entwicklungsländern vorbereitet;„vor Ort“<br />
ist es mit Sicherheit ein hilfreicher Begleiter.<br />
Winfried Zacher,<br />
Arzt und bis Mai 2009 Leiter der Fachgruppe Gesundheit im DED<br />
Elgin Hackenbruch (Hg.): Go international – Handbuch zur Vorbereitung von<br />
Gesundheitsberufen auf die Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre<br />
Hilfe, 2. Auflage, Verlag Hans Huber, Bern 2009, 508 Seiten, 49,95 Euro<br />
»<br />
Die Gewinner<br />
der Literaturverlosung aus DED-Brief 2/2009:<br />
44<br />
Stichwort: Gesundheit<br />
Jürgen Deubert, Berlin; Christine Gucker-Hellemann,Weilburg;<br />
Marlies Jansen, Berlin; Karl-Heinz Kirchner, Nürnberg;<br />
Nils Nobiling, Herdecke; Jos Schnurer, Hildesheim;<br />
Karin Schüler, Bonn; Georg Sutter, Kißlegg; I.Wendl, Annweiler.<br />
45
� KULTUR<br />
Brief 3.2009<br />
Energie für das Land<br />
3 Eine Broschüre, die gemeinsam von der Ar-<br />
beitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH)<br />
e.V. und der Katholische Landvolkbewegung<br />
Deutschland (KLB) herausgegeben wurde, befasst<br />
sich mit der Analyse der Energiesituation<br />
in den Ländern des Nordens und des Südens.<br />
An Beispielen aus der Praxis wird nachgewiesen,<br />
dass eine nachhaltige ländliche Energiepolitik<br />
eine wesentliche Voraussetzung für die zukunftsfähige<br />
Entwicklung ist. Die Autoren sind ehemalige<br />
AGEH-Fachkräfte. So führt etwa Regina Frey,<br />
die fünf Jahre in Südamerika gearbeitet hat, in ihrem<br />
Artikel aus, welches Potenzial<br />
in Bezug auf Energieeffizienz<br />
in der deutschen<br />
Landwirtschaft steckt. Ihre<br />
2.000 Legehennen hält sie<br />
in einem mobilen Stall mit<br />
eigener, regenerativer<br />
Stromversorgung. Der benötigt<br />
lediglich ein Prozent<br />
der fossilen Energie eines konventionellen<br />
Vergleichsstalls. Roger Loozen und<br />
Philippe Teller leiten an einem Beispiel für Dieselmotoren,<br />
die mit Palmöl betrieben werden, her,<br />
dass Agrotreibstoffe zum Nutzen von Kleinbauern<br />
eingesetzt werden können.<br />
Die Broschüre kann bestellt werden bei der Arbeitsgemeinschaft<br />
für Entwicklungshilfe (AGEH) e.V.,<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ripuarenstraße<br />
8, 50679 Köln oder über www.ageh.org.<br />
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe,<br />
AGEH e.V., Katholische Landvolkbewegung<br />
Deutschland (Hrsg.): Energie für das Land –<br />
Energie vom Land – Chancen und Risiken für den<br />
ländlichen Raum in Nord und Süd, Köln 2009,<br />
44 Seiten, geheftet, 10,00 Euro<br />
Stichwort: Energie<br />
Kleidung im Wandel der Zeit<br />
3 Mit diesem Band hat Melissa Leventon einen<br />
fundierten Überblick über die internationale Geschichte<br />
des Kostüms geschaffen. Die zentrale<br />
Aussage ist dabei, dass Kleider den Körper nicht<br />
nur bedecken, sondern ihn auch schmücken sollen.<br />
Durch ihr Material und ihre Beschaffenheit<br />
haben sie auch immer die Stellung und den<br />
Reichtum ihrer Träger unterstrichen. Die Darstellung<br />
beschränkt sich dabei nicht nur auf die<br />
Religion und globale Entwicklung<br />
3 Religionen sind entscheidende Gestaltungskräfte für gesellschaftliche<br />
Entwicklung. Sie bringen menschliche Entwicklung voran, können<br />
sie aber auch behindern. In einer globalisierten Welt überschreiten<br />
diese Einflüsse Grenzen.<br />
Die europäische Entwicklungspolitik basiert auf unserer säkularen<br />
Staatsordnung. Durch die Fokussierung auf staatliche Systeme ist sie geneigt, Religion als<br />
reines Glaubenssystem zu verstehen. Doch Religionen sind der Ursprung von Weltbildern und<br />
Gesellschaftsordnungen. Sie haben einen entscheidenden Einfluss auf die politische, wirtschaftliche<br />
und soziokulturelle Entwicklung von Gesellschaften; darüber hinaus wirken sie<br />
auf die Verhaltensmentalitäten der Bürger. In diesem Band untersuchen international tätige<br />
Fachleute aus Wissenschaft, Politik und entwicklungspolitischer Praxis den umfangreichen<br />
Themenkomplex aus verschiedenen Perspektiven, um einen Beitrag zur Analyse der vielfältigen<br />
Wechselwirkungen zwischen Religion und Entwicklung im Zeitalter der Globalisierung zu<br />
leisten.<br />
Jürgen Wilhelm, Hartmut Ihne (Hrsg.): Religion und globale Entwicklung,<br />
Berlin University Press 2009, 362 Seiten, 39,39 Euro<br />
Im Blick der Anderen<br />
Stichwort: Religion<br />
3 Wer sich für gesellschaftliche Entwicklungen in Mali interessiert,<br />
sich möglicherweise auf eine Reise oder einen längeren Aufenthalt im<br />
Lande vorbereitet, findet in diesem Band eine Reihe spannender Einblicke.<br />
Studierende der Universität Frankfurt berichten in sechs lesenswerten<br />
Kapiteln über Forschungsprojekte, die sie zusammen mit<br />
malischen Studenten im Land durchgeführt haben. Die Themen<br />
reichen vom Einfluss einer Telenovela auf das Leben malischer Familien, der Bedeutung von<br />
HIV/AIDS in der Gesellschaft Malis, über die Analyse eines Mangoentwicklungsprojektes<br />
bis hin zur Bedeutung des Hip Hop unter malischen Jugendlichen.Wer immer schon einmal<br />
wissen wollte, was Ethnologen eigentlich machen, der findet hier einige Antworten.<br />
Claire Grauer, DED-Entwicklungsstipendiatin von 2006 bis 2007 in Tansania<br />
Ute Röschenthaler, Mamadou Diawara (Hrsg.): Im Blick der Anderen. Auf ethnologischer Feldforschung<br />
in Mali. Verlag: Brandes & Apsel, Frankfurt am Main 2008, 168 Seiten, 14,90 Euro<br />
Stichwort: Ethnologie<br />
westliche Mode, sondern bezieht<br />
Seitenblicke auf die Kleidung<br />
in anderen Kulturen und<br />
Traditionen mit ein. Das Buch<br />
bietet nicht nur eine vergnügliche<br />
Reise durch die Welt der<br />
Mode, sondern lässt zugleich<br />
auch die Stilunterschiede einzelner Kleidungsstücke<br />
in den verschiedenen Epochen erkennen.<br />
Sabine Ludwig,<br />
DED-Entwicklungshelferin in Benin<br />
von 1999 bis 2001<br />
Melissa Leventon (Hrsg.):<br />
Kostüme weltweit, Haupt Verlag,<br />
Bern-Stuttgart-Wien 2009,<br />
352 Seiten, 39,90 Euro<br />
Stichwort: Kleidung
� OFFENE STELLEN Brief 3.2009 46 47<br />
für den Jemen<br />
k Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und<br />
eine Basissanitärversorgung sind fundamental<br />
für die Menschen in Entwicklungsländern. Der<br />
DED unterstützt im Jemen Betriebe der Wasserver-<br />
und Abwasserentsorgung. Dazu sucht der<br />
DED dringend technische Berater oder Beraterinnen,<br />
die die Betriebe beim Aufbau einer mobilen<br />
Serviceeinheit für technische Qualitätsverbesserung,<br />
bei der Ermittlung des Fortbildungsbedarfs<br />
und bei der Organisation und Verbesserung<br />
von Betriebsabläufen unterstützen.<br />
Es handelt sich um drei Arbeitsplätze mit unterschiedlichen<br />
Aufgaben. So geht es um die Beratung<br />
bei Betrieb und Wartung von abwassertechnischen<br />
Anlagen (Projektplatz-PP 9709), um<br />
die Wartung der Leitungssysteme sowie Unterstützung<br />
bei der Sicherung der Trinkwasserqualität<br />
(PP 9710) und um Beratung bei Betrieb<br />
und Wartung der elektrotechnischen Anlagen<br />
(PP 9711). Voraussetzungen für die Mitarbeit sind<br />
langjährige Berufserfahrung und spezifische<br />
Fachkenntnisse im jeweiligen oben genannten<br />
Arbeitsbereich sowie ausgeprägte Fähigkeiten<br />
im Umgang mit Mitarbeitern und Auszubilden-<br />
Hebamme in Kambodscha<br />
© Karsten Tolle<br />
Beratung<br />
beim<br />
Betrieb<br />
der neuen<br />
Anlage<br />
im Jemen.<br />
den, gute Englischkenntnisse und interkulturelle<br />
Sensibilität. Die drei Projektplätze sind in der Hauptstadt<br />
Sanaa angesiedelt, es werden aber häufige<br />
Dienstreisen auch an entlegene Standorte erforderlich<br />
sein.<br />
Weitere Details zu diesen Stellen und weitere<br />
Stellenangebote finden Sie unter www.ded.de/<br />
stellenmarkt. Dort können Sie sich mit Angabe der<br />
Projektplatz-Nummer (PP) direkt bewerben.<br />
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Alexander-Monteiro,<br />
Tel. 02 28 /24 34-265 gerne zur Verfügung.<br />
Birgit.Alexander-Monteiro@ded.de<br />
k In Kambodscha trägt der DED zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung mit speziellem Fokus<br />
auf Mutter-Kind-Gesundheit in ausgewählten Einrichtungen der Provinzhauptstadt Kampot bei. Partner-<br />
organisation ist das Provincial Health Department Kampot. Gesucht wird eine Hebamme, die die Weiter-<br />
bildung von Pflegepersonal sowie Hebammen an Gesundheitszentren und dem Provinzkrankenhaus<br />
unterstützt (PP 9863). Im Vordergrund steht dabei die ante- und postnatale Pflege. Die Position ist<br />
eng mit dem Management des Provincial Health Department und dem GTZ-Programm zur Qualitätsverbesserung<br />
der Mutter-Kind-Gesundheit verknüpft. Im gleichen Bereich arbeitet bereits eine weitere<br />
DED-Fachkraft. Voraussetzungen für die Tätigkeit sind praktische Erfahrung in Geburtshilfe, Leitungserfahrung<br />
im Gesundheitsbereich und interkulturelle Kompetenz.<br />
Weitere Details zu dieser Stelle<br />
und weitere Stellenangebote<br />
finden Sie unter www.ded.de/<br />
stellenmarkt. Dort können Sie<br />
sich mit Angabe der Projektplatz-<br />
Nummer (PP) direkt bewerben.<br />
Bei Rückfragen steht Ihnen<br />
Frau Schmitz-Eckert (Mo, Di, Do, Fr),<br />
Tel. 02 28 /24 34-256 gerne zur Verfügung.<br />
Ilse.Schmitz-Eckert@ded.de<br />
© Olga Platzer Technische Berater<br />
Malerische Ansichten<br />
in Sambor, Kambodscha.<br />
Nächste Themen<br />
4/2009<br />
Weltwärts mit dem DED<br />
1/2010<br />
Mobilität<br />
www.ded.de<br />
Impressum<br />
Herausgeber<br />
Deutscher Entwicklungsdienst,<br />
gemeinnützige Gesellschaft mbH,<br />
Tulpenfeld 7, 53113 Bonn<br />
Geschäftsführung<br />
Dr. Jürgen Wilhelm<br />
Redaktion<br />
Angela Krug (V.i.S.d.P.),<br />
Maria Ehrke-Hurtado<br />
Namentlich gekennzeichnete<br />
Beiträge geben die persönliche<br />
Meinung der Verfasser wieder.<br />
Redaktionsbeirat<br />
Jutta Heckel, Karl Moosmann,<br />
Matthias Ohletz, Dr. Annette Roth,<br />
Angela Semmelroth,<br />
Till Winkelmann<br />
Gestaltung<br />
kippconcept gmbh, Bonn<br />
Titelfoto<br />
Britta Radike<br />
Druck<br />
SZ Offsetdruck-Verlag GmbH<br />
Gedruckt auf FSC-zertifiziertem<br />
Papier<br />
Redaktionsadresse<br />
Deutscher Entwicklungsdienst,<br />
DED-Brief,Tulpenfeld 7, 53113 Bonn<br />
Telefon 02 28 /24 34-132<br />
Telefax 02 28 /24 34-139<br />
redaktion@ded.de<br />
Nachdruck frei bei vollständiger<br />
Quellenangabe. Belegexemplare<br />
erbeten an die DED-Brief-Redaktion.
»<br />
Sie suchen<br />
eine Herausforderung<br />
im Ausland?<br />
Im Auftrag des:<br />
www.ded.de/stellenmarkt